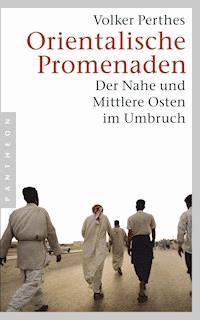Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
Ägypten – Pharao und seine Gegner
Kairo: die Stadt, der Müll und das Leben
Oberägyptische Begegnungen
Alexandria: kulturelle Renaissance und konservative Weltbilder
Buchmessendiskurse: Islam und Gewalt
Führerkult und Neues Denken, oder: Wie reformiere ich eine Staatspartei?
Pharaos Kontrahenten: zwischen Regimepartei und alter Ideologie
Islamistische Alternativen?
Israel und Palästina – Schwierige Scheidung
Momentaufnahmen oder: Der Eindruck kann trügen
Konfliktstationen
Israel hat sich verändert
Identität und Ideologie: Israels neue Stammesstruktur
Jugendbegegnungen (1): Normal werden!
Staatszerfall ohne Staat: Palästina nach der Intifada
Autoritätsverluste in Gaza
Eigenverantwortlichkeiten: Was lief schief?
Zaunperspektiven (1): »Nicht in Partnerschaft«
Zaunperspektiven (2) – Qalqiliya von innen
Jerusalem ist verloren
Jugendbegegnungen (2): Kultur gegen Ghetto
Zaunperspektiven (3): Nicht zwei Melonen in einer Hand
Berater (1): »Draw your own borders«
Berater (2): »Wir wollen einen hohen Zaun«
Berater (3): Fünfzig Jahre Waffenstillstand?
Islamistische Alternativen? Hamas im Wartestand
Ausreisen
Saudi-Arabien – Ein Land diskutiert mit sich selbst
Das erste kurze Jahrhundert
Veränderung unter Druck
Riad und die saudische Langeweile
Was man(n) trägt
Religion und Tradition oder: »Der wahre Islam verlangt aber nicht
Beweis und Irrtum
»Religion ist Leben«
Geschlechtertrennung
Frauenfragen
Technische Probleme
Saudische Perspektiven: ein Land debattiert mit sich selbst
Reformperspektiven oder: Was sind die Prioritäten?
Von unaufhaltsamer Veränderung
Alte Garde versus Wahhabismus der Mitte?
Der Scheich möchte gerne zitiert werden
Herrenabend
»Eine Nation der Menschenrechte«
Im Herzen des Wahhabismus
Abschied
Durchs milde Kurdistan
Anreise
Ein virtuelles Land
Kurdistan im Irak
Wege und Städte
Böse Erinnerungen
Lebenswege
Innenminister und Gouverneur
Kein Hass
Dies ist nicht der Irak
Föderalismus oder Unabhängigkeit?
Die kurdische Schweiz ist nicht die Schweiz
Einen besseren Staat bauen …
Mit Sicherheit kurdisch
Demokratie im Irak – aber mit wem?
Die Stadt des Anstoßes: Kirkuk und die schwierige Suche nach Verständigung
Abu Ibrahims Netzwerk
Widerstehen oder sich arrangieren?
Aus der Geschichte lernen?
Irakisch-iranische Übergänge
Iran – Mehr Kultur als Revolution
Rückblicke: Revolution und Moderation
»War is real for us!« Revolution, Krieg und Erinnerung
Pragmatismus und Konflikte der Nachkriegszeit
Reformeuphorien und Realismus
Verhältnisse voller Misstrauen: Iran, die USA und der Rest der Welt
»Den Iranern geht es gut: Sie haben so viele Parks«
Teheraner Nord-Süd-Gefälle: einmal die Vali Asr ablaufen
Geistliche Führer: die Islamische Republik, die Religion und die Religiösen
Was ist iranisch? Jugend, Kultur und Identität nach der konservativen Wende
Anhang
Literaturempfehlungen
Abkürzungsverzeichnis
Copyright
Vorwort
BÜCHER, DIE DIE ENTWICKLUNGEN im Nahen und Mittleren Osten beschreiben, bewegen sich innerhalb des Spannungsverhältnisses zwischen den langen Linien der Geschichte und den tagespolitischen Ereignissen, die so oft die internationalen Fernsehnachrichten dominieren. Wenn es solchen Büchern gelingt, politische, gesellschaftliche und kulturelle Konstanten so herauszuarbeiten, dass der Leser die Nachrichtenbrocken, die ihn über neue diplomatische Vorstöße, gescheiterte Vermittlungsbemühungen, militärische Drohgebärden oder Auseinandersetzungen, Terroranschläge und politisches Säbelrasseln und gelegentlich auch über Investorenkonferenzen, Kulturaustausch und politische Dialoge informieren, sinnvoll in ein Gesamtbild einordnen kann, erleben sie vielleicht eine zweite Auflage oder erscheinen nach einiger Zeit als Taschenbuch. Gleichwohl bleiben sie immer zu einem gewissen Grade eine Momentaufnahme. So heißt es in dem Israel- und Palästina-Kapitel dieses Buches, dass ich nicht wisse, ob wieder Krieg herrschen werde, wenn das Buch erscheine. Das Manuskript hatte ich im Spätsommer 2005 abgeschlossen, die Originalausgabe erschien im Frühjahr 2006.
Der Krieg, den ich befürchtet hatte, begann wenige Monate später, im Juli: Eine höchst ungleiche, dreiseitige Auseinandersetzung, bei der die Hizbullah, eine libanesische Partei, die gleichzeitig auch eine Guerillabewegung ist, Krieg gegen Israel und Israel Krieg gegen den Libanon führte, während der libanesische Staat, der diesen Krieg nicht wollte und nicht verhindern konnte, sich Hilfe suchend an die internationale Gemeinschaft wandte, um dem Blutverlust und den Zerstörungen ein Ende zu bereiten. Die Staatengemeinschaft ließ sich Zeit, bis sie reagierte. Vor allem die USA wollten Israel erst einmal siegen lassen, was so allerdings nicht gelang: Israels Regierung brachte zwar dem Libanon eine schwere – manche würden sagen: existentielle – Niederlage bei. Libanons Wiederaufbau wurde sicher um ein Jahrzehnt zurückgeworfen. Israel sah aber in den Augen der eigenen Öffentlichkeit nicht wie ein Sieger aus, die politischen und militärischen Führungen Israels mussten sich von einer Untersuchungskommission schwerwiegende Inkompetenzen vorhalten lassen; das Ansehen der Hizbullah in vielen arabischen Ländern nahm zu; und die regionalen Spannungen blieben so heftig, dass – während dieses Vorwort geschrieben wird – eine neue militärische Konfrontation wahrscheinlich bleibt. Neue Gewaltausbrüche in den palästinensischen Gebieten wie auch im Nord-Libanon, wo die libanesische Armee bewaffneten islamistischen Akteuren gegenüberstand, zeigten, dass ein solcher Konflikt an nahezu jeder Front aufbrechen kann: zwischen Israel und den Palästinensern, zwischen verschiedenen palästinensischen Fraktionen, an der israelisch-libanesischen oder israelisch-syrischen Grenze oder innerhalb des Libanon.
Die internationale Gemeinschaft hat zwar ihr Engagement im Nahen Osten verstärkt – diplomatisch durch die Wiederbelebung des so genannten Nahost-Quartetts (USA, Europäische Union, Vereinte Nationen und Russland), das sich vor allem um eine Regelung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern kümmern soll, und auch militärisch durch eine Aufstockung der UNO-Friedenstruppe im Libanon (UNIFIL). Damit wurde jedoch bis zum Zeitpunkt, da dieses Vorwort entsteht, noch kein neuer diplomatischer Prozess auf den Weg gebracht, der Israel, den Palästinensern, dem Libanon und Syrien die Perspektive eines haltbaren Friedens näher bringen würde. Das ist nicht zuletzt für Deutschland von Bedeutung, dessen Regierung sich unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 aktiv um die Wiederbelebung eines nahöstlichen Friedensprozesses bemüht hat, das vor allem aber mit der Verstärkung der UNIFIL-Mission erstmals auch mit eigenen Soldaten im Nahen Osten engagiert ist. Neue kriegerische Auseinandersetzungen etwa zwischen Israel und dem Libanon oder Israel und Syrien würden nicht nur die Aufgabe dieser Mission in Frage stellen, sondern könnten die Marineeinheiten, die vor der Küste des Libanon patrouillieren, auch zum Ziel der einen oder anderen Konfliktpartei machen.
Die Unruhe, von der das Buch sowohl in seinen Promenaden durch einzelne Länder und Gebiete wie auch mit Blick auf die Gesamtregion berichtet, ist jedenfalls in den zwei Jahren seit seinem ersten Erscheinen erhalten geblieben. Einige Entwicklungen haben eine andere Richtung genommen als damals erwartet wurde, andere haben Erwartungen bestätigt. Sicher ist, dass weiterhin zwei zentrale Konfliktkonstellationen auf die politischen Entwicklungen, wirtschaftlichen Chancen und gesellschaftlich-kulturellen Debatten und Auseinandersetzungen in der gesamten Region ausstrahlen: Zum einen der bereits erwähnte Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, der nur durch ein definitives Ende der israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete und durch eine Anerkennung Israels durch seine arabische Umwelt zu Ende gehen kann, zum anderen die gewaltsamen Auseinandersetzungen im Irak, bei denen es sich seit langem nicht mehr nur um einen Aufstand gegen die amerikanische Besatzungsmacht handelt, sondern auch um einen Bürgerkrieg im Schatten der Besatzung des Landes und, teilweise zumindest, eine Stellvertreterauseinandersetzung zwischen einer Reiher regionaler Akteure.
Dabei ist Irakisch-Kurdistan, in das uns einer der langen Wege führt, die dieses Buch beschreibt, weiterhin so etwas wie eine Insel der Stabilität in dem zerrütteten und umkämpften Land. Je stärker allerdings der Rest des Irak in blutigem Chaos zu versinken droht, desto stärker auch die Tendenzen der irakischen Kurden, sich im Wortsinne abzugrenzen und ihre faktische Autonomie unwiderruflich zu machen. Eine einheitliche kurdische Regionalregierung ist mittlerweile gebildet worden, und Masoud Barzani, den wir auf seiner Bergfeste in Salahadin besuchen, ist zum Präsidenten Irakisch-Kurdistans gewählt worden. Eher zugespitzt allerdings haben sich die Konflikte um Kirkuk, die uns bei den Gesprächen in dieser tristen Stadt so deutlich vorgetragen werden: Hier entsteht eine Frontlinie zwischen irakischen Kurden und Arabern, die quer zu den Fronten in anderen Teilen des Irak zu verlaufen scheint. Auch hier allerdings gilt, dass die amerikanischen Streitkräfte den politischen, tribalen, konfessionellen oder ethnischen Auseinandersetzungen, die im Irak unter ihrer Hand freigesetzt wurden, trotz ihrer militärischen Überlegenheit machtlos gegenüber stehen.
Das Scheitern der USA im Irak, das sich seit Ende 2006 auch zunehmend in den Debatten des US-Kongresses in Washington darüber widerspiegelt, wie und zu welchem Zeitpunkt die amerikanischen Truppen das Land an Euphrat und Tigris verlassen sollen und können, hat die Machtgewichte zwischen den unterschiedlichen Akteuren im Nahen und Mittleren Osten weiter verschoben. Gestärkt worden sind vor allem die mehr oder weniger autoritären Regimeeliten, fast gleichgültig, ob sie sich als Freunde oder eher als Gegner der USA darstellen. Schauen wir nach Ägypten, der ersten Station unserer Promenaden: Hier war man in den ersten ein, zwei Jahren nach dem Sturz des irakischen Diktators Saddam Hussein tatsächlich besorgt, dass Washington quer durch die arabisch-nahöstliche Region auf politische Reformen in Richtung demokratischer Teilhabe dringen würde.
Kritische Bemerkungen des amerikanischen Präsidenten und seiner Außenministerin, die den ägyptischen Präsidenten drängten, in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle in der arabischen Welt zu spielen, mischten sich mit selbstbewussteren Stimmen aus der ägyptischen Gesellschaft und aus Oppositionskreisen. Husni Mubarak, ägyptischer Präsident seit 1981, ging selbst in die politische Offensive und ließ bei der letzten Abstimmung über das höchste und mächtigste Amt im Staat sogar Konkurrenten zu. Niemand erwartete, dass ein Oppositionskandidat gegen den amtierenden Präsidenten und die Machtmaschine der Regimepartei eine echte Chance haben würde. Wichtig war vielmehr, dass das Prinzip einer demokratischen Auseinandersetzung um das Präsidentenamt überhaupt verankert wurde. Dies blieb dann allerdings auf weiteres auch alles, was Mubarak an politischer Öffnung zuzugestehen bereit war.
Der stärkste Gegenkandidat Mubaraks, Ayman Nur, wurde wenige Wochen nach den Präsidentschaftswahlen unter fadenscheinigen Begründungen zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, eine Art Racheakt des Staates dafür, dass Nur mit seiner Kandidatur nicht nur eine demokratische Fassade für die Wiederwahl des Präsidenten lieferte, sondern eine alternative politische Plattform aufbauen wollte. Immerhin erreichte er 7,6 Prozent der Stimmen und damit eindeutig zu viel für den Geschmack der ägyptischen Führung. Mubaraks Regime zeigte seine autoritären Seiten in der Folge wieder sehr viel deutlicher. Zwar arbeiteten eine Reihe liberaler Minister und hoher Beamter weiter an wirtschaftlicher Reform und technologischer Modernisierung des Landes. Alle innenpolitischen Maßnahmen scheinen aber in erster Linie darauf gerichtet zu sein sicherzustellen, dass Gamal Mubarak, der Sohn des alternden Präsidenten, irgendwann dessen Nachfolge antritt und dass politische Konkurrenz, die wirklich gefährlich werden könnte, notfalls mit repressiven Mitteln in Schach gehalten wird.
So wurde auch Issam al-Erian, der Vertreter der Muslimbruderschaft, dem wir in Kairo im Gebäude des Ärztesyndikats begegnen, ein weiteres Mal ins Gefängnis geworfen, als die Polizei wieder einmal die üblichen Verdächtigen einsammelte, um den Muslimbrüdern und ihren Anhängern zu zeigen, dass man ihnen nicht erlauben werde, sich auf legale Weile zu einer echten Alternative zur herrschenden Partei zu entwickeln. Proteste der amerikanischen Regierung oder, wie hinzuzufügen wäre, der Europäischen Union gibt es kaum noch: Man braucht heute Ägypten wieder als stabilen Partner im Nahen Osten, will nach den Erfahrungen der palästinensischen Wahlen von Anfang 2006, bei denen die islamistische Hamas eine Mehrheit der Sitze eroberte, solche Entwicklungen nicht unbedingt in Ägypten oder anderen Staaten der Region wiederholt sehen und hält sich deshalb mit Demokratisierungsforderungen zurück.
Das Scheitern amerikanischer Politik im Irak hat auch den politischen Handlungskontext der Führung in Saudi-Arabien verändert. Instabilität und Chaos im Nachbarland, in den palästinensischen Gebieten, im Libanon und anderswo in der Region sind aus saudischer Sicht beunruhigend. Den Amerikanern traut man nicht mehr zu, Ordnung in die regionalen Verhältnisse zu bringen; gleichzeitig ist die Sorge, dass Washington Druck auf Riad machen könne, die eigenen innenpolitischen Verhältnisse westlichen Vorstellungen anzupassen, gegenüber den ersten ein, zwei Jahren nach dem Sturz des Regimes in Bagdad erheblich zurückgegangen. Die politische Elite um König Abdallah ist selbstbewusster geworden: Mit den Kommunalwahlen, die wie geplant stattgefunden haben, hat man ein Minimum politischer Beteiligung erlaubt; auch die Nationalen Dialoge sind fortgeführt worden. Mehr hält man bis auf weiteres offenbar nicht für notwendig. Lieber versucht man das eigene Modell, das auf Anhörung, Beratung und einem nach Möglichkeit breiten Konsens beruht, bei dem alle relevanten Kräfte einen Platz am Tisch und ein Stück vom Kuchen erhalten, auch in andere Länder der Region zu exportieren. Aus diesem Grunde haben saudische Vermittler sich erfolgreich bemüht, die zerstrittenen palästinensischen Fraktionen – die Fatah von PLO-Chef Mahmud Abbas und die islamistische Hamas – auf die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit zu verpflichten. Das ist nicht, was die USA wollten. Diese setzten auf den Sieg der säkularen Fatah, deren Truppen sie aufzurüsten bereit waren.
Eine Integration der Islamisten in eine gemeinsame Regierung entsprach den Vorstellungen Washingtons nicht. Saudische Führungsfiguren sind aber heute sicher, dass sie mit ihrer Orientierung auf Konsens das für die Region richtigere Konzept haben. In ähnlichem Sinne haben sie sich deshalb bemüht, auch die zerstrittenen Parteien des Libanon an einen Tisch zu bringen, reden dazu selbst mit der von Iran unterstützten Hizbullah und setzen auch gegenüber Teheran eher auf den Konsens der großen regionalen Mächte am Golf als auf Konfrontation: Man mag in Riad zwar das schiitische Regime in Teheran nicht, ist sich aber sicher, dass man Iran in aller Zukunft als großen Nachbarn ertragen und akzeptieren muss. Wie lange die Amerikaner dagegen vor Ort bleiben werden, weiß niemand genau.
Amerikanische Demokratievorstellungen haben für das monarchische System in Saudi-Arabien ohnehin nie große Attraktivität besessen. Das Land befindet sich, wie wir bei unseren Besuchen in der Hauptstadt Riad und in den Orten der Ostprovinz erleben, weiterhin in einer intensiven Diskussion mit sich selbst. Man debattiert Formen der Beteiligung, das Verhältnis der Geschlechter, Inhalt und Platz der Religion. Dass Veränderungen notwendig sind, bestreitet kaum jemand. Aber es fällt dem Königshaus heute sehr viel leichter, Kritikern, die etwa eine volle Demokratisierung westlichen Musters einfordern würden, auf das Beispiel des benachbarten Irak zu verweisen, wohin Amerika schließlich seine Demokratie exportiert habe.
Auch in Iran war das Selbstbewusstsein der Führung gewachsen – hatte man doch nicht nur die Schwierigkeiten, die die USA im Irak erleben würden, vorausgesehen und gleichzeitig von den neuen Verhältnissen im Irak profitiert: Der große Nachbar stellte nun keine direkte Bedrohung mehr dar und wurde zudem von politischen Kräften regiert oder mitregiert, die Jahre ihres Lebens im iranischen Exil verbracht hatten und auf gute Beziehungen zur Islamischen Republik bedacht waren. Iran war zweifellos eine regionale Macht, deren Interessen nicht mehr ignoriert werden konnten. Die Beziehungen zur internationalen Gemeinschaft allerdings wurden in den zwei Jahren, die dem Erscheinen der Erstausgabe dieses Buches folgten, auf eine harte Probe gestellt. Präsident Ahmadinejad provozierte durch inakzeptable, aggressive Äußerungen mit Blick auf Israel; die Regierung trieb das Atomprogramm ungeachtet einer Reihe von Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates und internationalen Sanktionen voran.
Zum Redaktionsschluss der Taschenbuchausgabe befanden sich Iran und die westlichen Staaten, die aktiv nach einer Lösung im Atomstreit suchten – Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit Unterstützung des EU-Außenbeauftragten Solana und mittlerweile auch der USA, Russlands und Chinas – in einer Sackgasse: »Iran baut mehr und mehr Zentrifugen, der Sicherheitsrat beschließt mehr und mehr Resolutionen«, so fasste es ein ehemaliger Staatssekretär des iranischen Außenministeriums im Gespräch zusammen. Tatsächlich verfehlten die Sanktionen, die der Sicherheitsrat Ende 2006 gegen Iran verhängte, ihr unmittelbares Ziel, die iranische Regierung zum Einfrieren ihres Urananreicherungsprogramms zu bewegen. Sie hatten aber in anderer Hinsicht durchaus Wirkung: Die innere Kritik an Ahmadinejad, der offensichtlich mit seiner Politik das Land international isolierte, nahm deutlich zu, und die durch seinen Wahlsieg im Jahre 2005 deutlich gebeutelten Reformkräfte erhielten neuen Auftrieb. Diese innere Gärung schlug sich auch im Ergebnis der Kommunalwahlen und der Wahlen zum so genannten Expertenrat nieder, bei denen Ahmadinejad und seine Anhänger klare Niederlagen erlitten. Sicher war, dass europäische und iranische Reformkräfte sich weiter um eine verhandelte Lösung im Atomstreit bemühen würden; ein militärisches Vorgehen, das in den USA durchaus diskutiert wurde, wäre zumindest aus europäischer Sicht eben keine »Lösung«.
Ohne Fortschritte blieb die Situation im israelisch-palästinensischen Konfliktfeld: In den palästinensischen Gebieten gab es Anfang 2006, ein gutes halbes Jahr nach meinem im zweiten Kapitel beschriebenen letzten Besuch im Gazastreifen, in der Westbank und in Israel, tatsächlich demokratische und auch durch internationale Wahlbeobachter als fair und frei charakterisierte Wahlen. Kurze Zeit später, im März 2006, wurde in Israel ein neues Parlament und eine neue Regierung gewählt. An die Stelle Ariel Sharons, der seit Januar 2006 nach einem Schlaganfall im Koma liegt, trat dessen langjähriger Ideengeber Ehud Olmert, ein vorwärts denkender Politiker, der aufgrund seines Wahlversprechens gewählt wurde, innerhalb einer Legislaturperiode Israels Grenzen durch Friedensschluss mit seinen Nachbarn endgültig festzulegen. Olmert erwies sich aber auch als ausgesprochen ungeschickter politischer Führer, dem es gelang, seine eigenen Popularitätsraten innerhalb eines Jahres von mehrheitlicher Zustimmung auf eine Rate im kleinen einstelligen Bereich zu senken. Im Frühjahr 2007 erwartete jedenfalls in Israel kaum noch jemand, dass der innenpolitisch geschwächte Ministerpräsident den Sommer politisch überleben werde.
Ein für die Regierung verheerender Untersuchungsbericht über die Art und Weise, wie Israel den Libanonkrieg des Vorjahres geführt hatte, schadete dem Ansehen der Regierung besonders. Zu den weniger beachteten, für die Gesamtentwicklung im israelisch-arabischen Raum aber durchaus entscheidenden Vorwürfen der Untersuchungskommission gehörte die Bemerkung, dass die israelische Führung es offenbar nicht mehr für notwendig erachtet habe, energisch nach Wegen zu suchen, um mit den Nachbarn haltbare Friedensverträge abzuschließen. Tatsächlich würde es sowohl die israelische wie auch die palästinensische Regierung stärken, wenn wieder ernsthafte Friedensverhandlungen auf den Weg gebracht würden: Die Regierungen und die Diplomaten ständen dann wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – nicht die Gewalt, die Milizen und die Militärs.
In den palästinensischen Gebieten befindet sich die islamistische Hamas nun nicht mehr, wie es im Buch noch heißt, »im Wartestand«: Sie regiert mittlerweile oder regiert zumindest mit. Seit den Legislativratswahlen Anfang 2006 hatte sie die dafür notwendige parlamentarische Mehrheit. Sie verfügte allerdings über wenig andere Ressourcen, die notwendig gewesen wären, um die Regierungsgeschäfte auch erfolgreich zu führen: Geringe Erfahrung, keine Kontrolle über die Sicherheitskräfte, die weiterhin der abgewählten Fatah und allenfalls noch dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas loyal waren, vor allem aber keine internationale Unterstützung. Die USA und die meisten europäischen Staaten entschieden sich, jegliche direkte Zusammenarbeit mit den palästinensischen Ministerien und jeden Kontakt mit den Ministern zu verweigern, solange die Hamas-Regierung bestimmte durchaus richtige Forderungen der internationalen Gemeinschaft nicht explizit erfülle: die Anerkennung des Existenzrechts Israels, eine Selbstverpflichtung auf die Einhaltung aller von der PLO geschlossenen Vereinbarungen mit Israel und ein Bekenntnis zum Gewaltverzicht.
Die europäischen Staaten zumindest übersahen dabei zweierlei: Zum einen, dass es eine Reihe Staaten in der Welt gibt, einige davon, durch die auch die Reise dieses Buches führt, die durchaus berechtigten Forderungen der internationalen Gemeinschaft nicht nachkommen, ohne dass man deshalb das Gespräch mit ihnen einstellen würde. Zum anderen, dass die Aufkündigung des direkten Kontakts mit der Palästinensischen Autorität und die Beendigung direkter Finanzhilfen an die palästinensischen Behörden nur den weiteren Zerfall staatlicher oder vorstaatlicher Strukturen in den palästinensischen Gebieten befördern würde. Europa schickte zwar genauso viel Geld in diese Gebiete wie vorher, umging aber die dortigen Behörden, spielte stattdessen selbst Sozialamt und ließ durch eigene Mitarbeiter individuelle Fälle von Bedürftigkeit überprüften und Hilfszahlungen an Arbeitslose, Arme und Kranke oder an notwendiges Personal in Bildungseinrichtungen und Krankenhäusern vornehmen. Das half, die größte Not zu lindern, brachte aber den Aufbau verlässlicher staatlicher Strukturen nicht wirklich weiter.
Einen möglichen Ausweg aus der Blockade fanden letztlich die Saudis mit ihrer Vermittlung zwischen den palästinensischen Parteien, die zur Bildung der so genannten Einheitsregierung zwischen Fatah und Hamas führte. Seit diese im Frühjahr 2007 ihre Arbeit aufnahm, sprechen Europäer und Amerikaner zumindest wieder mit einigen der palästinensischen Minister – darunter dem neuen Außenminister Ziad Abu Amr, der uns bei unseren Gaza-Promenaden begegnet. Er löste in dieser Funktion übrigens Mahmud Zahar ab, den Hamasführer, der uns bei jenem Besuch das Programm seiner Partei und seine Vorstellungen der mittelfristigen Entwicklungen auf der palästinensisch-israelischen Szene erklärt hatte. Die Einheitsregierung ist allerdings in sich gespalten, wobei es mehr um die Macht innerhalb des zerrütteten palästinensischen Quasi-Staates als um Fragen der Politik oder des Friedensprozesses geht: Wiederholte Auseinandersetzungen zwischen den »Koalitionsparteien« könnten leicht in einen Bürgerkrieg münden, der für die Menschen im Gazastreifen und in der Westbank mindestens so verheerend wäre wie die Fortsetzung der Besatzungsherrschaft und die schier endlose Spirale von Gewalt, Zorn und gescheiterten Verhandlungen im israelisch-palästinensischen Verhältnis.
Dieses Verhältnis bleibt, so sehr man sich auch in anderen arabischen Staaten gerne auf die unmittelbaren, eigenen Angelegenheiten konzentrieren würde, ein zentrales Element für die Fortentwicklung regionaler Politik und regionaler Debatten. Nichts fördert extremistische – islamistische oder nationalistische – Ideologien und Gruppen so sehr wie der ungelöste israelisch-palästinensische Konflikt, nichts erschwert die Zusammenarbeit zwischen der arabischen Welt auf der einen Seite, Europa und den USA auf der anderen so sehr wie die Unfähigkeit oder Unwilligkeit des Westens, diesen Konflikt einer fairen Lösung näher zu bringen. Und natürlich verstecken die Regime arabischer Staaten oder Irans sich gerne hinter diesem Konflikt, um Reformforderungen aus den eigenen Gesellschaften abzuwehren oder eigene Defizite zu relativieren.
Der Wunsch nach Normalität, der uns auf unseren Promenaden immer wieder begegnet, wird deshalb zumindest so lange unerfüllt bleiben, wie Israelis und Palästinenser nicht allein oder mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft eine Regelung finden, die ihnen Sicherheit und Staatlichkeit in zwei klar voneinander abgegrenzten und sich gegenseitig anerkennenden Gemeinwesen erlaubt.
Berlin, im Mai 2007
Einführung
Zeitenwende im Nahen und Mittleren Osten?
DER NAHE UND MITTLERE OSTEN ist zu Beginn dieses Jahrhunderts ins Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit gerückt, doch die Ereignisse und Entwicklungen, die die Welt und diese Region beschäftigen, scheinen von Akteuren bestimmt, die zum Teil in ganz verschiedenen zeitlichen Zusammenhängen leben und in unterschiedlichen Zeiträumen denken. Geschichte spielt auf jeden Fall immer hinein, und zwar nicht in erster Linie als eine Vergangenheit, aus der die Völker Lehren ziehen, sondern oft zur Strukturierung der politischen Gegenwart und der aktuellen Konflikte.
Unterschiedliche Zeitrechnungen gibt es in dieser Region tatsächlich: Während ich das Manuskript dieses Buches im Sommer 2005 nach unserer Zeitrechnung fertigstelle, befinden wir uns nach dem islamischen Mondkalender, der in Saudi-Arabien gilt, aber auch von zahlreichen gläubigen sunnitischen Muslimen in anderen Ländern beachtet wird, im Jahr 1426 nach der Hijra (dem Auszug des Propheten Muhammad aus Mekka). In Iran legt man dagegen das Sonnenjahr zugrunde und lebt im Jahr 1384. In Israel entspricht das dem Jahr 5765 der jüdischen Zeitrechnung. Konservative und religiöse jüdische Blätter pflegen dieses Datum vor das internationale oder »christliche« zu stellen, das im öffentlichen Leben Israels verbindlich ist. Andere Völker und Minderheiten haben noch andere Kalender, so feiern die Kurden ihr Neujahr (Newroz) zwar gemeinsam mit den Iranern, befinden sich aber bereits im Jahr 2705. Und die heute überwiegend christlichen Assyrer, Namensgeber des assyrischen Reiches in Mesopotamien (und später des davon abgeleiteten Syrien), zeigen, dass ihre Geschichte weit vor die der anderen Völker zurückreicht: Bei ihnen begann am 1. April 2005 das Jahr 6755.
Dieses Buch nimmt den Leser mit auf einen politischen Streifzug durch sechs Länder und Gebiete des Nahen und Mittleren Ostens. Wir beginnen in Ägypten, bewegen uns dann durch Israel und die palästinensischen Gebiete, besuchen Saudi-Arabien, ziehen durch Irakisch-Kurdistan und beenden die Reise in Iran. Wir erleben auf diesen »Promenaden« die ganze Vielfalt, die sprachliche, kulturelle und konfessionelle Pluralität des nah- und mittelöstlichen Mosaiks. Damit ist dies keine reine Fortsetzung meiner »Geheimen Gärten«, die ein eher systematisch angelegtes Gesamtbild der »neuen arabischen Welt« und der politisch-gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen bieten, denen die einzelnen Länder sich zu stellen haben.1 Man kann die beiden Bücher vielmehr parallel lesen. Das hier vorliegende zeichnet das Bild der Region, ihrer Konflikte und Debatten, ihrer gesellschaftlichen Verwerfungen und Auseinandersetzungen vornehmlich, indem es die dort lebenden Menschen zu Wort kommen lässt. In den zahlreichen persönlichen und ohne große Rücksicht auf Ausgewogenheit ausgewählten Begegnungen spiegelt sich eine Gesellschaft, die nicht erst seit dem Irakkrieg im Umbruch ist.
Tatsächlich hat die von Amerika angeführte Irak-Invasion die geopolitischen Verhältnisse im Nahen und Mittleren Osten durcheinander gewirbelt. Neue Themen gelangten auf die regionale Agenda, manche Fragen wurden neu gewichtet, und die Gefahr von gewaltsamen Auseinandersetzungen hat sich erhöht. Man kann von einer geopolitischen Revolution, vielleicht sogar von einem historischen Wendepunkt in den regionalen Entwicklungen sprechen. Langjährige Stagnation ist an vielen Stellen einer Unruhe gewichen, die neue Risiken, aber auch neue Chancen birgt.
Am deutlichsten wird das im Irak. Der Krieg befreite die Iraker von der übelsten der mittelöstlichen Diktaturen, brachte ihnen aber keinen Frieden. Das Land wurde zum »sicheren Hafen« für Terroristen und wahrscheinlich zum Ausbildungslager und Exporteur eines sich religiös legitimierenden Terrorismus; seine territoriale Einheit ist gefährdet. Gleichzeitig werden hier Formen von Pluralismus, Demokratie und Selbstbestimmung eingeübt, die auch für andere Staaten in der Region modellhaft werden könnten, wenn es gelingt, sie institutionell abzusichern, so dass sie nicht von Rebellion und Bürgerkrieg hinweggefegt werden.
Auch in den israelisch-palästinensischen Konflikt ist nach vier Jahren blutiger Auseinandersetzungen eine neue Dynamik gekommen. Mit dem israelischen Abzug aus dem Gazastreifen und mit dem Bau des Sperrwalls beziehungsweise der Mauer in der Westbank wurden lang gepflegte Tabus gebrochen und zugleich die politische Geographie verändert. Dies kann einen neuen, ernsthaften Friedensprozess befördern, aus dem am Ende zwei unabhängige, neben- und miteinander lebende Staaten hervorgehen; es kann aber auch bedeuten, dass lediglich die Ausgangslinien der kommenden Konfrontation festgelegt werden.
Ägypten und mehr noch Saudi-Arabien sind von dem regionalen Erdbeben, das der Irakkrieg ausgelöst hat, schwer erschüttert worden. Beide Staaten verstanden und verstehen sich als regionale Führungsmächte, aber beide waren während der Krise gegen ihren Willen in eine Zuschauerrolle gedrängt. Der Irakkrieg und die internationalen Forderungen nach Reform und Modernisierung der arabischen Welt lassen zugleich die Kritik an den inneren Verhältnissen in diesen beiden Ländern lauter werden. In tiefgehenden Reformdebatten wird hier inzwischen um den richtigen Weg in die Zukunft gestritten. Ähnliches gilt unter etwas anderen Vorzeichen auch in Iran, wo aufgrund der Enttäuschung nach einer achtjährigen Reformperiode, in der wenig erreicht wurde, ein politischer Rechtsschwenk erfolgte.
In allen Ländern versuchen einzelne Akteure, das europäische und amerikanische Drängen auf Demokratisierung und politische Modernisierung der arabischen Welt und des Mittleren Ostens zu nutzen. Andere fürchten um die Unabhängigkeit und Souveränität ihrer Länder – oder behaupten dies zumindest, um Reformforderungen aus dem Innern abzuwehren. Dabei geht es den Bürgern und Bürgerinnen dieser Länder gar nicht darum, den eigenen Staat oder dessen Autorität zu unterminieren. Ihre Forderungen und Wünsche sind politisch, aber selten revolutionär. Über allem steht das Wort »Demokratie«. Die meisten Menschen verstehen darunter aber nicht den unmittelbaren Sprung von autoritären in liberaldemokratische Verhältnisse westlichen Musters, sondern zuerst und vor allem die Durchsetzung und die Garantie von Menschenwürde und Menschenrecht, die Eindämmung von Korruption, mehr Rechtsstaatlichkeit, die Stärkung der Rechte von Frauen, mehr Liberalität und Offenheit. Das alles sind Voraussetzungen und Elemente einer wirksamen und nachhaltigen Demokratisierung.
Der Religion – oder richtiger den religiös-politischen oder religiös gefärbten Debatten – kommt eine enorme Bedeutung bei den Auseinandersetzungen um die Zukunft der einzelnen Länder zu, durch die diese »Promenaden« führen. Diese Auseinandersetzungen finden – teils mehr, teils weniger offen – überall statt: in den religiösen Schulen und Universitäten Irans, in den islamischen Parteien und Bewegungen Ägyptens und Palästinas, innerhalb der ägyptischen Regimepartei und in der Zivilgesellschaft, im Konsultativrat sowie bei öffentlichen und halböffentlichen Diskussionen in Saudi-Arabien. Es geht dabei überall um die Verfasstheit der politischen Systeme, um Fragen der Teilhabe an politischen Entscheidungen, um Menschenund Bürgerrechte, oft auch um das Verhältnis zu den Nachbarn in der Region, fast immer um Gewalt und den inneren wie äußeren Frieden sowie um die Haltung zum Westen.
Nicht alle diese Diskussionen sind erbaulich, und manche Diskussionspartner sind wenig erfreuliche Erscheinungen. Gerade im Streit über Terrorismus und Gewalt, über das Verhältnis zu den USA und Europa oder über Demokratie und Menschenrechte aber wird deutlich, dass es falsch ist, von einem Konflikt der Kulturen oder der Zivilisationen zu sprechen. Zutreffender wär es, von einem Konflikt innerhalb der Kultur oder von einer Konfliktlinie in der arabischmuslimischen Zivilisation zu sprechen, die sich quer durch diese Welt zieht und nicht etwa »den Islam« gegen »den Westen« positioniert oder abgrenzt. Viele der gewalttätigen wie der nur – jedenfalls bislang nur – verbalen und politischen Auseinandersetzungen, die wir in dieser Region erleben, lassen sich als Teil eines stellenweise akuten, stellenweise latenten, aber wahrscheinlich noch länger andauernden Bürgerkriegs in slow motion verstehen. Die Kluft ist tief zwischen denen, die eine friedliche politische Veränderung, die Entwicklung offener Gesellschaften und internationale Kooperation und Integration anstreben, und jenen, die letztlich eine totalitäre Ordnung errichten wollen und sich als Teilnehmer einer globalen, zeit- und raumübergreifenden Auseinandersetzung sehen. Dazu rechnen sie die Kreuzzüge, den westlichen Kolonialismus, die sowjetische Besatzung Afghanistans und den arabisch-israelischen Konflikt ebenso wie den Aufstand gegen die amerikanische Besatzung im Irak und die Anschläge von al-Qaida oder ähnlichen Gruppen in Saudi-Arabien, Ägypten und Indonesien, New York, Madrid und London.
Auf der anderen Seite haben wir es unmittelbar und ganz konkret mit ungelösten territorialen Konflikten zu tun, die verhandelt werden müssen. Nicht nur in Israel und den palästinensischen Gebieten, sondern auch in Kurdistan oder am Golf geht es um die politischgeografische Bestimmung und die Kontrolle von Land und Ressourcen. Religiöse, konfessionelle und historische Überhöhungen bleiben auch da nicht aus, etwa in Kirkuk, dem – wie Kurden gern sagen – »Jerusalem Kurdistans«, oder im wirklichen Jerusalem, der heute faktisch geteilten Hauptstadt Israels und – im besten Fall – zukünftig gemeinsamen Hauptstadt zweier Staaten. Die Bemühungen um eine Regelung oder Beilegung dieser Konflikte entspringen weniger einer idealistischen Friedenssehnsucht als vielmehr der realpolitischen Erkenntnis, dass keine der Konfliktparteien die andere wirklich besiegen kann. Und sie entpringen der Suche nach »Normalität«, was vor allem für die Jugendlichen gilt, die mir zwischen Kairo und Teheran, Tel Aviv und Riad begegnet sind.
Fragen nach der eigenen Identität spielen eine große Rolle. Dazu gehört, sich abzugrenzen, was im wörtlichen Sinn zu verstehen ist, um den eigenen Platz bestimmen und die Zukunft der eigenen Gemeinschaft definieren zu können.
Radikale Positionen zu beziehen in den lokalen und regionalen Konflikten oder gar in internationalen Verhandlungen, ist übrigens keineswegs ein Privileg der Jugend. Häufig finden wir bei enttäuschten Mitgliedern älterer und mittlerer Generationen sehr viel unversöhnlichere Positionen. Viele der Jungen wie der Älteren machen kein Hehl daraus, dass sie wenig Vertrauen zum Westen haben. Kritische Fragen nach der Richtung und nach der Moral westlicher Politik richten sich keineswegs nur an die USA, sondern auch an die Europäer.
Die Reisen, die diesem Buch zugrunde liegen, habe ich bis zum Frühsommer 2005 unternommen. Die Übersetzungen aus Gesprächen sind meine eigenen, das Gleiche gilt, sofern nichts anderes vermerkt ist, für schriftliche Quellen. Bei Begriffen aus den Sprachen der Region habe ich mich um eine leicht verständliche Transliteration bemüht und mich bei Eigennamen in der Regel an die von den Betroffenen selbst gewählte Form gehalten.
Dank für Unterstützung gebührt vielen. Von den vielen Freunden und Bekannten in der Region, die mir zu Einsichten verholfen, Kontakte vermittelt, Wege gezeigt oder schlicht den Aufenthalt in ihren Städten angenehmer gemacht haben, seien hier stellvertretend Professor Heba Raouf Ezzet in Kairo, Dr. Ziad Abu Amr sowie Salah und Bettina Abd al-Shafi in Gaza, Professor Angelika Timm, Dr. Mark Heller und Julia Scherf in Tel Aviv, Dr. Mahdi Abd al-Hadi in Jerusalem, Dr. Muhamad Shtayyeh und Christian Sterzing in Ramallah, Dr. Thomas Schneider und Professor Khalil al-Khalil in Riad, Ibrahim Hassan in Salahadin, Dr. Kamal Fuad und Dildar Kittani in Sulaimani, Dr. Abbas Maleki, Dr. Abbas Araqchi sowie Dr. Christiane Krämer-Hus-Hus und ihre Familie in Teheran genannt.
Selbstverständlich sind alle eventuellen Fehlinterpretationen von Lage und Entwicklungen in den Ländern der Region meine eigenen. Muriel Asseburg, Ruth Ciesinger, Claudia Rolf, Eva Wegner und Nina Zolanwar danke ich für kritisches Lesen von verschiedenen Teilen des Manuskripts.
Der Fritz Thyssen Stiftung bin ich für einen großzügigen Zuschuss zu meinen Reisekosten dankbar.
Volker Perthes
Berlin, im Herbst 2005
Ägypten
Pharao und seine Gegner
ES LAG KEINESWEGS IM INTERESSE des ägyptischen Präsidenten und der ägyptischen Regierung, in der alljährlichen Rede des amerikanischen Präsidenten zur Lage der Nation erwähnt zu werden. Im Februar 2005 sprach der gerade für eine zweite Amtszeit gewählte George W. Bush Ägypten in dieser wichtigen Rede dennoch sehr direkt an: »Die große und stolze ägyptische Nation«, erklärte Bush, »die den Weg zum Frieden im Nahen Osten gezeigt hat, kann jetzt den Weg zur Demokratie im Nahen Osten zeigen.« Am selben Tag fand in Ägypten eine Pressekonferenz lokaler Menschenrechtsorganisationen statt, die gegen die Verhaftung von Ayman Nour, Abgeordneter des ägyptischen Parlaments und Vorsitzender der Ghad-Partei, protestierten. Nour war mit einer wenig überzeugenden Anklage vor den Haftrichter gebracht und für anderthalb Monate aus dem Verkehr gezogen worden. Beim Haftprüfungstermin erschien er mit einem orangefarbenen Schal; bei der Pressekonferenz der Menschenrechtsorganisationen stellten sich seine Anhänger mit orangefarbenen Plakaten vor die Fernsehkameras – ein Versuch, von der Revolution zu profitieren, die gerade in der Ukraine zu einem Machtwechsel geführt hatte. Ausländische Journalisten, die hier Vorboten einer Bürgerrevolution sahen, irrten sich nach Meinung des ägyptischen Redakteurs eines der vom staatlichen Medienkonzern al-Ahram herausgegebenen Blätter allerdings: »Leider. Es wäre gut, wenn so etwas passierte, aber ich sehe es nicht. Alles geschieht hier nur am oberen Rand der Gesellschaft, politische Bewegungen haben keine soziale Tiefe.«
Der Ablauf der Ereignisse war höchst bezeichnend für die politische Situation Ägyptens seit dem Irakkrieg. Das Land kann sich internationalen Entwicklungen nicht verschließen und reagiert insbesondere auf Druck von Seiten der USA, von denen es jährlich etwa zwei Milliarden Dollar an Militär- und Entwicklungshilfe erhält, ausgesprochen empfindlich. Die Nation – oder diejenigen, die sie international vertreten – ist tatsächlich stolz auf ihre Vorreiterrolle in der arabischen Welt und sehr darauf bedacht, diese Position zu behaupten. Damit verbunden ist eine konstruktive und aktive Vermittlungspolitik im israelisch-palästinensischen Konflikt, die sowohl von der israelischen als auch von der palästinensischen Führung und von den internationalen Parteien, die ein Interesse am Erfolg der nahöstlichen Friedensbemühungen haben, für unentbehrlich gehalten wird. Ägypten spielt seine Rolle bewusst, mit großem Geschick und nahezu unberührt davon, dass der eigene, 1979 geschlossene Friedensvertrag mit Israel wie auch die Beziehungen Ägyptens zum jüdischen Staat ein – milde ausgedrückt – innenpolitisch sehr umstrittenes Thema darstellen. Israel gilt, wenn man dem populistischen Diskurs islamistischer und nationalistischer Kreise folgt, der sich auch in den Regierungsmedien spiegelt, noch immer als Feindstaat. Man sollte sich allerdings hüten, diese veröffentlichte Meinung für die allgemeine öffentliche Meinung zu halten.
Innenpolitisch gibt es durchaus eine Diskussion über Reform und Veränderung, und die wird zweifellos durch die internationalen Forderungen nach »arabischer Reform« befördert, auch wenn die politischen Führungseliten auf Regierungs- wie auf Oppositionsseite permanent den Eindruck zu erwecken versuchen, es gäbe keinen ausländischen Reformdruck. Wenn doch, sei er völlig wirkungslos, denn man verbitte sich solche Einmischung ganz entschieden. Ägypten wisse schließlich selbst am besten, wie viele und welche Reformen es wirksam und ohne die innere Stabilität zu gefährden einleiten und umsetzen könne. Dem Generalsekretär der Nationaldemokratischen Partei (NDP) von Präsident Husni Mubarak gelang es immerhin, nach der Bush-Rede und der Verhaftung des Abgeordneten Nour die Vertreter aller vom Staat legalisierten Oppositionsparteien zusammenzubringen und ihnen eine gemeinsame Erklärung abzuringen, in der sie sich gegen jegliche »äußere Einmischung« aussprachen und jeden Versuch, Ägypten von außen den Weg zu Reformen vorzuschreiben, zurückwiesen.
Die NDP ist eine aus der Einheitspartei Gamal Abd al-Nassers, Ägyptens Präsident von 1952 bis 1970, hervorgegangene Regimepartei. Da das Regime die Lizenzierung von Oppositionsparteien sehr selektiv erlaubt oder verwehrt, hat die NDP als Partei des Regimes ein riesengroßes, das ganze Land bis ins letzte Dorf überziehendes Patronagenetzwerk aufbauen können – ein Instrument der sozialen Kontrolle wie auch der Verbindung zwischen dem politischen Zentrum und der Bevölkerungsbasis, das Informationen, Unmut und Zustimmung, Ressourcen und Kontakte in jede gewünschte Richtung leitet. Die Oppositionsparteien haben keine entsprechenden Apparate, und der Staat sorgt notfalls mit administrativen Mitteln dafür, dass sie auch keine erhalten. Oppositionsgruppen, die zu populär zu werden drohen, legalisiert man erst gar nicht. Das trifft vor allem die Muslimbruderschaft (offiziell: Gemeinschaft der muslimischen Brüder), eine fast achtzig Jahre alte, im sozialen Milieu Ägyptens fest verwurzelte und immer noch schlagkräftige politisch-islamische Vereinigung.
Das politische System Ägyptens lässt sich als pluralistischer Autoritarismus charakterisieren, weil den gebildeten und nicht nur den einigermaßen wohlhabenden Schichten erhebliche persönliche Freiheiten, auch eine gewisse Meinungs- und Pressefreiheit, eingeräumt werden und mittlerweile sogar offene Kritik am Präsidenten und seinem Regime erlaubt ist. Gleichzeitig trägt man institutionell dafür Sorge, dass sich an den Herrschaftsverhältnissen und den politischen Mehrheiten selbst bei regelmäßig durchgeführten Wahlen nichts ändert: Der Präsident als eigentlicher Entscheidungsträger, der die Regierung einsetzt, ist bis 2005 noch stets durch ein Referendum und nicht durch eine Wahl mit echten Alternativen bestimmt worden. Über den Kandidaten für das Referendum entscheidet das Parlament mit Zweidrittelmehrheit. Da die Partei des Präsidenten bisher immer über eine solche Mehrheit verfügt hat, war die Wahl und Wiederwahl Mubaraks immer sicher.2
Dieses System, das den Mittelschichten geistige und politische Spielräume erlaubt, zeigt sich gegen die unteren Schichten zuweilen offen als Polizeistaat, der sich nicht scheut, repressive Mittel einzusetzen, um etwa organisierte Massenproteste zu verhindern. »In einer Oppositionszeitung«, sagt Hani Shukrallah, ein liberaler Kopf und bis vor kurzem noch Chefredakteur der englischsprachigen, vergleichsweise liberalen al-Ahram Weekly, »kann man viel über das Regime, auch über den Präsidenten schreiben. Sagte man das Gleiche vor einem Fabriktor, würde das zur unmittelbaren Festnahme des Redners führen.« Nicht von ungefähr hat Ägypten noch keine unabhängigen Gewerkschaften, sondern einen Gewerkschaftsverband sowjetischen Typs, eine Arbeiterverwaltung also, die vor allem die Interessen der staatlichen Industrie verteidigt. Wenn in den politisch-intellektuellen Zirkeln, bei Oppositionsparteien oder Menschenrechtsorganisationen und natürlich im Umfeld ausländischer Botschaften intensiv über politische Reformen, insbesondere die Notwendigkeit, die autoritär-präsidentielle Verfassung zu ändern, diskutiert wird, ist ein erster wichtiger Schritt getan, aber man sollte nicht übersehen, dass diese Debatten letztlich nur eine Minderheit, im Wesentlichen die politische, intellektuelle und kulturelle Elite, beschäftigen.
Die Mehrheit der Bevölkerung erwartet nach allen Umfragen und auch nach Erfahrungen, die man selber machen kann, etwas anderes: Für sechzig Prozent der Befragten haben Armutsbekämpfung, der Kampf gegen die Korruption und eine Verbesserung des Bildungswesens Priorität – alles zweifellos politische Themen -, die Einführung demokratischer Normen und Praktiken halten sie dagegen für weniger dringlich.3 Reformer innerhalb des Staatsapparats richten ihr Augenmerk daher in erster Linie auf die Aufrechterhaltung und Verbesserung staatlicher sozialer Leistungen – Wohnungsbau, geregelte Trinkwasserversorgung, eine intakte Kanalisation – und bemühen sich um wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze. Die wirtschaftlichen Zuwächse müssten aber deutlich über den Wachstumsraten der Bevölkerung liegen, wenn landesweit die Lebensverhältnisse verbessert werden sollen. Das jährliche Durchschnittseinkommen liegt bei weniger als tausendvierhundert Dollar, und selbst wenn wir vom Doppelten ausgehen, weil Statistiken in Entwicklungsländern die reale Wirtschaftsleistung fast immer unterschätzen, ist das nicht viel. Zudem ist das Einkommen im Land ausgesprochen ungleich verteilt. Vielleicht drei Prozent der Bevölkerung können sich einen Lebensstandard leisten, der dem durchschnittlichen Standard in Westeuropa entspricht, ein noch kleinerer Teil verfügt über kaum vorstellbaren Reichtum; die Mehrheit aber muss mit dem Durchschnittseinkommen oder weniger auskommen.
Ägypten ist ein Land mit fast 75 Millionen Einwohnern, zu denen nach Angaben des statistischen Amtes jährlich rund 1,3 Millionen Menschen hinzukommen. Damit steigt die Zahl der Erwerbsfähigen, für die Arbeit zu beschaffen ist, jedes Jahr um knapp fünfhunderttausend. Öffentliche und private Arbeitgeber schaffen es immerhin, sechzig bis achtzig Prozent dieser jungen Leute aufzunehmen, der Rest muss mit marginalen, ungeregelten Arbeiten ein Auskommen finden. All das beeinflusst das Verhältnis von Politik und Gesellschaft unmittelbar. Bei Parlamentswahlen ist oft der gute Kontakt des Kandidaten zur staatlichen Führung wichtiger als das Programm, das er vertritt; ein Oppositionskandidat kann noch so gute Konzepte vortragen, wenn er keine Patronage in Kairo hat, sind seine Chancen gering, denn er hat wenig zu bieten: keine Zugänge zu staatlichen Stellen, keine Jobs im öffentlichen Sektor. Deshalb schließen sich selbst änderungsfreudige, aufstrebende Politiker eher der Regimepartei an, als sich um den Aufbau politischer Alternativen zu bemühen.
Oppositionsarbeit ist nicht sehr attraktiv, solange die Opposition auf absehbare Zeit keine Chance hat, auf friedlichem Wege an die Macht zu kommen. Das System kooptiert immer wieder die klugen, pragmatischen Köpfe, die darüber ihren Frieden mit den herrschenden Verhältnissen machen, und lässt die Opposition im Wesentlichen als einen Tummelplatz von Dogmatikern erscheinen, die kaum eine Alternative zu Regierung und Regime darstellen. Wer sich dieser Rollenverteilung verweigert, sich also weder unter den großen Schirm des Regimes stellen noch Opposition in den schrillen, populistischen Tönen der Islamisten und Nationalisten machen will, hat die größten Schwierigkeiten.
Die Kooptierung reformerischer Kräfte in die Regierung ist auf Dauer aber wohl nicht ausreichend. »Wir haben zum ersten Mal Minister«, sagt Abd al-Monem Said, der Chef des al-Ahram-Zentrums für Strategische und Politische Studien, der wichtigsten Denkfabrik Ägyptens, »die zugeben, dass es Probleme gibt.« Man hat einige wirtschaftliche Reformen auf den Weg gebracht, doch vieles steht noch aus. Die Inflation ist einigermaßen unter Kontrolle; einige Hindernisse für lokale Unternehmer und ausländisches Kapital sind abgebaut worden. Ein Team um Gamal Mubarak, den gut ausgebildeten Sohn des Staatspräsidenten, hat sich vorgenommen, das Land aus dem Kern des Regimes heraus auf einen Reformkurs zu bringen, bei dem Wirtschaft, Finanzen und Bildung im Vordergrund stehen. Das Team ist politisch nicht blind, es weiß, dass man politischen Wettbewerb auch um wichtige Staatsämter zulassen muss. Ohne dies werden die wirtschaftlichen Reformen das Land nicht aus der drückenden Atmosphäre der Stagnation befreien, die trotz der demonstrativen Energie, die das Umfeld des Präsidentensohns ausstrahlt, auf dem Land lastet. Zu oft haben die Ägypter schon gehört, dass die neue Regierung nun wirklich eine Reformregierung sei. Viele warten deshalb auf deutlichere Signale oder hoffen gar auf die Ära nach dem 1928 geborenen Präsidenten Mubarak. Der Diskussionsprozess um die politische Zukunft des Landes ist jedenfalls in vollem Gange.
Der Ausgang des Experiments, weitgehende Veränderungen von innen heraus auf den Weg zu bringen, ist offen, der Erfolg keineswegs garantiert. Ernsthafter Widerstand gegen diese Reformen kommt allerdings nicht von der Opposition, sondern ebenfalls aus dem Kern des politisch-administrativen Systems: Die Bürokratie, die in Jahrzehnten der Staatswirtschaft durch die automatische Übernahme jedes Hochschulabgängers aufgebläht wurde, hat Angst vor allem, was nach Marktwirtschaft riecht. Das Sicherheitsestablishment, die Spitzen des Militärs und der Geheimdienste unterstützen zwar eine vorsichtige wirtschaftliche Öffnung, bekämpfen jedoch jede ernsthafte politische Liberalisierung. Sie sind skeptisch und befürchten, dass die Reformen, die der Präsidentensohn und seine Mitarbeiter auf den Weg bringen wollen, zu weit gehen oder außer Kontrolle geraten könnten oder dass Gamal Mubarak, der aus seinen Sympathien für die USA und amerikanisches Wirtschaftsdenken keinen Hehl macht, gar das Land »an die Amerikaner verkaufen« könnte. Die jungen Reformer ihrerseits sind vorsichtig und achten darauf, so formuliert es jedenfalls einer der engsten Mitarbeiter Gamal Mubaraks, »dem Sicherheitsestablishment nicht auf die Zehen zu treten«.
Letztlich wartet man in allen wichtigen politischen Fragen darauf, dass der alternde Präsident selbst ein Machtwort spricht und die Dinge entscheidet. Kaum jemand bestreitet, dass das, was die Ägypter ihre »pharaonische Tradition« nennen, die politische Kultur bestimmt: Das Volk beobachtet – und spekuliert -, was an der Spitze geschieht, erwartet aber, dass letztlich Pharao allein die weisen Entscheidungen trifft. Wie immer diese auch ausfallen, es wird sie am Ende hinnehmen. Ob Mubarak entscheidet, seinen Sohn zu inthronisieren, ob er einen Vizepräsidenten aus dem Sicherheitsestablishment ernennt, der bei seinem Tod seine Nachfolge antritt, oder ob er für die Zeit nach dem Ende seiner Ära eine Einschränkung der quasi-absoluten Vollmachten des Präsidenten auf den Weg bringt – die Bevölkerung wie die politischen und militärischen Eliten würden jede dieser Entscheidungen wohl akzeptieren. Vorerst aber steht der Präsident für den Status quo, für die Fortsetzung des Bewährten, wozu zumindest in den letzten zweihundert Jahren ägyptischer Geschichte hin und wieder auch Reformansätze aus dem Kern des Herrschaftsapparats selbst gehört haben.
Kritik aus den USA und aus anderen befreundeten Staaten hört man indes nicht gern. Nur drei Wochen nach der Rede Bushs vom Februar 2005 zündete Präsident Mubarak daher eine kleine politische Bombe, indem er bei einer Ansprache in der Universität von Menufiya, seiner Heimatstadt im Nildelta, seinen sorgfältig ausgesuchten Zuhörern ohne jede Vorwarnung mitteilte, dass er, der Präsident, das Parlament auffordern werde, die Verfassung insoweit zu ändern, dass bei den kommenden Präsidentschaftswahlen mehrere Kandidaten antreten könnten. Mit dieser Ankündigung erwies sich Mubarak wieder einmal als gerissener Meister des politischen Spiels, denn er überraschte nicht nur die Öffentlichkeit, sondern nahm auch der Opposition den Wind aus den sich gerade blähenden Segeln. Der Oppositionspresse blieb kaum etwas anderes übrig, als die Entscheidung zu loben. Die Regierungszeitungen betonten, dass dieser wichtige Schritt Ägyptens zur wahren Demokratie allein das Ergebnis des internen politischen Dialogs sei und nichts, rein gar nichts mit ausländischem Druck zu tun habe. Dass die Verfassungsänderung Mubarak immer noch eine haushohe Mehrheit garantieren würde, da nur die kleinen Parteien Gegenkandidaten ins Feld schicken durften und unabhängige Kandidaten sowie die verbotene, aber populäre Muslimbruderschaft faktisch ausgeschlossen blieben, fiel dabei kaum ins Gewicht, hatte aber aus Regierungssicht den zweifellos förderlichen Effekt, Zwietracht unter den Oppositionsgruppen zu säen: Einige unterstützten im Parlament die vorgeschlagene Änderung und die Wiederwahl des Präsidenten, andere erklärten sie zur Farce. In Ägypten kursierte bald der Witz, eine der vielen Bedingungen für die Zulassung als Präsidentschaftskandidat sei eine mehrjährige Berufserfahrung im höchsten Staatsamt. Mubarak gewann die Präsidentschaftswahl im September dementsprechend mit wenig überraschenden 88,6 Prozent der abgegebenen Stimmen.
Tatsächlich stellt eine Auswahl unter mehreren Kandidaten einen Schritt zu mehr demokratischer Teilhabe dar. Seine Wirkung wird dies aber wahrscheinlich erst in der Nach-Husni-Mubarak-Ära entfalten. Noch dominiert der seit 1981 amtierende Präsident die Politik seines Landes und stützt sich dabei auf eine politische Kultur, die tatsächlich seit pharaonischer Zeit durch zentralistische Regierungsführung geprägt ist: Gutes wie Schlechtes, jede grundlegende Veränderung, das jedenfalls ist die Erfahrung von Generationen, kommt von »oben« und aus der Hauptstadt – niemand würde etwas anderes erwarten. Das heißt aber durchaus nicht, dass Ägyptens Gesellschaft ihrer politischen Führung blind folgen würde oder gar gleichgeschaltet ist, vielmehr ist sie lebhaft, offen und toleriert auch Andersdenkende.
Ägypten ist ein überwiegend muslimisches Land. Die große Mehrheit der Ägypter ist fromm, und diese Frömmigkeit wird auch gern demonstriert – nicht zuletzt durch äußerliche Zeichen wie Kopftuch und Schleier, Barttracht oder den zabib al-salat, den Gebetsfleck, wörtlich die Gebetsrosine: eine Vernarbung auf der männlichen Stirn, die man pflegt und gern auch vergrößert, um zu zeigen, wie häufig und heftig der Gezeichnete beim Beten mit der Stirn auf den Teppich schlägt. Ägypten ist das Mutterland des modernen – mit der kulturellen und politischen Moderne entstandenen – islamischen Fundamentalismus, der sich hier seit den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts nicht zuletzt in Gestalt der Muslimbruderschaft organisiert. Ableger oder ideologisch ähnlich gelagerte Bewegungen, die sich die Bruderschaft zum Vorbild nehmen, finden sich heute in fast allen arabischen und in manchen nichtarabischen muslimischen Staaten.4
Die religiöse Strenge und Ausschließlichkeit des saudi-arabischen Wahhabismus ist dem Land aber fremd. In den letzten Jahrzehnten – vor allem bis zum Beginn der achtziger, dann wieder in den neunziger Jahren und noch einmal im Jahre 2005 – überrollten Wellen terroristischer Gewalt das Land. In den Achtzigern zogen manche der selbst ernannten Krieger für die islamische Sache nach Afghanistan, Anfang der Neunziger, als die Mujahidin die russischen Besatzer vertrieben hatten, kehrten sie nach Ägypten zurück und mit ihnen die kriegerischen Erfahrungen und die Bereitschaft zum bewaffneten Jihad. Zwischen 1992 und 1997 bildete der Anschlag auf den Hatschepsut-Tempel bei Luxor den blutigen Höhepunkt der Gewalt, und Beobachter sprachen von einem »Krieg« zwischen Staat und terroristischen Gruppen. Der Staat reagierte auf diese Bedrohung mit äußerst repressiven und letztlich überlegenen Mitteln. Angesichts ihrer Niederlage sagten sich die wichtigsten der gewaltbereiten islamistischen Gruppen Ende der neunziger Jahre vom bewaffneten Kampf los.
Eine breite gesellschaftliche Unterstützung haben die Anschläge auf Politiker, Polizisten und ausländische Touristen in Ägypten nie gefunden, und so sind die radikalen Islamisten nicht nur militärisch, sondern auch politisch gescheitert. Einzelne Ultraradikale, darunter der durch seine Gewaltorientierung berüchtigte Arzt Ayman al-Zawahiri, blieben jedoch mit Usama bin Laden und der al-Qaida im Untergrund. Zawahiri und Bin Laden dürften auch jene Gruppen inspiriert haben, die 2005 mit blutigen Anschlägen auf internationale Hotels die innere Sicherheit des Landes in Frage stellten.
Zahlreiche Mitglieder der einst militanten Gruppen sitzen noch immer in den Gefängnissen, die meisten versuchten aber, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.5 Die Gewaltphase der neunziger Jahre gilt heute allgemein als Bruch, als Abweichung vom ägyptischen Weg. In Ägypten folgt man ohnehin eher dem Prinzip, leben und leben zu lassen, und sucht nach Möglichkeit ein Auskommen zu finden, das den gesellschaftlichen Frieden nicht gefährdet. Von Reform wird überall gesprochen, aber nach radikalen Umbrüchen steht nur einer kleinen Minderheit der Sinn.
Kairo: die Stadt, der Müll und das Leben
KAIRO IST VERMUTLICH die schmutzigste Hauptstadt des Vorderen Orients. Was immer verstauben kann, verstaubt, was immer verfallen kann, verfällt, und wo immer Platz ist für Müll, häuft sich welcher an. Das gilt selbst für die Pyramiden. Eine, so schreibt eine Tageszeitung, sei kurz vor dem Einsturz, weil man sich nicht gekümmert habe, sie gegen Wassereinbrüche zu schützen. Aber die Pyramiden haben ja auch wirklich schon lange gestanden.
In Kairo nehmen die Probleme Ägyptens im beständigen Kreislauf von öffentlicher Finanzknappheit, privater Armut, hohem Bevölkerungswachstum und offenbarem Desinteresse der politischen Eliten am Wohl der Bevölkerungsmehrheit zu. So verkommen einstmals bürgerliche Viertel oder solche der Mittelschicht, wenn die Reichen in neue und noch luxuriösere Hochhäuser entlang dem Nil oder außerhalb Groß-Kairos ziehen, zu dem, was man hier ein »populäres« Viertel nennt. Rund um die Stadt wachsen geplant und ungeplant Ansiedlungen, die Zuwanderer vom Lande und neue Generationen von Armen aus den traditionellen Stadtvierteln aufnehmen. In diesen spontan und wild gebauten Vierteln fehlt es am Allernötigsten wie Trinkwasser und Kanalisation. Der Staat hat, das lässt sich nicht übersehen, viel für den Ausbau der Infrastruktur getan, für Verkehrswege wie für die Kanalisation, und er hat der Stadt damit den immer wieder vorhergesagten Infarkt erspart. Dieses Perpetuum mobile von Zuwachs und Verfall zum Stillstand zu bringen, würde auch so manche europäische Kommunalverwaltung überfordern.
Auf fast jede Straße, jedes Gebäude und jede Institution in Downtown passt die Beschreibung: »hat bessere Zeiten gesehen«. Journalisten und Literaten, Angestellte und Beamte treffen sich in Restaurants und Cafés, die schon in den vierziger, fünfziger oder sechziger Jahren einen guten Namen hatten. Aber heute ist das Geld knapp, und so wird der Gast im »Groppi«, einem Kaffeehaus mit Konditorei, das eine wahre Institution der ägyptischen Hauptstadt ist, per Aushang freundlich darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt an einen Verzehr im Wert von mindestens acht ägyptischen Pfund – das ist etwas mehr als ein Euro – gebunden ist. Trinkgelder sitzen nicht mehr sehr locker. Die Lokale verstauben allmählich. Die Uniformen der Kellner – darauf besteht, wer auf sich hält – sind oft geflickt und selten gewaschen, und für den gebotenen Service gibt kaum jemand freiwillig ein nennenswertes Trinkgeld.
Natürlich ist es nicht leicht, bei dem Staub aus der nahen Wüste, der Kairo bei jedem Wind überzieht, bei dem Ruß aus Hunderttausenden oftmals schrottreifer Autos der Stadt ein frisches, sauberes Aussehen zu verleihen. Doch selbst wenn man das berücksichtigt, gewahrt man eine Vernachlässigung und Indifferenz, wie es sie in anderen Städten der Region, die ähnliche Probleme haben – in Teheran etwa -, nicht in dem Maße gibt. Möglicherweise ist dies der Preis für das ununterbrochene Wachstum eines Großstadtmolochs, der keine Zeit hat, so etwas wie Bürgersinn oder eine zivile Kultur mit Respekt für öffentliches oder auch nur gemeinsames Eigentum auszubilden.
Trotz alledem ist Kairo voller Leben, am Tag wie in der Nacht vital und abwechslungsreich und von enormer Anziehung. Man kann sich treiben lassen durch die islamische Altstadt Kairos oder durch Downtown, das Geschäfts- und Büroviertel der Kolonial-, Gründerund Unabhängigkeitszeit, wo Avenuen im französischen Design mit stuckverzierten Fassaden vergangene Pracht verströmen. Oder man sucht dem alltäglichen Kairo über eine der unprätentiösen Durchgangsstraßen – etwa der des »26. Juli« – näher zu kommen.
Die Straße des 26. Juli, benannt nach dem Tag des Umsturzes Gamal Abd al-Nassers im Jahre 1952, erstreckt sich vom alten Downtown bis zum Vorort Gizeh im Westen. Sie kreuzt in der Nähe des Hohen Gerichts und der wichtigsten Zeitungsverlage die dicht befahrene Ramses-Avenue, verläuft dann durch das populäre Bulak-Viertel, überquert zwei Nilarme sowie die Insel Zamalek und zieht sich schließlich durch die neueren Viertel am westlichen Flussufer bis zur Stadtgrenze. Es ist keine prächtige Straße, die in Kairo die Moderne der zwanziger bis fünfziger Jahre im Osten mit der der siebziger Jahre im Westen verbindet. Ihren Ausgang nimmt sie am Asbakiya-Park, einer gepflegten Anlage mit alten Bäumen, weiten Rasenflächen und einem echten Spielplatz mit Schaukel und Rutsche – eine Seltenheit in Kairo. Sonntags und freitags wird eine kleine Eintrittsgebühr erhoben, so dass der Park auch an diesen Tagen ein ruhiger und beinahe leerer Platz ist. Hier endet das europäische Kairo. Dahinter beginnt das Musky-Viertel, ein einfaches Wohngebiet, durch das der Besucher nach einigen hundert Metern zum Khan al-Khalili, dem traditionellen Souk Kairos, gelangt.
In westlicher Richtung präsentiert sich der 26. Juli dagegen als Mittelschichtsboulevard mit leicht gehobenem Anspruch, gesäumt von ein paar Kinos, Fast-food-Läden und vielen Schuh- und Konfektionsgeschäften. Im geräumigen Bistro »L’Américain« bemüht man sich, gewisse Standards aufrechtzuerhalten. Hier sitzen junge Ägypter der Internet-Generation, Yuppie-Anwälte, die Grundstücksgeschäfte abschließen, und junge Paare mit besserem Einkommen. Man bestellt einen Snack und verbringt den Nachmittag zeitunglesend oder am Handy. Noch weiter westlich passiert man das einst ockerfarbene, nun aber grau verstaubte Gerichtsgebäude und einige Hotels, die einmal gut gewesen sein mögen. Hier wird die Straße lebhafter: Junge Männer bieten auf Holzladen Socken, Uhren oder T-Shirts an. Wenn sie diese ganz plötzlich auf den Kopf heben und um die nächste Straßenecke verschwinden, naht eine Kontrollstreife der Polizei, die zumindest den Anschein erwecken soll, dass man dem unorganisierten Straßenhandel Grenzen setzt.
Etwas abseits, in der Nähe des mächtigen Gebäudes des al-Ahram-Verlages, sitzen Angestellte und Journalisten aus dem Zeitungsimperium in einem Café. Ein Straßenfeger schiebt mit einem Reisigbesen den Unrat zusammen und kippt ihn dann mit Hilfe eines Sperrholzbretts und den bloßen Händen in einen Weidenkorb. Die Angestellten diskutieren derweil über Politik. Palästinensische Entwicklungen sind immer von Interesse. Des toten Arafats strategischer Fehler sei es gewesen, sagt einer, auf die militarisierte Intifada gesetzt zu haben; Abu Mazin, ergänzt ein Zweiter, nun ja, das sei kein großer Führer. »Aber immerhin«, so wirft ein Dritter ein und schließt die Diskussion damit ab, »er ist gemäßigt« – und schon deshalb, so scheint mitzuklingen, ein bisschen wie die meisten Ägypter.
Zwischen der Ramses-Avenue, die zum Bahnhof führt, und der Brücke nach Zamalek verläuft der 26. Juli durch Bulak, eines jener Innenstadtviertel, die in ägyptischen Fernsehserien für das »wahre« Kairo der einfachen Leute stehen. Die Straße liegt hier im ewigen Schatten, weil in Höhe des zweiten Stocks der Wohn- und Bürogebäude, die überwiegend aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts stammen, eine Schnellstraße verläuft. Kairos Verkehr fließt hier wie auf anderen Durchgangsstraßen auf zwei Ebenen. Das verdoppelt die Blechlawinen und mit ihnen den Lärm und den Staub. Unten spielt sich das Leben ab, als gäbe es die Autobahn zwei Stockwerke höher gar nicht. Angestellte hasten zum nahe gelegenen Außenministerium oder in eines der vielen Büros, Straßenhändler bieten aus Kartons oder aus dem Aktenkoffer Kleinwaren feil.
Während die einen ihrer Arbeit nachgehen, sitzen andere in den Läden, Kaffeehäusern und kleinen Garküchen des Viertels. Ein Arbeiter in Plastiksandalen, die nur noch von Kordeln zusammengehalten werden, trägt schmierige Getriebeteile in eine Werkstatt, ein Fahradfahrer balanciert eine grob gezimmerte Leiter auf dem Kopf und steuert mit wahrer Künstlerschaft mal auf dieser, mal auf jener Spur durch den Verkehr. Ein junger Mann führt einen Grauschimmel am Halfter über die Straße – entgegen der Fahrtrichtung, damit man ihn besser wahrnehmen kann. Am Krankenhaus in der Nähe des Zeitungsviertels hocken Arbeiter auf dem Bordstein. Sie tragen ihr Werkzeugbündel – Hammer und Meißel – bei sich und warten seit den frühen Morgenstunden darauf, dass jemand sie für den Tag beschäftigt. Auf der gegenüberliegenden Seite, vor dem Italienischen Kulturzentrum, fischt der wachhabende Polizist aus seinem Stahlhelm in Essig eingelegtes Gemüse, das er in einen Brotfladen füllt.
Sobald man in eine der kleineren Seitenstraßen eintaucht, stößt man auf einfachere, jüngere Gebäude und sieht sich ganz plötzlich und unverkennbar in die Dritte Welt versetzt: Die Straßen, die einmal asphaltiert waren, werden allmählich wieder zu festgetretenen Erdpfaden. Die vorherrschende Kleidung der Männer ist die Galabeyya, das einfache, bodenlange Männergewand der Ägypter. Auf dem Kopf tragen sie Wollmützchen oder ein zum Turban geschlungenes Tuch, während die Frauen, ebenfalls meist im langen Gewand, in hellen Farben mit buntem oder schwarzem Kopftuch gehen.
Im Schatten der Hochbahn werden am Straßenrand Massen an Konfektionsware angeboten. Die Händler rollen große metallene Kleiderständer über den Asphalt, bis sie einen freien Platz erwischen, an dem sie sich für den Tag aufstellen. Hemden kosten fünfzehn ägyptische Pfund, Hosen zwanzig, also zwei, drei Euro. »Okkasion« steht auf den Pappschildern mit den Preisen. Es ist gebrauchte Ware. Wo sie herkomme, frage ich einen Händler. »Belgien«, sagt er kurz. Die Ware stammt also aus Altkleidersammlungen in Europa. Die ägyptische Textilindustrie kann mit dieser Ware nicht konkurrieren.
Über die »Brücke des 26. Juli« führt der Weg weiter nach Zamalek. Die Insel im Nil hat sich einen kosmopolitischen und intellektuellen Charme erhalten, auch wenn die gehobene, gebildete Mittelschicht, die ihr diesen Charakter verliehen hat, mittlerweile in der Minderheit sein dürfte. Der Architektur nach ist dies ein europäisches, Ende des neunzehnten, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entstandenes Großstadtviertel. In dieser Gegend wohnte früher, wer zur britischen Kolonialmacht, später, wer zu ausländischen Missionen, Bildungs- und Kultureinrichtungen gehörte und dennoch mitten in Kairo sein wollte. Bis heute gibt es hier mehr Galerien, internationale Buchhandlungen und Kultureinrichtungen als anderswo in der Stadt, zugleich aber auch das ganz normale ägyptisch-städtische Leben. Das spielt sich wesentlich innerhalb der hara ab, der kleinen Straße oder des Viertels, wo die bawabs, die meist oberägyptischen oder sudanesischen Concierges, jeden kennen und der Gemüsehändler wie der Professor seinen festen Platz im sozialen Mikrokosmos hat. Amm (»Onkel«) Abduh, der Friseur, hat gerade einem gut sechzigjährigen, kräftig gebauten Herrn im blauen Maßanzug den Kopf rasiert; nur eine scharf begrenzte Fläche halbmillimeterkurzer Haare ist stehen geblieben. Ob ich wisse, wer der Herr sei, fragt mich Onkel Abduh mit geheimnisvoller Miene. Ich weiß es nicht. »Der arbeitet beim Präsidenten«, erklärt er, »ein hoher Offizier, ein General, so einer mit Adler und gekreuzten Schwertern«, und dabei zeigt der Friseur auf seine eigenen Schultern, damit ich auch alles richtig verstehe. Ein Gespräch über Politik im Allgemeinen und den Präsidenten im Besonderen entwickelt sich daraus nicht. Der Präsident sei der Vater der Nation, und er habe Stabilität gebracht, sagt der Friseur, und mehr verlangt er nicht.
Zamalek lässt sich auf der Straße des 26. Juli in einer halben Stunde durchwandern, per Auto wird man zu vielen Zeiten des Tages genauso lange brauchen. Die Straße verbindet im weiteren Verlauf die Insel über die »Brücke des 15. Mai« – nach der innerparteilichen Säuberungsaktion, mit der Präsident Anwar al-Sadat 1971 die Macht innerhalb des Regimes konsolidierte – mit dem Stadtteil Muhandissun (Ingenieure), der schon im Namen den Planungs- und Entwicklungsoptimismus der sechziger und siebziger Jahre offenbart. Kurz hinter der Brücke trifft die Straße des 26. Juli auf den Boulevard der Arabischen Liga, acht- bis zehnspurige Verkehrsadern, gesäumt von schmucklosen Apartmenthäusern im modern-funktionalistischen Stil. An der Kreuzung steht ein Denkmal für den Literaturnobelpreisträger Nagib Machfus. Der Dichter, dargestellt als Flaneur mit Buch und Stock, schaut auf ein 1970, also in den letzten Regierungsund Lebensmonaten Nassers, eröffnetes Freiluftkino, einen Waschbetonklotz, der genauso gut in Warnemünde oder Wesel stehen könnte. Die Schmuckklinker sind zum Teil abgefallen, die Betonwände pilzzerfressen, die Geländer der Freitreppe heruntergebrochen, aber das Kino ist weiter in Betrieb. »Abends ist es hier sehr voll«, sagt der Direktor der Einrichtung, »auch wenn es bei Tage vielleicht nicht danach aussieht, dass wir noch in Betrieb sind.«
Die Straße führt am Zamalek Sporting Club vorbei, wo der wichtigste Fußballverein des Landes zu Hause ist. Hier wird auf großformatigen Plakaten Wahlkampf gemacht. Vereinsmitglieder, die auf sich halten und bereit sind, viel Geld zu investieren, konkurrieren um die Gremien des Vereins – Demokratie zumindest im Sportverein. Dann senkt sich die Hochstraße ab und geht in eine Schnellstraße über, die durch ein ärmeres Viertel mit ungepflasterten, engen Gassen gebrochen ist. Die Häuser scheinen hier wie in so vielen älteren Stadtvierteln nur darauf zu warten, abgerissen zu werden und moderneren Apartmenthäusern zu weichen. Dahinter endet die Provinz Kairo, und es beginnt, obwohl es heute nur ein Ortsteil Groß-Kairos ist, das Gouvernement Gizeh.
Auf der Grenze zwischen den beiden Stadtteilen verläuft die Eisenbahn, die wichtigste Nord-Süd-Verbindung des Landes. Die übervollen Züge der dritten Klasse transportieren auf diesen Schienen täglich Tausende Arbeiter, Bauern, Studenten und Soldaten aus Oberägypten nach Kairo und am Wochenende Zehntausende aus Kairo nach Oberägypten. Beamte und Geschäftsreisende, Offiziere und Grundbesitzer fahren dagegen in der »zweiten klimatisierten« oder in der ersten Klasse. Die dritte Klasse braucht keine Klimaanlage, denn sie hat keine Fensterscheiben.
Oberägyptische Begegnungen
ÄGYPTEN LEBT VOM NIL und von dem grünen Landstreifen rechts und links des großen Flusses. Der Nil und die Fellachen, die Bauern, ernähren das Land und liefern der Metropole Kairo die Menschen. Die Fahrt am Nil entlang offenbart, warum jede Regierung zumindest behaupten muss, die Sache der Bauern zu vertreten. Die Bemühungen reichen bis zu der unter Nasser erlassenen Verfassungsbestimmung, dass die Hälfte der Parlamentsabgeordneten Arbeiter und Bauern sein müssen. Faktisch ist diese Bestimmung heute zwar ausgehöhlt, aber ihren Wortlaut anzurühren, traut man sich nicht.