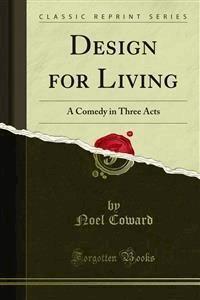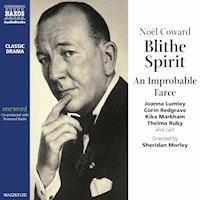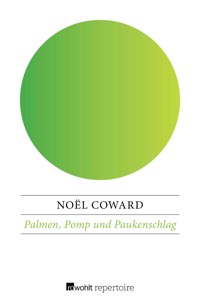
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Daß der Bühnenautor Noël Coward, bei dem Generationen junger Dramatiker in England und Amerika in die Lehre gingen, auch ein brillanter Romancier war, beweist sein hier vorliegender erster Roman. Samolo, eine imaginäre Insel im Pazifik, erwartet den Besuch von Königin Elizabeth und Prinz Philip. Noch bevor die hohen Gäste den Fuß an Land gesetzt haben, beginnt unter den Bewohnern der Insel, Eingeborenen wie Briten, der Kampf um gesellschaftlichen Erfolg. Ein turbulenter Jahrmarkt der Eitelkeiten hebt an, bei dem die bildhübsche, die Männer an sich fesselnde Herzogin von Fowey alle anderen aussticht. Eine freche Satire auf die «gute Gesellschaft» Englands voller Übermut, Herz, Witz und Charme.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Noël Coward
Palmen, Pomp und Paukenschlag
Aus dem Englischen von N. O. Scarpi
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Daß der Bühnenautor Noël Coward, bei dem Generationen junger Dramatiker in England und Amerika in die Lehre gingen, auch ein brillanter Romancier war, beweist sein hier vorliegender erster Roman. Samolo, eine imaginäre Insel im Pazifik, erwartet den Besuch von Königin Elizabeth und Prinz Philip. Noch bevor die hohen Gäste den Fuß an Land gesetzt haben, beginnt unter den Bewohnern der Insel, Eingeborenen wie Briten, der Kampf um gesellschaftlichen Erfolg. Ein turbulenter Jahrmarkt der Eitelkeiten hebt an, bei dem die bildhübsche, die Männer an sich fesselnde Herzogin von Fowey alle anderen aussticht. Eine freche Satire auf die «gute Gesellschaft» Englands voller Übermut, Herz, Witz und Charme.
Über Noël Coward
Noël Coward, der «englische Curt Goetz», wurde am 16. Dezember 1899 als Sohn eines kinderreichen Musikers in Teddington geboren. Schon als Kind zog es ihn unwiderstehlich zum Theater; er spielte mit zehn Jahren seine erste Bühnenrolle und wurde später Schauspieler, dann Theater- und Filmregisseur. Coward war der Meister des «Boulevard-Theaters», der mit seinen sozial- und gesellschaftskritischen Schauspielen, Komödien, Musikkomödien, Revuen, Operetten und Filmen vor allem unterhalten wollte. Er war der international erfolgreichste Autor des modernen englischen Theaters, und überall in der Welt rühmte man sein großes handwerkliches Können, seine technische Brillanz, seine geschliffenen Dialoge, seinen zynischen Witz, seine originelle Charakterisierungskunst. Aus der großen Zahl seiner Werke sind vor allem zu nennen: «Gefallene Engel» (1925), «Weekend» (1925), «Intimitäten» (1930), «Geisterkomödie» (1941), «Akt mit Geige» (1956) und das utopische Schauspiel «Peace in Our Time» (1947), in dem er Hitler England erobern läßt. Sir Noël Coward starb am 26. März 1973 auf Jamaika.
Inhaltsübersicht
NANCY MITFORD in Freundschaft zugeeignet
I
Es hat keinen Zweck, so zu tun, als wäre die Residenz des Gouverneurs architektonisch sehenswert, denn das ist nun einmal nicht der Fall; in ihrem Innern wirkt sie mit ihren freundlichen, luftigen Räumen und den tief eingebuchteten Veranden recht gemütlich, von außen aber ist sie eindeutig scheußlich. Von welcher Seite man sie auch betrachtet, sie erinnert an einen gigantischen lila Pudding. Sie wurde zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts gebaut, nachdem das alte Haus abgebrannt war, und kein Mensch weiß, warum man sie damals lila und seither immer wieder lila angestrichen hatte. Sie weist Kuppeln und Türme und Pfeiler und einige pseudoromanische Fenster auf, und darunter bilden eine Reihe mächtiger Steinwölbungen eine Art Katakombe. Diese Besonderheit ist als Zufluchtsort für die Hausbewohner zureichend begründet worden; dorthin ziehen sie sich zurück, wenn sie von göttlichen Launen, wie etwa Taifunen und Erdbeben, bedroht werden, obgleich ich nicht glauben kann, daß diese Freistatt bei einer Überschwemmung viel nützt. Als Lady Alexandra das Gebäude zum erstenmal aus seinem Opunzienhain grinsen sah, mußte sie derart lachen, daß ihr die Luft ausging und sie, als der Wagen vor dem Tor hielt, erst aussteigen konnte, nachdem man ihr ein Glas Wasser gebracht hatte. Lady A. ist heiter und charmant, und gegen Seine Exzellenz – Sir George Shotter – läßt sich nicht das geringste einwenden. Er sieht gut aus, ohne übertrieben vornehm zu wirken, ist von sympathischer Zuverlässigkeit, und in seinem Auge schimmert es lustig. An sich muß man ihn näher kennen, denn er ist zurückhaltend und besitzt nicht die fröhliche Extrovertiertheit seiner Frau; nimmt man sich aber die Mühe und stochert ein wenig tiefer, so gelangt man zu dem lustigen Schimmer und fühlt sich vertraut und heimisch.
Sie und ich sind übrigens alte Waffenkameraden, denn wir haben von Kriegsbeginn an beim Transport-Korps gedient, wurden auf dem Lowndes Square gedrillt, nannten unsere Vorgesetzten ‹Madam›, und später, als wir uns selber im Offiziersrang sahen und uns ein paar sehr schneidige Uniformen geleistet hatten, wurden wir auch mit ‹Madam› angesprochen und fuhren Lamettaköpfe zu und von Flugplätzen und Bahnhöfen und sonntags mit ihren Sekretärinnen nach Boulters Lock zum Essen.
Noch später, während der Schlacht um England, hatten wir grausigere Pflichten zu erfüllen, mußten die Zähne zusammenbeißen, mußten kaltblütig und tüchtig sein, wenn wir Menschen aus zerstörten Häusern holten und sie in die Lazarette schafften. Sandra war in jeder Beziehung großartig, und wir hatten viel Spaß miteinander; natürlich nicht, wenn wir die Menschen aus den Häusern holten, aber sonst. Damals hieß sie Lady Alexandra Haven und hatte noch nicht geheiratet, obgleich sie schon seit 1939 mit dem guten George ausging. Er stand als Politiker ziemlich links, war wütend über das Münchner Abkommen gewesen, und das hatte ihn mir gleich sympathisch gemacht.
Da sie auch mit anderen Verehrern ausging, glaubte damals kein Mensch, daß sie George heiraten würde, aber im Jahre 1943 tat sie es, und sie feierten recht ausgefallene Flitterwochen, als sie im Mittleren Osten von Ort zu Ort flitzten, um sein Regiment zu finden, das plötzlich verlegt worden war.
Unterdessen hatte sie natürlich den Dienst beim Transport-Korps aufgegeben und ich auch – mit großer Erleichterung, wie ich zugeben muß. Das alles war gut und schön zu Beginn, als glühender Patriotismus uns aufrecht hielt und wir uns gewissermaßen geweiht fühlten, doch nach kurzer Zeit ging uns die aufreizende Weiblichkeit der ganzen Einrichtung auf die Nerven. Ich weiß, daß das ein beschämendes Eingeständnis ist, für mich aber haben Frauen in Uniform immer etwas unbestimmt Komisches. Ich weiß wohl, daß der Hilfsdienst bei der Armee hervorragend war und der Hilfsdienst bei der Luftwaffe nicht minder, und gar der Hilfsdienst bei der Flotte war tapfer und tüchtig bis zum letzten Taljereep, aber wenn die Frauen marschieren und Exerzieren und ihre Busen im Takt wabbeln, so habe ich einfach Lust zu lachen. Das gehörte zu den Dingen, über die Sandra und ich uns wohl am meisten amüsierten. Ja, wir tun es noch jetzt, wenn wir Zeit zu einem Schwatz haben und jene merkwürdigen Tage aus der Vergangenheit zu uns zurückflattern.
Nun, heute ist sie die Gemahlin unseres Gouverneurs, und ich finde es furchtbar nett, sie hier zu haben, denn jetzt freut man sich darauf, in die Residenz zu gehen, und das war ganz gewiß nicht der Fall, so lange die armen Blaises hier lebten. Nicht daß sie nicht ungemein freundlich und wohlwollend gewesen wären und ihre Pflichten umgänglich und gewissenhaft erfüllt hätten, aber sie waren beide farblos und ein wenig vertrocknet, und es fehlte ihnen derart an Lebenskraft, daß man den Eindruck hatte, nach dem Fisch müßte Sauerstoff serviert werden. Die arme Lady Blaise litt, ohne zu klagen, an irgendeiner unklaren Krankheit, namens Dia- und noch etwas. Es war nicht -betes oder -rrhoe, was nach dem Dia kam, aber was es auch gewesen sein mochte, sie wurde dadurch nur noch farbloser und schien in ihrem eigenen, persönlichen Aquarium schlaff durch die Jahre zu schwimmen.
Er, Sir Hilary, entstieg geradewegs Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett; er war durch und durch blaß, seine Augen waren blaß, seine Haut war blaß, sein Haar war blaß, und wenn er Truppen inspizierte oder bei öffentlichen Anlässen auf einer Estrade stand, so sah er aus, als hätte man ihn aufgestellt und ein unsichtbarer Eisenstab im Rücken hielte ihn davon ab, auf die Nase zu fallen.
Nun ist alles anders geworden, Gott sei Dank, auch die Wandbespannungen und die Möbelbezüge. Das ganze Haus wirkt licht und luftig, was es vorher bestimmt nicht tat.
Nicht daß sich Sandra als Hausfrau besonders auszeichnete. Gelegentlich plant sie für das Essen großartige Neuerungen, und in Anfällen jäher Begeisterung läßt sie sich aus New York und Paris exotische Kochbücher schicken, doch wenn diese eintreffen, hat sie alles schon vergessen und knabbert an Aufläufen und Frikadellen, ohne es auch nur zu merken.
Was sie den verdorrten Knochen dieses pompösen, alten gotischen Mausoleums eingeflößt hat, ist Persönlichkeit.
Nichtsdestoweniger verzieht sie sich aus dem Haus, wann immer sie eine Gelegenheit findet, und kommt zu uns auf die Pflanzung, tritt sich die Schuhe von den Füßen und legt sich einfach hin. Die Kinder vergöttern Sandra, weil sie sie leichthin und als Erwachsene behandelt und nicht plötzlich mit einer süßlich duldsamen Stimme fragt, was sie werden wollen, wenn sie groß sind, und ob sie gern in die Schule gehen. Simon, der älteste, ist siebeneinhalb, und die Zwillinge, Janet und Cokey, sind sechs. Cokey heißt mit ihrem richtigen Namen Sarah-Ellen; eines Tages aber, als sie noch klein war und sie und Janet in ihrem Wagen im Garten lagen, fiel eine Kokosnuß, zum Glück eine kleine, vom Baum, verfehlte den Kopf des Kindes um Haaresbreite und verursachte eine böse Schramme an der Schulter. Obgleich die Kleine erschrak, schrie sie nicht und machte auch keine Szene, sondern streckte nur die Patschhand aus, klopfte vorwurfsvoll auf die Nuß und sagte: «Schlimme Cokey!» Und wenn dieser Spitzname nicht ein gräßliches Anhängsel aus der Säuglingsphase ist, dann weiß ich wirklich nicht, was sonst eines sein soll. Jedenfalls blieb ‹Cokey› an ihr haften, und damit hat diese ziemlich langweilige kleine Erklärung ein Ende.
An einem schwülen Nachmittag im März fuhr Sandra, unerwartet wie gewöhnlich, im Kombiwagen der Residenz vor. In einem grünen Leinenkleid wirkte sie frisch und entzückend, aber in ihrem Auge flimmerte es fiebrig. Ich lag auf der hinteren Veranda und versuchte, mich für einen jener zeitgenössischen, allzusehr in der Seele bohrenden Romane zu interessieren, von denen ich wohl wußte, daß ich sie lesen sollte, obgleich ich in Wahrheit gar keine Lust dazu hatte. Dieser Roman war von einem Hysteriker geschrieben, der, nach einer greulichen Kindheit in Frankfurt, Parteimitglied wurde und mit einer hochgestellten Revolutionärin namens Irma in die Ukraine ging. Sie hatte gerade Brauen, schwelende Augen und litt unter jähen Ausbrüchen einer tigerhaften Sinnlichkeit, in denen sie den Kopf des Verfassers an den Mund zog und unartikulierte Schreie hören ließ, während die freie Hand sich an den Knöpfen ihres Uniformrocks zu schaffen machte.
Just in dem Augenblick, da er, meiner Ansicht nach sehr vernünftigerweise, beschloß, dem Kommunismus zu entsagen, erschien Sandra.
Wie gewöhnlich stieß sie sich die Schuhe von den Füßen, warf sich auf die Hollywoodschaukel, die heftig knarrte, und rief:
«Gott sei Dank, daß du zu Hause bist. Ich hätt’s nicht ausgehalten, wenn du nicht dagewesen wärst!»
Ich fragte sie, ob sie einen Drink wolle, aber sie erwiderte, daß sie weder einen Drink noch Tee noch sonst was wolle, nichts, als flach liegen und in den Strom eines Weltbewußtseins tauchen, wo die Zeit zu existieren aufhöre, und wo sie selber ihre Gedanken auf nichts irgendwie Besonderes richten müsse. Das Mittagessen, fuhr sie fort, sei ein einziger Jammer gewesen, von den Avocatobirnen angefangen, über das Currygericht zu der Zitronentorte und dem Kaffee. Ein anglikanischer Bischof mit einem ohrenbetäubenden Husten sei dagewesen, ferner ein amerikanischer Senator mit seiner Frau und ein mächtiger Aluminiummagnat aus Pittsburgh. Zudem war Cuckoo Honey, die Frau des Kolonialsekretärs, völlig entfesselt, was nicht wenig besagen will, und hatte den amerikanischen Senator tödlich beleidigt, als sie ganz überflüssig eine Rede über die Negerfrage vom Stapel ließ, von der sie offenbar weniger als nichts wußte.
«Das Schreckliche an Cuckoo ist, daß sie ihre unsinnige Einbildung so gar nicht merkt.» Sandra streckte sich und stöhnte. «Sie hat sich selber in jeder Hinsicht genau geprüft, außerstande, einen Makel zu finden. Sie ist weder grausam noch ungütig noch übelwollend, aber von Zeit zu Zeit bringt sie es fertig, daß man sie für das alles hält. Sie platzt mit dem heraus, was ihr gerade durch den albernen Kopf wirbelt, ohne daß sie sich auch nur den Bruchteil einer Sekunde lang die Mühe nimmt, die Gefühle ihres Gegenübers zu berücksichtigen. Sogar ein betrunkenes dreijähriges Kind hätte begriffen, daß der Senator ein hartgesottener Südstaatler ist, gesäugt mit dem dort üblichen Gebräu aus Branntwein, Zucker, Eis und Krauseminze, ein Mann, den man in seiner Jugend, um ihm eine Geburtstagsfreude zu machen, zu einem Lynchgericht führte. Ausgerechnet ihn unter allen Sterblichen mußte sie sich ausersehen, um ihn mit ihrer ganzen verschwommenen, ungenauen Humanitätsduselei zu überschütten. Natürlich zitterte die Luft vor Peinlichkeit, der Senator lief violett an, und ich murmelte etwas Abgeschmacktes der Art, daß die Rassenfrage ein viel zu kompliziertes Thema für ein heiteres, ungezwungenes Mittagessen sei, das aber überhörte sie vollständig und sie stürzte sich in einen Dschungel von Klischees, und ihre Stimme wurde immer lauter und lauter, bis ich schließlich gezwungen war, ganz unvermittelt aufzuspringen, wie das Männchen aus der Schachtel, und sie und die Frau des Senators auf die Veranda zu führen, wo sie dann mit fest zusammengepreßten Lippen dasaßen und einander finster musterten.»
Sandra seufzte tief und suchte in ihrer Handtasche nach einer Zigarette. «Als sie endlich alle abgezogen waren und ich über Cuckoo hergefallen und sie unter Tränen verschwunden war, tauchte George auf, zitternd wie Espenlaub, und brachte mir mit Grabesstimme die große Neuigkeit bei!»
«Was meinst du damit?» fragte ich und warf ihr eine Schachtel Zündholzer zu.
«Es ist allerstrengstes Staatsgeheimnis.» Sie zündete sich die Zigarette an und warf mir die Schachtel zurück. «Er ließ mich schwören, es keiner lebenden Seele anzuvertrauen, nicht einmal dir, aber ich sagte, das sei blanker Unsinn und dir müsse ich immer alles sagen, und so gab er nach, aber unter der Bedingung, daß du dein großes Ehrenwort geben und versprechen sollst, die Klappe zu halten, bis es offiziell bekanntgegeben wird.»
«Was offiziell bekanntgegeben wird?»
«Daß sie im Juni hierherkommen.»
«Daß wer im Juni hierherkommt?»
«Die Königin natürlich», antwortete Sandra. «Und Prinz Philip. Sie kommen am 21. mit einem Kriegsschiff und bleiben drei Tage. Drei ganze Tage und drei ganze Nächte, und lange, lange vor diesen drei ganzen Tagen und Nächten werde ich in einer Zwangsjacke fortgeschleppt werden wie das arme Geschöpf in ‹Endstation Sehnsucht›.»
«Na», murmelte ich, ohne auf sie zu hören. «Das wird ja eine Aufregung geben!»
«Kannst du dir vorstellen», rief Sandra mit tragischer Miene, «was von jetzt bis zum Juni mit uns allen geschehen wird? Kannst du dir den Neid, das Gezänk, die Planungsausschüsse, die Festkomitees, das demütigende Wettrennen um Rang und Platz ausmalen, das jetzt losgeht? Ein wahrer Albtraum!»
«Es hat keinen Sinn, daß du dich in eine Wut hineinredest», sagte ich besänftigend. «Eine Menge von all dem wird vermutlich sehr lustig sein, und für die Insel ist es auf alle Fälle vorteilhaft. Die Samolaner werden schrecklich stolz und ergriffen sein.»
«Das weiß ich alles», sagte Sandra. «Ich weiß, daß es für die Insel und auch für die lieben Samolaner vorteilhaft ist. Auch für George ist es vorteilhaft, daß die Geschichte sich gerade während seiner Amtszeit abspielt; das weiß ich. Ich weiß auch, daß es für den samolanischen Fremdenverkehr einen unglaublichen Aufschwung bedeutet, und für alle Hotels wird es vorteilhaft sein, für die einheimischen Künstler und Handwerker, für die Studenten, für die Pfadfinder, für den Frauenverein. Nur eine einzige, einsame, zitternde Kreatur wird es nicht so vorteilhaft finden, und das ist leider die unselige Gattin des Gouverneurs, auf deren schwache, gebeugte Schultern die erdrückende Last des ganzen Betriebs niederfällt.»
«Nur Mut, Liebste», sagte ich. «Wahrscheinlich wirst du jede Minute genießen, wirst jedermann hin und her kommandieren und dich großartig amüsieren.»
«Ich hatte gehofft, bei dir Mitleid und Verständnis zu finden, ich hatte gehofft, du würdest mir in der Stunde der Prüfung beistehen, jetzt aber sehe ich, daß meine Hoffnungen auf Treibsand gebaut waren. Schon kann ich einen Schimmer von schrecklicher, vorstädtischer Fürstenvergötzung in deinem Auge entdecken. Wahrscheinlich wirst du schlimmer sein als sonstwer in der Kolonie, du wirst dich dauernd auf sie stürzen und auf und ab hopsen wie ein Kork!»
«Es hat keinen Zweck, mir Götzendienst vorzuwerfen, wenn’s um die königliche Familie geht», erwiderte ich. «So bin ich erzogen worden, und jetzt ist’s zu spät, mich zu ändern. Ich spüre schon, wie eine süße, sentimentale Schulmädchenaufregung in mir brodelt. Ich habe sogar schon, während deines Jammerns und Stöhnens, ein bezauberndes neues Abendkleid entworfen und mir überlegt, ob Jeannie noch Zeit hat, mein Diadem in London aus der Barclay-Bank zu holen und mir hierherzuschicken. Es ist ja in Wirklichkeit ein ziemlich düsteres kleines Ding, was mir meine Tante Cordelia vermacht hat, aber es besitzt eine gewisse muffige Vornehmheit.»
Sandra seufzte. «Jetzt hätte ich gegen eine Tasse Tee doch nichts einzuwenden.»
Ich läutete Tahali, dem Diener. Die Gemahlin des Gouverneurs hatte sich wieder flach auf den Rücken gestreckt und die Augen geschlossen; dann und wann senkte sie den linken Fuß und brachte ihre Liegestatt zum Schaukeln, die jedesmal klagend quietschte, und ich fragte mich, ob es denn kein Öl im Hause gebe, und wenn, ob ich imstande wäre, die Scharniere zu schmieren, ohne den losen Bezug zu verschmieren. Ich habe leider nie zu diesen kleinen häuslichen Arbeiten getaugt, die für das glatte Funktionieren eines behaglichen Heims wichtig sind, und in diesem behaglichen Heim ist immer irgendwo irgend etwas nicht in Ordnung. Gerade jetzt, da ich das schreibe, fehlen an Robins Duschevorhang zwei Ringe, was ich schon seit Wochen gerichtet haben müßte, und im Erdgeschoß bleibt der Sitz auf dem Anstandsort nicht aufgerichtet, wie er soll. Weibliche Besucher stört das natürlich nicht, für Männer aber ist es verzwickt, denn sie müssen eine unnatürliche seitliche Stellung einnehmen und den Sitz mit einem Knie obenhalten.
Offenbar läßt sich da nichts machen, ohne daß man den ganzen Krempel auseinandernimmt und wieder zusammensetzt, und das bedingt, daß man Mr. Pana-Oti, den Spengler, holen muß, wovor mir graut. Doch angesichts des bevorstehenden großen Ereignisses müßte jedenfalls vor dem Juni etwas Entscheidendes geschehen. Nicht daß ich erwartete, die königlichen Gäste würden viel Zeit in meinem unteren WC verbringen, aber man weiß doch nie, und Prinz Philip könnte auf seiner Fahrt zum Golfplatz eine Reifenpanne haben und irgendwer könnte sagen: ‹Sir, die Pflanzung von Craigies ist nur einen Steinwurf entfernt, und wenn Sie Wert auf einen guten Drink legen, sich waschen und ein wenig zurechtmachen wollen, so würde man sich bestimmt geehrt fühlen und wäre entzückt. Es sind furchtbar nette Leute, sie allerdings ein wenig sprunghaft …› Und dann würden alle hereinströmen und ich würde das schreckliche Aufschlagen hören und wäre für alle Zeiten blamiert.
Sandra öffnete ein Auge und warf mir einen Blick zu. «Du siehst so gequält drein. Woran denkst du?»
«An den Herzog von Edinburgh.»
«Das hätte ich wissen können», erwiderte sie ärgerlich und schloß das Auge wieder.
Tahali erschien mit dem Teetablett, das er sorgsam auf den geflochtenen Tisch stellte, ein Meisterwerk samolanischer Volkskunst, sehr reizend und ganz der Atmosphäre entsprechend, aber immer geneigt zu wackeln. Nachdem er das Tablett abgesetzt hatte, machte er vor Sandra eine prächtige Verbeugung und verzog sich ins Haus. Tahali ist ein Schatz und die Sonne meines Lebens. Als Robin mich nach unserer Heirat hierherbrachte, war Tahali sechzehn und eine Art Aushilfsbursche. Da er sich als außerordentlich tüchtig, angenehm und dekorativ erwies, ernannten wir ihn ein Jahr darauf zum Hausdiener, und in den letzten zwei Jahren war er Majordomus, Butler und Chauffeur in einer Person; er leitet den ganzen Haushalt, und ich könnte es keinen Tag ohne ihn schaffen. Er ist groß und schön und lebt, wie die meisten Samolaner, in dem glücklichen Zustand, von Sünde nichts zu wissen. Er hat eine Frau und drei Kinder in seinem Heimatdorf auf der anderen Seite der Insel, die er nur widerwillig zweimal im Jahr besucht, und einige vertraute Freundinnen und diverse andere Kinder hier, in Pendarla, die er häufiger besucht. Von Zeit zu Zeit läßt er sich gehen, betrinkt sich mit Kala-kala, taumelt in den frühen Morgenstunden heim und erscheint beim Frühstück trübäugig, katzenjämmerlich und in schrecklichem Zustand.
Bei solchen Gelegenheiten muß er entweder eine Strafpredigt Robins über sich ergehen lassen, worauf er in Tränen ausbricht, oder er wird von mir feierlich zurechtgewiesen, was gewöhnlich in fröhlichem, hemmungslosem Gelächter endet. Er weiß nämlich instinktiv, daß hinter meinen Worten kein Gramm Überzeugung steckt und daß es mir in meinem tiefsten Herzen völlig gleichgültig ist, ob er sich ab und zu sinnlos besäuft oder nicht, wenn es nur nicht allzuoft geschieht, seine Arbeit nicht beeinträchtigt und das übrige Personal nicht durcheinanderbringt.
Ich weiß genau, daß für eine ehrbare englische Hausfrau dieses laisser faire in Fragen der Moral höchst unpassend ist. Ich weiß auch, daß es meine Pflicht als gute Christin auf dieser Insel ist, die nur sehr oberflächlich einem fröhlichen Heidentum abgerungen wurde, das Übel auszutreiben, wo immer es sein häßliches Haupt erhebt, und meinen Untergebenen mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber zu solchen Dingen tauge ich nun einmal nicht, weil ich über das, was schlecht ist und was nicht, meine eigenen Ansichten habe.
Würde ich Tahali dabei erwischen, wie er ein Kind gräßlich verdrischt oder ein Tier absichtlich quält, dann prügelte ich ihn mit den bloßen Händen aus dem Haus; wenn er sich aber von Zeit zu Zeit betrinken oder mit einer seiner Freundinnen ins Bett hüpfen will, so kann ich keinen irdischen Grund sehen, warum er das nicht tun sollte, und ebensowenig einen überirdischen. Er ist ein junger Mann, sieht blendend aus, steckt voll Lebenskraft und wäre ein Esel, wenn er nicht jede fröhliche Gelegenheit ergriffe, die sich ihm bietet. Natürlich, wenn ich ihm anmerken sollte, daß er sich allen Ernstes aufs Trinken verlegt und zum ausgepichten Alkoholiker entwickelt, dann täte ich alles, was in meiner Macht steht, um dem ein Ende zu setzen, denn es würde sein gutes Aussehen verderben, seinen ganzen Charme vernichten, er würde verdummen und für sich selber und für alle anderen unbrauchbar werden. Doch es ist wenig wahrscheinlich, daß es so weit kommt, da die Samolaner nur selten Alkoholiker werden, ja, überhaupt auf keinem Gebiet zu Unmäßigkeiten neigen, wie wir Abendländer es in unserer Erhabenheit zu tun pflegen. Im Gegensatz zu uns sind sie nämlich nicht neurotisch. Es gibt keine Rauschgiftsüchtigen, kein Nymphomanen, keine Säufer, keine pathologischen Lustmörder auf Samolo. Eros treibt sein munteres Spiel, und das mit kindlich naiver Mißachtung der Grenzen der Geschlechter. In England wissen wir, daß kein kleines Mädchen hoffen darf, nach Einbruch der Dunkelheit unbehelligt über die Gemeindewiese von Wandsworth zu kommen, während es sich hierzulande über die ganze Länge und Breite der Insel durchplappern könnte, ohne daß ihm anderes zustieße, als von freundlichen Dorfbewohnern mit Guaven und Mangofrüchten vollgestopft zu werden und mit verdorbenem Magen heimzukehren.
Sandra setzte sich auf ihrer schaukelnden Liegestatt auf und strich sich das Haar zurecht. «Gegen dieses Knarren mußt du irgendwas tun. Es zerreißt einem das Trommelfell!»
«Ich weiß, mich macht es schon seit Monaten verrückt.»
«Das Ding müßte geschmiert werden.»
«Das weiß ich auch. Ich wollte es schon längst schmieren lassen, aber irgendwie komm ich nie dazu.»
«Wenn ihr Öl im Haus habt, mach ich das in zwei Minuten.»
«Du wirst nichts dergleichen tun!» erklärte ich. «Du würdest nur dich und dein Kleid verschmieren, und es hat keinen Sinn, mir mit deiner Lagerfeuer-Tüchtigkeit imponieren zu wollen. Beim Transport-Korps warst du schlimmer als ich.»
«Keine Spur!» Sie strich Butter auf ein Cassava-Brötchen und tat ein Häufchen Marmelade darauf. «Ich habe einmal in strömendem Regen auf der Umgehungsstraße bei Esher binnen zehn Minuten einen Reifen gewechselt. Der alte Knabe, den ich fuhr, war tief beeindruckt.»
«Hat er dir nicht seine Hilfe angeboten?»
«Natürlich hat er das, aber ich lehnte ab. Er war ohnehin schon sehr alt, funkelte nur so von Orden; und es wäre schrecklich unpassend gewesen, wenn jemand dazugekommen wäre und ihn, bis auf die Haut durchnäßt, mit mir auf dem Asphalt herumwirtschaften gesehen hätte. Zudem hätte er leicht einen Herzanfall kriegen können.»
«Zu welchem Behuf ließ er auf der Umgehungsstraße bei Esher seine Orden funkeln?»
«Das weiß ich nicht.» Sandra blickte zerstreut über die Schlucht nach den Hügeln auf der anderen Seite; die Bananenblätter schimmerten blaugrün im Sonnenlicht des späten Nachmittags. «Ich hatte ihn in Portsmouth abgeholt und sollte ihn zu irgendeiner Feier ins Hotel Dorchester bringen. Sind diese Bananen frisch gespritzt worden oder fehlt ihnen irgendwas? Sie sehen so seltsam blau aus.»
«Gespritzt», sagte ich. «Die ganze Ernte ist heute früh behandelt worden. Wären sie nicht wunderbar zu malen? Nur daß kein Mensch es glauben würde.»
«Darauf kommt es wohl nicht an. Sieh dir Gauguin an mit all seinen rosa Bergen und braunen Damen mit kurzen Beinen und ohne Knochen. Kein Mensch kann das eine Minute lang glaubhaft finden. Ach Gott», seufzte sie und begann die Schuhe anzuziehen. «Jetzt muß ich heim, und ich habe gar keine Lust dazu, so schön und friedlich ist es hier trotz diesem greulichen Knarren. Du schwörst, keiner lebenden Seele auch nur ein Sterbenswörtchen von der großen Neuigkeit zu verraten. Komm doch morgen zum Mittagessen hinüber, nach Tisch können wir in mein Zimmer gehen und mit den Listen anfangen.»
«Was für Listen?»
«Alle möglichen Listen», sagte sie energisch und stand auf. «Ich glaube nicht, daß morgen ein besonderes Schreckgespenst zum Mittagessen erscheint. Zum mindesten wirst du von Cuckoo verschont bleiben, denn ich habe nicht die Absicht, sie in den nächsten vierzehn Tagen zu irgendwas einzuladen; sie braucht eine ordentliche Lektion. Das schlimmste daran ist, daß es sie wirklich schwer treffen wird. Ist das nicht unglaublich? Ich an ihrer Stelle fände das nur angenehm.» Wir schlenderten durch das Haus auf die vordere Veranda hinaus. «Sie hat eine Vorliebe für alles Offizielle», fuhr Sandra fort. «Sie wickelt es um sich wie einen Pelzmantel und kuschelt sich hinein. Kannst du sie dir vorstellen, wenn der arme Edward endlich irgendwo Gouverneur wird? Wozu es ja eines Tages kommt. Sie wird sich wie der leibhaftige Teufel aufführen, die Leute rechts und links beleidigen und den Adjutanten zum Wahnsinn treiben; und alles mit den besten Absichten. Viel von dieser blutlosen folie de grandeur kommt wohl daher, daß sie in dem verdammten Bergnest in Indien geboren und aufgewachsen ist. Sie muß eine gräßliche Person gewesen sein, wenn sie in Reithosen dahergaloppierte und sich mit den feurigen Leutnants herumtrieb. Ach Gott!» Sie küßte mich zerstreut und stieg in den Kombiwagen.
«Du redest dich wieder in eine Wut hinein», meinte ich, «und das hat gar keinen Zweck und schlägt dir nur auf den Magen. Und jedenfalls hast du jetzt an erheblich wichtigere Dinge zu denken als an Cuckoo Honey.»
«Vielen Dank für die gütige Mahnung.» Sie lachte. «Punkt ein Uhr, und vielen Dank für die Cassava-Brötchen, die mich mindestens ein Kilo gekostet haben.» Sie winkte, wendete den Wagen unter dem Eukalyptusbaum und verschwand jenseits der Auffahrt.
Nachdenklich ging ich auf die hintere Veranda und goß mir noch eine Tasse Tee ein. Die Sonne stand knapp über dem Horizont, und Nanny, die mit dem Wagen fortgefahren war, um in der Stadt Besorgungen zu machen und die Kinder von der Schule abzuholen, konnte jede Minute wieder da sein. Es lohnte nicht mehr, irgendwas anzufangen, wie etwa das Kreuzworträtsel in der Times zu lösen oder die Hollywoodschaukel zu schmieren, und der Gedanke, zu jenem humorlosen Kommunisten und seinen geistlosen, schuldbewußten Auseinandersetzungen zurückzukehren, war mir gräßlich; so setzte ich mich einfach hin, zündete mir eine Zigarette an und betrachtete die Aussicht, die sich meistens zu dieser Stunde wie eine impressionistische Ausstellung darbot.
Von dieser hinteren Veranda sieht man nicht aufs Meer, sondern zunächst auf die Pflanzung, die zum Fluß am Grunde der Schlucht hin abfällt, und dann auf die violetten Felsen, auf das gefiederte Bambusgehölz, das den Hügel erklimmt, und dahinter noch auf andere Hügel, die sich gewellt in der Ferne verlieren, wo die hohen Spitzen der Lailanu-Berge wie blaue Finger in den bunten Himmel ragen.
II
Zur üblichen Stunde kam Nanny mit den Kindern, und der Abendfriede zersplitterte in tausend Stückchen. Die Kinder stürzten aus dem Wagen und rannten mit Kriegsgeheul ins Haus; Cokey purzelte im Nu auf den Boden, mußte aufgehoben und getröstet werden; auf Simons Stirn prangte eine Beule von der Größe eines Cricketballs, das Ergebnis eines Kampfes mit Dickie Chalmers, der ihn mit einem Lineal geschlagen hatte. Plötzlich rasten auch die Hunde von der Küche herbei, bellten begeistert, sprangen jedermann an und warfen ein Tischchen mit einer verdrossenen Fotografie von Robins Schwester um; das nahm ich nicht weiter übel, denn das Bild reizte mich, sooft ich es sah. Nicht daß ich Helen nicht leiden mochte; bei den wenigen unumgänglichen Gelegenheiten kamen wir ausgezeichnet miteinander aus, aber sie hat etwas sehr Strenges an sich und erweckt immer den Eindruck, als beschuldigte sie mich, etwas Unrechtes zu tun. Sie wohnt in einem kalten grauen Haus in Pertshire, das mit Geweihen und ausgestopften Hechten angefüllt ist, und ich lebe in der ständigen Angst, sie und Hamish könnten plötzlich beschließen, zu uns zu kommen und bei uns zu bleiben.
Nachdem der Hexensabbat verrauscht und Kinder und Hunde glücklich im Garten verschwunden waren, setzte sich Nanny nicht ohne Absicht auf der Veranda nieder. Sie hatte den Hut abgenommen, das Haar zurechtgezupft und schien zu einem netten kleinen Schwatz aufgelegt. Nanny bedarf wohl einer kurzen Erklärung: zunächst ist sie keine ‹Nanny› im üblichen Sinn des Wortes, das eine Kinderpflegerin bezeichnet. Ihr richtiger Name ist Vera Longman, und sie kam nach Samolo mit ihrer Mutter, die anscheinend ein Scheusal ersten Ranges war, eine jener Bridge spielenden, herumziehenden englischen Witwen, die mit ihrem kleinen Einkommen durch die Welt gondeln, die Luft von Cheltenham mit seinen pensionierten Beamten hinter sich herschleppen und mit den Hoteldirektoren Streit anfangen. Nun, sie starb 1950 im Beach Grove-Gästehaus an einem Herzanfall und ließ die unglückselige Vera, die sich ihr völlig aufgeopfert hatte, ohne einen Penny zurück. Alle waren rührend nett und hilfsbereit, Lady Blaise schuf eine Stiftung, zu der wir alle anonym beitrugen, damit Vera sich nicht gedemütigt fühlen sollte, wenn sie uns in Gesellschaft traf, und Siggy Rubia verschaffte ihr für die Wintersaison eine Stelle im Reisebüro des Royal Samolan. In dieser Atempause konnte sie sich nach etwas anderem umsehen.
Vor zwei Jahren kam sie zu uns, weil sie sagte, sie verstehe sich gut mit Kindern, und alles in allem ist sie tatsächlich ein großer Erfolg. Sie versteht es wirklich gut mit Kindern, sie ist energisch, vernünftig und recht nett, und wenn ich auch nicht behaupten kann, daß die Kinder in sie vernarrt seien, finden sie sich doch philosophisch mit ihr ab und tun in der Regel, was sie ihnen sagt.
Robin kann sie nicht ausstehen; ihr unausrottbares feines Getue reizt ihn, und er behauptet, sie gehe durchs Leben mit der Sehnsucht, beleidigt zu werden. Ich selber mag sie auf eine unergiebige Art recht gern, aber sie läßt sich auf keine Vertraulichkeit ein, und obgleich ich gelegentlich versucht habe, ihre gußeiserne Korrektheit zu durchdringen, ist es mir nie recht gelungen. In gefühlvolleren Stunden möchte ich glauben, daß diese Starrheit die Folge einer katastrophalen Liebesgeschichte ist und daß sie eines Tages den Mann ihrer Träume treffen und aufblühen wird wie eine Rose, doch allzu große Hoffnungen mache ich mir nicht. Ihr Wesen ist von ihrer gräßlichen alten Mutter ein für allemal aus der Form gequetscht worden, und selbst wenn sie den Mann ihrer Träume findet, was ich sehr bezweifle, wird ihr helles, zimperliches kleines Lachen und ihr unvergleichliches Talent für Gemeinplätze ihn wahrscheinlich davonscheuchen, bevor er auch nur den ersten Schritt getan hat.
Ich bot ihr eine Tasse Tee an, aber sie sagte, sie habe schon mit Mrs. Turling Tee getrunken, die sie im Laden bei Rodrigues traf, wo Mrs. Turling weiße Leinenservietten kaufte, die sie mit Blumen bemalen wollte. Mrs. Turling gehört zu unseren lokalen Einrichtungen. Sie und der Admiral leben schon seit Jahren hier und sind ungemein beliebt. Er ist knallrot im Gesicht und eine anerkannte Autorität in allen Wetterfragen, sie ist blaß und reizend und unermüdlich; nie läßt sie ab zu malen, zu nähen, zu häkeln und niedliche Geschenke für Wohltätigkeitsbasare zu ersinnen. Er spricht von ihr nur als von der ‹Prinzessin›, und sie sind alle beide schon reichlich über siebzig.
«Mrs. Turling hat mir etwas sehr Interessantes erzählt», sagte Nanny, senkte die Stimme und beugte sich vor, als vermute sie in der Hibiskusvase ein verstecktes Mikrophon. «Es mag auch bloß eines der üblichen Gerüchte sein, doch der Admiral hat es offenbar im Club gehört und ist sehr aufgeregt heimgekommen.»
«Was für ein Gerücht?»
«Ich weiß, ich sollte es Ihnen nicht sagen, denn sie hat mich strengste Verschwiegenheit schwören lassen, aber ich kann’s einfach nicht bei mir behalten.» Nanny ließ ihr Kichern hören, mit dem sie Robin verrückt macht, und schaute verstohlen über ihre Schulter.
«Nun los, Nanny!» Ich beugte mich auch vor, so daß unsere Köpfe nur einen halben Meter voneinander entfernt waren. «Sie wissen, wie gern ich einen ordentlichen Inseltratsch höre!»
«Es ist nicht eigentlich ein Tratsch; dazu ist es viel zu wichtig. Ich meine – es ist etwas wirklich schrecklich Aufregendes; das heißt – wenn es wahr ist.»
Nanny beugte sich noch weiter vor, bis ich fürchtete, sie könnte mir in den Schoß fallen. Natürlich hatte ich unterdessen schon vermutet, was sie mir verraten würde, es wäre aber grausam gewesen, ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen, und so stieß ich nur einen leisen Seufzer höchster Spannung aus. «Nur zu, nur zu», flüsterte ich atemlos. «Reden Sie doch! Ich sitze auf Kohlen!»
«Die Königin!» sagte sie triumphierend. «Die Königin und Prinz Philip kommen im Juni zu einem offiziellen Besuch hierher!»
Ich sank wie betäubt zurück und starrte sie mit schmeichelhafter Ungläubigkeit an. «Nein!» sagte ich. «Das kann nicht wahr sein!»
«Der Admiral hält es anscheinend doch für wahr. Er sagt, der ganze Club spreche schon davon.»
«Warum ist dann nichts in den Zeitungen gewesen?»
«Es muß streng geheim bleiben. Bis alles auf das peinlichste geregelt ist. Das wenigstens hat Mrs. Turling gesagt. Aber es wird herrlich sein, nicht? Ich meine, wenn es wahr ist. Stellen Sie sich nur vor, was die Samolaner anstellen werden, wenn sie unsere entzückende junge Königin und ihren bildschönen Gemahl sehen. Ich meine, es wird in jeder Hinsicht vorteilhaft sein, gewissermaßen eine Erinnerung an die Heimat, an das Mutterland, ein Zeichen dafür, daß wir alle einer einzigen großen Familie angehören. Mrs. Turling meinte, sie wäre gar nicht überrascht, wenn dies bei den Wahlen viel ausmachen und der Samolaner Sozialistischen Nationalpartei eine schwere Niederlage eintragen würde. Schließlich gibt es doch nichts Wichtigeres als den persönlichen Kontakt. Ich meine, die bloße Tatsache, daß die Eingeborenen die Königin mit eigenen Augen sehen, muß doch eine ungeheure Wirkung haben. Finden Sie nicht auch?»
«Es ist ein Jammer», sagte ich, denn die Begeisterung schlug mir zu hohe Wellen, «es ist ein Jammer, daß sie beschlossen haben, ausgerechnet mitten in der Regenzeit zu kommen.»
«Das wird Ihrer Majestät nichts ausmachen», erklärte Nanny unbekümmert. «In England muß sie ständig alle möglichen Dinge bei strömendem Regen tun, und sie achtet überhaupt nicht darauf. Erst unlängst war ein Bild von ihr in der Zeitung; da stand sie irgendwo bei einem Pferderennen lächelnd in einem Meer von Regenschirmen. Zudem ist’s hier selbst in der Regenzeit nur wenige Stunden am Tag wirklich schlimm. Ich meine, es ist nicht wie in England, wo es überhaupt nicht aufhört.»
In diesem Augenblick wurden wir von Tahali unterbrochen, der das Teetablett holte. Nanny schob schuldbewußt den Stuhl zurück, als wären wir bei irgendwas Abscheulichem ertappt worden, und ließ mit einer ihrer Meinung nach phantastischen Geistesgegenwart eine matte Tirade gegen das Verkehrschaos in der Stadt vom Stapel.
«Und die Polizisten sind ganz hoffnungslos», sagte sie. «Mit einer Hand treiben sie einen an und mit der anderen halten sie einen zurück.»
«Das ist, im Kleinen, das Leben», bemerkte ich zerstreut.
«Wie meinen Sie das?» Nanny blieb mitten in ihrem Höhenflug stecken und sah mich verdutzt an.
«Nun», murmelte ich unbehaglich und versuchte meine Gedanken zu sammeln, die zurück zu Tante Cordelias Diadem gewandert waren, «das ist doch eine der lästigsten Seiten in einer demokratischen Ordnung. Nicht?»
Tahali, der vermutlich wußte, daß ich das alles improvisierte, warf mir einen schnellen Blick zu, der beinahe ein verständnisvolles Zwinkern war, und verschwand mit dem Tablett.
«Was ist es?» wollte Nanny unbedingt wissen, und ihre blasse Stirn kräuselte sich.
«Diese dumme Sache, daß man einmal ermutigt wird, etwas zu tun, und im nächsten Augenblick daran gehindert. Wie beim Kauf eines neuen Wagens», setzte ich ziemlich sinnlos hinzu.
«Aber Sie haben doch keinen neuen Wagen gekauft?»
«Natürlich nicht. Ich habe das bloß als Beispiel verwendet. Wir werden die ganze Zeit dazu aufgemuntert, einen neuen Wagen zu kaufen, weil das der Automobilindustrie guttut und vielen Leuten Arbeit gibt, und jeder neue Wagen ist so konstruiert, daß er schneller fährt als der alte, und da saust man triumphierend los und wird an der ersten Straßenecke wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten.»
«Ich fürchte, das verstehe ich immer noch nicht ganz.»
«Macht nichts», sagte ich verzweifelt. «Es ist völlig belanglos. Aber Sie hatten von den Polizisten gesprochen, die einem mit der einen Hand winken und mit der anderen bremsen, und ich hatte darauf gesagt, das sei das Leben im Kleinen, was wirklich nicht viel bedeutete und mir nur so herausgeschlüpft war; und da fragten Sie mich nicht ohne Berechtigung, was ich eigentlich meinte, und ich mußte irgendwas erfinden, um es zu rechtfertigen.»
«Was zu rechtfertigen?»
«Das von dem Leben im Kleinen.» Ich lehnte mich zurück und schloß die Augen.
«Sie sind manchmal wirklich komisch, Mrs. Craigie. Ja, das sind Sie!» Nanny wieherte kurz. «Ich weiß nie, was Sie im nächsten Augenblick sagen werden.»
«Ich auch nicht.» Noch immer hielt ich die Augen geschlossen.
«Sie haben doch nicht etwa Kopfschmerzen?»
Die Besorgnis in ihrer Stimme zwang mich, die Lider zu heben. Sie war aufgestanden und sah mich ängstlich an, den Kopf zur Seite geneigt, als versuchte sie, in einem Zug die Zeitung des Nachbarn zu lesen.
«Ja», sagte ich, «ich habe wirklich ein wenig Kopfschmerzen. Es war ein drückender Nachmittag, und dummerweise trank ich vor dem Mittagessen etwas Sherry. Das schlägt mir immer auf die Leber.»
«Das tut mir so leid! Kann ich Ihnen irgendwie helfen?»
«Nein, wirklich nicht. Wenn Sie jetzt nach den Kindern sehen würden, gehe ich hinauf, schlucke zwei Aspirin und nehme ein Bad.»
«Gut. Ich überlasse Sie Ihrem Schicksal.» Sie ging die Stufen zum Garten hinunter, blieb stehen, drehte sich um. «Aber Sie sagen keinem Menschen, was ich Ihnen erzählt habe! Ich mußte Mrs. Turling strengste Verschwiegenheit schwören.»
«Ehrenwort –» versprach ich ihr, und sie schritt über das Gras, als wäre sie einer Novelle von Katherine Mansfield entsprungen.
III
Ich ging hinauf, schluckte zwei Aspirin, und erst dann fiel mir ein, daß ich ja gar keine Kopfschmerzen hatte, sondern daß das nur eine Ausrede gewesen war, um Nanny loszuwerden. Dann setzte ich mich verzagt aufs Bett, sah mich im Zimmer um und stellte zum hundertstenmal fest, daß ich die ganze Einrichtung satt hatte, daß die Zeit gekommen war, das Zimmer frisch zu streichen, andere Möbel zu kaufen, kurz, alles völlig zu verwandeln. Ich wußte, daß Robin stampfen würde wie ein Stier, denn er ist ein Gewohnheitstier und liebt es, wenn die Dinge in schönster Ordnung und unverändert und behaglich vertraut sind. Ich dagegen, ich bin nicht so, ganz und gar nicht; und wenn alles zu lange bleibt, kriege ich Platzangst. Ich bin wie von unvernünftigen Teufeln besessen und meinem Wesen nach dagegen allergisch, es beim Guten bewenden zu lassen. Einmal, als ich noch sehr jung war, quetschte ich meinen alten Strohhut so lange zurecht, bis er die Form eines Bootes hatte, und setzte ihn verkehrt auf. Das gab ein schreckliches Drama, ich bekam einen Klaps und durfte nicht zu den Verekers zum Tee gehen.
Eigentlich war gegen unser Schlafzimmer gar nichts einzuwenden. Es war hell und freundlich und ganz anspruchslos, aber Maisie Coffrington hatte mir einige von jenen prächtigen amerikanischen Magazinen in die Hand gedrückt, die sich hauptsächlich mit Inneneinrichtung beschäftigen und eine Fülle buntfarbiger Illustrationen bieten von Patios in Kalifornien, entzückenden Wohnräumen in Florida und klobig-luxuriösen Blockhäusern in den Adirondacks mit viel Naturstein, feuerroten Teppichen, mächtigen rechtwinkligen Lehnstühlen, und wo man hinschaut Bratroste. Nicht, daß ich derlei Zeug in unserem Schlafzimmer haben wollte, aber ich spielte doch mit dem Gedanken an flaschengrüne Wände, an einen riesigen weißen Teppich und an zwei flotte zweckentsprechende Nachttische, eine Spezialkonstruktion mit Platz für dieses und jenes. Ich gebe zu, mein Mut verging bei der Vorstellung, daß ich Tali-Lapa, unseren Ortsschreiner, bitten müßte, zwei solche Nachttische zu zimmern. Die samolanischen Handwerker sind samt und sonders fleißig und begeisterungsfähig, aber sie haben absolut kein Augenmaß und sind von Natur aus nicht imstande, zwei vollkommen gleiche Stücke anzufertigen.
Ich entsagte zunächst den zweckentsprechenden Nachttischen, den flaschengrünen Wänden, dem weißen Teppich und beschäftigte mich damit, alles in zartes Muschelrosa zu tauchen, mit rauchgrauen Vorhängen und vielleicht irgendwo einem Hauch von Apfelgrün, als Eulalia mit der Nachmittagspost hereinkam. Eulalia ist ausgesprochen schön und reinster Gauguin, nur daß sie keine kurzen Beine hat – sie hat sehr lange, langsam wandelnde Beine. Alles an ihr ist langsam und schlaff. Manchmal habe ich sie beobachtet, wenn sie die Veranda aufräumte, und jedesmal staunte ich darüber, daß jemand etwas so langsam machen konnte, ohne in tiefen Schlaf zu versinken. Sie bewegt sich von einem Ding zum anderen wie eine müde Odaliske nach einem ungewöhnlich erschöpfenden Abend mit jungen Leuten. Dann und wann hält sie völlig inne, bleibt still stehen und schaut vor sich hin. Täte sie das, weil sie plötzlich von der Aussicht überwältigt wird oder weil sie im Garten etwas Besonderes gesehen hat, so wäre das noch verständlich; aber sie tut es häufig vor einer kahlen Wand.
Nachdem sie die Schale mit den Briefen in meine Reichweite gesenkt hatte, wartete sie abgekehrt, bis ich nach den Briefen griff, und dann schlängelte sie sich mit schmachtendem Lächeln aus dem Zimmer.
Es waren drei Nummern von Time and Tide, zwei Nummern des Punch, ein paar Rechnungen und Prospekte und ein Brief von meiner Mutter. Die vertraute, wie gestochene Schrift zu sehen, gibt mir immer einen leisen Stoß, halb Freude, halb Besorgnis; sie ist weit über siebzig, und ich fürchte immer die Nachricht, daß die Ärzte irgendwo eine unheimliche Geschwulst entdeckt haben oder daß sie gefallen ist und sich etwas gebrochen hat. Ich weiß, daß Damen von einem bestimmten Alter an dazu neigen hinzufallen, und obgleich Jeannie ihr nie von der Seite weicht und sich hingebungsvoll um sie kümmert, bleibt das eine stete Sorge. Diesmal waren meine Ängste jedoch unbegründet, denn sie schien in prickelnder Laune und voll von bissigem Humor.
Liebste Grizel!
Vor zwei Tagen habe ich einen Brief von Dir erhalten, datiert vom 7. Dezember, was bedeutet, daß er über einen Monat gebraucht hat, um mich zu erreichen. Ich kann das mit dem besten Willen nicht verstehen, es sei denn, daß Du ihn ewig lang bei Dir herumgetragen und vergessen hast, ihn aufzugeben. Wenn nicht, solltest Du Dich bei Eurer Post beschweren, und ich werde Jeannie beauftragen, hier bei uns zu reklamieren. Das alles ist sehr unangenehm, und ich hatte schon angefangen, mir Sorgen zu machen.
Besondere Neuigkeiten gibt es nicht, höchstens daß die Älteste von Bletchleys wieder einmal durchgebrannt ist, diesmal ausgerechnet mit einem der jungen Männer vom British Council, die herumreisen und in Skandinavien und Belgien und anderen lächerlichen Gegenden Kunstausstellungen veranstalten. Die arme Lilian Bletchley ist, wie Du Dir denken kannst, in einem furchtbaren Zustand. Letzten Dienstag war sie zum Mittagessen bei mir und hat ausgesehen wie eine Wahnsinnige; Jeannie mußte ihr einen Eierpunsch brauen. Sie tut mir natürlich leid, aber im Grunde ist sie ganz allein schuld, weil sie diese schrecklichen Mädchen von Anfang an unmöglich erzogen hat. Nichts war gut genug für sie. Sie sind maßlos verhätschelt worden, und das ist der Erfolg! Nichts als Zänkereien und gerichtliche Trennungen und ordinäre Prozesse wegen Geldgeschichten. Und jetzt noch das! Ich glaubte immer, Jill, die jüngste, sei vernünftiger als die anderen drei zusammen, aber jetzt stellt sich heraus, daß sie auch über die Stränge schlägt und mit einem verheirateten Mann in Aix-en-Provence lebt. Die Leute benehmen sich heutzutage wirklich sehr merkwürdig. Jeannie sagt, das sei die Folge des Krieges, aber ich meine, daß es nichts ist als reiner Egoismus.
Sonst wüßte ich nichts, was Dich interessieren könnte. Ich war mit der armen Grace Felstead – John ist in der Klinik – in der Nachmittagsvorstellung von einem dieser amerikanischen Musicals, und, meine Liebe, wir sind völlig taub geworden. Das Frauenzimmer, das die Hauptrolle spielte, war sehr häßlich und hatte eine Stimme wie eine Wiesenknarre, und sie sang dasselbe Lied immer wieder, bis ich sie am liebsten erdrosselt hätte. Unsere Köpfe waren am Zerspringen, als wir herauskamen, und statt bei Gunter Tee zu trinken, habe ich Grace beim Ladies Empire Club abgesetzt und bin geradewegs heimgefahren und ins Bett gegangen. Grüß bitte Robin und die süßen Kinderchen. Wie gern möchte ich einen Blick auf sie werfen! Die Fotos, die Du geschickt hast, sind reizend, obgleich das eine, das, wo Du auf den Stufen stehst, mich ein wenig beunruhigt – Du siehst schrecklich blaß und müde aus. Hoffentlich treibst Du Dich nicht zuviel herum. Aber jetzt muß ich wirklich schließen, weil Jeannie wartet, um den Brief in den Kasten zu werfen. Gib acht auf Dich, mein Liebling.
Deine Dich liebende Mutter
PS. Wie herrlich, daß die Königin und Prinz Philip im Juni nach Samolo kommen! Da wird sich was tun!
Ich schob den Brief wieder in den Umschlag und trat auf unseren kleinen Balkon hinaus. Es war beinahe dunkel, im Ort flammten die Lichter auf, und in der Hibiskushecke glitzerten die Leuchtkäfer. Mutters Briefe machten mich immer ein wenig traurig; nicht daß es eine ernste Trauer gewesen wäre, aber eine gewisse leise Sehnsucht mit Heimweh und der Erinnerung an vergangene Dinge und dem Gefühl, daß der Flügelwagen der Zeit doch allzu schnell weiterrasselte und uns alle dem Alter, dem Rheuma und dem stillen Grab entgegenführte.
Ich sah Mutter deutlich in ihrer gemütlichen kleinen Wohnung am Eaton Square, wie sie am Fenster saß und durch die Bäume den Lichtern der Wagen nachschaute; vielleicht schaute sie auch über die langen Jahre hinweg auf die Zeit, da sie jung und hübsch gewesen war, da die Zukunft grenzenlos, von Verheißungen schimmernd vor ihr gelegen und nichts auf die verlöschende Dämmerung hingedeutet hatte. Und jetzt waren sechzig Jahre vorbei, um sie senkte sich die Dämmerung, mit jedem hastenden Tag ein wenig dunkler, bis bald, sehr bald nichts mehr übrigblieb und ihre Geschichte aus und vorüber war.
Ich wußte, daß Mutter, anders als ich, noch immer zäh an einigen wenigen religiösen Überzeugungen festhielt. Sie war weit davon entfernt, eine frömmelnde, hundertprozentige, gläubige Kirchgängerin zu sein; was man ihr aber als Kind fest eingeprägt hatte, lag griffbereit, wenn sich ein Bedürfnis danach einstellen sollte. Ich bin überzeugt, daß der Tod keine Schrecken für sie hatte. War sie von Natur aus mutig oder hielt sie in den geheimen Schlupfwinkeln ihres Herzens die Bilder eines Lebens im Jenseits aufrecht, wo sie alle ihre alten Freunde wiedersehen und bis in alle Ewigkeit in einem gemütlichen, erbarmungsvollen Vakuum leben würde? Ich weiß es nicht und hänge selber nicht an so fragwürdigen Hoffnungen. Meine sehr genauen Ansichten von einem Leben nach dem Tode sind fast durchweg auf der Soll-Seite. Ich finde es schon schwierig genug, in dieser kurzen Lebensspanne mit alten Freunden auszukommen, die, völlig verändert, plötzlich aus der Vergangenheit auftauchen und erwarten, daß unsere Beziehungen, ohne Rücksicht auf die dazwischenliegenden Jahre, dort wieder aufgenommen werden, wo sie abgebrochen worden waren. Der Gedanke, daß ich gleich nach meinem letzten Seufzer mit Sack und Pack in irgendeine namenlose himmlische Sphäre befördert und zwischen einer Schar alter Bekannter abgesetzt werden soll, an die ich seit Jahren nicht mehr gedacht habe, erfüllt mich mit Bestürzung. Aber ich glaube, daß ich, wenn die Zeit für mich gekommen ist – vorausgesetzt, daß ich nicht mit dem Flugzeug abstürze oder ertrinke oder sonst bei einem Unglücksfall abgeschrieben werden muß –, durchaus bereit und ergeben sein werde. Ich sehe mich sogar mit einem gewissen wehmütigen Vergnügen als sehr alte Dame und will dann versuchen, nach Möglichkeit meine Umwelt nicht zu belästigen, obgleich ich bestimmt dann und wann ein wenig bissig werde, sei es auch nur, um im Spiel zu bleiben. Ich bin hoffentlich weniger zapplig als jetzt. Gelassen und elfenbeinfarben will ich in einem stillen Zimmer sitzen und mit einem leicht zitternden Begrüßungslächeln die Besuche meiner Enkel und vielleicht sogar Urenkel erwarten. Wenn sie dann wieder fort sind, und wenn das Zimmer, ihrer Jugend, ihrer Lebenslust, ihrer Fröhlichkeit beraubt, in seine gewohnte Dämmerstimmung zurücksinkt, dann möchte ich sachte die Geschenke auspacken, die sie mir gebracht haben, denn ich hoffe aufrichtig, daß sie mich nur selten mit leeren Händen besuchen, und duldsam lächelnd werde ich den Kopf schütteln, ein ganz gewöhnliches Kopfschütteln, das nichts mit der Parkinsonschen Krankheit zu tun hat, und in mein Bett schlüpfen und warten, einfach warten, ohne Erregung, ohne Angst, bis der große Schnitter auch mich dahingerafft hat. Natürlich ist es mir durchaus klar, daß alles sich auch anders abspielen kann. Vielleicht werde ich ein zänkisches altes Ungeheuer, taub wie ein Laternenpfahl, von Blähungen und anderen Widrigkeiten geplagt, oder ich könnte auch, verbittert, einsam und widerspenstig, in einer greulichen Pension in Folkestone landen. Das alles weiß man nun einmal nicht, und es hat keinen Zweck, sich Sorgen darüber zu machen oder Pläne zu schmieden. Man muß sich damit abfinden, wenn es soweit ist, und die gebeugten, schwachen Schultern straffen und so gut wie möglich seine Würde zu wahren suchen.
Ich ging vom Balkon ins Haus, knipste die Lichter an und betrachtete mit ziemlich düsteren Blicken die Kleider, die in meinem Schrank hingen. Robin und ich sollten mit Bimbo und Lucy Chalmers zu Abend essen, und ich konnte unmöglich wieder das bequeme Schwarze anziehen, das ich getragen hatte, als sie vorige Woche bei uns gewesen und als wir mit ihnen zur Eröffnung des neuen Super-Kinos in der Madana Road gegangen waren. Damals schätzte ich es, weil es nicht gleich zerknittert wie das blaue Victor-Stiebel-Modell; die Fauteuils im Super-Kino sind wie tiefe Badewannen aus Plüsch und man muß sich praktisch hineinlegen.
Schließlich nahm ich mein graues ‹Einfaches› vom Bügel und legte es auf das Bett. Es verpflichtet zu nichts, hat eine gute Linie, und obgleich Robin sagt, ich sähe darin aus wie eine Gefängniswärterin, habe ich es gern. Während ich das gute Stück lustlos anzog und mir im Herzen wünschte, ein hinreißender Filmstar zu sein mit einem Schrank voll berückender Kleider für jeden Augenblick des Tages, kam Robin in Gedanken versunken herein, in der Hand einen Whisky-Soda.
«Der verdammte kleine Dickie Chalmers hat Simon mit einem Lineal geschlagen.»
«Ja, ich weiß.»
«Er hat jetzt eine schreckliche Beule auf der Stirn!»
«Das weiß ich auch», sagte ich, «Simon schien ganz stolz darauf zu sein.»
«Er ist zwei Jahre älter und viel größer als Simon. Ich hätte Lust, ihn tüchtig zu verprügeln.»
«Warum tust du’s nicht?» fragte ich. «Wenn wir uns beeilen, können wir in einer Dreiviertelstunde bei Chalmers’ sein, und dann gehst du einfach ins Kinderzimmer hinauf und schlägst ihn grün und blau, während ich versuche, Lucy und Bimbo auf dem Patio bei guter Laune zu halten. Sie werden wahrscheinlich nicht über alle Maßen entzückt sein, und vielleicht ist es kein sehr freundlicher Anfang für den Abend, wenn dir aber so sehr daran liegt …»
«Ich muß mich wirklich über dich wundem.» Robin blickte mich vorwurfsvoll an. «Ich hätte gedacht, wenn dein eigener Sohn mißhandelt und gequält wird, könntest du ein wenig natürlichen Groll empfinden.»
«Sei doch nicht töricht, Schatz. Er ist in Wirklichkeit gar nicht so sehr mißhandelt und gequält worden. Er hat sich in eine Rauferei eingelassen, und Dickie hat ihm mit dem Lineal eins versetzt. Einer ist so viel wert wie der andere. Simon rauft eben dauernd, und das hast du in seinem Alter wahrscheinlich auch getan; ihr habt alle beide eine kampflustige Ader.»
«Ich bin keineswegs kampflustig. Ich bin nur für Fairness, und ich halte es nicht für fair, wenn ein Riesenbengel wie Dickie ein halb so großes Kind mit einem Lineal anfällt. Warum hat er nicht seine Fäuste gebraucht?»
«Ich sehe nicht ein, warum das viel besser gewesen wäre; er hätte ihm die Zähne ausschlagen können.»
In diesem Augenblick läutete das Telefon. Wortlos griff Robin nach dem Hörer und reichte ihn mir. Ich nahm ihn und setzte mich aufs Bett. Es war Lucy Chalmers, und ihre Stimme klang ein wenig gezwungen. «Hör, Liebste», sagte sie, «wir erleben ein kleines Drama, und ich dachte, ich müßte dich doch verständigen, bevor du mit Robin herüberkommst. Bimbo badet gerade, aber er wird jede Minute fertig sein, und so habe ich nicht viel Zeit. Wo ist Robin?»
«Hier», erwiderte ich. «Etwa einen Meter von mir entfernt und gerade im Begriff, sich auf mein graues Kleid zu setzen.»
Robin warf mir einen unheilverkündenden Blick zu und verzog sich auf den Balkon.
«Ich werde leise reden», fuhr Lucy fort, «und du kannst antworten, wie du es für richtig hältst, ohne dabei etwas zu verraten.»
«Was, um Himmels willen, ist denn geschehen?»
«Es handelt sich leider um euren Stolz, um euren Augapfel! Er hat sich wirklich furchtbar aufgeführt. Er und Dickie sind heute in der Mittagspause aneinandergeraten. Es hat anscheinend ganz harmlos damit angefangen, daß sie sich mit Plastilinkugeln bewarfen, dann aber artete es aus, und Simon ist auf Dickie losgestürzt wie ein wildgewordener Bock und hat ihn von der Bank hinuntergestoßen –»
«Bevor Dickie ihn mit dem Lineal geschlagen hat oder nachher?» fragte ich kühl.
«Vorher. Dickie griff in Notwehr nach dem Lineal, weil Simon sich wirklich wie ein Wahnsinniger aufgeführt hat, und dann versuchte eines der anderen Kinder, sie zu trennen, aber Simon hat sich losgerissen und Dickie mit aller Kraft zwischen die Beine getreten, und jetzt liegt Dickie im Bett und wir mußten Doktor Spears kommen lassen. Die Testikel des armen Kindes sind geschwollen, und er hat schreckliche Schmerzen.»
«Ach Gott», ich senkte die Stimme, denn Robin schlenderte wieder ins Zimmer. «Das tut mir wirklich furchtbar leid!»
«Ich hätte dich normalerweise nicht damit belästigt», sagte Lucy, «aber Bimbo ist außer sich vor Wut und speit Feuer und Schwefel und brummt typisches altes Schulgerede von Fairness und warum Simon nicht dazu erzogen sei, seine Fäuste zu gebrauchen …»
«Hör auf.» Ich spürte, daß ich das Lachen nicht länger verbeißen konnte. «Genau dasselbe habe ich mir vor zwei Minuten anhören müssen.»
«Es ist aber wirklich nichts Komisches daran», sagte Lucy unsicher, und doch konnte ich auch in ihrer Stimme ein leichtes Vibrieren wahrnehmen. «Und sag Robin, er möge sich doch um jeden Preis zurückhalten und Bimbo reden lassen, ohne selber in Wut zu geraten, sonst herrscht am Ende Blutrache zwischen uns, einer glaubt, den anderen schneiden zu müssen, und das wäre ja die reinste Hölle.»
«Gut, gut, ich will mein möglichstes tun. Und das mit Dickie tut mir schrecklich leid.»
«Ich muß jetzt aufhören», sagte Lucy. «Bimbo ist aus dem Bad und fängt schon wieder an zu brüllen. Wir essen um acht, aber ihr solltet lieber früher kommen, damit man das Schlimmste bald überstanden hat.»
Ich legte nachdenklich den Hörer hin, nahm eine Zigarette aus der Porzellandose auf dem Nachttisch und zündete sie an. Die Lust zu lachen war mir vergangen, und mit einemmal fühlte ich mich niedergedrückt. Es war gut und nett von Lucy, daß sie mich angerufen hatte, doch bei aller Dankbarkeit reizte mich ihr verschwörerisches Getue ein wenig. Ich zählte nie zu den Anhängern der abgedroschenen Theorie, daß Männer im Grunde nur große Schulbuben seien und daß Frauen von Natur aus die Pflicht hätten, ihren Männern gutmütig alles hingehen zu lassen, ihre Koller mit unendlichem Verständnis und überlegener Einsicht zu erdulden und sie nachher mit sanfter Wortgewalt ins sonnige Heim zurückzuführen. Wenn Bimbo wütend war und über Robin herfallen wollte, sah ich nicht ein, warum man von Robin erwartete, taktvoll zu sein und Bimbo toben zu lassen. Simon hatte sich offenbar schlecht benommen, aber er war schließlich erst siebeneinhalb Jahre und Dickie war zehn.
Ich schaute zu Robin hinüber, der sich mit den Sachen auf meinem Toilettentisch zu schaffen machte. Sein Hemd war verschwitzt und zerdrückt, er trug seine schmutzigen alten Reithosen und sah noch immer verdrossen drein, doch jäh überkam mich das Verlangen, die Arme um ihn zu schlingen, und ich dankte meinem Schicksal, daß ich mit ihm verheiratet war und nicht mit Bimbo. Bimbo war ein netter Mensch und ich mochte ihn ganz gern, aber er war von viel derberem Schlag als Robin und darum auch erheblich weniger interessant. Bimbos Werte traten klar und deutlich und unabänderlich hervor, während Robins Eigenschaften, hinter einer vollkommen normalen Fassade, gleitender und weniger herkömmlich und durchschaubar waren.
«Worum ging es denn?» Er ließ die Dinge auf dem Toilettentisch liegen und kam zu mir herüber.
«Es war Lucy. Sie ist ziemlich aufgeregt. Es scheint, daß Simon nicht ganz so sehr mißhandelt und gequält wurde, wie du angenommen hast.»
«Was meinst du damit?»
«Nun, Dickie liegt im Bett und hat große Schmerzen.»
«Geschieht ihm recht!» Robin schlürfte seinen Whisky-Soda. «Das wird ihn vielleicht lehren, nur mit Buben seiner Größe anzubinden.»
«Und was Fairness betrifft, haben sich wohl beide Jungen nicht ganz an die Regeln gehalten, die der achte Marquis von Queensberry im Jahre 1867 für den Boxkampf aufstellen ließ. Wir werden uns leider mit der Tatsache abfinden müssen, daß sich Simon, um es sanft auszudrücken, nicht gerade ethisch benommen hat.»
«Du wirst wohl mit siebeneinhalb Jahren auch nicht besonders ethisch gewesen sein.»
«Bestimmt nicht, aber ich bin vor ziemlich langer Zeit siebeneinhalb gewesen, und wir besprechen, was sich heute zutrug.»
«Was ist denn geschehen? Was hat Simon getan? Oder vielmehr, was soll er nach Lucys Reden getan haben?»
«Er hat Dickie sehr stark zwischen die Beine getreten.»
«Geschieht ihm recht», sagte Robin.
«Lucy sagt, daß seine Testikel schlimm geschwollen sind; sie mußten Doktor Spears kommen lassen.»
«Und was jetzt?»
«Es ist eine peinliche Lage, und wir sollten wirklich versuchen, sie so taktvoll wie möglich zu behandeln.»
«Hat der Doktor gesagt, daß es etwas Ernstes ist?»
«Das weiß ich nicht; er war noch nicht dort gewesen, als Lucy mich anrief. Aber es muß recht schlimm sein, denn sie sagt, daß sich der arme Dickie in grauenhaften Schmerzen windet.»
«Das wird schon stimmen.» Robin nickte verständnisvoll. «Solche Sachen können sehr schmerzhaft sein. Mich hat einmal ein Cricketball am Steißbein erwischt, und ich lag drei Tage im Bett. Es tat teuflisch weh, aber schließlich habe ich es doch überstanden.»
«Das sehe ich, Lieber. Aber in der jetzigen Lage hilft uns das nicht viel weiter.»
«Ich weiß nicht recht, was man eigentlich von uns erwartet. Wir sind nicht daran schuld, wenn Dickie Chalmers mit einem Lineal auf unseren Sohn losgeht; der Kleine muß sich eben verteidigen, so gut er kann.»
«Man könnte gegen uns geltend machen, daß wir unserem lieben kleinen Sohn die Regeln des fair play nicht genügend eingehämmert haben; das wenigstens wird Bimbo behaupten. Er schnappt anscheinend vor Wut über.»
«Ich pfeif darauf, was Bimbo sagt. Er hat seine Kinder ohnehin wie Gassenjungen aufwachsen lassen. Der Lausbub stolziert dauernd in seinem Cowboyaufzug herum und tut sich groß, und das Mädchen schnieft fortwährend.»
«Nicht fortwährend, Liebling. Sie hat eben einen Schnupfen, den sie nicht los wird.»
«Sie muß schon verdammt wenig gesund sein, wenn sie in diesem Klima ihren Schnupfen nicht los wird.»
«Vielleicht ist sie das», sagte ich geduldig. «Vielleicht hat sie schwache Lungen, geschwollene Mandeln und einen nörgelnden Blinddarm – ich weiß es nicht; aber was sie auch hat, für unsere Diskussion ist es vollkommen unwichtig.»
«Ich will Bimbo mit seinem fair play schon kommen, wenn er anfängt, dummes Zeug zu reden.»
«Das ist es ja gerade, was ich befürchte.» Ich trat zu ihm und schob meinen Arm besänftigend unter seinen. «Bitte, bitte, nimm dich zusammen und laß ihn reden, wenn er dich auch noch so sehr aufregt. Schließlich hat der arme Dickie das schlechtere Teil erwischt, und wir wollen doch nicht in eine heftige Fehde mit den Chalmers’ geraten, bei der jeder Partei nimmt und ein endloser Klatsch entsteht. Dies ist nun einmal eine kleine Insel, und wir sind alte Freunde. Sei lieb und verständig, und wenn es dich noch so juckt, schlag nicht zurück. Und übrigens», setzte ich hinzu, «solltest du wohl auch ein Wörtchen mit Simon reden. Er hat die ganze Sache etwas gar zu leicht genommen.»
«Schön, mein Herz. Nur Ruhe. Ich werde ein Muster an Selbstbeherrschung sein. Und jetzt nimm dein Bad, ich will auch noch baden, und es ist schon zwanzig nach sieben. Morgen werde ich Simon etwas erzählen.» Er küßte mich zerstreut, stellte das leere Glas auf meinen Toilettentisch und wollte das Zimmer verlassen. Bei der Tür wandte er sich um. «Richtig!» sagte er. «Ich weiß eine ziemlich aufregende Neuigkeit, aber diese Geschichte hat mich völlig abgelenkt.»
«Was denn?»