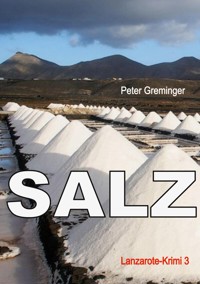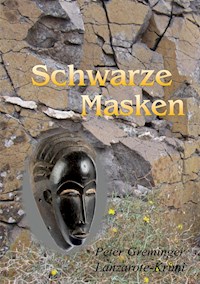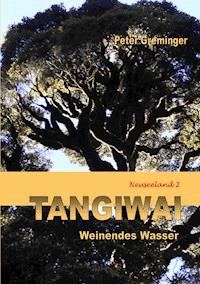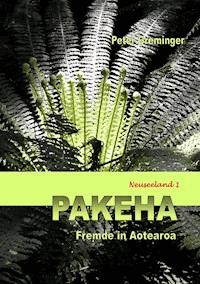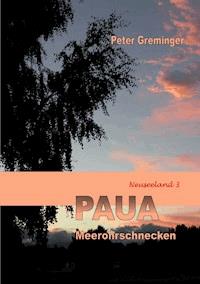
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Tod seines Vaters verfolgte Carl all die Jahre. Das Einzige, was ihm blieb, war die Erinnerung an das Heldenbegräbnis, an die Salutschüsse und an die feierliche Überreichung einer Medaille des dänischen Königshauses. Als Carl im Alter von bald siebzig Jahren in Neuseeland seine Ruhe findet, glaubt er endlich am Ziel zu sein. Da muss er entdecken, dass in diesem Land nicht endemische Arten von Fauna und Flora, welche scheinbar das Gleichgewicht der Natur stören, gnadenlos verfolgt und ausgerottet werden. Holte ihn die Vergangenheit wieder ein? Er verstand nicht, wie sich der Mensch als Herr über Mensch und Kreatur wähnen konnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Zwei Jahre im fernen Neuseeland sind für Peter Greminger nicht ohne Folgen geblieben. Seinen beiden ersten Romanen PAKEHA (Fremde in Aotearoa) und TANGIWAI (Weinendes Wasser) folgte unmittelbar der jetzt vorliegende PAUA. Alle drei Bücher haben Titel in Maori und lassen erahnen, dass dem Autor diese Volksgruppe nicht gleichgültig geblieben ist. Fasziniert hat ihn aber auch die großartige, noch zum größten Teil unbeschädigte Natur.
Peter Greminger war viele Jahre seines bisherigen Lebens gereist und hatte besonders im südostasiatischen Raum gearbeitet. Neuseeland war aber noch eine neue Erfahrung, die er nicht zuletzt seiner Frau Marlis zu verdanken hatte. Im frühen Ruhestand hatte er auf einmal die Zeit und Muße, die Welt um sich genauer zu betrachten und seine Gedanken auch zu Papier zu bringen. Damals ahnte er nicht, dass für ihn das Thema Neuseeland noch nicht abgeschlossen war und bald ein weiterer Romane entstehen würde: KAHURANGI (Grüner Stein).
Peter Greminger
Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden.
(Lk 6/37)
Für meine Schwester Elisabeth
Inhaltsverzeichnis
Nordsee 1940
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Nordsee 1940
Das rote Warnlicht über dem verriegelten Schott verriet unmissverständlich, dass höchste Alarmstufe war. Dennoch tat Obermaat Hansen ruhig seinen Dienst, las den Öldruck vom Manometer ab und trug den Wert mit sauberer, spitzer Schrift gewissenhaft in die Tabelle auf dem Brett ein. Das unentwegte Dröhnen des großen Dieselmotors und die Abgeschlossenheit des Raumes tief unten im Schiffsrumpf, ließen die Gefahr weit in die Ferne rücken. Erik und seine drei Kameraden erledigten weiter mechanisch ihre Aufgaben. Zwecklos, sich über etwas Sorgen zu machen, was man ja sowieso nicht ändern konnte. Natürlich waren da ein paar bohrende Gedanken und Fragen, was dort oben wohl los war. Schließlich war man im Krieg und nicht auf einer Vergnügungsfahrt, aber hier unten verrichteten sie gewissenhaft ihre Arbeit. Sven, Daniel und der kleine rothaarige Max ließen sich durch die Alarmstufe Rot nicht so schnell einschüchtern. Einzig das Stottern eines Kolbens oder das Kreischen eines angefressenen Lagers konnte sie aus der Ruhe bringen, aber selbst dann wussten sie genau was zu tun war, damit die Fregatte 'Aalborg' immer die von oben geforderte Leistung erbrachte.
Im Moment schien alles in Ordnung und die 'Aalborg' stampfte unermüdlich ihren Weg durch das eiskalte Wasser der Nordsee. Erik schob das Brett zufrieden nickend in das Fach seines Pults und klappte den Deckel darüber. Mit einem raschen Blick überzeugte er sich, dass das rote Licht immer noch leuchtete. Wohl eine übertriebene Vorsichtsmaßnahme der Offiziere auf der Brücke, denn wer sollte ihnen schon in dieser kalten, grauen Aprilnacht in die Weite des Nordmeeres folgen. Ihr Auftrag würde erst in etwa zehn Stunden beginnen, das war bei der Einsatzbesprechung mitgeteilt worden. Man wollte nach Möglichkeit die mit Stahl und Kohle für Hitlers Kriegsmaschinerie beladenen Frachter aus Schweden und Norwegen daran hindern, nach Süden zu den deutschen Häfen zu gelangen. Ihre besondere Aufgabe bestand darin, die Meeresenge zwischen der skandinavischen Halbinsel und Dänemark, den Skagerrak, zu blockieren. Ein gut gezielter Schuss vor Bug, begleitet mit der entsprechenden Aufforderung würde wohl jeden vernünftigen Kapitän veranlassen sofort umzukehren oder einen britischen Hafen anzusteuern.
Erik Hansen öffnete den Kragen seines hellbraunen Uniformhemdes, warf sich auf den einzigen Stuhl und atmete tief durch. Sven und Daniel hatten sich auf der anderen Seite längst Erleichterung verschafft und nickten verständnisvoll herüber. An eine Unterhaltung war bei dem Lärm nicht zu denken, aber die Gesten waren klar. Wenn nur bald das verfluchte Warnlicht erlöschen würde. Es wurde langsam stickend heiß hier unten, und wenn die Schotten noch lange geschlossen blieben wäre es kaum mehr auszuhalten.
Ach was, sagte sich Erik, sie würden auch diesen Dienst hinter sich bringen. Dann kam das lange Wochenende. Ostern mit der Familie, das war so gut wie sicher und einen Ausflug zu den Dünen bei Issum hatte er dem Jungen sowieso versprochen. Carl war ihr einziger Sohn. Ja, sie hatten sich beide mehr Kinder gewünscht. Aber nach der schwierigen Geburt vor acht Jahren hatte der Arzt unmissverständlich abgeraten. Ein zweites Mal würde Karin so etwas kaum überleben.
Die Hitze, das Motorengeräusch und die ununterbrochene stampfende Bewegung des Schiffes machten schläfrig. Erik streckte die Beine von sich und stemmte sie gegen die Kühlwasserleitung zu seinen Füssen. Die ewige Warterei! Die nächste Kontrolle war erst in einer guten halben Stunde fällig, unterdessen konnte der Diesel ruhig weiterhämmern.
Als der Torpedo einschlug, wusste Erik nicht wie lange er dagesessen hatte oder ob er vielleicht sogar eingenickt war. Mit staunend aufgerissenen Augen verfolgte er, wie die gegenüberliegende Wand barst. Seine Kameraden wurden wie leblose Stoffpuppen gegen den schweren Motorblock geschleudert und dann war das Monster auch schon über ihm. Der Druck und die hereinschießenden Wassermassen raubten ihm sofort das Bewusstsein und ersparten ihm so wenigstens den grausamen Ertrinkungstod im eiskalten Wasser der wütenden Nordsee.
Minuten später versank die stolze Fregatte 'Aalborg' der Königlichen Marine in die dunkle Tiefe des Meeres und mit ihr die gesamte Besatzung. Kurz danach schrieb ein deutscher U-Boot-Kommandant siegesgewiss in sein Logbuch: „Uhrzeit 05:24, Position 57°15' nördliche Breite, 06°42' östliche Länge, feindliche Fregatte vernichtet und versenkt.“
KAPITEL 1
Mit kurzen, kräftigen Schlägen steuerte er das Kanu Richtung offenes Meer. Kurz nach Mittag, beim Einsetzen der Ebbe, hatte Carl sein eigentümliches fragiles Gefährt beim Bootshaus von Mapua zu Wasser gelassen und war mit der Strömung durch die enge Passage des Waimea Estuarys hinausgeglitten. Er kannte sich aus, hielt sich rechts, nahe der dicht bewaldeten Insel und umrundete sofort die Landspitze, um vor den weiten, sanften Strand zu kommen. Weiter links lauerten bösartige Wirbel, dort wo die aus der riesigen, flachen Bucht herausströmenden Wassermassen auf die heranstürmende Brandung der Tasmanischen See prallten und wild aufschäumend miteinander rangen.
Normalerweise hätte er nun eine halbe Stunde lang kräftig mit dem Paddel gearbeitet und wäre wie ein Pfeil dem mehrere Kilometer langen einsamen Strand gefolgt, um so schnell als möglich auf der anderen Seite zu den seichten Buchten und Verstecken der Vogelkolonien zu gelangen. An diesem Tag ließ er sich aber einfach auf der schwachen Dünung ins weite Meer hinaustragen. Er vertraute voll und ganz auf seine Erfahrung, die ihm sagte, dass ihn die Flut nach ein paar Stunden ohne große Anstrengung wieder zurückbringen würde. Auch auf sein Kanu war absolut Verlass. Er hatte es selber aus bestem Fiberglass gebaut und es lag hervorragend im Wasser. Dass es überhaupt nicht den Vorstellungen hiesiger Bootsbesitzer entsprach, störte ihn überhaupt nicht. Es war weder ein schnittiges Kajak, die bei den Touristen immer beliebter wurden, noch war es eines jener traditionellen Wakas der Maoris, mit ihren reich geschnitzten Heck- und Bugfiguren. Eigentlich gehörte sein Kanu der Form und Bauart nach eher auf einen der einsamen kanadischen Seen, als in die Tasman Bay der neuseeländischen Südinsel. Er selber müsste ein Indianer mit Federn im schwarzen Haar sein.
Über Carls Gesicht huschte ein Schmunzeln. Seine braun gegerbte Haut entsprach wohl derjenigen eines Indianers, aber das kurz geschnittene, lohweiße Haar passte überhaupt nicht ins Bild. Es verriet vielmehr, dass er kurz vor seinem siebzigsten Geburtstag stand. Die sehnige Gestalt, die kräftigen Arme und die Art, wie er mit dem Paddel umging, zeugten von einem rauen Leben auf hoher See. Er war kein gut gepolsterter Hobbysegler, sondern hatte auf manch schwankendem Deck harte Arbeit verrichtet. Er fürchtete weder Kälte noch Hitze. Er trug keinen Hut und die eng zusammengekniffenen hellblauen Augen waren an Wind und Wetter gewöhnt.
Während das Kanu auf den Wellen sanft auf und nieder schaukelte, beobachtete Carl die ferne Küstenlinie. Links war deutlich der Hafen und die dahinterliegende Stadt Nelson zu sehen. Es war ein geschäftiger Ort, den er nach Möglichkeit mied. Neue, teure Appartementhäuser wucherten entlang der Küstenstraße, bereit, weitere Horden zahlungswilliger Touristen aufzunehmen. Im Zentrum, wo sich als Wahrzeichen ein scheußlicher Turm erhob, war ein emsiges Gedränge um Geschäfte, Agenturen und Cafés. Die unpersönliche städtische Atmosphäre, die sich in letzter Zeit dort breit machte und so gar nicht zu dem früher beschaulichen Ort passen wollte, war Carl zu tiefst zuwider.
Folgte man der Küstenlinie in nordöstlicher Richtung, verlor sie sich in weiter Ferne bei den ersten Inseln des Marlborough Sounds. Auf der anderen Seite, ganz rechts, lagen die dunklen Hügel des Abel Tasman National Parks. Geheimnisvoll, ja fast bedrohlich, sahen sie aus, und man konnte sich gut vorstellen, wie der Seefahrer Abel Janszoon Tasman im Dezember 1642, ohne an Land zu gehen, wieder davonsegelte, als seine Leute schon in den Booten von den Einheimischen niedergemetzelt wurden. Tasman war nachweislich der erste Europäer, der Neuseeland entdeckte, und die große Bucht hinter den Anhöhen nannte er nach der schrecklichen Erfahrung mit den Maoris prompt 'Murderers Bay'. Die riesige Bucht heißt heute aber viel harmloser 'Golden Bay'. Sie ist weltweit einmalig und die einsame, siebenundzwanzig Kilometer weite Fahrt hinaus auf einer schmalen Düne, welche die Bucht fast umschließt, beeindruckt jeden. Sie ist ständigem Wechsel unterworfen und ein Paradies für eine einzigartige Fauna. Die Düne war aber viel zu weit entfernt und zu niedrig, als dass sie Carl von seinem Kanu aus hätte sehen können. Unmittelbar vor seinen Augen hatte er aber zwei schneebedeckte Berge, den Mount Arthur und die Twins. Das macht eigentlich drei, denn wie der Name sagt, sind die Twins tatsächlich zwei Gipfel.
Das herrliche Panorama beeindruckte Carl Hansen an diesem Tag aber kaum. Seine Gedanken waren weit weg. Als er an diesem Vormittag bei Robin hereinschaute, war sie ausgeflogen. Ein hastig geschriebener Zettel an der Tür informierte ihn, dass sie die nächsten paar Tage für das DOC, dem Departement of Conservation, im Abel Tasman Park unterwegs sei und kaum vor dem Wochenende zurück wäre. Was auch immer sie dort draußen im Busch tat, er war enttäuscht. Er hatte sich auf einen gemütlichen Nachmittag gefreut, wollte ihr zuschauen, wie sie vor der Staffelei stand und malte.
Robin Fleming war eine außergewöhnliche Frau. Im Alter von fünfundfünfzig Jahren war sie immer noch voll sprühender Energie und Tatkraft. Oder vielleicht sollte es heißen, sie hatte erneut ihr Leben in beide Hände genommen und brachte nun temperamentvoll mit Pinsel, Spachtel und Ölfarbe lang unterdrückte Gefühle zum Ausdruck. Ihre Bilder, die wild im Atelier herumstanden, waren von ausgelebten Emotionen nur so geladen. Man konnte förmlich sehen, wie sie mit Schwung und Kraft den Pinsel führte und mit leuchtenden Farben ihre Figuren zum Leben erweckte. Sie malte vorwiegend Tiere und dabei waren Vögel ihre Lieblinge. Nicht zierliche Finken und Spatzen, nein, kräftige, elegante Seevögel, Möwen, Tölpel, Fregattvögel und Albatrosse, die sich in die Lüfte schwangen, unter ihnen oft die aufschäumenden Wellen des Ozeans. Ein Kormoran, mit weit ausgebreiteten Flügeln auf einem alten verwitterten Ponder oder ein Reiher, regungslos und stolz im seichten Wasser stehend, das waren ihre Motive. Im Moment arbeitete sie gerade an einer Gruppe Pinguine auf einer Eisscholle des südlichen Eismeeres.
Carl, der sich sein Leben lang kaum für Kunst interessiert hatte, war fasziniert. Die Frau gab ihm überhaupt einige Rätsel auf. Neben der Malerei war sie eine engagierte Natur- und Tierschützerin. Das war ja auch der Anlass, wie er sie kennengelernt hatte, damals vor drei Jahren.
Der Streit um den kleinen Foxterrier schwelte schon seit sie Singapore verlassen hatten. Carl fuhr als Deckmatrose auf dem japanischen Frachter 'Oyama Maru II' und hatte seinen struppigen, schwarzweißen 'Fixy' mit der ausdrücklichen Erlaubnis des Zahlmeisters an Bord gebracht. Obwohl die Besatzung das drollige Tier mit viel Spott und Gelächter empfing, hatte doch niemand etwas dagegen, außer Herbert.
„Halt mir bloß den Köter vom Leib“, maulte dieser, als Fixy auf Erkundung aus war und schnüffelnd um seine Beine strich.
„Ach, der tut doch nichts!“, verteidigte ihn Carl.
„So weit ist's mit der christlichen Seefahrt schon gekommen“, maulte der Deutsche weiter. „Früher war allen klar, Hunde und Nutten hatten an Bord nichts zu suchen.“
„Er wird dir kaum den Tripper anhängen, der Fixy. Den hast dir wohl eher im „Ship-Inn“ in Hongkong geholt.“
„Schweig du kleiner Dänenaffe! Dort verkehren nur richtige Männer, keine Tanten wie du, die ein niedliches Schoßhündchen brauchen. – Wehe wenn ich das Vieh in meiner Koje antreffe. Den werf' ich eigenhändig über Bord.“
„Komm Fixy, dem Bösewicht gehen wir besser aus dem Weg“, sagte Carl und hob das unschuldig blickende Tier auf.
Der große Deutsche maulte noch etwas unverständliches, machte mit der Hand eine obszöne Geste und verschwand in den Aufbauten achtern.
Die Fahrt führte sie über Surabaya in Ostjava und durch die Torresstrasse nach Port Moresby. Während von den einheimischen Hafenarbeitern dreißig Tonnen Rohkautschuk verladen wurde, begab sich die Besatzung an Land, so auch Herbert.
Zwei Nächte in den Bars und zwielichtigen Etablissements im sogenannten 'Down Town', der Innenstadt, genügte dem zügellosen Deutschen nicht. Nachdem er einen hierher verschlagenen Landsmann aus Westfalen kennengelernt hatte, gab es kein Halten mehr. Sie zogen von einem Lokal zum anderen, beschwatzten die willigen Mädchen und verschwanden für eine schnelle Stunde im schmuddeligen Hinterzimmer. Der neue Kumpan Günther war ein Relikt eines deutschen Unternehmens, welches vor ein paar Jahren dadurch bekannt wurde, dass es in Neu Guinea mit rücksichtslosen Methoden Bergbau betrieben und große Umweltschäden verursacht hatte. Erosion und ein vergifteter Flusslauf zwangen die Firma schließlich, unter dem Druck der Weltöffentlichkeit, zur Aufgabe.
In der zweiten durchzechten Nacht verlegten sich die Beiden immer mehr aufs Saufen. Dem Bier folgten nun reihenweise doppelte Klare. Irgendwann am frühen Morgen fanden sie sich vor einem vergitterten Eingang einer Bar und wussten nicht, wie sie dorthin gekommen waren. Während Günther sich würgend erbrach, kämpfte Herbert gegen den aufsteigenden Ekel, rappelte sich auf und schwankte grunzend davon. Dienstantritt auf der scheiß '..ama Maru' war punkt neun Uhr. Er suchte verzweifelt in seinem Gedächtnis, wo das denn war. Wie durch ein Wunder, oder war es der Schutzpatron aller besoffenen Seeleute, fand er den Hafen und das richtige Schiff. Als er keuchend über das Fallreep auf Deck schwankte, kam ihm als erstes Fixy in die Quere. Er versetzte diesem derart einen Tritt, dass er selber beinahe rücklings vom Deck gefallen wäre.
„Verfluchter Kö-öter!“, schrie er. „Ich ma-k di-sch kalt!“
Nur die totale Besoffenheit des Deutschen rettete Fixy, der sich jaulend unter einer Winde verkroch. Im Schutze der schweren Ketten knurrte er seinem Peiniger nach, als dieser fluchend nach achtern torkelte.
Carl merkte nichts von alldem und Herbert schien sich, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatten, auch nicht daran zu erinnern. Einzig Fixy vergaß nicht.
Nach einem kurzen Stopp im Hafen von Suva, auf den Fidschi-Inseln, stampfte der alte Kahn in gerader Linie südwärts durch den aalglatten Pazifik. Die Tage rannen dahin wie zähflüssiges Öl aus dem verschmierten Motor unten im stickigen Maschinenraum. Niemand wusste woher es kam und wohin es versickerte. Die Männer lungerten untätig, mürrisch und wortkarg herum. Selbst Freunde hatten sich nichts zu sagen und erst recht nicht jene, die sich hassten. Carl und Herbert gingen sich aus dem Weg, aber die kugelrunden Augen von Fixy verfolgten seinen Feind lauernd, wann immer dieser in seine Nähe kam.
Der offene Schlagabtausch kam ganz unerwartet. Als sie die neuseeländische Nordinsel passiert hatten und in die Cook Strait einbogen, fegte ihnen aus Süden plötzlich ein eisiger Wind entgegen. Direkt aus der Antarktis kommend, peitschte er mächtige Wellen seitwärts gegen das Schiff, so dass dieses zitternd erbebte und selbst hartgesottene Seebären aufgerüttelt wurden. Jetzt wurden plötzlich alle Hände gebraucht, die Ladung musste zusätzlich gesichert und alle Luken dicht verschlossen werden. Einzig Herbert scherte sich einen Dreck um die allgemeine Aufregung und bequemte sich nur langsam und widerwillig aus der Koje zu klettern. Just als er missmutig seine Beine über den Rand hängen ließ und überlegte, ob er wirklich gebraucht würde, erkannte Fixy seine Chance. Er hatte sich, erschrocken über das plötzliche Geschaukel und die aufkommende Hektik, unter der Koje verkrochen. Als nun die verhassten Beine so verlockend vor ihm baumelten, konnte er nicht widerstehen und schnappte zu.
„Ah...!“ Der Aufschrei ging im Tosen des Sturmes unter. „Au-ah!“, heulte Herbert. „Dieser verfluchte Köter! Ich bring ihn um!“
Mit aller Kraft schleuderte er den Hund von sich. Ein großer Teil seines Sockens hing in des wilden Tieres Lefze und ein Fetzen Haut klaffte am Bein. Ein kleines Rinnsal Blut rann über den Fuß, zwischen die Zehen. Sein Blut!
„Warte du Drecksvieh!“, schrie er, sprang auf und schlug prompt den Kopf gegen die obere Koje. Heulend und in blinder, weißglühender Wut stürzte er sich auf das Tier. Fixy war aber klug genug zu erkennen, dass er einen solchen massiven Frontalangriff nicht überleben würde und entfloh unter Knurren und Kläffen hinaus aufs Deck.
Just in diesem Moment versammelten sich ein gutes halbes Dutzend Seeleute draußen im Schutze der Aufbauten zu einer wohlverdienten Zigarette. Sie beobachteten erstaunt die wilde Verfolgungsjagd. Fixy rutschte wie ein sich überschlagendes Knäuel über das nasse Deck und landete direkt vor den Füssen seines Herrn.
„Was soll das ...“, begann Carl, aber da war Herbert auch schon über ihm. Sie stürzten gegen den Rand der nahen Luke, so dass Carl für einen Moment die Luft wegblieb. Herbert kniete über ihm und begann in blinder Wut auf ihn einzudreschen.
„Dein Scheißköter!“, schrie der Wahnsinnige. „Ich bring euch beide um, dich und deinen Köter!“
Starke Arme griffen zu und scharfe Worte drangen in das durchgedrehte Hirn. „Aufhören! ... Herbert! ... So hör doch endlich auf! Du bringst ihn ja tatsächlich um!“
Von den Angriffen befreit, rappelte sich Carl auf, schwankte einen Moment auf dem wogenden Deck und wollte sich nun seinerseits auf den Angreifer stürzen.
„Genug!“, erklang der scharfe Befehl und Carl erkannte den Kapitän, der dazwischen trat. Er ließ die Arme sinken und blickte in die Augen seines Gegners. Nackte Mordlust schlug ihm entgegen. Herbert wollte sich erneut auf ihn stürzen.
„Sein Köter hat mich gebissen. Das soll er mir büßen, der Dänenaffe!“, brüllte er.
„Du verfluchter Nazi!“, schrie nun Carl seinerseits. „Ihr deutschen Dreckschweine habt wohl immer noch nicht genug. Wollt alle umbringen, die euch im Wege sind. Das habt ihr schon damals ...“
„Ruhe!“, donnerte nun der Kapitän. „Wenn ihr nicht sofort Ruhe gebt, lass ich euch einsperren.“
„Einen Nazi ... hat er mich genannt!“, kreischte Herbert weiter.
„Das lass ich nicht auf mir sitzen.“
„Herrgott Donnerwetter! Nun hört endlich auf! ... Herbert, gehen Sie nach vorn und lassen Sie sich vom Ersten verbinden!“, befahl der Kapitän. „Und Sie Carl, ... ja, ihr alle, geht und reinigt endlich die Luke sechs für die Ladung in Nelson!“, ... „Etwas plötzlich, wenn ich bitten darf!“
Mürrisch machte sich die Gruppe über das schwankende Deck und gegen die peitschenden Böen ankämpfend davon. Schräge Blicke in Richtung Carl verrieten ihren Unmut. Was zum Teufel war mit dem? Einen 'Nazi' nannte er den Herbert. Mehr als fünfzig Jahre waren verstrichen seither. Der Herbert hatte doch nichts zu tun mit dem damaligen Hitlerzeugs. Sicher, er war ein Hitzkopf und manche fanden ihn auch arrogant, aber den Krieg hatte der doch höchstens noch als grüner Jüngling miterlebt. Na ja, so genau wusste man das auch nicht. Hatten die Deutschen damals nicht sogar Kinder und alte Männer an die Front geschickt. Ach was, ein Scheißkrieg war's! Man sollte ihn am besten vergessen.
Nur, der Kapitän hatte nichts vergessen. Nachdem das stürmische Wetter nachgelassen hatte, konnten sie es wagen, die D'Urville Island zu umrunden und dann Richtung Nelson in die Tasman Bay zu fahren. Eigentlich gab es zwischen den Marlborough Sounds und der großen Insel einen engen Durchgang, der French Pass genannt wurde. Seit aber der französische Kapitän Dumont d'Urville im Jahre 1827 mit seiner dreimastigen Corvette 'Astrolabe' in der gefährlichen Passage nur mit knapper Not einer Katastrophe entkommen war, wagte es niemand mehr dort hindurch zu fahren, schon gar nicht große Frachter, wie die 'Oyama Maru II'. Sie waren also gezwungen, weit nördlich, die Insel mit dem französischen Namen zu umrunden und erst dann wieder südlich in die große Tasman Bay einzubiegen um schlussendlich nach Nelson zu gelangen. Da man dort nur bei Flut in den Hafen einlaufen konnte, hatten sie draußen auf offener See nochmals ein paar Stunden zu warten. Kapitän Miller benützte die ruhige Zeit und ließ den Matrosen Carl rufen.
„Kommen Sie herein Carl!“, sagte er freundlich, als dieser unter der Türe erschien. „Setzen Sie sich!“
Als einziger auf dem Schiff hatte der Kapitän eine schöne, geräumige Kabine mit einem Salon, wo sogar ein massiver Schreibtisch stand.
„Danke“, sagte Carl und setzte sich auf den Stuhl vor dem Pult. Eine Zeitlang musterte der Kapitän seinen Untergebenen nachdenklich. Dann begann er: „Sie wissen, warum ich Sie rufen ließ?“
„Natürlich, kann's mir vorstellen.“
„Wir haben heutzutage sehr lockere Sitten an Bord und ich bin der letzte, der sich daran stößt. Dennoch gibt es Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen.“
„Der Streit wegen Fixy, nehm' ich an“, sagte Carl.
„Ja, auch ...“, antwortete der Vorgesetzte. „Vor allem aber ihre Einstellung gegenüber uns Deutschen.“
„Sie ... Sie sind auch ...“ stotterte Carl.
Der Kapitän lächelte. „Keine Sorge, Carl. Ich will Sie nicht verurteilen. Ich nehme an, Sie hatten gute Gründe für ihr Verhalten. Es war eine scheußliche Zeit.“
„Ja. Ich hab' gleich zu Beginn meinen Vater verloren. Es war so unsinnig. Dänemark hat ja überhaupt nie richtig Krieg geführt. Wir waren innerhalb weniger Stunden besetzt. Weshalb musste er dann umgebracht werden?“
„Diese Frage stellen sich wohl alle. – Auch ich habe meine Eltern verloren. In Berlin, kurz vor dem Schluss. – Dennoch, wir müssen aufhören mit dem Hass, mit der Suche nach den Schuldigen. Die jetzige, neue Generation soll eine unbelastete Zukunft haben. Wir müssen die Vergangenheit endlich ruhen lassen.“
„Machen wir uns das nicht etwas zu einfach?“, wandte Carl ein.
„Nein. Es braucht die Anstrengung aller Beteiligten. Und genau da muss ich eingreifen. Ich kann auf diesem Schiff keinen Hass dulden. Wir sind ein absolut internationales Unternehmen. Wir wollen keine ethnische Konflikte, keinen Rassenhass und schon gar keinen Deutschenhass. Wir müssen auf zu engem Raum miteinander auskommen. Das ist es, was ich meine.“
„Mit allem Respekt, Herr Kapitän. Es war doch einzig der Streit um einen kleinen Hund. Ja, ich habe mich gehen lassen und ein paar böse Worte gebraucht, dafür entschuldige ich mich auch. Aber der Herbert, der wollte den armen Fixy tatsächlich umbringen.“
„Nein, nein mein Lieber, hier geht es nicht nur um einen Hund“, sagte der Kapitän. „Ich kann nicht dulden, dass Sie und Herbert sich weiter in die Haare geraten.“
Carl zögerte. „Ich verstehe, Sie meinen einer von uns beiden ist zuviel auf diesem Schiff.“
„So könnte man es ausdrücken.“
„Dann werde ich in Nelson wohl am besten die 'Oyama Maru' verlassen.“
Der Kapitän nickte. „Das wäre wohl für uns alle das Beste.“ Er kritzelte rasch eine Notiz auf einen Zettel und streckte diesen Carl hin.
„Melden Sie sich damit beim Zahlmeister. Er wird ihnen die Heuer auszahlen, bevor Sie an Land gehen.“
Carl starrte auf das Papier, steckte es ein und sagte: „Jawohl Sir! ... Danke!“
„Ach ja, noch etwas. ... Der Hund, der wird erst in die Quarantäne kommen. ... Sie wissen schon, Neuseeland ist da sehr strickt.“ Carl seufzte: „Dem armen Tier wird doch wirklich nichts erspart.“
„Soviel ich weiß ist's nur für eine Woche“, sagte der Kapitän. „Er wird's überleben.“ Mit einer flüchtigen Handbewegung war Carl unmissverständlich entlassen.
Wortlos verließ Carl die Kabine und schloss die Tür leise hinter sich. Klar, dass die beiden Deutschen zusammenhielten. Hätte er gewusst, dass der Kapitän auch einer war, hätte er in Singapore auf der 'Oyama Maru' schon gar nicht angemustert. Des Kapitäns Name Miller hätte ihn eigentlich aufhorchen lassen müssen, aber wer vermutete denn gleich hinter jedem germanisch klingenden Namen einen alten Nazi ...
Nelson war nicht gerade der Ort, wo man leicht auf einem anderen Schiff unterkam. Es war kein Welthafen von Bedeutung und die paar lahmen Frachter, die sich hierher verirrten, heuerten kaum neue Matrosen an. Aber das kümmerte Carl im Moment wenig.
Als an diesem Nachmittag die Flut ihren höchsten Stand erreichte, arbeitete sich das Schiff langsam durch die enge Einfahrt zwischen einer Insel und einer langgezogenen Kies Bank, auf der ein kleiner Leuchtturm stand, hindurch. Der einzige große Anlegeplatz war frei und die 'Oyama Maru' manövrierte langsam an das Pier. Vor den Lagerhäusern türmten sich riesige Stapel Holzstämme, offensichtlich auf ihre Verladung wartend. Neuseelands Holzindustrie schien im vollen Gange.
Einer der Ersten, die das schwankende Fallreep hinunter eilten, war Carl. Er hatte seinen Seemannssack über die Schulter geworfen und unter dem rechten Arm trug er den sichtlich verstörten Fixy. Kaum hatte er den Fuß auf das Quai gesetzt, wurde er von einem stattlichen Beamten, dessen braunes, breites Gesicht untrüglich den Maori verriet, in Empfang genommen. Dieser nahm seinen Pass entgegen und dirigierte ihn freundlich aber bestimmt rechts zum Gebäude, wo Zoll und Hafenmeister untergebracht waren. Hinter einer Glastür wartete schon der Beamte, zuständig für umweltbezogene, staatliche Sicherheit.
„Tut mir leid, Sir, im Moment ist kein Tierarzt zur Hand“, meinte er achselzuckend. „Der Hund muss aber sowieso hier bleiben, bitte folgen Sie mir.“
Der Zwinger war eng, aber sauber. Bevor Fixy merkte, wie ihm geschah, landete er hinter dem Drahtgitter, von wo er Carl mit fragenden, runden Kugelaugen betrachtete.
„Wer sieht denn nach ihm und füttert ihn?“, machte sich Carl Sorgen.
„Keine Bange“, versicherte der Beamte. „Er wird gut versorgt. Morgen kommt der Tierarzt und das Füttern übernimmt eine Frau. Ich habe sie schon aufgeboten.“ Damit beugte er sich zu Fixy hinunter. „Bist im Moment halt allein hier, Kleiner.“
Vorsorglich schob Carl ein paar Biskuits durch das Gitter. Fixy schnappte gierig danach und war damit eine Weile beschäftigt.
„Dann kann ich jetzt gehen?“
„Ich brauch nur noch ein paar Daten und ihre Anschrift“, antwortete der Beamte. „Wir können das draußen erledigen.“
Als sie die Türe hinter sich schlossen, folgte ihnen ein erbärmliches Winseln und während Carl das Formular ausfüllte, ertönte ein Geheul und Gebell, das durch Knochen und Mark ging.
„Das ist immer so“, sagte der Beamte bedauernd. „Aber sie beruhigen sich bald. – Sie können ihn natürlich jederzeit besuchen. Morgens neun bis nachmittags um fünf Uhr ist immer jemand hier.“
„Wann kommt er dann wieder frei?“
„Das entscheidet der Arzt. Normalerweise in einer Woche, maximal zehn Tage.“
Carl streckte ihm das Formular hin. „Eine Anschrift habe ich natürlich noch keine. Hab ja noch keine Bleibe.“
„Vielleicht ein Hotel?“
„Ich dachte eigentlich an etwas Einfacheres.“
„Ein Bed & Breakfast? ... Da wüsst' ich ihnen eine Adresse, nicht weit vom Zentrum und preiswert“, schlug der Beamte vor.
„Wenn Sie meinen! ... Ja, warum eigentlich nicht.“
„Es liegt an der Hardy Street, fast genau gegenüber einem kleinen Park, Nummer hundertachtundzwanzig. Es ist ein älteres traditionelles Haus, mit weißer Veranda und großen Fenstern. Die Besitzerin ist eine weit entfernte Verwandte meiner Frau und ist verwitwet. Sie wird froh sein über einen anständigen Untermieter.“
„Gut, ich werd's mir ansehen.“
Zufrieden nickte der Beamte und blickte auf das Papier in seinen Händen.
„So, ... da, bitte noch ihre Unterschrift!“
„Danke!“ Carl kritzelte seinen Namen auf die bezeichnete Stelle.
„Ich werde morgen bestimmt herkommen und nach meinem Fixy sehen.“
„Also, dann bis morgen ... und viel Glück!“
„Nochmals vielen Dank!“
Carl eilte hinaus, während drinnen das Bellen und Winseln nicht aufhören wollte. Er nahm seinen Pass in Empfang, schulterte seinen Sack und marschierte strammen Schrittes der fremden Stadt zu.
Robin lernte er ein paar Tage später kennen. Seine Sorge um Fixy trieb ihn immer wieder in Richtung Hafen und zu dem Gebäude, wo der kleine Hund geduldig ausharrte. Jedes Mal, wenn er den Kopf durch die Türe streckte, empfing ihn lautes Gebell. Deshalb war er an diesem Vormittag erstaunt, als kein Laut zu hören war. Vor dem Zwinger kauerte eine Gestalt und redete leise mit dem Tier, während sie einen Napf mit dicken Fleischklötzen aus einer Dose füllte. Fixy stand erwartungsvoll wedelnd dabei und blickte nur kurz Carl entgegen.
„Na du treuloser Kerl“, reklamierte Carl. „Wenn's ums Futtern geht, ist alle Freundschaft vergessen.“
„Einen Moment“, sagte die Gestalt über die Schulter. „Ich bin gleich fertig.“
Sie stand auf, wandte sich um und stellte die leere Dose auf ein Gestell. Carl erkannte einen wirren braunen Lockenkopf und ein fein geschnittenes Gesicht. Die rotbraune, gefärbte Haarpracht täuschte nicht darüber hinweg, dass die Frau bereits über fünfzig sein musste. Feine Fältchen scharten sich um ihre Augen und gaben ihr einen spöttisch blinzelnden Ausdruck. Die Person selber war zierlich und eher kleingewachsen, was ihren pfiffigen Eindruck noch verstärkte. Jetzt strich sie das einfache, geblümte Kleid zurecht und lächelte Carl freundlich entgegen.
„Er ist schon ein kleiner Vielfraß, der Fixy“, sagte sie.
Ihre Stimme klang hell, wie eine kleine Glocke. Ihr Hall war längst verklungen, als Carl sich fasste und verwirrt fragte: „Sind Sie die Tierärztin?“
„Aber nein!“, lachte sie ihn an. „Ich schau nur nach den Tieren. ...
Das heißt, wenn welche hier sind. Füttern und sauber halten, Sie wissen schon. ... Der Tierarzt, der war gestern hier.“
„Dann ist alles in Ordnung, ... mit Fixy?“
„Natürlich“, sagte sie und holte ein Brett vom Hacken. „Hier steht's, am Montag kommt er heraus.“
„Noch so ein Wochenende“, entfuhr es Carl.
„Warum?“
„Ach nichts! ... Ist ein langweiliges Kaff, dieses Nelson.“
„Soo...“, meinte sie gedehnt. „Find ich eigentlich nicht.“ Fragend schaute sie ihm in die Augen. „Wo wohnen Sie denn?“
Er erklärte es ihr. Das Haus war tatsächlich ruhig und das Zimmer sauber und wohnlich. Aber das war auch schon alles. Die Besitzerin ließ sich kaum einmal blicken und weitere Mieter gab es keine. Carl fühlte sich völlig allein.
„Ach, bei Dorothea, da sind Sie. Das ist ja nur ein paar Blocks von mir.“
„Sie wohnen auch an der Hardy Street?“
„Ah, nein, ich hab dort nur meine Bilder“, antwortete sie leicht verlegen.
„Sie malen?“
„Oh, bitte entschuldigen Sie Herr Hansen. Ich bin Robin Fleming und das Café Gallery stellt meine Bilder aus.“
„Sie kennen meinen Namen?“
„Natürlich, steht ja auf der Tafel hier.“ Damit hängte die das Brett zurück und entsorgte die leere Dose im Abfalleimer. Während Carl sich mit Fixy unterhielt, hantierte sie geschäftig hinter seinem Rücken. Und als er endlich aufstand, sagte sie: „Wenn Sie möchten, können Sie mitfahren. Ich will jetzt auch zur Hardy Street.“ Carl überlegte nicht lange. „Gerne“, antwortete er. „Wenn Sie mir erlauben, Sie dort zum Kaffee einzuladen.“
Auf einmal war Nelson überhaupt kein langweiliges Kaff mehr, und noch an diesem Wochenende fuhr er mit hinaus nach Mapua, wo Robin in einem kleinen Häuschen ihr Atelier eingerichtet hatte.
Mitten in seinen Gedanken merkte Carl plötzlich, wie weit er abgetrieben worden war. Direkt vor ihm lag die Ruby Bay, welche viel weiter westlich lag. Er raffte sich auf und fing kräftig an zu paddeln. Der Seemann in ihm tadelte seine Unvorsichtigkeit. Man durfte mit einem Kanu nicht so weit hinaus. Wenn das Wetter jetzt noch umschlug, dann Gnade ihm Gott. Aber er war zuversichtlich. Es würde zwar ein hartes Stück Arbeit werden, gegen die Strömung wieder vor das Waimea Estuary zu kommen. Aber er würde es schon schaffen und rechtzeitig mit der Flut durch den engen Einlass zurück zum alten Bootssteg gelangen. Morgen, da würde er es gemütlicher nehmen und mit seinem richtigen Boot, der 'Mollymawk', zum Fischen hinausfahren.
KAPITEL 2
Die 'Mollymawk' war zwölf Meter lang und hatte eine enge aber gemütliche Kajüte unter Deck. Ein sanftes Schaukeln und der leichte Stoß gegen die Fender weckten Carl. Der Schatten eines anderen Bootes schwebte an der Luke vorbei, durch welche die morgendliche Dämmerung ein fahles Licht in den düsteren Raum warf. Das leise gleichmäßige Tuckern verlor sich langsam in der Ferne.
Die Yacht nebenan ist bereits ausgelaufen, dachte Carl schläfrig und ließ seinen Geist unentschlossen im Zwielicht zwischen Schlaf und Wachsein treiben. Die verfluchten Deutschen wollten doch immer die ersten sein. Er hatte keine Eile, außerdem machte sich jetzt ein schmerzhaftes Pochen in seinem Kopf bemerkbar. Er drehte sich gegen die Wand und versuchte nochmals einzuschlafen. Erfolglos. – Wer gab ihnen überhaupt das Recht, sich hier aufzuführen, wie wenn ihnen ganz Neuseeland gehörte?
Carl warf sich auf die andere Seite. Verflucht, nun hatten sie es geschafft. Es war endgültig vorbei mit dem Schlafen. Die wütende Stimme des Deutschen drang erneut in sein Ohr: „Mach, dass du versoffener, alter Lump von unserer Yacht kommst!“, schrie dieser und hätte ihn beinahe ins schwarze Wasser zwischen den Booten gestoßen. Dabei hatte alles so harmlos angefangen. Der scheiß Whisky ließ ihn doch immer wieder alle Hemmungen fahren und holte die Wahrheit hervor, die er ihnen dann ins Gesicht schleuderte. Ja, es war nichts als die Wahrheit, und er hasste diese verfluchte Bande von Mördern. – Trotzdem, er sollte sich nicht derart gehen lassen. Erschöpft sank er zurück.
Als er gestern müde und abgekämpft von der langen Kanufahrt zurückkam, lag eine blendend weiße Segelyacht neben seiner alten 'Mollymawk'. Der Kapitän und offensichtlich auch der Besitzer des stolzen Bootes mit dem Namen 'Ostwind' winkte jovial herüber und begrüßte ihn mit lauter Stimme.
„Ahoi!“, rief er, als Carl auf sein eigenes Deck sprang. „Guten Tag Herr Nachbar!“
„Hallo!“, nickte Carl zurück.
„Was für ein herrlicher Tag“, fuhr der Fremde fort. „Wir sind eben erst eingetrudelt und wollen unsere Ankunft nach guter Seemannstradition feiern. Hätten Sie Lust auf ein Bier?“
„Hm..., weiß nicht...“
„Wer ist da, Rolf?“, tönte es von unten in bestem, hellem Hochdeutsch. Ein Kopf mit blondem, kurz geschnittenem Haar tauchte auf.
„Unser Nachbar steuerbord, Liebste. Endlich jemand, der mit mir ein Bier trinkt.“ Dann zu Carl hinüber: „So kommen Sie schon! Es ist schön kühl, echtes Löwenbräu.“
Deutsche, durchfuhr es Carl. Er wollte kurz angebunden ablehnen, aber nun tauchte die Frau in Lebensgröße auf. Der jugendliche, schlanke Körper war von goldener Sonnenbräune und nur mit einem knappen, hellblauen Bikini bedeckt. Die Sonnenbrille hatte sie ins strohblonde Haar geschoben, und ihre Haltung mit bloßen Füssen auf dem blanken Deck war aufreizend genug, um selbst einem Carl die Sprache zu verschlagen.
„Bitte“, lächelte sie herüber und ließ sich in einen der Stühle unter dem Sonnensegel fallen.
„Na ja“, sagte Carl. „Wenn's sein muss.“ Alle Deutschen konnten ja nicht schlecht sein und das junge Paar machte einen sorglosen, fröhlichen Eindruck. Ein gutes Bier war sowieso nicht zu verachten.
Er schwang sich also auf das Deck der Yacht und stellte sich vor:
„Ich bin Carl Hansen.“
„Rolf Jürgens“ antwortete der Deutsche und schüttelte kräftig seine Hand. „Und das ist Ute. – Wir kommen aus Hamburg, auf 'ner Reise um die Welt.“
Ute beugte sich vor und streckte ihm die Hand entgegen. Die knapp bedeckten Brüste waren eine Augenweide und ihre hellgrauen Augen blitzten auf. „Willkommen an Bord ... Carl! ... Ich darf doch Carl sagen?“
„Natürlich“, murmelte er und schielte auf die langen, makellosen
Beine. „Bleiben Sie lange in Nelson?“
„Eigentlich nur einen Tag. Wir wollten Treibstoff bunkern und dann weiter durch die Cook Strait. ... Aber jetzt... gefällt es mir ganz gut hier“, sagte sie und streckte sich wohlig.
Carl setzte sich ihr gegenüber, während Ute ihn durch die langen Wimpern beobachtete. Er war trotz seines Alters immer noch ein stattlicher Mann. Nicht besonders groß aber drahtig und mit einer lederbraunen Haut, die seine vielen Aktivitäten im Freien, besonders auf dem Wasser, verrieten. Wie die meisten Neuseeländer war er mit Shorts und einem einfachen, bunten Shirt bequem gekleidet. Auch er ging barfuß.
Rolf verschwand unter Deck und das Klappern und Klingen von Flaschen tönte herauf. Kurz darauf erschien er mit einem Korb voller Bierflaschen und einem Glas perlendem Champagner.
„Danke Liebling“, sagte Ute und nahm das Glas entgegen.
Er stellte den Korb zwischen sie und grinste: „Dachte, ich bring' gleich ein paar zusätzliche herauf. Unser Durst könnte sich grösser erweisen, als angenommen.“
Stehend öffnete er die Flaschen und reichte eine Carl. Dieser hob sie dankend und nickte in Richtung der schönen Frau.
„Prost!“, rief Rolf laut. „Auf eine gute Nachbarschaft.“
Dann tranken sie.
„Einfach köstlich, so ein Bierchen“, seufzte Rolf. Er stand immer noch wie ein Fels zwischen ihnen und blickte wohlgefällig in die Runde. Sein blaues T-Shirt, auf dem ein gesticktes Steuerrad prangte, spannte sich über den leichten Ansatz eines Bauches. Die weiße Hose war makellos und seine Füße steckten in leichten Segeltuchschuhen. Nur die goldverzierte Mütze fehlte zu einem Bilderbuchkapitän. Sein Gesicht war faltenlos und hatte eine leicht glänzende Röte von der Sonne, ganz im Gegensatz zu der herrlichen Bräune seiner Frau. Auch lichteten sich seine dunkelblonden Haare über den Schläfen und gaben ihm eher das Aussehen eines biederen Buchhalters, als das eines sportlichen Weltenbummlers.
„Ihr solltet ein paar Tage bleiben“, sagte Carl. „Nelson ist ein interessanter Ort, den man nicht einfach links liegen lässt.“
„Er hat recht, Rolf, stimmte Ute bei. „Ein Bummel durch die Stadt muss einfach herrlich sein. Sicher gibt es hier fantastische Boutiquen und ich habe gelesen, dass Nelson ein wahres Künstlerparadies sein soll.“
„Weiß nicht recht“, entgegnete der Mann. „Wir wollten doch nach Norden, Auckland und dann die Inseln ...“
„Die erreichen wir doch immer noch. ... Bitte!“
Ergeben sank Rolf auf einen Stuhl. „Na ja, wenn du unbedingt möchtest.“
„Da gibt's auch ein paar interessante Lokale“, doppelte Carl nach und grinste. „Ein schottisches Pub, ganz im alten Stil mit herrlichem Ale und einem Whisky für echte Kerle.“
Rolf angelte sich die zweite Flasche. „Also, gut. Ja, warum eigentlich nicht“, meinte er versöhnlich.
„Ich versteh's ja, dass dir so ein Stadtbummel auf den Wecker gibt“, lenkte Carl ein. „Geht mir selber auch nicht besser. Dieses Shopping' ist einfach nichts für unsereins.“
„Auch nicht für unseren Geldbeutel!“, ergänzte Rolf bübisch ernst.
„Ach, du alter Geizhals!“, lachte Ute.
„Wir könnten ja zum Fischen hinausfahren, während die Dame die neuseeländische Wirtschaft ankurbelt“, schlug Carl vor. „Ich wollte morgen sowieso mein Glück versuchen.“
„Ausgezeichnet!“, rief Rolf begeistert. „Du bist meine Rettung Carl.“
„Das versteh' ich überhaupt nicht“, sagte Carl und schielte in Richtung hellblauer Bikini. „Da braucht's doch bestimmt keine Rettung vor so einer schönen Frau.“
„Da schau her!“, polterte Rolf und lachte. „Unser Gast macht Komplimente. Nur zu, was glaubst du, wie mühsam so eine einsame Seereise mit ihr werden kann.“
Ute winkte lächelnd ab: „Rolf, bitte ...“ Dann zwinkerte sie in Carls Richtung und sagte mit gespieltem Ernst: „Sieh nur, Carl, er ist meiner überdrüssig.“
„Wart nur, meine Liebe!“, ging Rolf darauf ein. „Warte, bis wir in Hawaii sind und mir die hübschen Mädchen Blumen um den Hals legen und auf meine Knie klettern.“
„Na ja, unterdessen geht ihr beide ruhig zuerst einmal zum Fischen und ich schau mich in Nelson etwas um.“ Damit stand sie auf. „Ich will mir nur schnell etwas überziehen. Es wird langsam kühl.“ Sie entschwand mit wiegendem Gang den Blicken der beiden Männer.
Stolz leuchtete in Rolfs Augen. „Ein Klasseweib oder etwa nicht.“
„Hm... ja, natürlich.“
„Ihre Familie stammt ursprünglich aus Schweden, daher die blonden Haare. ... Hat sie früher lang getragen, aber zum Segeln ist das nichts, ... du weißt schon.“ Er verstummte, denn Ute kehrte zurück.
Sie hatte sich ein buntes Kleid übergezogen. Es schmiegte sich eng um ihren Körper und betonte ihren schlanken Hals verführerisch.
Carl konnte sich das lange seidene Haar gut vorstellen, wie es um die makellosen Schultern floss und mit der gebräunten Haut zu matt schimmerndem Gold verschmolz. Tatsächlich, die Frau war eine verwirrende Schönheit und sie war sich ihrer Wirkung auch sehr bewusst. Sollte sie vielleicht dem Klischee entsprechen, welches schöne, blonde Frauen zu Dummerchen abstempelte. Carl glaubte nicht daran. Ute spielte sehr wohl mit ihren Reizen, aber dumm war sie bestimmt nicht.
Sie tranken und schwatzten. Die Stimmen wurden lauter und der Inhalt des Korbes war längst verschwunden. Auch Ute trank nach deutscher Manier nun ebenfalls Bier. Rolf stieg unter Deck auf der Suche nach einer Flasche, die er als absolut unentbehrliches Wundermittel der Notapotheke bezeichnete.
„Du bist also kein Neuseeländer, Carl“, stellte Ute fest.
„Nein, ich bin Däne.“
„Dacht ich mir schon, nach deinem Namen.“
„Wir sind hier eigentlich alles Zugewanderte“, erklärte er. „Die Ältesten kamen vor ein paar Generationen her, hauptsächlich Engländer, Schotten, Iren, einige Jugoslawen und aus fast jedem Land Europas ein paar. Nur die Maoris sind etwas länger hier, aber sie sind genauso zugewandert, ... aus Polynesien.“
„... und jetzt auch noch einer aus Dänemark“, fügte sie schalkhaft hinzu.
„... und eine aus Schweden!“, beendete er und blickte in ihre silbern strahlenden Augen.
Sie lachte. „Aha, Rolf hat dich schon über mich aufgeklärt. Ja, meine Eltern kamen aus Schweden. Ich bin aber in Hamburg geboren und bin Deutsche.“
Sie wurde ernst. Instinktiv erfasste sie seine Gedanken. „Du magst uns nicht besonders, die Deutschen?“
„Hm...“
Rolf kletterte mühsam die Treppe herauf und hörte die letzten Worte. „Was ist mit uns?“, begehrte er auf.
„Nichts, Liebling“, sagte Ute schnell. „Komm, schenk endlich ein!“
„Zu Befehl Frau Kapitän“, schnappte er. Seine Bewegungen waren schon etwas unsicher, als er die Gläser aufs Tischchen knallte und den Whisky randvoll einschenkte.
„Ein Black Label“, kommentierte er. „Haben die Kerle vom Zoll glatt übersehen.“
„Ein Glück für uns“, fand Carl und ließ einen kräftigen Zug durch die Kehle rinnen. Wohlige Wärme breitete sich im ganzen Körper aus und versetzte ihn in eine Stimmung in welcher er ganze Welten versetzen konnte. Deshalb meinte er anzüglich: „Hätte ich nie gedacht, dass ein Deutscher solch herrlichen Whisky an Bord haben könnte und dazu noch eine solch wundervolle Frau.“
„Ha“, machte Rolf und grinste verächtlich. „Hab' noch eine zweite ... Flasche natürlich. ... Die Frau, die hätten sie ruhig beschlagnahmen können.“
„Ich bin keine Ware“, setzte sich Ute zur Wehr. „Rolf, jetzt wirst du beleidigend.“
„Ach was! ... Sei ruhig!“, knurrte er jetzt schon reichlich betrunken.
„Die scheiß Zöllner haben mein ganzes Boot auseinander genommen. Sie haben den ganzen Kühlschrank geleert, nur dich ...“
„Es ist genug, Rolf. ... Bitte trink nicht so viel!“
„Ich trink' so viel ich will, merk dir das! ... Komm schon Carl, wir lassen uns doch nicht einen guten Schluck versauen. Weiber und Zöllner, diese Scheißkerle!“
„Sie tun nur ihre Pflicht“, wandte Carl ein.
„Die Weiber!“, grölte Rolf. „Die tun's überhaupt nicht. ... Mach schon mein verehrtes Weib, hol uns die zweite Flasche! ... Etwas Beeilung, wenn ich bitten darf!“
„Ich mag nicht mehr“, sagte Carl und wollte aufstehen. Aber Rolf hielt ihn zurück. „Was soll das? ... Willst wohl mit einem standfesten Deutschen nicht saufen!“
„Bitte Rolf, lass das“, flehte Ute und legte beruhigend ihre Hand auf seinen Arm.
Vor Carl spielte sich das Folgende mit der trägen Klarheit des Angetrunkenen ab. Rolf packte Utes Handgelenk und drehte den Arm brutal auf den Rücken, versetzte ihr einen Stoß Richtung Abgang. Er schrie: „Nun mach schon du Schlampe, ich hab' dich was geheißen!“
Während die Frau stöhnend wieder auf die Beine kam, stemmte sich Carl hoch. Viel zu langsam, wie ihm schien. Dann packte er Rolf am Kragen und drückte ihn mit Gewalt in den Stuhl. Ein Glas kollerte über das Deck und verschüttete den scharf riechenden Inhalt. „Hör auf du ... du ... du ...!“, schrie er nun seinerseits. „Rühr sie noch einmal an und ich schlag' dich zu Brei.“
Der Bedrängte lag schlapp in seinem Stuhl und grinste blöde. „Da schau her! ... Er ist auch so ein Besserwisser, wie die scheiß Zöllner. Sie wollen alle, dass ich kusche. Aber merk dir, ein Deutscher der kuscht nicht. – Ich pfeif auf euer Neuseeland!“
„Nun hör mir gut zu, ... mein Freund. Du bist in unserem Land ein Gast und das respektieren wir. Aber wenn ich vorhin sagte, die Zöllner tun nur ihre Pflicht, dann ist es auch so. Unsere Gesetze sind klar und gelten für jeden, auch für dich. Wolltest wohl ein paar stinkende Würste hereinschmuggeln. Aber wir wollen euer verfluchtes BSE, oder was immer für Seuchen ihr habt, nicht. Dass dir die Zöllner den Kühlschrank ausräumten, ist einzig deine eigene Schuld.“
„So ein Bocksmist! Wir Deutschen schleppen doch nichts ein.“
„Wir Deutschen, wir Deutschen“, äffte Carl nach. Das Blut und der Alkohol rauschten in seinem Kopf. „Ihr habt überhaupt nichts gelernt. ... Ihr seid Nazis geblieben wie eh und je. Ihr wollt über allem herrschen und befehlen. ... Selbst vor den Frauen habt ihr keinen Respekt.“
„Jetzt muss doch tatsächlich so ein Scheißdäne daherkommen und mir sagen, wie ich mit meiner eigenen Frau umzugehen habe. Dabei hat der Lump sie schon den ganzen Abend angemacht. Deinesgleichen hätten wir kurzerhand abserviert, auf nimmer wiedersehen.“
„Ja, darin ward ihr einsame Spitze. Aber damit ist endgültig vorbei. Die Welt hat sich geändert und für Leute wie dich ist hier kein Platz. Deine Art ist uns zuwider und deinen scheiß Whisky will ich schon gar nicht. Mir ekelt!“
Carl wandte sich zur Reling und hielt sich fest. Mittlerweile war es dunkel geworden und die Kluft zwischen den Schiffen war schwarz und drohend. Ute war längst leise unter Deck verschwunden. Drohend stand Rolf hinter ihm und geiferte: „Möchtest mich wohl los sein, damit du freie Bahn bei Ute hast.“
„Hol dich doch der Teufel! Wenn ich das wollte ... Es wär' ein leichtes. Ich würd' dich ersäufen und keiner würde dir eine Träne nachweinen. Ein besoffener Ausländer, der über Bord fiel ...“
Rolf torkelte gegen ihn und schrie: „Mach, dass du von meiner Yacht kommst, du versoffener Lump! Ich lass mir doch von dir nicht drohen.“
Irgendwann registrierte sein umnebeltes Hirn ein Poltern. Ihm war schlecht, der ganze verfluchte Kahn schwankte ja. Dann hörte er es wieder und das Schaukeln bedeutete, dass jemand an Bord gekommen war. Ruckartig saß Carl auf dem Rand der Koje und hielt sich den Kopf. Vielleicht war es Robin, die früher zurück gekommen war. Sie tauchte manchmal unverhofft auf. Aber sein Kopf brummte wie ein Hornissennest. Mein Gott, dachte er, wie konnte man nur so blöd sein und so viel trinken. Dann kletterte er mühsam den Aufgang hoch. Oben im gleißenden Licht stand etwas Dunkles. Er blinzelte. Eine Tasche, registrierte er. Die gehörte doch nicht hierher.
Oben angekommen drehte er sich um. Vorn auf dem Vorderdeck saß eine Gestalt, die Knie angezogen und den Kopf darauf, ein Häuflein Mensch. Ihm schwindelte. Die blonden Haare, das war doch Ute.
Als sie ihn gewahrte, kam sie zögernd nach hinten. „Guten Tag Carl“, sagte sie und blickte ihm hilflos ins Gesicht.
„Tag Ute! Was tust du denn hier?“ Er schaute sich um. „Wo ist denn die Ostwind' ... und wo ist... Rolf?“
Die Gestalt vor ihm hatte überhaupt nichts mehr von der verführerischen Frau mit den langen Beinen an sich. In verwaschenen Jeans und einer weißen Bluse sah sie viel eher wie ein schüchternes Schulmädchen aus.
„Er ist weg, ... heute früh“, antwortete sie. „Es, ... es tut mir leid Carl, ... wegen gestern.“
„Du brauchst dich nicht zu entschuldigen“, brummte er. „Wir waren besoffen und dann kann ich mich einfach nicht beherrschen. ... Mir tut's leid.“
„Carl“, begann sie. „Kann ich für den Moment hier bleiben, bis ich etwas gefunden habe. In der Stadt ist um die Zeit sicher noch alles geschlossen.“
„Natürlich! ... Wie viel Uhr ist's denn?“
„Kurz vor neun“, antwortete sie. „Rolf ist bereits um sechs Uhr ausgelaufen, obwohl er noch völlig betrunken war.“
„Der Idiot!“, entfuhr es Carl.
„Ja, hab' ich auch gesagt. Er will hinüber nach Wellington. Und wenn ich nicht mitkomme, so sei ihm das nur recht. – Ich brauch' sowieso etwas Abstand.“
„Wann kommt er zurück?“
Sie zuckte die Achseln. „Weiß ich nicht.“
„Er kann dich doch nicht einfach sitzen lassen. Ist der Mann völlig bescheuert.“
„Lass gut sein, Carl. Ich werde mir für ein paar Tage eine Pension suchen.“
Nun regte sich der Kavalier im Manne und dessen Beschützerinstinkt. „Du kannst natürlich auf der 'Mollymawk' bleiben. Es ist zwar eng aber wir werden schon einen Weg finden.“
Ihre großen Augen waren mit seinen fast auf gleicher Höhe und blickten unergründlich und fragend.
„Keine Angst, ich überlass dir natürlich die Koje“, sagte er schnell.
„Und jetzt brauchen wir zuerst einen Kaffee. Jawohl, frischen Kaffee, der uns auf die Beine hilft.“
Als sie hintereinander hinunterstiegen, schlug ihnen der Mief der letzten Nacht entgegen. Schnell riss Carl eine Luke auf und warf die zerwühlte Wolldecke vom Boden auf die Koje.
„Bitte entschuldige diesen Saustall“, sagte er zerknirscht. „Hatte noch keine Zeit zum Saubermachen.“
Sie lachte hell auf. „Dir fehlt wohl die Hausfrau!“
Da, da war sie wieder, die aufreizende Person von gestern. Jetzt funkelten auch die Augen wieder schelmisch, und als sie sich der kleinen Kombüse zuwandte, kam er nicht darum herum die herrlich strammen Formen in den engen Jeans zu bewundern.
„Wo hast du denn den Kaffee?“, verlangte sie zu wissen, während sie die Gasflamme hochdrehte.
„Unten im rechten Schrank“, antwortete er. „Aber lass nur, ich mach' das schon.“
Endlich saßen sie am Klapptisch, mit dampfenden Tassen in der Hand. Mit jedem Schluck wurde sein Kopf klarer und immer mehr wunderte er sich, wie er in diese Situation hineingeschlittert war. Die Frau gegenüber könnte gut und gerne seine Tochter sein, aber er war ein Mann und noch keineswegs zu alt und unempfänglich für weibliche Reize. – Ja, warum ergriff er nicht einfach die Gelegenheit und fuhr mit ihr hinaus zu einer einsamen Bucht? Es gab drüben im Marlborough Sound hunderte sonnengebadeter Plätzchen, wo sie tagelang allein wären und ungestört der Lebenslust freien Lauf lassen konnten. Sie konnten sich nackt in den goldenen Stand legen, die Sonne würde ihre Körper wohlig erwärmen, und das glasklare Meer würde frischen, zarten Fisch auftischen. – Und zum Dessert gäbe es herrliche, köstliche Liebe, nichts als Liebe ...
KAPITEL 3
Der Abel Tasman Nationalpark erstreckt sich über gut zweiundzwanzigtausend Hektaren Buschland entlang der Küste der Tasman Bay. Er reicht hinein, bis zum Mount Evans und in die Takaka Hills über dem gleichnamigen Tal, welches in nördlicher Richtung hinunter zur Golden Bay führt. Kurz nach der kleinen Ansiedlung Marahau, nahe einem sumpfigen Küstengebiet, befindet sich der südliche Eingang zu diesem einmaligen Reservat. Ein weiterer, der nördliche, befindet sich an der Wainui Bay und ist von Takaka aus erreichbar. Lange, einsame Tracks führen durch den Urwald. Das ganze Gebiet ist nur zu Fuß zu durchqueren und die zerrissene Küstenlinie mit den vielen einsamen Buchten ist nur mit dem Boot erreichbar. Es besteht deshalb die strenge Vorschrift, sich im Visitorbuch bei den Eingängen mit Angabe über die geplante Route und die voraussichtliche Rückkehr einzutragen.
Diese Vorschrift galt natürlich nur für Touristen und nicht für die ortskundige Dreiergruppe des DOC, die an diesem frühen Nachmittag, vom nördlichen Takaka kommend, die Awaroa Bay durchquerte und zielbewusst in den regennassen Wald hinein marschierte. Sie waren spät dran, aber die Awaroa Bucht war nur bei Ebbe passierbar, dann, wenn sie bei niedrigstem Wasserstand völlig austrocknete, und das war an diesem Tag eben erst um die Mittagszeit möglich gewesen. Das Departement of Conservation, man kann es mit Departement für Umwelt- und Heimatschutz übersetzen, war nicht nur der strenge Hüter der vielen neuseeländischen Nationalparks, sondern befasste sich auch intensiv mit der Erhaltung von Fauna und Flora. Es gibt auf dieser Erde wohl kaum ein weiteres Land, das sich derart gründlich mit dem Schutz seiner Natur auseinander setzt. Das hat seine Gründe.
Die drei Hauptinseln Neuseelands, North-, South- und Stewart-Island wurden vor etwa achtzig Millionen Jahren von der großen südlichen Landmasse, Gondwanaland genannt, getrennt und drifteten weit nach Osten. Sie wurden vom Rest der Welt derart isoliert, dass das Land seine ureigensten Arten hervorbrachte. Neben vielen außergewöhnlichen Pflanzen hat vor allem die Vogelwelt eine erstaunliche Evolution durchgemacht. Da den Vögeln am Boden seit jeher die natürlichen Feinde fehlten, fanden sie das Fliegen überflüssig, nisteten im Unterholz und pickten Maden und Würmer aus dem Erdreich. Mit der Zeit verkümmerten sogar ihre Flügel. Neben dem Kiwi, dem Weka oder Pukeko gibt es auch heute noch viele solch flugunfähige Vögel. Der Kiwi, als das Nationalsymbol von Neuseeland, ist wohl der bekannteste. Leider kamen mit den Menschen und den modernen Verkehrsmitteln auf einmal auch Feinde ins Land. Flinke Räuber, wie Wiesel, Ratten und Frettchen fanden in den behinderten Vögeln und deren Gelege leichte Beute. Dummerweise wurden gerade die Frettchen von den Menschen gezielt ausgesetzt, um der damaligen Kaninchenplage Herr zu werden. Die Kaninchen ihrerseits wurden vorher ironischerweise ebenfalls als Nutztiere durch die ersten Siedler ins Land gebracht. Ratten kamen mit den Schiffen an Land und vermehrten sich unaufhaltsam zu einer Plage. Ein richtiger, unkontrollierbarer Teufelskreis begann also. Eine der vordringlichsten Aufgaben des DOC wurde deshalb, diesen zu durchbrechen und nach Möglichkeit die kleinen Räuber auszumerzen.
Diese ganze Problematik kannte Robin Fleming nur zu gut. Seit über zwanzig Jahren arbeitete sie für das DOC und war mit Überzeugung und Eifer dabei, wenn es darum ging weiteren Schaden zu vermeiden und die endemischen Vögel vor dem sicheren Aussterben zu bewahren. Trotzdem, es wurde immer mühsamer, die schweren unförmigen Fallen auf einem Traggestell durch den Wald zu schleppen. Das war harte Knochenarbeit, und sie fragte sich in letzter Zeit öfters, ob sie nicht doch langsam zu alt dafür wurde. Die beiden jungen Mitstreiter auf dem Pfad vor ihr hatten offensichtlich keine Mühe und marschierten zügig weiter. Nun, sie war selber schuld. Sie bestand jedes Mal darauf, dass jeder, ob Mann oder Frau, alt oder jung, sich gleichviel zumute und sich das Dutzend Fallen ohne Murren aufbürde.
Wie immer ging ihr Sohn Paul voraus. Dann, unvermittelt blieb er bei einer roten Markierung stehen und spähte in das dichte Buschwerk dahinter. Das dreieckige, glänzende Täfelchen, in Augenhöhe an einem Baum befestigt, bedeutete, dass sich in unmittelbarer Nähe eine der früher aufgestellten Fallen befand. Er bahnte sich ein paar Schritte durchs Unterholz. Dann hörte man ihn laut fluchen.
„Diese verdammten Touristen. Können sie die Fallen denn nicht in Ruhe lassen!“
Er schimpfte weiter Unverständliches vor sich hin und warf seine Last von der Schulter. Juliette, seine Freundin und dann auch Robin erreichten die Stelle und blickten auf die Bescherung. Eingedrückt und umgekippt lag der kleine zirka fünfzig Zentimeter lange Kasten im Gebüsch. Offensichtlich war es das Werk eines sinnlosen Fußtrittes. Ein paar kümmerliche Schalenreste verrieten, wo das als Köder benutzte Hühnerei gelandet und zerbrochen war.
Es dauerte eine ganze Weile, bis Paul die Trümmer beseitigt und einen neuen Kasten platziert hatte. Juliette half mit, holte ein neues Ei aus einem umgehängten Behälter, kniete sich hin und legte dieses sorgfältig in die neu gespannte Falle. Robin schrieb Nummer, Datum und Uhrzeit in ein Heft und fügte, dick unterstrichen, die Anmerkung 'zerstört' hinzu. Solchen Vandalismus trafen sie leider nur zu oft an. Entweder war es sinnlose Zerstörungswut kopfloser Passanten oder völliges Unverständnis, ja sogar gezielte Ablehnung ihrer Bemühungen. Wer konnte das schon genau wissen? Tatsache war, dass immer wieder ein großer Teil der Fallen in solcher Weise sabotiert wurden. Leider war man in einem Dilemma. Wollte man die Fallen weiter weg vom Pfad im Gebüsch verstecken, wäre das wegen dem dichten Urwald äußerst zeitraubend, ja fast unmöglich. Das Resultat wäre, dass man sie auch kaum mehr finden würde. Noch bessere Markierungen würden aber wieder genau das Gegenteil bewirken. Man konnte eigentlich nur an die Vernunft der Wanderer appellieren.
Als sie wieder auf dem Weg waren, drückte es Paul bitter so aus:
„Man sollte Fallen für dumme Leute aufstellen. Die Beute wäre reichlich.“
Sie folgten weiter dem Pfad, welcher sich in engen Kurven durch den Busch wand. Alle paar hundert Meter hielten sie an, luden eine Falle ab, platzierten sie gekonnt im Gestrüpp, markierten und registrierten. Auf diese Art arbeiteten sich die drei schweigend voran. Es begegnete ihnen niemand, denn die Schulferien waren vorbei, und die paar möglichen ausländischen Touristen hatten sich wohl vom nächtlichen Regen abschrecken lassen. Durch die Lücken der Bäume beobachtete Robin, wie kleine Rinnsale Wasser, vom weiter draußen liegenden Tasmanischen Meer herkommend, sich zögernd ihren Weg zurück in die Awaroa Bucht suchten. In etwa einer Stunde würde der ausgetrocknete sandige Grund verschwunden sein und die Fläche wieder geheimnisvoll, ihre Tiefen oder Untiefen verbergend, in der Abendsonne glitzern.
Die Gruppe wandte sich jetzt landeinwärts. Nachdem sie den sanften Übergang, den Tonga Saddle, überschritten hatten, folgten sie dem Richardson Stream, bis zu einem langgezogenen Strand hinunter. Draußen, direkt vor ihnen, lag Tonga Island und das entsprechende Marine Reserve. Ihr Tagesziel war aber weiter südlich, die Bark Bay. Wären da nicht die Lasten auf dem Rücken gewesen, wäre es einer traumhaften Wanderung gleichgekommen, denn der Regen der letzten Nacht hatte dem dunklen Wald, dem smaragdgrünen Wasser, den goldenen Buchten und dem azurblau strahlenden Himmel eine letzte, betörende Klarheit verliehen. Man hätte glaubten können, in einem riesigen Gemälde zu wandeln, umrahmt von weiß leuchtenden Sonnenstrahlen.
Lange bevor sie die Bark Bay erreichten, waren ihre Traggestelle bis auf ein paar beschädigte Fallen leer. Es war ausgemacht, dass sie in einer der Hütten des DOC übernachten würden. Dort würde der Helikopter auch ihre Ausrüstung und weitere hundert Fallen deponieren.
Die Bark Bay hat einen blendend weißen Strand, der in einem weiten Bogen in der einsamen Bucht liegt. Dahinter verstecken sich ein paar einfache Hütten zwischen Bäumen und Gebüsch. Eine befestigte Feuerstelle mitten auf einem offenen Platz und ein gut eingerichtetes Toilettenhäuschen weiter hinten, vervollständigten die Anlage. Sie wurde oft und rege benutzt, als Ausgangspunkt für weite Wanderungen, als Pfadfinderlager oder einfach als Unterkunft für Ausflügler. Dort fanden die stressgeplagten Menschen, weit weg vom Alltag, die sorglose Abgeschiedenheit des Waldes, die herrliche Wärme des goldenen Strandes oder mit dem Kanu die frische Lebendigkeit des kristallklaren Wassers.
Ihr Sohn Paul und seine Freundin Juliette waren vorausgeeilt, hatten ihre Lasten und Kleider vor der Hütte des DOC abgeworfen und plantschten bereits fröhlich, verliebt im herrlichen Wasser, während Robin die letzten hundert Meter durch den Sand stapfte. Die Beiden waren wie übermütige Kinder, spritzten um sich, kreischten und jauchzten. Eigentlich war es vor allem Juliette, die sich mit ihrem Übermut ins Wasser warf und um sich spritzte. Paul hatte eher die Gelassenheit seines Vaters geerbt. Er hatte alle Hände voll zu tun, um nicht im aufspritzenden Nass unterzugehen. Die jungen Körper umfingen sich und Robin betrachtete das herrliche Bild mit warmem Herzen und einem zufriedenen Lächeln. Gott musste vom gleichen Gefühl überwältigt worden sein, als er seine beiden Menschen im Paradies sah.
Robin betrat die Hütte und machte sich am Funkgerät zu schaffen. Es dauerte dann kaum zwanzig Minuten, bis das flatternde Geräusch des nahenden Helikopters ertönte. Er schwirrte heran, wirbelte den Sand auf und berührte kurz den Boden. Die offene Luke spukte ihre Rucksäcke und Ausrüstung aus. Robin rannte hinzu und half mit den vier sperrigen Stapeln Fallen. Sie winkte dem Mann im Schatten des klaffenden Loches nach, als der Helikopter sich wie eine Libelle in den Himmel hob und in einem eleganten Bogen verschwand. Wenige Minuten später war wieder einsame Stille. Leise plätschernd rollten kleine Brandungswellen in den Sand und irgendwo in den Büschen zirpten ein paar Zikaden.
Robin beobachtete das junge Paar, das ihr durch den Sand entgegenlief. Paul, mit einer dunkelblauen Badehose bekleidet, wirkte bedeutend älter als seine Freundin Juliette, welche ein helles Bisschen mit schmalen Trägerchen trug. Obwohl sie bereits zweiundzwanzig war, wirkte die Gestalt mädchenhaft zierlich. Das täuschte aber gewaltig, denn in der kleinen Person steckte eine unglaubliche Energie.
„Lass nur Robin!“, rief sie ihr entgegen. „Wir machen das schon.“ Und dann zum keuchend ankommenden Paul: „Fass an, wir schaffen das Zeug zur Hütte!“
„Danke“, sagte Robin und ließ sich in den Sand plumpsen. Sie war froh um die Hilfe und beobachtete, wie die Beiden alle Ruck- und Schlafsäcke hinaufschafften und zuletzt die Fallen zu einem Stapel aufschichteten. Nun war alles da, was sie für die nächsten paar Tage brauchten. Morgen würden sie weiter in südlicher Richtung marschieren.
Sie brachen kurz nach Tagesanbruch auf, denn die Kälte der Nacht kam langsam in die Hütte gekrochen. Den schnellen Kaffee, den Robin auf dem kleinen Gaskocher braute, tranken sie im Freien in den ersten wärmenden Sonnenstrahlen stehend. Dann packten sie zusammen. Nebst Rucksack und Schlafsack luden sie sich auch noch so viele Fallen auf wie sie tragen konnten. Das waren natürlich weit weniger als gestern. Nach kurzer Zeit keuchte jeder, selbst Paul, unter der Last. Jede Falle, die sie fortan los wurden, war eine Erleichterung und als sie die Hängebrücke über den Falls River erreichten, hatten sie fast die Hälfte der beschwerlichen Kasten im Wald zurückgelassen.