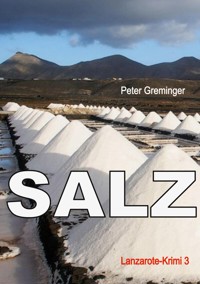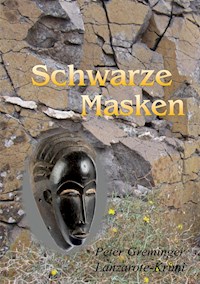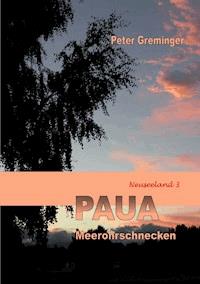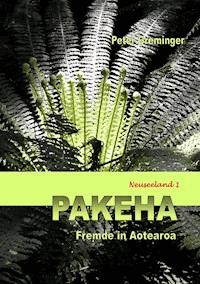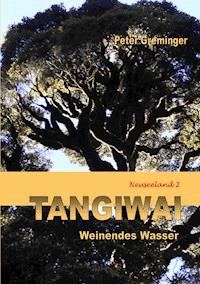
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bauernsohn Alois Hartmann verfluchte die starrköpfigen Ansichten seines Vaters und verließ mit seiner jungen Frau Judith überstürzt und enttäuscht den stattlichen Hof im schweizerischen Sankt Galler Rheintal. Wenn er als Zweitgeborener auch nichts galt, so würde er ihnen allen beweisen, wer etwas von Vieh, Ackerbau und Landwirtschaft verstand. Es war gutes Land am Taranaki, aber es forderte alles. Ausgelaugt und aller Illusionen beraubt, auch wenn die Hartmann-Station ein stattlicher Besitz geworden war, machte sich Judith am Heiligabend 1953 auf die Reise nach Auckland, wo sie bei ihrer Freundin Verständnis, Aufmunterung und Rat zu finden hoffte. Dass der Zug in der Heiligen Nacht sein Ziel nie erreichen würde, wusste aber außer vielleicht dem zürnenden Mount Ruapehu, niemand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Kurz bevor der Jahres-Aufenthalt in Neuseeland zu Ende ging und nachdem sein erster Roman PAKEHA (Fremde in Aotearoa) abgeschlossen war, wurde Peter Greminger von einem Ereignis gefesselt, welches das Land auf der anderen Seite der Welt vor rund fünfzig Jahren dramatisch erschütterte. Dieser zweite Neuseeland-Roman TANGIWAI war damit nur noch eine Frage der Zeit.
Peter Greminger war den größten Teil seines bisherigen Lebens gereist und hatte besonders im südostasiatischen Raum gearbeitet. Neuseeland war aber doch eine neue Erfahrung, die er nicht zuletzt seiner Frau Marlis zu verdanken hatte. Im frühen Ruhestand hatte er auf einmal die Zeit und Muße, die Welt um sich genauer zu betrachten und seine Gedanken auch zu Papier zu bringen. Damals ahnte er nicht, dass für ihn das Thema Neuseeland noch nicht abgeschlossen war und noch zwei weitere Romane entstehen würden: PAUA (Meerohrschnecken) und KAHURANGI (Grüner Stein).
Peter Greminger
Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln.
(Joh 3/4)
Für meine Kinder Anita und Richard
Inhaltsverzeichnis
Maui
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Maui
'Te Ika a Maui' oder Maui's Fisch, so heißt die nördliche Insel Neuseelands in der Überlieferung der Maoris. Diese Legende wird früher oder später wohl jeder hören, der nur irgendwie mit dem weit entfernten Land in Berührung kommt und, mit ein wenig Phantasie, einen Fisch in der Form der Nordinsel erkennen kann. Sie wird dann ausgeschmückt und abgeändert, je nachdem wer gerade erzählt oder zuhört. So sollen Maui's neidische Brüder den Fisch zerhackt haben, zur heutigen bizarren Form, oder die riesige Hawkebay soll der wundersame Angelhaken aus dem Kiefer seiner Großmutter gewesen sein, den er mit seinem eigenen Nasenblut köderte und damit die Insel fing. Was aber die Wenigsten wissen, die Geschichte geht weiter, denn es fehlten ja noch die Berge, die Vulkane, die sich bis in die heutige Zeit immer wieder, oft grollend, manchmal heimlich kochend oder gar bösartig speiend, Aufmerksamkeit verschaffen.
Nachdem der Halbgott Maui, er war der jüngste Sohn von Makea und Taranga, den riesigen Fisch gefangen hatte, ließ er seine Brüder allein mit der Beute und kehrte heim nach Hawaiki, um Hilfe zu holen. Die Brüder ängstigen sich aber sehr und flehten zu Ranginui, dem Gott des Universums, ihnen beizustehen. Ranginui hatte Erbarmen und sprach: „Die Macht von Te Ika a Maui kann nur durch noch größere gebändigt werden. Deshalb gebe ich euch den mächtigen Berg Ruapehu. “ Er pflanzte den höchsten Vulkan mitten auf die Insel und dieser wachte fortan stolz und drohend über dem Land.
Als die Jahrmillionen vergingen, wurde der einsame Berg traurig, und seine Tränen flossen zu Tal. Nach Süden strömte der Whanganui River, nach Norden der große Waikato. Ruapehu bettelte aber bei Ranginui um Gefährten, damit er aus seiner Einsamkeit erlöst werde. Ranginui sandte ihm, in seiner Güte, mit der Zeit vier Kameraden. Zuerst kam Tongariro, der Wächter über die beiden Flüsse. Dann folgte Taranaki als Bewahrer der Tabus der neuen Sippe. Einige Zeit später kam Ngauruhoe, der Vollstrecker der Gebote und erhielt seinen Platz mitten in der Gruppe. Zuletzt schenkte der gütige Gott des Universums dem Tongariro eine Braut, die Jungfrau Pihanga.
Pihanga schielte aber vorbei an ihrem unscheinbaren, langweiligen Gatten Tongariro, auch am grobschlächtigen Ngauruhoe und am mächtigen Ruapehu. Sie verliebte sich in den, etwas abseits stehenden, wunderschönen, schlanken und ebenmäßigen Taranaki. Dieser fürchtete aber um seine Ehre als Hüter der Tabus und suchte bei seinem Gefährten Ruapehu Rat. Der weise Riese ermahnte ihn väterlich, es durfte einfach nicht sein, dass er sich auf eine Affäre mit der Frau eines Freundes einlasse. Taranaki nickte und entschloss sich schweren Herzens die Sippe zu verlassen. Er folgte dem Whanganui River und ließ sich bei Te Hauauru, an der Westküste nieder. Von da an steht er schlank und schön, einsam und etwas traurig, an der Küste und bewacht den Ort, wo die goldene Sonne jeden Abend ins weite Meer taucht.
KAPITEL 1
Judith beobachtete Liz schweigend, als diese sich in den offenen Schrank beugte, die Kleider suchend hin- und her beförderte, dann einen ihrer Röcke hervor zerrte, nur um diesen wieder achtlos zurückzustoßen. Ein Kleiderbügel fiel polternd zu Boden. Mit spitzem Aufschrei wirbelte Liz herum und schwenkte ein seidig glänzendes Kleid vor sich hin, wie ein Torero seine Muleta.
„Wau!“, rief sie mit leuchtenden Augen. „Woher kommt denn das?“ Obwohl Judith die unbeschwerte Direktheit ihrer Freundin seit langem kannte, konnte sie sich immer noch nicht damit abfinden, dass diese ohne zu fragen, völlig selbstverständlich in ihren persönlichen Sachen wühlte und ihr damit, scheinbar unbewusst, das letzte bisschen Privatsphäre raubte. – Außerdem, die Tracht kam sowieso nicht in Frage.
Liz presste das prachtvolle Kleid ungestüm an sich und posierte tänzelnd vor dem großen Spiegel. Dabei bildeten die breiten Hüften und stämmigen Beine in den verwaschenen hellroten Jeans einen derart grotesken Widerspruch zu den zarten Stickereien und filigranen Silberarbeiten auf dem festlichen dunkelblauen Stoff, dass Judith ein verhaltenes Lächeln nicht unterdrücken konnte. Den struppig blonden Haarschopf konnte man sich ebenso wenig unter der zierlichen, dazugehörigen Haube aus sorgfältig gestärktem schwarzem Tüll vorstellen, wie auch der wabbelig üppige Busen kaum in das fein geschnürte Mieder passen würde.
Die Rheintaler Sonntagstracht stand ihr selber aber nach wie vor wie angegossen, dachte Judith und seufzte.
„Bitte, lass das doch“, wehrte sie sich leise, „die Tracht kann man hier sowieso nicht tragen. Ich hätte sie besser zu Hause gelassen.“
„Wo?“, entgegnete Liz verständnislos.
„Auf dem Sonnenhof“, entgegnete Judith, bemerkte aber gleich, dass Liz ihr nicht folgen konnte. Überhaupt, was schwatzte sie da, den Sonnenhof gab's vermutlich überhaupt nicht mehr und ihr “Zuhause“ war es eigentlich schon damals nicht.
Keine zwei Jahre gebe er ihm, hatte Alois, allen die es wissen wollten, zornig verkündet. Man sollte den Hof gescheiter gleich anzünden, der Bruder würde ihn sowieso in kurzer Zeit herunterwirtschaften.
Der Sonnenhof lag eingebettet in saftige Wiesen bei Frümsen, dort wo sich im Rücken die Felsen des Alpsteins erheben und man vor sich über den Rhein ins Ländle und nach Vorarlberg blicken konnte. Gleich hinter dem österreichischen Feldkirch, nach dem engen Durchgang, den sich die Ill in Jahrtausend langer Arbeit gegraben hatte, liegt Frastanz. Dort verbrachte sie ihre Kindheit. Die Bruchstücke der Erinnerung fügten sich zu einem, teils aus fröhlichen Stunden aber noch mehr aus viel Armut und Streit bestehenden, verblassenden Mosaik zusammen. Ihr Vater war früh gestorben. Zu Tode gesoffen hat er sich, meinte die Mutter vorwurfsvoll, wie wenn die Kinder Schuld daran gehabt hätten. Die größenwahnsinnigen Parolen um die deutsche Einheit, aber vor allem die herrschende Arbeitslosigkeit zerfurchten des Vaters hageres Gesicht und ließen ihn wohl mehr in Hoffnungslosigkeit als im Alkohol ertrinken. Immer seltener, mit leiser Stimme, erzählte er von einer gerechten Welt, wo alle Menschen gleich behandelt würden und der Staat auch wirklich für seine Bürger sorgte. Ein Kommunist, wurde gemunkelt, wenn man vom versoffenen Bader redete, und die rechtschaffenen Leute machten bald einen Bogen um die Roten vom hinteren Gässle. Judith konnte mit bestem Willen keine besondere Röte in ihrem Gesicht feststellen, außer vielleicht damals, als sie für zwei Wochen mit den Masern im Bett lag und sich der entstellenden Flecken fürchterlich schämte.
Vaters Beerdigung verlief so ereignislos wie sein Leben. Die zu jener Zeit sonst übliche, protzige Veranstaltung mit uniformierter Marschkapelle und flatternden Fahnen fehlte gänzlich, und das kleine, unscheinbare Grüppchen um das offene Grab zerstreute sich nach dem hastigen Segen des Pfarrers rasch.
Fortan arbeitete Mutter Bader als Putzfrau in der Spinnerei Ganahl, der Fabrik am Kanal, und brachte sich und die vier Kinder mit einem kargen Lohn leidlich durch. Kochen, Waschen wie auch alle anderen Hausarbeiten waren jetzt, neben der Schule, Sache der einzigen Tochter. Mit achtzehn riss Judith aus und floh über die Grenze in die benachbarte Schweiz. Dort fand sie sofort Arbeit als Kellnerin im Gasthaus 'Schlüssel' zu Altstätten.
Wie sich im Nachhinein herausstellte, war es ein reiner Zufall, dass Alois im 'Schlüssel' einkehrte. Er hatte an einem schwülen Sommernachmittag eine Ladung Stroh nach dem appenzellischen Gais zu liefern. Just bevor er aber gegen die steile Stossstraße hinauf steuerte, gab sein Hürlimann stotternd und röchelnd den Geist auf. Nachdem die Ladung abgehängt und mit großen Steinen gesichert war, wurde der störrische Traktor unter Mithilfe einiger bereitwilliger Müßiggänger in die nächste Werkstatt geschoben. Dort stellte sich bald heraus, dass die Reparatur etliche Stunden dauern würde. Dass man die Helfer in der Wartezeit zu einem Trunk einlud, war wohl eine Selbstverständlichkeit und so landete Alois, hemdsärmelig und verschwitzt, an der Spitze von vier Einheimischen in der Schankstube des 'Schlüssels'. Wie das eben so geht, es dauerte dann weit in den späten Nachmittag hinein, und die fröhliche Runde fand bald einmal Gefallen am hübschen Dirndl von drüben aus dem Vorarlbergischen. Dieses eilte flink zwischen Ausschank und Tischen hin und her und schenkte den Gästen immer ein paar freundliche Worte und ein warmes Lächeln. Mit roten Gesichtern und glänzenden Äuglein wurden flotte Sprüche und anzügliche Witze zum Besten gegeben. Nur Alois enthielt sich solcher Rede und trank bedächtig seinen Schoppen, während er verstohlen dem hübschen Fräulein nachschaute und insgeheim hoffte, dass die Reparatur noch recht lange dauern würde.
In den nächsten Tagen und Wochen hatte Alois immer wieder zufällig in Altstätten zu tun, und dass er dann im Schlüssel' an der Ringstraße einkehrte, hatte offensichtlich seine Gründe. Es dauerte dann auch kaum ein Jahr, bis das Aufgebot bestellt wurde und er Judith als Sohnesfrau auf den Sonnenhof brachte.
Der große Hof mit dem breiten Scheunendach und der massiven Eingangstreppe, deren Stufen aus grauem Sandstein beidseitig zur schweren Tür hinaufführten, schüchterte sie anfänglich gewaltig ein. Drinnen im Halbdunkeln durchquerte ein langer Gang das ganze Haus. In der riesigen Küche verriet aber die kalte Asche im Herd, dass in letzter Zeit kaum gekochte wurde, und im Schrank lagen einsame, in Papier gewickelte Reste von Brot und Rauchwurst. Ohne Zweifel, hier herrsche reine Männerwirtschaft.
Die Meisterin war vor etwas mehr als zwei Jahren an Tuberkulose gestorben, und seither machte eine Frau aus dem Dorf zweimal die Woche sauber und erledigte die Wäsche. Gut, dass zwei stramme Söhne da waren, meinte der Bauer. Arbeit war genug da – und jetzt natürlich auch für die junge Frau.
Sie feuerte also ein, putzte, wusch und kochte. Sie polierte die blinden Scheiben, erneuerte Gardinen und zog leuchtend rote Geranien auf den Fensterbänken. Bald freute sie sich am stattlichen Hausstand, und der Hof schien zu neuem Glanz zu erstrahlen. Selbst Alois nickte anerkennend und gab ihr im Verstohlenen einen aufmunternden Klaps auf den Hintern. Er arbeitete draußen lange Stunden, versorgte das Vieh und bestellte die Äcker. Der Sonnenhof lebte wieder auf, das meinten auch die Dörfler und Nachbarn neidlos. Nur der Bauer gab ab, das wussten alle. Wenn er mit müden Schritten und gebeugtem Rücken über den Hof ging, war nicht zu übersehen, dass die Zeit des Ruhestandes und der Übergabe an die Jungen gekommen war.
Mitten im darauf folgenden Winter verkündete er beim Abendessen ohne Einleitung, dass Köbi, sobald dieser eine passende Frau gefunden habe, den Hof übernehmen werde. Man müsse nur noch zum Notar, das Notwendige regeln.
Am Platz gegenüber ließ Alois seinen Löffel klirrend in den Suppenteller fallen und protestierte. Es war doch offensichtlich, Jakob war völlig ungeeignet für die Bauernarbeit. Er war immer wieder fort und interessierte sich mehr für Politik als für den Hof. Ja, besonders seit in Deutschland dieser Hitler den Ton angab. – Außerdem, eine Frau fand der sowieso nicht ...
Darin täuschte sich Alois. Wenige Wochen später stellte Jakob seine zukünftige Frau vor, ein Deutsche aus Lindau, mit klarer Sprache und roten Fingernägeln. Der Bauer brummte etwas von Ausländerinnen aber das sei wohl die heutige Zeit. Außerdem, Köbi war der Erstgeborene, da gab es keine Frage, wer den Hof übernehme.
Das war vor fünfzehn Jahren gewesen. Bei Nacht und Nebel, ohne Abschied, waren sie abgereist und nach dem fernen Neuseeland ausgewandert. Sie waren überzeugt vom angetanen Unrecht und voller Zorn über den verbohrten Vater, der, starrköpfig wie er war, meinte, nur der Älteste könne einen Hof übernehmen. Jakob, ... ha, dass man nicht lachte, der konnte doch nicht einmal ein Schaf von einem Geißbock unterscheiden. Wie sollte der einen Betrieb wie den Sonnenhof führen?
Inzwischen war der Krieg über Europa hergefallen. Fünf bittere, lange Jahre vergingen, voller Sorgen um die Eltern und Geschwister in der Heimat. Die Japaner kamen im Pazifik Neuseeland eine Zeitlang bedrohlich nah, bis sie endlich durch die alliierten Flottenverbände wieder zurückgetrieben wurden. Am sechsten August 1945 um 08:15 Uhr fiel aber die erste amerikanische Atombombe, mit dem höhnischen Namen 'Little Boy', auf Hiroshima. Drei Tage später brachte dann diejenige auf Nagasaki, dem Land des Lächelns und der Kirschblüten die wohl schrecklichste Niederlage der ganzen Menschheit.
Neuseelands Zugehörigkeit zum Commonwealth verwickelte das ferne Land aber aus reiner Loyalität zur britischen Krone in Kriegshandlungen auf weit entfernten Schlachtfeldern. Alois und Judith merkten wenig davon und waren in ihrem eigenen Neuanfang völlig gefangen. Die Welt lag in Trümmern, sie aber wollten es schaffen und zeigen, was man durch Arbeit, Fleiß und Ausdauer leisten konnte. Zweifellos, Alois würde allen beweisen, dass er zum Landwirt geboren war.
Der Erfolg kam nur zögernd; um so schneller schwanden die Illusionen. Eine neue Heimat hatten sie wohl gefunden aber auch harte Arbeit, Einsamkeit und einen unaufhörlichen Kampf gegen die neue, fremde Umwelt. Das weite Land war tatsächlich fruchtbar und das Klima mild, aber jedes Stück Erde mussten sie immer wieder der unwilligen, struppigen Wildnis abtrotzen. Stacheliger Ginster wucherte überall, Hasen wurden zur Plage und Termiten fraßen am Gebälk des Hauses. Diesen Winter regnete es viel, zu viel und zu lange. Die Kühe standen tief im Schlamm, und der Hofplatz versank im Morast. Judith kam sich vor, wie wenn sie seit Wochen in Gummistiefeln umherirren würde. Im Haus ging sie der Einfachheit halber barfuß. – Was in aller Welt sollte sie hier mit einer St.Galler Sonntagstracht anfangen. Es war ja geradezu komisch.
Sie sehnte sich in letzter Zeit immer öfters nach der Geborgenheit ihrer Heimat. Zugegeben, die Winter im Vorarlberg waren oft grimmig kalt. Aber wenn draußen die Bäume unter der Schneelast ächzten, lange, glitzernde Zapfen von der Dachtraufe hingen und Eisblumen die Vorfenster festlich schmückten, dann saßen sie dort in der Stube am grünen Kachelofen oder am Tisch unter der Lampe mit Rollen aus weißem Porzellan, emailliertem Gegengewicht und mattem Glaszylinder. Der warme Schein umfing sie alle, wie wenn er die Familie vor den dunklen Schatten in den Ecken der Stube beschützte wollte. Es roch nach gebratenen Äpfeln und Zimt.
War das jetzt Heimweh? – Ach was, es war nur ein Traum, dem sie da nachhing. Johann und Manfred waren im Krieg gefallen und nur Hanspeter schrieb gelegentlich und richtete Grüße der Mutter aus, tatsächlich einmal im Jahr ... zu Weihnachten. – Ach, das Fest der Liebe und Freude, gab es das überhaupt noch, nach allem? Weihnachten hier, mitten im Sommer, unter einer glühenden Sonne, die erbarmungslos auf Menschen und Tiere brannte. – Jetzt, ein halbes Jahr davor, es war Juli, lag Weihnachten in weiter Ferne. Jetzt wechselten Kälte, Wind und Nässe sich ab, drangen durch Tür und Wände ins Haus und ließen das Land in noch größerer Einsamkeit versinken ...
Sie war in die Küche geflohen, holte energisch Tassen aus dem Schrank und setzte den Kessel auf. Was soll das, schalt sie sich. Soll ich etwa in Heimweh versinken und alten Zeiten nachtrauern? Wir kamen hierher in eine neue, besseren Welt und haben es geschafft. – Sei nicht undankbar! Andere waren früher nach Amerika ausgewandert, ohne eine Chance auf Rückkehr. Die mussten sich mit Schweiß und Blut ein neues Leben erkämpfen, starben oft einsam, arm und verbittert und lagen in fremder, unbekannter Erde ..., mit ihnen ihre gescheiterten, unerreichten Träume. Man musste ehrlich sein, hier hatten sie es viel leichter. Sie waren in Neuseeland offen aufgenommen worden. Hilfsbereitschaft und Anteilnahme waren für die Bevölkerung, ob einheimische Maoris oder Pakehas, wie die weißen Zuwanderer genannt wurden, eine Selbstverständlichkeit. Problemlos erwarben sie ihr Land, erweiterten das Haus und vergrößerten die Herde. – Und noch etwas, eine Rückkehr in die alte Heimat wäre immer möglich gewesen, wenn auch eine Zeit lang der schreckliche Weltkrieg nicht dazu einlud. Sie waren geblieben, hatten hart gearbeitet und die Hartmann-Station aufgebaut. Alois hatte sein Ziel erreicht, er war Herr und Meister auf seinem eigenen Hof.
„Wo ist eigentlich Alois?“ Liz war ihr in die Küche gefolgt und stand an der Anrichte. Sie löffelte sich gerade großzügig Zucker in die Tasse und wartete auf den Tee. „Hast du noch von dem Kuchen?“, fuhr sie fort und öffnete die schwere Tür des Kühlschranks. „Milch?“
„Bitte!“, antwortete Judith und rückte auf der Eckbank um Platz zu machen. „Alois ist am Hang drüben und sticht den Ginster aus. Er wuchert bereits wieder in die obere Weide hinein. Es ist jedes Jahr dasselbe, das Gestrüpp ist einfach nicht auszurotten.“
„Ach, er arbeitet zu viel.“
„Ja ...“, antwortete Judith schwach. „Aber nächste Woche wollen wir zum Skifahren.“
„Ach so, deshalb also dein Kummer mit der Garderobe. Wohin geht's denn?“
„Oberhalb Ohakune gibt's ein Skigebiet, Turoa genannt. Dort wurde neuerdings ein Skilift gebaut und Alois meint, ein paar Tage Schnee und Sonne würde uns gut tun.“
„Ich beneide euch!“, entfuhr es Liz. „Aber geht nur, wir werden uns um den Hof kümmern. Mein Kevin kann problemlos ein paar Kühe mehr melken. Jetzt im Winter ist hier sowieso nicht viel los.“
„Hoffentlich hast du recht. Alois ist unglaublich nervös. Er wartet geradezu darauf, dass etwas schief gehen könnte.“
„Aber was denn? Nun macht euch doch nicht unnötig verrückt. Was kann hier schon schief gehen?“ Dann fuhr sie fort: „Erzähl mir lieber von Turoa und dem Skilaufen. Kannst du das denn?“
„Oh sicher, das heißt, ich bin vor vielen Jahren, zu Hause in den Alpen etwas gefahren. Natürlich konnten wir uns das kaum leisten und Vater war jedes Mal maßlos wütend. Aber da ich die Skis einer Freundin benützen durfte, reichte der Zustupf meiner Mutter über ein Wochenende gerade so. – Ich glaube, Skifahren, das verlernt man nie. Alois hat mir neue Bretter mit Stahlkanten und moderner Bindung versprochen.“ Mit geröteten Wangen ereiferte sich Judith weiter: „Was glaubst du, wie ich im stiebenden Schnee den Hang hinunter sausen werde. Und wenn das mit dem Skilift stimmt, gleich mehrmals am Tag. Den mühseligen Aufstieg mit den Fellen kannst du glatt vergessen. Einfach toll!“
„Und wenn du stürzst? Ich hab' gehört das ist gefährlich.“
„Ach was, es wird schon nichts passieren.“
Die Teetassen waren längst erkaltet und hatten braune Ringe auf dem Wachstuch des Küchentisches zurückgelassen. Draußen im Eingang hörte man ein Rumpeln und das scheppernde Zuschlagen des Fliegengitters.
„Da kommt Alois“, sagte Judith und stand auf.
„Oh, ich muss heim!“, stammelte Liz sofort und eilte zur Tür, wo sie beinahe mit Alois zusammenstieß.
„Guten Abend“, brummte dieser und drückte sich vorbei zum Spültrog.
„Hei“, entgegnete Liz. „Ich muss mich beeilen, die Kinder und Kevin sind sicher hungrig. Haben wahrscheinlich schon den Kühlschrank geplündert. Ich muss weg, ein andermal!“
Damit verschwand sie durch die Türe. Alois brummte etwas Unverständliches, während er sich kaltes Wasser ins Gesicht spritzte.
„Hat die Frau denn nichts zu tun?“, maulte er und griff nach dem Handtuch, das Judith ihm reichte.
„Ja ...“, entgegnete Judith kleinlaut. Dann verteidigte sie ihre Freundin: „Sie braucht halt manchmal einen Menschen, mit dem sie reden kann. Wir leben hier ja wirklich wie Einsiedler, sehen manchmal tagelang keine Seele.“
„Und ich?“, grinste er nun, „bin ich denn niemand?“
„Aber natürlich!“, ging sie darauf ein, „nur manchmal fehlt auch mir etwas mehr Leben im Haus. Liz hat wenigstens ihre Kinder ...“
Nun wurde er ernst. „Es gibt keine. Ich dachte, das Thema hätten wir ein für allemal abgeschlossen.“
„Entschuldige, ich weiß, das war ungerecht.“
„Schon gut. Was gibt's zu essen?“
Jetzt kroch die Wut in ihr hoch, wie langsam wirkendes Gift. Sah er denn überhaupt nicht, was für ein Leben sie hier führte. Lebendig begraben war man hier. Was nützte die ganze verfluchte Station, wenn man außer glotzenden Kühen, dummen Schafen und hässlichen Puten niemandem begegnete. Natürlich war Liz manchmal geschwätzig und aufdringlich, aber sie war auch die einzige Person mit der sie Kontakt hatte. In dieser gottverlassenen Gegend war ja sonst niemand. Soll er doch sein verdammtes Essen selber machen. Wütend drehte sie sich um und verschwand im Arbeitszimmer. Die Tür fiel krachend ins Schloss.
Alois stand einen Moment versteinert, schüttelte dann den Kopf und wandte sich dem Kühlschrank zu. Er türmte sich großzügig Schinken, Käse und Gurken auf einen Teller und legte vier weiße, rechteckige Brotscheiben dazu. Dann angelte er sich eine Flasche Bier, leerte sie mit kräftigem Zug fast zur Neige. Während er sich auf die Bank an den Tisch zwängte und die verlassenen Tassen zur Seite schob brummte er vor sich hin. Weiber, soll sie doch der Teufel holen, mit ihrem Getue. War es nicht genug, dass er sich zu Tode schuftete. Er hatte hier alles mit eigenen Händen erarbeitet und das war der Dank. – Außerdem, hatte sie vergessen, dass sie am Samstag zum Ruapehu wollten! ... Skilaufen, Herrgott noch einmal!
Ankunft in Aotearoa
KAPITEL 2
Da die Reise über Whanganui nach Raetihi und Ohakune sicherlich drei Stunden beanspruchen würde, hatten sie beschlossen, zeitig aufzubrechen. Aber als Judith kurz nach sechs Uhr erwachte, fand sie das Bett neben sich leer. Etwas benommen tastete sie sich in die Küche um Kaffee zu kochen, als Alois durch die Tür aus dem Dunkeln herein kam.
„Kann nicht mit“, brummte er vor sich hin, als er sich die Arme wusch. „Die Lotte steht kurz vor dem Fohlen.“
„Aber ...“, entgegnete sie schwach. „Die sollte doch erst in drei Wochen so weit sein.“ Eigentlich ein unnützer Protest, denn Judith wusste genau, dass die Stute Lotte vorging und Alois diese nie und nimmer der unsicheren Fürsorge von Kevin und Liz überlassen würde.
„Geh' halt allein“, meinte Alois und nahm die heiße Tasse in Empfang.
„Allein ...“
„Warum nicht?“
Ja, warum eigentlich nicht. Dieser verfluchte Hof ließ sie einfach nie los. Er umklammerte sie mit aller Gewalt und hielt sie zurück mit immer neuen Tricks. Er spielte mit ihr wie eine Katze mit einer Maus. Immer wenn sie glaubte jetzt könnte sie entwischen, holten sie die unbarmherzigen Krallen zurück. Alois empfand das anders. Er fügte sich in die Situation und wenn das Fohlen jetzt kam, so war ihm das auch recht. – Ja, warum sollte sie eigentlich nicht alleine fahren.
„Gut“, sagte sie entschlossen, „ich fahr', ich nehme den Buick. Ist da genug Benzin im Tank?“
„Ja, ja. Ich hab' ihn gestern aufgefüllt. Und im Kofferraum ist ein zusätzlicher Kanister.“
„Danke!“
So hatte sie rasch ihre Sachen zusammengerafft, Kleider und Schuhe verstaut und die neuen Skis quer über die Sitze geworfen. Dann fuhr sie los. Die Straße bis zur Makakaho Junction war eine einzige Schlammbahn. Der Wagen schlitterte oft gefährlich gegen den Rand, und die Scheinwerfer warfen gespenstisches Licht in die Büsche. Sie brauchte fast eine Stunde, bis sie endlich die befestigte Straße nach Whanganui erreichte, wo es dann zügig Richtung Norden ging. Der bleigraue Morgen lichtete sich immer mehr, und als die Sonne durch die Wolken brach, entdeckte sie plötzlich zwischen den grauen Schleiern die weißen Gipfel des Ruapehu vor sich. Von dieser Seite zeigte sich der riesige Vulkan recht uncharakteristisch, eine eigentliche Kegelform war nicht auszumachen. Seine weißen Flanken ragten immer wieder aus den sich auftürmenden Wolken und ließen das gewaltige Massiv nur erahnen. Es schien die ganze Landschaft in steter Unrast und Bewegung. Bald verdunkelten sich die Wolken, und die Schneegipfel blickten blass und einsam hervor. Dann blitzten sie auf einmal auf, wie Spiegel im gleißenden Sonnenlicht. Sie warfen ihren Glanz in die Wolkentürme hinein und ließen diese mit Licht und Schatten ihr dreidimensionales Spiel treiben. Unten auf dem endlosen Hügelland erreichten die Strahlen die dunklen Mulden und breiteten warme, sanfte Flecken aus, die wie Segelschiffe dahinglitten, schneller als ihr Auto.
Judith wurde mit jeder Meile, die sie hinter sich ließ, ruhiger. Die nagende Nervosität legte sich, sie wurde eins mit dem gewaltigen Naturschauspiel. Diese Losgelöstheit von allem Menschlichen und, im Gegensatz dazu, das völlige Aufgehen in der weiten Natur, konnte man eigentlich nur in diesem herrlichen Land erfahren. Sie hatte dieses Gefühl schon früher verspürt, aber an diesem Tag erkannte sie noch deutlicher, die Macht die darin lag, die unendliche Weite, die lebensspendende Schönheit und die verborgene Verheißung dieses 'Landes der großen weißen Wolke'. Wie treffend der Name, den die von weit her kommenden Maoris vor hunderten von Jahren ihrer neuen Heimat gegeben hatten.
Kurz vor zehn Uhr erreichte sie den kleinen Ort Ohakune. Ursprünglich war die Ansiedlung während dem Bau der Nord-Süd-Eisenbahnlinie um das Jahr 1905 entstanden und hieß damals Ohakune Junction, mit einer wichtigen Station genau unterhalb des Ruapehu-Massives. Als die zahlreichen Brücken und Viadukte erstellt waren und die Bahnlinie durchgehend in Betrieb, erlangte der Ort weitere Bedeutung als große Holz-Verladestation. Die Forstwirtschaft und der Handel mit Holz waren für Neuseeland seit jeher von Bedeutung, und immer noch rodete man ganze Hänge kahl, weit mehr als wieder aufgeforstet wurde. Nur langsam wurde man sich der Frevelei bewusst und pflanzte in großem Stil schnellwachsende, kalifornische Pinien, die schon nach fünfundzwanzig Jahren geschlagen werden konnten. In neuerer Zeit verlor die Station aber an Bedeutung, denn mit dem raschen Ausbau des Straßennetzes wurden für Transporte immer mehr die weit beweglicheren Lastwagen eingesetzt. Die Eisenbahn wurde zunehmend, mit einer Reisezeit von weniger als zwölf Stunden, zur bequemen Schnellverbindung für den Personenverkehr zwischen Wellington und Auckland. Neuerdings hielten die Expresszüge auch wieder in Ohakune, da an den Abhängen des Ruapehu und Tongariro ein riesiger Nationalpark und ein Erholungsgebiet für Sommer und Winter entstanden waren.
Als Judith vor dem etwas erhöht gelegenen hölzernen Bahnhofgebäude in die Rimu Street einbog und vor der Kings Court Lodge anhielt, warteten etwa ein halbes Dutzend junge Leute bei einem klapperigen Kleinbus und diskutierten lebhaft mit dem Fahrer. Sie drückte energisch auf die Hupe und winkte Aufmerksamkeit heischend, damit sie ja nicht zurückgelassen werde.
„Ich bin gleich da!“, rief sie ihnen zu und brachte den Buick mit einem Ruck vor der Herberge zum Stehen.
So gelangte sie unverhofft in den Kreis einer Gruppe einheimischer Wintersportler, die den herrlichen Tag ebenfalls nützen wollten. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis alles Platz gefunden hatte aber dann ging die fröhliche Fahrt endlich los. Der kleine, altersschwache Bus mühte sich die steilen Kurven hoch, holperte schwankend über die vielen Schlaglöcher, so dass Skier und Rucksäcke wild durcheinander purzelten. Die Fahrgäste mussten sich fest an ihre Sitze klammern. Es ging vorbei an der Rangerstation, quer über den Schnee zum neuen Skilift. Der herrliche weiße Hang lag noch fast unberührt vor ihnen. Fröhlich schwatzend und lachend kletterte die Gruppe aus ihrem Gefährt. Drüben beim Häuschen erklang jetzt ein Surren, danach ein zaghaftes Rattern, während die Bügel langsam anfuhren und den Berg hinaufstrebten. Dann folgten sie sich aber in regelmäßigen Abständen, und es dauerte nicht lange, bis sich die mutigsten der Sportler nach dem überraschenden, ungewohnten Ruck in die Höhe schleppen ließen. Judith selber fand sich bald unverhofft neben einem jungen Mann damit beschäftigt, die Bretter in der Spur zu halten und nicht vom Bügel zu rutschen.
„Sie sind allein“, stellte er trocken fest, während er sich die Stöcke unter den Arm klemmte.
„Ja ... mein Mann war verhindert.“ Judith musterte die große sportliche Erscheinung neben ihr mit einem Seitenblick. Viel war nicht zu erkennen, denn er hatte eine blaurote Wollmütze in die Stirn gezogen und den braunen Anorak hoch geschlossen. Er trug einen Rucksack, was vermuten ließ, dass er sich wohl nicht nur mit der gut vorbereiteten Piste begnügen wollte.
„So allein ist nicht ungefährlich“, bestätigte er ihre Gedanken. „Bleiben Sie besser auf der Piste, das ist sicherer.“
„Ich kann schon selber auf mich aufpassen“, antwortete sie spitz. Fügte dann aber erklärend hinzu: „Bin in den Alpen oft Ski gelaufen.“
„Oh, eine Alpinistin!“, grinste er von der Seite.
„Aus Österreich“, bestätigte sie.
„Das hier ist aber der Ruapehu. Werd' wohl ein Auge auf Sie haben. Nur so zur Sicherheit ...“
„Nur zu!“, lachte sie, als sie den Bügel mit einem Ruck losließen und dabei fast ineinander gefahren wären.
„Ich heiße Alan!“, rief er ihr noch nach, bevor er mit einem gekonnten Schwung den ersten Abhang nahm.
Lachend schüttelte Judith den Kopf und blickte der entschwindenden Gestalt nach, welche, kleine Staubwolken zurücklassend, einen Bogen um den andern zog.
Die morgendlichen Wolken waren nun endgültig verschwunden, eine gleißende Sonne stieg höher und ließ das Weiß vor ihr in Millionen von Kristallen erglitzern. Sie rückte die Sonnenbrille zurecht und blickte um sich. Die wenigen Sportler verloren sich bald im weiten Hang. Judith hatte das Gefühl, der Berg gehöre nur ihr, ihr ganz allein, damit sie an seiner Flanke hinuntergleite, sanft und weich. Zögernd, fast andächtig ließ sie sich davontragen. Schwung an Schwung schwebte sie dahin, wurde mutiger, fuhr schneller, direkter. Der Wind sauste um sie, zerrte an der leuchtend roten Windjacke. Feiner Schnee, aufgewirbelt von den Spitzen der Skis, sammelte sich auf den Schuhen und an der dunkelblauen Keilhose. Ein etwas flacheres Stück nahm sie pfeilgerade, mit geducktem Oberkörper, die Stöcke unter den Arm geklemmt. Sie sprang über eine kleine Erhöhung und erblickte die unterhalb Wartenden erst im letzten Moment. Sie riss die Skier quer und kam, eine riesige Schneewolke um sich, keine zwei Yards neben Alan und seinem Gefährten zu stehen. Pustend, unter viel Gelächter klopften sich die Beiden den aufgewirbelten Pulverschnee von den Jacken.
„Unsere Österreicherin ist ja eine richtige Rennfahrerin!“, rief Alan.
„Erstens bin ich nicht eure Österreicherin und zweitens steht ihr da wie blutige Anfänger, an einer unübersichtlichen Stelle!“
Der zweite Mann kicherte und gluckste. Er war etwas kleiner als Alan, trug Jeans und einen dicken Strickpullover mit großem Hirschmuster. Kleine blaue Augen spähten unter einer Zipfelmütze hervor. „Du bist ein Anfänger, Alan!“, wieherte er.
„Anfänger!“, spottete nun Judith ihrerseits, hieb die Stöcke in den Schnee und raste den Abhang hinunter. Die beiden Männer erholten sich rasch, sprangen herum und nahmen das provozierte Rennen auf. Fast gleichzeitig erreichten sie die Talstation, schwer atmend, mit geröteten Gesichtern.
„Ich heiß' Judith“, keuchte sie lachend.
„Alan McGavin“, erwiderte er, „und das ist Jim.“
Alan hatte sich die Mütze vom Kopf gefegt, und erst jetzt sah Judith ein jugendliches Profil mit schwarzen, kurzen Haaren und dunklen Augen. Er war wohl kaum dreißig und hatte das Aussehen eines Studenten, intelligent und unbeschwert.
Die nächsten Stunden vergingen im Flug und als sie mit dem Bus wieder talwärts strebten, hatten sich die Drei schon soweit angefreundet, dass sie sich für den Abend im Alpine Inn verabredeten, um die österreichische Skifahrerin auch am richtigen Ort gebührend zu feiern, wie Alan anzüglich meinte.
Der Wirt des Alpine Inn hieß Herbert Weigel. Er führte das Geschäft schon seit vielen Jahren. Das Gasthaus lag etwas abseits von der Eisenbahnlinie aber direkt an der Straße, wo gegenüber auch die einzige Werkstatt des Ortes lag. Alan und Jim verkehrten hier regelmäßig, denn sie hatten ihre Quartiere gleich über der Garage. Jim arbeitete dort als Mechaniker.
Das Lokal war völlig leer und die hinteren Tische standen im Dunkeln, als Judith gegen sieben Uhr eintraf. Etwas verloren sah sie sich um und schalt sich im Stillen eine Törin, dass sie sich auf einen gemütlichen Abend gefreut hatte. Schon wollte sie ernüchtert umkehren, als Jim hinter ihr durch die Pendeltür auftauchte. Er musste auf der gegenüberliegenden Seite der Straße gewartet haben.
„Alan kommt gleich“, sagte er etwas verlegen. „Wo bleibt nur der Herbert?“
Er ging hinter die massive Theke, fand den Schalter und sofort breitete sich warmes Licht über die hölzernen Tische und Bänke aus. Jetzt erschien auch eine schwere dunkelhäutige Frau durch die Hintertür und musterte die Ankömmlinge.
„Ach, guten Abend Jim“, begrüßte sie diesen lautstark, als sie ihn erkannte.
„Anna, wo bleibt nur der faule Herbert? ... Wir haben Gäste!“
„Ja, ja, ich komm ja schon ...“ wehrte sich der Wirt, als er nun ebenfalls aus dem Hintergrund erschien.
Judith horchte auf. Das klang doch nach deutschem Akzent, und tatsächlich stellte sich heraus, dass Herbert, ein waschechter Wiener, vor über zwanzig Jahren in dieser Gegend hängen geblieben war. Sein wienerisch gefärbtes Englisch hatte er nie ganz verloren. Seine grauen Augen leuchteten förmlich auf, als er in Judith eine Österreicherin erkannte und jetzt überschlug er sich nahezu mit gnädiger Frau' und küss die Hand'. Wie ein Wiesel rückte er die Stühle am besten Tisch zurecht und breitete ein sauberes rotweiß kariertes Tuch darüber.
Als Alan endlich erschien, saßen sie bereits bequem am Tisch und Herbert hatte es sich nicht nehmen lassen, ein Gläschen Sekt zur Feier des Tages zu offerieren.
„Da komm ich ja gerade recht“, ereiferte sich Alan, setzte sich zu ihnen und nahm das dargebotene Glas in Empfang.
Der aufgeregte Wirt, sein Gesicht hatte sich sichtbar gerötet, verschwand alsbald in der Küche und man hörte ihn lautstark seine Mannschaft herum kommandieren. Er servierte höchst persönlich seine Spezialität, ein Tafelspitz mit Kraut und Semmelknödel. Dazu gab's köstliche hausgemachte Majonäse und Meerrettich. Einzig das nachfolgende Dessert war zu seinem Leidwesen statt einer feinen Sachertorte ein landesübliches Schokolade-Fudge. Viel Rahm und tausend Entschuldigungen, wenn er nur geahnt hätte, dass sich die gnädige Frau heute die Ehre geben würde, dann hätte er selbstverständlich ..., vertuschten diese Unvollkommenheit.
Im Laufe des Abends, als sich die Gäste satt und zufrieden zurücklehnten, brachte Herbert eine weitere Flasche australischen Rotwein und ein Glas für sich selber an den Tisch. „Ihr gestattet doch?“, fragte er und ließ sich auf die Kante des freien Stuhls nieder.
„Solange du großzügig deinen Wein ausschenkst ... bitte“, grinste Alan und leerte sein Glas.
„Der Herr Geologe ist heute wohl in Stimmung!“
„Ach, Sie sind Geologe?“, erkundigte sich Judith aufhorchend.
„Im letzten Semester ... und wenn ich die Examen schaffe“, seufzte Alan.
„Der ewige Student“, fötzelte Jim.
Draußen klappte die Tür, und ein untersetzter Mann trat ins Lokal. Fast hätte man ihn für einen Maori gehalten, denn seine Haut war dunkel wie gegerbtes Leder, aber die schütteren grauen Haare und die scharfen Gesichtszüge entlarvten ihn eher als einen Pakeha der frühen Einwanderungswellen.
Als er die fröhliche Runde am Tisch in der Ecke erblickte, kam er direkt auf sie zu.
„Guten Abend“, sagte er mit leiser Stimme. „Hab gehört, dass du da bist Alan. Dachte mir schon, dass ich dich hier finde.“
„Roy, schön dich zu sehen. Komm setz dich zu uns.“ Dann stellte er vor: „Das ist Judith, Skiläuferin des Tages.“
„Guten Abend Judith, ich bin Roy Sheffield, der Park-Ranger.“ Er angelte sich einen Stuhl am Nebentisch und ließ sich nieder.
Judith nickte ihm zu. „Hallo Roy, Sie passen wohl auf uns Sonntagssportler auf, dass uns dort oben nichts passiert.“
„War heute nicht viel aufzupassen, bei den paar Leuten“, meinte er trocken.
„Doch, doch“, fiel nun Alan ins Wort. „Roy hat den ganzen Berg unter Kontrolle. Er spürt's lange zum Voraus, was der Ruapehu ausbrütet.“
Judith lachte. „Wenn ein unvorsichtiger Skifahrer stürzt und sich vielleicht den Knöchel verstaucht, ist doch sicher der Berg nicht schuld“, argumentierte sie.
„Ha!“, rief Alan übermütig, „der könnte auch der mutigsten Österreicherin einen Schrecken einjagen. Er kann nämlich, im Gegensatz zu euren harmlosen Hügelchen, wütend fauchen. Ungefähr so! ... Wuff!“
„Lass das!“, tadelte sie lachend, „du warst ja noch nie auf einem richtigen Alpengipfel.“ Dann wandte sie sich dem Ranger zu: „Sie glauben er könnte ausbrechen?“
Doch Alan fuhr dazwischen: „Der Roy, der merkt sofort, wenn's soweit ist. Er kann das förmlich riechen. Es stinkt kurz vorher wie faule Eier, meint er.“
„Unsinn!“, wehrte sich Roy. „Beim letzten Mal, 1948, war ich noch beim Militär und hab' die Eruption glatt verpasst.“
„Ich erinnere mich, das war vor fünf Jahren“, sagte Judith. „Ist es hier denn so gefährlich?“
Der Ranger winkte ab und schüttelte den Kopf.
„Keine Angst“, erwiderte Jim an seiner Stelle. „Wir sind in besten Händen. Die beiden Experten in Sachen Vulkan weilen unter uns.“
„Das tönt so, wie wenn wir mit bloßen Händen einen Vulkanausbruch aufhalten könnten“, grinste Alan.
Roy blieb ernst. „So ein Blödsinn! Nur keine unnötige Panik. Trotzdem, ich möchte dich sprechen Alan.“
Dieser schenkte nach. „Komm schon, trink zuerst ein Glas!“
„Danke!“, sagte Roy, ließ sein Glas aber unberührt. „Ja, im Moment sind wir sicher, denn der Frost und das Eis halten den Berg zusammen. Ich mache mir aber Sorgen, wenn's wärmer wird. Ich war kurz vor dem großen Schnee noch einmal oben. Alan, du weißt, der Kratersee ist randvoll ...“
„Ja, natürlich. Wir sind im Sommer ja noch darin geschwommen. Erinnerst du dich, herrlich warm, wie in einer Badewanne.“
„24 Grad, um genau zu sein, und im Mai war's noch genauso. Außerdem ist die Ablaufhöhle jetzt praktisch unter Wasser und halb eingestürzt. Wir wissen beide, dass dort unter dem Gletscher der Whangaehu River seinen Ursprung hat. Da ist vor genau dreißig Jahren schon einmal eine Laharflut losgebrochen. Wir müssen die lahmen Kerle vom Government Geological Survey Office unbedingt warnen.“
„Hab' ich ja schon getan“, entgegnete Alan. „Man hat's zur Kenntnis genommen, ist aber nicht besonders beunruhigt. Solche Laharströme kommen immer wieder vor, nichts Ungewöhnliches.“
„Wenn's diesen Sommer dort oben nur die kleinste Erschütterung gibt, dann kommt der ganze Kratersee den Berg herunter. Dann Gnade uns Gott.“
„Du siehst zu schwarz lieber Roy. Aber ich werde noch einmal mit den Behörden reden. Bloß, ob die auf einen Studenten hören ...“
„Ich hab's schriftlich abgefasst und unterschrieben. Mehr kann ich auch nicht tun.“
Er übergab Alan den Brief und ermahnte ihn eindringlich, ihn nicht zu vergessen und beim GGS in Auckland unverzüglich abzuliefern.
„Mach ich, versprochen“, sagte Alan und steckte das Schreiben ein. „Nun vermies uns aber nicht das schöne Wochenende. Und erschreck unsere Dame hier nicht!“
„Schon ein komisches Gefühl, so unter einem Vulkan zu sitzen“, sagte Judith. „Da lob' ich mir doch die Alpen zu Hause. Die speien weder Feuer noch Asche und begraben uns nicht unter scheußlicher Lahar.“
„Da haben wir sie wieder, unsere Österreicherin, sie will einfach immer gewinnen! Herbert, noch eine Flasche!“
Erstaunlicherweise fühlte sich Judith durchaus wohl, auch wenn sie allein als Frau in dieser Männerrunde saß. Es waren naturverbundene, unkomplizierte Menschen, und wenn sie jetzt auch etwas über den Durst getrunken hatten, sie vergriffen sich nie in ihrer Ausdrucksweise oder in ihrem Benehmen. Die fröhliche Runde dauerte deshalb bis spät in die Nacht hinein. Die schweigsame Anna hatte sich längst in die Küche zurückgezogen, und weitere Gäste besuchten an diesem Abend das Alpine Inn nicht.
Als Judith später allein die menschenleere Straße entlang zu ihrer Herberge ging, neuseeländische Männer hielten nicht viel von schwachen Frauen, die man nach Hause bringen musste, atmete sie die kalte Luft tief ein und blickte zu den Sternen empor. Kurz dachte sie an Alois und an die Hartmann-Station. Sie schienen weit weg und ebenso unwirklich wie der geheimnisvolle, drohende Ruapehu, der sich jetzt hinter ihr in Schleier von Nebel hüllte, wie wenn auch er sich zur wohlverdienten Ruhe begeben wollte.
Nach der Wärme des Lokals, der Mahlzeit und der Getränke, war das Zimmer im Kings Lodge eisig kalt. Wohl lagen neben einem schwarzen Ungetüm von einem offenen Kamin grobe Scheiter bereit, aber sie hatte absolut keine Lust, sich mit Streichholz und alten Zeitungen abzumühen. Schließlich würde sich der hohe Raum nur noch mit beißendem Rauch füllen. Sie entledigte sich also gerade einmal ihrer Jacke und Hose und schlüpfte in der Unterwäsche zwischen die klammen Tücher. Eine Zeit lang lag sie steif da und versuchte das bisschen Wärme zusammenzuhalten. Ebenso versteinert waren ihre Gedanken und fixierten sich auf den eben erlebten Abend, während sie in die nackte Lampe über dem Bett starrte. Nach einigen Minuten gab sie sich einen Ruck. Nein, sie brauchte sich keine Gedanken zu machen. Sie hatte nichts Falsches getan und hatte nur einen schönen Tag und einen fröhlichen Abend genossen. Energisch zog sie an der Kordel und löschte das Licht.
Die Bilder wurden nun lebendig, kreisten über ihrem wach liegenden Geist. Da war Alans Gestalt, fremd, neu und unergründlich neben ihr am Bügel des Skilifts. Ein Schatten nur, unerkannt unter Mütze und Jacke, und doch hätte sie ihn unter Tausenden wieder herauspicken können. Die fröhliche Jagd über die Piste, der Spott über die Österreicherin. Aber sie war ja gar keine Österreicherin, sie war Schweizerin, aus Frümsen bei Altstätten, verheiratet und Bauernfrau. Das musste sie unbedingt klarstellen. – Der Männerabend, ... sie als einzige Frau! Es schien niemanden zu stören, ... sie vielleicht? – Der zimperliche Herbert, ... auch ohne Frau. War der vielleicht schwul? Und wenn, es störte niemand. – Leise Angst nagte an ihr bei den Gedanken und Sorgen des Parkwächters. Wie sicher war man hier? Alan lachte darüber, doch auch er machte sich Sorgen. Das merkte sie, ohne dass er es aussprach. Er wolle auf sie aufpassen, hatte er gleich am Anfang gesagt. Sie konnte sich nicht erinnern, wann ihr das zum letzten Mal jemand versichert hatte. – Ach was, sie brauchte keinen Schutz. Ihre Sicherheit war die Hartmann-Station, keine vier Stunden von hier und ihr Mann. Ja, der beschützte die Stute und das Fohlen, wo war denn sie geblieben? Sie war schon lange viel weniger wert. Ja, am Anfang, da hatte er in ihr wohl noch die Stute gesehen und war scharf auf sie gewesen, aber jetzt stand sie im Stall, wie eine alte Mähre, gerade noch gut genug, gelegentlich einen Wagen zu ziehen. Viel wichtiger war jetzt das richtige Pferd und das kommende Fohlen. – Sie war aber noch nicht alt und keineswegs verbraucht. Die Komplimente und Aufmerksamkeit der Männer heute waren Balsam auf ihre Wunden, und Alans Blicke ließen ihr kleine Schauer durch den Körper jagen.
Während sie sich in der allmählichen Wärme ihres Bettes eingrub, erwachten Sehnsüchte, längst verdrängte Gefühle und unerfüllte Wünsche krochen die Lenden hoch und züngelten in ihren Schoss, bis sie mit leisem wohligen Seufzen in die Welt der Träume entglitt. Watteweiche Schleier schwebten um ihn, den Berg, den Ruapehu, geheimnisvoll, schön und voll unersättlicher Kraft. Er leuchtete ihr entgegen, stark und wundervoll. Dann nahm er drohende dunkle Gestalt an, verfinsterte den Himmel und zerriss die weißen Schleier. Ein Gesicht tauchte auf, zuerst nur vage. Er beruhigte die Wogen und streckte seine Arme aus. ... Ich,... Alan, ich beschütze dich ...
Der wunderschöne Sonntag lockte ein paar weitere Wintersportler an, das merkte Judith schon bei der Anfahrt den Berg hinauf. Gleich beim Skilift wartete Alan. Er war allein, Jim hätte eine dringende Autoreparatur zurückgehalten. Als einzige Werkstatt im Ort könne man nicht so sein und müsste halt auch einmal am Sonntag zugreifen.
„Zu viele Leute“, brummte Alan, als sie schon am Bügel in die Höhe glitten. „Lass uns heute weiter aufsteigen. Ich hab' ein zusätzliches Paar Felle dabei.“
„Wenn Sie meinen“, erwiderte Judith zaghaft. Ihr Kopf summte noch vom gestrigen Wein, aber die frische Luft tat gut. „Ist es nicht lawinengefährlich abseits der Piste?“
„Keine Angst, ich kenn' mich aus. Der Schnee ist meist sehr kompakt, muss die hohe Luftfeuchtigkeit vom Meer her sein. Aber wir steigen sowieso die Ostflanke hoch, bis zum Gletscher. Unterhalb des Tahurangi gibt es keine nennenswerte Lawinenhänge.“
Mühselig, Schritt um Schritt, erkämpften sie Höhe und Judith wollte sich, schwer atmend, schon ernstlich fragen, ob das wirklich der Sinn ihres Skiurlaubs sei. Dann aber, nach gut einer Stunde, erreichten sie den Grat. Von ihrem Standpunkt aus blickten sie über den Gletscher, dessen Zunge weit hinunter reichte und in einer zerfurchten Rinne endete. Über sich konnten sie den Anfang des Eisstromes oben am Kraterrand eigentlich nur erahnen.
„Das ist der Mangaehuehu Gletscher. Der Whangaehu, von dem gestern die Rede war, ist von hier aus nicht zu sehen. Er liegt weiter drüben, hinter dem Grat dort. Der Whangaehu ist unser Sorgenkind. Er ist die Quelle des gleichnamigen Flusses weiter unten“, erklärte Alan, vornüber auf beide Stöcke gestützt. „Aber wir wissen, dass das Wasser eigentlich aus dem Kratersee kommt. Roy und ich haben im letzten Sommer Wasserproben verglichen. Unten im Fluss ist dieselbe schwefelhaltige trübe Brühe, wie sie im Krater liegt.“
„Und darin seid ihr geschwommen?“
„Oh ja! Es ist immer herrlich warm, ein richtiges Thermalbad.“
„Könnte man auch jetzt darin schwimmen?“
„Sicher, aber im Winter kommt man dort nicht hinauf. Zuviel blankes Eis, zu gefährlich“, wehrte er ab.
„In einem Kratersee schwimmen, das wäre ein Hit“, begeisterte sich Judith.
„Na ja, Sie könnten ja im Sommer wiederkommen. Ich würde Sie gerne hinaufführen.“
Warum eigentlich nicht, dachte Judith, fragte aber laut: „Steigen wir jetzt noch weiter auf?“
„Nicht mehr weit, vielleicht eine halbe Stunde noch, dort hinüber“, zeigte Alan. „Von dort haben wir eine wunderschöne Abfahrt vor uns.“
Ein weiterer Blick über den Gletscher, hinunter ins Tal, über die Ebene und zum fernen Hügelland, ließ sie tief durchatmen. Es war herrlich. Dunkle Wälder beschützten den Fuß des Berges, dann lagen grüne Flächen unberührt unter der Sonne, dazwischen schlängelten sich unbekannte Wasserläufe und suchten den Weg irgendwo in der Weite. Gegen Osten erstreckte sich ein Hochplateau in graubraunen Schattierungen und verschwand in kahlen Hügeln, in einer unbekannten Wüste. Der Mensch hatte kaum eine Spur hinterlassen. Man könnte die paar Straßenstücke glatt übersehen, die dann und wann in der Ferne verschwanden. Ohakune war nicht zu sehen. Das Dorf hatte sich unten in den Schatten des Berges geduckt und versteckt. Kein Haus, weit und breit. Nichts störte diese Ruhe und diesen Frieden. Und doch schwebte eine unsichtbare Drohung über ihnen, die den Menschen noch kleiner erscheinen ließ, als er in dieser grandiosen Szene sowieso schon war. Mount Ruapehu, der Gewaltige, wachte über ihnen und sie wussten nicht, war er freundlich und friedlich gestimmt, oder grollte er vielleicht, wollte plötzlich in gnadenlosem Zorn ausbrechen und alles in Reichweite unbarmherzig vernichten.
„Ich fühle mich so ausgeliefert, ... dem Berg ...“ Sie fand keine passenden Worte.
„Ja, der Berg ist allmächtig und allgegenwärtig. Ich verstehe, was Sie meinen. Den meisten Neulingen geht es so. Nur die Einheimischen haben sich ihre eigene Philosophie geschaffen. Sie rechnen in Jahrzehnten, Jahrhunderten, mit der kalkulierten Unwahrscheinlichkeit, dass gerade jetzt etwas passieren sollte. Man könnte es Fatalismus nennen, aber eigentlich ist es eher Naturverbundenheit, denn wer wollte sich anmaßen zu glauben, die Natur und das Schicksal nehme nicht auf der ganzen Welt seinen Lauf, egal wo immer wir sind und was wir tun.“
„Aber Sie selber bleiben nicht untätig. Sie steigen hinauf, kontrollieren, messen die Temperatur, prüfen das Wasser und verlassen sich nicht einfach aufs Glück“, wandte sie ein.
„Ich bin ja auch kein Einheimischer“, grinste er. Fuhr dann aber wieder ernst fort: „Natürlich sollten wir nicht einfach die Augen verschließen, und Roy hat vollkommen recht. Da oben braut sich etwas zusammen.“
Mit diesen Worten vollführte er eine Spitzkehre und wies mit einem Stock ins Tal. „Los, da geht's hinunter!“
Judith beobachtete die sportliche Gestalt, als sie sich nun abstieß und die ersten Bogen in die weiße Reinheit des Hanges zog. Imposant und mit einer echten Natürlichkeit bewegte sich dieser Mann, ganz das Ebenbild dieses Landes, grenzenlos und frei. Mit einem Gefühl von Glück und Losgelöstheit folgte sie ihm, schwang im gleichen Rhythmus und erlebte einen Rausch von Verbundenheit, mit dem Schnee unter ihren Skiern, mit dem fast endlosen sanften Hang und den Schwüngen, die sie beide da hineinlegten. Wie wenn ein Maler mit den letzten kraftvollen Pinselstrichen seinem Werk zu Leben verhilft, so erschienen die beiden Spuren im leuchtenden, glitzernden Schnee, wunderbar, jede für sich und doch zusammengehörend, Leben spendend in ihrem Gleichklang und in ihrer Reinheit.
Unten auf der Piste und beim Skilift blickten ein paar Wintersportler hinauf und brachen in freudige Rufe aus, als sie dem Paar entgegenblickten, das da wie zwei unwirkliche Schatten im Gegenlicht den Hang hinunter glitt. Dann huschten die Beiden vorbei. Nur ein leichtes, fast überirdisches Zischen folgte ihnen, als sie ohne anzuhalten und ohne genau erkennen zu lassen, wer da so göttlich fuhr, dem Tal zustrebten.
KAPITEL 3
Der Wirt des 'Northern Rails', wo sich die Eisenbahner von Palmerston North trafen, fluchte leise vor sich hin und drehte nervös an den abgegriffenen Bakelit-Knöpfen des Radios. Das nussbaumfarbene elegante Gerät hatte eigentlich viel besser in die gute Stube seiner verstorbenen Mutter gepasst, als jetzt in dieses verrauchte Bierlokal. Seit ein paar Jahren stand es etwas deplatziert hinter der Theke vor einem blinden Spiegel und verdrängte die mit Rum, Wodka und Whisky gefüllten Flaschen. Es versuchte beharrlich die Kundschaft und vor allem die Stammgäste mit allerlei volkstümlicher Radiomusik zu unterhalten. – Heute aber war das Rugbyspiel. Es krachte ohrenbetäubend aus dem Lautsprecher, dann wurde der nerventötende, sphärische Pfeifton leiser und man hörte wieder, wie sich der Kommentator die Kehle aus dem Hals schrie, als er versuchte den Lärm der aufgebrachten Menge im Manawatu Stadion zu übertönen.
Die Männer standen wie erstarrt auf der gegenüberliegenden Seite und klammerten sich an die Biergläser. Ihr Billy McOven angelte sich den Ball und brach wie eine Ramme quer durch die gegnerischen Reihen, schaffte noch einen Bogen gegen die Mitte und erhechtete seinen zweiten 'Touchdown' in diesem Spiel. Die Stimme im Radio überschlug sich und ging im allgemeinen Geschrei, Schulterklopfen und Biernachbestellen unter.
Der Lokführer John Baker bezahlte die beiden frischen Pints Ale, nahm einen kräftigen Schluck und wandte sich frohlockend seinem langjährigen Freund und Heizer zu: „Die Black Stones' sind wirklich wahre Teufelskerle. Der Sieg ist so gut wie geritzt, die 'Ranfurl' ist unser.“ Er meinte damit die hart umkämpfte Ranfurly Shield Trophy, der Traum jedes Rugby-Spielers in Neuseeland.
„Aber natürlich, hups ...“, grunzte Oliver und verschüttete einen Teil des bis an den Rand gefüllten Glases.
„Pass doch auf!“, rief John, während er zusah, wie der weiße Zettel mit der Nummer 23 langsam das Nass aufsog und die Zahl kaum mehr lesbar wurde. Er fischte das Papier heraus und klebte es vorsorglich an eine der wenigen trockenen Stellen auf die Theke.
„Wo ist meiner ...?“, lallte O1.
Alle nannten den untersetzten kleinen Mann Ol, denn sie wussten seit langem, dass er das läppische Oliver hasste. Er hatte seinen Eltern nie verziehen, dass sie ihn auf so einen bübischen Namen getauft und damit bestraft hatten. Das war doch kein Name für einen richtigen Iren.
„Hat ihn doch glatt einer geklaut.“ Seine schmalen Äuglein, jetzt in der düsteren Kneipe von undefinierbarer Farbe, wanderten unruhig hin und her, bis sie zornig aufblitzten. Während sich das sommersprossige Gesicht rot verfärbte schrie er: „Ihr Bastarde, ihr verfluchten, wo ist mein Ticket!“
„Ol, lass das“, beschwichtigte John. „Es war die Fünfzehn, ich hab's gesehen. Hast sie wohl selber irgendwo hingesteckt.“
„Ich? ... Du, du bist mein Zeuge, wenn die gewinnt, musst du bestätigen, dass ich die Fünfzehn hatte!“
„Ja, ja, wenn sie gewinnt!“
Inmitten dieser wogenden Männergesellschaft war die verlorene Nummer schnell vergessen. John bestellte eine neue Runde, denn in der Zwischenzeit hatten die “Black Stones“ das Rugbyspiel glorreich zu ihren Gunsten entschieden. Jetzt standen sie schon in drei Reihen an der Theke, und der Lärmpegel war unaufhörlich gestiegen. Man schrie sich zu, nickte ergeben, auch wenn man nichts verstanden hatte oder schrie noch lauter zurück.
Dem Tumult wurde jäh ein Ende bereitet, als Aufmerksamkeit fordernd, eine helle Glocke erklang. Im Hintergrund, neben einem einfachen Tisch, stand ein massiger Mann in einer glänzenden beigen Gummischürze. Er hatte ein großes flaches Metallgefäß vor sich, in dem schwere Pakete lagen. Es war der Metzger des nahen Schlachthofes. Er grinste übers ganze feiste Gesicht; der heutige Abend war ein Erfolg und brachte ihm ein paar anständige Dollars ein. Auch sein Kunde konnte zufrieden sein, die Lose waren schon früh am Abend alle verkauft. Der letztere, ein Bauer aus der Gegend, wusste ganz genau, dass eine Verlosung mehr Erfolg versprach, als wenn er das Fleisch am nächsten Morgen auf dem Markt in der Stadt angeboten hätte. Das Rind, das er heute zur Bank geführt hatte war sowieso von eher geringem Gewicht gewesen. Er wusste, hier wurde meist alles problemlos an den Mann gebracht und man blieb nicht auf den letzten zähen Stücken sitzen, wie das auf dem Markt oft passierte. Wenn man dann noch einen Abend wie den heutigen erwischte ... er hätte die Lose ohne Schwierigkeiten zweimal verkaufen können.
„Wir kommen zur Verlosung von zweihundert Pfund bestem Rindfleisch des Farmers Ken Merril, ... na ja, ihr kennt ihn ja alle.“
Die Ansage ging in tosendem Beifall und Gejohle unter. Ken Merril grinste mit gerötetem Gesicht verlegen. Der Schlachter wartete bedächtig, die Spannung stieg. Dann griff er in einen auf der Theke stehenden Eimer und fischte demonstrativ langsam den ersten Zettel heraus. Wieder erklang die Glocke.
„Nummer 42“, rief der bullige Mann in die Menge und zeigte den Beweis rundherum. Ein Raunen ging durch die Kneipe. Nach einem Blick auf den eigenen Zettel schaute sich jeder suchend um. Unter grellen Pfeiftönen und lauten Rufen drängte sich der Glückliche vor und empfing das erste Paket.
Dann ging's zügig weiter. Nummer 33, Glocke, 18, Glocke, und plötzlich die 23.
„Ich!“, stotterte John und schnappte sich sein Los von der Theke. Das Bierglas entging nur ganz knapp einer Katastrophe. John strahlte und bahnte sich den Weg zum Tisch, wo er ein riesiges, in Zeitungspapier gewickeltes, gut verschnürtes Paket in Empfang nahm. Wie wenn die “Black Stones“ ihre Trophäe bejubeln würden, so hob John sein gut zehn Pfund schweres Lendenstück in die Höhe und schrie in Begeisterung: „Ich hab' gewonnen! Für einen Schilling so viel Fleisch!“
Auch Oliver strahlte, jetzt schon fast wieder nüchtern, während John das Paket vor ihm auf die Theke türmte. „Mensch John, du ... du Glückspilz! Nun musst du mich ... mich aber einladen! Deine Betty bereitet einen vorzüglichen Braten, immer mit viel Sauce und Z ... Zwiebeln.“
„Klar doch“, antwortete John und schlug seinem Freund auf die Schulter. „Wer würde seinen besten Heizer vergessen. ... Natürlich bist du eingeladen.“
Zwei Stunden später marschierte John am dunklen Bahnhof vorbei heimwärts, Richtung Hokowhitu. Das schwere Paket zerrte an seinem rechten Arm. Er blieb kurz stehen und wechselte zur anderen Hand, während er über die Geleise blickte. Der nordwärts fahrende Nachtzug war längst abgefahren, aber der Güterzug Richtung Woodville wartete noch ganz hinten vor dem geschlossenen Signal. Vielleicht war es Steve, der ihn heute Nacht fuhr, oder Terry. Er wusste es nicht, aber eins war klar, seine eigene Schicht begann morgen Mittag, dann, wenn er den Express Richtung Auckland übernahm. Wie gewohnt, Punkt 10:57 Uhr würde er aus dem Bahnhof rollen. Es war höchste Zeit fürs Bett, die paar Drinks mussten ausgeschlafen werden.
Der späte Fußmarsch durch die menschenleeren Straßen und der kalte Südwind ernüchterten ihn vollkommen, und als er zehn Minuten später in den Steward Crescent einbog, pfiff er leise vor sich hin. Im Fenster ihres kleinen Hauses brannte matt ein Licht. Betty musste noch auf sein. Sicher würde sie sich über das mitgebrachte Geschenk freuen. Die Bohlen der Veranda knarrten laut, als er hinaufstieg und sich am Türschloss zu schaffen machte. Links neben dem Eingang stand im Schatten verlassen sein Sessel und ein kleines Tischchen. Eine Zeitung war zu Boden geflattert. Gedankenlos hob John sie auf und beschwerte sie mit dem massiven Aschenbecher aus Glas, in dem noch seine kalte Pfeife lag. Hier verbrachte er oft ungestört seinen Feierabend, an der frischen Luft.
Drinnen rührte sich nichts. Er ging in die Küche und legte das Fleisch in den Kühlschrank. Man musste es aufteilen und einpökeln – und natürlich einen schönen Braten herrichten, für Samstagabend, wenn Oliver kam. Er durfte nicht vergessen es Betty zu sagen. Sie war scheinbar doch zu Bett gegangen, hatte aber das Licht im Wohnzimmer vergessen. Als er eintrat, zuckte er zusammen. Ärger stieg in ihm hoch.
„Wendy, was zum Teufel soll das“, fuhr er die auf dem Fussboden sitzende Gestalt an.
Er bekam keine Antwort. Mitten im Raum war um das goldene Bild eines Engels ein Kreis mit brennenden Kerzen aufgestellt. Sie warfen unruhige Schatten auf die dunkelbraunen Möbel und spiegelten sich im Glas der gerahmten Fotos, die über der Anrichte an der Wand hingen. Familienaufnahmen, ein Hochzeitsbild natürlich, sie beide zusammen mit der kleinen Tochter, aber auch er selber in der neuen, schicken Uniform der New Zealand Railways. Am liebsten war ihm die Aufnahme aus Dunedin. Vor Jahren, waren sie auf der Südinsel zum Taiaroa Head hinausgefahren und hatten die Albatrosse beobachtet. Die vierjährige Wendy hatte ihre helle Freude an den großen eleganten Seglern, die dann wie lahme Enten mit einem plumpen Hopser auf der Klippe landeten. Eine glückliche Familie blickte aus dem goldenen Rahmen, der jetzt matt im Kerzenlicht glänzte.
Wendy saß mit gekreuzten Beinen vor dem mit grünem Plüsch überzogenen Sofa, dessen abgewetzte Polster schon lange einen neuen Bezug gebraucht hätten. Sie starrte mit leeren Augen in die flackernden Lichter. Ein schwacher Geruch von Wachs und Schwefel stieg ihm in die Nase. Seine Tochter wiegte sich leise hin und her, ohne auf den Eindringling zu achten. Sie trug ein weißes Nachthemd, ein paar Nummern zu groß, so dass es über ihre linke Schulter hing und die spitzen Knochen ihres Schlüsselbeins und Oberarms entblößte.
Mein Gott, wie mager sie ist, durchfuhr es John. Ihre Haare waren ein verfilztes Gewirr, einem alten Mopp nicht unähnlich. Wo waren die herrlichen goldenen Locken geblieben, die er an seinem kleinen Mädchen so geliebt hatte und die ihre Mutter täglich hingebungsvoll gebürstet und gekämmt hatte. Nur ihre Augen waren dieselben geblieben. Zwar lagen sie jetzt in dunklen Höhlen, aber das helle Blau mit einem leichten Grünton strahlte manchmal noch genauso, wie vor zehn, fünfzehn Jahren, auch wenn heutzutage vielleicht aus einem anderen Grund.
„Wendy ...“, begann er noch einmal.
Endlich drehte sie langsam den Kopf und in ihre Augen kam Leben.
„Vater! Ach, dubist's ...“
„Was machst du denn da? Willst du unser Haus anzünden? Wo ist deine Mutter?“
„Mom ist zu Bett gegangen“, antwortete sie. „Sei bitte leise, – Gloria schläft.“
Gloria, ihr Enkelkind bedeutete ihnen alles. Es wurde von Betty abgöttisch geliebt und verwöhnt. Notgedrungen hatten sie die Elternrolle übernommen, als Wendy ihnen deutlich zu verstehen gab, dass sie für Höheres berufen sei, als Windeln zu waschen. Wieder stieg Ärger in John hoch. Herrgott noch einmal, warum hat sie die Kleine nicht gleich 'Halleluja' getauft! Diese Geschichte mit dem neuen
'Seelenheil' musste doch einmal ein Ende nehmen. Aber nein, sie hatte diesem längst verstorbenen Gauner und Heuchler, diesem Bill Ratana, blindlings zu folgen. Te Mangai nannte er sich damals, das Sprachrohr Gottes. So ein Quatsch! Eigentlich war's eine Maoribewegung, die es während der Labourregierungszeit tatsächlich zu beachtlichem, politischem Einfluss brachte. Aber heutzutage waren, Gott sein Dank, wieder vernünftige Leute an der Macht. Sidney Holland, der Premier, hielt absolut nichts von diesem Schaumschläger, diesem Ratanazeugs. Auch die richtige, die anglikanische Kirche exkommunizierte bekannt gewordene Anhänger dieser Sekte unbarmherzig. Aber Wendy ..., die wusste es natürlich besser. War sie denn nicht alt genug und solcher Kinderei entwachsen?
In der Zwischenzeit hatte Wendy die Kerzen gelöscht, so dass beißender Rauch gegen die Decke schwebte. John unterdrückte ein Niesen. „... Bleibst du?“, fragte er beherrscht.
„Nur heute Nacht“, antwortete sie. „Ich muss morgen in Whanganui sein, eine Feier und Heilung mit Te Wiretoa. Ich bleibe dann bis im Dezember, es gibt so viele Leidende und Kranke, sie brauchen meine Hilfe.“
Längst hatte John Baker es aufgegeben, auf sie einzureden und von ihrem unsinnigen Tun abzuraten. Hilfe für die Kranken, das war ja an und für sich nichts Falsches, aber wie sie diese sogenannten Heilungen durchführten. Sie würde noch mit dem Gesetz in Konflikt kommen, denn es wurden Stimmen laut, dass die Jünger Ratanas die Leidenden von medizinischer Hilfe abhielten und so deren Situation nur verschlimmerten, ja ihren baldigen Tod herbeiführten. Im Parlament sprach man offen und lautstark von Mord, und dass die Sekte endlich verboten werden sollte. Aber eben, Wendy war nicht davon abzubringen, und dass ihr eigenes Kind vielleicht die Mutter brauchen würde, das schien sie nicht zu kümmern.
„Aber wenigstens Weihnachten bist du da?“, fragte John.
„Ja, Dad, ich hab's Mom versprochen, wir wollen dann zusammen feiern.“
„Na ja, dann geh' ich jetzt ins Bett. Hab' morgen den Auckland-Express und brauch' den Schlaf.“