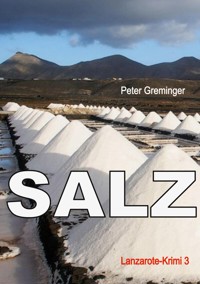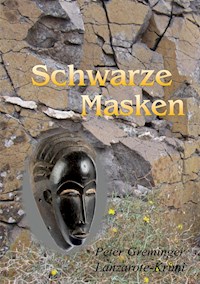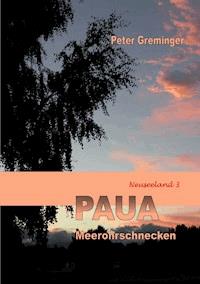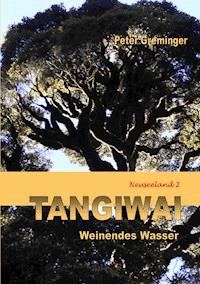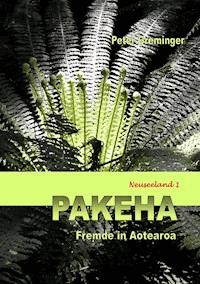
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geburtsstätte des Landes der Kiwis liegt auf der Nordinsel, in der Bay of Islands. Dort legten die Engländer im Jahre 1840 einen für den aufrührerischen Häuptling Hone Heke Pokai inakzeptablen Vertrag über die Souveränität des Landes vor. Obwohl er diese Treaty of Waitangi zuerst nichtsahnend unterschrieb, bekämpfte er sie später verbissen. Mitten in diese unruhige Zeit gerieten die Missionare der Church of England und mit ihnen Reverend Robert Burrows. Die Maoris nahmen das Christentum willig an, aber das friedliche Zusammenleben mit den Pakehas (so nannten sie die fremden Eindringlinge) wurde immer wieder von Streitereien und blutigen Kriegen gestört. Dass aber die Differenzen bis zum heutigen Tag nicht bereinigt werden konnten, das war nicht vorauszusehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Das neue Jahrtausend begann für Peter Greminger mit der Ruhe eines glücklichen Frührentners. Seiner Meinung nach, hatte er als Leiter verschiedener Textilfabriken in Asien mehr als genug geleistet, und die neu geschlossene Ehe mit seiner lieben Marlis ließ ihn neu aufleben. Es war dann auch sie, die ihn ermunterte, sich an den Laptop zu setzen und seine Phantasien der Elektronik anzuvertrauen.
Das Jahr Neuseeland war wie geschaffen für einen ersten Versuch. Peter Gremingers beharrliche Art zu recherchieren bescherten ihm bald eine Fülle von Eindrücken und Ideen über das ferne Land. Er reiste deshalb mit dem vorliegenden Roman PAKEHA im Gepäck zurück nach Hause. Damals ahnte er noch nicht, dass ihn das Thema Neuseeland nicht mehr loslassen sollte und drei weitere Romane entstehen würden: TANGIWAI (Weinendes Wasser), PAUA (Meerohrschnecken) und KAHURANGI (Grüner Stein).
Peter Greminger
Was sie redet, hat Hand und Fuß; mit freundlichen Worten gibt sie Anweisungen und Ratschläge.
(Spr 31/26)
Dieses Buch ist mit herzlichem Dank meiner lieben Frau gewidmet.
Inhaltsverzeichnis
Im Jahr 2001
Im Jahr 1845
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 39
Im Jahre 2001-02
Im Jahr 2001
Eigentlich machte ich mir nie viel aus Tätowierungen, verstand aber durchaus, dass ein kleiner, zierlicher Schmetterling, auf dem wohlgeformten Po eines hübschen Mädchens, eines Mannes Phantasie beflügeln kann. Solche Kunstwerke erinnerten mich aber eher an einsame, brummige Seeleute, die sich in einem verrufenen Hafenviertel einen blauen Anker oder ein Herz mit dem Namen einer temporären Liebe einritzen ließen. In Japan ist der tätowierte Körper aber untrügliches Zeichen der Angehörigkeit zu einer mafiaähnlichen Organisation, und in Indonesien erließ vor ein paar Jahren ein zorniger General, nachdem seine Tochter vergewaltigt und ermordet worden war, den Schießbefehl auf alle Männer mit Tätowierungen. Die Opfer wurden meist in Säcken in den Fluss geworfen, und bald war landauf, landab das Wort 'dikarungi' - zu Deutsch 'einsacken' – in aller Munde. Ich habe selber erlebt, wie ein Arbeiter in unserem Betrieb in West Java eines Tages mit einem schrecklich verbrannten Arm auftauchte, weil er das verräterische Bild mit einem heißen Bügeleisen entfernen wollte.
Tätowierungen waren für mich also eher etwas Unsinniges und Abstoßendes. Wie konnte sich ein Mensch derart verunstalten, ohne an die Konsequenzen zu denken? Dass aber jemand solch blauschwarze Zeichnungen stolz im ganzen Gesicht tragen konnte, schien mir völlig unverständlich. Die Maoris in Neuseeland tun das aber, wie wir bald erfahren sollten.
Das bedrohliche Zischen und Fauchen beim Einsteigen erinnerte mich an eine große Raubkatze, die in der flimmernden Savanne, mit dem Schweif peitschend, regungslos auf dem Boden lag und deren feiner Geruchsinn in der Ferne das nichtsahnende Opfer ausmachte. Es muss wohl die nicht zu bewältigende Erinnerung an den fürchterlichen Terror von New York gewesen sein, die mich drei Tage später in das Innere der Boing 747 der Thai International begleitete.
Jetzt schlug uns jedoch eine Mischung von Kerosindämpfen, Gummiabrieb und Essensgerüchen entgegen, bevor uns der schallabsorbierende, gepolsterte Käfig mit leiser Musik empfing. Marlis schob sich vor mir durch die Sitzreihen, mit Blick nach oben, die richtige Nummer suchend. Ihr leicht zerzaustes, kurzes, rotbraunes Haar passte ausgezeichnet zur grünen Bluse und ihre bequemen Jeans boten mir einen wohltuenden Anblick. Trotzdem konnte ich das leicht mulmige Gefühl nicht loswerden – und wirkte das strahlende Bilderbuchlächeln der Stewardess, die uns in die richtige Reihe dirigierte, nicht eine Spur gekünstelter als sonst?
Als die entfesselte Kraft das Flugzeug wie einen abspringenden Tiger vorwärts preschen ließ, blitzten Bilder der einstürzenden Türme des World-Trade-Centers durch mein Gehirn, Tausende von Opfern, in Sekundenschnelle. In diesem Moment gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir entkamen und schwangen uns in den flimmernden Himmel hinein – oder das Raubtier würde seine Pranken in uns schlagen und uns irgendwo weit vorn, am Ende der Rollbahn vernichten. – Die Statistiken hatten Recht, Flugzeuge waren eines der sichersten Transportmittel. Unsere Piloten hatten uns mühelos in die Luft bekommen.
Marlis ließ meinen Arm los und lehnte sich gegen meine Schulter. „Liebling", flüsterte sie mir ins Ohr, „wir sind unterwegs! Neuseeland erwartet uns."
„Hm?" – Ich stellte mir die Weltkugel vor. – „Noch etwas Geduld, meine Liebe. Lass uns erst einmal nach Bangkok kommen."
Ich kramte in der Sitztasche nach dem bekannten Airlineheft in Hochglanzdruck. Es war schon etwas zerfleddert von suchenden Händen früherer nervöser Fluggäste. Auf der zerknitterten Weltkarte fand ich die roten Flugrouten. Von Zürich Richtung Jugoslawien – oder was davon noch übrig war – , über den Iran, hinein nach Afghanistan. Dort unten versteckte sich der Angeschuldigte und Terroristenführer Osama bin Laden, auf den die Amerikaner ihre ganze Wut und ihren Frust entluden. „Wanted, dead or alive", hatte Präsident Bush der Welt über CNN verkündet und denjenigen, die Terroristen Unterschlupf gewährten, massive Vergeltung angedroht. Afghanistan stand direkt in seiner Schusslinie, und da führte die rote Linie genau durch.
Mein Finger blieb an der Grenze zwischen dem südlichen Afghanistan und Pakistan stehen. Vor siebenunddreißig Jahren hatte ich dort unten gearbeitet und beim Aufbau einer Textilfabrik mitgeholfen. Acht Monate meines Lebens, die sich unauslöschlich in meine Erinnerung eingeprägt hatten. Die heutigen Bilder des Fernsehens über das Land, wo die Mullahs und die Scharia regierten, unterschieden sich kaum von dem damals Erlebten. Die Gegend der Sindhi, zwischen Indus und Quetta, war ein dürrer, unwirtlicher Landstrich, einer Wüste gleich. Von dort ging es in die kahlen, unwegsamen Berge, Richtung südliches Afghanistan. Staubige, löchrige Schotterstraßen, verfallene Lehmbauten zwischen dürrem stacheligem Gestrüpp, Menschen in graubraun schmutzigen Hemden und Tüchern, noch schmutzigere, halbnackte Kinder mit verfilztem Haar um ein trübes, schlammiges Wasserloch. All das sah ich lebhaft vor meinen Augen. Ich erinnerte mich an das Elend, den Schmutz, an einen Basar in der Mittagshitze, Staub, knirschend zwischen den Zähnen, Fliegen im Gesicht, ganze Schwärme auf dem Fleisch eines geschlachteten Hammels. Unrat lag überall, die Fäkalien rannen auf die Straße, eine Kanalisation fehlte gänzlich. Wasser war kostbar und wurde in Schläuchen verkauft. Nur intensives Abkochen rettete uns damals vor Bauchkrämpfen und Durchfall. So war es damals – so ist es heute. – Die Zeit musste vor tausend Jahren stillgestanden sein.
Unsere Maschine zog unverdrossen Stunde um Stunde gegen Osten, südlich der Grenze entlang, quer über Pakistan, nach Indien hinein. Die Amerikaner verschoben ihren Angriff bis auf weiteres.
Ich hatte mir meinen grünen Pullover um die Schultern gezogen und Marlis hüllte sich in die dünne Wolldecke. Wie immer fröstelten wir im Luftzug der Klimaanlage. Meine Frau lächelte erlöst, als ich ihr zuraunte: „Afghanistan, Angst und Terror sind weit hinter uns."
„Gott sei Dank! – Monatelang haben wir darauf gewartet, und jetzt sind wir dem Ziel nahe", entgegnete sie und drückte meine Hand.
„Sollen wir Champagner bestellen? Wir sind schließlich auf unserer Hochzeitsreise ... ."
„Schon wieder!" Ihre grünen Augen funkelten schelmisch. „Lass gut sein, das funktioniert nur ein Mal."
„Ich liebe dich aber und schließlich haben wir erst vor ein paar Wochen geheiratet – wirklich!"
Vor knapp vier Jahren saßen wir, genau wie jetzt, nebeneinander im Flugzeug, ebenfalls auf dem Weg nach Neuseeland. Damals kannten wir uns kaum ein paar stürmische Wochen und die Verliebtheit muss uns wie eine leuchtende Aura umgeben haben. Die freundlichen Stewardessen der British Airways damals zweifelten keinen Moment an unserem vorgetäuschten Honeymoon, servierten Champagner und überreichten uns die Glückwünsche der gesamten Crew. Selig verliebt genossen wir den kleinen Schwindel.
Heute, nicht weniger verliebt, verheiratet und – vernünftig, wollten wir aber nichts mehr riskieren, aßen brav die Speisen aus dem Plastik und tranken einen biederen roten Wein. Unser Ziel war dasselbe, das ferne Neuseeland. Marlis hat eine erwachsene Tochter, die es tatsächlich geschafft hatte, sich auf der anderen Seite der Welt zu verheiraten. Als Anfang 1998 zur Hochzeit geladen wurde, war auch ich mit von Partie und lernte Mutter, Tochter, Schwiegersohn, Land und Leute etwas kennen. Aber es reichte in der kurzen Zeit natürlich nur für eine schnelle Tour und eine kurze Reise durch die Südinsel. Außerdem hatte meine Verliebtheit damals meinen Blick wohl etwas getrübt.
Jetzt war das zweite Baby fällig und die glückliche Großmutter im Anmarsch. Mich konnten solche Tatsachen nicht mehr erschüttern, denn auch ich war unterdessen vierfacher Großvater mit grauen Haaren und altmodischen Ansichten geworden.
Mehr als zwanzig Stunden später saßen wir in der beeindruckenden neuen Transithalle von Sydney und warteten auf den Aufruf zur letzten Etappe unserer langen Reise. Unsere Thai-International hatte vorher einen langen Aufenthalt in Bangkok eingelegt, und wir hatten die Gelegenheit zu ein paar wohltuenden Stunden Schlaf im Airporthotel benützt. Die Erfahrung früherer Flüge lehrte uns, dass in unserem Alter nach etwa zwölf Stunden unbedingt eine Ruhepause vonnöten war. Ich fühlte mich deshalb frühmorgens in Sydney ausgesprochen munter, wanderte die Halle auf und ab und ließ glückliche Bilder unserer ersten 'Hochzeitsreise' vor meinem Geiste auferstehen. Das Opernhaus, Wahrzeichen und zugleich abgegriffenes Postkartensujets Australiens, hatte uns damals unausweichlich in seinen Bann gezogen. Blau schimmernd ragte es über dem Wasser, und meine Marlis schwebte wie eine Königin vor mir die breite Flucht Treppen hinauf, hinein zum unvergesslichen 'Cosi fan tutti' von Wolfgang Amadeus Mozart. Wegen einer Musik-Festival-Woche war das imposante, geblähten Segeln gleichende Gebäude in mattes blaues Flutlicht getaucht. Ein Traum hätte nicht schöner sein können.
„Was freut dich denn so?", lächelte mir Marlis zu und hakte sich unter.
Ich drückte ihren Arm: „Erinnerst du dich – die Oper vor vier Jahren? – Ich war so verliebt. – Ich bin so glücklich! So glücklich wie damals. – Ja, noch viel mehr!"
„Es war einfach wunderbar, unvergesslich!", schwärmte auch sie.
„Es geht gleich weiter", antwortete ich, ohne die Zweideutigkeit meiner Worte zu bemerken, denn ich lauschte auf das Knacken, das durch die Lautsprecher ging. „Diesmal gilt es ernst. Neuseeland wird uns für ein Jahr auf Gedeih und Verderben behalten."
„Was soll schon passieren? Du bist bei mir, Angela und Roland nicht weit. Ich freue mich so!"
„Na ja", dämpfte ich etwas, „ein paar Probleme werden schon auf uns zukommen. Wir brauchen ein Auto und eine Wohnung. Wir wissen auch immer noch nicht, wie es Angela geht und wann das Baby kommt."
„Flug TG771 nach Auckland ist zum Einsteigen bereit!", hallte es nun endgültig über unseren Köpfen, und die Passagiere drängten sich zum Ausgang. Nochmals gut drei Stunden und wir wären am Ziel. Endlich würde sich die monatelang gehegte Sehnsucht erfüllen.
Als unser Flugzeug zur Landung ansetzte, wurde mir noch einmal im ganzen Umfang bewusst, was für einen außerordentlichen Schritt wir wagten. 'Aotearoa', das Land der langen weißen Wolke', hatte uns eingefangen.
Captain James Cook ankerte 1769 in der Bay of Islands
Cooks Karte auf der Brigg Endeavour
Im Jahr 1845
KAPITEL 1
Kurz vor Weihnachten im Jahre 1814 ankerte die Brigg H.M.S. 'Active' bei Rangihoua in der Bay of Islands. Die Boote wurden zu Wasser gelassen, und Reverend Samuel Marsden, im schwarzen Gehrock und Zylinder, führte eine zusammengewürfelte Gruppe Missionare, Einwanderer, Abenteurer und Seeleute an den Strand. Er dankte Gott dem Allmächtigen, nach der stürmischen Überfahrt endlich wieder festen Boden unter den Füssen zu haben. Zu diesem Anlass zelebrierte der Vertreter der Church of England den ersten christlichen Gottesdienst auf neuseeländischem Boden. Er wählte den Text aus dem Lukas Evangelium:
(2/10) „Habt keine Angst, ich bring euch gute Nachricht, über die sich alle freuen werden!"
Ob die damals versammelten staunenden Maoris diese Ankündigung des Jesuskindes verstanden? Wohl kaum.
Neugierig waren sie aus dem weiter hinten gelegenen Dorf näher gekommen und beobachteten die Fremden, wie sie aus ihren plumpen Booten kletterten und sogar ein paar Frauen und Kinder an Land trugen. Die Pakehas – so nannten die Einheimischen die Fremden – schienen in friedlicher Absicht zu kommen und es bestand keinen Grund, sich in die oben auf dem Hügel liegende, palisadenbewehrte Festung, den Pa, zurückzuziehen. Trotzdem standen ein paar kräftige Krieger mit wachsamen Augen da und verfolgten argwöhnisch, wie immer mehr Kisten, Säcke und Fässer an Land gebracht wurden. Die Maori-Krieger waren fast alle an die vier Zoll grösser und stämmiger als die weißen Männer. Deren Häuptling, im schwarzen Rock, war außerdem beleibt und unbeweglich und kam nur schwer schnaufend durch den Sand die Böschung hinauf.
Die Einheimischen waren wohl viel mehr am Inhalt der Kisten und Fässer interessiert als an dem, was der Reverend in gebrochener Sprache erzählte, von einen großen, einzigen Gott, der für alle, auch für sie da sei. Geduldig ließen sie aber die eigenartige Weihnachtsfeier über sich ergehen und lernten willig das einfache letzte Wort 'Amen '.
Dreißig Jahre später war der christliche Glauben durch etliche fest etablierte Missionsstationen verbreitet und viele der Heiden bekehrt. Er, Reverend Robert Burrows, würde also nur eine wohl vorbereitete Arbeit übernehmen und ein weiteres kleines Steinchen ins göttliche Mosaik einfügen. Solche Gedanken geisterten ihm durch den Kopf, als er an Bord des Dreimasters H.M.S.'North Star' hinüber auf die nahen buschbewachsenen Anhöhen schaute und die Stelle, wo Marsden damals landete, suchte.
Raue Seeleute waren damit beschäftigt, die Rahsegel am Großmast einzuholen. Unter lauten Rufen kletterten sie behände in die Wanten, um die Segel zu bergen. Das Schiff schaukelte jetzt sanft in den Wellen, während der Kapitän den Weg zwischen Moturoa Island und dem Poraenui Point zum Kerikeri Inlet suchte.
Eben verschwand links die Insel Motuarohia. Dort hatte Captain James Cook im Jahr 1769, während seiner vergeblichen Suche nach dem vermeintlichen südlichen Kontinent, geankert und das Land für die englische Krone beansprucht. Dann kamen aber die Wal- und Robbenfänger aus aller Welt, und ein reger Handel mit Tran, Seals und Kauri-Holz setzte ein. Abenteurer, meuternde Seeleute und Sträflinge suchten ihr schnelles Glück, kümmerten sich nicht um Recht und Ordnung, sondern verfuhren nach dem Gesetz des Schnelleren und Stärkeren. In den Niederlassungen entlang der Küste herrschten Unruhe und Gesetzlosigkeit. Alkohol, käuflicher Sex und Verbrechen gehörten zur Tagesordnung. Als dann die Einheimischen auch noch die Macht der Feuerwaffen, der Musketen, erkannten, war der Teufel los. Die Stämme gingen aufeinander los, eroberten, versklavten und töteten. Die blutigen Musketen-Kriege wüteten. Erst Jahrzehnte später, nämlich vor knapp fünf Jahren, sandte Königin Victoria dem überforderten Residenten Busby Captain Hobson zu Hilfe, da unterdessen auch die Franzosen ein Auge auf die neue Kolonie geworfen hatten. Rasch arbeiteten sie einen Vertrag zwischen Maoris und den Pakehas aus, der die Ordnung und Souveränität unter der britischen Krone regeln sollte. Die Treaty of Waitangi garantierte den Maoris das Land-, Jagd- und Fischrecht sowie den Schutz Ihrer Majestät der Königin.
Am 6. Februar 1840 war das große Hui von Waitangi, und Häuptling Hone Heke Pokai war einer der Ersten von rund Fünfhundert, der unterschrieb.
Reverend Robert Burrows, dem das alles durch den Kopf ging, fror leicht, denn der Wind blies empfindlich kalt von Süden gegen das Land. Anfang Oktober war es eigentlich Frühling und der neuseeländische Winter längst vorbei, aber dieser Wind kam direkt von der Antarktis und ging durch Mark und Bein. Trotzdem waren das Ufer und die dahinterliegenden Hügel mit intensivem Grün dicht bewachsen. Der Wald in der Ferne erschien von geheimnisvollem, undurchdringlichem Schwarz. Weiße und graue Wolken hingen darüber und gaben der Landschaft etwas Unnahbares, fast wie die dunklen Tiefen des Ozeans, aus dem die Inseln emporstiegen. Ein paar große Möwen segelten um das Schiff und stürzten sich dann und wann kreischend auf Abfälle, die irgendwo vom Deck ins Wasser gefallen waren. Langsam glitten die knorrigen Mangroven, in seichtem Wasser stehend, vorbei. Der Kapitän beobachtete scharf seinen Lotsen, der vorne weit über den Bug lehnte und nach Untiefen suchte. Eine Hand fuhr hoch, ein paar scharfe Kommandos ertönten und die letzten Segel fielen. Klirrend fuhr der rostige Anker ins aufspritzende dunkle Wasser. Es würde noch eine Weile dauern, bis die Boote bereit waren.
Robert wich den Matrosen aus und spähte nach vorn. Es war fast wie eine Heimkehr für ihn, denn er hatte die letzten vier Jahre gegenüber, in der Bay of Islands, im verrufenen Kororareka verbracht. Es war eine unruhige, ungewisse Zeit gewesen, in der sich Engländer und Maoris an den Vertrag von Waitangi zu gewöhnen versuchten. Die Letzteren mit immer mehr Mühe, denn es wurde bald einmal klar, dass sich viele Einheimische hintergangen fühlten und um ihr Land fürchteten. Unter Reverend Henry Williams, der die Kirche in Paihia leitete, versuchte er damals in Kororareka eine kleine anglikanische Gemeinde zusammenzuhalten. Ein fast unmögliches Unterfangen für einen jungen, unerfahrenen Mann, der dort auch noch gegen den starken Einfluss einer katholischen Marist Mission anzukämpfen hatte. Bischof Selwyn schien aber Pläne für ihn zu schmieden und schickte Robert kurzerhand auf einen Heimurlaub, damit er endlich auch mit einer passenden Frau zurückkehre.
Die Mündung des Kerikeri lag breit vor ihnen, die Gebäude dicht am Ufer waren deutlich auszumachen. Da stand ein eckiges Steinhaus, grau und farblos. Unweit davon ein stattliches, weiß gestrichenes Missionshaus mit einer weiten Veranda, einem Anbau und Garten. Robert wusste, es war das Haus von James und Charlotte Kemp, welche er von damals flüchtig kannte. Eine kleine Kirche stand weiter hinten auf der Anhöhe. Massive, weiße Zäune schützten die ganze Anlage.
Inzwischen war auch Anne aus der Kabine auf Deck erschienen. Wie jedes Mal, wenn sie während der monatelangen Überfahrt auftauchte, ging ein bewunderndes Raunen durch die Mannschaft. Sie rauschte die Stufe auf das Vordeck empor, raffte den Rock aus weichem lila Musselin und steuerte auf Robert zu. Halt suchend griff sie nach seinem Arm: „Ist das die Kerikeri Missionsstation, dort vorn?"
Der Wind hatte die Krempe ihres kecken Häubchens aufgestellt und ein paar goldene Locken ergriffen. Leuchtende, hellblaue Augen blickten ihn fragend an.
„Ja meine Liebe. Rechts, das weiße Haus, dort wohnen die Kemps. Sie erwarten uns sicher schon."
Die kunstvoll geschwungenen roten Lippen öffneten sich leicht, und dann stellte sie fest: „Es scheint aber recht einsam hier. – Wo sind denn die Wilden?"
Robert drehte sich ihr zu und forschte in den geliebten, hellen Augen. Er wurde überwältigt von ihrer Schönheit. Der Teint hatte während der langen Seereise etwas gelitten, aber die geröteten Wangen machten die liebliche Gestalt nur noch begehrenswerter. Sein aufkommender Unwille verrauchte.
„Aber ich bitte dich! Die Maoris erwarten schon lange nicht mehr jedes ankommende Schiff mit großer Empfangszeremonie. Früher war das anders, da wäre jetzt die ganze Flussmündung voller Kanus und am Strand würden uns die Häuptlinge mit einem kriegerischen Tanz begrüßen."
Der Kapitän erschien auf dem Vorderdeck. Er war rasch in seine schwarze Jacke mit den zwei Reihen goldener Knöpfe geschlüpft, jedoch ohne sich die Mühe zu machen, diese zu schließen. Er strahlte übers bärtige Gesicht und kam auf die Beiden zu.
„War 'ne lange Reise, Sir, Madam!", sagte er, wobei er sich kurz vor der Dame verbeugte.
„Herr Kapitän", begrüßte ihn Robert. „Vielen Dank! Sie haben wirklich alles getan, um meiner Frau die Überfahrt so angenehm wie möglich zu machen. Nochmals herzlichen Dank."
„Oh ja", sagte Anne. „Wir haben die Reise genossen. Ich bin nun aber doch froh, dass wir da sind. Ich danke Ihnen, Herr Kapitän."
„War mir ein Vergnügen Madam", entgegnete McIngrin. „Wir bringen gerade Ihr Gepäck an Land." Damit deutete er auf die umfangreiche Ansammlung von Kisten, Koffern und Säcken. „Wir wollen weiter, müssen vor der Ebbe raus und rüber nach Kororareka. – Werden dort mindestens zwei Monate bleiben."
Er erläuterte nicht näher, was für Geschäfte ihn so eilig hinübertrieben, und Robert wollte es auch gar nicht so genau wissen. Die Seeleute hatten harte Monate hinter sich – und die Kneipen von Kororareka lockten...
„Nehmen Sie dieses Boot, Reverend!", fuhr McIngrin fort und zeigte nach Steuerbord, wo die Matrosen bereits die Ruder einlegten.
„Alles Gute, Madam." Er nickte kurz in Annes Richtung, machte kehrt und verschwand in Richtung Kajüte.
„Komm Liebste, lass uns gehen", sagte Robert und dirigierte seine Frau zur Leiter.
„Haben wir auch alles?"
„Sicher, keine Bange, es fehlt nichts."
Anne stolperte über herumliegendes Tauwerk, fing sich aber auf und kletterte behände ins Boot hinunter. Zwei Seeleute empfingen sie sicher, und Robert turnte selber rasch hintennach. Kurze Zeit später stieß der Bug sanft in den Sand.
James Kemp stand breitbeinig, einen zerdrückten Hut in den Händen, vor einer zusammengewürfelten Gruppe. Links neben ihm wartete seine Frau Charlotte. Einige Dienstboten spähten herüber, und zwei Männer, offensichtlich Handwerker, warfen sich ein paar Worte zu. Beide waren dann auch zur Stelle, zogen das schwere Boot, so weit es ging, herauf und halfen den Passagieren heraus. Anne entledigte sich ihrer Schuhe, raffte den Rock und watete an Land.
„Mein Gott, wie ich ausseh!", entsetzte sie sich, als sie bemerkte, dass ihr Kleid trotz aller Vorsicht nass geworden war und wie wenig elegant sie barfuß vor den Zuschauern stand.
Mrs.Kemp trat lächelnd vor, half Anne auf sicheren Boden und begrüßte sie tröstend: „Nur halb so schlimm, das trocknet bald wieder."
Ihre Stimme klang energisch, und starke Arme umfingen Anne in einem herzlichen Willkommen. „Mrs.Burrows, schön, dass Sie endlich da sind."
Charlotte Kemp freute sich aufrichtig. Rosige Wangen und gütige braune Augen wurden von einer schwarzen Haube eingerahmt, unter welcher das graue Haar, straff zurückgekämmt, kaum zu sehen war. Die große Schürze und hochgekrempelte Ärmel verrieten, dass sie Arbeit nicht scheute. Einfache, robuste Schnürschuhe schauten unter dem langen grauen Rock hervor.
„Kommen Sie, wir gehen ins Haus. Hier sind genug Männer, die sich um alles kümmern." Damit führte sie Anne durch das Tor im weißen Zaun.
Unterdessen hieß Mr.Kemp einen leicht schwankenden Robert, dessen Beine sich erst wieder an den festen Boden gewöhnen mussten, herzlich willkommen.
„Guten Tag, Sir", sagte Robert. „Es ist uns eine Ehre – so ein Empfang!"
„Ach, nicht der Rede wert", entgegnete Kemp. „Unser Haus ist für alle guten Christen offen. Bischof Selwyn hat Sie mir wärmstens empfohlen."
Er schüttelte Roberts Hand lange und kräftig. Der stämmige Mann hatte bereits etwas schüttere graue Haare, eine richtige Hakennase und ein breites, energisches Kinn. Aus engen Schlitzen maßen Robert stahlgraue Augen.
„Wir kennen uns. Sie waren drüben in Kororareka, nicht wahr?"
„Ja, war ich, für Reverend Williams. – Ich versuchte unsere Schäfchen zusammenzuhalten", erklärte Robert.
„Natürlich, Reverend Burrows."
„Nennen Sie mich ruhig weiterhin Robert, ich bin wohl etwas älter geworden, aber immer noch derselbe."
„Hm – wir sind wohl alle älter geworden – hm." Er streckte seine große Hand hin und sagte entschlossen: „Ich bin James!"
Dabei stülpte er seinen Filzhut energisch auf den Kopf. Sie packten beide einen Koffer und folgten den Frauen zum Haus. Hinter ihnen ergriffen die Männer unaufgefordert das restliche Gepäck. Robert schaute sich um, blickte über den Hof, zur Kirche hinauf und lächelte in sich hinein. Ja, hier erwartete ihn eine neue Aufgabe. Er würde der Geistliche sein, für Engländer und Maoris, mit ihnen reden, beten, feiern oder trauern, so wie es Gott gefiel.
Etwas stimmte aber nicht. Wo waren denn all die Einheimischen, die Ngapuhi? Außer ein paar Dienstboten waren keine Maoris zu sehen, und die Ansiedlung, drüben auf der anderen Seite des Kerikeri, schien verlassen.
Die frühere Missionsstation, erbaut von Reverend Butler, war unter den Kemps zu einem Handels- und Farmhaus geworden. Der Church Mission Society of London gefiel das überhaupt nicht. Tatsächlich, die kleine Kirche schien verwaist und die Gemeinde in alle Winde verstreut. Es würde nicht leicht werden. James Kemp war kein eigentlicher Missionar und beschäftigte sich hauptsächlich mit Geschäften und Handel. Im großen Gebäude aus Stein lagen vermutlich Waren, Geräte und Vorräte. Eine breite Straße führte hinauf, an der kleinen Kirche vorbei, wahrscheinlich weiter hinein ins Landesinnere, wo das Dorf und die Missionsstation Te Waimate lagen.
Die Kirche – musste sich Robert in Erinnerung rufen – , die Kirche war der Grund, warum er hier war. Nun, am Sonntag würde er sehen, wie es um seine Aufgabe stand, wenn die Gemeinde zu seinem ersten Gottesdienst kam.
Mittlerweile waren sie ins Haus gelangt. James Kemp wuchtete den Koffer in eine Ecke neben dem Eingang.
„Oben ist ein Zimmer leer", meinte er. „Martha kann einräumen. – Kommen Sie, Robert, wir wollen essen."
Erst jetzt merkte Robert, wie hungrig er war. Seit dem kargen Frühstück auf dem Schiff waren Stunden vergangen, und die Sonne stand bereits tief am Horizont.
Das Innere des Hauses wirkte recht düster. In einem großen Raum, der sowohl als Esszimmer wie auch als Küche diente, war ein massiver Tisch mit blauweißem Porzellan gedeckt. Ein Mädchen mit langen goldenen Zöpfen schob eben eine große Schüssel mit herrlich duftendem Stew in die Mitte.
„Bitte, Francy, du hast den Löffel vergessen", tadelte Mrs.Kemp.
„Oh, tut mir Leid, Mutter. Er kommt sofort."
James rückte die Bank und bat Robert zu Tisch. Anne saß auf einem Stuhl gegenüber und nahm Charlotte hilfreich eine dampfende Platte mit Gemüse und Kartoffeln ab.
„Was für wunderbares Porzellan, richtiges Wedgwood aus Shropshire – oder nicht?"
„Aus Staffordshire, meine Liebe", antwortete Charlotte. „Es wurde mir letztes Jahr endlich herübergebracht, außer einer Teekanne alles unbeschädigt."
„Aber wir konnten sie doch wieder zusammenkleben. Sie ist so gut wie neu!", warf das blonde Mädchen ein.
„Natürlich, Francy. – Trotzdem, jetzt ist sie wertlos", entgegnete die Mutter.
Anne musterte die Fünfzehnjährige: „Du bist eine kluge Lady, Liebste. – Hast du Geschwister?"
Nun räusperte sich der Vater, während er sich vom Laib ein großes Stück Brot abbrach: „Nehmt alle, es ist genug da." Und dann: „Meine Söhne arbeiten in Paihia. In der Druckerei von Colenso, soviel ich weiß. Te Waimate braucht Bibeln, sagen sie."
„Tatsächlich, Bischof Selwyn hatte Großes vor. Seit die dortige St.
John's Church Bischofssitz wurde, ist sicher viel vergrößert worden. Wird wohl bald eine kleine Stadt sein", sagte Robert zwischen den Bissen.
„Nicht so schnell, Robert! Sie kennen die neueste Situation nicht.
Die C.M.S, die Church Mission Society, hat den Vertrag für Te Waimate mit Seiner Exzellenz nicht mehr erneuert. Er ist bereits abgereist, an die Tamaki Strait, nach Auckland. Te Waimate hat so seine Probleme. Die Betriebe sind nicht mehr rentabel. Die Felder verkommen. Die Maoris ziehen auch dort weg."
Durch die bleiverglasten Scheiben konnte Robert gerade noch einen letzten Blick auf die 'North Star' erhaschen, bevor diese hinter der Biegung des Kerikeri Inlets verschwand. Dann lag das Wasser ruhig und verlassen da.
Robert hatte sich also nicht getäuscht, eine unerklärbare Spannung lag in der Luft. Auch hier in Kerikeri waren die Maoris größtenteils verschwunden, und nur die Dienstleute schienen schweigend ihrer Arbeit nachzugehen. Dem Rumpeln nach waren sie oben mit seinem Gepäck beschäftigt. – Diese zunehmende Unzufriedenheit über den Vertrag von Waitangi. Sollte das vielleicht die Ursache sein?
„Es ist schon so", erklärte Kemp, wie wenn er Roberts stille Frage gehört hätte. „Die Maoris sind unzufrieden. Heke wiegelt sie auf.
Seine Banden ziehen durch die Dörfer, zerstören und plündern bei unseren Leuten. Kein Wunder, dass sie alle wegbleiben. Er hat nicht einmal Ehrfurcht vor der Fahne Ihrer Majestät der Königin. Hat sie drüben in Kororareka neulich heruntergerissen. – So eine Schande!"
„Scheußlich!" stimmte Robert zu. „Aber Heke war schon immer ein Querulant, ich kenn' ihn. Trotzdem, was tut denn die Regierung?"
„Governor FitzRoy konnte glücklicherweise Schlimmeres verhüten.
Waaka, ein loyaler Häuptling, hat ihm versprochen, die Aufwiegler in Zaum zu halten. Er überreichte FitzRoy zehn rostige Musketen, als Pfand für Ruhe und Ordnung. – Geradezu lächerlich, wenn Sie mich fragen."
Kemp schwieg, aber in Roberts Kopf schwirrten die Fragen. Warum verstanden die Maoris die Treaty nicht? War sie so schlecht? Hielten sich die Einwanderer tatsächlich nicht daran, vielleicht sogar auch die Behörden? Sicher, die Lage war angespannt. Dass aber Bischof Selwyn deshalb Te Waimate im Stich ließ, das durfte doch nicht wahr sein ...
Während Charlotte und Anne über den Neuigkeiten aus London die Zeit vergaßen, das einfache Mahl beendeten und schwatzend den Tisch abräumten, schenkte James Kemp nochmals Wein nach. Dann griff er in eine Lade gleich neben dem Tisch und brachte einen pergamentenen Brief zum Vorschein. Mit großen steilen schwarzen Buchstaben war darauf der Empfänger geschrieben: AN Reverend Robert Burrows.
James Kemp drehte den Brief einen Moment in der Hand und meinte: „Es sind bereits zwei Wochen her, seit Selwyn mit seinem Gefolge an Bord ging. Er wollte nicht mehr länger warten. Hier, das hat er für Sie hinterlassen."
Der gewichtige Brief wog schwer in Roberts Hand. Zögernd brach er das rotbraune Siegel mit dem bischöflichen Wappen und faltete das Papier auseinander.
September 26th anno 1844.
Dear Robert,
wir hoffen, dass Sie und Ihre sehr verehrte Frau Gemahlin eine ruhige Überfahrt verbrachten. Leider erlaubten mir dringende Geschäfte nicht, wie es sich ziemlich gehört hätte, Ihre Ankunft abzuwarten. Ich gestatte mir aber, Ihnen mitzuteilen, dass Sie, nachdem Sie und Ihre werte Frau Gemahlin sich gehörig ausgeruht haben, die Reise nach Te Waimate antreten sollen, um dort dringende Geschäfte, die wegen meiner Abreise liegen geblieben sind, zu übernehmen. Im Besonderen lege ich Ihnen die Eröffnung der dortigen Mädchenschule ans Herz und bitte Sie dringlichst, auch die Farm- und Handwerksstätten nach Ihrem Gutdünken in Ordnung zu bringen. Voller Vertrauen lege ich die Geschicke von Te Waimate in Ihre und in Gottes Hand. Der Allmächtige sei immer mit Ihnen.
Unterschrieben und mit dem bischöflichen Zeichen versehen: Seine Exzellenz G.A. Selwyn,
Bischof von New Zealand
Das Papier knisterte leise, als Robert es wortlos über den Tisch schob und sagte: „Lesen Sie selber, James!"
Was für einen Auftrag! Kaum zu fassen. Er sollte Te Waimate übernehmen, alles was Bischof Selwyn hinterlassen hatte und auch noch eine neue Schule dazu. Nur langsam sanken diese unglaublichen Befehle in sein Denken ein. Wie war das möglich? Vor seiner Abreise in Southhampton war doch alles geregelt, er sollte in Kerikeri eine christliche Gemeinde betreuen, Engländer wie Maoris.
Er war Priester, ein Diener Gottes. Er wollte missionieren, Gottesdienste zelebrieren, taufen und, wenn's dem Herrn gefiel, auch bestatten. Man hatte schon von der neuen Siedlung am Tamaki gehört, sie sollte rasch wachsen. Aber warum war Bischof Selwyn so schnell bereit, alles aufzugeben und seinen Sitz nach Auckland zu verlegen? Robert verstand nichts mehr, seine Pläne schienen völlig durcheinandergeraten ... die Kirche, die Mission, England, seine Frau ...
James Kemp gab ein unwirsches Knurren von sich: „Hab's mir doch gedacht. – Heke hat's tatsächlich geschafft, dieser Lumpenhund, er gibt keine Ruhe – der nicht!"
„Wie soll ich das verstehen?", fragte Robert.
„Na ja, eine lange, üble Geschichte. – Hone Heke Pokai, Sie kennen ihn ja, mochte Selwyn überhaupt nicht. Der Bischof sah sich als Oberhaupt der Kirche Ihrer Majestät und benahm sich auch entsprechend arrogant. Heke gefiel das ganz und gar nicht und säte in Te Waimate Unfrieden, wo er nur konnte. Er ist schuld am Zerfall der Missionsstation und dass die Maoris verschwanden."
„Und deshalb hat Bischof Selwyn aufgegeben?"
„Eigentlich schon", meinte Kemp. „Er war für die C.M.S. einfach nicht mehr tragbar."
„Ja, und ich soll es jetzt besser machen?"
„Hm ... Es sieht wohl so aus ..."
James Kemp brummte vor sich hin und schüttelte sorgenvoll den Kopf. „Es war völlig falsch, die Truppen aus Kororareka abzuziehen. Heke wird keine Ruhe geben und nimmt sich jede Frechheit heraus."
„Aber die Missionen wird er doch in Ruhe lassen", versuchte Robert sich selber zu beruhigen.
„Ja, soweit ich weiß – noch."
„Es ist aber unsere Pflicht und Aufgabe, Gottes Wort zu verbreiten und auch danach zu leben. In Rebellion, Unruhe und Stammeshändel wollen wir uns nicht einmischen. Das dürfen wir nicht, wir sind für alle Menschen da."
Robert merkte selber, wie theoretisch das klang.
James' Antwort kam auch wie aus einer Pistole geschossen: „Ja, bis uns die Kugeln um die Ohren fliegen! Hören Sie, irgendwann muss sich jeder auf eine Seite stellen. Die richtige zu wählen, das ist, was zählt."
Er hatte sich in Fahrt geredet und bremste nun ab: „Von Haus aus stehen wir ja bereits auf Seite der Königin. Das weiß auch ein Hone Heke, ohne Zweifel. Ihre Aufgabe drüben in Te Waimate wird nicht leicht werden, aber es ist immer gut, wenn man sich auf Gottes Schutz und Gnade berufen kann."
„Was denken Sie, James, wann sollen wir reisen?"
„Lassen Sie sich Zeit, ein- zwei Wochen hören Sie sich um, bereiten Sie alles vor. Reverend Davis ist ja unterdessen dort."
Robert nahm die Ratschläge gerne an. James Kemp war schon seit 1819 hier und wenn seine Station heute auch wenig für die Mission tat, hatte die Familie doch viel Erfahrung mit den Einheimischen. In der kurzen Zeit konnte er selber hoffentlich die kleine Kirche oben am Hang wieder etwas zu neuem Leben erwecken.
„Und noch etwas", brummte Kemp, während er sich vom Tische erhob, „lassen Sie vorerst Ihre Frau hier, sie ist hier sicherer."
Ankunft der Einwanderer: Gott sei mit Euch!
KAPITEL 2
Der weitere Abend verlief ruhig und man begab sich zeitig zu Bett. Auf ihre Fragen hatte Robert seiner Frau einige Einzelheiten erklärt und vom neuen Auftrag des Bischofs berichtet. Ihr schien die Situation wenig beunruhigend und er ließ sie vorerst im Glauben, es habe sich nur der Ort ihrer Mission geändert, alles andere sei beim Alten. So schlief sie dann auch bald friedlich neben ihm ein, während er sich noch lange auf dem hohen Bett hin und her wälzte. – Endlich sank er in einen unruhigen Schlaf.
Das schrecklich bemalte Gesicht, einer Fratze gleichend, mit herausgestreckter Zunge, sprang auf ihn zu und brüllte ihm unflätige, unverständliche Worte entgegen. Die Gestalt schwang einen schweren, mit Federn geschmückten Speer und wirbelte diesen mit kriegerischem Gebaren herum. Dann sprang die furchterregende Gestalt vor...
Schweißgebadet fuhr Robert hoch. Es war stockfinster und er wusste im Moment nicht, wo er sich befand. Dann hörte er leise Schritte.
Ein schwacher Lichtschimmer kam durchs Fenster. Unten musste jemand eine Lampe angezündet haben – vielleicht James Kemp, der einen letzten Kontrollgang machte. Der schwache Schimmer blieb.
Robert war bald darauf in einen tiefen Schlaf gesunken. Hone Heke, die schreckenserregende Gestalt, war verschwunden.
Im frühen Morgenlicht wurde Robert durch häusliche Geräusche unter ihnen geweckt. Sofort schlug er die Bettvorhänge zurück und sprang auf. Anne seufzte leicht neben ihm und drehte sich zur Seite.
Aus der weißen Schüssel spritzte er sich eiskaltes Wasser ins Gesicht und rieb sich den Hals mit einem rauen Tuch rot. Schnell fuhr er in die Hose und Schuhe, ging hinaus und schloss die Türe leise hinter sich. Unten stand Charlotte am Tisch und rüstete Gemüse.
Kurz schaute sie auf, konzentrierte sich aber sofort wieder aufs große Messer, mit welchem sie weiße Rüben in gleichmäßige Scheiben schnitt.
„Guten Morgen, Robert. Gut geschlafen?" Damit deutete sie mit dem Messer in Richtung Herd und fuhr fort: „Dort steht Kaffee, er sollte noch heiß sein."
„Guten Morgen! Vielen Dank", erwiderte er.
„James ist drüben im Lagerhaus, er erwartet Sie."
Von der Veranda zum Lager waren es keine fünfzig Meter. Ein kalter Wind blies ihm entgegen und dichte Wolken hingen über den Hügeln. Das Wasser des Kerikeri war grau und schwer wie Blei.
Die Ebbe hatte ein schmutzig braunes Ufer zurückgelassen, in dem ein paar schwarze Vögel mit wuchtigen roten Schnäbeln herumstocherten. Ein ausgetretener Weg führte hinüber zur Straße an der das Lagerhaus stand. Dieses war völlig aus grauem Stein gebaut, mächtig, wie eine Festung, mit vergitterten Fenstern. Das Dach aus groben Schindeln war erst kürzlich erneuert worden. Oben über dem Eingang klaffte eine Luke, und ein Flaschenzug ragte heraus.
Robert stieß die schwere, eisenbeschlagene Türe auf und trat ins düstere Innere. Auf den Steinplatten standen Kisten, Säcke und Fässer mit Hacken, Ösen, Ringen, Nägeln und vieles mehr.
Über sich hörte Robert ein Rumpeln und Rumoren. Kemp musste dort oben sein. Er fand hinten in der dunklen Ecke eine massive Holztreppe und stieg hinauf. Getreidesäcke standen in langen Reihen an den Wänden. Grobes Leinen, schwarz beschriftet: 'New South Wales, Australia' mit den verschiedenen Inhaltsangaben: 'Weizen, Gerste' oder 'Hafer'. Die massiven Balken und Bohlen bogen sich unter der gewaltigen Last, denn das Lager war zum Bersten voll.
Kemp war aber oben im Dachgeschoss. Er hatte eine große Kiste neben die Luke gestellt und war eben daran, Bücher hineinzulegen.
Als er Roberts Kopf auftauchen sah, drehte er sich um, klopfte den Staub vom dicken Buch das er in der Hand hielt, und rief: „Kommen Sie nur herauf, Robert und schauen Sie sich das an!"
„Es sind alles seine Bücher und Schriften, liegen schon seit drei Jahren hier, und als er abzog, hat er sie einfach dagelassen. Was zum Teufel soll ich damit anfangen?" Sprach's und warf das Buch unmutig in die Kiste.
„Guten Morgen James", begrüßte ihn Robert und trat näher.
Ein Blick auf den dunkelbraunen Einband ließ in aufmerksam werden. Er hatte wahrhaftig eine Übersetzung des Neuen Testamentes in Te Reo Maori in der Hand.
„Das ist ein Werk von William Williams", staunte er und blätterte weiter. „Es wurde in Paihia auf der Stanhope-Presse von Colenso gedruckt. Wirklich, beeindruckend! Die ersten Schriften in Maori entstanden ja vor kaum zwanzig Jahren."
James brummte etwas und deutete auf die Stapel in der Ecke: „Ist alles Ihnen, Bischof Selwyn scheint's nicht mehr zu brauchen."
Robert freute sich aufrichtig über den gefundenen Schatz und fing an zu stöbern. Bücher und Schriften aller Art lagen da verstaubt und verblichen, meist theologische Werke, handgeschrieben oder gedruckt, in Englisch und Maori, ein wahres Archiv.
„Verstehen Sie denn das überhaupt?", erkundigte sich Kemp.
„Nun, Theologie hab ich studiert", entgegnete Robert lächelnd, „Englisch ist meine Muttersprache und Maori lernte ich während meiner Zeit in Kororareka. So gut das ging natürlich. Es waren ja kaum Aufzeichnungen der Maori Sprache vorhanden."
„Tut mir leid, ich wollte Sie nicht kränken. Es stimmt schon, die paar Blättchen, die drüben gedruckt werden, sind wohl kaum der Rede wert."
„Maori", fuhr er fort, „lernten auch wir im täglichen Umgang mit den Eingeborenen. Unsere Geschäfte machen wir aber zum Glück immer noch in gottgefälligem Englisch Ihrer Majestät."
„Was haben Sie damit vor?", wollte Robert wissen und deutete in die Kiste.
„Ha, ist alles Ihnen, bitte!"
„Gut, wenn Sie gestatten, werde ich alles durchgehen und prüfen.
Vielleicht bin ich ganz froh um ein paar Unterlagen für die Gemeinde in Te Waimate."
Wieder brummte James: „Bitte."
James Kemp stampfte die Treppe hinunter und ließ Robert mit dem Buch in der Hand stehen. Dieser machte sich aber unverzüglich über die Schriften her.
Es handelte sich vorwiegend um Übersetzungen aus der Bibel sowie von Kirchen-, Gesangs- und Gebetsbüchern. Die Maoris verfügten über keine Schrift im üblichen Sinne. Sie überlieferten ihre Geschichte durch Weitererzählen und oft durch reich geschnitzte Kunstwerke, Symbole von Göttern, Ahnen und Helden. Es war eine fast unlösbare Aufgabe, das Gesprochene, das für die Engländer sowieso fremd klang, in Worten und Sätzen schriftlich festzuhalten.
Robert selber hatte das erfahren, als er sich damals in Te Reo Maori vertiefte, ohne ein vernünftiges Wörterbuch zur Hand zu haben.
Als Robert zur Mittagszeit endlich zum Tee gerufen wurde, kam er ganz verstaubt aber mit leuchtenden Augen herüber. Es hielt ihn aber nicht lange. Er verschwand rasch wieder, nachdem er Charlotte für die Mahlzeit herzlich gedankt und Anne einen flüchtigen Kuss auf die Wange gedrückt hatte. Er eilte ins kühle Innere des Steinhauses zurück, stieg hinauf unters Dach und vertiefte sich weiter in die aufgestöberten Werke.
Er begann zu sortieren, abzustauben und beiseite zu legen. Einiges konnte er sicher gut gebrauchen. Bibelübersetzungen gab es in Te Waimate sicher nur wenige, wenn überhaupt, und von den kleinen Gebetsbüchern konnte man weitere Kopien drucken lassen. Die würden sich in seiner Kirche vortrefflich ausmachen. Er lehnte sich auf dem wackeligen Hocker zurück und schaute sich um. Landwirtschaftliche Geräte lagen auf dem Boden zerstreut, und ein paar weitere Kisten standen an der Wand.
Er hob den Deckel der vordersten Kiste. Braunes Papier war zu sehen. Ein öliger Geruch schlug ihm entgegen. Was war das? Er schlug das Ölpapier zurück und erschrak. Matt glänzten ihm die langen Läufe nagelneuer Musketen entgegen. Schloss und Hahn waren sorgfältig eingeölt, alles in tadellosem Zustand. Reihe an Reihe lagen sie da, sorgfältig übereinander gestapelt, ein gutes Dutzend. Rasch trat er zur nächsten Kiste und fand das gleiche. Zwei, drei, nein vier weitere, alle mit demselben bedrohlichen Inhalt. Er verschloss sie alle wieder sorgfältig, bevor er sich zum Nachdenken hinsetzte.
Was in Gottes Namen wollte Kemp mit diesem Arsenal? Damit konnte man ja eine ganze Schwadron ausstatten. Sollte er ihn zur Rede stellen? Wer alles hatte wohl Zugang zu diesem Lager? Aber es war doch wohl kaum anzunehmen, dass die Musketen dort lagen ohne Wissen von Kemp. Den königlichen Truppen konnten sie kaum gehören, sonst wären die Kisten markiert und mit dem Siegel der Krone versehen. Sollte er Meldung erstatten, dem Bischof?
Aber der hatte ja selber sein Lager hier, wie all die Bücher bewiesen.
Robert entschloss sich, erst einmal abzuwarten und zu schweigen.
Vorerst lagen die Waffen ja gut verpackt eingelagert und würden damit noch keine Menschen bedrohen. Er wollte die Augen offen halten und ein größerer Abtransport würde ihm sicherlich nicht entgehen. Damit gab er sich vorerst einmal zufrieden.
KAPITEL 3
Als Anne erfuhr, dass sie auf unbestimmte Zeit bei den Kemps in Kerikeri bleiben sollte, fand sie sich nur zögernd mit dieser vorübergehenden Lösung ab. Sie verstand sich aber gut mit Charlotte, und das Haus versprach doch einigen Komfort, den sie in Te Waimate wohl vermissen würde. Robert versicherte ihr auch ausdrücklich, sobald die Situation es erlaube, nach ihr zu schicken, sie abzuholen und in Te Waimate mit ihr ein gemeinsames Heim zu gründen.
Die Tage flossen dahin. Robert machte einige Ausritte in die nähere Umgebung, um seine Reitkünste aufzufrischen. James Kemp verkaufte ihm für achtzig Pfund einen gefleckten Wallach, den Robert auf einer Weide hinter dem Haus unter anderen Pferden stehen sah.
Der Preis war hoch, aber der Wallach, ein robustes, williges Pferd mit dem Namen 'Spot', gefiel ihm auf Anhieb. Die wenigen Maoris, die er unterwegs traf, waren neugierig aber freundlich.
Der erste Sonntagsgottesdienst enttäuschte ihn gewaltig. Kaum ein Dutzend Menschen saßen in den harten Bänken der kleinen düsteren Kirche. Als er zum steinernen Altar ging, erhoben sich in der vordersten Reihe die Kemps, Vater, Mutter und Francy. Die anderen Gläubigen, verstreut im Raum wie die ersten welken Blätter im Herbst, waren Maoris, meist Dienstleute des Anwesens. Die wenigen unbekannten Gesichter schienen den neuen Priester unverhohlen neugierig zu mustern.
Seine Predigt hörte sich hohl und schmucklos an, wie die grauen Wände und die farblosen Fenster. Alle, einschließlich Robert, atmeten erleichtert auf, als der Segen erteilt war und jeder wortlos seines Weges ging.
Wenig später stand er alleine in der Kirche. – Oh Gott, dachte er, was für ein kläglicher Anlass. Wo war der frühere Eifer der Gemeinde geblieben, als sich die getauften Menschen dicht im Gotteshaus drängten und helles Halleluja und fröhliches Singen ertönten?
Die Maoris waren weg, die Siedler kümmerten sich hauptsächlich um Handel und Landwirtschaft, und die Handwerker ließen sich nicht blicken. Ja, wo waren denn zum Beispiel die beiden Männer, die sie bei der Ankunft gesehen hatten, geblieben? – Er musste unbedingt Kemp fragen.
„Die, die wohnen dort drüben auf der anderen Seite", antwortete James an diesem Nachmittag auf Roberts Frage und deutete ans andere Ufer. „Sie haben eingeborene Frauen, arbeiten aber meist in Te Waimate. Sie heißen Parrott, William Parrott und John Bedggood, Bauleute, Maurer und Schreiner."
„Ein Besuch kann ja wohl nichts schaden. Erlauben Sie, James, dass ich Ihr Boot benutze?"
„Sicher", nickte Kemp und wandte sich dem Haus zu.
„Verschwenden Sie nur nicht Ihre Zeit", hörte ihn Robert noch brummen.
Nein, Zeit für einen Mitmenschen war nie verschwendet, dachte Robert. Er wusste, die beiden hatten sich wegen ihrer Frauen isoliert. Die englische Gesellschaft war weit davon entfernt, Mischehen zu akzeptieren. Solange die Männer im fremden Land vorwiegend unter sich lebten, war es nur üblich, dass sie sich eine Eingeborene zur Gefährtin nahmen. Sobald aber, wie jetzt, die Frauen ankamen, Familien der Weißen entstanden und gesellschaftlicher Umgang gepflegt wurde, waren solche Gespielinnen eines Ehrenmannes unwürdig und wurden verachtet. Bekannte sich der Mann aber zu seiner Liebe und heiratete vielleicht gar noch, wurden sie geschnitten, waren dem Klatsch ausgesetzt und wurden von der Gesellschaft gemieden. Kein Wunder, lebten die beiden drüben abseits der Ansiedlung der Kemps.
Ein paar laute Kinder empfingen ihn am anderen Ufer. Ihre braunen Körper glänzten, Beine und Arme waren mit Dreck verkrustet, aber die Gesichter lachten. Johlend halfen sie das Boot heraufziehen, und Robert folgte ihnen auf einem schmalen ausgetretenen Pfad zwischen den Bäumen. Hier war es windstill, feucht und schwül. Ein paar, zum größeren Teil verlassene Hütten aus Holz und Binsengeflecht standen am Rand. Die Steine einer zerfallenen Feuergrube für das Hangi lagen zerstreut im graubraunen Gras. Ein demolierter Zaun aus knorrigen Stecken hing schräg über den Weg. Nachdem sie diesen umrundet hatten, öffnete sich die Sicht auf die andere Seite der Landzunge, in eine kleine versteckte Bucht. Dort lagen zwei Kanus und ein Boot, ähnlich wie dasjenige, mit welchem Robert übergesetzt hatte. Im Hintergrund zwischen den Bäumen stand ein massives Blockhaus, ohne Zweifel das Haus von Parrott und Bedggood.
Die Nachricht von Roberts Ankunft war ihm natürlich vorausgeeilt, und eben trat John Bedggood ins Freie. Er kam Robert ein paar zögernde Schritte entgegen. Er trug ein rot kariertes Hemd, eine raue, braune Arbeitshose und darunter grobe Ledersandalen an den Füssen. Der Ankommende war aber von einem riesigen schwarzen Bart und einer großen Knollennase gefesselt. Unter buschigen Augenbrauen musterten ihn, durch schmale Schlitze, hellbraune Augen.
„Guten Abend Sir, wir freuen uns, dass Sie uns mit Ihrem Besuch beehren", sagte Bedggood, schüttelte Roberts Hand kräftig und fuhr fort: „Bitte kommen Sie herein. Wir wollen gleich essen."
Roberts Versicherungen, er wolle ihre Abendmahlzeit nicht stören und nur kurz bleiben, tat Bedggood mit einer Handbewegung ab.
Damit verscheuchte er auch gleich die glotzenden Kinder: „Macht dass ihr nach Hause kommt, vorwärts, husch-husch!"
Sie traten in einen großen freundlichen Wohnraum. Hinten am Herd hantierte eine Frau, stellte eine rußgeschwärzte Pfanne zur Seite und drehte sich um.
„Haere mai", sagte sie leise, wirkte aber weder scheu noch unterwürfig, „willkommen."
„Meine Frau Reni", stellte Bedggood vor.
Warme, freundliche Augen blickten Robert entgegen.
„Bitte setzen Sie sich doch, es ist gleich fertig", sagte sie, diesmal in perfektem Englisch, und wandte sich wieder dem Herd zu.
Die Männer rutschten auf eine Bank an der Wand, und Robert ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Links neben der Türe stand eine große Truhe mit eisernen Beschlägen. Darüber hingen eine schwere Axt, eine Sichel und eine Machete. In der Ecke war eine Türe zu einen Nebenraum. Sie war geschlossen und Robert vermutete, dass sie zu Parrotts Hausteil führte.
Bedggood folgte seinem Blick und bestätigte: „Williams Kammer.
Er ist irgendwo draußen. Kommt wohl heute nicht zum Abendbrot."
Robert fragte nicht weiter, denn er entdeckte hinten im Raum ein Gestell mit vielen Büchern, dicht gedrängt neben allerlei Haushaltgerät wie Kannen, Platten, Krüge und Tassen. Die Bücher schienen völlig fehl am Platz.
„Unsere Bibliothek", lachte nun Bedggood, „alles Mögliche, wir lesen gern."
„Ha, das meiste ist technisches Zeug, wissen Sie, Radmacherei, Drechslerei und Wagenbau und was weiß ich", mischte sich Reni ein, während sie Kartoffeln, Rüben und Klöße auftischte.
„Guten Appetit", wünschte sie und setzte sich auf einen Stuhl gegenüber.
„Reni schwärmt halt für Novellen und Gedichte, Jonson, Ann Radcliffe und neuerdings auch Charles Dickens. Am besten etwas, was sie zu Tränen rührt", grinste John über den Tisch.
„Ach, lass das, John, das interessiert doch unseren Gast nicht", wehrte sie ab.
Robert hielt die Gabel in die Luft und stellte schmunzelnd richtig: „Glauben Sie nur nicht, ein Priester lese nur die Bibel. Lesen erweitert den Horizont und soll auch unterhalten. Die Bibel ist zwar ein interessantes Buch und ist mir unabkömmlich, aber eine Reiseerzählung oder gar eine Liebeskomödie kann mich durchaus köstlich erfreuen."
Sie unterhielten sich angeregt und genossen das vorzügliche Mahl.
Robert fand, dass die beiden äußerst lebhafte, und interessierte Gesprächspartner und zudem ein liebenswürdiges Paar waren. Er fühlte sich wohl in ihrer Mitte und schloss sie insgeheim ohne Vorbehalt in sein Herz ein. Vorurteile über Mischehen lagen ihm sowieso fern. Er hatte genug schlechte Beziehungen und Verhältnisse gesehen, während der Zeit in Kororareka, wo die einheimischen Frauen gehandelt wurden wie Fische am Hafen. Kaum war das zarte Fleisch verspiesen, wurden sie weggeworfen wie die übrig gebliebenen Gräte, Köpfe und Flossen. Das Benehmen der weißen Männer, meist Seeleute, Soldaten, Händler und Gauner, viele waren sogar entflohene Sträflinge, ekelte ihn heute noch an. Er schämte sich für die weiße Rasse, die meinte, mit den Maoris umgehen zu können wie mit minderwertiger Ware. Nun gut, nicht alle waren so, und der heutige Abend bewies, dass es auch Menschen gab, die die Maoris achteten und liebten.
Sie merkten kaum, dass draußen die Sonne tiefer sank und die Bäume bereits lange Schatten über das Ufer des Kerikeri warfen.
Reni hatte den Tisch abgeräumt und eine Petrollampe angezündet, während Robert auf seine Aufgabe in Te Waimate zu sprechen kam.
„Bischof Selwyn hat mir da eine große Aufgabe hinterlassen", schloss er seinen kurzen Bericht.
„Wir, William und ich, wir waren dort mit dem Bau der Mädchenschule beschäftigt. Aber jetzt wissen wir nicht mehr, was das soll.
Ohne Lohn wollen wir nicht arbeiten, William schon gar nicht."
Robert überlegte nicht lange: „Es ist mir natürlich im Moment unklar, wie dort die Dinge stehen. Es würde mich aber freuen, wenn Sie mit mir nach Te Waimate reiten könnten. Ihre Erfahrung wäre mir eine große Hilfe."
In diesem Moment krachte die Türe gegen die Wand. Reni schrie auf, die Männer sprangen hoch. In der Tür stand ein Mann, mit wildem Blick und zerzausten Haaren. Das schmutzige Hemd stand weit offen, und mit der einen Hand fuchtelte er bedrohlich mit einer Pistole. Die hagere Gestalt stutzte einen Moment, trat einen Schritt vor und warf die Tür ins Schloss.
„William! Was zum Teufel ...?", begann John.
„Heke", stammelte der Mann und ließ die Pistole endlich sinken, „er kommt!"
Robert, dem die Anrufung des Teufels und Hekes in einem Zug total verwirrte, zog die Luft ein. – Heke, das war doch dieser Rebell, dieser Häuptling ....
Energisch trat John vor, nahm die Pistole an sich, prüfte kurz Zündstein und Lunte und legte die Waffe sorgfältig in die Truhe neben der Tür.
„William, sei vernünftig! Was geht da vor?"
„Heke – soll Rangihoua verwüstet haben. Er ist auf dem Weg hierher. Ein Verwandter von Reipae ist eben eingetroffen. – Heke kommt... ." Williams weinerliche Stimme zitterte.
„Reiß dich zusammen, bis jetzt hat Heke uns immer in Ruhe gelassen."
Damit wandte sich John an Robert: „Kein Grund zur Besorgnis. Wir wollen den Mann empfangen und hören, was er will."
Sie traten vor das Haus. Die Dämmerung hatte schon fast eingesetzt, nur über dem Wasser des Kerikeri lag noch ein silberner Schimmer.
Sie brauchten nicht lange zu warten, da brach's aus der Dunkelheit zwischen den Bäumen hervor. Eine mit schwarzen Strichen gezeichnete Fratze starrte ihnen entgegen, streckte die Zunge heraus und brüllte unflätige, unverständliche Worte. Die kräftige Gestalt schwang einen mit Federn geschmückten Speer und sprang mit einem Satz vor.
Robert erschrak. Sein Alptraum, sollte er hier wahr werden? Die Szene war in der Dämmerung so unwirklich, dass ihm das Herz bis zum Halse klopfte.
John hielt ihn am Arm: „Alles nur Theater, keine Angst."
Er trat vor und rief: „Hone Heke Pokai, ich bin's, John Bedggood, ich begrüße dich!"
Heke gab ein Zeichen. Seine Begleiter ließen ihre Waffen sinken und kamen unter den Bäumen hervor. Ein gutes Dutzend, alle bewaffnet, mit Speeren, Keulen und sogar einigen Musketen.
„Ich grüße dich, John Bedggood. Wer ist da bei dir?"
„Das ist Reverend Robert Burrows für die Mission in Te Waimate."
„Wir haben nichts gegen die Mission", erwiderte der Häuptling und winkte ihnen, näherzutreten.
Alle setzten sich im Kreis, Heke etwas vorne. John und Robert benützten einen morschen Baumstamm und warteten ab. Die Gesichter der meisten Maoris waren mit schwarzen Tätowierungen versehen. Je nach Rang und Ansehen hatten sie Federn im Haar. Einige trugen wollene Decken, denn der Abend war bereits empfindlich kühl. Auch Heke zog sich nun einen Umhang aus Flachs und Federn über die Schultern.
„Wo ist denn dein Bruder?", wollte er wissen.
„William Parrott ist nicht mein Bruder. Er ist im Haus, fühlt sich nicht wohl." John fiel die kleine Lüge leicht und er hoffte inständig, dass William auch wirklich im Hause bleiben würde. Um Reni brauchte er sich keine Sorgen zu machen, sie war vernünftig genug, außer Sichtweite zu bleiben.
„Du warst doch in Kororareka,", stellte Heke fest und starrte Robert unumwunden an.
Als dieser aber in gutem Te Reo Maori antwortete und bestätigte, dass er vier Jahre dort verbracht und auch vom großen Häuptling Hone Heke Pokai gehört habe, war das Eis gebrochen und ein Palaver begann, das nur durch die einbrechende Dunkelheit gestoppt wurde. Nachdem sich John und Robert ins Haus zurückgezogen hatten, verschwanden auch die kriegerischen Gestalten im Dunkel des Waldes.
William Parrott hatte sich unterdessen beruhigt, saß am Tisch und löffelte gierig das Essen in sich hinein. John zuckte die Schultern und wandte sich an Robert: „Sie können die Nacht hier verbringen."
„Vielen Dank, aber ich möchte zurück, die Kemps sind sonst beunruhigt. Vielleicht haben sie auch von Heke gehört und machen sich Sorgen."
„Gut, es ist eine klare Nacht, Sie sollten keine Probleme haben, über den Kerikeri zu rudern. Ich bringe Sie aber besser zur Anlegestelle."
Robert bedankte sich herzlich bei Reni, versprach wiederzukommen und lud beide freundlich zum nächsten Gottesdienst ein. Dann folgte er John, der sich rasch eine Jacke überzog, in die Nacht hinaus.
Helles Sternenlicht ließ sie den Weg zurück ohne weiteres finden.
Auch schienen die leeren Häuser auf einmal zu neuem Leben erwacht. Da und dort waren Feuer auszumachen, und Gestalten huschten zwischen den Gebäuden hin und her. Offensichtlich hatten Hekes Leute sich hier für die Nacht eingerichtet, und es schienen nicht wenige zu sein.
Beim Boot verabschiedete sich John: „Machen Sie sich nicht unnötig Sorgen. Die Maoris tun uns schon nichts. Sie wissen, dass sie der Königin Treue geschworen haben, auch zu ihrem Vorteil."
Robert ruderte hinaus ins ruhige pechschwarze Wasser. Drüben waren die Silhouetten der Hügel, des Stein- und des früheren Missionshauses schwach auszumachen.
Auf einmal flackerte ein Schimmer auf. Ein schwaches Licht fiel aus einem Fenster und zog eine feine silbrige Linie über das Wasser. Die Kemps waren wohl noch nicht zu Bett gegangen und hatten noch Licht an, obwohl sie sonst doch die schweren Vorhänge zogen.
Robert legte sich kräftig in die Riemen. Das einsame Licht schimmerte und leuchtete ihm den Weg.
KAPITEL 4
Als sie die Anhöhe erreichten und zurückblickten, war nur noch die kleine Kirche über dem Kerikeri Inlet zu sehen. Zwischen den Bäumen glitzerte das Meer in der Weite, silbern, azur und türkis, ein herrliches Farbenspiel in der Sonne. Die wenigen weißen Wolken segelten dahin wie Boote mit fernem Ziel. Sie warfen dann und wann geheimnisvolle Schatten in die prächtige Landschaft und schienen mit dem Wind, der in leichten Böen aus dem Norden kam, zu spielen. In den Büschen zwitscherten unsichtbare Vögel und aus den Baumkronen erklang dann und wann der Flötenton eines Tuis, der wohl damit seine Partnerin lockte. Es war Frühling.
Robert und John ritten gemächlich, Seite an Seite. Ein schwer beladenes Packpferd folgte ihnen in langsamem Trott. Die Straße war breit genug, auch für Fuhrwerke, und folgte der sanften Anhöhe entlang dem Puketotara Stream bis sie quer durch den Wald, Richtung Südwesten, ins Landesinnere führte. Dann wurde das Gelände hügelig, man durchquerte mehrere Bäche und ließ links die Hügel des Pokaka hinter sich. Nach etlichen Meilen erreichten sie die Brücke über den Waitangi.
„Die Brücke wurde vor gut zehn Jahren erbaut, als Te Waimate von George Clarke und seiner Familie bewohnt wurde", berichtete John Bedggood. „Seine Geschäfte gingen hervorragend, Ackerbau, Weizen, Kumara und Gemüse. Auch Kauri-Holz wurde geschlagen und erzielte gute Preise. Die Transporte zur Küste waren enorm und das Steinhaus, das Lager am Kerikeri war brechend voll – zu der Zeit."
„Ein erstaunliches Gebäude", flocht Robert ein.
„Oh ja, es wurde etwa zur gleichen Zeit wie diese Brücke erstellt, nur dauerte es Jahre länger. Vulkanisches Gestein und Kalk aus gebrannten Muscheln waren das Material, und für die Ecken wurden Sandsteinquader aus Sydney hergeschafft. – Übrigens", fuhr er fort: „das war William, der es baute. Das war noch vor meiner Zeit."
„William Parrott?"
„Ja, er ist ein hervorragender Handwerker, Maurer, um genau zu sein."
Robert sah den abgemagerten, verstörten Mann deutlich vor sich, wie er mit vor Angst starrem Blick in der Türe stand und mit der Pistole fuchtelte. Dieser Mann sollte das Steinhaus gebaut haben?
„Was ist denn los mit dem Mann?", fragte er ohne Umschweife.
„Na ja, wir wissen auch nichts Genaueres. Er war eigentlich eine fröhliche Natur. Hat aber nie etwas aus seiner Vergangenheit erzählt. Nur, seit er mit dieser Maorifrau zusammen ist. – Er trinkt, wenn Sie mich fragen."
„Die Frau, ist sie keine Hilfe?", begann Robert.
„Ach was, die hätte er besser drüben gelassen, in Kororareka. Aber ich möchte nichts Übles verbreiten."
Es war wohl eine jener Beziehungen, wie sie im alten Kororareka häufig vorkamen. Fragwürdige Lokale, Bars und Bordelle wucherten in diesem Ort wie Unkraut. Walfänger, Matrosen, Abenteurer und entflohene Häftlinge bevölkerten die schmutzigen Straßen. Wo Schurken und Gestrandete verkehrten, da waren natürlich auch die Zuhälter, Huren und Inhaber zweideutiger Etablissements nicht weit. Parrott war offensichtlich in diese Kreise geraten. Robert versuchte zu verstehen und Bedauern stieg in ihm hoch.
„Der Herr ist auch für Unglückliche da. – Ja, gerade besonders für sie", sagte er leise vor sich hin. „Ich muss mich um ihn kümmern."
Er war etwas zurückgeblieben, denn er musste sich erst an sein neues Pferd 'Spot' gewöhnen. Sein schwarzer, halblanger Gehrock und der enge Kragen machten ihm außerdem zu schaffen. Nicht so Bedggood. Dieser war ein hervorragender Reiter und saß bequem und unverkrampft im Sattel.
Robert war unendlich dankbar für die Bekanntschaft von John Bedggood. Der Mann stand mit beiden Beinen auf der Erde und sah die Dinge in diesem Land mit offenen Augen, ließ sich nichts vormachen und vertrat seine Ansichten offen und ehrlich. Sie hatten während den letzten drei Tagen über vieles gesprochen, England, die Politik, die Missionsarbeit und natürlich über Te Waimate im Besonderen. John wusste mehr als nur Bescheid. Er erahnte mit wachem Geist die Hintergründe und Absichten, aus der Sicht der Kirche, der Krone, der Siedler, wie auch der Maoris.
Als Robert ihn bat, sich ihm anzuschließen und mit nach Te Waimate zu reiten, willigte John ohne Zögern ein, sparte nicht mit Ratschlägen, was sie alles benötigen würden und wo es in der Missionsstation im Besonderen im Argen liege. Er hatte ja die letzten Jahre dort gearbeitet und erst seit Bischof Selwyn wegzog, war er zu Hause geblieben.
Die Straße führte nun leicht aufwärts, auf einen flachen Geländerücken. Rechts, gegen das Tal des Waitangi zu, lagen Felder und Äcker. Bei näherem Hinsehen bemerkte Robert, dass das Land ungepflegt und voller Unkraut war. Nichts deutete darauf hin, dass hier früher Weizen und Gerste standen und gerade Furchen für Kartoffeln gepflügt wurden. Reste notdürftiger Zäune standen schräg und ungenutzt am Rande. Niemand schien sich darum zu kümmern, das Land war fruchtbar aber verlassen.
Geradeaus waren nun die ersten Gebäude auszumachen, die Straße führte direkt darauf zu. Links, hinter großen Tawa Bäumen und Manukabüschen, lagen einfache Hütten der Eingeborenen, zum größten Teil aus dem üblichen Geflecht von Raupo, wenige aus Holz. Unweit davon standen einige Schuppen, Werkstätte und Lagerräume, und davor, weiter unten, drehte sich tatsächlich ein Wasserrad an der Seite einer Mühle. Das Wasser kam von einem Weiher, welcher weiter hinten in der Senke eines kleinen Baches lag.
Das klappernde Geräusch war nun deutlich zu hören, aber niemand war zu sehen. Über der Siedlung der Maoris hingen leichte Rauchfahnen im schwachen Wind. Nur sie verrieten, dass Menschen anwesend waren. Was aber direkt vor ihnen lag, erschien fast wie ein englisches Dorf. In großzügigem Abstand lagen drei eindrückliche Missionshäuser, umgeben von Rasenanlagen und Blumenbeeten.
Dahinter duckten sich verschiedene Häuser, deren Verwendung nicht zu erkennen war. Das am weitesten entfernte Gebäude war aber die Kirche. Ein massiver Turm mit schlankem spitzem Dach überragte das wuchtige weiße Gebäude in beeindruckender Weise.