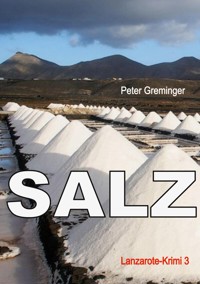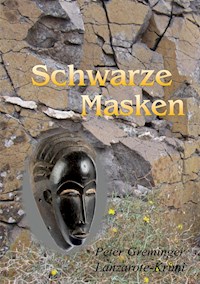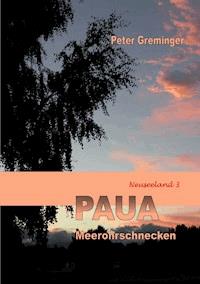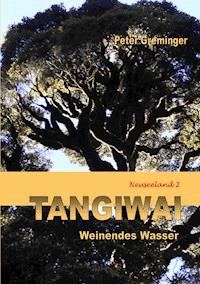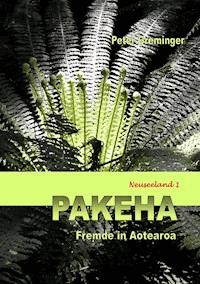Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paul Wiederkehr heiratete in Bandung eine Sundanesin und hoffte noch viele glückliche Jahre im Land, wo Höflichkeit und Geduld herrschten, zu verbringen. Alles ging gut, bis eines Nachts sein Freund und Kollege René unter mysteriösen Umständen verunfallte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Peter Greminger verbrachte den größten Teil seines Lebens im südostasiatischen Raum, wo er verschiedene Textilbetriebe leitete. Auf der indonesischen Insel Java arbeitete er fünfzehn Jahre und lernte Land, Leute und Kultur bestens kennen. Er erlernte die Sprache (Bahasa Indonesia) schnell, und selbst die Art der Sundanesen blieb ihm nicht verschlossen. Das vorliegende Buch basiert deshalb viel auf seinen unvergesslichen Erfahrungen an dieses herrliche Land, ist aber ein Roman und keine Autobiografie.
Nach Abschluss seiner Tätigkeit in Indonesien verbrachte der Autor weitere zwei Jahre in Neuseeland, wo vier Romane über das Land der Kiwis entstanden: „Pakeha“ (Fremde in Neuseeland), „Tangiwai“ (Weinendes Wasser), „Paua“ (Meerohrschnecken und „Kahurangi“ (Grüner Stein).
Peter Greminger
Jedem ausländischen Experten, welcher zum Transfer of Know-How sich im Lande aufhält, ist ein Counterpart zuzuweisen, der innert angemessener Zeit dessen Arbeit übernimmt.
So steht es im Reglement der Aufenthaltsbewilligung KIM’S für Indonesien.
UM DIE MYSTERIÖSEN UMSTÄNDE EINES UNFALLS AUF DER INDONESISCHEN INSEL JAVA.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Epilog
Kapitel 1
„Das ist Haram!“, wetterte die Frau Richterin und schob die Akte demonstrativ zur Seite. Darauf erging sie sich in einem Schwall von Erklärungen, was im Koran als unrein, verabscheuungswürdig und fluchbeladen bezeichnet werde und deshalb verboten sei. Dann folgten rechtliche Erklärungen, von denen Paul kaum die Hälfte verstand.
Die beiden Angeklagten saßen auf zwei harten Holzstühlen mitten im Raum genau vor der Schranke des Gerichts. Die resolute Dame dahinter machte eine ernste Miene. Das rundliche Gesicht deutete daraufhin, dass sie aus Central-Java stammte. Das schwarze Haar war straff nach hinten zu einem Knoten zusammengerafft, was ihr eine zusätzliche lehrerhafte Autorität verlieh.
Angeklagt war das Paar natürlich nicht. Sie saßen hier, weil sie heiraten wollten und dafür eine richterliche Genehmigung brauchten. Rini, die Frau neben Paul, war eine zierliche Sundanesin, um die 35 Jahre alt. Das luftige hellgrüne Kleid passte ausgezeichnet zu den fein geschnittenen Zügen ihres Gesichtes. Im Moment saß sie aber da, hatte die Augen niedergeschlagen und die Hände in den Schoss gelegt.
Paul hatte sich extra ein leichtes Sakko übergezogen, das war er dem Gericht, trotz der tropischen Wärme, doch schuldig. Er trug eine helle Hose und ein weißes Hemd. Mit einssiebzig war er eigentlich nicht sehr groß, überragte aber doch die meisten Einheimischen um einige Zentimeter. Mit starrer Miene folgte er den komplizierten Ausführungen. Er hatte in den vergangenen vier Jahren das Bahasa Indonesia schon leidlich gelernt, aber für das hier Vorgebrachte genügten diese Sprachkenntnisse einfach nicht. Der Inhalt war aber bald einmal klar, ihr Antrag, trotz unterschiedlicher Religion zivilstandsamtlich zu heiraten, war abgelehnt.
Ein Blick zur Seite, wo der Anwalt auf einer Bank an der Wand saß, zeigte deutlich, dass dieser ebenfalls begriffen hatte. Der kleine Mann, in einem schlecht sitzenden dunklen Anzug, hatte seine Aufgabe wohl nicht gründlich genug vorbereitet. Man hatte ihnen doch versichert, dass in Indonesien der Islam wohl Staatsreligion war, aber dass unter der Ideologie der so genannten „Pancasila“ die Glaubensfreiheit garantiert sei. Wieso wetterte jetzt die Richterin im Namen Allahs und bezichtigte Rini des Umganges mit einem Ungläubigen und dass dafür die Folgen schwerwiegend seien.
Der Antrag sei abgelehnt, die schriftliche Begründung werde demnächst ausgefertigt und das Verfahren sei geschlossen.
Etwas benommen standen sie kurz danach draußen vor dem Gebäude des Bezirksgerichtes Bandung und befragten den Anwalt. Kein Problem, beteuerte dieser, man würde einfach noch einmal beantragen und auf einen besseren Entscheid hoffen.
Die drückende Hitze war einem befreienden Regenschauer gewichen, als sie, Wochen später, das große Gebäude an der Jalan Ambon, wo das Zivilstandsamt untergebracht war, verließen und zum wartenden Auto eilten. Indonesien wurde seit Tagen von nachmittäglichen Regengüssen heimgesucht, was aber um diese Jahreszeit nicht anders zu erwarten war. Der Nordwest Monsun würde gegen Ende des Monats aber endgültig abflauen und dann erwartete man warme, trockene Tage.
In der kleinen Gruppe war Paul Wiederkehr derjenige, der besonders auffiel, denn er war der einzige Ausländer weit und breit. Er war mit einem weißen Hemd und dunkler Hose einfach gekleidet. Dazu trug er schwarze Halbschuhe. Diese Bescheidenheit war eigentlich erstaunlich, wenn man berücksichtigte, dass er vor wenigen Minuten einen entscheidenden Schritt seines Lebens getan hatte. Er war nämlich von diesem Moment an ein verheirateter Mann.
Die drei Frauen, welche nun unter dem Schirm des Chauffeurs in den Wagen kletterten, waren weit festlicher gekleidet. Ibu Surya trug einen bunten Sarong aus traditionellem Batik und ein fein besticktes glänzendes Oberteil. Das schwarze Haar hatte sie straff zu einem Knoten zusammengebunden. Sie sah trotz ihres Alters grazil, ja sogar puppenhaft aus. Ganz im Gegensatz zu ihrer Großmutter, war Vini in einem modernen, schwarzen Hosenanzug erschienen. Sie trug dazu einen leuchtenden, rotblauen Schal, der ihr etwas vom Aussehen einer Stewardess gab, wenn man davon absah, dass sie erst vierzehn Jahre alt war. Sie lachte fröhlich und rutschte auf dem Rücksitz in die Mitte.
Die Braut, sie war natürlich die wichtigste Person des Tages, stand einen Moment lang unschlüssig neben der Autotür, während das Regenwasser vom Schirm, den der Fahrer über sie hielt, auf ihren Ärmel tropfte. Die Nässe würde die feine Seide der lindengrünen Bluse ruinieren, wenn sie nicht endlich einstieg. Auch ihr Sarong war von höchster Qualität, handgemacht und aus Yogyakarta. Der edle Stoff umschmeichelte die zierliche Gestalt, die er innig liebte, und welche er fortan seine Frau nennen würde.
Endlich stieg sie ein, und Paul sprang auf der anderen Seite auf den Beifahrersitz. Nicht gerade eine Hochzeitskutsche, fuhr es ihm durch den Kopf, aber eben, die ganze Heirat war ziemlich ungewöhnlich, von allem Anfang an, gewesen. Nun war es aber vollbracht und Rini war seine Frau. Ein Blick über die Lehne bestätigte, auch sie lächelte glücklich.
Während die Scheibenwischer quietschend die letzten schweren Tropfen beseitigten, lenkte Pak Adang den Wagen durch den wilden Verkehr der westjavanischen Stadt Bandung in Richtung Setiabudi. Auch Adang gehörte zur Familie, wenn ihn Paul auch als Fahrer verpflichtet hatte. Er war Rinis Schwager und so etwas wie der Allrounder der Familie. Früher hatte er beim Militär gedient, und nach dem Ausscheiden war ihm die etwas autoritäre Art der ABRI Angehörigen geblieben. Er war aber ein äußerst loyaler und zuverlässiger Mensch, und sein militärischer Schneid war Paul nur recht. Manch schwierige Situation löste Pak Adang im Handumdrehen. Paul war sich seiner komfortablen Position voll bewusst. Zum einen arbeitete er für eine erfolgreiche chinesische Firma, hatte in eine sundanesische Familie eingeheiratet und wurde durch einen Veteranen der indonesischen Streitkräfte beschützt. Jetzt konnte ihm eigentlich nichts mehr passieren.
Ohne Pak Adang wäre die Heirat wohl noch schwieriger geworden. Der Letztere hatte den Anwalt gefunden und dafür gesorgt, dass die Termine nicht in alle Ewigkeit verschoben wurden.
Zwar gab es Freunde unter den Ausländern, die spotteten über Pauls kompliziertes Vorgehen, und meinten, so eine Indonesierin wäre doch problemlos in der Moschee zu ehelichen. Man müsste sich einfach pro forma zum Islam bekennen, und schon sei so eine traditionelle Heirat mit allem Drum und Dran möglich. Freilich schätzte dabei wohl der eine oder andere auch, dass eine Scheidung ebenso unproblematisch vonstattengehen würde und durch dreimaliges verbal ausgedrücktes Verstoßen äußerst schnell erledigt war. So nicht, schwor sich Paul, und schlug eine zivilrechtliche Trauung vor. Obwohl die Religionsfreiheit eigentlich garantiert war, gab es in Indonesien aber kein entsprechendes Gesetz, das eine Heirat mit einem Ungläubigen, einem Christen, ohne weiteres erlaubte. Es brauchte also eine richterliche Entscheidung für so eine Ausnahme.
Der Antrag wurde gestellt, sie wurden vorgeladen und prompt abgewiesen. Nach dem zweiten Anlauf besann sich Pak Adang des höchst üblichen Vorgehens, mit einer Geldsumme den Weg zu ebnen. So kam es, dass bei der dritten Verhandlung dem Antrag stattgegeben wurde. Dies, erstaunlicherweise von der genau gleichen Richterin, welche vorher vehement dagegen wetterte, und Rini der sträflichen Unreinheit und des Umganges mit einem Ungläubigen bezichtigte. Nun lebten die beiden aber schon zwei Jahre zusammen und von Unreinheit kann da wirklich keine Rede gewesen sein, sondern ganz einfach von Liebe.
Unterdessen hatten sie das Zentrum mit dem chaotischen Verkehr, den überfüllten öffentlichen Kleinbussen und den todesmutigen Fahrern der Dreiradtaxis, den sogenannten Bejaks, hinter sich gelassen und strebten den Hang hinauf. Palmen und farbenprächtige Büsche säumten den Straßenrand. Hinter Mauern und Hecken versteckten sich prächtige Bungalows. Es wurde merklich kühler. Dann war die kleine Hochzeitsparty beim Café Venezia angekommen, wo Paul einen Tisch reserviert hatte. Nach kurzem Widerstand gesellte sich auch Pak Adang zum Tisch, aber nicht bevor er das Auto einem der selbsternannten, herumhängenden Parkwächter anvertraut hatte. Der Letztere erkannte natürlich sofort, dass da, ohne schwerwiegende Folgen, keine krummen Sachen passierten durften, und das Auto des fremden Tuan absolut tabu war.
Das Café Venezia war trotz des fremdländischen Namens ein typisch sundanesisches Lokal, in einem mit tropischen Pflanzen überwucherten Garten, mit Bambustischen unter Schirmen und Dächern aus Palmwedel oder Injuk. Der Regen hatte kaum mehr als ein paar Pfützen hinterlassen und die Gruppe ließ sich behaglich in der kühlen Umgebung nieder. Die Frauen bestellten in ihrer sanft klingenden Sprache eine umfangreiche Mahlzeit. Sundanesisch war für Paul eine weitere Herausforderung, nachdem er die offizielle Landessprache, Bahasa Indonesia, schon recht ordentlich beherrschte. Am besten man ließ die Frauen gewähren. Was da dann aufgetischt wurde überraschte ihn nicht wirklich. Die kleinen Spießchen mit Hühnerfleisch, Sate Ayam genannt, kannte er schon. Dazu wurde eine Erdnusssauce mit scharfen Chilischoten gereicht. Statt weißem Reis gab es diesmal Nasi Lontong, eine klebrige Reisrolle im Bananenblatt. Dann kam natürlich das obligatorische Lalab Sambal, welches Paul als sundanesischen Salat betitelte, auf den Tisch. Dazu gehörten erstaunliche Sachen, so zum Beispiel lange rohe Bohnen, junge Blätter des Papaya Baumes oder runde knallgrüne Kugeln, die nach Petrol schmeckten. Paul nannte diese respektlos „Kugellager“ an Sambal Sauce. Natürlich durfte auf dieser Festtafel der Goldfisch nicht fehlen. Diese gebratene Delikatesse ist derart voller feiner Gräte, dass ein Europäer daran buchstäblich ersticken müsste. Paul hielt sich also an die köstlichen Sate und bestellte zum Nachtisch einen Avocado Shake. Die eher geschmacklose, pürierte Avocado wird mit flüssigem Rohrzucker und Schokolademilch angereichert und schmeckte kühl serviert einfach herrlich.
Paul verstand das Tischgespräch kaum, vermutete aber, dass es sich um Familienangelegenheiten handelte, welche die drei Frauen eingehend besprachen. Rini blickte manchmal fragend in seine Richtung, aber Paul lächelte glücklich zurück und störte sich an dieser Ausgeschlossenheit nicht wirklich. Diese gab ihm vielmehr etwas Zeit, seinen eigenen Gedanken nachzuhangen.
Wenn dieses Essen vorbei war, würden sie zurück zu ihrem Haus fahren, und Pak Adang würde Großmutter Surya und Vini ebenfalls nach Hause bringen. Vini, Rinis Tochter aus erster Ehe, lebte seit Jahren bei Ibu Surya, eigentlich bei deren Großfamilie, im Hause von Schwester Megawati, oder eben von Pak Adang, dem Schwager. Rinis zweite, die ältere Tochter, war seit Anfang Jahr zu einem Studienaufenthalt in England. Das hatte Paul arrangiert. Überhaupt hatte er sich, bald nachdem er mit Rini in das Haus an der Jalan Karangsari gezogen war, auch um die beiden Töchter gekümmert. Deren Vater war vor Jahren, eines Tages einfach verschwunden und hatte die Familie mit einer simplen, mit arabischen Schnörkeln verzierten Scheidungsurkunde, ausgestellt durch die lokale Moschee, zurückgelassen. So einfach war das hier.
Glücklich darüber, dass nun seine heutige Vermählung eine sichere Grundlage besaß, beschloss Paul, gleich anderntags die Botschaft in Jakarta zu informieren, damit die Heirat auch in der Schweiz registriert würde. Mit Beklemmung dachte er an die Hochzeit eines deutschen Kollegen, der den, von westlichen Staaten kaum anerkannten Weg der traditionellen Trauung in einer Moschee gewählt hatte. Irgendwann war sogar herausgekommen, dass der Kerl zu Hause, in Deutschland, eine Frau und zwei erwachsene Kinder hatte und dort sogar immer noch an einem Eigenheim baute. Da täuschte das ganze riesige indonesische Hochzeitsfest nicht darüber hinweg, dass der ansonsten umgängliche Mann eigentlich Bigamie beging.
Paul hatte dieses unglaubliche Fest noch in bester Erinnerung. Auf den Besuch der Moschee hatte er verzichtet, aber der Einladung zum Empfang war er gefolgt. Dieser fand in einer großen Halle unweit der südlichen Umfahrungsstraße von Bandung statt. Hunderte von Gästen strömten heran. Die Autos verstopften jegliche Zufahrt, und innen war ein unvorstellbares Gedränge. Vorne auf der Bühne war eine pompöse Kulisse für die Hauptakteure aufgebaut worden. Zwei goldene Sessel mit rot bespanntem Polster aus Samt standen vor Laub umrankten Säulen und reichgeschnitzten Wandschirmen. Nebenan, etwas kleiner, aber nicht minder prächtig, befanden sich die Sessel beider Eltern. Aus begreiflichen Gründen waren die beiden auf der linken Seite, die Sitze der Eltern des Bräutigams, verwaist. Deren Rolle wurde von einem befreundeten Ehepaar übernommen. Im Moment, als sich Paul und Rini zur Bühne vorarbeiteten, standen die Familie und das Brautpaar in einer Reihe dort oben, um die Gäste zu begrüßen. Die Gastgeber, wie auch die Gäste, waren fast alle in den farbenprächtigen Roben der indonesischen Traditionen gekleidet. Die Frauen in herrlichen Sarongs aus Batik trugen durchwegs feine seidene Oberteile und einen bunten, ebenso feinen Schal, den sie Selendang nannten. Die schwarzen Haare hatten sie meist hochgesteckt und teilweise mit wippenden Nadeln geschmückt. Manchmal trugen auch Männer einen Sarong. Das zeigte aber, dass derjenige eher aus Mitteljava stammte. Er trug dann oft auch eine Kopfbedeckung aus Batik und einen Kris im Gürtel. Die javanische Tracht war in Indonesien seit langem die traditionsreichste und bedeutendste. Deshalb waren auch hier Braut und Bräutigam so gekleidet. Während die zierliche Braut einer herrlichen exotischen Blüte glich, sah der Deutsche unter seinem javanischen Käppi doch eher komisch aus. Das wurde aber von allen Anwesenden gutmütig übersehen.
Das Ritual war immer dasselbe. Die Gäste strebten nach der Ankunft in einer langen Reihe der Bühne zu, passierten die Hauptakteure mit zusammengelegten Händen zum traditionellen Gruß, murmelten einige Glückwünsche und stiegen auf der anderen Seite hinunter, um sich auf das Büffet zu stürzen. Auch dieses war sehenswert. Reich dekorierte Schüsseln enthielten exotische Speisen jeder Art. Herrliche Orchideen schmückten die Tafel, und Berge von Obst vollendeten den Segen zum leiblichen Wohl. Leider war natürlich alles kalt, war es doch unmöglich, so etwas innert nützlicher Frist aufzubauen. Daran störte sich aber niemand. Man häufte Reis, Huhn, Gemüse, Lalab und Sambal auf einen Teller und gab oben drauf die Süßspeise und eine Banane. So bewaffnet balancierte man das Ganze durch die Menge und versuchte einen der Klappstühle zu ergattern. Dort schaufelte man sich, mit einem Löffel, soviel man konnte in sich hinein, drückte danach die Papierserviette oben auf den Rest und platzierte den Teller unter den Stuhl. Hatte man das geschafft, und war nicht aus Versehen in einen der vielen Teller getreten, machte man sich erneut auf den Weg zur Bühne. Gleiche Prozedur wie vorher, nur dass man jetzt ein leises Dankeschön murmelte, bevor man unverzüglich dem Ausgang zustrebte. Eigentlich war das alles für den Europäer eher unanständig, aber Rini belehrte Paul, dass es äußerst beleidigend wäre, nach dem Essen zu bleiben. Das würde bedeuten, dass man nicht satt wäre und der Gastgeber ein Geizhals sei. Na prost, darauf konnte er verzichten, schwor sich Paul, und der heutige Tag bestätigte, dass er einen anderen Weg gefunden hatte.
Freilich, auf eine kleine Party ganz unter Freunden wollten auch Paul und Rini nicht verzichten. So kam es, dass sie gegen Abend auf dem Weg zum Haus von Mike und Rosie waren.
Mike war viele Jahre durch die arabischen Länder gezogen und hatte an deren Netz der Telekommunikation mitgearbeitet. Dass er dabei gutes Geld verdient hatte, zweifelte niemand, und als er Rosie heiratete und das Haus bauen ließ, war klar, der Mann hatte endlich seinen Hafen gefunden. Er war ein gutmütiger Kumpel und seine Frau eine fröhliche unkomplizierte Person, welche übrigens der christlichen Minderheit in diesem Lande angehörte. Dass die Bande von Ausländern aber besonders gerne in diesem Haus verkehrte, lag wohl auch an der schmucken Bar, die Mike im hinteren Teil des riesigen Wohnzimmers eingerichtet hatte. Dort war schon manches gemütliches Fest, bis tief in die Nacht hinein, gefeiert worden.
„Wir sollten nicht zu lange bleiben“, murmelte Rini, als Pak Adang an diesem Abend den Wagen zu der neuen Überbauung Sekelimus im Süden Bandungs steuerte.
„Natürlich, Sayang“, entgegnete Paul. Das sundanesische Wort für Liebling kam ohne Zögern über seine Lippen. „Eine kleine Feier werden wir uns aber doch gönnen. Alle meine Freunde werden da sein und du kennst ja die Frauen.“
„Na ja, das schon, wenn da auch ein paar nicht so ganz zu uns passen.“
Jetzt lachte Paul schallend. „Wir wollen doch nicht die Sittenpolizei spielen, meine Liebe. Wenn sich einer wie Eddy halt eine Freundin gönnt, so lass es gut sein.“
Es stimmte schon, da kamen manchmal die fragwürdigsten Menschen zusammen, aber zu einer leichten Frau gehörte auch immer ein leichtsinniger Mann. Eddy war sicher so einer, der bei jeder Gelegenheit mit einer anderen ankam, aber das musste der selber verantworten. Er war ein Landsmann von Mike und deshalb sicher auch heute mit dabei. Es war nun einmal so, dass man sich an einem Tag wie heute bei Mike traf.
Rini und Paul wurden mit großem Hallo empfangen. Laute Gratulationswünsche ertönten, und Mike hatte es tatsächlich fertig gebracht, den Hochzeitsmarsch aufzulegen. Grinsend kam er hinter der Bar hervor und klopfte Paul auf die Schulter.
„Na, alter Kumpel!“, übertönte er die laute Musik. „Willkommen im Klub der Verheirateten.“
Rini wurde sofort von den Frauen umringt, welche sich in ihren besten Kleidern präsentierten. Es war ein buntes Gemisch von östlich – westlicher Mode, welche genau zu den vielen verschiedenen Menschen passte. Paul beobachtete seine Frau glücklich. Sie hatte das traditionelle Kebaya mit einer etwas moderneren Version vertauscht und sah einfach bezaubernd aus. Ein bodenlanger Rock aus glänzender dunkelblauer Seide lag eng um ihre Beine und betonte die schlanke Figur. Das ärmellose Oberteil ließ den schlanken Hals und die wohlgeformten Arme unter einem betörenden, durchsichtigen Gebilde aus feinster himmelblauer Stickerei erkennen. Das vorher straff gebundene Haar umschmeichelte jetzt frei in natürlichen Wellen das zierliche Gesicht. Das Letztere war von der traditionellen starken Schminke befreit und wirkte mit dem strahlenden Lächeln einfach zauberhaft. Sie bewegte sich wie eine liebliche Prinzessin zwischen der fröhlichen Schar Frauen. Die feingliedrigen, anmutig zusammengelegten Hände berührten sich beim traditionellen Gruß kaum und wirkten wie die Gesten fernöstlicher Tänzerinnen.
Die Männer belagerten bald die Bar, wo Mike die uneingeschränkte Kontrolle übernommen hatte. Es waren nicht genügend Hocker vorhanden, weshalb sich ein wogendes Hin und Her bildete, als alle dem Neuvermählten zuprosten wollten. Einer der Ersten, der sich zu Paul hinschob, war René.
„Auf dein Glück!“, wünschte er mit einem Lachen im Gesicht. „Für den neuen Anfang, in eurem gemeinsamen Leben“, fügte er hinzu.
„Danke!“, entgegnete Paul. „So ganz neu ist es ja auch wieder nicht.“
Tatsächlich, man durfte die vergangenen zwei Jahre nicht vergessen. Eigentlich war der heutige Tag einfach die Bestätigung ihrer Beziehung. - René sah das aber etwas anders.
„Für mich war es damals aber wirklich ein Meilenstein“, konterte er deshalb.
„Ach, lass es gut sein“, beschwichtigte Paul. Er wusste genau, wo das hinführte. Die meisten der Anwesenden belächelten seinen ungewohnten hindernisreichen Weg. - Und René? Der hatte genau das Gegenteil getan, er hatte in der Moschee geheiratet. Trotzdem achtete Paul dessen Vorgehen, denn auch er hatte eine gewisse Standfestigkeit bewiesen. Er hatte sich nicht nur pro forma zum Islam bekannt, damit die Heirat problemlos vonstattengehe, nein, er war tatsächlich ein Muslim geworden und dabei geblieben. Mit Erstaunen hatte Paul, bei einem kürzlichen Besuch in dessen Haus an der Jalan Parakan, den Mann auf dem Teppich vor dem aufgeschlagenen Koran angetroffen. Es gebe durchaus auch eine Ausgabe in Deutsch, hatte René erklärt und der Inhalt sei äußerst interessant, überhaupt nicht so unterschiedlich zur Bibel. Paul, dem eine Abkehr vom anerzogenen Glauben seiner Kindheit kaum vorstellbar war, verstand diesen Wandel seines Freundes nicht. Ebensowenig hätte er Rini zu einer Bekehrung zum Christentum gedrängt. Der Glaube war seiner Ansicht nach eine absolut persönliche Angelegenheit und sollte auch in einer Partnerschaft zwischen Mann und Frau nicht als zwingende Einigkeit vorausgesetzt werden. Moderne Ehen verlangten heutzutage in vielen Belangen große Toleranz zwischen den Partnern, warum also nicht auch in der Religion? Wer wollte denn behaupten, sein Glaube sei ultimativ auch für alle Anderen der Richtige? Es galt doch einfach dem anders Denkenden diesen Freiraum zuzugestehen. Für Rini und ihn schien diese Denkweise durchaus vernünftig und resultierte eben in der heute erlebten Ziviltrauung.
René schienen diese Überlegungen durchaus nicht fremd. Er konnte aber nicht verkneifen, seine Argumente anzubringen: „Ich verstehe schon. Trotzdem, es hat für uns vieles erleichtert. Für Tati war das schon wichtig und jetzt besonders auch für die Kleine.“
Ihre Tochter war vor kaum drei Monaten zur Welt gekommen, und sie war Renés Augapfel. René vergötterte sie. Tati, die Mutter, bekam alle Unterstützung ihrer Familie, so dass seit der Geburt der kleinen Indah das junge Paar kaum je allein gelassen wurde. Auch jetzt waren Tatis Mutter und die Schwestern da und behüteten das Kleinkind pausenlos. Sie hielten sich allerdings scheu im Hintergrund, denn das fröhliche Treiben an der Bar, natürlich nicht ohne reichlichen Alkoholkonsum, tolerierten sie als Gäste nur gezwungenermaßen. Die mit weiten Tüchern verhüllten Gestalten tauchten deshalb auch nur gelegentlich aus den hinteren Zimmern auf. Sie riefen tadelnd nach Tati und tuschelten leise, sofort wieder verschwindend.
Unterdessen war der Lärmpegel gestiegen. Aus den Lautsprechern tönten alte Schlager, und zwei Frauen tanzten ausgelassen. Paul erschien diese Verträglichkeit zwischen den beiden Welten, einerseits der muslimischen und christlichen, andererseits aber auch zwischen der östlichen und westlichen Kultur, erstaunlich. – Nun ja, diese Verbindungen kamen immer mehr zu Stande, wahrscheinlich oft aus finanziellen Überlegungen. Der weiße Mann wurde immer noch mit einem wohlhabenden gleichgestellt. Dies traf natürlich oft zu, so war René mit seinem gut bezahlten Job als Textiltechniker der Schweizer Firma, welcher früher auch Paul angehört hatte, durchaus eine gute Partie. René arbeitete eben in diesen Tagen in der Firma, welche Paul leitete. Wohl aus diesem Grund, glitt ihr Gespräch bald einmal in technische Themen ab. Das passierte immer wieder, denn die meisten der anwesenden Männer hatten einen ähnlichen beruflichen Hintergrund. Sie waren als Servicetechniker, als Monteure oder als sonstige Spezialisten ins Land gekommen und dann geblieben. Für Lieferanten, Vertreter wie auch Kunden war so ein Engagement nur von Vorteil, denn die Betroffenen sprachen bald einmal die Landessprache und kannten sich mit den lokalen Gepflogenheiten aus. Nur einer der Anwesenden schien nicht in diese Rolle zu passen. Das war Hadia.
Hadia war Chinese und seine Frau Angelika Deutsche. Die hellblonde Frau war, neben Eddys Mädchen, die Einzige, welche unter den Männern an der Bar saß und einen Longdrink vor sich hatte. Ein erstaunliches Paar, dachte Paul. Hadia sprach fließend Deutsch. Er hatte seine Frau während eines Studienaufenthaltes in Hamburg kennengelernt und mit nach Hause gebracht. Die kühle Norddeutsche mit der klassischen Sprache passte aber so wenig in dieses Indonesien, wie ein zwitschernder Paradiesvogel nach Hamburg. Angelika war aber keineswegs eine schwierige Person. Sie gab sich jede erdenkliche Mühe, sprach nach einem Jahr besser Bahasa als mancher Monteur in zehn Jahren und unterstützte ihren Mann in der Buchhaltung seines Geschäftes. Hadia war etwas kleiner als seine Frau, war aber genauso intelligent. Die letztere Tatsache schätzte Paul sehr, denn er nahm immer öfters Hadias Dienste in Anspruch. Der führte nämlich eine mechanische Werkstatt und fertigte Ersatzteile jeglicher Art an. Nun ja, das konnte man in Bandung fast an jeder Straßenecke haben. Nur, in den lokalen Bruchbuden gab’s so etwas wie Präzision und Zuverlässigkeit nur selten. Das war mit Hadia ganz anders, und Paul konnte mit dessen Hilfe manch unglücklichen Maschinenstillstand in seinem Betrieb vermeiden oder mindestens verkürzen.
Hadia saß in der Ecke der Bar an der Wand und beobachtete lächelnd das Geschehen um ihn herum. Als Chinese war er von der Runde nicht eigentlich ausgeschlossen, aber seine Herkunft distanzierte ihn schon ein wenig. Den Männern, mit ihrem kumpelhaften Benehmen war der Chinese etwas zu fein und für die indonesischen Frauen, einer ethnischen Minderheit im Lande angehörig, zu fremd. Dass sich das Paar trotzdem immer wieder zu den Ausländern und ihren Frauen gesellte, lag wohl daran, dass sie von den Einheimischen nicht voll aufgenommen wurden. Übrigens ganz allgemein das Los der Chinesen in Indonesien, denn diese waren unerwünschte Immigranten, welche zudem auch noch die wirtschaftlichen Fäden in den Händen hielten. Fast so wie die Juden in Europa, dachte Paul für sich, korrigierte aber sofort. Da war natürlich das riesige Reich der Mitte, eine ganz andere Dimension, was sich die Chinesen wohl weltweit durchaus bewusst waren. Hadia war für ihn aber ein guter Freund, den er immer gerne um sich wusste.
„Nun tanz doch mal mit deiner Braut!“, unterbrach Rosie Pauls Gedanken, die laute Musik übertönend.
Schuldbewusst grinsend rutschte er vom Barhocker und bahnte sich einen Weg durch die Gesellschaft. Rini war immer noch von den Frauen umlagert, lächelte ihm jetzt aber glücklich zu. Klopfenden Herzens schob er die zierliche Frau auf die Tanzfläche und nahm sie in die Arme. Ein langsamer Walzer klang aus den Lautsprechern, und mit jedem sicherer werdenden Schritt vergaß Paul die Welt um sich und versank in den Blicken seiner Geliebten.
KAPITEL 2
Cimerah liegt eine knappe Stunde östlich von Bandung am Abhang der dortigen vulkanischen Hügelkette. Der Name beschreibt genau den Ort, er heißt nämlich “Roter Bach“. Cimerah ist ein Ortsteil des Dorfes Cibuntu im Bezirk Bandung Kulon. Sehr viele Ortsbezeichnungen beginnen in West Java mit dem sundanesischen Wort “Ci“, welches Bach bedeutet, und enden dann mit den Bezeichnungen “merah“, “biru“, “pedes“ oder “panas“ für rot, blau, scharf oder heiß, je nach Lage.
Der “Rote Bach“ kam neben einem ungeteerten Sträßchen den Hang hinunter und wurde in regelmäßigen Abständen in die Reisterrassen geleitet. Rot waren hier die Straße, die Felder, der fruchtbare Boden und davon eben auch das Wasser. Zu dieser Jahreszeit standen in den überfluteten Feldern zarte, hellgrüne Reispflanzen. Das rotgrüne Muster leuchtete wie ein feines Gewebe von höchster Qualität, wie für einen Sarong einer Jungfrau.
Achmed schritt gemächlich den Hang hinauf. Er kam von seinem Haus etwas unterhalb des Dorfes. An den Hängen beidseitig des Baches reihten sich viele kunstvoll angelegte Terrassen. Dazwischen standen immer wieder struppiges Buschwerk, Bambus und sattgrüne Fruchtbäume. Sein eigenes kleines Reisfeld lag etwas weiter oben, auf der linken Seite. Dort war er aber bereits am Morgen gewesen und hatte einen schadhaften Damm in Ordnung gebracht. Immer wenn es lange nicht mehr regnete, trockneten die Dämme aus Lehm und Erde rasch aus und bekamen Risse. Das war oben am Hang eine leidige Angelegenheit, da Wind und Erosion dort ungehindert auf das Erdreich wirkten. Unten im Tal war es besser, aber dort waren die großen Reisfelder den schnell wachsenden Industriebauten gewichen. Auch er hatte das Land neben dem Bambushain für gutes Geld verkauft. Ibu Nuria hatte lange protestiert und ihn für verrückt erklärt. Man verkaufe doch nicht seine Lebensgrundlage und schon gar nicht an diese schlitzäugigen Orang China. Bald hätten diese Schurken das ganze breite Tal überbaut, und dann würden sie sehen, wovon sie alle leben würden. Ihr, ja ihr konnte es schließlich egal sein, ihre Zeit war abgelaufen, aber er, Achmed, er war ein Dummkopf von einem Schwiegersohn, der seine Familie ins unvermeidliche Verderben führte.
So hatte Ibu Nuria wochenlang lamentiert und sie alle beinahe in den Wahnsinn getrieben. Natürlich kannte er all diese Argumente, er war ja nicht dumm, aber wie in Allahs Namen, sollte er sonst das Schulgeld für Momon auftreiben? Der Junge brauchte eine gute Ausbildung. Die Zukunft lag dort unten, in den Fabriken und nicht im Schlamm eines Reisfeldes. Er musste verkaufen. – Ha! Dann, als er den Fernseher nach Hause brachte, war Ibu Nuria die Erste, die das interessierte. Heute brachte man die Alte kaum mehr von der Flimmerkiste weg.
Achmed grinste vor sich hin. Das Problem war damit gelöst, aber irgendwie, tief drinnen gab eine leise Stimme keine Ruhe und flüsterte mahnend, ob er nicht doch eine Dummheit gemacht hatte. Das Feld beim Bambushain hatte er damals von seinem Vater übernommen, als dieser im Alter von 48 Jahren unerwartet verstorben war. Seit vielen Jahrzehnten war es der Stolz der Familie gewesen. Sie hatten zu den angesehenen Mitgliedern ihres Kampungs gehört und waren in der glücklichen Lage, Überschüsse, wie Reis, Singkong, Bananen oder Avocaden in die Stadt zu liefern. Seit ein paar Jahren waren aber die Preise eingebrochen, da eine Agrarreform der Regierung neue Sorten Reis für Großanbau mit mehrfachem Jahresertrag vorschrieb. Wer nicht vergrößern oder zusammenlegen konnte, der stand vor dem Aus. Man hatte es kommen sehen und als dann das Angebot, das Land an diesen kleinen Chinesen abzutreten, vom Pak Lurah vehement unterstützt wurde, entschloss er sich zum Verkauf. Mit ihm hatten etliche Nachbarn das gleiche getan, denn der Lurah, der Dorfälteste, hatte überzeugend dargelegt, dass es keinen besseren Weg gebe, und dass nach dem Aufbau der Fabrik dort alle eine gut bezahlte Arbeit finden würden.
Nun war die Pabrik Tekstil dort unten seit Monaten in Betrieb, aber eine Arbeit hatte keiner erhalten. Was war nur schief gelaufen? Diese Frage wollte man heute dem Pak Lurah unbedingt stellen. Nach dem Abendgebet wäre die richtige Gelegenheit.
Achmeds Ziel, die Mesjid Hadjia, war eine kleine Moschee, verborgen unter den Wedeln einer krummgewachsenen Palme. Eine runde Kuppel aus Blech verriet das Haus Allahs, und an der Außenwand fand Achmed eine plattenbelegte Rinne unter einfachen Wasserspendern. Er war aber zu früh, denn die Sonne stand noch über dem Horizont. Die Mesjid lag einsam und ruhig vor ihm. Sobald aber die Nacht hereinbrach, würden sie kommen. Er erwartete viele seiner Nachbarn, denn sie alle hatten die gleichen Fragen, und es ging bereits ein unfreundliches Murren durch das Dorf. – Hatte der Lurah sie mit schönen, nicht einzuhaltenden Worten beschwatzt und gleichzeitig eine stattliche Provision eingestrichen?
Achmed kauerte sich bedächtig an den Wegrand und steckte sich eine Kretek an. Der tief inhalierte Rauch des würzigen Tabaks umhüllte ihn mit dem betörenden Duft von Gewürznelken. Er blickte über das Tal, wo die Schatten allmählich länger wurden. Es war ein herrliches Bild von zarten Pastelltönen und sanft weißen Dunstschleiern. In der Ferne erhob sich eine Kette dunkler, geheimnisvoller Hügel. Die Einschnitte dazwischen versanken bereits in der Dunkelheit, während die vulkanischen Höhen noch die letzten Sonnenstrahlen einfingen. Der gnädige und weise Gott hatte ihnen eine wunderbare Heimat geschenkt. Gelobt seien Allah und sein Prophet!
Leider riss die neu gebaute Schnellstraße dort unten eine unübersehbare Wunde in das Gemälde. Bereits hatten geschäftstüchtige Kleinunternehmer ihre Buden und Läden entlang dem Asphaltband aufgebaut. Ein “Warung“ nach dem anderen entstand, man verkaufte Coca-Cola und Zigaretten, manchmal Früchte und Kuchen. Die Besitzer reparierten gerne ihre frisierten Motorräder und drehten mit lautem Aufheulen Extrarunden. Frauen bereiteten Tee oder Kopi Tubruk zu und schwatzten den Tag lang.
Rechts, gegen Bandung hin, reihten sich die neuen glänzenden Fabrikdächer. Die flachen Gebäude darunter waren in hohe Mauern eingeschlossen. Weiter gegen Süden lag aber die Landschaft noch intakt im aufkommenden Schatten. Haine mit verschiedenen Fruchtbäumen trennten dort die Häuser der Bauern von ihren Feldern. Das Netzwerk der Dämme war trotz der Dämmerung noch gut auszumachen. – Wie lange würde es dauern, bis auch sie den Fabriken weichen mussten?
Von weiter unten waren jetzt Stimmen zu hören. Trotz der zunehmenden Dunkelheit entdeckte Achmed die Gruppe Männer mit dem Imam in der Mitte. Dessen weißes Käppchen, welches ihn als Hadji auszeichnete, leuchtete hell. Als sie näher kamen, verstummte das Gerede, und Achmed vernahm gerade noch, wie der Imam besänftigend sagte: „… zuerst beten, so Allah will.“
Die meisten seiner Begleiter waren einfach gekleidet, manche sogar mit dem traditionellen braun gemusterten Sarong der Männer. Sie kamen barfuß oder in einfachen Gummischlarpen den Weg hinauf. Da war aber auch der Pak Lurah. Er trug eine Jacke und den schwarzen, randlosen Hut, den Peci. Zusammen mit seiner etwas korpulenten Figur markierte er damit seine Führerrolle.
Weitere Ankömmlinge tauchten auf. Alle begaben sich nun wortlos zu der Waschanlage und entledigten sich des Staubes. Auch Achmed gesellte sich zu ihnen. Es war Pflicht jedes guten Moslems, Hände, Gesicht, Arme und Füße vor dem Gebet zu waschen. Allfällige Schuhe blieben vor dem Eingang, so dass das Innere der Mosche rein blieb.
Achmed blieb im Hintergrund, richtete sich gegen Mekka und konzentrierte sich auf das Gebet. Der Imam hantierte mit dem Mikrophon.
„Allahu akbar!“, ertönte der Ruf zu Ehren Gottes.
Es folgten drei Rak’at Fard und zwei Sunna worauf das Gebet mit dem Segen abschloss: „Assalamu alaikum wa rahmatullah!“
Es verstrich geraume Zeit, bis auch der Letzte sein Gebet beendet hatte und der Lurah das Mikrophon übernahm. Die Männer, etwa zwei Dutzend, machten es sich bequem. Langsam erhob sich ein Gemurmel, welches der Lurah aber mit einer Handbewegung zum Verstummen brachte.
„Saudara Saudara, yang terhormat…“, begann der Dorfälteste mit der formellen Anrede. „Wir haben als gläubige Muslime eben unser Abendgebet beendet und wollen mit großem Vertrauen auf Allah auch unsere täglichen Anliegen in seine gütigen Hände legen. Wir alle haben…“
„Können wir nicht in Sundanesisch reden?“, fuhr einer ziemlich unhöflich dazwischen.
„Ich dachte, ihr versteht alle unsere Landessprache“, konterte Pak Lurah, besann sich aber: „Semuhun… natürlich, ich bitte um Entschuldigung. – Also, wir… ich habe gehört, dass einige von euch mit dem Landverkauf nicht zufrieden sind…“
Der Dorfälteste erging sich umständlich in einer Schilderung, wie sie alle vor gut einem Jahr ein vorteilhaftes Geschäft abgeschlossen hätten. Und wenn jetzt nicht alles perfekt liefe, so sei man doch immer noch sehr gut weggekommen…
Man ließ ihn reden, denn eine weitere Unterbrechung wäre nun wirklich einer Beleidigung gleichgekommen. Einzig in den hinteren Reihen wurde getuschelt. Das Gesicht des Redners glänzte. Er schwitzte offensichtlich. Dann, als er geendet hatte, bot er das Mikrophon den Versammelten an.
Ein untersetzter Mann in einem bunten Batikhemd erhob sich und winkte ab. „Ich brauch das nicht. – Verehrter Pak Lurah, verehrte Anwesende, bitte entschuldigt, aber die vorangegangenen Ausführungen treffen den Kern der Sache nicht. Sie, Pak Lurah, haben uns allen gute Arbeit in der Fabrik versprochen. Das war ausschlaggebend für den damaligen Verkauf. Heute wissen wir, dass kaum einer angestellt wurde und wir so in unserer Existenz bedroht sind. Wie sollen wir uns jetzt ernähren, Pak Lurah?“
„Ja, wie, Pak Lurah?“, brummten einige Anwesende unmutig.
„Bitte, bitte“, versuchte der Lurah zu besänftigen und räusperte ins Mikrophon. „Es ist alles einfach zu erklären. – Die Versprechungen wurden mir von der Firma PT. Indosun damals ausdrücklich gemacht, und ich kann wirklich nichts dafür, wenn diese sich jetzt nicht daran hält. Ich war deshalb auch vor ein paar Tagen dort und habe mich für euch eingesetzt. Der Personalchef ist einer von uns, aus Ost Java. Er erklärte, dass PT. Indosun bereits über dreihundert Arbeiterinnen rekrutiert habe, und dass für die neue Spinnerei noch mehr benötigt würden. Wir müssen einfach Geduld haben.“
Nun sprang Achmed auf. „Geduld, Geduld! Soll ich damit vielleicht meine Familie ernähren? – Ja, auch meine Schwester wurde angestellt. Sie verdient einen Hungerlohn, gerade genug für eine Schüssel Reis. Was ist aber mit uns? Ich brauche Arbeit!“
„Hast du dich denn schon beworben?“
„So ein Unsinn! Natürlich habe ich mich beworben. Alle von uns haben das getan, und jetzt liegen die Akten bei denen dort unten und türmen sich zu einem wartenden Berg. Ich brauche Arbeit, jetzt!“
Achmed ließ sich nieder, während ein Sturm der Empörung aufbrauste. „Ja, jetzt wollen wir Arbeit! Arbeit!“
Nachdem wieder etwas Ruhe eingekehrt war, versuchte es der Lurah noch einmal: „Ich kann euch auch nicht weiterhelfen. Es liegt an der Firma, welche Arbeitskräfte sie einstellen will. Ich kann da nur vermitteln.“
„Ja, und eine Provision einstreichen…“, knurrte einer unerkannt. Der mit dem Batikhemd erhob seine Stimme erneut: „Saudara, wir sind einmal mehr die Betrogenen. Es sind immer diese Chinesen, die ihre Geschäfte auf unsere Kosten machen, und da ist auch noch ein Orang Buleh, ein Weißer, der mischt auch mit. Wir sollten dieser Bande wieder einmal zeigen, dass man mit uns nicht so umspringen kann.“
Der Lurah schwieg.
„Ja, lasst uns morgen hinuntergehen und denen zeigen, mit wem sie sich anlegen!“, rief ein junger Mann aus der Mitte.
„Die sollen uns kennenlernen!“
„Nieder mit den Ausbeutern!“
„Kami akan menang! Wir werden siegen!“
Achmed war die ganze Geschichte nicht mehr geheuer. So hatte er sich den Ausgang nicht vorgestellt. Aber war es seine Pflicht, die aufgebrachten Männer zu bremsen? Der Lurah schien auch nicht willig einzugreifen. – Hatte der wirklich sein Möglichstes getan, oder war das alles leeres Gerede? Einmal mehr versteckte sich der Verantwortliche hinter den Aufgebrachten und ließ diese gewähren. Ihm graute vor dem Unabsehbaren. Dieses war ein Aufstand gegen die Falschen. Der eigentlich Fehlbare war doch der Lurah. Der hatte sie mit unhaltbaren Versprechen zum Landverkauf gedrängt, hatte die Kommission für den Preis einkassiert und verdiente jetzt auch noch an den Bewerbungen.
Achmed wusste ganz genau, wie das gelaufen war, bis seine Schwester eingestellt wurde. Der Lurah leitete die Bewerbung weiter, gab seine Empfehlung ab und bezog von den Arbeitswilligen eine Vermittlungsgebühr. Einen ganzen Monat musste Sindi dafür arbeiten. Sie hatte es ohne Murren getan, und jetzt brachte sie etwa hundertfünfzigtausend Rupien nach Hause. Das war nicht viel, aber besser als gar nichts. Eigentlich war Sindi ganz zufrieden, sagte sie doch, dass es geregelte Pausen gebe, eine Mahlzeit in der Kantine und Transporte hin und zurück. Die Arbeit an den Maschinen sei wohl ungewohnt, aber gut organisiert, und die Vorgesetzten seien durchwegs freundlich. – Man hatte also kaum einen Grund, gegen die Chinesen und den Weißen zu wettern. Natürlich verstand auch er nicht, warum die Männer keine Arbeit bekamen.
Als sich die Versammlung auflöste und die Männer dem Dorf zustrebten, waren da und dort immer noch böse Wortfetzen zu hören. Eine schmale Mondsichel leuchtete Achmed den Weg zurück zu seinem Haus. Er erwartete den morgigen Tag mit Sorge. Ein Gedanke verfolgte ihn unaufhörlich. Er durfte den Seinen mit keinem Wort von den wirren Plänen der aufgebrachten Männer erzählen, denn wenn etwas bis zur Fabrik durchsickern würde, wären Sindi, er und seine Familie sofort in Verdacht und dann dem wütenden Mob ausgeliefert.
KAPITEL 3
Pak Ponto war Pauls rechte Hand und im Umgang mit den lokalen Arbeitern unersetzlich. Diesen Status verdankte er seiner Herkunft aus Ambon, der Provinzhauptstadt der Molukken. Mit seiner Körpergröße, seiner kräftigen drahtigen Gestalt und den rabenschwarzen krausen Haaren, war er das Abbild eines wilden Kriegers, welcher, verglichen mit den feinen zierlichen Sundanesen, sich ohne Schwierigkeiten Gehör verschaffen konnte. Nicht immer waren aber direkte Befehlsgewalt und Durchsetzungsvermögen der richtige Weg. Das hatte Pak Ponto aus der Vergangenheit gelernt und hatte seine eigene gemäßigte Art von Autorität entwickelt.
Die Molukken, eine kleine Inselgruppe weit im östlichen Teil des Archipels, hatte eine besondere Vergangenheit. Daran waren zum großen Teil die Gewürznelken Schuld, denn über den lukrativen Handel um das duftende Gold, stritten sich damals die Kolonialherren immer wieder heftig. Von den Portugiesen christianisiert, von den Engländern verkauft, von den Holländern tyrannisiert und von den Japanern im letzten Krieg besetzt, erklärten sich die geplagten Einheimischen in den fünfziger Jahren für unabhängig und proklamierten ihre eigene Republik der Süd Molukken. Monate später besetzten indonesische Truppen die Inseln, und fortan gehörten sie definitiv zum riesigen Staatsgebilde Indonesien.
Am Tag nachdem in der Moschee Hadjia oben im Dorf Cibuntu ein Protest angezettelt wurde, kam Pak Ponto kurz vor Mittag aufgeregt ins Büro gestürmt.
„Pak Paul, da draußen ist der Teufel los!“
Paul grinste gut gelaunt und sagte: „Komm herein! Die Welt wird schon nicht untergehen.“
Der Mann blieb aber ernst, und jetzt bemerkte Paul auch, dass die Angestellten im Vorzimmer unruhig und mit ernsten Gesichtern miteinander tuschelten.
Pak Ponto schloss die Türe. „Da draußen vor der Einfahrt ist irgendein Aufruhr im Gange. Die Wachmänner haben glücklicherweise die Tore rechtzeitig geschlossen. Der Mob ist vorerst vom Eindringen abgehalten. Die heulen aber bereits ganz gefährlich.“
„Was wollen die denn?“, fragte Paul ungläubig.
„Na ja, ich glaube, das hat mit der Personalabteilung zu tun. Ich glaube, die wollen Arbeit. – Aber sicher bin ich mir nicht.“
„Dann müssen wir sie fragen.“
„Du bleibst hier!“, befahl Ponto bestimmt. „Die sind unberechenbar, und mit einem Ausländer wollen die jetzt bestimmt nicht verhandeln. Wir werden schon noch erfahren, was los ist.“
„Gut“, lenkte Paul ein. „Dann geh’ du, und finde heraus was die wollen!“
Während Pak Ponto davoneilte, spähte Paul durch das vordere Fenster. Er beobachtete, wie der Mann im Pförtnerhaus verschwand. Das Tor war von seiner Position aus nicht sichtbar, und zur Straße hin versperrte eine hohe Mauer den Ausblick. Die Mauerkrone war oben mit scharfen Glasscherben bestückt. Angeblich sollten diese mögliche Einbrecher davon abhalten, nachts einzusteigen. Auch auf dem schweren Eisentor, erinnerte sich Paul, ragten gefährlich wirkende Spitzen in die Höhe. So leicht konnte also keiner hereinkommen. Diese beruhigende Überlegung bekam aber einen bedrohlichen Riss, wenn man bedachte, dass weit hinten, am anderen Ende der Fabrik, das Gelände offen in die Reisfelder überging. Die Arbeiten an der Mauer dort waren im Gange, aber noch lange nicht abgeschlossen. Paul konnte nur hoffen, dass sich die Meute vor dem Tor dieser Situation nicht bewusst war. Es konnte aber genauso gut sein, dass das Ganze dort vorne auf der Straße einfach eine gezielte Demonstration war, ohne die Absicht, in die Firma einzudringen.
Paul klappte das Fenster auf und horchte angestrengt hinaus. Tatsächlich war, neben dem leisen Brummen der Klimaanlage, ein fernes Geschrei auszumachen. Es tönte wenig bedrohlich, doch waren dazwischen unverkennbar auch Rufe und Sprechchöre zu vernehmen. Verstehen konnte Paul überhaupt nichts.
Die Situation schien also im Moment nicht sehr dramatisch. Das konnte sich aber ändern. Um zwei Uhr war Schichtwechsel, und wenn einige hundert Arbeiterinnen herein und hinaus wollten, hatten sie eindeutig ein Problem. Paul schloss das Fenster und ging seine Möglichkeiten durch. Er war als Betriebsleiter nur dem Besitzer persönlich verantwortlich, und da der letztere oft nicht im Betrieb anzutreffen war, war jetzt auch niemand da, der ihm raten konnte. Sollte er kurzerhand Oy Tang Sun anrufen? Konnte der Chinese in dieser Situation wirklich helfen?
Was war denn mit der Rekrutierung der Arbeiter schief gelaufen, so dass die Bevölkerung plötzlich Kopf stand? Ja, natürlich war auch ihm schon zu Ohren gekommen, dass kaum Männer aus den umliegenden Dörfern eingestellt wurden. Das hatte aber seine Gründe. Für den Unterhalt der hoch technischen Maschinen konnte man nun einfach keine Reisbauern einstellen, welche kaum Lesen und Schreiben beherrschten. Es wurden gelernte Mechaniker, Elektriker, Meister und Vorarbeiter gesucht. Außerdem waren für die eigentliche Bedienung der Textilmaschinen von jeher flinke Frauenhände besser geeignet, und Frauen hatte man zu Hunderten eingestellt, auch aus der Region.
Das Problem der fehlenden Facharbeiter hatte Paul früh erkannt und gehandelt. Obwohl der Patron zuerst recht verständnislos reagierte, hatte Paul darauf bestanden, die Ausbildung solcher Kräfte zu fördern. Er hatte eine Lehrwerkstatt eingerichtet und einen Absolventen des Technischen Polytechnikums als Meister verpflichtet. Es war ein mühsamer jedoch erfolgreicher Weg, aber selbst da war eine gewisse Voraussetzung an Schulbildung unerlässlich, was dazu führte, dass selbst diese Lehrlinge kaum im nahen Dorf gefunden wurden. Inzwischen war die Ausbildung ein großer Erfolg, und selbst Oy Tang Sun ließ sich jedes Mal stolz durch die Werkstatt führen und beobachtete die Lehrlinge bei ihrer Arbeit. Ja, es ging sogar so weit, dass Paul selber mehrere Stunden wöchentlich Textilkunde unterrichtete, so dass auch die Frauen zu Vorarbeiterinnen und Laborantinnen befördert werden konnten.
All diese Maßnahmen waren nicht zuletzt auch im Sinne der Behörden, die darauf bestanden, dass ein ausländischer Experte die lokalen Arbeitskräfte auszubilden habe, so dass diese zu einem späteren Zeitpunkt seine Aufgaben übernehmen könnten. Leider scheiterte diese Doktrin meistens daran, dass der so Ausgebildete von anderer Seite rasch eine bessere, höhere Stellung angeboten bekam und die Firma fluchtartig verließ. Diesem Problem konnte man zum Teil mit Beförderungen und höheren Löhnen begegnen, was aber sofort wieder zu sozialen Ungerechtigkeiten führte. Erneut war die arme Landbevölkerung diskriminiert, und die sowieso schon kargen Einkommen der einfachen Arbeiterschaft wurden noch weniger verstanden. Diese Löhne waren in Indonesien so tief, dass auch Paul sie mit Unbehagen zur Kenntnis nahm. Er versuchte sein Bestes, drängte auf bessere Bedingungen, immer mit dem Argument, bessere Leistungen und Qualität rechtfertigten in jedem Fall eine bessere Entlohnung. Damit rannte er natürlich gehen die Politik der Personalabteilung an, die sich strikte an die üblichen Normen halten wollte. Es war ein Teufelskreis, eine Gratwanderung, welche eigentlich kaum zu gewinnen war.
Mit solchen Gedanken im Kopf, hieß Paul seine Sekretärin unverzüglich Mr. Liem zu rufen. Der Mann, ein Chinese, war inoffiziell der Chef der Personalabteilung. Inoffiziell deshalb, weil ein Chinese in Indonesien diese Position nie und nimmer innehaben konnte. Personalangelegenheiten konnten ausschließlich durch reinrassige Indonesier, auch “Pribumi“ genannt, erfolgreich bewältigt werden. Diese Person war bei PT. Indosun Pak Arjono, ein liebenswürdiger Mensch aus Yogyakarta. Dieser verhandelte auch mit viel Fingerspitzengefühl mit Arbeitern, Angestellten, Beamten und Gewerkschaftern. Er nahm für die Belegschaft so etwas wie eine Vaterrolle ein und genoss hohes Ansehen. Die eigentlichen Richtlinien aber, kamen ausschließlich von Liem, einem verarmten Verwandten des Besitzers Oy Tang Sun. Mit Liem musste Paul jetzt also sprechen.
Paul begrüßte den Eintretenden freundlich und deutete auf den freien Stuhl: „Guten Tag Pak Liem. Haben Sie gehört, was da draußen los ist?“
„Natürlich“, antwortete Liem und ließ sich nieder. „Eine Demonstration, ein richtiger Aufstand…“
„Langsam, langsam“, beruhigte Paul. „Wir wollen doch nicht gleich einen ausgewachsenen Krieg herbeireden, wegen ein paar Unzufriedenen.“
„Ein paar…! Es sind Hunderte und es werden immer mehr.“
Tatsächlich hörte man das Geschrei nun auch durch die geschlossenen Fenster. Paul verstand den Chinesen gut. Ihnen saßen die Erinnerungen an die früheren Pogrome nur allzu sehr in den Knochen, und wenn man ehrlich war, auch in ihm stieg ein leicht mulmiges Gefühl auf. Ob Chinese oder Weißer, da würde der Mob wohl keinen großen Unterschied machen.
„Also, ich denke wir sollten zuerst einmal Mr. Oy…“
„Ach, das habe ich bereits getan“, fuhr Liem dazwischen. „Er ist sehr besorgt und rät uns eindringlich, uns da ja nicht einzumischen.“
Paul war nicht überrascht. Dieser Draht zum Chef war ihm völlig bewusst. Eine solche Rückversicherung würde wohl jeder chinesische Geschäftsmann einrichten. Die Ermahnung war eigentlich überflüssig, denn auch ihm war klar, dass sie, mit einem unbedachten Auftritt, nur Öl ins Feuer gießen würden. Es war einfach die Frage, was jetzt helfen konnte. Da draußen waren hunderte von aufgebrachten Männern, und in einer guten Stunde war Schichtwechsel.
„Ich denke wir sollten Pak Arjono zum Pförtnerhaus schicken“, überlegte Paul. „Vielleicht kann er seine Landsleute zu Vernunft bringen.“
„Von wegen Landsleute!“, knurrte Liem. „Das sind aufgebrachte Sundanesen, da draußen, und Arjono kommt aus Zentraljava…“
In diesem Moment kam Ponto zurück. Als er Liem erblickte, zögerte er und schüttelte unmerklich den Kopf. Dann sagte er aber: „Pak Paul, vermutlich ist alles nur halb so wild.“
Paul verstand und wandte sich an Liem: „Bitte finden Sie heraus, was Pak Arjono meint. Vielleicht kann er doch vermitteln.“
Sobald Liem die Türe hinter sich zugezogen hatte, wurde Ponto ernst. „Hoffentlich hat der keine Dummheit gemacht“, brummte er. „Der hat sicher schon herumtelefoniert und alle aufgescheucht.“
„Na ja, Mr. Oy weiß inzwischen Bescheid“, meinte Paul. „Da draußen scheint wirklich der Teufel los. Wenn die wollen, stürmen sie das Tor.“
„So schnell geht das nicht“, beruhigte Ponto. „Ich habe die Wachmannschaft verstärkt, und das hohe Tor hält einiges aus.“
Jetzt grinste Paul erleichtert. Er wusste ganz genau was Ponto meinte. Der hatte seit langem einige seiner Landsleute aus Ambon in seine Mannschaft aufgenommen. Willige Leute, hatte Paul bald festgestellt, aber das wilde Aussehen der großen starken Männer flößte Respekt ein. Die standen jetzt da vorne am Eingang und würden wohl einige der Aufgebrachten zur Raison bringen.
„Gut“, überlegte Paul sofort wieder ernst. „Wie soll aber der Schichtwechsel vonstattengehen. Da kommt doch wirklich niemand durch. – Könnte man vielleicht alles um ein paar Stunden verschieben? Ist das der Frühschicht zuzumuten, länger auszuharren? Und die Hereinkommenden…?“
„Sind kaum ein Problem, denn die wissen längst was los ist“, meinte Pak Ponto lakonisch. „Außerdem werden sie ja auch nicht abgeholt.“
Das stimmte. Die Busse, welche entlang der Hauptachse die Arbeiter einsammelten, konnten ja auch nicht losfahren. Die Frauen der Abendschicht würden somit überhaupt nicht eintreffen.
Während sie weiter berieten, ertönte plötzlich ein anderes Geräusch. Motoren brummten heran und heulten auf. Die Menge schrie und protestierte laut. Die Bürotür schlug auf.
Pak Adang stand im Rahmen und grinste. „Na also! In zehn Minuten ist der Spuk vorbei.“
Paul erfuhr erst viel später, was sich dort draußen wirklich abgespielt hatte. Es begann damit, dass der angesehene Industrielle Oy Tang Sun mit General Suprajokjono öfters Golf spielte. Als Oy von der Demonstration vor seiner Fabrik erfuhr, genügte ein Telefonanruf, um die Dienste der Armee zu mobilisieren. Eine Kolonne Infanterie auf Lastwagen, begleitet von einem leichten Schützenpanzer, wurde losgeschickt und traf innert kürzester Zeit am Ort des Geschehens ein. Nachdem der Tross mitten auf der Straße zu Halt gekommen war, sprangen Dutzende Soldaten von den Laderampen und gingen ohne Zaudern mit Gewehrkolben auf die aufheulende Meute los. Die Vernünftigsten ergriffen sofort die Flucht. Wer Pech hatte, wurde ergriffen und landete unter rohen Flüchen und brutalen Griffen auf einem Lastwagen.
Eine teuflische, hoffnungslose Situation, erklärte Pak Adang später. Wer einmal in die Hände des Militärs geriet, der hatte ausgelacht und wurde für lange Zeit nicht mehr gesehen.
Innerhalb weniger Minuten war die Demonstration aufgelöst, und nur der zurückbleibende, hin und her patrouillierende Schützenpanzer verriet, dass hier kurz vorher verzweifelte Menschen um eine faire Überlebenschance gestritten hatten.
Die Busse der PT. Indosun fuhren aus und kamen mit den frischen Arbeiterinnen zurück. Der Schichtwechsel funktionierte, wie wenn nichts gewesen wäre. Müde Frauen saßen mit stumpfen Gesichtern zur Heimfahrt bereit. Nicht einmal die hellgrüne Uniform konnte davon ablenken, dass sie einer Herde willenloser Kreaturen glichen.
Nachdem vor dem Tor wieder Ruhe eingekehrt war, gingen die langen Diskussionen los. Auch Oy Tang Sun war am Apparat und meinte beruhigend: „Keine Bange Mr. Paul, wir sind sicher. General Suprajokjono hat mir versprochen, die nächsten Wochen ein Auge auf die Aufrührer zu haben. Sonst haben Sie in der Fabrik ja alles im Griff. Ich fahre morgen für ein paar Tage nach Jakarta, geschäftlich.“
Liem kam mit nervösen Ratschlägen, ja nicht alleine unterwegs zu sein und auch die Familienangehörigen zu warnen, ja vorsichtig zu sein. Diese Leute seinen unberechenbar, und der kleinste Anlass könnte das Feuer wieder auflodern lassen.
Man kann auch übertreiben, dachte Paul. Viel wichtiger war ihm später das Gespräch mit Pak Ponto. Er bestätigte im Prinzip die Vermutungen, dass die Männer aus dem nahen Dorf unzufrieden waren und endlich Arbeit wollten. Ponto wusste aber auch, dass ihnen vom Dorfältesten, dem Pak Lurah, völlig falsche Aussichten vorgegaukelt wurden, und dass es am Abend zuvor in der Moschee zu einer hitzigen Diskussion gekommen war. Dieser Lurah war tatsächlich ein Gauner und hatte Millionen von Rupien kassiert. Er schröpfte die Leute gleich zwei Mal. Zuerst strich er die saftige Kommission für die Landverkäufe ein, und dann ließ er sich auch für die Vermittlung von Arbeitsstellen bezahlen. Viele der Reisbauern, welche kaum schreiben und lesen konnten, waren ihm dabei wehrlos ausgeliefert. Dieser Halunke nahm seine eigenen Landsleute schamlos aus. – Da war aber noch eine Frage. Zu solchen undurchsichtigen Geschäften gehörten immer zwei. Welche Gelder bei den Landkäufen flossen, wusste wohl einzig Oy Tang Sun. Für den Chinesen war so etwas wohl völlig normal. Vermutlich machten da auch noch einige andere die hohle Hand. Viel schlimmer war die Sache mit den Arbeitsstellen. Irgendjemand in der Personalabteilung musste da mitmachen, denn wäre dem nicht so, könnten sich die Arbeitswilligen doch einfach hier im Büro melden, und der Umweg über einen Pak Lurah wäre überflüssig. – Pak Arjono vielleicht? Paul konnte sich das kaum vorstellen. Der väterlich wirkende stille Mann schien über einem solchen Verdacht erhaben. Trotzdem, konnte sich Paul wirklich ein Urteil erlauben? Die asiatische Gesellschaft war in dieser Hinsicht unglaublich kompliziert und undurchsichtig. Es war für einen Europäer praktisch unmöglich, sich in deren Gedankenwelt einzufühlen. Paul machte sich nichts vor, selbst Rini und deren Familie war für ihn manches Mal ein Buch mit sieben Siegeln.
KAPITEL 4
„Indosun Textiles; Selamat Pagi“, flötete Miss Henrietta in den Hörer. Darauf folgten einige sundanesische Sätze.
Paul konnte das ankommende Telefonat durch die offene Tür deutlich hören, kümmerte sich aber weiter nicht darum. Er saß in seinem Büro am einfachen Schreibtisch und hatte gerade die Pläne für die Klimaanlage der neuen Spinnerei vor sich ausgebreitet. Der Besuch des Lieferanten stand bevor, und er wollte ganz genau wissen, wie die Anlage einmal funktionieren würde. Paul ließ meistens die Türe offen, um nicht derart abgeschnitten zu sein und damit seine Sekretärin nebenan weitere Aufgaben übernehmen konnte. Seit den ungemütlichen Ereignissen der Arbeiterdemonstration waren zwei Wochen vergangen, und längst war wieder Normalität eingekehrt.
„Mr. Paul!“, rief nun aber Henrietta und spähte durch die Tür. „Ibu ist am Apparat. Auf Linie zwei bitte.“
„Danke!“ antwortete Paul mechanisch und drückte auf den entsprechenden Knopf. „Hallo meine Liebe!“ Dann bemerkte er schmunzelnd, dass seine Sekretärin tatsächlich das Wort ’Ibu’ benützt hatte, welches hier nur für eine verheiratete Frau und Mutter gedacht war. Informationen schienen auch in diesem Land schnelle Beine zu haben.
„Paul, ich habe schlechte Nachrichten“, sagte Rini am anderen Ende leise auf Englisch. Sie hatten sich angewöhnt, diese Fremdsprache zu benützen, welche hier kaum jemand richtig verstand.
„Paul, hörst du mich? René hatte einen Unfall. Er ist schwer verletzt.“
„Wer?“ Dann dämmerte ihm wen sie meinte. „Du meinst René? Der hatte einen Unfall? – Wieso? Was ist passiert?“
„Ich weiß auch nichts Genaueres. Tati hat eben angerufen. Sie ist im Krankenhaus und völlig aufgelöst. – Er muss letzte Nacht mit dem Auto verunfallt sein.“
„Letzte Nacht? – Was, gestern, am Sonntag? Er sollte heute doch bei uns sein, eine Carde muss neu beschlagen werden. Wir brauchen diese unbedingt.“
Dann merkte er, wie unmöglich er klang. „Oh, Entschuldigung! Ist es sehr schlimm?“