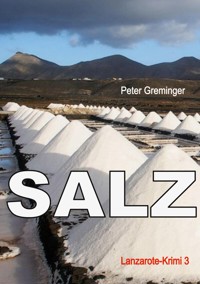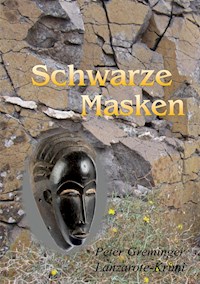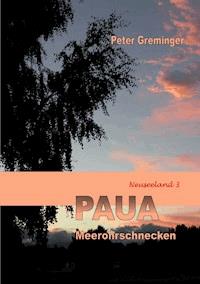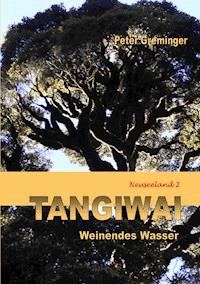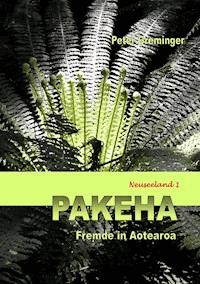Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unerwartete Nachricht aus dem fernen Neuseeland schreckt die junge Frau auf. Die Welt öffnet sich. Ja, warum soll sie zu Hause verkümmern? Drei Wochen später ist Tamara auf dem Weg nach einem neuen, wenig bekannten Teil dieser Erde, nach Neuseeland. Nach Monaten auf der Flucht vor einem rätselhaften Mord und auf den Spuren des geheimnisvollen Greenstones, erreicht Tamara die raue Westküste der Südinsel. Mitten im steinigen Bett eines ausgetrockneten Flusses stößt sie unverhofft auf einen einsamen Mann. Die Begegnung verändert ihre ganze Haltung gegenüber Mensch und Natur. Die Schöpfung wird zum Kunstwerk, hart, glatt und matt glänzend, wie aus grünem Stein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Die Faszination über das Land am anderen Ende der Welt hat den Autor nach wie vor nicht losgelassen. Dies ist der vierte Roman über Neuseeland, nach PAKEHA (Fremde in Aotearoa), TANGIWAI (Weinendes Wasser) und PAUA (Meerohrschnecken).
Peter Greminger verbrachte den größten Teil seines Lebens im südostasiatischen Raum, wo er verschiedene Textilbetriebe leitete. Neuseeland lernte er aber erst im frühen Ruhestand kennen. Seine Frau brachte eine erwachsene Tochter, welche nach Neuseeland ausgewandert war, mit in die Ehe, ein Grund genug, sich in das interessante Land der Kiwis zu verlieben. Während langen Aufenthalten auf der Nord- wie auf der Südinsel entstanden dann seine Werke.
Peter Greminger
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
(Genesis 6,37)
Für meine Enkelkinder
Inhaltsverzeichnis
Sechs Wochen zuvor...
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Sechs Wochen zuvor...
Keiner hatte auch nur die leiseste Ahnung. Die Firma BuyBites hatte vom einen auf den anderen Tag Pleite gemacht.
Tamara Paganini saß völlig allein in ihrem großen Büro, an einem modernen Schreibtisch aus Glas und hellem Eschenholz. Sie tippte die liegen gebliebenen Rechnungen in das Formular auf dem Bildschirm. Sie arbeitete verbissen. Immer öfter flatterten die Fakturen lange verspätet auf ihren Tisch, sollten dann aber noch am selben Tag gedruckt und verschickt werden. Das Klingeln des Telefons auf dem Tisch gegenüber ignorierte sie. Sollten die Kerle doch selber sehen, dass sie erreichbar waren. Sie, die einzige Frau im Betrieb, schien die Ausnahme zu sein, die sich an so etwas wie eine geregelte Arbeitszeit zu halten hatte.
BuyBites hatte sich im Silver-Tower auf der dritten Etage eingemietet. Das runde Gebäude war mit drei Jahren kaum älter als die junge Firma selbst. Es lag an der Zürcherstraße, ein zehnstöckiges Glasgebäude nach modernster Architektur und das neue Wahrzeichen der kleinen Ostschweizer Stadt. George, Fred und Jonathan hatten BuyBites kurz nach dem Ende ihres Studiums gemeinsam gegründet. George Malevic war der Chef. Er bestand aber darauf, dass man sich in so einem jungen, dynamischen Unternehmen beim Vornamen nannte und ein kollegiales, ungezwungenes Arbeitsverhältnis pflegte. Es war durchaus normal, dass die Herren, so wie an diesem Tag, erst spät erschienen oder ihre Arbeit überhaupt zu Hause erledigten. Oft waren sie tagelang nur über das Handy zu erreichen.
Tamara blickte über die verlassenen Monitore hinweg. Drüben, auf dem Tisch an der Wand, war ein Gerät in seine Bestandteile zerlegt. Dort arbeitete Herman, der Techniker, aber auch er war heute abwesend. Das erstaunte Tamara nun doch, denn Herman war sonst zuverlässig und auch anwesend. Außerdem hatte er ihr versprochen, dass sie heute zusammen zum Mittagessen ins nahe Café Florian, auf der anderen Straßenseite, gehen würden. Es war bereits nach elf Uhr. Wenn er nicht bald auftauchte ...
Durch die Glastür erschien aber nicht ihr Freund, sondern George, der Chef. Sofort fiel Tamara dessen Kleidung auf. Der dunkle Anzug und die dezente Krawatte waren so ungewöhnlich, dass sie ihn ungläubig anstarrte. Während er direkt auf sie zukam, verzog er keine Miene. Unmittelbar vor ihrem Pult blieb er zögernd stehen. „Morgen Tam!“
„Guten Morgen George“, antwortete Tamara abwartend.
Er, der sonst wie ein Wasserfall reden konnte, fand nur schwer Worte. „Tam, du machst wirklich alles großartig. ... Wir sind dir sehr zu Dank verpflichtet.“
„Oh, wieso? ... Diese Rechnungen sind gleich fertig.“
„Ach was, die Rechnungen. Nein, es geht nicht darum.“
„Ja?“
„Hör Tam, wir müssen schließen. Ich muss dir leider kündigen“, murmelte er. „Das bekommst du natürlich noch schriftlich.“
„Was!“
„Du hast schon richtig gehört. Wir müssen zumachen. Bitte räume auf. Du brauchst morgen nicht mehr zur Arbeit zu kommen. Das restliche Gehalt erhältst du wie üblich überwiesen.“
„Aber wieso? ... Was ist mit den anderen?“
„Wir haben Konkurs angemeldet. Die Firma wird aufgelöst.“
„Und Herman?“
„Der weiß schon Bescheid. Soviel ich weiß, bewirbt er sich heute um eine neue Stellung.“
Ungläubig starrte ihn Tamara an. „Ach, und ich erfahre es als Letzte. Ich steh also einfach auf der Straße.“
„Du findest bestimmt bald wieder etwas.“
„So, denkst du!“
„Klar.“
„Bleibt mir wohl nichts anderes übrig ...“
„Uns ja auch, Tam. Der Auftrag für Eurotrans ging an die deutsche Konkurrenz. Sie arbeiten eng mit IBM zusammen. Man hat uns einfach ausgebootet. Sie haben uns nicht einmal richtig angehört. Dabei ist unsere Entwicklung geradezu revolutionär. Aber die Großen, die tun einander nicht weh, die halten zusammen.“
Ja, vielleicht habt ihr auch den Boden der Realität verlassen, dachte Tamara im Stillen. Und jetzt muss ich ...
Am selben Abend stand Herman vor der Tür. Tamara war noch immer völlig verwirrt und tigerte seit Stunden durch ihre kleine Wohnung. Sie kam sich vor wie der Spielball von ein paar Taugenichtsen, welche sich auf ein gewagtes Abenteuer eingelassen hatten, dieses aber sofort abbrachen, sobald es brenzlig wurde. Verflucht, jawohl, auf ihre Kosten. Aber sie ärgerte sich auch über sich selbst. Sie hatte tatsächlich blauäugig geglaubt, bei einer großen Sache mit dabei zu sein. Das Ganze war von Anfang an eine riesige Seifenblase gewesen, und jetzt war sie eben geplatzt.
Herman! Was zum Teufel glaubte der? Er stand im Eingang, wie wenn nichts gewesen wäre, und versuchte sie zu küssen.
Wutentbrannt entzog sie sich ihm. „Du, du bist keinen Dreck besser als die ganze Bande“, keifte sie. „Hast genau gewusst, was los war.“
„Bitte Tam, lass mich doch erst einmal herein.“
„Ach, hau doch ab! Mit euresgleichen will ich nichts mehr zu tun haben ...“
Herman drückte die Tür hinter sich zu und versuchte es erneut: „Aber ich hab doch damit nichts zu tun. Auch ich habe meine Stellung verloren. Hast du das vergessen?“
„Du hast es längst gewusst. Aber auf mich blöde Ziege brauchte man ja keine Rücksicht zu nehmen. Warum hast du mir nichts gesagt?“
„Nun komm schon! Ich wusste auch erst seit Mittwoch wirklich Bescheid. Und sei doch einmal ehrlich, auch dir müsste doch längst aufgefallen sein, dass da aus der großen Sache nichts werden konnte. Aus ein paar halbfertigen Programmen, großen Worten und viel heißer Luft kann einfach nichts werden.“
„Schon ...“, antwortete Tamara verzweifelt und ließ sich auf das Sofa sinken. „Was soll ich denn jetzt tun?“
„Dasselbe wie ich, eine neue Arbeit suchen.“
Herman setzte sich vorsichtig auf die Kante und blickte bekümmert auf die zusammengesunkene Gestalt. Tamara war wirklich etwas überempfindlich, ja manchmal richtig zickig. So lief das heutzutage nun einmal einfach. Man musste etwas riskieren. Wenn's ein Hit wurde, war man aus dem Schneider. Wenn nicht, probierte man halt etwas anderes. Was soll's? – Nur gut, dass sie nicht wusste, dass auch er mit zehn Riesen bei BuyBites eingestiegen war. Ob er von dem Geld je wieder einmal etwas sehen würde, das stand in den Sternen. George meinte zwar, die Einrichtung würde bei der Liquidation einiges einbringen. Aber er selbst war sich da nicht so sicher. Bei dem heutigen Tempo mit welchem die Geräte veralteten, waren die paar Computer wohl nicht mehr viel wert. Einzig den High Resolution Printer für Großformate, den wollte er im Auge behalten. Mit dem könnte er vielleicht sogar selber anfangen und Werbematerial drucken. Mit der richtigen Software wäre das ein Kinderspiel und Werbung, das war immer gefragt.
Herman hatte aber in diesem Moment ganz andere Gedanken. Es war Freitagabend. Normalerweise traf man sich im StarLight. Da gab's coolen Sound und die Drinks waren nicht zu teuer. Tamara war meistens dabei, aber heute? Sollte er mit so einer Heulsuse aufkreuzen? Es gab dort zwar jede Menge Mädchen, aber er hatte heute absolut keine Lust, sich abzumühen und dann auch noch zu riskieren, allein ins Bett zu steigen.
Deshalb versuchte er es: „Tam, Schatz, lass doch die blöde Arbeit. War ja sowieso nichts Gescheites. Komm, wir machen uns einen flotten Abend. Ich lad dich zu einer Pizza ein.“
Nach einigem Zögern raffte sich Tamara auf, und der Abend wurde ganz nett. Als dann Herman am späten Samstagvormittag verschwunden war, wuchsen die Sorgen bei Tamara aber wieder. Nach einer ausgiebigen Dusche und dem zweiten Glas Orangensaft fühlte sie sich etwas besser. Sie schaltete die Musikanlage ein und lauschte dem vollen Klang der rhythmischen Töne. Bang & Olufsen war teuer, aber kaum zu überbieten. Das neue DVD-Gerät, das musste sie jetzt wohl zuerst einmal vergessen. Ohne Lohn würde sie sich einiges nicht mehr leisten können.
Sie betrachtete sich im großen Spiegel neben der Garderobe. Ach was, sie war jung, schlank und hübsch. Sie beugte sich vor. Nein, keine Schatten um die Augen. Die blauen Augen waren klar und die Wimpern selbst ohne Tusche lang und verführerisch. Die Haarfarbe fand sie etwas langweilig. Aber das natürliche Dunkelblond konnte man etwas heller tönen, und eine modisch rötliche Strähne, sagte Conny, die Friseuse, war immer ein guter Blickfang. Um ihr Aussehen brauchte sie sich wirklich keine Sorgen zu machen.
Nein, es hatte keinen Zweck dem Vergangenen nachzutrauern. Diesen schalen Nachgeschmack musste sie einfach loswerden. Sie war sich nicht einmal sicher, ob nicht auch Herman zu diesen unbefriedigenden, abgestandenen Erinnerungen gehörte. Sie war eine selbstbewusste, moderne junge Frau, die Zukunft lag ihr zu Füßen. Ja, sie sollte einfach ganz neu beginnen.
Mit diesem Vorsatz begab sich Tamara gleich am Montag auf Stellensuche. Etwas beklommen meldete sie sich bei der regionalen Arbeitsvermittlung. Sie bekam viele gute Ratschläge, ja man bot ihr sogar einen Umschulungskurs an. Sie schrieb Bewerbungen, telefonierte, blätterte täglich durch die Zeitungen und wagte einige persönliche Vorsprachen. Absagen flatterten ins Haus, mit schön formulierten Worten oder kurzem negativem Bescheid. Namhafte Firmen fanden die Arbeitssuchende nicht einmal das Papier einer Antwort wert und ließen nichts von sich hören. Der Frust stieg in Tamara hoch, wie eine herangleitende Würgeschlange, langsam, stetig und tödlich. Ihren Eltern hatte sie erklärt, dass sie gute Aussichten auf eine wichtige Stellung in der Verwaltung einer Großbank habe. So gut wie sicher, behauptete sie, nur um nicht zugeben zu müssen, dass sie vom Arbeitslosengeld lebte.
Die Firma BuyBites gehörte längst der Vergangenheit an. Die Gläubiger waren mit wertlosen Verlustscheinen entschädigt worden und George Malevic, der Verantwortliche, war spurlos verschwunden. Herman ergatterte tatsächlich die Druckmaschine und produzierte jetzt eifrig Plakate. Er fuhr bereits wieder ein neues Auto. Tamara traf ihn gelegentlich am Wochenende, aber ihre Beziehung hatte sich auf ein Minimum reduziert.
An einem trüben Freitagabend Ende November saß Tamara etwas verlassen auf dem Hocker im StarLight, umgeben von der laut dröhnenden Musik und dem gelegentlich aufwallenden Gelächter der Gäste. Herman schäkerte offen mit einer Gruppe junger Frauen am anderen Ende der Bar. Gelangweilt nippte Tamara an ihrem Fruchtsaft. Er schmeckte sauer und kaum nach frischen Orangen. Sie überlegte angewidert, ob sie nicht einfach nach Hause gehen sollte und spielte gedankenverloren mit dem Handy.
Plötzlich gewahrte sie das kleine Signet eines Briefleins in der unteren Ecke des Displays. Eine neu hereingekommene Meldung, überlegte sie und drückte automatisch auf die Taste. Eine völlig unbekannte Nummer. Lesen? ... O.K.!
„hi, tam“, stand da in einheitlichen Kleinbuchstaben. „vergiss deine regula in nz nicht! tim ist abgehauen! der schuft! was soll ich hier allein? kommst du?“
Es dauerte eine ganz Weile, bis das Entzifferte in Tamaras Kopf einen Sinn ergab. Es war noch nicht lange her, dass Regula, Hals über Kopf und schwer verliebt, ihrem Tim nach Neuseeland gefolgt war. Tamara hatte die Freundin heimlich um das unverhoffte Glück beneidet. Soviel sie wusste, besaßen Tims Eltern eine große Farm, dort, auf der anderen Seite der Welt. Ihrem einzigen Sohn hatten sie ein Studium in der Schweiz ermöglicht. Er stand damals kurz vor seinem Abschluss, irgendetwas in der Hotel- oder Tourismusbranche, da lernte er Regula kennen. Von allen beglückwünscht waren die beiden nach einer rauschenden Abschiedsfeier abgereist. Die Heirat sollte in der neuen Heimat stattfinden, wo Tim später ein eigenes Landgasthaus, eine sogenannte ,Lodge', eröffnen wollte.
Aus Tims Schilderungen hatte Tamara mitbekommen, dass dieses Land auf der anderen Seite der Erde einzigartig sei und ihnen außergewöhnliche Möglichkeiten in einem aufblühenden Tourismus bieten konnte. Die unendliche Weite und Freiheit, verbunden mit einer unverdorbenen Natur, musste einfach gigantisch sein. Tamara stellte sich bildlich vor, wie Regula als Herrin eines großen Landhauses über Gäste und Dienstboten regierte und sogar eigene Pferde zum Ausreiten auf der Koppel hatte.
Die erhaltene Meldung klang aber ganz anders. Sollte Regulas Traum tatsächlich schon nach kurzer Zeit in die Brüche gegangen sein? Warum kam sie dann nicht einfach nach Hause? Die Kerle waren doch auf der ganzen Welt gleich. Sie schwafelten von großer Liebe und meinten damit einzig einen schnellen Sprung ins Bett.
Dann machte sich ein weiterer Gedanke breit und fraß sich langsam, aber unermüdlich, in Tamaras Kopf. Ja, warum sollte sie die Gelegenheit dieser Einladung nicht beim Schopf packen und selber sehen, was es mit den Naturwundern Neuseeland auf sich hatte? Die meisten ihrer Bekannten trampten monatelang durch fremde Länder und hatten abenteuerliche Weltreisen hinter sich. Sobald sie es sich leisten konnten, warfen sie ihren Job bedenkenlos über Bord und zogen los. Was hielt sie denn hier zurück?
Tamara blickte durch die in den Strahlen der Spots wogenden Rauchschleier auf die lärmende Gesellschaft gegenüber. Schrilles Gelächter und wogende Körper vermischten sich mit dem Dröhnen der Bässe aus den schwarzen Monstern von Lautsprechern. Die Frauen um Herman boten ungeniert viel nackte Haut und freche Piercings. Zwei Typen, vor Gläsern mit Bacardi und Cola, blickten immer öfter in ihre Richtung. Es war nur eine Frage des Alkoholkonsums, bis sie sich an sie heranmachen würden.
Während Tamara ihr Handy im Täschchen verschwinden ließ, schüttelte sie geradezu der krasse Gegensatz zu der heilen, ländlichen Idylle, welche Regulas Nachricht in ihr heraufbeschworen hatte. Er war so grotesk, dass sie ein Auflachen nur schwer unterdrücken konnte. Ja, warum eigentlich nicht? Das konnte der ganz neue Anfang werden. Zumindest würde sie den notwendigen Abstand zu dieser scheiß Gesellschaft hier erlangen.
Herman merkte nicht einmal, dass sie bezahlte, dem Ausgang zustrebte und verschwand.
KAPITEL 1
Sichtlich verlegen umarmte Regula ihre Freundin und versicherte mit einem nicht enden wollenden Redeschwall, dass sie trotz allem herzlich willkommen sei.
Als Tamara nämlich durch die Glastür des Flughafens von Auckland trat, entdeckte sie die beiden Wartenden sofort und es war klar, dass von einer Trennung keine Rede sein konnte. Tim stand etwas linkisch neben seiner Freundin und grinste der Ankommenden entgegen. Während er sich um den schweren Rucksack bemühte, überhäufte sie Regula mit vielen Erklärungen, dass Tim und sie nun doch zusammen bleiben würden und die Hochzeit schon geplant sei. Sie, Tamara, sollte natürlich ihre erste Brautjungfer werden. Wie sie sich doch alle freuten, dass Tamara die weite Reise angetreten habe. Einfach super!
Vom Empfang überwältigt, standen auch Tamara die Tränen in den Augen. Das lange Warten im engen Flugzeugsitz und die nagenden Zweifel, ob sie das Richtige getan hatte und diese Reise nicht einfach voreilig unternommen hatte, waren jetzt zu Ende.
Glücklich umarmte sie ihre Freundin erneut und flüsterte: „Regi, wie ich mich freue. ... Nun ist alles gut.“
Die ganze Welt schien wieder in Ordnung. Sie war dem verkorksten, hoffnungslosen Leben einer unbarmherzigen Leistungsgesellschaft entronnen, und ihre Freundin hatte ihr verloren geglaubtes Liebesglück wieder gefunden. Tamara fühlte sich wie neugeboren. Ihre Sinne waren berauscht und bereit für alles Neue. Was würde dieses verheißene Land alles bieten? Sie blickte deshalb, wenig später, immer wieder in die vorbeiziehende unbekannte Gegend hinaus, während Tims Wagen seinen Weg durch die Vororte von Auckland suchte.
Auf dem Hintersitz plapperte Regula mit rot glühenden Backen ununterbrochen. Sie erzählte von ihren Plänen und von der Farm, auf der sie vorübergehend lebten. Tims Eltern seien einfach super. Es wären bescheidene Leute, die sich nicht vor vieler Arbeit scheuten. Der Hof sei gewaltig, mit einer Herde von fast dreihundert Kühen, kaum vorstellbar. Dann waren da etwa tausend Schafe, drei Pferde, zwei Hunde, eine Schar Hühner und ein paar Katzen. Tim hätte zu Hause eigentlich eine voll ausgelastete Arbeitsstelle. Aber er wollte unbedingt seinen Traum mit der Lodge verwirklichen. Diese lag an der Bay of Plenty, musste aber zuerst noch ein wenig umgebaut werden. Natürlich würden sie in den nächsten paar Tagen gleich dort hinaus fahren, so dass Tamara mit eigenen Augen sehen würde, was für ein traumhaft schöner Flecken Erde sie einmal ihr ,Zuhause' nennen würden. In der Zwischenzeit konnten sie bei seinen Eltern wohnen. Tim wollte aber so bald als möglich sein eigener Herr und Meister sein und nicht weiter Zäune flicken, Kälbern auf die Welt helfen oder Schafe entwurmen.
Tamara lachte hell auf. Es war kaum zu glauben, aus der etwas zimperlichen Regi, die kaum einer Fliege etwas antun konnte, war eine richtige Bäuerin geworden.
Unterdessen hatten sie die Autobahn nach Süden erreicht. Anfänglich irritierte Tamara der ungewohnte Linksverkehr, aber man war in einem Land des Commonwealth, und da fuhr man links. Tim lenkte den Wagen völlig entspannt, wenn er auch für Tamaras Empfinden etwas zu schnell fuhr. Eine flache, eher schmucklose Landschaft huschte vorbei.
Eine halbe Stunde später erreichten sie das südliche Ende des Motorways. Noch wusste Tamara nicht, dass sie damit schon fast das ganze Autobahnnetz des Landes gesehen hatte. Die gleiche vierspurige Straße führte in entgegengesetzter, nördlicher Richtung durch Auckland, über die berühmte Harbour Bridge und von dort ein paar Kilometer weiter. Der Rest des weiten Landes war danach nur noch durch normale Haupt- oder schmale Nebenstraßen erschlossen. Von den vielen ungeteerten Schotterpisten ahnte Tamara einstweilen noch nichts.
Die Fahrt zog sich dahin. Es wurde Abend, und Tamaras Sinne ermatteten. Links und rechts lag ausgedehntes Weideland. In der Ferne erkannte man ein paar sanfte Hügel. Noch knapp eine Stunde, beruhigte Regula ihre Freundin. Sie würden die Stadt Hamilton umfahren, und noch bevor sie den Ort mit dem typisch englischen Namen Cambridge erreichten, würden sie einige Ks weiter östlich ihr Ziel, die Farm, erreichen. Ein K, das sei ein Kilometer, erläuterte sie auf Tamaras verständnislosen Blick. In Neuseeland würden laufend solche Abkürzungen gebraucht. Man gewöhne sich bald daran.
Zwar hatte Tamara während der Schulzeit fleißig Englisch gelernt, aber gleich bei ihrer Ankunft musste sie feststellen, dass sie kaum ein Wort verstand. Ja, lachte Regula, auch daran würde sie sich gewöhnen. Man sprach hier einfach schnell und etwas schluderig, aber die Leute würden sich sofort jede nur erdenkliche Mühe geben, wenn sie bemerkten, dass man sie nicht verstand. Man war hier Fremden gegenüber sehr offen.
Diese Aussage stimmte. Tims Eltern, sie hießen Eileen und Brian, nahmen Tamara auf wie eine Tochter. Es dauerte kaum zwei Wochen, bis Tam, alle nannten sie jetzt Tam, praktisch zur Familie gehörte.
Die Größe des landwirtschaftlichen Betriebes erstaunte Tamara immer wieder. So weit das Auge reichte, nichts als Weiden. Es war praktisch unmöglich, die Melford-Station zu Fuß zu erkunden. Aus diesem Grund setzte Brian seinen Gast schon am zweiten Tag auf eines jener vierräderigen Fahrzeuge, die wie plumpe Motorräder aussehen. Anfänglich schaukelte Tamara vorsichtig entlang der Wege, aber bald brauste auch sie übermütig querfeldein. Die Hunde jagten mit, umrundeten die Schafe oder erschreckten die friedlich grasenden Kühe. Anfänglich wollte Tamara diesen Spaß mit ihrer Freundin teilen, aber diese winkte ab.
„Ich möchte fürs Leben gerne“, sagte Regula errötend. „Aber ich darf wirklich nicht ...“
Jetzt verstand Tamara und lachte: „Ach du meine Güte! Regi, du bist schwanger!“
Diese nickte mit niedergeschlagenen Augen. „Tim ist da sehr eigenwillig. Nein, ich darf wirklich nicht.“
„Aber natürlich! ... Du freust dich doch? Meine Liebe, das ist wirklich toll. Wann ...?“
„Ich glaube im September. Es muss gleich bei seiner Rückkehr passiert sein.“
„Liebe Regi, ich freue mich für dich“, begeisterte sich Tamara.
Dann fuhr sie fort: „Warum war er denn überhaupt weg?“
„Wer?“
„Dein Tim natürlich.“ Tamara wurde unsicher. Was ging sie das überhaupt an?
Auch Regula zögerte. „Ich weiß nicht genau. Er sagte etwas wäre mit der Lodge gewesen.“
Die Lodge. Entgegen ihrer Versprechungen waren sie auch nach drei Wochen noch nicht dorthin gefahren ...
Tamara wollte nicht aufdringlich werden und enthielt sich weiterer Fragen. Sicher war auf der Farm so viel Arbeit zu bewältigen, dass zurzeit einfach kein Ausflug möglich war. Brian und auch seine Frau verließen das Haus meist in aller Früh hemdsärmelig und in Stiefeln. Sie arbeiteten irgendwo draußen bei den Herden, auf den Weiden oder unter den knorrigen Bäumen am Rande des Baches. Das Mittagessen fiel praktisch aus. Jeder kam schnell zum Haus und holte sich etwas aus dem Kühlschrank. Nur abends, wenn alle anderen schon todmüde waren, stand Eileen in der Küche und richtete eine kräftige Mahlzeit.
Tim war oft den ganzen Tag verschwunden. Meist fuhr er mit dem alten Toyota weg und tauchte erst nach Stunden wieder auf. Reparaturen, Besorgungen, Einkäufe von Dünger und Futtermittel schienen ihn zu beschäftigen. Als Tim einmal sogar über Nacht wegblieb, schien sich niemand in der Familie große Sorgen zu machen. Er sei wohl aufgehalten worden. Vielleicht war die Straße unterbrochen oder der alte Klapperwagen hatte seinen Geist aufgegeben. Tim würde sich schon zu helfen wissen.
Als Tamara ihrer Freundin verstohlen in die Augen blickte, zuckte diese nur unwissend die Schultern und verschwand allein im Schlafzimmer. Scheinbar war so etwas nichts Ungewöhnliches, und als Tim am nächsten Nachmittag mit einer riesigen Packung Schokoladeneis in den Händen wieder auftauchte, wurde er mit großem Hallo empfangen und alle freuten sich an den gewaltigen Portionen der Schleckerei.
So verging der Januar und Tamara hatte sich an das naturverbundene ländliche Leben gewöhnt. Staub, Fliegen und glühende Sonne gehörten einfach dazu. Von etwas Schmutz war noch niemand gestorben, und gegen die Sonne, die in diesen Breiten erbarmungslos durch das Ozonloch brannte, trug man einfach einen anständigen Hut.
Tamara machte sich nützlich, wo immer sie konnte. Dennoch kreisten ihre Gedanken immer öfter um die Frage, was eigentlich werden sollte. Einerseits war da die geplante Hochzeit, von der kaum je gesprochen wurde. Andererseits hatte sie sich vorgenommen, dieses Land näher kennenzulernen. Wollte sie eine Reise, vielleicht sogar bis zur Südinsel, unternehmen, durfte sie nicht bis in den Winter hinein warten. Mittlerweile hatte sie mitbekommen, dass in diesem Land viele Touristen mit dem Wohnmobil unterwegs waren. Das war aber keine billige Sache. Das konnte sie sich schlicht und einfach nicht leisten, auch wenn sie der Gedanke noch so lockte. Unabhängig durch die weiten Gegenden zu fahren und wo immer sie wollte anzuhalten und zu bleiben, das würde wohl ein unerfüllter Traum bleiben.
Als sie sich endlich aufraffte und Brian auf ihre Gedanken ansprach, lachte dieser sorglos. „Ich kenn' da genau den richtigen Mann für so ein Problem.“ Er packte das angebissene Mittagsbrot und winkte Tamara energisch, ihm zu folgen.
„Aber das kann doch warten!“ rief Tamara überrumpelt.
„Ach was! Komm schon! Es ist nicht weit. Morton hat genau das Richtige für dich. Komm, steig ein!“
,Nicht weit' war eine Autofahrt von knapp einer Stunde.
Während Tamara sich in den Sitz drückte, sagte sie kläglich: „Ich will ja nicht gleich wegrennen. Regulas Hochzeit ist doch viel wichtiger.“
„Weiß nicht“, brummte Brian.
„Wieso?“
„Ich weiß nicht, was bei denen zuerst kommen soll, die Hochzeit oder das Baby. Früher war das klar, aber heutzutage ...“
„Ich dachte ...“
Brian unterbrach sie: „Ach was, mach du doch einfach einmal deine Reise. Bis du zurück bist, wissen die beiden vielleicht was sie wollen.“
Es stimmte schon, Regula schien zwischen wechselnder Hoch- und Tiefstimmung zu schwanken. Anfänglich hatte Tamara diesen Zustand Regulas Schwangerschaft zugeschrieben. Dass aber die Hochzeit immer weniger erwähnt wurde, gab wirklich zu denken.
Für den Rest der Fahrt versank Tamara in nachdenkliches Schweigen. Brian schaltete die Gänge noch ein wenig rücksichtsloser. Wenig später bremste er mit einem Ruck vor einer Werkstatt kurz hinter Morrinsville, in einem kleinen Ort mit unaussprechlichem Namen.
Brian führte seinen Gast zwischen alten Autowracks hindurch zu einem Blechschuppen. Im Inneren werkte ein Mann im schwarzen, ölverschmierten Overall. Es war, wie sich herausstellte, Morton, der Inhaber, ein alter Bekannter von Brian.
„Morton, du alter Gauner“, begrüßte ihn Brian. „Bei dir steht doch immer noch der graue Kleinbus hinter dem Haus. Es wird langsam Zeit, dass du den aus dem Weg hast. Mach einen fairen Preis für diese Dame hier.“
Tamara, völlig überrumpelt, stammelte: „Moment, ich kann doch nicht einfach ...“
„Tam, du brauchst ein Fortbewegungsmittel. Der Volkswagen ist genau das Richtige für dich. Wir entfernen die hinteren Sitze und schon hast du dein eigenes Hotelzimmer. So reist es sich in unserem Land am bequemsten.“
Morton wischte sich mit einem Lappen über seine Glatze. „Nun lass die Lady doch auch zu Wort kommen. – Naja, für einen Tausender würde ich ihn hergeben, weil du's bist, Brian.“
Tamara schnappte nach Luft. Ein Auto für eintausend Neuseeland-Dollar. Das waren ja nur etwa achthundert Franken. Unmöglich, für das bekam man doch nur noch eine Schrottkiste. Wo stand das Ding überhaupt.
„Kann man das Gefährt denn sehen?“
„Natürlich, meine Liebe“, ereiferte sich Morton. „Gleich um die Ecke, kommen Sie!“
Tatsächlich, da stand ein Volkswagen-Kleinbus neben einem rostigen Haufen aus Blech und altem Eisen. Die graue Farbe war völlig matt und zerkratzt. Nun gut, mit der Farbe fährt ein Auto ja nicht. Durch die schmutzigen Scheiben sah Tamara wenig einladende zerlöcherte Sitze.
Morton schwang sich hinter das Steuer und drehte den Schlüssel. Sofort sprang der Motor an. Der Mann strahlte übers ganze Gesicht. „Sag ich's doch. Diese Volkswagen sind nicht zu killen. Dieser schafft problemlos nochmals hunderttausend Kilometer. – Eigentlich ist ein Tausender viel zu wenig.“
Tamara umrundete das Vehikel. Naja, vier Räder, Lampen und Scheibenwischer waren vorhanden. Sofort schaltete Morton die Wischer ein. Ratternd fuhren sie über die trockene Scheibe.
„Ist alles geprüft und erst letzte Woche abgenommen“, meinte er.
„WOF, die technische Inspektion und Registratur, sind vorhanden.
Sie können den Wagen mitnehmen.“
„Ich muss zuerst das Geld ...“, begann Tamara.
„Überhaupt kein Problem. Sie kommen einfach später vorbei. Ich hol nur schnell die Papiere.“
Zehn Minuten später war Tamara Besitzerin eines eigenen Wagens. Ja konnte sie das graue Ungetüm überhaupt fahren? Ach was, Auto war Auto. Mit zitternden Knien kletterte sie auf den Fahrersitz. Oh weh, alles war verkehrt. Würde sie die Gänge mit der linken Hand überhaupt finden? Draußen schauten ihr die Männer grinsend zu. Auf die Kupplung, Gang einlegen, Gas geben und langsam loslassen. Gelernt war gelernt. Fahrschulmäßig holperte Tamara davon. Na also, es ging. Schon war Brian mit seinem Toyota vorbei und brauste davon. Tamara hinten nach, ... immer schön auf der linken Straßenseite.
Das graue Monster stand bereits seit einer Woche im Hof, als Tamara eines Morgens Regula zusammengesunken am Frühstückstisch antraf. Der wirre Haarschopf und die roten Augen sprachen Bände.
„Regi, was ist nur passiert“, murmelte Tamara erschrocken und rückte auf die Bank neben die Freundin.
Von einer Schwangerschaft war noch immer nichts zu bemerken, außer vielleicht der gelegentlichen Brechreize, welche die junge Frau manchmal unverhofft zur Toilette trieben. Regula war jung und kräftig, und ein Kind war doch ihr größter Wunsch. Heute saß sie aber da wie ein Häufchen Elend.
„Regi“, begann Tamara erneut und legte den Arm um ihre Schulter.
„Kann ich dir helfen? Es kann doch nicht so schlimm sein.“
Die junge Frau schluchzte auf und schüttelte unmerklich den Kopf. Ihre Schultern zuckten, aber sie schwieg.
Tamara blickte unsicher auf die verkrampften Hände und über den Tisch. Alles schien wie immer. Die anderen Hausbewohner waren längst draußen, irgendwo an der Arbeit. Hier im Inneren herrschte, bis auf das leise Brummen des Kühlschrankes, Totenstille. Waren das vielleicht Depressionen einer Frau, welche ein Kind erwartete? Wie sollte Tamara das wissen. Ja, hatte Regula vielleicht Streit mit Tim?
„Tim ...“, schluchzte Regula, nur um erneut von Krämpfen geschüttelt zu werden.
Also doch! „Was ist mit Tim?“
Keine Antwort.
„Regula! So hör doch endlich auf! Wo ist Tim?“
Ja, wo war der Mann? Jetzt erinnerte sich Tamara. Sie hatte ihn seit vorgestern nicht mehr gesehen. Das war an und für sich nicht ungewöhnlich, ging und kam der Sohn des Hauses doch meist, ohne dass man wusste, wo er war und was er tat. So lange war er allerdings noch nie weggeblieben.
Deshalb fragte Tamara nochmals: „Regula, antworte! Wo ist Tim?“
„W...weg ...“
Als nichts weiter kam, stand Tamara auf und holte die Kanne mit Kaffee von der Anrichte. Sie schenkte zwei Mugs voll und schob einen energisch über den Tisch.
„So, jetzt trink erst einmal und dann erzählst du, was passiert ist!
Wieso ist Tim weg?“
„Wie ... wie das letzte Mal. ... Er ist einfach weg.“
„Seit wann?“
„Vor zwei Tagen.“
„Hat er gesagt wohin er fährt?“
„Nein ...“
„Nein?“
„Er sagt nie, wohin er geht.“
Das war oft so. Aber zwei Tage einfach verschwinden, das war keineswegs die feine Art.
„Er wird schon wieder kommen“, tröstete Tamara. – „Hattet ihr vielleicht Streit?“
„Nicht direkt.“
„Aber?“
„Ich hab wegen der Hochzeit gefragt ...“
„Klar ...und?“
„Er hat mich angeschrien und gesagt, ich solle nicht dauernd drängen.“ Endlich hob Regula den Kopf und fuhr etwas gefasster fort: „Ich dachte, die Hochzeit würde bald stattfinden. Ich freute mich so darauf, und das Baby sollte doch in eine intakte Familie hinein geboren werden.“
„Das hat doch noch Zeit.“
„Ja schon, aber er will sich nicht festlegen. Jetzt im Sommer sei nicht die richtige Zeit, meint er. Er hätte Wichtigeres zu tun.“
„Und dann ist er weg?“
„Ja, er hat ein paar Sachen eingepackt und die Türe hinter sich zugeschlagen.“
„Ach was“, beruhigte Tamara. „Der kommt schon wieder. Musst einfach etwas Geduld haben. Viele Männer bekommen schreckliche Panik, wenn's daran geht, ihre Freiheit zu verlieren. Du wirst schon sehen, der kommt mit hängenden Ohren zurück und bittet dich um Verzeihung.“
Tamara wusste selber nicht, woher sie diese Weisheit und Zuversicht nur nahm. Sie hatte doch keine Ahnung. Ihre eigenen Beziehungen lagen weit zurück und waren schon gar nicht ein Muster von Treue und Dauerhaftigkeit gewesen. Wie kam sie darauf, Tim wäre da besser und würde Regula auf den Händen tragen? Trotzdem, ihre Freundin erwartete ein Kind und das gab der Geschichte doch eine ganz andere Dimension.
„Hast du denn eine Ahnung, wohin er gefahren ist?“ versuchte Tamara zu ergründen.
„Vielleicht ... die Lodge.“
Tamara stutzte. Die Lodge, das Gästehaus, von dem anfänglich so geschwärmt wurde, es war kaum mehr erwähnt worden. So war auch keine Rede mehr davon, dass man mit ihr dorthin fahren wolle und ihr den wundervollen Flecken Erde an der Bay of Plenty zeigen wolle. Gab es da vielleicht Schwierigkeiten, die Tim jetzt zu meistern versuchte?
„Lass uns doch noch einen Tag warten. Er kommt bestimmt wieder“, versuchte Tamara ihre Freundin zu beruhigen. „Wenn er nicht auftaucht, können wir immer noch hinfahren.“
Regula nickte ergeben und verschwand kurz darauf im Bad.
Auch die Eltern schienen nicht so richtig zu wissen, was vom Verschwinden ihres Sohnes zu halten war. Dennoch waren sie nicht eigentlich beunruhigt. So etwas war in diesem Land nicht ungewöhnlich. Es konnte vielerlei Gründe haben, warum jemand aufgehalten wurde. Tim, ihr Sohn, war ein erwachsener Mann und würde sich schon zu helfen wissen.
Was für Gründe ihn denn dort bei der Lodge vielleicht aufgehalten hätten, wollte Tamara am Abend wissen, als sie zu dritt um den großen Tisch saßen. Regula war bereits zu Bett gegangen.
„Das ist schwer zu sagen“, antwortete Brian. „Es ist ein weiter Weg zum Te Kaha Point, wo die Lodge liegt.“
„Glauben Sie, dass etwas mit dem Auto passiert ist?“, mutmaßte Tamara.
„Kaum. Der Toyota ist ein ausgezeichnetes Fahrzeug und ein platter Reifen war für Tim noch nie ein Problem.“
„Eine unvorhergesehene Reparatur an der Lodge vielleicht?“
„Hm... wer weiß! Als ich das letzte Mal dort war, sah das Ganze schon etwas baufällig aus“, bestätigte Tims Vater.
„Baufällig, nennst du das!“, ereiferte sich Eileen. „Es ist eine Bruchbude, von der die Maori nur die Wände übrig gelassen haben. ... Baufällig, dass ich nicht lache!“
„Nun sei doch nicht so abwertend!“, brummte Brian. „Klar, mit dem Haus ist nicht viel los, aber das Grundstück liegt an ausgezeichneter Lage und ist auch groß genug.“
„Ich kann einfach nicht verstehen, was Tim sich in den Kopf gesetzt hat. Wieso sollen Touristen dort hinaus zum East Cape kommen, wo doch die Maori dauernd Probleme machen? Du selber rätst doch jedem ab, um die Halbinsel zu fahren.“
„Nun mach nicht alles mies, Frau! Erstens liegt Te Kaha nicht draußen am East Cape und zweitens sind nicht alle Maori gleich Kriminelle.“
Tamara, welche der Diskussion erstaunt folgte, stellte die Frage, die sie schon seit Beginn beschäftigte: „Die Maori, die Ureinwohner, sind sie denn noch so wild und gefährlich?“
Brian lachte schallend. „Meine Liebe, keine Angst, wir sind hier nicht im ,Wilden Westen'. Neuseelands Ureinwohner, wie du sie nennst, sind längst keine Wilde mehr. Ganz im Gegenteil, sie sind gleichwertige Bürger dieses Landes und genießen sogar einige Privilegien. Dann darf man nicht vergessen, sie sind auch keine eigentlichen Ureinwohner. Sie sind einfach ein paar hundert Jahre früher eingewandert als wir, das ist alles.“
„Ach, das wusste ich nicht. Woher kamen sie denn?“
„Aus Polynesien heißt es. Zwar gibt es keine Beweise, aber ihre Überlieferungen berichten davon, wenn auch nur als Legenden.“
„Interessant!“, ereiferte sich Tamara. „Sie haben sicher eine reiche Tradition und Kultur.“
„Sie sind faul, lügen und stehlen“, fuhr Eileen dazwischen. „Und Frauen sind vor ihnen nicht sicher. Man sollte sich nicht mit ihnen einlassen.“
„Hör endlich auf!“, knurrte Brian. „Nur wegen ein paar Taugenichtsen ist doch nicht ein ganzes Volk schlecht.“
Tamara dachte an ihren Volkswagen, den sie inzwischen liebevoll ,Hausi' nannte. „Kann man denn hier unbedenklich reisen?“
„Aber natürlich, meine Liebe“, entgegnete Brian. „Neuseeland ist einer der sichersten Orte dieser Welt.“
Tamara schwieg. In Gedanken hatte sie bereits ihre geplante ausgedehnte Erkundungsreise durch die Nord- und Südinsel in Gefahr gesehen. Die Maori waren bis jetzt ein Faktor gewesen, den sie völlig übersehen hatte. Eine gewisse Vorsicht schien aber angebracht, auch wenn Brian meinte, es wäre absolut ungefährlich und die Maori seien harmlos. War es aber nicht auf der ganzen Erde das Gleiche? Es gab immer irgendwo Bösewichte zwischen all den Guten. Eine hundertprozentige Sicherheitsgarantie gab es nirgends.
Mit diesem Wissen im Kopf und einer gehörigen Portion Abenteuerlust ermunterte Tamara am nächsten Tag ihre Freundin Regula, dass sie zusammen zur Bay of Plenty fahren und selber erkunden sollten, was es mit Tim und dieser Lodge auf sich hatte.
KAPITEL 2
Die Bay of Plenty erstreckt sich über mehr als zweihundert Kilometer zwischen der Coromandel-Halbinsel und dem riesigen East Cape. Der westliche Teil, von Waihi Beach über Mount Maunganui bis Whakatane, ist ein Eldorado für meist einheimische Touristen. Während der Woche waren die Straßen aber, so wie eigentlich in ganz Neuseeland, wenig befahren.
Tamara folgte gemächlich der Küste in östlicher Richtung. Die beliebten Strände lagen längst hinter ihr, und der alte Volkswagen brummte dem Städtchen Opotiki entgegen. Nach der Straßenkarte, welche auf dem Sitz neben ihr lag, zweigte dort eine letzte einsame Route nach Süden ab und führte quer über die Halbinsel nach Gisborne. Sicher war es eine einsame, stundenlange Route, welche durch die Raukumara Berge führt. Tamara fuhr aber durch die wenigen Häuser des kleinen Ortes und nahm die schmale, kurvenreiche Straße, welche immer weiter der großen Bay of Plenty folgte.
Kurz nach ihrer Abfahrt von der Melford-Station hatte Tamara bedauernd festgestellt, dass das eingebaute Autoradio nicht funktionierte. Bald aber begrüßte sie die nur vom monotonen Brummen des Motors begleitete, ungestörte Fahrt. Seit Stunden überlegte sie, ob sie nicht besser umkehren sollte. War die Entscheidung, alleine zu fahren, nicht doch voreilig gewesen. Regula hatte über Beschwerden und Unwohlsein geklagt und sich außerstande gefühlt, die lange Reise anzutreten. Vermutlich war sie aber einfach in einem mentalen Tief, so dass sie sich mitleiderregend im Bett verkroch. Tamara verstand das nicht. Wäre ihr Mann verschwunden, würde sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um herauszufinden was los ist. Regula weigerte sich aber schlichtweg, mitzukommen. Fürchtete sie vielleicht, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen? War Tim doch nicht so ein Götter-Mann, wie es den Anschein hatte?
Den Ausschlag für ihre Alleinfahrt hatte aber einmal mehr Brian, Regulas geduldiger Schwiegervater in spe, gegeben. Tamara könne damit das Praktische mit dem Nützlichen verbinden, meinte er energisch. Sie könne sich, bevor sie auf ihre große Reise ginge, an den Kleinbus gewöhnen und gleichzeitig nachsehen, wie es um die Lodge stehe. Diese sei leicht zu finden, ein einzelnes Haus auf einer kleinen Anhöhe, dreizehn Kilometer außerhalb von Te Kaha. Sollte sie das Haus verfehlen, könnte sie immer noch auf der Poststelle im Ort nach der Taonga Lodge fragen. Sollte sie Tim dort treffen, wäre alles in bester Ordnung, und Tamara könnte sie zu Hause telefonisch benachrichtigen. Mit seinem Sohn würde er dann allerdings nachträglich noch ein paar ernste Worte wechseln müssen.
Nach einigem Zögern hatte sie eingewilligt. Schon vor Tagen hatte Brian die unnötigen Hintersitze aus dem Volkswagen entfernt. Eileen organisierte eine alte Matratze und eine Decke. Oben drauf kamen Kissen und Tamaras Schlafsack. Obwohl sie das etwas sonderlich fand, bestand Brian darauf, dass sie einen Reservekanister Benzin und einige Flaschen Wasser ins Auto legte. Weiter ausgerüstet mit einer Straßenkarte, ihrer Tasche mit Zahnbürste und T-Shirts sowie einer Packung Biskuits war sie am nächsten Morgen zeitig losgefahren. Regula hatte sie schlafen lassen, aber Brian und Eileen standen im Hof und winkten ihr nach.
Es war früher Nachmittag und Tamara war bereits seit sechs Stunden unterwegs. In Whakatane hatte sie in einem kleinen Laden ein Sandwich und Mineralwasser erstanden. Sie machte sich keine Sorgen, abends würde sie in einem Restaurant essen und dann einen ruhigen Ort für die Nacht suchen. Das Land lag friedlich und etwas einsam vor ihr.
Ein paar flüchtige Augenblicke hatte sie braune Menschen, Maori, gesehen. Außer ihrer Hautfarbe und der schwarzen Haare schienen sie sich aber kaum von den weißen Einwohnern zu unterscheiden. Auch die Siedlungen glichen sich. Die meist einfachen Holzhäuser ließen kaum Schlüsse über ihre Bewohner zu. Vielleicht waren die etwas abseits der Straße gelegenen Bauten ein wenig ärmlicher und verrieten dadurch die Behausungen der Maori. Tamara war sich nicht sicher. Manchmal sah sie eine Schar fröhlicher Kinder. Es kam ihr auf jeden Fall jetzt völlig lächerlich vor, von gefährlichen Wilden zu reden.
Die gewundene enge Straße zog sich dahin. Die Küste lag fast immer in unmittelbarer Nähe. Diese war hier etwas rauer, felsiger geworden, und war gesäumt von knorrigen Bäumen mit roten Blüten, manchmal einfach von dichtem Gestrüpp. Dahinter breitete sich das tiefblaue Meer aus. Der Wind wehte herüber und verlieh der Oberfläche des Wassers glitzerndes Leben und geheimnisvolle Kraft. Gelegentlich war das leichte Brausen der Brandung durch das offene Wagenfenster zu hören, wie eine leise Erinnerung an die Unendlichkeit der Elemente.
Seit einer halben Stunde war Tamara keinem Auto mehr begegnet. Beruhigt horchte sie auf das gleichmäßige Brummen des Motors. Ihr ,Hausi' schien zuverlässig und war leichter zu steuern, als sie zuerst gedacht hatte. Die Straße war schmal, aber in gutem Zustand. Tamara schätzte, dass sie in etwa einer Stunde ihr Ziel erreichen würde.
Te Kaha war eine Ansammlung weniger Häuser. Ein Fahrweg führte von der Straße zu der Mauer einer kleinen Anlegestelle. Unmittelbar gegenüber befand sich ein einfaches, mit einem Blechdach versehenes Gebäude. Es entpuppte sich als Laden, Tankstelle, Postbüro und Hafenmeisterei, alles in einem. Gleich daneben, fast höher als das Haus, stand ein Boot auf einem Trailer. Zwei Männer verharrten dort und beobachteten interessiert, wie Tamara ihr Gefährt nebenan abstellte.
Als Tamara mit steifen Beinen aus dem Wagen kletterte, bemerkte sie, dass einer der beiden Männer ein Maori war. Der Wind schlug ihr weit heftiger entgegen, als sie im Inneren des Autos vermutet hatte. Lachend kämpfte sie um ihre Frisur, ging aber mutig auf die beiden Männer zu.
„Ich bin auf der Suche nach der Taonga Lodge“, rief Tamara gegen den Wind. „Wissen Sie vielleicht wo das ist?“
Während der Maori ihr schweigend entgegenstarrte, grinste der bärtige Weiße und sagte: „Lady, was wollen Sie denn dort draußen? Klar, wir wissen genau, wo die Taonga Lodge liegt.“
„Ist es weit?“
„Nein, ist es eigentlich nicht.“
Im Gegensatz zum Maori trug der Mann eine kurze Hose, Gummistiefel und ein einfaches T-Shirt. Der Maori war etwa gleich groß, trug aber lange schwarze Beinbekleidung und ein kariertes Hemd. Seine schwarzen Augen fixierten Tamara fragend.
Es war wieder der Weiße, der fortfuhr: „Mein Name ist Thomson ... Charles nennt man mich und das hier ist Joe. Ich würde Sie gerne hinfahren, aber ich kann hier nicht weg.“
„Nein, nein“, wehrte sich Tamara. „Sagen Sie mir einfach, wo es langgeht. Soviel ich weiß, noch weiter geradeaus.“
Nun meldete sich der Maori. „Ich werde Sie hinbringen“, sagte er klar und deutlich.
„Sie ...?“
Charles lachte. „Ja, warum nicht. Er beißt nicht, meine Liebe. Joe ist mein bester Freund und völlig harmlos.“
„Oh! Entschuldigen Sie. Ich wollte nicht ...“
„Schon gut, Madam“, versicherte der Maori höflich. „Ich werde Sie begleiten, natürlich nur wenn Sie wollen.“
„Wenn Sie meinen ...“
Nachdem sich Tamara im kleinen Laden mit ein paar Lebensmitteln für die Weiterreise versorgt hatte, kletterte sie mit einem dumpfen Gefühl auf den Fahrersitz neben den geduldig wartenden Joe. Automatisch lenkte sie das Fahrzeug zurück auf die Straße und fuhr in östlicher Richtung weiter. Sie dachte an ihre Mutter zu Hause, die bei dem Gedanken, ihre Tochter könnte einen Anhalter mitnehmen, schreckliche Ängste bekam. Dass diese jetzt sogar einen ,Wilden' neben sich im Auto sitzen hatte, würde sie vermutlich nahe an den Herztod bringen.
Verstohlen blickte Tamara zur Seite. Der Maori saß regungslos da und blickte geradeaus. Es war ein stolzes Profil, wenn die stumpfe Nase diesen Eindruck auch etwas milderte. Seine schwarzen struppigen Haare waren kurz geschnitten. Ein Bartwuchs fehlte oder er war glatt rasiert. Diesen letzten Eindruck bestätigte der leichte Geruch nach Toilettenwasser.
Sie hatten bereits eine Viertelstunde schweigende Fahrt hinter sich, und Tamara fragte sich besorgt, ob sie nicht einen riesigen Fehler begangen hatte, als Joe plötzlich nach links deutete.
„Dort hinauf!“ sagte er.
Tamara bremste und blickte prüfend in die angegebene Richtung.
Ein steiniger Fahrweg führte eine kleine Anhöhe hinauf. Sie war mit dichtem Gestrüpp bewachsen und verdeckte die Sicht auf das Meer. Tamara schaltete in den ersten Gang und steuerte den Wagen vorsichtig den Hang hinauf. Dass hier ein Gasthaus, eine Lodge sein sollte, konnte sie sich mit bestem Willen kaum vorstellen. Da war nichts, außer dem Rattern des gequälten Motors. Würde sie dort oben überhaupt wenden können?
Als sie die Kuppe erreichten, öffnete sich plötzlich die Sicht auf das Meer. Tamara bremste abrupt und hielt überwältigt an. Es war, wie wenn der Vorhang über einem neuen großartigen Bühnenbild aufgegangen wäre. Unmittelbar vor ihnen über der Küste stand ein großes weißes Haus inmitten einer verwilderten Anlage. Der Hügel war auf dieser Seite frei von Gestrüpp, bis zu den Klippen sanft abfallend und mit Gras bewachsen. Das Meer schimmerte dahinter in allen Blau- und Grüntönen. Knorrige Bäume mit feuerroten Blüten und Riesenfarne mit herrlichen hellgrünen Fächern verdeckten teilweise die felsigen Klippen und den darunter liegenden Strand.
Tamara entdeckte weit draußen eine kleine Insel. Wie ein weißer Schleier schwebte Dunst darüber.
„White Island“, flüsterte der Maori, wie in großer Ehrfurcht.
„Weiße Insel?“, wiederholte Tamara fragend.
„Ja, der aktivste Vulkan Neuseelands.“
„Ein Vulkan? Diese kleine Insel?“
„Das täuscht, sie liegt fünfzig Kilometer weit draußen“, erklärte Joe. „Man kann sie nur bei gutem Wetter sehen.“
„Diese Aussicht ist einmalig, einfach gigantisch“, rief Tamara überwältigt.
„Ja“, bestätigte Joe. „Es ist ein heiliger Ort. Wir verehren ihn seit Jahrhunderten.“
Inzwischen hatte Tamara den Toyota entdeckt. Er stand verlassen neben dem Fahrweg. Erleichterung überkam sie. Tim war also in der Nähe, vermutlich im Haus dort drüben. Sie hatte die Taonga Lodge gefunden.
Dankbar wandte sie sich Joe zu und sagte: „Das ist es also. Joe, ich bin Ihnen sehr dankbar.“
Der Maori starrte aber mit finsterem Gesicht geradeaus. Komische, undurchsichtige Gesellen, diese Maori, dachte Tamara verwirrt. Dann legte sie aber wieder den Gang ein und rumpelte zum Haus hinunter.
Aus einem Schuppen neben dem Haus tauchte eine Gestalt auf. Es war Tim in kurzer Hose und schmutzigem Leibchen. Sofort fiel ihr die Schrotflinte in seinen Händen auf.
„Tamara!“, rief er von weitem. „Was tust du denn hier?“
Er wartete aber keine Antwort ab, sondern packte das Gewehr energischer und knurrte drohend: „Was will dieser Kerl hier? – Verschwinde, aber schleunigst!“
Joe war aus dem Wagen geklettert und stand regungslos da. Seine Augen waren unbeweglich und eiskalt.
„Was soll das, Tim?“, stammelte Tamara. „Joe war so nett, mir den Weg zu zeigen. Bist du verrückt geworden, uns mit dem Gewehr zu empfangen?“
„Halt dich da raus, Tamara! Der Kerl soll verschwinden. Wird's bald!“
In Tamara kroch die Wut hoch. „Was erlaubst du dir eigentlich!“, schrie sie. „Bist du von Sinnen? Ich werde diesen Herrn jetzt zurückfahren und mir überlegen, ob ich überhaupt wieder herkommen soll. Es ist kaum zu glauben, aber scheinbar habe ich mich gewaltig in dir getäuscht. So kannst du nicht mit uns umspringen.“
„Du verstehst überhaupt nichts!“, brüllte Tim zurück. „Was weißt du schon über dieses Gesindel?“
„Das Einzige was ich hier erkennen kann, ist, dass du dich scheußlich benimmst.“ Damit wandte sie sich an den Maori. „Kommen
Sie, Joe, wir verschwinden. Hier stinkt's!“
Joe war die ganze Zeit bewegungslos neben dem Volkswagen gestanden. Jetzt drehte er sich dem Meer zu und senkte den Kopf und sagte leise: „Unsere Ahnen werden dir nie verzeihen, Pakeha. Deine Gebeine werden nie an diesem heiligen Ort ruhen, denn du missachtest unsere Tapus und verhöhnst unsere Götter.“
Tim hob drohend das Gewehr. „Verschwinde endlich von meinem Land! ... Soll ich dir Beine machen?“
Tamara hatte den Motor bereits laufen, als Joe endlich einstieg und die Türe zuzog. Sie stieß zurück, rammte geräuschvoll den ersten Gang ein und rumpelte rücksichtslos, eine riesige Staubfahne hinter sich lassend, den Hügel hinunter. Erst als sie wieder auf der Straße war, beruhigte sie sich etwas. Das Erlebte war derart außergewöhnlich, dass sie schweigend, aber wütend, den Kopf schüttelte.
„Es tut mir leid“, brummte der Maori neben ihr. „Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte nicht dort hinauf mitkommen dürfen.“
„Verdammt, wir haben doch nichts Unrechtes getan!“
„Nein, natürlich nicht“, bestätigte Joe. „Sie haben sich nichts vorzuwerfen.“
„Sie vielleicht? ... So ein Unsinn!“
„Es gibt da schon Probleme, aber das braucht Sie nicht zu kümmern.“
„Was für Probleme?“
„Ach, lassen wir das. – Wohin wollen Sie überhaupt?“
„Ich, ... ich weiß nicht, ... ich dachte an ein Restaurant, ein Hotel.“
„Ein Hotel!“ Jetzt grinste der Mann amüsiert. „Da müssten Sie schon bis nach Opotiki zurückfahren. Hier draußen gibt es so etwas nicht.“
„Sie meinen, hier kann man nicht übernachten? Nach dem eben Erlebten möchte ich nicht am Straßenrand im Auto schlafen.“
„Das würde ich auch nicht empfehlen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Sie könnten's bei Richard und Dorothea versuchen. Die offerieren Bed & Breakfast zu vernünftigen Preisen.“
„Klar, warum nicht“, überlegte Tamara, jetzt plötzlich müde. „Ist das weit von hier?“
„Nein“, antwortete Joe, „aber Sie müssen umkehren.“
Tamara wendete. Da erinnerte sie sich: „Aber ich muss Sie doch zurück zum Dorf bringen. “
„Keineswegs, Miss ...“
„Oh, entschuldigen Sie. Ich habe mich nicht einmal vorgestellt. Ich bin Tamara Paganini und komme aus der Schweiz.“
„Ach, Sie gehören nicht zu den Melfords.“
„Sie kennen Brian und Eileen?“
„Hm ...“, machte Joe und deutete zu einer Einfahrt, welche hundert Meter hinunter zu einem kleinen Strand führte. Sie waren inzwischen einige Kilometer weiter östlich gefahren und hatten die Taonga Lodge ein gutes Stück hinter sich gelassen.
Unten, unweit vom Strand stand ein einsames Haus in einem Meer voller Blumen. Tamara hielt vor einem weiß gestrichenen Lattenzaun und stellte den Motor ab. Staunend betrachtete sie das prachtvolle Bild, das niedrige Haus mit der weiten Veranda. Leuchtend rote Rosen kletterten am Geländer hoch. Geranien standen, Büschen gleich, mit riesigen Blüten in den Beeten um das Gebäude. Quer über dem gepflegten Rasen leuchteten Blumen, deren Namen Tamara nicht einmal erahnen konnte. Die vorherrschende Farbe war Rot. Sogar die Bäume unweit vom Strand leuchteten in tiefstem Purpur. Später erfuhr Tamara, dass es sich dabei um Pohutukawa-Bäume handelte, deren Blütenpracht sich in den Monaten Dezember und Januar voll entfaltet, was ihnen auch den Namen Weihnachtsbäume' einbrachte.
Das ungewohnte Dröhnen des Volkswagens schien die Bewohner des Hauses aufgescheucht zu haben, denn auf dem Deck erschienen zwei Personen. Ihre Gesichter hellten sich auf, als sie Joe erkannten. „Joe“, rief die Frau freudig. „Schön, dich zu sehen.“
Auch der Mann schüttelte dem Maori die Hand und verlangte lautstark zu wissen, warum er sich denn so lange nicht habe blicken lassen.
„Ich hatte viel zu tun“, verteidigte sich Joe, dessen Gesicht auf einmal fröhlich strahlte. „Eigentlich bringe ich euch nur schnell einen Gast.“
Jetzt wandte sich Dorothea der Angekommenen zu. „Ach du meine Güte! Entschuldigen Sie! Ich nehme an, Sie suchen ein Zimmer für die Nacht, meine Liebe.“
„Das ist Tamara, aus der Schweiz“, erklärte Joe. „Sie hat mich im Dorf um Hilfe gebeten und ich dachte, bei euch ist sie gut aufgehoben.“
„Aber natürlich! Herzlich Willkommen, Tamara! Das ist mein Mann Richard, mein Name ist Dorothea. – Richard, sei doch so gut und kümmere dich um das Gepäck! Und du Joe, komm herein, ich mach uns allen eine schöne Tasse Tee.“
Tamara, die bis dahin etwas sprachlos dagestanden hatte, gab sich einen Ruck und stammelte mit gebrochenem Englisch: „Ach bitte, da ist nicht viel Gepäck. Ich brauche auch nur ein kleines Zimmer. Ich wusste ja nicht, wie einsam diese Gegend ist.“
Die etwas größere Frau umfasste Tamaras Schultern und führte diese die zwei Stufen zum Deck hinauf. „Keine Sorge, meine Liebe, Sie bekommen ein schönes Zimmer, ein Frühstück und wenn Sie es wünschen auch ein kräftiges Abendessen. Wir hier in Neuseeland lassen doch niemanden auf der Straße stehen. Sie sind uns herzlich willkommen.“
Wenig später saßen sie alle in bequemen Korbsesseln auf dem Deck und tranken den köstlichen Tee. Dorothea bot selbstgebackene Muffins an. Die Konversation plätscherte träge dahin. Die Schweiz, das sei doch ein wunderschönes Land, begeisterte sich Dorothea. Ja, man sei einmal auf einer Europareise in die Schweiz gekommen. Sie hätten in einer Stadt an einem See haltgemacht. Viel Kultur gäbe es da, prächtige Gebäude und herrliche Geschäfte.
Das könnte Luzern gewesen sein, mutmaßte Tamara. – Ja, natürlich, genau das war der Ort. Man sei aber gleich weitergefahren, nach Italien. Aber Switzerland, das müsse man einfach gesehen haben.
Tamara unterdrückte eine Bemerkung, dass es hier doch viel schöner sei. Die Aussicht von der Veranda war auch atemberaubend. Der prachtvolle Garten, die herrlich blühenden Bäume, der unberührte Strand und das glitzernde Wasser des weiten Ozeans, es war ein Paradies.
Richard und Dorothea mussten so um die Fünfzig sein. Auf Tamaras scheue Fragen erzählten sie, dass sie in jungen Jahren aus England nach Neuseeland gekommen seien. Jetzt seien die Kinder ausgeflogen und sie hätten hier einen Ort der Ruhe und Zufriedenheit gefunden. Sie kämen manchmal zu Besuch, die Kinder, aber durch das B & B würden sie auch so immer wieder interessante Leute kennenlernen. Man war hier draußen also nicht so einsam, wie es schien.
Joe hatte schweigend seinen Tee getrunken und erhob sich. „Ich geh jetzt“, sagte er. „Vielen Dank, Dorothea. Ich sehe, unser Gast ist gut aufgehoben. – Richard ...“
„Wiedersehen, Joe“, brummte der Letztere. „Komm doch wieder vorbei. Wir könnten wieder einmal zum Fischen hinausfahren.“
Tamara fühlte sich verpflichtet. „Soll ich Sie zum Dorf zurückfahren?“
„Nicht nötig!“, antwortete der Davoneilende. „Alles Gute!“
„Er wohnt keine drei Kilometer weit entfernt“, erklärte Richard.
„Ein netter Mensch“, murmelte Tamara in Gedanken.
„Oh ja!“
Dorothea blickte dem Maori sinnend nach. „Ja, Joe ist uns ans Herz gewachsen. – Allerdings weiß ich nicht, was heute mit ihm war. Er schien so verschlossen.“
Das war auch Tamara aufgefallen. Aber im Gegensatz zu ihren Gastgebern erahnte sie, was den Mann bedrückte. Er hatte den Vorfall mit keinem Wort erwähnt und jetzt war sie selber nicht sicher, ob sie von Tim und der Taonga Lodge erzählen sollte. Die Geschichte schien so unwirklich. War das Ganze vielleicht einfach in großes Missverständnis? Was sollte sie jetzt tun? Auf der Melford-Station warteten sicher alle ungeduldig auf Bescheid. Aber was sollte sie ihnen berichten? Dass Tim sie mit dem Gewehr in der Hand empfangen und bedroht hatte? Seine Eltern mussten sie für verrückt halten, und Regula nicht minder.
„Möchten Sie noch eine Tasse?“, unterbrach Dorothea ihre Gedanken.
„Nein, danke!“
Dann fasste Tamara einen Entschluss. Sie konnte nicht einfach so tun, wie wenn nichts gewesen wäre. Sie musste morgen nochmals dort hin und mit Tim reden. Wenn sie allein käme, würde er sicher vernünftig reagieren. Ja, wenn sie sich überlegte, Tims Zorn war eigentlich gegen den Maori gerichtet gewesen. Was er wohl gegen Joe hatte? Richard und Dorothea standen dem Einheimischen nahe. Vielleicht wusste sie, was los war.
„Oder doch, ja, ich nehme gerne noch eine Tasse.“
„Natürlich, meine Liebe!“
„Ich habe heute etwas erlebt, was ich überhaupt nicht verstehe“, begann Tamara. „Aber zuerst müssen Sie wissen, woher ich komme.“
Tamara begann zu erzählen, von ihrer Freundin, deren Verlobung, Tim und seiner Familie. Dann erwähnte sie dessen unverständliches Verschwinden, wobei er die schwangere Regula einfach zurückgelassen hatte.
„Ich bin ihm nachgefahren“, sagte sie. „In Te Kaha begegnete ich Joe, der mich zur Taonga Lodge führte.“
„Zur Taonga Lodge?“, knurrte Richard.
„Ja, aber wir wurden schrecklich empfangen. Tim bedrohte uns mit einer Schrotflinte und verjagte uns.“
„Oh, jetzt verstehe ich, warum Joe so niedergeschlagen wirkte“, warf Dorothea ein. „Das galt nicht Ihnen, meine Liebe. Der Besitzer der Taonga Lodge hegt einen alten Hass gegen die Maori.“
„Tim hat Streit mit den Maori?“
„Das ist eine lange Geschichte“, brummte Richard, „aber erzähle doch du, Thea.“
„Eigentlich ist es eine gesamtneuseeländische Problematik“, begann Dorothea.
„Die Maori betrachten sich als die Ureinwohner dieses Landes, was sie in gewissem Sinne auch sind, denn sie waren viele hunderte Jahre vor den Weißen hier. Dem gegenüber weiß man heute aber, dass auch sie Einwanderer waren. Sie kamen in Kanus von den polynesischen Inseln. Im Laufe der britischen Kolonisierung erlebten sie einen Niedergang, welcher erst in diesem Jahrhundert gestoppt werden konnte. Sie retteten ihre Kultur, ihre Traditionen und Ahnenverehrung durch mündliche Überlieferung in die heutige Zeit hinüber und erhielten immer mehr den Status gleichwertiger Bürger dieses Neuseelands. Ihre Anzahl hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht und beträgt heute um die zehn Prozent der Bevölkerung.
Neben zum Teil berechtigten, manchmal aber auch unrealistischen Landforderungen legen die Maori immer mehr Wert auf ihre Ahnenverehrung und damit auf heilige Stätten, welche mit einem Tapu belegt sind und unter keinen Umständen gestört werden dürfen. Taonga Lodge steht auf so einem Ort.“
„Großer Gott!“, entfuhr es Tamara. „Das ist ja schrecklich. – Aber wie konnte solch ein Haus überhaupt auf so einem Platz gebaut werden?“
„Naja, früher kümmerte man sich wenig um solche Angelegenheiten. Erst in den letzten Jahren werden die Maori fordernder. Sie sehen ihr Recht darin, das Land zurück zu verlangen. Da es sich dabei meist um die schönsten Plätze handelt, an der Küste, auf einer Anhöhe oder einem Hügel, ist es für jeden Grundeigentümer ein Alptraum, man könnte auf seinem Land die Gebeine eines angeblich verehrten Häuptlings finden. Ist der Hügel dann erwiesenermaßen auch noch der Ort einer alten Befestigungsanlage, was die Maori einen Pa nennen, dann hat der rechtmäßige Besitzer keine Chance mehr. Namhafte Projekte sind so vereitelt worden, nur damit Jahre später Unkraut und dichtes Gestrüpp sich über dem Ort breit machen kann.“
„Dann verteidigt Tim eigentlich nur seinen Besitz.“
„Ja, so könnte man es nennen. Dass er aber mit dem Gewehr in der Hand argumentiert, das ist falsch, und Joe ist wohl der Letzte, der mit Gewalt seinen Vorteil erzwingen will.“
„Ihr kennt Joe schon lange?“, dachte Tamara laut. „Er machte auch auf mich den Eindruck eines besonnenen Mannes.“
„So ist es, Joe ist ein durch und durch edler Charakter“, fuhr Dorothea fort. „Leider gibt es bei den Maori aber auch Hitzköpfe. Da tut dieser Tim gut daran, auf der Hut zu sein.“
„Was sollte er Ihrer Ansicht nach denn tun? – Hatten Sie hier auch solche Probleme?“
Jetzt lachte Richard, der bis dahin schweigend zugehört hatte: „Ach, du meine Güte! Unser Flecken Land hier war nichts als ein verwilderter Uferfelsen. Hier gibt es keine heiligen Gebeine, höchstens später einmal, wenn unsere alten Knochen hier verbleichen.“
„Außerdem haben wir uns natürlich im Dorf der Maori erkundigt, bevor wir hier anfingen“, ergänzte Dorothea.
„Warum tut das denn Tim nicht?“
„Das wissen wir auch nicht, meine Liebe. Ehrlich gesagt, auch uns ist neu, dass sich da unser Nachbar mit den Maori anlegt.“
Nachbar ist gut, dachte Tamara. Es mussten mindestens fünf Kilometer sein, aber dazwischen war eben nichts als raue Natur. Jetzt, nachdem sie die Zusammenhänge kannte, nahm sie sich vor, gleich morgen früh nochmals zur Taonga Lodge zu fahren und mit Tim zu reden. Dann konnte sie immer noch die Melford-Station anrufen und Regula berichten, dass Tim wohlauf sei.
KAPITEL 3
Das Meer war eine gleißende Fläche im Gegenlicht der aufgehenden Sonne. Joseph Wakamoa blinzelte durch die halb geschlossenen Lider und erspähte weit draußen ein einsames Fischerboot. Es war wohl auf der verspäteten Heimkehr zum Hafen von Tauranga.
Die Anhöhe, auf welcher Joe sich niedergelassen hatte, war ein Ausläufer des Hügels, auf welchem die Taonga Lodge jetzt langsam in ein milchig weißes Morgenlicht getaucht wurde. Eine friedliche Stille lag über dem herrlichen Bild und ließ die unschöne Szene vom Vortag völlig irreal erscheinen. Joe war sich der Besonderheit dieses Ortes bewusst. Immer wieder zog es ihn hierher, zu dieser frühen Morgenstunde, wo die Reinheit des neuen Tages noch unverdorben vor ihm lag und die Sonne sich über den Horizont emporhob, wie wenn sie, über die Krippe gebeugt, ihr Neugeborenes in die Arme schließen wollte.
Das Geheimnis des ewigen Neuanfanges erfasste Joe jedes Mal. War es, weil hier irgendwo in dieser Erde die Gebeine eines Vorfahren ruhten oder weil er von der Überlieferung wusste, dass vor hunderten von Jahren seine Ahnen aus Hawaiki hier an Land gekommen waren und sich niedergelassen hatten? Diese alten Legenden bezweifelte er aber, denn es gab keine Beweise, keine Niederschriften oder Funde, welche die Geschichten über die Ankunft der acht Kanus, die über das Meer gekommen sein sollen, bestätigten. Eines davon, jenes mit dem Namen Mataatua soll just hier in dieser Bucht aufgetaucht sein, und dessen Insassen sollten die direkten Vorfahren der Stämme dieser Gegend sein.
Joseph Wakamoa tastete unbewusst nach dem merkwürdigen Anhänger, den er, seit er vom Knaben zum Mann herangewachsen war, um seinen Hals trug. Der damalige Tohunga des Dorfes war längst verstorben, aber Joe vergaß den Moment nie, als der Schamane ihm das Amulett umlegte und sagte: „Joseph, du trägst einen guten christlicher Name, aber vergiss nie, mein Sohn, die Kraft der Ahnen ist unergründlich. Seit vielen Generationen wird sie durch solche Hei-Tiki weitergegeben. Trage es mit Stolz und spüre sein Mauri, seine Kraft!“
Das Amulett glänzte matt im morgendlichen Licht. Es hing schwer an dem einfachen Lederbändel, denn es war aus grünem Stein, aus Nephrit, gefertigt. Es glich einem kleinen gedrungenen Menschen mit großem schräg gedrücktem Kopf. Kleine, gebogene Gliedmaßen umschlangen einen unscheinbaren Leib. Riesige Augen und eine ebenso große Zunge gaben ihm das groteske Aussehen eines alten Säuglings.
„Pounamu, der grüne Stein, entstand durch die Vereinigung der Götter des Meeres und der Kälte“, erklärte der Priester. „Seine Farbe ist wie die des tiefen geheimnisvollen Meeres und sein Glanz erinnert an das matte Eis der Gletscher. Unsere Vorfahren sind bis zur Westküste der Südinsel gereist, um den wertvollen Stein zu finden. Er wurde zur Herstellung von Werkzeug und Waffen verwendet, denn seine Härte ist unübertroffen und seine Kraft groß. Aber am wichtigsten war immer die Herstellung von solchen sagenumwobenen Tiki, denn sie versprachen dem Besitzer großes Mana, Macht und Würde.“
Auf Joes Frage, woher denn dieses besondere Hei-Tiki komme, lächelte der Schamane nur still vor sich hin und schwieg. Joe beugte ehrfürchtig seinen Kopf. War es denn wichtig, woher das Amulett stammte? Natürlich wusste er, dass die Suche und der Abbau dieses Gesteins längst kommerzielle Ausmaße angenommen hatten und dass im Touristenzentrum von Rotorua Hunderte solcher Tiki angeboten wurden. Bald jeder Gast dieses Landes wusste, was ein Tiki war, und dass die Vorsilbe Hei schlicht und einfach ,Anhänger' bedeutete.