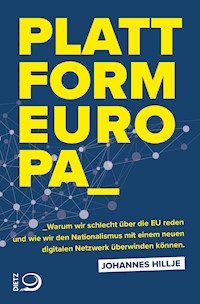
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag J.H.W. Dietz Nachf.
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Plattform Europa ist ein visionärer Vorschlag für ein digitales, öffentlich finanziertes, gemeinwohlorientiertes und unabhängiges soziales Netzwerk: Ein virtueller Ort für Bildung, europäische Bürgerinitiativen, den direkten Austausch unter Menschen in ganz Europa, aber auch für Nachrichten, für Unterhaltungsangebote oder Dienstleistungen. Pünktlich zu den Europawahlen stellt der Europa-Experte und Politikberater Johannes Hillje seine Idee vor, die helfen soll, den Nationalismus zu überwinden, den Gemeinschaftsgeist zu fördern und die EU demokratischer zu machen. Die Öffentlichkeit in Europa ist heute national und digital organisiert – beides spielt Nationalisten und Populisten in die Hände. Die toxischen Diskurse über die Euro-Krise, den Brexit oder Migration haben die Europäer an den Abgrund gebracht, weil sie zwar übereinander, aber nicht miteinander reden. Die Digitalisierung könnte sie näher zusammenbringen, doch Facebook & Co. haben die digitale Öffentlichkeit privatisiert und zum Resonanzraum von Fakes und Trollen werden lassen. Die Plattform Europa will das ändern und das Internet endlich in den Dienst der Demokratie und Europas stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8012-7013-1 (E-Book)
ISBN 978-3-8012-0553-9 (Printausgabe)
Copyright © 2019
by Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH
Dreizehnmorgenweg 24, 53175 Bonn
Cover: Petra Bähner, Köln
Satz: Ralf Schnarrenberger, Hamburg
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, 2019
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet: www.dietz-verlag.de
_Inhalt
Cover
Titel
Impressum
_EINLEITUNG
_KAPITEL 1
DAS PROBLEM: EUROPA IM TEUFELSKREIS DER KRISENDISKURSE
Die neuen Proeuropäer
Wie wir ein grosses Werk kleinreden
Fremd im eigenen Haus
Europa im Teufelskreis
Krisen als Konflikte
Konflikte als News
News als Nationalismus
Modus des Misstrauens
Der unbekannte Retter
Diskurs der Delegitimierung
_KAPITEL 2
DIE URSACHE: NATIONALE FILTERBLASEN
Vergesst den europäischen Fernsehsender!
Nationen in Filterblasen
Parlamentarismus als Ergebnis statt als Prozess
Der halbe Korrespondent
Unter Eliten
Die unvorstellbare Gemeinschaft
Zugehörigkeit ungleich Zusammengehörigkeit
Digitale Dominanz, digitaler Dilettantismus
Vernetztes Europa
_KAPITEL 3
DIE LÖSUNG: PLATTFORM EUROPA
Wir leben in einer Plattformgesellschaft
Warum Europa eine Plattform werden sollte
Europa als Plattformbetreiber
Europäischer Newsroom
European Way of Life
Politisches Engagement
Apps: Europa anwenden
_AUSBLICK:
EUROPAS NEUE SOUVERÄNITÄT
Anmerkungen
Über den Autor
_EINLEITUNG
Wenn in diesen Jahren so eifrig über Wege aus Europas Dauerkrise gesprochen wird, dann bemühen die Rednerinnen und Redner gerne einen Satz, die sie dem französischen »Vater Europas«, Jean Monnet, zuschreiben: »Wenn ich nochmals mit dem Aufbau Europas beginnen könnte, dann würde ich mit der Kultur beginnen.« Soll Monnet gesagt haben – hat er aber nicht. Es ist ein Fake-Zitat, das ihm nachträglich in den Mund gelegt wird. Die Jean-Monnet-Stiftung in Lausanne weiß, wie es dazu gekommen ist: Den Anstoß zu dieser Legende gab – in guter Absicht wohl bemerkt – der einstige französische Kulturminister Jack Lang. Er hatte gesagt: »Monnet hätte sagen können oder sollen, dass wenn er nochmals mit dem Aufbau Europas …« und so weiter.
Dass Monnet es hätte gesagt haben können, ist eine recht zutreffende Metapher für den Zustand Europas. Die jüngste Geschichte der Europäischen Union ist ebenfalls eine, die in großen Teilen im Konjunktiv II geschrieben werden muss. Seit der Abstimmung über den Brexit war in der EU-Politik sehr viel hätte, können, sollen und sehr wenig machte, entschied, plante. Obwohl es zunächst den Anschein machte, als würde Europa nach dem Super-GAU im Sommer 2016 die Flucht nach vorne ergreifen. In Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft oder Literatur keimte plötzlich eine europäische Aufbruchsstimmung auf. Emmanuel Macron entfesselte in seiner Rede an der Pariser Université de Sorbonne im September 2017 so etwas wie eine proeuropäische Emotion. Er forderte nichts weniger als die Neugründung Europas, schwärmte von europäischer Souveränität und präsentierte eine ganze Liste von konkreten Reformvorschlägen. Der »Pulse of Europe« schlug über Monate auf den Straßen. Menschen malten sich ihre Gesichter blau an, wickelten sich in EU-Fahnen, für kurze Zeit war Europa ein bisschen cool. Experten skizzierten Szenarien für die Vollendung der europäischen Demokratie, ganz vorne dabei die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot mit ihrem Entwurf einer europäischen Republik. Den Büchermarkt erfasste ebenfalls ein neuer proeuropäischer Zeitgeist. Titel wie »Trotz alledem! Europa muss man einfach lieben« (Heribert Prantl) oder »Wir sind Europa!« (Evelyn Roll) ersetzten die zuvor allgegenwärtige europäische Abgesangsliteratur. Und auch wenn in Europa immer alles etwas länger dauert, war der Zeitpunkt noch günstig: Die Wahlen in Frankreich und Deutschland waren just passé, zwei Jahre noch bis zu den nächsten Europawahlen, endlich konnte mal in Ruhe gearbeitet werden.
Nichts da. Die Bundesregierung antwortete lange Zeit auf Macrons Vorschläge gar nicht, um sie nach mehr als einem Jahr »einhundertprozentig abzuwürgen«, wie Jürgen Habermas feststellte.1 Allenfalls reagierte Deutschland auf die ausgestreckte Hand Frankreichs nur mit dem kleinen Finger in Form von kleinteiligen Reformen in der Wirtschafts- und Währungspolitik. Ein großer Wurf gelang nicht. Der fehlende Mut der Einen kann im heutigen Europa nicht ohne den Übermut der Anderen verstanden werden. Von den skandinavischen Ländern über Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien bis hin zu den Visegrád-Staaten: Populismus und Nationalismus sind fast an allen Ecken und Enden der Union auf dem Vormarsch. In Österreich, Italien, Tschechien oder Polen sind sie aus der Opposition mittlerweile in Regierungsverantwortung aufgestiegen. Die Hoffnung von der »Mäßigung an der Macht« hat sich bei diesen Kräften größtenteils als naiv erwiesen. Zwar sind Parteien wie die FPÖ oder die Lega von »Exit«-Forderungen, aus dem Euro oder gleich der ganzen Union, abgerückt. Statt raus wollen sie heute vielmehr rein nach Europa – aber eben in ein Europa, das dem Geiste der europäischen Integration vollkommen entgegensteht. Der Konflikt zwischen ihnen und Politikern wie Macron dreht sich im Kern um den Ort von Souveränität. Es stehen sich Europa-Souveränisten und Nation-Souveränisten gegenüber. Die eine Seite meint, dass die EU-Staaten in einer global verflochtenen Welt nur dann handlungsfähig und selbstbestimmt bleiben, wenn sie ihre Souveränität in europäischen Institutionen bündeln. Die andere Seite, deren Vertreter es rechts wie links gibt, pocht darauf, dass Souveränität fest an die Nation geknüpft sein muss, weil sie die einzige Quelle politischer Legitimität sein könne.2 Streitigkeiten über die Verteilung von Geflüchteten, die mit Mehrheit gegen einzelne Regierungen durchgesetzt wurden, sind Ausdruck von diesem Grundkonflikt. Es geht dabei nur vordergründig um die Sachfrage selbst. Viel grundlegender ist, wer das letzte Wort hat, ob solche Entscheidungen wie derzeit vorgesehen tatsächlich nach dem Mehrheitsprinzip getroffen werden sollen und inwiefern der Europäische Gerichtshof die europäischen Rechtsprinzipien auch im Verfassungsrecht der Mitgliedsstaaten einfordern kann. Wenn Macron die schillernde Figur im Lager der europäischen Souveränität ist, dann ist Viktor Orbán sein Pendant auf der Gegenseite. Seit 2010 baut Orbán sein Land in einen illiberalen Staat um und gerät dabei immer öfter mit den EU-Institutionen in Konflikt: Bei der Einschränkung der Wissenschaft, Unterdrückung der Zivilgesellschaft, Gleichschaltung der Medien oder Abschaffung der Gewaltenteilung. Orbán bezeichnet die Kritik aus Brüssel als Beleidigung des ungarischen Volkes, das doch nur sein Selbstbestimmungsrecht ausüben würde. Und wenn die Selbstbestimmung des Volkes im Widerspruch zu den Prinzipien der Union steht, dann müsse die Nation das letzte Wort haben. Unabhängig der Sachfragen, denn bei der Flüchtlingsverteilung sind sich ein Viktor Orbán und ein Matteo Salvini ganz und gar nicht einig, ist diese Souveränitätslogik zum europäischen Zeitgeist eines erstarkten populistischen Nationalismus geworden. Selbstherrlich, aber nicht aus der Luft gegriffen, sagt Orbán: »Früher haben wir geglaubt, dass Europa unsere Zukunft ist. Heute spüren wir, dass wir die Zukunft Europas sind.«
Europa hätte die Trendwende hinlegen können, als es nach dem Brexit kurzzeitig zu dem beschriebenen europäischen Erwachen kam. Demoskopen maßen quer durch die Union Rekordwerte bei der Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft des eigenen Landes. Ein »window of opportunity«, das offen stand für Reformen, ja für eine sinnvolle Vertiefung der EU in ausgewählten Bereichen. Warum haben es die proeuropäischen Kräfte nicht genutzt, während EU-skeptische Kräfte ihre Agenda längst umsetzten? Es hat einerseits natürlich mit politischem Willen zu tun, allen voran dem der Bundesregierung. Auf der anderen Seite – und das ist ein zentrales Argument dieses Buches – haben Populisten und Nationalisten einen strukturellen Vorteil im politischen Wettbewerb der EU: Es ist die Dysfunktionalität der europäischen Öffentlichkeit. Heutzutage sind Öffentlichkeiten in Europa in erster Linie national und digital organisiert. Das mag zunächst wie ein Gegensatz klingen, zeichnet sich die Digitalisierung doch durch die Entgrenzung von Kommunikation aus. Technologisch und strukturell trifft das zu, diskursiv nicht. Gemessen an den Themen, Akteuren und Perspektiven sind öffentliche Debatten über europäische Politik einseitig national geprägt, egal ob sie auf analogen oder digitalen Kanälen stattfinden. Die heutige Struktur der Öffentlichkeit spielt populistischen Nationalisten zweifach in die Hände: Zum einen brauchen sie ihre nationalistischen Positionen nicht gegenüber einem europäischen Gemeinwohl zu rechtfertigen, weil es dieses als Bewertungsmaßstab im Diskurs praktisch nicht gibt. Andererseits profitieren sie von den Algorithmen sozialer Medien, die keinem Gemeinwohlauftrag, sondern allein einem Aufmerksamkeitsauftrag der Digitalkonzerne folgen. Troll-Armeen, Fake News und Hass können in ihnen frei flottieren und Meinungsbildungsprozesse manipulieren. Dabei operiert die »digitale Rechte« transnational, koordiniert globale Attacken etwa auf nationale Wahlen. Im schlechtesten Fall steht am Ende ein desinformierter Wählerwille wie beim Brexit-Votum, als einzelne Wählergruppen mit lügnerischen »Dark Ads« auf Facebook bombardiert wurden. In jedem Fall sind die Öffentlichkeiten in Europa zu Resonanzräumen für Populismus und Nationalismus geworden, für die Legitimierung europäischer Politik bieten sie hingegen äußerst schlechte Umweltbedingungen.
Helmut Kohl erklärte 1995, dass die europäische Integration »irreversibel« sei. »Irreversibel heißt für mich«, präzisierte Kohl, »dass man später wohl über das Tempo der Integration in einzelnen Politikbereichen diskutieren kann, dass sich aber die Richtung nicht mehr verändern lässt.«3 Das Votum für den Brexit ist nur der offenkundigste Beleg, dass Kohl sich geirrt hat. Im Jahr 2019 ist Desintegration in der EU ein politischer Fakt und erklärtes Ziel nicht weniger Regierungen. Und weitere Länder sagen: »Bis hierhin, aber nicht weiter«. Dabei sind es keineswegs nur konservative oder rechtsgerichtete Kräfte, die dem Voranschreiten der europäischen Integration offen entgegentreten. Zweifel gibt es genauso auf linker Seite: Der französische Linkenanführer Jean-Luc Mélenchon und Sahra Wagenknecht aus Deutschland sind führende Köpfe einer nationalorientierten Linken in Europa. Ihre Analyse lautet: Die EU tickt neoliberal, im Kampf zwischen Kapital und Arbeit steht sie systematisch auf der falschen Seite. Umverteilung, starker Arbeitnehmerschutz oder höhere Unternehmenssteuern seien mit ihr nicht umsetzbar. Auch im Lager der Sozialdemokratie wird die Enttäuschung über Europa zunehmend größer. Dort besteht der Eindruck, dass man die sozialdemokratischen Trophäen des 20. Jahrhunderts nur dort verteidigen könne, wo man sie errungen hat, also im Nationalstaat. Statt mit Souveränität argumentieren solche Stimmen mit Solidarität: Die Nation sei die einzige Gemeinschaft, in der man bisher zuverlässig Solidarität im Sinne materieller Umverteilung habe organisieren können. Kurzum: Mit Europa sei kein Sozialstaat zu machen. Und es stimmt ja, die europäische Integration ist bisher eine liberale Erfolgsstory, keine linke oder sozialdemokratische. In der EU sind ökonomische Freiheiten deutlich weiter entwickelt als soziale Sicherheiten. Aber der Rückgriff auf einstige »goldene Zeiten« stößt bei der Formulierung von Politik für die Zukunft eben auch an seinen Grenzen. So bleibt ein Widerspruch in den Apologien des Nationalstaats stets unaufgelöst: Wie will man ein kapitalistisches System, das unabhängig nationaler Grenzen operiert, in genau diesen einhegen? Muss demokratische Kontrolle nicht vielmehr auf der Ebene organisiert werden, wo die zu kontrollierenden Akteure handeln? Man muss die real existierende Europäische Union nicht mögen, aber man kann sie als Handlungsrahmen nicht ablehnen, wenn demokratische Souveränität und soziale Rechte in der Globalisierung verteidigt werden sollen. Man muss sie mit politischen Mehrheiten verändern.
Klar ist: EU-Kritik und Europafreundlichkeit sind keine Gegensätze. Im Gegenteil, wer die EU verteidigen will, muss sie kritisieren. Gerade jetzt in der Krise müsste Europa eigentlich heftig streiten. Aber bitte über das »Wie« gemeinsamer europäischer Politik, nicht über das »Ob«. Der vor den Nazis geflüchtete Wirtschaftswissenschaftler Albert O. Hirschmann hat in seinem Grundlagenwerk »Abwanderung und Widerspruch. Reaktionen auf Leistungsabfall bei Unternehmungen, Organisationen und Staaten« (1974) drei Handlungsoptionen für Bürgerinnen und Bürger skizziert, deren Institutionen sich in einer existenziellen Krise befinden: Sie können kollektiv ihre Stimme erheben (Widerspruch), die Institution verlassen (Abwanderung) oder den Frust in sich hineinfressen und treu bleiben (Loyalität). Den meisten Menschen in der EU bleibt heute nur die letzte Option, auch weil in vielen Ländern die zweite Option verfassungsbedingt gar nicht über ein Referendum erreichbar wäre. Sie müssten Regierungen wählen, die den Ausstieg irgendwie für sie durchsetzen. Viel sinnvoller wäre es jedoch, endlich die erste Option zu ermöglichen: den Widerspruch der Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir die EU verändern wollen, sie etwa demokratischer, sozialer, nachhaltiger gestalten möchten, dann brauchen wir einen angemessen Kommunikationsraum, in dem wir über den Weg dorthin diskutieren können. Meine Prognose lautet: Von hieran ist kein substanzieller europäischer Integrationsschritt mehr ohne eine europäische Öffentlichkeit möglich. Es muss eine europäische Öffentlichkeit geben oder es wird irgendwann die Europäische Union nicht mehr geben. Jeder noch so logische nächste Schritt, wie etwa die Einrichtung eines Euro-Finanzministers, wird heute von einem aus Ängsten, Vorurteilen und Selbstbezug zusammengesetzten nationalen Filter aussortiert. Die große Mehrheit der Menschen in Europa fühlt sich als EU-Bürgerinnen und Bürger. An europäischer Identität mangelt es heute bei den Menschen nicht mehr unbedingt, aber keine Struktur bringt sie zusammen, um sich über ihre gemeinsamen bürgerschaftlichen Belange zu verständigen. Auf der anderen Seite treffen EU-Politikerinnen und -Politiker weitreichende Entscheidungen, für deren Legitimierung ihnen der öffentliche Raum fehlt. Mehr noch: Weil heute die legitimierten Entscheidungen europäischer Institutionen nahezu folgenlos von nationalen Regierungen ignoriert werden können, ist jeder weitere Integrationsschritt zum Scheitern verurteilt, wenn er nicht mit der Schaffung einer Öffentlichkeit als essentiellen Reproduktionsmechanismus genau dieser demokratischen Legitimität einhergeht. Warum ein solcher europäischer Kommunikationsraum bisher nicht entstanden ist, wie man ihn mit Hilfe digitaler Technologie aber schaffen könnte, möchte dieses Buch beantworten.
Das Buch folgt einem simplen Aufbau: Problem, Ursache und Lösung. Letzteres möchte natürlich nur als ein Lösungsvorschlag, nicht als Allheilmittel verstanden werden. Das erste Kapitel nähert sich dem Problem anhand der europäischen Krisendiskurse der letzten Jahre. Diese entpuppen sich als ein Teufelskreis aus Krise, News und Nationalismus: Europäische Politik ist vor allem dann für die Medien attraktiv, wenn sie als Krise erzählt werden kann. Hinter den Krisen stehen Konflikte zwischen den Mitgliedsländern, die medial nicht nur konfrontativ zugespitzt werden, sondern auch anhand von Auf- und Abwertungen die Abgrenzungen zwischen den Nationen befördern. Diese Diskurse stärken das Nationalbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung für gemeinsame Lösungen gerät dagegen ebenfalls in die Krise. Das zweite Kapitel geht den Ursachen für diesen toxischen Europadiskurs auf den Grund. Es fehlt an einer europäischen Öffentlichkeit, die bis heute weder über die Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten, noch eines europäischen Supermediums, noch mit Hilfe digitaler Kanäle geschaffen werden konnte. Die Mitgliedstaaten reden zwar über die EU und übereinander, aber nicht miteinander. Europa verhandelt europäische Themen in nationalen Filterblasen statt in einem europäischen Kommunikationsraum. Soll heißen: Die Bürgerinnen und Bürger bekommen Informationen über europäische Politik durch einen nationalen Filter serviert. Dieser Filter ist kein Algorithmus, sondern eine mediale Diskursordnung, die von einer einseitig nationalen Sicht auf europäische Belange geprägt ist. Sie legt den Fokus auf den nationalen Saldo statt die europäischer Solidarität, sie konstruiert das europäische Kollektiv auf Basis nationaler Narrative. Mit anderen Worten: In den Öffentlichkeiten gibt es ein Verständnis von und die Präferenz für ein »französisches Europa«, ein »deutsches Europa« oder ein »ungarisches Europa«, aber eben nicht für ein europäisches Europa, das sich aus einem europäischen Frankreich, Deutschland und Ungarn zusammensetzt. Für einen Austausch sind die Wände der nationalen Blasen zu robust. Folglich fehlt es an einem Gefühl von Zusammengehörigkeit in Europa, weil das nicht allein durch die Summe nationaler Zugehörigkeitsgefühle zur EU entstehen kann. Das dritte Kapitel nimmt einerseits die weithin unerschöpften digitalen Potenziale für eine europäische Öffentlichkeit zum Ausgangspunkt. Andererseits setzt es bei den von privatwirtschaftlichen Interessen übertrumpften demokratischen Möglichkeiten der Digitalisierung an. Soziale Netzwerke sind Resonanzräume für Populisten geworden, ihre Algorithmen unterscheiden nicht zwischen Fakten und Fakes, sie folgen einem Geschäftsmodell statt einer demokratischen Grundordnung. Es sind Plattformen wie Facebook, Google oder YouTube, die den digitalen öffentlichen Raum privatisiert und oligopolisiert haben. An ihnen geht kaum ein Datenstrom im digitalen Ökosystem mehr vorbei. Unter ihrer Kontrolle ist die Relevanz, Sichtbarkeit, Verbreitung und Darstellungsform öffentlicher Belange. Sie haben die Hoheit über persönliche Daten, ja ihnen gehört die Infrastruktur, auf der sich demokratische Öffentlichkeit im Netz konstituiert. Man könnte sagen: Mit der Digitalisierung ist die Öffentlichkeit der Öffentlichkeit abhandengekommen. Davon ausgehend formuliere ich den Vorschlag für eine Plattform Europa in öffentlicher Hand. Diese Plattform verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele: Erstens eine Demokratisierung des digitalen Raums in Europa, somit die Schaffung einer digitalen Öffentlichkeit nach europäischen Werten, die dem Gemeinwohl und der europäischen Demokratie dient. Eine solche Plattform in die öffentliche Hand zu geben, kann durchaus als ein Schritt zur Institutionalisierung des Internets verstanden werden – nachdem man feststellen muss, dass das uninstitutionalisierte Internet nach demokratischen Maßstäben gescheitert ist, wenn nicht gar zu einer Gefahr für die Demokratie geworden ist. Zweitens sollen die dezentralen, nationenunabhängigen Strukturen des Netzes endlich für die europäische Integration nutzbar gemacht werden. In seinem vielbeachteten Buch »The People vs Tech« argumentiert Jamie Bartlett, dass die Demokratie und das Internet in ihren Wesen unvereinbar miteinander seien. Ich argumentiere: Die Demokratie ist sehr wohl für die digitale Welt gemacht, aber die digitale Welt bisher nicht für die Demokratie. Weil die Digitalisierung bis heute von der Wirtschaft, nicht von der Demokratie gesteuert wird. Europa könnte das ändern. Muss es ändern. Denn im Grunde ist das Internet wie für die europäische Demokratie gemacht. Es kann geographische, sprachliche und kulturelle Grenzen besser überwinden als jedes andere Medium. Auf der Plattform Europa geht es deshalb darum, die Infrastruktur für einen europäischen Kommunikationsraum zu schaffen, der die zentralen Bedürfnisse einer europäischen Demokratie erfüllen kann. Auch wenn die konkreten Funktionen und Inhalte der Plattform Europa (im Gegensatz zur EU) unbedingt bottom-up statt top-down entwickelt werden sollten, möchte ich als »Basisausstattung« vier Bereiche vorschlagen: Ein europäischer Newsroom für einen paneuropäischen Diskurs über europäische Themen; Unterhaltungs- und Kulturangebote zur Repräsentation eines European Way of Life; Instrumente der politischen Partizipation zum Abbau des Beteiligungsdefizit in der EU sowie Apps, die alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer Mobilität von der europäischen Integration profitieren lassen. Sprachbarrieren lassen sich heute mit Hilfe Künstlicher Intelligenz überwinden – sogar in Echtzeit. Ja, in Anbetracht der technologischen Entwicklungen kann man damit rechnen, dass die nächste digitale Entwicklungsstufe das »übersetzte Internet« sein wird. Das ist ein Meilenstein für die europäische Öffentlichkeit. Der Datenschutz wird sich auf der Plattform an den Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, nicht irgendeines Unternehmens orientieren. Die Algorithmen würden persönliche Vorlieben mit gesellschaftlicher Relevanz verbinden, aber nicht jene belohnen, die Hass oder Hetze verbreiten. Die Inhalte liefern Kooperationspartner wie Medienhäuser, Theater, Universitäten oder Museen, die heute ihrerseits nach attraktiveren Verbreitungswegen als YouTube und Co suchen. Und die Inhalte werden, dort wo europäische »Versorgungslücken« existieren, selbst produziert oder in Auftrag gegeben (zum Beispiel europäische Serien). In diesem postnationalen Kommunikationsraum kann Europa seine demokratischen Werte gegenüber illiberalen Regierungen verteidigen, die in rasendem Tempo nationale Medien und Kulturinstitute zu Propagandaorganen umbauen. Laut Reporter Ohne Grenzen hat sich 2017 der Zustand der Pressefreiheit in keiner Region der Welt so sehr verschlechtert wie in Europa. Mit der Plattform Europa würde die europäische Demokratie einen Wachhund bekommen, der gleichermaßen EU-Institutionen wie auch nationale Regierungen im Blick hat. Nicht zuletzt wäre die Plattform ein mächtiger europäischer Player in der heutigen Plattformgesellschaft, der, anders als seine zumeist amerikanischen Konkurrenten, zu allererst einem Gesellschaftsauftrag statt einem Geschäftsmodell unterliegt. Populismus, Desinformation oder »Hate Speech« fungieren dann nicht mehr als Quellen für Wertschöpfung, sondern sind zu sanktionierende Verstöße gegen den rechtlichen und normativen Rahmen, in dem die Europäische Union angelegt wurde.
Gewiss: Ich sehe Europas Probleme auch deshalb als Kommunikationsprobleme, weil politische Kommunikation mein Beruf ist. Naturgemäß leide auch ich unter einer déformation professionnelle. Übrigens auch einer nationalen – das gehört zur Ehrlichkeit, wenn man ein Buch über Europa schreibt. Mir ist vollkommen klar, dass sich Europas Probleme nicht allein durch »Reden« lösen, es braucht entschiedenes politisches Handeln. Auch institutionelle Veränderungen sind nötig, damit in der europäischen Politik eine Konfliktkultur entsteht, die für die Medien berichtenswert wäre. So bräuchte es im Europäischen Parlament den Streit zwischen »Regierungsmehrheit« und »Opposition«, im europäischen Rat müssten sich vielmehr politische als nationale Lager gegenüberstehen. Doch die Dinge hängen zusammen. Das politische Europa funktioniert nicht ohne ein ebenbürtiges öffentliches Europa. Im Herbst 2013 habe ich dazu eine Erfahrung gemacht, die zu einem ersten Anstoß zu diesem Buch werden sollte: Damals arbeitete ich als Wahlkampfmanager der Europäischen Grünen Partei zu den Europawahlen 2014. Im Europäischen Parlament vertrat ich meine Spitzenkandidatin bei den Verhandlungen zwischen Parlament, Parteien und Medien über die Organisation der ersten europäischen TV-Debatte. Die europäischen Parteien hatten erstmals Spitzenkandidaten für das Amt des Präsidenten der EU-Kommission nominiert. Es war ein demokratischer Fortschritt, dass zwischen dem Ausgang der Europawahl und der Besetzung des wichtigsten Postens in der EU nun ein engerer Zusammenhang geschaffen wurde. Von diesem Plus an Einfluss der Wählerinnen und Wähler sowie der Personalisierung versprachen wir uns in Brüssel eine höhere Attraktivität der Europawahlen und folglich eine stärkere Wahlbeteiligung. Doch es gelang uns nicht, die nationalen TV-Sender davon zu überzeugen, dieses Novum der EU-Geschichte in das Hauptprogramm zu ziehen. Stattdessen strahlten Spartenkanäle wie Phoenix, BBC Parliamentary Channel oder France24 die Debatte aus. Das ernüchternde Ergebnis: Am Wahltag kannte kaum jemand die EU-Spitzenkandidaten, in Tschechien und Großbritannien waren es gerade einmal 5 Prozent der Wahlberechtigten. Noch schlimmer: Die Wenigsten wussten von dem gestiegenen Einfluss ihrer Wählerstimme auf die Besetzung des Chefpostens der EU-Kommission. Dagegen konnte aber immerhin bei den wenigen Wählerinnen und Wählern, die davon wussten, ein »Mobilisierungseffekt« nachgewiesen werden. Die Spitzenkandidaten waren ein Grund für sie, wählen zu gehen, wie eine Nachwahlbefragung ergab. Es war also mal wieder Sache von hätte, können, sollen.
Die Zeit der verpassten Chancen, der nicht genutzten Gelegenheitsfenster muss nun vorbei sein – bevor es mit der EU vorbei ist. Die Binse, dass in jeder Krise auch eine Chance liegt, kann man für das Europa der letzten Jahre streichen. Vielleicht hat Europa nur noch diese eine Chance: Dem Austausch, dem konstruktiven Streit, der Empathie, dem Gemeinsamen, den Vorteilen, aber auch der Kritik an der europäischen Einigung einen angemessenen Resonanzraum zu geben. Diese Chance ist die Plattform Europa.
_KAPITEL 1
DAS PROBLEM: EUROPA IM TEUFELSKREIS DER KRISENDISKURSE
DIE NEUEN PROEUROPÄER
Der Wandel, der sich in den letzten Jahren im öffentlichen Diskurs über die europäische Integration vollzogen hat, lässt sich in einem Mann personifizieren: Sebastian Kurz. Er trat drei Tage nach seinem Wahlsieg bei den Nationalratswahlen in Österreich 2017 vor die Mikrofone, um genau eine Botschaft zu platzieren: »Ich bin Proeuropäer.« Die Medien gestanden ihm dieses Label fortan unkritisch ein, auch politische Konkurrenten erhoben keinen Widerspruch. Gerade weil diese Bezeichnung im Widerspruch zu vielen Aussagen in seinem Wahlkampf steht, war es ein erster, sehr wichtiger »Spin«, den Kurz noch vor seiner offiziellen Vereidigung zum Bundeskanzler Österreichs setzte. Denn im ersten Jahr seiner Kanzlerschaft wurde Wien zu einem politischen Machtzentrum Europas: Im Juli 2018 übernahm die Regierung Kurz den rotierenden Vorsitz des Rates der EU. Das vorsitzende Land hat für ein halbes Jahr die Hoheit über die Tagungsordnung des mächtigsten EU-Entscheidungsorgans, das sich aus den Chefs oder Ministern der nationalen Regierungen zusammensetzt. Den Österreichern fiel diese Rolle in dem Moment zu, als die neue Regierung ein neues Kapitel in der Europapolitik des Landes aufschlug. Österreich galt lange Zeit in der Europäischen Union als östlichstes der westlichen Mitgliedstaaten. Seit dem Amtsantritt der konservativ-rechtspopulistischen Regierung ist es politisch eher das westlichste der östlichen Länder. Zu beobachten war dieser Wandel in der Vorbereitung und Ausführung des EU-Ratsvorsitzes.
Es hat Tradition, dass die Regierungen ihren Ratsvorsitz unter ein Motto stellen. Bevor Österreich am Zuge war, führte die bulgarische Regierung die Union unter dem Slogan: »Zusammen sind wir stark«. Österreich wählte den Leitspruch »Ein Europa, das schützt«. Dieses Motto hatte die österreichische Regierung wenig originell formuliert, war es doch wortwörtlich aus Emmanuel Macrons Wahlprogramm kopiert. Mit »Une Europe qui protège« hatte er das Europakapitel seines Programmes zur Präsidentschaftswahl 2016 überschrieben.4 Der Slogan hatte im französischen Wahlkampf gut funktioniert, weil er sich an die multiplen Ängste einer breiten Mittelschicht des Landes richtete. Macron versprach Schutz vor den sozialen Bedrohungen der Globalisierung, vor der ruinösen Steuervermeidung multinationaler Unternehmen, vor den Folgen des Klimawandels, vor der Gefahr durch den Terrorismus. Nun sind Slogans aber nur Hülsen und können folglich ganz unterschiedliche Inhalte umschließen. So nutze die Regierung Kurz zwar denselben erfolgsgeprüften Wortlaut, stellte aber ein Thema an die oberste Stelle ihrer Agenda, das für Macron keiner Schutzpolitik bedurfte: »Sicherheit und Kampf gegen illegale Migration«. Nach der Kurz’schen Interpretation dieses Mottos sollte Europa seine Bürgerinnen und Bürger in erster Linie vor Menschen beschützen, die ihrerseits auf der Suche nach Schutz sind und ja erst in Ermangelung legaler Fluchtwege nach Europa zu »illegalen Migranten« werden. Hinter dem Versprechen vom Schutz vor Schutzsuchenden steckt das Verständnis von Flüchtlingen als physischer Gefahr: Drei Tage vor Übernahme des EU-Ratsvorsitzes führte die österreichische Regierung mit der Polizei- und Militärübung »Pro Borders« öffentlichkeitswirksam vor, wie sie mit Radpanzern und »Black Hawk«-Kampfhubschraubern das eigene Volk vor dieser »Bedrohung« im »Ernstfall« schützen würde. Das Empfinden von einer akuten Gefahr von außen ist die Voraussetzung für ein Schutzverlangen im Inneren. Aus dieser Angst akquiriert sich die Unterstützung für das Projekt »Festung Europa«. Gewiss: Österreich übernahm den Ratsvorsitz der EU in einer politisch festgefahrenen und emotional polarisierten Lage, insbesondere in der Flüchtlingspolitik. Sebastian Kurz betonte unermüdlich sein Selbstverständnis vom »Brückenbauer« – ein zweites Etikett, das er sich neben dem Proeuropäertum anheftete. Vermitteln wollte er insbesondere zwischen der migrationskritischen Visegrád-Gruppe (Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien) und migrationsfreundlicheren Regierungen wie Deutschland, Spanien, Griechenland und (mit Abstrichen) Frankreich. Bei einem Treffen der Visegrád-Länder plus Österreich im Juni 2018 kündigte sich jedoch bereits an, dass Kurz eher Brückenkopf als Brückenfläche im Konflikt dieser Regierungen sein würde. Kurz und die vier osteuropäischen Regierungschefs verkündeten bei ihrem Treffen in Budapest, dass man sich in der Flüchtlingspolitik in allen Punkten einig sei: keine solidarische Verteilung von Asylberechtigten innerhalb der EU, militärischer Schutz der Außengrenzen sowie die Einrichtung von Zentren für die Asylantragstellung außerhalb der Union. Viktor Orbán sagt nach dem Treffen in einem Radiointerview: »Die Visegrád-Staaten, Österreich und Italien bilden ein Lager in der Migrationspolitik.«5 Die Gemeinsamkeiten zwischen Wien und den Regierungen, die sich hinter der Vision vom »Europa der Vaterländer« vereinen, beschränken sich allerdings nicht auf die Asylpolitik. Und hier vollzieht sich der europapolitische »Shift« Österreichs: Auch wenn es um Kürzungen im EU-Budget geht oder um die Beschneidung sozialer Rechte von in Österreich lebenden EU-Bürgern, hat die ÖVP/FPÖ-Regierung insgesamt einen Kurs eingeschlagen, bei dem sich die EU stärker »zurücknehmen« – so stand es in den offiziellen Prioritäten der österreichischen Ratspräsidentschaft – und die Mitgliedsstaaten entscheiden lassen soll.6 Selbst wenn man in manchen Einzelfragen wie der Verteidigungspolitik zu mehr europäischer Kooperation bereit sein mag, hatte sich Österreich in der gegenwärtig wichtigsten Auseinandersetzung über die Zukunft der Europäischen Union klar positioniert: Nicht ein starkes Europa, sondern die starke Nation soll der Ort von Souveränität sein. Kurz steht für ein »Europa mit weniger Europa«. Es ist auf sein kommunikatives Geschick zurückzuführen, dass er sich trotz seiner national ausgerichteten europapolitischen Agenda unwidersprochen als »Proeuropäer« bezeichnen kann. Er darf dieses Etikett mittlerweile sogar für seine gesamte Regierung reklamieren, die FPÖ inklusive, weil der Kanzler seinem Koalitionspartner abgewöhnt hat, den Austritt aus dem Euro und ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft zu fordern. Die europäische Gemeinschaft nicht verlassen zu wollen, gilt nach der Lesart von Kurz schon als proeuropäisch. Die Gleichung wenn ich nicht dagegen bin, bin ich dafür geht allerdings nicht auf. Im ersten Artikel der Europäischen Verträge ist formuliert, dass die EU-Mitgliedsstaaten eine immer tiefergehende Union (»ever closer union«) zwischen den Bürgerinnen und Bürgern Europas schaffen wollen. Im Kern war das jeher das Leitmotiv, das der Politik der EU-Institutionen und »proeuropäischen« Länder zugrunde lag. Ganz im Sinne Helmut Kohls. Europa ist demnach nicht Status quo, sondern ein Weg zu einer vollkommeneren Gemeinschaft. Diesen Weg der Vertiefung wollen Kurz und das »Vaterländer«-Lager nicht gehen. Wenn diese Regierungen »Ja« zu Europa sagen, dann sagen sie »Ja« zu einem zurechtgestutzten Europa: Eines, dass die Nationalstaaten stärkt, Kompetenzen renationalisiert, die Entscheidungen im Europäischen Rat mit Einstimmigkeitsprinzip zwischen nationalen Regierungen trifft und den supranationalen Institutionen ihre legislative, ja insgesamt politische, Potenz raubt. Nur ist ein solches Europa ein Europa des Nationalismus und damit das Gegenteil von dem, was die EU-Verträge langfristig vorsehen.
Warum lohnt es sich, auf der Selbsternennung von Sebastian Kurz zum »Proeuropäer« so sehr herumzureiten? Weil sie ein Zeugnis für das Diskursversagen über europäische Politik ist, das in diesem Kapitel ausführlich problematisiert wird, und deren Ursachen im zweiten sowie eine Lösung im dritten Teil des Buches beschrieben werden. Kurz ist eine weitreichende sprachliche Verschiebungsleistung gelungen, die das heutige Denken über Europa prägt: Lange Zeit wurden jene politischen Kräfte in Europa als »proeuropäisch« bezeichnet, die möglichst bald mehr





























