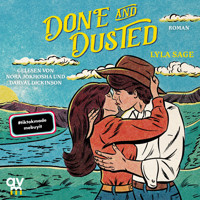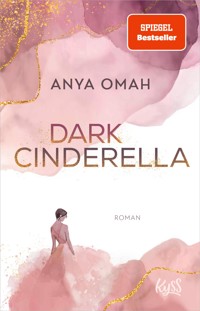Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Von Morgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gay Romance
- Sprache: Deutsch
Jetzt fängt das Leben an! Raus aus der Kleinstadt, auf nach New York! Mein großer Traum, in New York Film zu studieren, geht in Erfüllung. Und als ich meinen Professor James Leeds zum ersten Mal sehe, ist es um mich geschehen. Er ist umwerfend attraktiv, rasend klug – und hat eine dunkle Vergangenheit, die er um jeden Preis geheim halten will. Wir kommen uns näher, als ein Professor und sein Student dürfen. Doch als ich in seine gefährliche Welt gerate, stößt er mich von sich. Soll ich ihn aufgeben? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir füreinander bestimmt sind. Auch wenn die Stadt voller Pretty Boys ist ... Lies jetzt die Geschichte von Jonas und Jim - und all den Männern, die dazwischen kamen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JAMIE STARK
Pretty Boys
Buch I
~ Unschuld ~
Für meine große Liebe Jim … und alle Männer, die dazwischen kamen
Titel: Pretty Boys I – Unschuld
Autor: Jamie Stark
Verlag: Von Morgen Verlag
Stettiner Straße 20 13357 Berlin
Cover: Designs EE
Deutsche Erstveröffentlichung: Berlin 2022
© 2022 Von Morgen Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Dieser Roman beruht auf wahren Begebenheiten. Jedoch habe ich mir Freiheiten erlaubt, um Identitäten zu schützen. Die ganze Wahrheit ist zwischen den Zeilen.
1. Import/Export
2. Mein umwerfender Professor
3. Guter Junge
4. Vorspielen
5. Der Regisseur
Epilog
Danksagung
1. Import/Export
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich Jim vor mir, wie er aus der Dusche kommt. Groß, muskulös und einschüchternd wie die Gladiatoren aus den Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin. Wassertropfen rollen über seine Haut, die einen leichten Olivton hat. Er benutzt das Handtuch nur, um sich die lockigen Haare trocken zu rubbeln, in denen die ersten silbernen Strähnen glänzen. Er kommt auf mich zu, und ich muss vor Schüchternheit auf den Boden sehen, wo er nasse Fußspuren hinterlässt. Er ist so attraktiv, dass ich manchmal rot werde, wenn ich nur seinem Blick begegne. Er schiebt die Hand in meinen Nacken, zieht meinen Kopf zurück und küsst mich. Zärtlich erst, dann fordernder.
Ich öffne die Augen. Nicht Jim kommt aus der Dusche, sondern ein junger Mann, dessen echten Namen ich nie erfahren habe. Da, wo wir uns kennengelernt haben, heißt er Backstreet Boy. Tatsächlich könnte er einer Boyband aus den Neunzigern entsprungen sein. Er ist knabenhaft zierlich und lächelt unter seinen weißblond gefärbten Haaren. Letzte Nacht, im blauen und goldenen Clublicht, wirkte er wie ein Engel. Im schonungslosen Mittagslicht meines Studentenwohnheims sieht man ihm deutlich an, dass er weniger als zwei Stunden Schlaf und mehr als genug Partydrogen intus hat. Seine Blässe wirkt ungesund, und seine Augenringe sind beinah violett. Wenn ich ehrlich sein soll, steht ihm der Look.
Er wirft das Handtuch nach mir, mit dem er sich lose abgetrocknet hat. Ich fange es in der Luft. Schon ist er vor mir und drängt seinen noch feuchten Körper gegen mich.
„Ich hatte Spaß“, sagt er. Für einen Moment spüre ich seine Zähne an meinem Ohrläppchen und schaudere. Doch kaum ist er sich der Reaktion zwischen meinen Beinen gewiss, geht er durchs Zimmer und schlüpft in seine Boxershorts und Jeans. Er will nur Macht demonstrieren, mich nur ärgern – das ist immerhin sein Job. So wie meiner.
„Sehen wir uns nächstes Wochenende?“, fragt er.
„Wenn Mr. Wong mich bucht“, sage ich.
Er wirft mir einen Blick zu. „Bei so vielen Typen, die gestern deinetwegen Drinks bestellt haben, wirst du noch jedes Wochenende gebucht, bis du alt und hässlich bist. Und nenn ihn nicht Mr. Wong, als würden wir ihn respektieren. Unter uns heißt er ‚Schweinchen‘.“
Ich schmunzele. Tatsächlich hat Mr. Wong, mein neuer Arbeitgeber, die Angewohnheit, beim Sprechen zu grunzen.
Der junge Mann – mein neuer Lover? Mein Kumpel? Mein Kollege jedenfalls – ist inzwischen angezogen und holt eine Zigarette hervor, erinnert sich aber dann zum Glück daran, dass er hier nicht rauchen darf und den Feueralarm bereits einmal ausgelöst hat. Er klemmt sie sich hinters Ohr.
„Ich mach mich aus dem Staub“, sagt er im Vorbeigehen.
Ich spüre seine Hand, die meinen Schritt gerade so streift, dass ich glauben könnte, es sei aus Versehen. Aber bei ihm ist alles kalkuliert. Er ist ein Profi.
Hinter ihm fällt die Tür meines Zimmers zu. Ich bleibe eine Weile an die Wand gelehnt stehen, weil meine Knie so weich sind wie Gummi. Dann werfe ich mich aufs Bett, greife nach meinem Handy und rufe meine Stiefschwester und beste Freundin Agnes an. In Deutschland ist es sechs Stunden später als hier in New York, also abends.
„Jonas, du alter Amerikaner“, grüßt mich Agnes. „Was geht?“
Ich mache ein Geräusch irgendwo zwischen Luftschnappen und Seufzen.
„Hast du Aids?“
„Möglich, aber unwahrscheinlich. Gerade ist der zweite Mann, mit dem ich je geschlafen habe, aus meiner Tür spaziert.“
„Du Luder!“ Sie lacht. „Erzähl.“
Und ich erzähle.
Lasst mich drei Monate zurückspulen. Vor drei Monaten war ich noch so unschuldig, wie ich aussehe. Und ich will Halleluja rufen, dass es damit vorbei ist.
Ich bin zwar in Boston geboren, wo meine Mutter herkommt, aber in einer deutschen Kleinstadt aufgewachsen. Von der Stadt hat nur deshalb jemals irgendwer gehört, weil eine weltweit bekannte Sportartikel- und Modefirma hier gegründet wurde und immer noch ihren Hauptsitz hat. Sowohl mein Vater als auch meine Stiefmutter haben Managementpositionen in der Firma, und ich bin in einer Villa mit dreizehn Zimmern, einer Schwimmhalle im Garten und drei Hausangestellten aufgewachsen, aber das änderte nichts daran, dass wir in einer Kleinstadt lebten. Jeder kannte jeden. Und jede Abweichung von der Norm war ein Skandal.
Mein Vater hätte sich keinen besseren Vorzeigesohn wünschen können als mich. Ich nahm keine Drogen, schrottete nicht betrunken seinen Porsche oder stahl Geld, was manche Mitschüler, insbesondere die aus wohlhabendem Elternhaus, gelegentlich taten. Mit meinem Ruderteam wurde ich letzten Sommer deutscher Meister. Ich hatte die fünfte Klasse übersprungen und schloss als Jüngster in meinem Jahrgang, mit siebzehn, das Abitur ab. Durchschnittsnote Eins-Komma-Angeber-Null. Ich war ehrgeizig und diszipliniert. So wie mein Vater. Aber nur aus einem Grund: um wegzukommen.
Darum liebte ich auch Filme. Die Welten, in die sie mich entführten, fühlten sich echter an als mein großes, leeres Zuhause. Ich sah Humphrey Bogart und Audrey Hepburn öfter als meine Eltern. George Clooney und Brad Pitt waren meine Onkel, Sigourney Weaver und Meryl Streep meine Tanten. Darum war es nur naheliegend, dass ich in das Land wollte, in dem die meisten Filme gemacht wurden, die ich liebte, und dass ich dort lernen wollte, selbst Filme zu drehen. Genauer wollte ich in die Heimat von Woody Allen und Martin Scorsese, nach New York City. Ich bewarb mich an der renommierten Filmschule der New York University mit zwei Kurzfilmen, die ich in den Schulferien schrieb, drehte und schnitt. Sechs Prozent der Bewerber werden aufgenommen. Ich war einer von ihnen.
Das sind die Dinge, die mein Vater über mich weiß und seinen Kollegen beim Golfspielen erzählt. Was niemand außer meiner Stiefschwester Agnes weiß, ist, dass ich mir zu Pornos mit starken Männern und Jungs an Leinen einen runterhole, seit ich vierzehn Jahre alt bin.
Ok, zwölf.
Letzten Juli war es so weit. Ich landete am John F. Kennedy Flughafen in New York. Die Uni hatte mir empfohlen, als internationaler Student bei einem vorbereitenden Sommerprogramm mitzumachen, das schon vor dem ersten Semester stattfand. Also zog ich eines brütend heißen Nachmittags in das fast vollkommen verlassene Studentenwohnheim ein. Das Zimmer war karg, aber dafür hatte ich mein eigenes Bad und war im achten Stock. Durch das Fenster konnte ich den wuseligen Broadway und die Zehnte Straße mit den hohen, alten Bäumen sehen. Als ich den Kopf in den warmen Wind hinausstreckte, fühlte ich mich so frei wie noch nie.
In den folgenden Tagen gab es Orientierungsseminare für die Unieinrichtungen, die über Lower Manhattan verstreut waren, und meine Sommerkurse begannen: Einführung ins Fernsehstudio und Soundstudio, Einführung in Schneideprogramme und analoge Kameras. Das meiste wurde von älteren Studenten durchgeführt, die sich über die Ferien etwas dazuverdienen wollten. Meine Mitschüler waren internationale Studenten wie ich oder Amerikaner, die nicht an der Uni studierten, sondern nur für das Sommerprogramm bezahlten. Mit einigen freundete ich mich an, und wir halfen uns gegenseitig bei den Projekten, die wir für die Kurse entwickeln sollten.
Von ihnen hörte ich, dass manche Professoren bereits im Sommer Vorlesungen zum Test abhielten, die sie dann im Semester ganz offiziell anboten. Zu einer solchen Vorlesung namens „Punk Cinema“ wollte ich mitkommen – sie fand jeden zweiten Tag statt. Man sagte mir, der Professor sei noch relativ neu und schon einer der beliebtesten an der Hochschule. Sein Name war James Leeds, aber alle nannten ihn Jim.
Schon davor sah ich Jim bei einem denkwürdigen Ereignis im Hauptgebäude der Filmhochschule. Ich weiß nicht, ob ich an Liebe auf den ersten Blick glauben soll. Aber was ich weiß, ist, dass sich Verliebtheit – ja, vielleicht auch schon die geringste Spur von romantischem Interesse – anfühlt, als würde man jemanden wiedererkennen. Als hätte man denjenigen bereits in einem Traum geliebt und alles vergessen bis auf sein Gesicht, seine Bewegungsart, das Gefühl seiner Haut auf der eigenen.
Ich kam gerade mit einem Eiskaffee aus dem Aufzug. Jim stand bei der Treppe, die hier im neunten Stock praktisch niemand je benutzte, und hatte mir den Rücken zugewandt. Mir fiel seine Figur sofort auf – groß und breitschultrig, mit schmalen Hüften und etwas Federndem in den Beinen, dem man anmerkt, wie schnell und stark er ist. Er hatte seinen dunklen Lockenkopf gesenkt und schien wie ein Tier vor dem Mann in Deckung zu gehen, mit dem er in ein leises, eindringliches Gespräch verwickelt war.
Der Mann war um die dreißig und ebenfalls gutaussehend, mit kahlrasiertem Kopf und blitzenden hellen Augen, die verblüffend gut zu seinem orientalischen Teint passten. Ich konnte seinem Gesichtsausdruck ablesen, dass er etwas Verletzendes sagte. Etwas, das verletzen sollte.
Jim packte ihn plötzlich am Kragen und stieß ihn gegen die Wand.
Der Mann schien zu lachen, dann presste er Jim einen Kuss auf den Mund. Einen Moment war nicht klar, ob die beiden miteinander rangen oder rummachten. Schließlich stieß Jim den Mann von sich. Der fing sich und stolzierte davon, direkt auf mich zu. Nein, nicht auf mich, auf die Aufzüge. Er würdigte mich keines Blickes, als er an mir vorbeirauschte.
Ich stand wie festgefroren da. Die ganze Szene hatte nur ein paar Sekunden gedauert. Jim fuhr sich durch die Haare, dann drehte er sich um – und sah mich. Die Erkenntnis, beobachtet worden zu sein, zuckte wie ein Blitz durch seine Miene. Für einen Sekundenbruchteil schien sein Zorn mir allein zu gelten. Dann wandte er sich ab und verschwand mit großen Schritten in einem Gang, in dem die Büros der Mitarbeiter lagen.
Ich könnte etliche Erinnerungen an meine Kindheit ausgraben, in denen ich meine Eltern beim Streiten beobachte. In denen mein Vater innehält, als er mich entdeckt, und mit Augen ansieht, die noch vor Hass lodern. Und der Hass auf meine Mutter überträgt sich auf mich, einfach weil ich da bin. In der Erinnerung nehme ich seinen Hass bereitwillig auf mich, nur damit der Streit zwischen meinen Eltern endet. Damit könnte ich erklären, warum ich Jim auf den ersten Blick wiedererkannte, und warum dieses Wiedererkennen sich als heftige, irrationale Hingezogenheit ausdrückte.
Aber vielleicht gefällt mir die Vorstellung besser, von Jim geträumt zu haben, bevor ich ihm begegnet bin.
Ich muss gestehen, dass ich von da an öfter im Gebäude herumschlich, um Jim und den anderen Mann wiederzusehen, ohne recht zu wissen, was ich mir davon erhoffte. Aber keiner der beiden tauchte noch einmal auf. Dennoch ging mir der Einblick, den ich in ihr Leben erhascht hatte, nicht aus dem Kopf. Worüber sie wohl gestritten hatten? Der Gedanke an die beiden, wie sie miteinander rangen und sich küssten, erregte mich.
Die erste Vorlesung zu „Punk Cinema“ fand an einem Donnerstagnachmittag statt. Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich mir darunter vorzustellen hatte, und erschien voller Neugier im Vorlesungssaal, der zugleich ein Kino der Universität war. Etwa fünfzehn ältere Studenten tummelten sich in den vorderen Reihen der roten Samtsessel.
Am Rednerpult vor der Leinwand stand Jim und blätterte durch seine Unterlagen.
„Ist das …?“, fragte ich meine Kommilitonen.
„James Leeds“, bestätigte ein Mädchen. An ihre Freundin gewandt fügte sie hinzu: „Er ist so heiß!“
Ich starrte zu ihm auf. Er trug eine randlose Brille, einen dünnen dunkelroten Pullover mit hochgeschobenen Ärmeln und schwarze Jeans, die aus seiner sportlichen Figur kein Geheimnis machten. Seine wirren Haare und sein Drei-Tage-Bart wirkten auf eine elegante Weise ungepflegt. Als es Zeit war, blickte er auf und die Gespräche der Studenten versiegten, ohne dass er etwas sagen musste. Alles an ihm strahlte Autorität aus. Dann entdeckte er mich. Nichts an seinem Ausdruck verriet, ob er mich wiedererkannte. Aber für den Rest der Vorlesung sah er kein einziges Mal mehr auch nur in meine Richtung. Daraus schloss ich, dass er sich sehr wohl an die Szene erinnerte, die ich vor ein paar Tagen beobachtet hatte.
Was mit „Punk Cinema“ gemeint war, erklärte er so: Filme, die von der Punk-Subkultur der späten Siebziger, Achtziger und Neunziger inspiriert oder produziert worden waren. In der Vorlesung sollte es nicht nur um Filme gehen, sondern auch darum, den Begriff „Punk“ und seine Subkultur anhand der Filme zu definieren, mit denen sich die Szene assoziierte. Da dies nur der Testlauf war, erhoffte er sich von uns Ideen, Feedback und Vorschläge. Ich machte mir viele Notizen. Und fragte mich, wie Mr. Leeds zu dem Thema gekommen war. Er trug schwarze Doc Martens. Wahrscheinlich war er in seiner Jugend selbst in der Punk-Szene gewesen. Obwohl ich ihm zuhören wollte, ging meine Fantasie mit mir durch, und ich sah ihn in verschiedenen Szenarien als jungen Mann vor meinem geistigen Auge.
Die Vorlesung dauerte nicht lang, da er die Ausschnitte aus den Filmen, die er besprach, noch nicht vorbereitet hatte. Er verkündete jedoch, dass nach jeder Vorlesung ein Film hier im Saal gezeigt werden würde für diejenigen, die Zeit hatten. Ich hatte nichts anderes vor und beschloss, auch in Zukunft keine Pläne für die Abende nach der Vorlesung zu fassen. Nur drei Studenten gingen, der Rest schaute sich einen abgefahrenen Film aus den Achtzigern an, in dem jeder Mann stirbt, der mit der Hauptfigur Sex hat. Die gute Erklärung dafür war, dass kleine Aliens auf ihrem Dach gelandet sind, welche sich von den Glückhormonen ernähren, die beim Orgasmus ausgeschüttet werden, und dabei den Erzeuger töten. So viel zu Punk Cinema.
An den nächsten zwei Tagen schaute ich alle Filme, die Jim besprochen hatte, in der Filmbibliothek der Uni. Ich machte kaum Pausen und verbrachte meine gesamte Zeit in den Sitzkabinen mit den Bildschirmen, die Kopfhörer auf den Ohren. Nach jedem Film ging ich voller Bewunderung über Jims Interpretationen meine Notizen durch und machte mir noch mehr.
Bei der zweiten Vorlesung fiel es mir verdammt schwer, mich auf das zu konzentrieren, was Jim sagte. Immer wieder ließ ich mich vom Klang seiner Stimme davontragen. Er hat eine dunkle, aber zärtliche Stimme, die nie laut wird. Mehr noch aber gefällt mir die Art, wie er spricht: Ruhig und überlegt, mit nachdrücklicher Betonung. Obwohl meine Englischkenntnisse dank meiner amerikanischen Mutter auf dem Niveau eines Muttersprachlers sind, musste ich mir andauernd Begriffe notieren, die er verwendete und die ich nicht kannte. Danach schauten wir uns wieder einen Film an, diesmal über abgefuckte Vorstadtkids, die nach New York abhauen und ungefähr das erleben, was man erwarten würde.
Als der Film endete, war es bereits zehn Uhr abends. Draußen herrschte noch immer sommerliche Hitze. Eine Hitze, die die Stadtlichter zum Schmelzen bringt und alles so viel berührbarer wirken lässt. Wer einen solchen Abend schon einmal in New York erlebt hat, weiß, dass man dabei nie wieder schlafen will, sondern endlos durch die Nacht flanieren möchte.
„Das Diner, das wir gerade im Film gesehen haben, ist direkt hier um die Ecke“, sagte Jim, als wir alle vor dem Kino standen. Schweiß brach mir aus, aber ich konnte nicht sagen, ob es an der Hitze oder an Jims Nähe lag. Noch immer würdigte er mich keines Blickes und fuhr fort: „Eine Institution in der Nachbarschaft, und die Pancakes sind richtig gut. Wer hat Lust auf einen Ausflug?“
Sieben Studenten schlossen sich ihm an, einer davon ich. Mein Herz klopfte wie wild, als ich hinter der Gruppe herging. Seine bloße Gegenwart brachte mich durcheinander. In dem Diner, das tatsächlich noch das braun-orange Design wie während des Filmdrehs vor vierzig Jahren hatte und dadurch aus der Zeit gefallen wirkte, rutschten wir alle an einem Tisch zusammen. Ich saß am weitesten von Jim entfernt, was aber auch bedeutete, dass wir direkt im Blickfeld des anderen saßen. Er sah mich an. Wahrscheinlich zum dritten Mal überhaupt. Irgendetwas war in seinen Augen – Sorge, weil ich gesehen hatte, wie er seinem Liebhaber eine Ohrfeige gab? Oder Empörung, weil ich sie schamlos beobachtet hatte? Oder Verwunderung, weil er mir genau anmerkte, dass meine Knie zitterten …? Ich starrte auf die Speisekarte, die uns eine freundliche Kellnerin hinlegte.
Fast alle bestellten Pancakes mit Ahornsirup, Speck und Butter und dazu Kaffee, auch Jim und ich. So spät noch Kaffee zu trinken und Junk-Food zu essen sorgte dafür, dass ich mich wie ein Kind bei einer Übernachtungsparty fühlte. Für meine amerikanischen Kommilitonen schien es alltäglicher zu sein, denn sie stopften sich voll, als wäre es das normalste der Welt, um zehn Uhr abends Speck und Pancakes zu essen.
Und dann wurde leidenschaftlich über Filme diskutiert. Nur ich hielt den Mund. Ich hörte im Kopf, was ich sagen wollte, bevor ich es aussprach, und fand alles haarsträubend einfältig oder prahlerisch. Also aß ich wie ein Idiot meine Pancakes und trank meinen Kaffee, während Jim den anderen aufmerksam zuhörte und jedem das Gefühl gab, einen interessanten Beitrag zu leisten. Gerieten zwei mit ihrer Meinung aneinander, schlichtete er mit spöttischen, aber immer liebevollen Witzen, die er so todernst vortrug, dass alle anderen lachen mussten. Ich war hingerissen, konnte aber den Blick nicht heben. Hätte er mir nochmal in die Augen geschaut, hätte er sofort gewusst, was ich empfand, daran zweifelte ich nicht.
Die Gruppe blieb sage und schreibe zwei Stunden im Diner. Und die Diskussionen über Filme und Filmschaffende hätten noch bis zum Morgengrauen weitergehen können, wenn Jim nicht irgendwann aufgebrochen wäre. Ein paar Studenten blieben tatsächlich noch sitzen, um weiterzureden, denn das Diner hatte vierundzwanzig Stunden lang geöffnet, sieben Tage die Woche. New York eben. Wir anderen folgten Jim zur U-Bahn.
Mein Studentenwohnheim war in der Nähe, aber es war unmöglich, mich zu trennen. Vor allem, weil ich dann den Mund aufmachen und mich verabschieden müsste, und dafür war ich hundertmal zu verstockt. So stapfte ich hinter Jim und den anderen her und fragte mich, ob die anderen mich schon für grenzdebil hielten oder einfach als depressiv abstempelten.
Bei der Subway fuhr Jim Richtung Downtown, weil er in Brooklyn lebte, wie er sagte. Ein paar andere mussten nach Uptown, und ich blieb bei ihnen stehen, als die beiden Gruppen sich verabschiedeten. Als Jim weg war, konnte ich endlich wieder sprechen, so als wäre ein Zauberbann von mir gehoben worden, und sagte, dass ich doch lieber nach Hause laufen wollte.
Und ich lief. Ich konnte nicht langsam sein, ich flog geradezu nach Hause. Mir war klar, dass ich über die anregenden Gespräche, die Filme und Interpretationen nachdenken sollte, aber ich war so voll von Eindrücken von meinem Professor, dass ich kaum einen Gedanken fassen konnte. Dinge, die er gesagt hatte, flirrten mir durch den Kopf. Als ich schließlich in meinem schmalen Bett lag, die Lichter der Stadt an den Wänden und der Decke, stellte ich mir vor, ich wäre hinter ihm her nach Brooklyn gefahren. Und dann hätte ich durch ein Fenster beobachtet, wie er zu seinem Liebhaber nach Hause kam und die beiden stritten … Ich masturbierte mit geschlossenen Augen und fragte mich erst danach, ob ich hoffnungslos pervers war. Und was mein Professor wohl denken würde, wenn er davon wüsste.
Bei der nächsten Sitzung zwei Tage später kündigte Jim einen Vortrag an, der nicht direkt mit dem Thema „Punk Cinema“ zu tun hatte, aber im Gesamtzusammenhang vielleicht sinnvoll wäre. Er bat uns um unsere Meinung, ob er den Vortrag im Programm behalten sollte oder nicht.
„Das Thema, über das ich heute sprechen will“, sagte er, „lautet: Physische Gewalttätigkeit als Mittel politischen Ungehorsams.“
Er holte weit aus, zitierte Psychoanalytiker und Soziologen, analysierte, wie tabuisiert Aggression und Wut in der Gesellschaft seien, und unter welchen Umständen private Handlungen als politisch gelten können. Mir rauchte der Kopf, und meine Hand schmerzte vom schnellen Schreiben. Jeder zweite Satz, den er sagte, kam mir wie eine Erleuchtung vor. Die ganze Zeit fragte ich mich, ob er von sich selbst erzählte; ob der Vortrag eine Rechtfertigung war, selbst gewalttätig zu sein. War die Ohrfeige ein einmaliges Fehlverhalten gewesen? Oder war er zu Hause noch extremer? Wenn ich ihn sprechen hörte, seine ruhigen Gesten sah, konnte ich es mir nicht vorstellen. Dann wieder schlichen sich Bilder in meinen Kopf, Bilder, in die Wut in seinen Augen aufloderte und mich mit ansteckte. Ich spürte, wie ich hart wurde, und hoffte, dass sich kein Blick auf meinen Schritt verirrte.
Wir schauten uns im Anschluss „Fight Club“ von David Fincher an, und Jim empfahl uns, die Romanvorlage von Chuck Palahniuk oder andere Werke des Autors zu lesen. Da ich sowieso schon viel zu viele Filme guckte, wollte ich mir diesen Rat zu Herzen nehmen.
Der Film endet mit einer berühmt gewordenen Szene, in der die Wolkenkratzer von New York an der nächtlichen Skyline einstürzen. Als wir aus dem Kinosaal gingen, redeten alle nur davon. Jim, der schmunzelnd zuhörte – wahrscheinlich hatte er schon hunderte Stunden mitangehört, wie immer neue Generationen von Studenten begeistert von dem Film sprachen –, zückte draußen sein Handy und entschuldigte sich kurz. Er telefonierte mit jemandem. Als er auflegte, konnte er nur schwer ein zufriedenes Grinsen unterdrücken.
„Also, wer möchte, kann noch mitkommen“, sagte er. „Aber ihr müsst versprechen, euch zu benehmen. Und ja niemandem davon zu erzählen. Ein Bekannter von mir betreibt einen Nachtclub in der Nähe. Ich vermute, nicht alle von euch sind bereits einundzwanzig, aber er würde uns auf seine Dachterrasse lassen. Von dort oben haben wir fast so einen Ausblick wie unser Held im Film. Aber kein Alkohol, okay?“
Wir versprachen es alle hoch und heilig. Es belustigte mich, wie strikt das Alkoholverbot in den USA war. Ich hatte in Deutschland ja schon mit sechzehn legal Bier auf Partys getrunken – und sogar davor ab und zu mit meinen Eltern Wein.
Wir fuhren mit einem UBER-Taxi in den Meatpacking District, wo das Nachtleben brodelte. In einem Lagerhaus nahmen wir einen Aufzug bis ins oberste Stockwerk, wo uns zwei einschüchternde Security-Männer erst abschätzig musterten, aber dann durchließen, als Jim uns vorstellte. Durch einen schwarzen Gang gelangten wir in eine weitläufige Bar, deren Decke wie eine gigantische Lavalampe ihre Farben wechselte. Blau floss über in ein warmes Rot, das sich in ein nahezu psychodelisches Violett verwandelte. Schöne und vor allem schön gekleidete Menschen tummelten sich an den beiden Bartheken, in den Polstersitznischen und auf der Tanzfläche. Erst auf den zweiten Blick fiel mir auf, dass es mehr Männer als Frauen gab. Und dass eine überdurchschnittliche Anzahl dieser Männer mit ziemlicher Sicherheit schwul war.
Die vagen Träume, die ich von meinem Leben in New York City gehabt hatte, realisierten sich in dieser Sekunde. Ich musste aufpassen, mir meine Begeisterung nicht anmerken zu lassen zwischen meinen Kommilitonen, die sich alle Mühe gaben, so zu wirken, als würde sie das alles kalt lassen.
Jim scheuchte uns durch die Bar und eine Stahltreppe hinauf, vorbei an noch mehr Sitzgelegenheiten und Liegeflächen voller heiterer Leute, und durch eine massive Tür hinaus ins Freie.
Hier auf dem Dach legte ein DJ romantische Klänge auf, die vom lauen Sommerwind davongetragen wurden. Jim steuerte die Balustrade an, und wir lehnten uns dagegen und genossen den schwindelerregenden Ausblick in die Ferne und in die Tiefe. Ausnahmsweise drehte sich das Gespräch nicht um Filme. Jim erzählte von der Geschichte der Nachbarschaft, vom Nachtleben und – ich konnte vor Aufregung kaum atmen – der Schwulenbewegung, die hier in den Siebzigern stattgefunden hatte.
„Kommen Sie von hier?“, hörte ich mich fragen.
Er sah mich an. Seine dunkelbraunen Augen schienen innerhalb eines Blickes all meine Geheimnisse zu durchleuchten … und als er lächelte, fühlte es sich an, als würde er jedes noch so beschämende akzeptieren.
„Nein, ich bin vor zwei Jahren hergezogen. Geboren bin ich in Kalifornien. Mexikanische Mutter, weißer Vater. Und woher kommen Sie?“
„Deutschland.“
„Deutschland! Ich sage jetzt nichts über Autos, Würstchen oder Nazis. Aber enttäuschender Weise geht mir genau das durch den Kopf. In der Reihenfolge.“
„Nicht Lola Rennt von Tom Tykwer? Der Film müsste nach Ihrer Definition von Punk Cinema eigentlich ein Punk-Film sein.“
Er richtete sich ein wenig auf. „Den Film will ich euch noch vorführen.“
Ich lächelte. „Und trotzdem sind Ihnen zuerst Autos, Würstchen und Nazis eingefallen.“
„Spielzeug, Essen, Feinde – das gibt einen tiefen Einblick in meinen Charakter, hm?“
„Boys will be boys“, fiel mir ein – ein englisches Sprichwort, das ich, abgesehen von der dubiosen Bedeutung, an sich immer ganz niedlich gefunden habe.
Er lachte. Leise, fast nur ein Geräusch aus seiner Nase. Ich wollte ihm um den Hals fallen.
Wenig später kam ein großer, feister Chinese in einem maßgeschneiderten Anzug und schulterlangen, grauen Haaren zu uns und umarmte Jim. Jim stellte ihn als Mr. Wong vor, den Besitzer des Clubs, dessen Freundlichkeit wir es zu verdanken hatten, hier sein zu dürfen. Mr. Wongs Gesichtsausdruck schien in einem Lächeln festgefroren zu sein. Es war ein Lächeln, das völlig sinnentleert wirkte. Vielleicht, weil seine Haut verdächtig glatt und straff war, s als hätte der Beauty-Doc ein wenig zu viel nachgeholfen. Er klopfte Jim auf die Schulter und sagte, dass er Filme liebte, dann informierte er uns, dass wir auch alkoholfreie Getränke kaufen könnten, und verabschiedete sich wieder. Dabei drückte er im Vorbeigehen meine Schulter so wie Jims. Verwirrt sah ich ihm hinterher, doch beschloss dann, mir nichts dabei zu denken. Vielleicht war Mr. Wong es einfach gewohnt, ständig mit Fremden Small-Talk zu halten, und behandelte darum jeden wie einen Bekannten.
Da die Studenten alle etwas trinken wollten und manche auch schon älter als einundzwanzig waren, gingen wir schließlich zur Bar. Jim bestellte sich einen Orangensaft, was ich ihm gleichtat. Doch mein Saft kam nicht mit den anderen Getränken. Stattdessen reichte mir der Barkeeper etwas später mein Glas und winkte mich näher zu sich heran.
„In fünf Minuten vor den Toiletten unten“, sagte er.
„Wie bitte?“ Ich war mir sicher, mich verhört zu haben. Aber der Barkeeper hatte sich bereits abgewandt, um eine andere Bestellung aufzunehmen. Irritiert nippte ich an meinem Getränk – und hätte es fast wieder ausgespuckt. Es war Orangensaft, aber nur zu einem kleinen Teil. Der größere Teil schien aus Wodka oder Gin zu bestehen.
„Alles in Ordnung?“, fragte Jim, als er meine Miene bemerkte.
„Ja“, log ich.
Er schien misstrauisch, aber zum Glück lenkte ihn ein anderer Student mit einer Frage ab. Ich sah mich unauffällig nach dem Barkeeper um. Er wirkte recht feminin, mit einem bauchfreien Top und vielleicht sogar ein wenig Wimperntusche an den Augen. Aber er beachtete mich kein bisschen und war vollauf mit seiner Arbeit beschäftigt. Nein, er war nicht derjenige, der mich in fünf Minuten vor den Toiletten treffen wollte. Aber wer dann? Ich ließ den Blick schweifen. Ein umwerfend hübscher, dunkelhäutiger Mann erwiderte meinen Blick mit einem spöttischen Funkeln. War er es? Aber er wandte den Blick ab und vertiefte sich wieder in das Gespräch mit einem anderen Mann.
Ich zog mein Handy aus der Hosentasche und las in den folgenden fünf Minuten immer wieder die Uhrzeit ab. Sollte ich wirklich nach unten gehen? Natürlich war das eine rein theoretische Frage – allein aus Neugier musste ich gehen! Nach fünf Minuten entschuldigte ich mich und suchte die Toiletten auf.
Vor der Tür stand ein breit gebauter Sicherheitsangestellter. Als er mich sah, bedeutete er mir, ihm zu folgen. Mit mulmigem Gefühl ging ich ihm nach. Er führte mich am Hauptbereich des Clubs vorbei und öffnete eine Tür, die in der schwarz gemusterten Tapete kaum sichtbar war. Er winkte mich hindurch, und ich gab mir alle Mühe, mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen.
Ich betrat einen schlichten, aber edlen Raum mit chinesischen Möbeln. Durch einen venezianischen Spiegel konnte man den Club unten sehen, aber nicht hören. Hinter einem riesigen Schreibtisch ging Mr. Wong auf und ab und telefonierte mit jemandem auf Mandarin. Der Sicherheitsangestellte schloss die Tür hinter uns und bedeutete mir, zu warten.
Ich wartete also, bis das Telefonat von Mr. Wong beendet war. Er winkte mich zu einer Sofaecke und lehnte sich selbst gegen die Lehne eines Sessels. Hastig wischte ich mir meine schweißnassen Hände an der Hose ab.
„Ich freue mich, dass wir uns unter vier Augen sprechen können“, sagte er, als sei der Sicherheitsangestellte nicht vorhanden. „Gefällt dir der Drink? Es ist mein Lieblingswodka.“
„Danke.“ Ich versuchte mir nicht anmerken zu lassen, dass seine Sprechweise mich irritierte. Er schien zwischen den Worten kaum merklich zu grunzen, so als bekäme er nicht genug Luft.