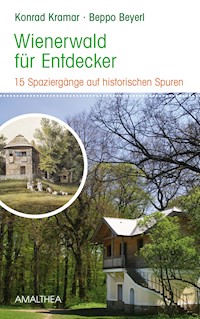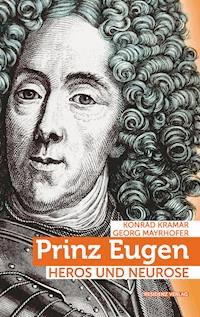
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zum 350. Geburtstag: Der Mensch hinter dem Mythos, vielschichtig, genial, modern, von Ängsten getrieben und von Zwängen bestimmt. Kriegsherr, Stratege, Philosoph, Gärtner, Baumeister - das historische Bild des Prinzen Eugen von Savoyen ist so übergroß wie seine Statue auf dem Wiener Heldenplatz. Treue und Ehrgefühl bestimmten sein Handeln, seine Persönlichkeit aber war von tief sitzenden kindlichen Neurosen geprägt, verborgen nur hinter einem "Image", das er ein Leben lang schützend vor sich her trug. Konrad Kramar und Georg Mayrhofer zeichnen vor dem Hintergrund seiner Zeit, aber aus dem Blickwinkel unserer Gegenwart, das vielschichtige Porträt einer öffentlichen Person, die Weichen stellte - und das eines privaten Menschen, der sich hinter der eigenen Heldenrolle zu verbergen suchte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KONRAD KRAMARGEORG MAYRHOFER
Prinz Eugen
HEROS UND NEUROSE
RESIDENZ VERLAG
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2013 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4337-7
ISBN Printausgabe:978-3-7017-3289-0
INHALT
Unser kleiner Prinz
1. Der Held betritt die Bühne
2. Aufstieg mit Stil
3. Eros und Neurose
4. Der Held, der eine Armee zerstörte
5. Geizig, gierig und genial
6. Ihro Gnadens umfassendes Wissen
7. Ein Schloss, in die Luft modelliert
8. Tragisches Finale
Zeittafel
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Dank
Namenregister
1 Eugen Prinz von Savoyen-Carignan, porträtiert in einem Stahlstich aus dem 19. Jahrhundert
1663
Geburt Prinz Eugens
1683
Eugen flieht aus Frankreich und tritt ins kaiserliche Heer ein
1668
Erste Eroberung Belgrads, Eugen wird schwer verwundet
1693
Ernennung Eugens zum Feldmarschall
1694
Eugen wird Oberbefehlshaber in Italien
1697
Eugen schlägt die Türken bei Zenta
1703
Eugen wird Präsident des Hofkriegsrates
1705
Leopold I. stirbt, Joseph I. folgt ihm als Kaiser auf den Thron
1707
Eugen wird Statthalter von Mailand
1708
Eugen und der Herzog von Marlborough besiegen Frankreich bei Oudenaarde
1711
Joseph I. stirbt, ihm folgt sein Bruder Karl VI. auf den Kaiserthron
1714
Der »Frieden von Rastatt« beendet den Spanischen Erbfolgekrieg; Baubeginn von Schloss Belvedere
1716
Eugen besiegt die Türken bei Peterwardein; Eugen wird Generalgouverneur der Spanischen Niederlande (heutiges Belgien)
1717
Eugen erobert Belgrad
1718
Der »Frieden von Passarowitz« beendet alle Türkenkriege
1724
Vollendung von Schloss Belvedere durch Johann Lukas von Hildebrandt
1736
Tod Prinz Eugens
Unser kleiner Prinz
Als österreichische Kinder lernten wir den »edlen Ritter« Prinz Eugen schon in der Volksschule kennen. Wir erhielten vage Berichte über die Befreiung Wiens von der osmanischen Belagerung und von Schlachten an Orten, die wir auf der Landkarte kaum finden konnten. Und es wurde uns eingebläut, dass es sich bei diesem Prinzen, dessen Vorname, anders als bei seinen Namensvettern, auf der zweiten Silbe – also »Eugén« – betont wurde, um einen großen Österreicher handelte. Er lebte – auch das war für »Taferlklassler« schwer einzuordnen – irgendwann in einer lang vergangenen Zeit, die einem bei Sonntagsausflügen in Form von opulenten Kirchen mit blattvergoldeten Altären begegnete.
Mit ein wenig Pech fand sich noch ein Onkel, der einen mit langatmigen militärhistorischen Berichten über den Prinzen Eugen langweilte oder einem – schon besser – beim Besuch des Heeresgeschichtlichen Museums Eugens Brustharnisch zeigte. Als Kind stellte man erstaunt fest, dass der berühmte Feldherr ungefähr den gleichen Brustumfang wie man selbst hatte. Schaudernd betrachtete man die Delle, die eine Musketenkugel hinterlassen hatte, und nahm pflichtschuldig zur Kenntnis, dass vor gut drei Jahrhunderten ein mutiger Draufgänger in Wien gelebt hatte. Warum besagter Onkel das mit so bewegter Stimme erzählen musste, blieb allerdings ein Rätsel, dem nicht weiter nachgegangen wurde – schließlich wollte man das Eis, das einem nach erfolgreich absolviertem Museumsbesuch in Aussicht gestellt worden war, nicht gefährden.
Sollte man in den Genuss einer höheren Schulbildung gekommen sein, war der Besuch der Österreichischen Nationalgalerie im Schloss Belvedere obligatorisch. Neben der für Pubertierende enttäuschenden Erfahrung, dass die Bilder nackter Frauen aus dem Barock eher an die eigene Tante Minna erinnerten (und die Damen der damaligen Zeit offensichtlich eine ähnlich fatale Neigung zu Kuchenbüfetts gehabt hatten), erfuhren wir, dass es sich dabei um das Schloss des Prinzen handelte. Die Aufmerksameren unter uns stellten fest, dass das Belvedere auch nicht viel kleiner als Schönbrunn war und eine unvergleichlich bessere Lage hatte. Der Verdacht drängte sich also auf, dass es sich beim Prinzen Eugen um eine bedeutende Persönlichkeit seiner Zeit gehandelt haben musste. Den Bezug zum Heute blieben Lehrer und andere Propagandisten der österreichischen Glorie allerdings schuldig. Die Information, dass er durch seine militärischen Leistungen die Grundlage für das Kaiserreich Österreich-Ungarn gelegt hatte, war, mehr ein halbes Jahrhundert nach dessen Untergang, auch nicht gerade interessant.
Vielleicht stand man später noch einmal vor dem monumentalen Reiterstandbild des Prinzen Eugen auf dem Heldenplatz und erfuhr, dass es sich dabei um ein Wunderwerk der Bronzegusstechnik und der Statik handelte, steht das schwere Monument doch nur auf den filigran wirkenden Hinterbeinen des Pferdes und wird durch den Schweif gerade einmal abgestützt. War man nicht gerade HTL-Schüler oder aus anderen Gründen an Bronzeguss und Statik interessiert, kam man um die Frage nicht herum, warum der Prinz fast 300 Jahre nach seinem Tod noch immer so populär war. Ihm gegenüber befindet sich das Reiterstandbild Erzherzog Karls (das von Statik und Bronzeguss her sogar noch bemerkenswerter ist, da es allein von den Hinterläufen des Pferdes getragen wird), der immerhin Napoleon besiegte und trotzdem froh sein muss, wenn allfällige Betrachter ihn in seiner historischen Bedeutung richtig einordnen können. Ähnlich geht es auch allen anderen österreichischen Feldherren, deren Denkmäler während der Gründerzeit rund um die Wiener Innenstadt verstreut wurden. Auf den Schultern der Sieger lang vergangener Schlachten hat sich Staub angesammelt, und nur Geschichtslehrer bekommen vor Aufregung gelegentlich noch rote Bäckchen, wenn sie von deren Taten berichten.
Anders bei Prinz Eugen: Der hält sich – im Vergleich – frisch, lebt in einem Lied weiter und erfreut sich, trotz wachsender innerer Distanz des Normalbürgers zum Militär, immer noch großer Beliebtheit. Der Schlüssel liegt wohl darin, dass die militärische Komponente nur ein Aspekt im ungewöhnlichen Leben des Prinzen war. »Man hat über Schlachten und Jahreszahlen den politischen Architekten und Seher vergessen«, schrieb Otto Habsburg im Vorwort einer der vielen populären Prinz-Eugen-Biografien. Und man möchte unserem (Fast-)Kaiser zu dieser wichtigen Einschätzung noch nachschicken, dass Eugen vor allem die damalige Moderne in das recht provinzielle Österreich brachte. Der »kleine Prinz« stellte einige Weichen, die bis heute nachwirken. Er unterstützte die Vorläufer der Akademie der Wissenschaften, und seine Büchersammlung bildet den Grundstock der Öster reichischen Nationalbibliothek. Seine Hofführung und sein Umgang mit Geschäfts- und Vertragspartnern galten als vorbildlich, und er wurde um seinen legendären Geschäftssinn beneidet. Selbst die österreichische Beamtenschaft kann sich rühmen, einen wichtigen Teil ihrer Wurzeln im Mitarbeiterstab des savoyischen Prinzen zu haben. Waren doch seine Sekretäre und deren Methoden Vorbild für die Verwaltungsreformen Maria Theresias und ihrer Nachfolger. Und, symbolträchtig angesichts der legendären Sparsamkeit des Prinzen, der österreichische Finanzminister residiert bis heute in Eugens Stadtpalais. Generationen von Machthabern, seien es die Habsburger, die Austrofaschisten oder die Nationalsozialisten, haben sich auf Prinz Eugen berufen, und selbst die neue österreichische Rechte beschwört die Erinnerung an ihn herauf, wenn es um die Abwehr einer vermeintlichen islamischen Bedrohung geht.
Die Biografie dieses vielschichtigen Mannes, der als mittelloser Volontär in die kaiserliche Armee eintrat und hoch angesehen als einer der reichsten Fürsten Europas starb, ist heute noch spannend. Es ist die Geschichte eines Menschen, dessen Bandbreite groß genug war, Österreich und auch Europa bis heute zu prägen.
Konrad Kramar & Georg Mayrhofer,September 2012
1.Der Held betritt die Bühne
Auf die Bewohner des barocken Wien muss Eugène de Savoie-Carignan gewirkt haben wie auf uns jemand, der mit den neuesten Trends und Ideen aus New York kommt. Dem fast noch mittelalterlichen, vom Denken der Renaissance und der beginnenden Aufklärung nur zart gestreiften österreichischen Schwert adel blieb ob des Lebenskonzepts, des Tempos und der Ideenwelt des quirligen Prinzen schlicht und einfach die Luft weg.
Die Welt war im Wandel begriffen, und dieser Wandel fand definitiv anderswo statt als im damals noch kleinen, rückständigen Österreich. Der deutsche Adel mit seinem mittelalterlichen Lehnssystem und einer Vorstellungswelt, die auf einer gottgegebenen Ordnung der Dinge beruhte, hatte sich überlebt. Auch die ursprüngliche Aufgabe der Aristokratie, die Kriegsführung, wurde plebejisiert. Krieg war nicht mehr die Aus einandersetzung einer hoch spezialisierten Elite. Ungeschulte Landsknechte ersetzten die Ritterschaft, waren schneller, billiger, effizienter, leichter auszutauschen, und die Herrscher konnten sie in Friedenszeiten auch wieder loswerden. Der Adel, natürlich immer noch größter Landbesitzer und damit, trotz der wirtschaftlichen Dynamik der Neuzeit, kein unerheblicher Machtfaktor, suchte eine gesellschaftliche Aufgabe. Doch der Adelsstand war bedroht, durch Revolutionen von unten wie von oben.
Philosophen wie Thomas Hobbes postulierten einen Gesellschaftsvertrag, der den Menschen als Individuum begriff, das nach einer staatlichen Organisationsform strebte, um dem Chaos zu entkommen. In diesem Streben nach Ordnung übertrugen die Menschen laut Hobbes die staatliche Gewalt einem Souverän. Wohlgemerkt einem Souverän, nicht zwingend einem König – von einer Erbstruktur in der gesamten Verwaltung, mit Rechtshoheit auf jedem noch so kleinen Rittergut, gar nicht zu reden. Am Vorabend der Aufklärung schien den Denkern des Abendlandes die direkte Einmischung Gottes in die Frage, wer einen Staat verwalten soll, etwas anmaßend. Der deutsche Philosoph Samuel von Pufendorf brachte noch die Vorstellung der unveräußerlichen Würde des Menschen, der »dignatio«, in die Diskussion ein, heute Bestandteil aller Verfassungen und der Deklaration der Menschenrechte. Da war es nicht mehr weit zu Hugo Grotius, der ein Selbstverteidigungsrecht des Menschen gegen den seine Macht missbrauchenden Souverän verkündete. Ein Recht, das seine holländischen Landsleute und später die Engländer auch gleich in Anspruch nahmen. Von adeligen Geburtsrechten war in diesen frühen republikanischen Gedankenwelten schon nicht mehr die Rede.
Die andere Revolution kam von oben, von den Herrscherhäusern, und entstammte ebenfalls der Gedankenwelt von Thomas Hobbes, der den Absolutismus in seinem Leviathan beschrieb. Besonders die französischen Staatsminister Richelieu und Mazarin festigten die Zentralgewalt und ersetzten das alte Lehnssystem durch staatliche Verwaltungsstrukturen. Unter König Ludwig XIV. gelangte es zur Perfektion. Hier war keine Rede mehr von irgendwelchen Rechten, die irgendwer außer dem Herrscher innehaben sollte. Alle Macht hatte sich im Herrscher zu vereinigen, alle Fäden hatten in seiner Residenz zusammenzulaufen. Die barocke Vorstellungswelt des Absolutismus ging so weit, dass man sich Herrscher und Land ident dachte, sein Körper die Erde, seine Knochen die Felsen, seine Adern die Flüsse. Souverän und Land verschmolzen zu einer Einheit, die restlichen Menschen waren nur noch die Bewohner des Landes und schon dadurch zweitrangig. Interessanterweise wurde dem Adel in diesem System keine Rolle zugedacht, zumindest keine selbstständige. Der Adel sollte höfisch sein. Das heißt, wollte man Bedeutung haben, musste man am Hof sein. War man am Hof, spielte man das Spiel nach den Regeln des Königs, und das war teuer. Alle potenziellen Konkurrenten ruinierten sich wirtschaftlich, um den modischen Anforderungen eines standesgemäßen Lebens zu entsprechen. Alle Gedanken konzentrierten sich auf das höfische Leben; für politische Konzepte, vielleicht sogar in Opposition zum König, durfte kein Raum sein. Ludwig XIV. achtete akribisch darauf, den französischen Adel in diesem entmündigten Zustand zu halten. Die Fronde, ein Adelsaufstand, war eine traumatische Jugenderinnerung und sollte bestimmend für sein Handeln sein. Der damalige Thronfolger hatte vor den Aufständischen aus Paris fliehen müssen – eine Demütigung, die der Sonnenkönig nie vergaß. Ludwigs System war außerordentlich erfolgreich. Der französische Adel stellte die Souveränität des Königshauses nie wieder infrage. Erst die Französische Revolution zerstörte das inzwischen völlig dekadente System des Absolutismus.
Während Kardinal Richelieu und seine Nachfolger die absolute Macht des Königs absicherten, erkämpften sich die Holländer gegen Spanien die Freiheit. Die »Republik der sieben vereinigten Provinzen« wurde der erste erfolgreiche, demokratische Staat des neuzeitlichen Europa. Die Holländer dominierten die Wirtschaft, ihre Kriegsschiffe die Meere und ihre Kunst die kulturelle Entwicklung.
Die Engländer wankten hin und her. Die Dynastie der Stuarts versuchte, ein absolutistisches System zu installieren, scheiterte aber an der eigenen Unfähigkeit und vor allem an dem tief im Puritanismus verwurzelten republikanischen Gedankengut. Die Engländer revoltierten, der König wurde hingerichtet, und unter der Führung Oliver Cromwells entstand eine Republik, die allerdings eher die Züge einer frömmlerischen Diktatur trug. Die Restauration der Stuarts scheiterte an deren unsensibler Religionspolitik. Erst mit der »glorious revolution« unter der Führung Wilhelm von Oraniens fand England zu seiner Form des inneren Interessenausgleichs und damit zu der konstitutionellen Monarchie, wie wir sie noch heute kennen.
Interessanterweise förderten beide Entwicklungen trotz ihrer Gegensätzlichkeit den Rationalismus. Beide Systeme schufen ein Klima der geistigen Offenheit. In Ludwigs Frankreich verloren Adel und Klerus im Verhältnis zum König dermaßen an Gewicht, dass ein Vakuum entstand, in das Intellektuelle und bürgerliche Kräfte vorstießen. Außerdem benötigte Ludwig XIV. für seine Kriegs- und Bauprojekte jede Menge Know-how. In Holland und England schuf der Puritanismus zwar nicht unbedingt ein geistig offenes Klima, aber durch seine sehr diesseitige Ausrichtung und dadurch, dass die Kulturträger aus dem praktischer veranlagten Bürgertum stammten, entstand ein Forum für brauchbare Ideen. Schlagartig ging der Samen des Humanismus und der Renaissance auf. Die moderne Naturwissenschaft entstand. Newton, Boyle, Pascal und Spinoza schufen maßgebliche Werke, die die Welt nachhaltiger verändern sollten als alle Kriege. In England wurde die Royal Society gegründet, in Paris die Académie Royale, zwei bis heute existierende Institutionen, die sich vor allem der Naturwissenschaft und der Mathematik verschrieben. Am französischen Hof galt es als schick, fachkundig über die neuesten Entwicklungen in der Wissenschaft zu parlieren, Bildung war plötzlich Bestandteil des höfischen Lebens. Paris war das Zentrum des Geistes, der Macht und des Fortschritts.
Eugen, Sohn einer ehemaligen Geliebten Ludwigs, wurde von den hohen Idealen dieses Hofes ebenso geformt wie von den beginnenden Auswüchsen. Er saugte die damalige Moderne quasi mit der Muttermilch auf. Zwar konnte er sich im Frankreich des Sonnenkönigs mit seinen Ambitionen nicht durchsetzen, sein Bild von der Welt bestimmte es jedoch bis zum Schluss. Und er trug diese Lebensform, diesen neuen, in seinen Interessen so unendlich weiter gespannten Zugang zum Leben bis in das verschlafene Wien. Mode und Accessoires hatten ihren Weg schnell dorthin gefunden, doch die geistige Öffnung war am vom Klerus dominierten Wiener Kaiserhof nicht wirklich willkommen.
Eugen, mit den Bourbonen wie mit den Habsburgern nahe verwandt, hatte keinen guten Stand am Hof des Sonnenkönigs. Im Machtkampf um die Kontrolle über Versailles, der in Paris auch immer ein Machtkampf um die Geschlechts teile Ludwigs war, hatte Eugens Mutter, Olympia Mancini, den Bogen eindeutig überspannt. Die ehemalige Geliebte Ludwigs war in einen Giftmischerskandal verwickelt, musste Paris verlassen und in die Verbannung nach Brüssel in den Spanischen Niederlanden, dem späteren Belgien.
Eugens Vater, der hoch angesehene Soldat Eugen Moritz von Savoyen-Carignan, war früh verstorben. Nach einer freudlosen Kindheit verbrachte Eugen als Jugendlicher seine Zeit ohne große Zukunftsperspektiven in Paris und pflegte schlechten Umgang. Exzesse und dekadente Verirrungen der Jugend nötigten sogar Ludwig XIV., selbst kein Kind von Traurigkeit, zum Einschreiten. Prinz Eugen erwarb sich den Ruf eines »petite salope«, einer unordentlichen, wenn nicht unwürdigen Existenz. Aber Eugen wollte es zu etwas bringen. Die Adeligen, auch wenn sie zum Hochadel gehörten wie Eugen, waren durch Ludwig XIV. entweder zu einem müßigen Leben als Hofschranzen verurteilt (allerdings musste man sich das leisten können), oder sie mussten sich, wie jeder andere auch, eine Aufgabe suchen. Traditionell standen Diplomatie und Militär als standesgemäße Tätigkeiten offen, aber da musste der König überzeugt sein, dass man zu etwas nütze war. Und das gelang Eugen nicht. Eugen war, wie man heute sagen würde, ziemlich gut vernetzt. Zu seinen engsten Freunden gehörte Louis Armand Prinz Conti, der mit Ludwigs illegitimer, aber offiziell anerkannter Tochter Made moiselle de Blois verheiratet war. Der zwei Jahre ältere Schwiegersohn des Königs verschaffte Prinz Eugen die heiß ersehnte Audienz, wo er seinen Wunsch vortrug, beim Militär Karriere zu machen. Ludwig lehnte ab. Die Verehrer Prinz Eugens kolportierten folgende Anekdote. Nach erfolgter Ablehnung wandte sich Ludwig an seine Berater und soll gefragt haben: Est-ce que j’ai fait la plus grande gaffe de ma vie? (Habe ich die größte Dummheit meines Lebens begangen?) Das würde aber, bei allem Respekt für den politischen Weitblick des Sonnenkönigs, doch fast hellseherische Fähigkeiten vorausgesetzt haben. Die Quelle dieser der Heldenverehrung sehr zuträglichen Anekdote dürfte Voltaires Das Zeitalter Ludwigs XIV.sein. Darin berichtet Voltaire von der Flucht Eugens und des Prinzen Conti. Ludwig soll ironisch gefragt haben, ob das nun ein großer Verlust sei. Schnell wurde ihm versichert, dass der Prinz von Savoyen immer ein unordentlicher und unfähiger Mensch bleiben würde. Eine andere Quelle berichtet, dass Ludwig zwar Eugens Wunsch nach einem militärischen Amt als berechtigt ansah, die Art und Weise, wie Eugen dieses gefordert hatte, allerdings als unverschämt empfand. Das würde zu Eugens Charakter passen. Er neigte zur Ungeduld und trat auch später dem Kaiser gegenüber sehr fordernd auf, wenn es um seine Rechte ging. Die Habsburgerkaiser, die ein etwas uneitleres Selbstbild hatten, tolerierten dieses Auftreten im Gegensatz zu Ludwig aber. Es stimmt allerdings, dass Ludwig den Werdegang Eugens interessiert verfolgte und später erkannte, dass er ein großes Talent an den Kaiser verloren hatte. Die letzte Mätresse Ludwigs, Madame de Maintenon, überlieferte in einem Brief die späte Wertschätzung des Sonnenkönigs. »Dieser Prinz ist ein unnachahmliches Muster für alle Regenten und Staatsämter«, soll Ludwig im Alter gesagt haben. »Ich kann seine eiserne Treue und Anhänglichkeit an seinen Souverän, sein reines Gefühl von Vaterlandsliebe und den hohen Begriff von strenger Erfüllung seiner verschiedenen Pflichten nicht genügend bewundern. Aber ich kann auch den Verlust, den Frankreich selbst an ihm erlitten hat, nicht genug bedauern. Die Vorsehung wollte es so: Denn wir würden seinen Tugenden nicht so viel Gerechtigkeit erzeigt haben.« Die Einsicht kam zu spät, denn statt seine Anlagen in der Dekadenz des Pariser Hofes zu vergeuden, fasste der zwanzigjährige Eugen den für damalige Verhältnisse ungeheuren Entschluss, einfach den Souverän zu wechseln.
Die Savoyer – die Hauptlinie beherrschte ein Herzogtum in Oberitalien mit der Hauptstadt Turin und sollte, viel später, die Könige eines geeinten Italien stellen – steckten zwischen den beiden Machtblöcken Heiliges Römisches Reich deutscher Nation und Frankreich. Mit allen relevanten Herrscherhäusern verwandt, neigten sie sich, je nach Opportunität, dem einen oder anderen Machtblock zu. Eugen entstammte der französischen Linie, einer besitzlosen Neben linie, vom Adelsprädikat her zwar auf Augenhöhe mit den Herrschenden, aber ohne großen Einfluss.
Ludwig Julius, ein älterer Bruder von Eugen, hatte es unter Schwierigkeiten geschafft, ein Dragonerregiment aufzustellen und in den Dienst des Kaisers zu gelangen. Milde Gaben aus dem Turiner Stammhaus und die Protektion der Markgrafen von Baden-Baden, ebenfalls verwandt, halfen. Eugens Bruder galt, wie übrigens alle seine Geschwister, als unfähig und kaum zu gebrauchen. Selbst Kaiser Leopold I., ein in seinem Urteil sehr zurückhaltender Herrscher, hielt wenig von dem jungen Prinzen. Ludwig Julius starb im Kampf gegen die heranrückende Armee Kara Mustafas. Als Eugen davon erfuhr, zog er den etwas voreiligen Schluss, dass der Platz an der Spitze der Savoyen-Dragoner nun für ihn frei sei. Er musste aus Frankreich weg und zum Kaiser. Doch Ludwig XIV. dachte nicht daran, seine Prinzen an den gegnerischen Kaiser zu verlieren, auch die »unbrauchbaren« nicht.
Den Drang, nach Osten zu gehen, wo die ehrenvolle Konfrontation mit den Türken wartete, teilte Eugen mit vielen jungen Adeligen. Aus ganz Europa drängten begeisterte junge Krieger zum Dienst in der kaiserlichen Armee. Schließlich ging es um die Verteidigung des Christentums. Frankreichs junger Adel hatte noch einen weiteren Grund. Die Reformen Ludwigs hatten zu einer »Verstaatlichung« der Armee geführt (übrigens auch in anderen Staaten, dort aber nicht so konsequent). Durch diese Verstaatlichung waren Offiziere, die noch im Dreißigjährigen Krieg als eine Art freies Unternehmertum agiert hatten, plötzlich weisungsgebundene Beamte. Die aristokratische Jugend hatte eine ausgeprägte Abneigung gegen diese Militärreformen, die von Ludwigs Kriegsminister Marquis de Louvois durchgeführt wurden. Die Technisierung und damit das Auswechselbarmachen des heldenhaften Kriegers störten. Der Raum für Individualismus war stark eingeschränkt. Auch sprach Ludwigs pragmatische Bündnispolitik gegen eine Beteiligung französischer Adeliger am Kampf des Kaisers. Schließlich war Ludwig mit den Türken verbündet, und französische Händler konnten die Waren der königlichen Manufakturen im ganzen Osmanischen Reich ungehindert verkaufen. Diese wertvollen Handelsprivilegien galt es zu schützen, außerdem kam eine weitere Schwächung des Kaisers der bourbonischen Expansionspolitik entgegen.
Gemeinsam mit Prinz Conti floh Eugen, im wahrsten Sinne des Wortes, bei Nacht und Nebel. Das ging natürlich nicht an. Der Schwiegersohn des französischen Königs wollte in den Dienst des Kaisers treten? Ein Gesichtsverlust, den nicht einmal der übermächtige Ludwig hinnehmen konnte. Die Verfolgung der Flüchtenden setzte sofort ein. Grenzen wurden gesperrt und die Überquerung des Rheins bei der Strafe von Leib und Leben verboten. Conti und Eugen flüchteten jedoch über den Norden, also über die Spanischen Niederlande, und kamen noch über die Grenze. Boten mit Briefen Ludwigs und aller Verwandten Contis wurden in Bewegung gesetzt, um den flüch tigen Schwiegersohn umzustimmen. Alle Anstrengungen galten dabei Louis Armand, sein Begleiter schien unerheblich zu sein. Im »signalement«, der Beschreibung der Begleitung Contis, wurde Eugen nur kurz erwähnt, sogar sein Alter wurde vage mit 18 bis 20 Jahren angegeben. Ludwigs dicht geknüpftes diplomatisches Netz entwickelte seine Aktivität auf Staatsebene. So erging die Bitte an den Kölner Kurfürsten, gegebenenfalls eine Verhaftung durchzuführen. Doch Conti und Eugen waren zu schnell, der Kölner Gesandte Tambonneau erhielt den Auftrag erst einen Tag nachdem Eugen und Conti durch Köln durchgekommen waren. Es steckten auch eine Spur Romantik und das angeberische Gehabe zweier junger Männer in der ganzen Angelegenheit. Der Posthalter, bei dem sie genächtigt hatten, gab an, Eugen habe ihm erzählt, dass sie nach Ungarn fuhren, um den Tod von Eugens Bruder zu rächen. Die Geschwindigkeit der beiden muss außerordentlich gewesen sein, und außerordentlich strapaziös. Eugen erkrankte auf der Flucht, ließ sich aber nicht aufhalten. Und er hatte Angst. Noch aus Köln schrieb er an seinen Turiner Onkel Emanuel Philibert: »Obwohl Euer Hoheit durch das Vergangene Anlass haben, sich über mich zu beklagen […]« Emanuel Philibert hatte sich sehr dafür eingesetzt, Eugen in den geistlichen Stand zu bringen und ihm Pfründe zukommen zu lassen. Allerdings wurde ihm das durch den freizügigen Lebenswandel des Neffen und dessen immer wieder geäußerte Absicht, zum Militär zu gehen, nicht immer leicht gemacht. Eugen bat den Onkel in seinem Brief weiter, seine Reise nach Wien gutzuheißen und seinen Einfluss beim Wiener Hof geltend zu machen, um dann der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, »dass Sie leicht die von mir begangenen Fehler vergessen werden und, da ich mit sehr wenig Geld abgereist bin, Sie genügend Gnade zeigen, um mich nicht in äußerster Not in einem für mich fremden Land auszusetzen«. Eugen hatte kein Geld, die Reisekasse stammte vom Prinzen Conti, und vielleicht kristallisierte sich zu diesem Zeitpunkt schon heraus, dass sein Freund weder die Energie noch die Nerven hatte, ihre Flucht durchzuziehen. Ludwigs Kölner Gesandten zeigten auf jeden Fall genug Initiative, den beiden Prinzen hinterherzuhetzen, und holten sie schließlich in Frankfurt am Main ein. Conti wurde die Konfiskation aller seiner Besitztümer in Frankreich angedroht sowie Straffreiheit im Fall einer Rückkehr angeboten. Dem mittellosen Eugen konnte man nicht mit Konfiskation drohen, und seine Rückkehr war, nachdem Louis Armand Prinz Conti umgestimmt war, auch nur noch von geringer Bedeutung. Conti überließ Eugen die Reisekasse und kehrte nach Paris zurück. Die freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden jungen Prinzen hatte aber Bestand, und als sich Louis Armand zwei Jahre später, diesmal mit Erlaubnis von Ludwig XIV., doch noch an den Türkenkriegen beteiligen wollte, eilte ihm der zu diesem Zeitpunkt in Wien bereits etablierte Eugen entgegen. Louis Armand starb sehr jung bereits fünf Jahre nach der abenteuerlichen Flucht. Mit seinem Tod scheint das letzte Band zerrissen zu sein, das Eugène de Savoie noch an das Frankreich des Sonnenkönigs band.
Eugen traf mit einer Barschaft von 12 Louisdor im kaiserlichen Lager ein. Der Hof war nach Passau geflohen, weil die Türken bereits vor Wien lagen. Trotz der angespannten Lage hatte sich die Geschichte von der Flucht der jungen Prinzen bereits herumgesprochen, denn an barocken Fürstenhöfen wurde gerne getratscht. Dem viel bewunderten, übermächtigen Ludwig gönnte man im Geheimen bestimmt die Schlappe, und Eugen hatte dadurch ein gutes Entrée am Wiener Hof. Natürlich gab es auch in Passau einen Gesandten Ludwigs, den Marquis de Sébeville, dessen Berichten nach Paris wir auch die Informationen über Eugens erste Schritte am Kaiserhof zu verdanken haben. Dabei zeigte sich, dass der zwanzigjährige Eugen von Anfang an sehr überlegt vorgegangen war. Von kopfloser Flucht oder jugendlicher Begeisterung konnte also keine Rede sein. Es stellte sich die in der Logik eines Fürstenhofes des 17. Jahrhunderts nicht unbedeutende protokollarische Frage, wer Eugen beim Kaiser einführen sollte. Sébeville fiel aus naheliegenden Gründen aus, obwohl er offenbar keine Order hatte, Eugen zu behindern. Prädestiniert wäre der Marchese di Parella gewesen, ein hoher Offizier des savoyischen Hofes, der beste Beziehungen zum Kriegsminister Graf Königsegg hatte und beim Kaiser in hohem Ansehen stand. Der junge Prinz wäre damit durch die Protektion seines Stammhauses eingeführt worden. Eugen entschied sich jedoch für den spanischen Gesandten Carlo Emanuele d’Este Marchese di Borgomanero, der deklariert einer Anti-Franzosen-Fraktion angehörte. Das kostete Eugen viel Rückhalt potenzieller Förderer, verdeutlichte aber den Bruch mit Ludwig. Diese ungewöhnliche Vorgehensweise war sehr weitsichtig. Denn Kaiser und französischer König würden bald die Machtpole der Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in Mitteleuropa werden. Eugen setzte auf den Sieg über die Türken und auf Habsburg. Damit war seine erste Entscheidung am Kaiserhof schon politisch und zeigte, dass der junge Mann nicht emotional, sondern rational vorging. Schon der ganz junge Eugen hatte die Fähigkeit, ein Ziel klar vor Augen zu haben und konsequent zu verfolgen.
Borgomanero, der bis zu seinem Tod einer der wichtigsten Förderer Eugens bleiben sollte, berichtete nach Madrid, dass Eugen zwar französisch erzogen, aber »nicht von französischer Denkungsart« sei, also unverdächtig, weiterhin zum Hof Ludwigs zu gehören. Die Flucht half da als Beweis. Eugen gelang es auch, sie als seine Flucht und nicht als die des Prinzen Conti darzustellen. Borgomanero zeigte sich im selben Bericht auch von der Urteilskraft des jungen Mannes beeindruckt und hielt ihn für vielversprechend. Aus dem »petite salope« war also ein vielversprechender junger Mann geworden, der sich in seinem Einführungsschreiben auch deklarierte: »Ich bekenne offen, dass ich diesen Entschluss (Anm.: dem Kaiser zu dienen) erst gefasst habe, nachdem ich versucht hatte, dem Beispiel meiner Ahnen folgend, meinem Land und dem Haus Bourbon mit ganzer Kraft zu dienen und nachdem ich mehrmals vergeblich bemüht war, in den Dienst der französischen Krone zu treten. Das Schicksal meiner Mutter verhinderte jedoch eine Karriere in der französischen Armee, obwohl weder meiner Mutter noch mir selbst jemals etwas nachgewiesen werden konnte. Ich versichere Euch, allergnädigster Kaiser, meiner unverbrüchlichen Treue und dass ich all meine Kraft, all meinen Mut und notfalls meinen letzten Blutstropfen dem Dienst Eurer Kaiserlichen Majestät sowie dem Wohle und Gedeihen Eures großen Hauses widmen werde.« Mit schonungsloser Offenheit sprach Eugen alles aus seiner Pariser Vergangenheit an, was dem Kaiser ohnehin zugetragen worden wäre. Er machte reinen Tisch und bot unbedingte Loyalität an. Das Angebot wurde angenommen, und man kann Eugen nicht vorwerfen, dass er nicht Wort gehalten hätte. Wenige Menschen haben zum »Wohle und Gedeihen« des Hauses Habsburg so viel beigetragen wie er. Die Audienz mit Borgomanero war erfolgreich. Der Zwanzigjährige, ohne jegliche militärische Erfahrung, hoffte zwar immer noch, das Regiment seines verstorbenen Bruders übernehmen zu dürfen, hatte aber genug Realitätssinn, das ihm angebotene Volontariat beim Oberbefehlshaber Karl von Lothringen anzunehmen.
Der römisch-deutsche Kaiser Leopold I. war eine völlig andere Persönlichkeit als Ludwig XIV. und entsprach so gar nicht dem barocken Ideal vom Herrscher. Der Marquis de Sébeville beschrieb seinem König die Enttäuschung über den Souverän etwas liebdienerisch so: »Man täuscht sich, wenn man glaubt, hier einen Herrscher zu finden, der sich durch seine schöne Figur und sein gutes Aussehen aus der Menge der wohlgestalteten Höflinge heraushebe, der sich durch ein majestätisches Auftreten als Herrn der anderen ausweise, der zuerst Respekt und Furcht erwecke, um dann durch seine Art, zu handeln und zu sprechen, Bewunderung zu verbreiten, und der endlich in allen seinen Aktionen Größe und Festigkeit und in allen seinen Gesprächen eine Feinheit des Geistes und eine Überlegenheit des Genies ausstrahle, die zu der Überzeugung zwingen, dass er würdig ist, der ganzen Welt zu befehlen, und dass ein solcher Herr ein Geschenk des Himmels ist, für das man sein ganzes Leben Gott danken muss.« Hier fordert ein Höfling sein Recht ein, zu einem Souverän aufzublicken. Eine gottgleiche Gestalt sollte der Herrscher sein, äußerlich und geistig auf einer anderen Ebene als die ihn umgebende Welt. Der hässliche, phlegmatische Leopold spottete diesem barocken Ideal, er konnte nur enttäuschen.
Wie anders war da doch der Sonnenkönig – schön, klug, eine Persönlichkeit, zu der man aufschauen konnte. Der Kaiser war ein persönlich integrer, gutmütiger Mensch mit ausgeprägt musikalischer Begabung. Eine gewaltige, herabhängende Unterlippe, von der unablässig Speichel tropfte, verunstaltete ihn. Er war zwar hochintelligent und durchaus in der Lage, die Komplexität seiner Aufgabe zu verstehen und analytisch zu durchdringen. Aber befangen in Selbstzweifel und umgeben von frömmlerischen Einflüsterern, bigotten Beichtvätern und reaktionären Adeligen, ließ er es an der notwendigen Entschlusskraft fehlen. Demütig fügte er sich in seine ihm von Gott auferlegten Pflichten. Max Braubach, der große Biograf Eugens, sieht in Leopold I. trotzdem den richtigen Mann am richtigen Ort: »Unbedingtes Gottvertrauen und angeborene Zähigkeit waren Tugenden, die sich gerade in schlimmen Zeiten sehr günstig auswirken konnten und ausgewirkt haben.«
Und die Zeiten waren schlimm. Es stand schlecht um Kaiserhaus und Reich und damit um die, eher kleinen, österreichischen Erblande. Frankreich, das mit Schweden als Sieger aus dem Dreißigjährigen Krieg hervorgegangen war, versuchte unter Ludwig XIV., die Vorherrschaft über Europa zu gewinnen, und das durchaus erfolgreich. Während das bevölkerungsarme Schweden den Erfolg aus dem großen Religionskrieg nicht umsetzen konnte, warf Frankreich sein ganzes Gewicht in die Waagschale. Mit 20 Millionen Einwohnern verfügte das bevölkerungsreichste Land Europas über die wichtigste Ressource der Zeit, Menschenmaterial, und mit der konsolidierten Zentralmacht eines absoluten Herrschers auch über die Möglichkeit, diese Ressource gezielt einzusetzen, was Ludwig ohne Skrupel tat. Der Verschleiß an Menschen war ein anerkanntes Mittel der Herrschenden. Der Sonnenkönig hatte genügend davon und mit dem Merkantilismus auch noch ein effizientes Wirtschaftssystem, um das »Menschenmaterial« als Soldaten auszurüsten. In einer Mischung aus Bewunderung und Entsetzen blickte die europäische Welt nach Versailles, kopierte mehr schlecht als recht die französische Lebensart und versuchte, nicht unter die Räder von Ludwigs Machtmaschinerie zu kommen.
Am südöstlichen Grenzverlauf zum gut organisierten, militärisch chronisch überlegenen Osmanischen Reich befand sich das inhomogene, aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammengewürfelte Österreich. Die eher schwachen Erblande hatten als einzigen Trumpf die Kaiserwürde, in vielerlei Hinsicht mehr eine zusätzliche Belastung als ein Vorteil. Kaiser Leopold verfügte kaum über Ressourcen, und seine Wünsche versandeten in unübersichtlichen Entscheidungsprozessen, in die Reichsstände, Städte und andere Fürsten einbezogen waren. Seine Mittel waren immer knapp. Der Entschluss der Hohen Pforte in Istanbul, diesmal Nägel mit Köpfen zu machen und neben dem Rest von Ungarn auch noch Wien zu erobern, aktivierte aber eine andere Ebene in Leopolds komplexer und komplizierter Machtbasis. Schließlich wollte der Sultan den »Goldenen Apfel«, wie Wien bei den Osmanen genannt wurde, endlich pflücken. Der Südturm des Stephansdoms sollte das höchste Minarett der islamischen Welt werden, das hatte Kara Mustafa geschworen. Die Osmanen griffen nicht ein paar Hungerleider am äußeren Rand des damaligen entwickelten Europa an, wie das bisher bei allen Türkenkriegen vom Rest Europas verstanden wurde, sondern das Zentrum der Christenheit selbst und dessen höchsten weltlichen Repräsentanten, den Kaiser. Der Untergang des Abendlandes drohte. Und der Untergang des Abendlandes ist immer ein probates Mittel, um Emotionen zu erzeugen, bis heute.
Die Habsburger, Erben der Stephanskrone und nominell die Herrscher des christlichen Teils Ungarns, also der nordwestlichen Randgebiete, die nicht von den Osmanen besetzt waren, versuchten wiederholt, diese Herrschaft auch auszuüben. Sie schickten Truppen, um die Wiener Zentralgewalt zu festigen. Sehr zum Ärger des selbstbewussten und immer nach Autarkie strebenden ungarischen Adels. Da es dabei nicht nur um das reine Streben nach einer habsburgischen Vormachtstellung ging, sondern das katholische Erzhaus auch noch die Reste des Protestantismus in Ungarn beseitigen wollte, kam zum Machtkampf der Religionskampf dazu. Eine Komponente, die es den ungarischen Magnaten leicht machte, die Bewahrung ihrer Privilegien als eine heilige Sache zu deklarieren. Mit Imre Thököly, einem enteigneten protestantischen Magnaten, fand sich ein Führer für diese ungarische Rebellion gegen die Habsburger. Die Hohe Pforte in Istanbul war klug genug, Thököly als ungarischen Fürsten anzuerkennen. Damit schien Ungarn schon dem Osmanischen Reich einverleibt, nach Wien war es nur noch ein Sprung. Thököly stand unter Waffen, und auf den »Goldenen Apfel« marschierte im Frühjahr 1683 aus Edirne, dem traditionellen Startpunkt der osmanischen Eroberungen, ein gewaltiges Heer von 200.000 Mann zu. Ludwig XIV., der, um seine absolute Herrschaft zu sichern, gnadenlos gegen die Reste der französischen Hugenotten vorgegangen war, unterstützte den protestantischen ungarischen Adel gegen Österreich. Und der allerchristlichste König, so Ludwigs offizieller Titel, stand auch zu seinem Bündnis mit den Türken. Die Ungarn marschierten mit ihrem »Kuruzzenkönig« Thököly gemeinsam mit den Osmanen. Die kaiserlichen Regimenter waren unterlegen, vergleichsweise schlecht organisiert und ausgerüstet. Sie waren von Anfang an auf dem Rückzug. Bei einem dieser Rückzugsgefechte fiel auch Eugens Bruder bei Petronell.
Das Osmanische Reich stand in seiner Blüte. Eine wohlorganisierte, professionell verwaltete Zentralmacht, die über die Ressourcen und das Menschenmaterial eines gewaltigen Staatsgebiets verfügte. Kunst und Handel gediehen prächtig. Mit Mehmed IV. herrschte ein politisch passiver Sultan, dessen Beiname »der Jäger« auf seine Lieblingsbeschäftigung hinwies. Doch Mehmed bewies, wie sein Gegner Leopold, durch die Auswahl des Personals seine Führungsqualitäten. Bei Köprülü Mehmed Pascha und später dessen Sohn Fazil Ahmed lagen die Geschicke des Reiches lange in fähigen Händen. Solange der Sultan auf Jagd war und sich nicht ins Tagesgeschäft einmischte, schien alles zu funktionieren. Die Köprülüs erweiterten das Staatsgebiet sukzessive nach Nordosten und nahmen Polen und dem noch nicht konsolidierten Russland große Gebiete ab. Sogar die Seemacht schlechthin, Venedig, konnten sie besiegen. Teile Kretas fielen an die Türkei, und der Handel im östlichen Mittelmeer geriet unter osmanische Kontrolle. Kara Mustafa, der dritte Großwesir in Mehmeds Regierungszeit, erwies sich aber eher als Missgriff, obwohl der Vormarsch auf Wien eigentlich sehr vielversprechend mit den üblichen Ingredienzien der osmanischen Erfolgsgeschichte begann: ein gewaltiges, gut organisiertes Heer, genug finanzieller Background und ein schwacher Gegner.
Diesmal ging die Rechnung jedoch nicht auf. Sehr zum Erstaunen aller Beobachter von Paris bis Istanbul schlug die inhomogene Armee des Kaisers die türkische Übermacht vernichtend. Eine Trendwende in der Geschichte Mitteleuropas – und mittendrin unser kleiner Prinz.
Karl von Lothringen sammelte seine Truppen im Tullnerfeld; Eugens Anwesenheit ist in einer Notiz des Sohnes des polnischen Königs, Jakob Sobieski, bezeugt, der den Besuch des »Duc Eugène de Soissons« im polnischen Lager erwähnt. Wie und an welcher Stelle er an dieser ersten Schlacht seines Lebens teilgenommen hat, ist nicht überliefert. Fest steht, dass der Einsatz des »prince volontaire« positiv aufgefallen ist und er sich, wie der Marchese di Borgomanero an den spanischen Hof berichtete, »tapfer geschlagen hat« und ihm der Kaiser seine volle Anerkennung zollte. Fest steht auch, dass Eugen der Krieg gefallen hat.
Wie gering der kaiserliche Entscheidungsspielraum war, zeigte sich direkt nach dem erfolgreichen Entsatz von Wien. Karl von Lothringen wollte den Erfolg sofort umsetzen und die auf dem Rückzug befindlichen Osmanen verfolgen. Aber mit der Befehlsgewalt des Oberbefehlshabers war es nicht weit her. Der Polenkönig Johann Sobieski, der mit seiner schweren Reiterei eine der schlagkräftigsten Armeen des Abendlandes befehligte, wollte sich der Verfolgung nicht anschließen, andere Hilfstruppen kehrten bereits in ihre Heimat zurück. Also blieb nur eine Rumpfarmee, die den Sieg weiter in türkisches Gebiet hineintrug. Doch diese Armee war unerwartet erfolgreich. Es gelang sogar, sehr symbolträchtig, Gran, den Bischofssitz des Primas von Ungarn, nach 150 Jahren islamischer Herrschaft zu befreien.
Die Rückkehr der Armee an den Kaiserhof, der inzwischen von Passau nach Linz übersiedelt war, war die Rückkehr strahlender junger Helden. Allen voran Max Emanuel von Bayern, eine von Idealismus und schwärmerischem Heldentum geprägte Persönlichkeit. Er schien in den Kämpfen um Gran und Raab zu der Überzeugung gelangt zu sein, dass Eugen seinen Idealen vom Heldentum sehr nahekam. Zumindest begann er seinen fast gleich alten Verwandten (Max Emanuels Mutter war eine savoyische Prinzessin) ab da zu fördern. In den wenigen Monaten seines Kriegseinsatzes war es Eugen offenbar gelungen, vom unbekannten Volontär zur Personalreserve aufzusteigen. Sein alter Förderer Borgomanero berichtete an den spanischen Hof, dass Eugen sogar ein eigenes Regiment in Aussicht gestellt wurde. Dieses Versprechen löste Leopold schon am 14. Dezember 1683, also nur knapp fünf Monate nachdem Eugen in kaiserliche Dienste getreten war, ein. Im kaiserlichen Patent hieß es, dass Eugen diese Ehre »in gnädigster Anseh- und Erwägung deroselben uns bekannter fürtrefflichen Qualitäten, Geschicklichkeit, auch erweisende Valor und Tapferkeit« erwiesen werde. Prinz Eugen, zwar hoch geehrt, aber immer noch mittellos, schrieb eine Reihe von Bettelbriefen an seine Verwandten, mit dem dringenden Ersuchen, ihm ein standesgemäßes Leben zu finanzieren.