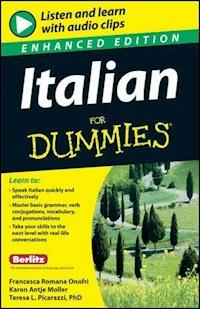Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Fundiertes psychologisches Grundwissen hat als Rüstzeug für Berufe der angewandten Pädagogik zunehmend an Bedeutung gewonnen. Das Buch bündelt grundlegende psychologische Inhalte und Erkenntnisse, die im Handlungsfeld der Heil- und Sonderpädagogik für alle Fachrichtungen gleichermaßen bedeutsam und hilfreich sind. Diese umfassen das diagnostische Basiswissen, neuropsychologische Erkenntnisse über Lernprozesse und entwicklungspsychologische Grundlagen. Ausgehend von der psychologischen Diagnostik werden in Teil 1 die sonderpädagogische Diagnostik, ihre Strategien, Prozessmodelle und Methoden beschrieben. Teil 2 befasst sich mit den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften, die im Zusammenhang mit Lernen und Lehren von grundsätzlicher Bedeutung sind. Teil 3 stellt Basiswissen aus der Entwicklungspsychologie zur Verfügung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Prof. i. R. Dr. Erwin Breitenbach lehrte Rehabilitationspsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er arbeitet momentan als Lehrbeauftragter der Universität Würzburg und betreibt zusammen mit Frau Dr. Miriam Stiehler das Blog »Praxis Förderdiagnostik«. Nach dem Studium des Lehramtes für Grund- und Hauptschulen sowie Psychologie war er zwölf Jahre als Diplompsychologe an einer Würzburger Einrichtung für sprach- und entwicklungsverzögerte Kinder tätig. Nach der Promotion in Sonderpädagogik kehrte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Institut für Sonderpädagogik der Universität Würzburg zurück, habilitierte sich dort im Fach Heilpädagogische Psychologie und folgte anschließend einem Ruf der Humboldt-Universität zu Berlin.
Erwin Breitenbach
Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik
unter Mitarbeit von Annett Kuschel
2., überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
2., überarbeitete Auflage 2021
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-036214-7
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-036215-4
epub: ISBN 978-3-17-036216-1
mobi: ISBN 978-3-17-036217-8
Vorwort der Herausgeber
Die vorliegende ›Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik‹ stellt den ersten Band der Reihe ›Nachbarwissenschaften der Heil- und Sonderpädagogik‹ dar. Die Grundidee der Reihe wurzelt in der Erkenntnis, dass Vertreterinnen und Vertreter der Heil- und Sonderpädagogik aufgrund der Vielschichtigkeit des Phänomens bei der Beforschung und Bearbeitung verschiedener Fragestellungen im Themenfeld der Behinderung und Benachteiligung schon immer stark auf Nachbarwissenschaften zurückgegriffen haben. Tatsächlich lassen sich die vielfältigen pädagogischen Fragen, die sich im Kontext von Behinderung und Benachteiligung stellen und im Zentrum der Heil- und Sonderpädagogik stehen, ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit angemessen nur in einer inter- und transdisziplinären Perspektive bearbeiten. Hierzu gehören neben den ›traditionellen‹ Nachbarwissenschaften Erziehungswissenschaft, Medizin, Psychologie und Soziologie auch die Philosophie, die Rechtswissenschaften und die Technikwissenschaften.
Die einzelnen Bände dieser Reihe sollen schwerpunktmäßig den Stand der jeweiligen Nachbarwissenschaft, sofern er für die Heil- und Sonderpädagogik relevant ist, aufarbeiten. Strukturgebend für die einzelnen Werke sind Fragestellungen, die aus der Heil- und Sonderpädagogik resultieren. Das bedeutet: Es wird grundsätzlich aus sonderpädagogischer Perspektive geprüft, welche Inhalte der jeweiligen Nachbarwissenschaft für sonderpädagogische Handlungsfelder sowie die Forschung und Theoriebildung bedeutsam sind und wie diese verständlich und fruchtbringend dargestellt werden können.
Einzelbände der Reihe sind:
Band 1: Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik
Band 2: Philosophie in der Heil- und Sonderpädagogik
Band 3: Soziologie in der Heil- und Sonderpädagogik
Band 4: Erziehungswissenschaft in der Heil- und Sonderpädagogik
Band 5: Medizin in der Heil- und Sonderpädagogik
Band 6: Recht in der Heil- und Sonderpädagogik
Band 7: Technik in der Heil- und Sonderpädagogik
Wir wünschen den Leserinnen und Lesern eine gewinnbringende Lektüre.
Köln, Berlin und Würzburg, im Sommer 2013
Markus Dederich, Erwin Breitenbach und Stephan Ellinger
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Einführung
von Erwin Breitenbach
Literatur
Teil I: Sonderpädagogische Diagnostik
von Erwin Breitenbach
1 Vom Nutzen und der Notwendigkeit
1.1 Diagnostische Kompetenz von Lehrkräften
1.2 Diagnostische Aufgaben und geforderte Kompetenzen
2 Psychologische Diagnostik
2.1 Begriffsklärung
2.2 Diagnostische Strategien
2.3 Diagnostischer Prozess
2.4 Normgerechte Beurteilung
2.5 Diagnostische Methoden
2.6 Ethische und rechtliche Bestimmungen
2.7 Bewertungs- und Beurteilungsfehler
2.8 Zusammenfassung
3 Sonderpädagogische Diagnostik
3.1 Begriffsbestimmungen
3.1.1 Pädagogische Diagnostik
3.1.2 Sonderpädagogische Diagnostik
3.2 Diagnostische Zielsetzungen
3.2.1 Spezifische Zielsetzungen und Strategien
3.2.2 Sonderpädagogische Diagnostik ist Förderdiagnostik
3.2.3 Unterscheidung: Platzierungs- und Förderungsdiagnostik
3.3 Diagnostischer Prozess
3.4 Zusammenfassung
4 Förderdiagnostik
4.1 Förderbedarf und Förderplan
4.2 Bestimmungsstücke der Förderdiagnostik
4.2.1 Lernprozesse analysieren
4.2.2 Die Situation, den Kontext einbeziehen
4.2.3 Diagnose und Förderung konsequent verknüpfen
4.2.4 Vorgeordnete Theorien und Wertvorstellungen mitdenken
4.2.5 Sich an Kompetenzen orientieren
4.3 Zusammenfassung
5 Selektions- oder Platzierungsdiagnostik
5.1 Inhalte und Aufgaben
5.2 Diagnose vor der Diagnostik
5.3 Probleme und Grenzen
5.4 Zusammenfassung
6 Methoden der sonderpädagogischen Diagnostik
6.1 Diagnostisches Gespräch
6.1.1 Anamnese und Exploration
6.1.2 Interview
6.1.3 Konsulentenarbeit
6.1.4 Schulisches Standortgespräch
6.1.5 Fehlerquellen und Aussagekraft von Gesprächsdaten
6.2 Verhaltensbeobachtung und Schätzskalen
6.2.1 Grundlegende Probleme
6.2.2 Beobachtungsarten
6.2.3 Stichprobenplan und Zeichensysteme
6.2.4 Kategoriensysteme
6.2.5 Rating- und Einschätzverfahren
6.2.6 Gütekriterien
6.2.7 Zusammenfassung
6.3 Screeningverfahren
6.4 Soziometrie
6.5 Curriculumbasiertes Messen (CBM) oder Lernverlaufsdiagnostik
6.5.1 Generieren von Aufgabenstichproben
6.5.2 Dokumentation des Lernfortschritts
6.5.3 Effekte auf die Lernfortschritte der Schüler und Gütekriterien
6.5.4 Das Schüler-Entwicklungs-System
6.5.5 Responsiveness-to-Intervention-Ansatz (RTI)
6.5.6 Offene Probleme
6.6 Informelle Verfahren
6.6.1 Kompetenzinventare
6.6.2 Didaktische Analysen
6.6.3 Fehleranalysen
6.6.4 Systematische Aufgabenvariation
6.7 Psychometrische Verfahren
6.7.1 Definition und Klassifikation
6.7.2 Grundlegende Theorien
6.7.3 Testkonstruktion nach der klassischen Testtheorie
6.7.4 Probleme bei der Anwendung
7 ICF in der sonderpädagogischen Diagnostik
7.1 Das bio-psycho-soziale Modell
7.2 Aufbau und Struktur
7.3 Anpassungen für das Kindes- und Jugendalter (ICF-CY)
7.4 Bedeutung für die sonderpädagogische Diagnostik
8 Das sonderpädagogische Gutachten
8.1 Grundlegende Prinzipien und Strategien
8.2 Struktur und Aufbau
8.3 Häufige Fehler
8.4 Förderplan und Fördergutachten
9 Zusammenfassung
Literatur
Teil II: Neuropsychologie des Lernens
von Erwin Breitenbach
1 Neuropsychologie
1.1 Geschichte der Hirnforschung und Neuropsychologie
1.1.1 Gehirn- und Herzhypothese
1.1.2 Leib-Seele-Problem
1.1.3 Lokalisation und Antilokalisation
1.1.4 Neuronenthese und moderne Biotechnik
1.1.5 Neuroimplantate, Tiefenhirnstimulation und Neuroenhancement
1.2 Hirnforschung als Leitdisziplin
1.2.1 Probleme – Befürchtungen – Nutzen
1.2.2 Das Modell der Supervenienz
1.3 Grundhypothese der Neuropsychologie
1.3.1 Hirnorganik beeinflusst Erleben und Verhalten
1.3.2 Erleben und Verhalten beeinflussen Hirnorganik
1.3.3 Spiegelneurone
1.3.4 Zusammenfassung und Konsequenzen
2 Theorie von Alexander R. Lurija
2.1 Grundbegriffe
2.1.1 Funktion und funktionelle Systeme
2.1.2 Dynamische Lokalisation
2.1.3 Symptom und Syndrom
2.2 Drei grundlegende Funktionseinheiten
2.2.1 Regulation von Tonus, Aktivierung, Wachheit des Bewusstseins
2.2.2 Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen
2.2.3 Programmierung, Steuerung und Kontrolle von Tätigkeiten
2.2.4 Erweiterung um eine vierte Einheit
2.3 Folgen und Weiterentwicklung
2.3.1 Teilleistungsstörungen
2.3.2 Corticale Landkarten
2.3.3 Funktionelle Systeme in der modernen Neuropsychologie
2.4 Zusammenfassung
3 Handlungsplanung oder Praxie
3.1 Dyspraxie
3.2 Funktionelles System zur Handlungsplanung
3.2.1 Motivation
3.2.2 Aufmerksamkeitssteuerung und Impulskontrolle
3.2.3 Körperwahrnehmung und räumliche Orientierung
3.2.4 Sprache
3.2.5 Gedächtnis
3.2.6 Sequenzbildung und Automatisierung
3.3 Diagnostische und pädagogischtherapeutische Implikationen
4 Aufmerksamkeitssteuerung
4.1 Neuropsychologische Aufmerksamkeitskonzepte
4.2 Aufmerksamkeit und Konzentration
4.3 Aufmerksamkeitsdefizite
4.4 Verhaltensoberprogramme
4.4.1 Aktivierungsniveau
4.4.2 Orientierungsreaktion
4.4.3 Formatio reticularis
4.4.4 Pädagogisch-therapeutische Implikationen
4.5 Zusammenfassung
5 Gedächtnis
5.1 Kurzzeitgedächtnis
5.1.1 Ultrakurzzeitgedächtnis
5.1.2 Arbeitsgedächtnis
5.2 Langzeitgedächtnis
5.2.1 Deklaratives und prozedurales Gedächtnis
5.2.2 Semantisches und episodisches Gedächtnis
5.2.3 Ereignisbestimmtes und merkmalsbestimmtes Gedächtnis
5.2.4 Willkürlich-absichtsvolles und nicht absichtsvolles Gedächtnis
5.2.5 Prospektives Gedächtnis
5.3 Einspeicherung, Konsolidierung und Abruf
5.3.1 Wiedererkennensgedächtnis
5.3.2 Intermediäres Gedächtnis
5.4 Gedächtnis und Gehirn
5.4.1 Deklaratives Gedächtnis und Zwischenhirn
5.4.2 Prozedurales Gedächtnis und Striatum
5.4.3 Neocortex und Arbeitsgedächtnis
5.5 Gedächtnisstörungen
5.6 Pädagogisch-didaktische Implikationen
6 Motivation
6.1 Emotion und Kognition
6.1.1 Emotion und Gedächtnis
6.1.2 Emotion und Informationsverarbeitungsstile
6.1.3 Emotion und Entscheidungsverhalten
6.2 Hirnorganische Korrelate
6.2.1 Limbisches System
6.2.2 Belohnungssystem
6.3 Motivationale Rahmenbedingungen von Lernen
6.3.1 Eigenaktivität
6.3.2 Sinnvolle Reizverarbeitung
6.3.3 Motivation der Lehrenden
6.3.4 Allgemeine Lernbereitschaft
6.3.5 Stress
6.3.6 Zusammenfassung
7 Abschließende Anmerkungen
Literatur
Teil III: Entwicklungspsychologische Grundlagen
von Annett Kuschel
1 Einleitung
1.1 Reifung
1.2 Prägung/sensible Phasen
1.3 Stabilität und Kontinuität
1.4 Entwicklungsaufgaben
2 Aufgaben der Entwicklungspsychologie
2.1 Beiträge für die Praxis
2.2 Leitfragen der Entwicklung
3 Ausgewählte Theorien der Entwicklungspsychologie
3.1 Exogenistische Modelle
3.2 Endogenistische Modelle
3.3 Aktionale und konstruktivistische Modelle
3.4 Interaktionistische Modelle
3.5 Der psychoanalytische Ansatz
3.6 Lerntheoretische Konzeptionen
3.6.1 Klassisches Konditionieren
3.6.2 Operantes Konditionieren
3.6.3 Beobachtungslernen
3.7 Ökologische Systemtheorie
3.8 Soziokulturelle Entwicklungstheorie
3.9 Informationsverarbeitungsansätze
4 Forschungsmethoden in der Entwicklungspsychologie
4.1 Querschnittstudien
4.2 Längsschnittstudien
4.3 Sequenzstudien
5 Frühe Eltern-Kind-Interaktion und Bindung
5.1 Frühe Eltern-Kind-Interaktion
5.2 Bindung
5.2.1 Messung der Bindungssicherheit
5.2.2 Bedeutung früher Bindungserfahrungen
6 Entwicklung des Denkens
6.1 Piaget
6.1.1 Sensumotorisches Stadium
6.1.2 Präoperationales Stadium
6.1.3 Konkret-operationales Stadium
6.1.4 Formal-operationales Stadium
6.1.5 Pädagogische Anwendungen von Piagets Theorie
6.1.6 Kritik an Piagets Theorie
6.2 Wygotski
6.2.1 Zone der proximalen Entwicklung
6.2.2 Kulturwerkzeuge
6.2.3 Gelenkte Partizipation
6.3 Domänenspezifisches Wissen
6.3.1 Intuitive Physik
6.3.2 Intuitive Psychologie (Theory of Mind)
6.3.3 Intuitive Biologie
7 Emotionale Entwicklung
7.1 Theorien über Wesen und Entstehung von Emotionen
7.2 Emotionen im Entwicklungsverlauf
7.2.1 Positive Emotionen
7.2.2 Negative Emotionen
7.2.3 Selbstbewusste Emotionen
7.3 Entwicklung der Emotionsregulierung
7.4 Individuelle Unterschiede bei Emotionen und Emotionsregulierung
8 Soziale Entwicklung
8.1 Grundlegende Konzeptionen
8.1.1 Psychoanalytische Sicht
8.1.2 Lerntheoretische Sicht
8.1.3 Kognitionspsychologische Sicht
8.1.4 Systemorientierte Sicht
8.2 Familiäre Beziehungen in der Kindheit
8.2.1 Eltern-Kind-Beziehung
8.2.2 Geschwisterbeziehungen
8.3 Gleichaltrige und Freundschaften
8.4 Soziale Beziehungen im Jugendalter
9 Sprachentwicklung
9.1 Merkmale und Komponenten der Sprache
9.2 Erklärungstheorien für den Spracherwerb
9.2.1 Rolle der Biologie
9.2.2 Rolle des soziokulturellen Umfeldes
9.2.3 Rolle des Lernens und Denkens
9.3 »Meilensteine« der Sprachentwicklung
9.3.1 Sprachproduktion im ersten Lebensjahr
9.3.2 Semantik
9.3.3 Grammatik
9.3.4 Pragmatik
10 Schlussbetrachtung und Ausblick
Literatur
Einführung
von Erwin Breitenbach
Theorien, Modelle und Konzepte aus der Psychologie werden in der Sonder- und Heilpädagogik mit einer großen Selbstverständlichkeit und mit langer Tradition zur Kenntnis genommen und für die eigene Theoriebildung ebenso genutzt wie für die Gestaltung der Praxis. Watzlawicks Theorie zur Kommunikation, Piagets Stufenmodell zur Denkentwicklung, Wygotskis Zone der proximalen Entwicklung, Lerntheorien, Ergebnisse der Einstellungsforschung, Bindungstheorie und Beobachtungen über die frühe Eltern-Kind-Interaktion, Beratungsmodelle, Intelligenzkonzepte, Erkenntnisse aus der Sprachentwicklungsforschung usw. haben in Theorie und Praxis der Heil- und Sonderpädagogik Einzug gehalten. Vor allem aber das weite Feld der Diagnostik mit den unterschiedlichsten Instrumenten und Methoden wie Verhaltensbeobachtung, Anamnese, Screeningverfahren und zu guter Letzt natürlich auch den zahlreichen je nach pädagogischer »Philosophie« oder »Ideologie« überschätzten oder verabscheuten psychologischen Tests wird von Heil- und Sonderpädagogen gar als wesentlicher Kompetenzbereich ihrer Profession betrachtet.
Paul Moor (1960) verfasste eine zweibändige »Heilpädagogische Psychologie«, in deren ersten Band er »psychologische Tatsachen« oder die verschiedenen psychologischen Hauptrichtungen aus pädagogischer Sicht auf ihre Brauchbarkeit für die heilpädagogische Praxis hin prüft und zur Entwicklung seiner Theorie vom inneren und äußeren Halt fruchtbar macht.
Viele Jahre später erscheinen Hand- und Lehrbücher zur heilpädagogischen oder sonderpädagogischen Psychologie, in denen eine solch kritische Prüfung psychologischen Wissens und vor allem seine Integration in pädagogisches Denken nicht mehr geleistet werden. Vielmehr werden in ihnen psychologische Erkenntnisse und Befunde zusammengestellt, die, nach Meinung der Autoren, ein hilfreiches Wissen für Heil- und Sonderpädagogen darstellen könnten.
Borchert (2000) stellt neben grundlegende psychologische Theorien und Perspektiven vor allem Wissen aus der pädagogischen Psychologie zu Diagnostik, Prävention und Intervention in sonderpädagogischen Handlungsfeldern zur Verfügung. Bundschuh (2008) wählt für seine »Heilpädagogische Psychologie« entwicklungspsychologische, allgemeinpsychologische, sozialpsychologische und diagnostische Erkenntnisse aus, von denen er annimmt, dass sie bei der Beantwortung heil- und sonderpädagogischer Fragestellungen hilfreich sind, zur Bewältigung der Aufgaben im heil- oder sonderpädagogischen Arbeitsfeld einen brauchbaren Beitrag leisten oder in den Rahmen einer heilpädagogischen Psychologie passen.
Davon abweichend konzentrieren sich die Herausgeber des »Handbuchs der heilpädagogischen Psychologie« Fengler und Jansen (1987) auf psychologische Besonderheiten im Zusammenhang mit unterschiedlichen Arten der Behinderung und greifen des Weiteren spezielle Problembereiche der heilpädagogischen Psychologie wie Diagnostik, Intervention, Supervision oder Burnout auf. Die behinderungsspezifischen psychologischen Aspekte sind jedoch meist eher vereinzelte Befunde aus entwicklungs- oder sozialpsychologischer oder diagnostischer Perspektive, aber sie stellen zumindest den ernsthaften Versuch dar, eine Art spezifisch heilpädagogische Psychologie zu etablieren.
Die Begriffe »heilpädagogische Psychologie« oder »sonderpädagogische Psychologie« legen nahe, dass es entsprechend der pädagogischen Psychologie eine eigenständige anwendungsorientierte psychologische Disziplin im sonderpädagogischen Handlungsfeld gäbe. In keinem in die Psychologie einführenden Werk tritt jedoch neben den traditionellen Teildisziplinen wie etwa Entwicklungs-, Sozial-, differentieller oder pädagogischer Psychologie die heil- oder sonderpädagogische Psychologie in Erscheinung. Während Paul Moors »Heilpädagogische Psychologie« vielleicht eher als psychologische Heilpädagogik zu bezeichnen wäre, werden von allen anderen Autoren unter der Überschrift »heilpädagogische oder sonderpädagogische Psychologie« vielmehr all diejenigen Erkenntnisse aus den Teildisziplinen der Psychologie zusammengetragen, die bereits Einzug in den breiten Wissenskanon der Heil- oder Sonderpädagogen gehalten haben oder es künftig tun sollten, weil sie eben als in heil- und sonderpädagogischen Handlungs- und Begründungszusammenhängen bedeutsam erachtet werden.
Die sonderpädagogische Diagnostik kann noch am ehesten als ein spezifisch heilpädagogisch-psychologisches Themenfeld betrachtet werden. Selbstverständlich ist auch sie aus der psychologischen Diagnostik heraus entstanden, beruft sich in weiten Teilen auf deren theoretische Grundlagen und erhält ständig neue Impulse von ihr. Mit dem Begriff und Konzept der Förderdiagnostik haben jedoch zahlreiche Sonderpädagogen und Psychologen immer wieder versucht, trotz heftigster Kritik, eine sonderpädagogisch-eigenständige diagnostische Theorie zu formulieren. Darüber hinaus wurden innerhalb der sonderpädagogischen Diagnostik Instrumente und Verfahren wie z. B. Fehleranalyse, schulisches Standortgespräch, Konsulentenarbeit oder das curriculumbasierte Messen mit seinen informellen Aufgabensammlungen und Kompetenzinventaren entwickelt, die speziell auf die Besonderheiten im heil- und sonderpädagogischen Arbeitsfeld ausgerichtet sind und die im Rahmen der psychologischen Diagnostik keine Anwendung finden. Die besondere Bedeutung der Diagnostik innerhalb der Heil- und Sonderpädagogik wird auch deutlich, wenn diagnostische Kompetenzen von Moser (2005) zu den zentralen Professionsmerkmalen von Sonderpädagogen gezählt werden, oder sie zeigt sich auch in den Ergebnissen einer Analyse gängiger sonderpädagogischer Fachzeitschriften von Buchner und Koenig (2008): Nach dem Themenbereich Schule nimmt Diagnostik und Therapie den zweiten Platz bei der Häufigkeit der in den analysierten Fachzeitschriften aufgegriffenen und bearbeiteten Fragestellungen ein.
Um den oben beschriebenen Missverständnissen auszuweichen, wurde für das hier vorliegende Buch der Titel »Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik« gewählt. Inhaltlich steht an prominenter erster Stelle die sonderpädagogische Diagnostik mit ihren Ursprüngen in der psychologischen Diagnostik und den charakteristischen Besonderheiten der Förderdiagnostik sowie den vielfältigen unterschiedlichen diagnostischen Instrumenten und Methoden. Daran schließen sich neuropsychologische Erkenntnisse zu Gedächtnis, Handlungsplanung, Aufmerksamkeitssteuerung und Motivation an, die als bedeutsam und grundlegend für das Verstehen von Lernprozessen zu sehen sind. Das Feststellen von Entwicklungsverzögerungen oder das Verringern und Aufholen derselben durch entwicklungsorientierte Förderung und Therapie erfordern zwangsläufig ein Wissen über Entwicklung und entsprechende Entwicklungsverläufe. Teil 3 bringt dem geneigten Leser dieses Wissen näher. Bei der Zusammenstellung der neuropsychologischen und entwicklungspsychologischen Wissensbestände wurden zwar die wenigen aktuellen behinderungsspezifischen Befunde aufgenommen, aber grundsätzlich lag der Fokus auf der Vermittlung eines für alle sonderpädagogischen Fachrichtungen relevanten Wissens.
Literatur
Borchert, J. (Hrsg.) (2000): Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie. Göttingen: Hogrefe.
Bundschuh, K. (2008): Heilpädagogische Psychologie. München: Reinhardt.
Buchner, T. & Koenig, O. (2008): Methoden und eingenommene Blickwinkel in der sonder- und heilpädagogischen Forschung von 1996–2006 – eine Zeitschriftenanalyse. In: Heilpädagogische Forschung 34, 15–34.
Fengler, J. & Jansen, G. (Hrsg.) (1987): Handbuch der heilpädagogischen Psychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
Moor, P. (1960): Heilpädagogische Psychologie. Bd. 1 und 2. Bern: Huber.
Moser, V. (2005): Diagnostische Kompetenz als sonderpädagogisches Professionsmerkmal. In: V. Moser & E. von Stechow (Hrsg.): Lernstands- und Entwicklungsdiagnosen. Diagnostik und Förderkonzeption in sonderpädagogischen Handlungsfeldern. Festschrift für Christiane Hofmann zum 60. Geburtstag. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 29–41.
Teil I: Sonderpädagogische Diagnostik
von Erwin Breitenbach
1 Vom Nutzen und der Notwendigkeit
Nicht immer waren und sind Fachleute im sonderpädagogischen Handlungsfeld vom Nutzen und der Notwendigkeit der Diagnostik überzeugt. Trotz geradezu überwältigender empirischer Belege für ihre Nützlichkeit, in jüngster Zeit vor allem durch die Bildungsforschung vehement vorgetragen, melden sich von Zeit zu Zeit Skeptiker mit immer gleicher grundsätzlicher Kritik an der Diagnostik zu Wort.
Diese mittlerweile müßige und meist von geringem Fachwissen getragene Diagnostikkritik erstarkt momentan erneut angesichts der Forderung nach einem inklusiven Erziehungs- und Bildungssystem. Die einen betonen die zunehmende Bedeutung diagnostischer Kompetenzen im Rahmen inklusiven Unterrichtens; für andere wird das Diagnostizieren durch Inklusion nun endgültig überflüssig, weil kontraproduktiv.
1.1 Diagnostische Kompetenz von Lehrkräften
Probst (1999) erhob in einer kleinen Studie das Image der Diagnostik bei Studierenden am Beginn ihrer Diagnostikausbildung mit der Methode des semantischen Differentials. Dazu forderte er 152 Studierende auf, die beiden Begriffe »Diagnostik« und »Förderung« entlang einer Liste von 21 polar angeordneten Eigenschaftspaaren einzustufen. Die Diagnostik wurde von den so Befragten eher mit Eigenschaften wie ernst, hart, streng, klärend, technisch, unsympathisch, mathematisch, nützlich, kühl, stark, repressiv, intellektuell in Verbindung gebracht, während die Förderung eher Eigenschaftsassoziationen wie weich, humanistisch, sympathisch, aktiv, engagiert, offen, optimistisch, flexibel, befreiend, warm, gefühlvoll, nützlich und musisch auslöste. Nach Probst (1999) illustriert dieser kleine empirische Einblick die bange Achtung der Studienanfänger oder Laien vor der Diagnostik als einer ungeliebten Notwendigkeit.
Paradies, Linser und Greving (2007) bedauern und kritisieren, dass sowohl an der Universität als auch im Referendariat Lehrer, mit Ausnahme der Sonderpädagogen, kaum mit dem Prozess des Diagnostizierens konfrontiert werden, wie wohl sie während des Unterrichtens permanent diagnostizieren, allerdings häufig, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Kontrastierend stellen sie dieser bedauernswerten Tatsache die Standards der Kultusministerkonferenz (KMK) zur Lehrerausbildung im Kompetenzbereich »Beurteilen« gegenüber. Hier ist zu lesen, dass Lehrer die Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülern diagnostizieren, um diese gezielt in ihrem Lernen zu fördern und zu beraten und dass Lehrkräfte die Leistungen von Schülern auf der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe erfassen. Dieses deutliche Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit versuchen Hesse und Latzko (2009) mit einer ständig wiederkehrenden Diagnostikfeindlichkeit der Pädagogen zu erklären. Die Schwankungen in der Wertschätzung und Anwendung pädagogischer Diagnostik sei im deutschen Bildungswesen unübersehbar und alle vorgetragenen Vorurteile gegenüber einer wissenschaftlichen Diagnostik mit effektiven und standardisierten Verfahren bestünden auch nach der mit PISA markierten Wende weiter.
Wie stellen sich nun die diagnostischen Kompetenzen tatsächlich im Spiegel empirischer Forschung dar?
Grassmann et al. (2002) untersuchten, inwieweit Lehrkräfte die Kenntnisse ihrer Schüler speziell im Anfangsunterricht Mathematik einschätzen können und stellen am Ende ihrer Studie, in die 830 Schüler einbezogen wurden, fest, dass die Einschätzung der Lehrkräfte signifikant von den in der Studie gemessenen Leistungen ihrer Schüler abwichen. Ähnliches berichten Hesse und Latzko (2009) von der Schulstudie SALVE (Systematische Analyse des Lernverhaltens und des Verständnisses in Mathematik: Entwicklungstrends und Fördermöglichkeiten) an der 654 Schüler aus 30 fünften Klassen aus Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschule teilnahmen. Bestätigt werden diese Ergebnisse durch Studien von Hoffmann und Böhme (2014), Koch und Hofmann (2015) oder Stang und Urhahne (2016).
In verschiedenen internationalen Schulleistungstests werden die nicht zufriedenstellenden Leistungen deutscher Schüler auch immer wieder mit mangelhaften diagnostischen Kompetenzen der Lehrkräfte in Verbindung gebracht. Die zuständigen Schulkoordinatoren an Hauptschulen hatten z. B. im Rahmen der ersten PISA-Untersuchung die Aufgabe, sich bei den Lehrkräften danach zu erkundigen, welche Schüler aus der PISA-Stichprobe nach ihrer Einschätzung schwache Leser seien. 90 Prozent der Schüler, deren PISA-Testergebnis noch unterhalb der Kompetenzstufe 1 lag, wurden von ihren Lehrern nicht als schwache Leser, sondern als unauffällig eingestuft (Deutsches PISA-Konsortium 2001; 2002).
In einer aktuellen Studie von Schmidt und Schabmann (2010) wurde die Genauigkeit und prognostische Validität von Lehrerbeurteilungen zu den Lese- und Rechtschreibleistungen von Grundschülern geprüft. 32 Klassenlehrer wurden gebeten, zu Beginn und Ende der ersten Klasse sowie zu Beginn und Ende der zweiten Klasse die Lese- und Rechtschreibleistungen ihrer Schüler einzuschätzen. Parallel zu diesen Messzeitpunkten wurden die Fähigkeiten der 282 Schüler mit standardisierten Verfahren erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass es in der untersuchten Population größere Gruppen von Kindern gibt, deren Probleme von den Lehrkräften deutlich unterschätzt werden, vor allem, wenn sie Schwierigkeiten im Lesen haben. Anfängliche Schwierigkeiten werden immer wieder fälschlicherweise als vorübergehend beurteilt. Die Autoren fordern deshalb abschließend vor allem eine Stärkung der diagnostischen Kompetenzen von Grundschullehrkräften. Eine ähnliche Überschätzung der basalen Lesefähigkeit von Sechstklässlern durch ihre Deutschlehrer fanden Rjosk et al. (2011). Falsch beurteilt werden jedoch nicht nur die schulischen Leistungen, sondern auch das Sozial- und Arbeitsverhalten oder die Konzentrationsfähigkeit der Schulkinder wie eine Studie von Stang und Urhahne (2016) zeigt.
Hofmann (2003) eruierte die diagnostischen Kompetenzen an hessischen Förderzentren und prüfte, inwieweit der für die hessischen Beratungs- und Förderzentren formulierte Anspruch an die Diagnostik in die Tat umgesetzt werde. Sie befragte dazu 159 Lehrkräfte und erkundigte sich vor allem nach den verwendeten diagnostischen Verfahren und den theoretischen Konzepten, auf deren Grundlage diagnostiziert werde. 77 bis 90 Prozent der Befragten praktizieren das seit Jahren übliche Standardvorgehen, das sich aus der Überprüfung der Intelligenz und der schulischen Leistungen zusammensetzt. Bei der Frage nach der theoretischen Perspektive melden 87 Prozent zurück, dass sie sich an der Entwicklung des ganzen Kindes orientieren. Demzufolge rangieren eher theoretisch analytische, weniger ganzheitlich orientierte Konzepte auf den unteren Plätzen: lerntheoretisch orientierte mit 54 Prozent, systemisch orientierte mit 32, interaktionstheoretisch orientierte mit 29, medizinisch orientierte mit 25 und tiefenpsychologisch orientierte mit 13 Prozent. Resümierend stellt Hofmann (2003) fest, dass nicht eine theoriegeleitete, selbstreflexive Diagnostik vorherrscht, sondern die Pragmatik der Alltagsdiagnostik, die allen konzeptionellen und programmatischen Einflüssen zu widerstehen scheint.
Schuck et al. (2006) analysierten 720 sonderpädagogische Gutachten der Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Sehen aus den Bundesländern Hamburg, Bremen, Niedersachen und Schleswig-Holstein mithilfe eines aus 2000 Kategorien bestehenden Rasters. Die Beurteilung nach den Hauptkategorien Anlass der Untersuchung, diagnostischer Gegenstand, Fördervorschläge und verwendete diagnostische Verfahren führte zu folgenden Ergebnissen:
1. Das sonderpädagogische Gutachten wird eher als Teil eines Verwaltungsaktes aufgefasst, denn als Dokument fachlicher Auseinandersetzung. Entsprechend finden sich 1,3 Äußerungen pro Gutachten zu verwaltungstechnischen Vorgaben und nur 0,35 Äußerungen zu Schulleistungen.
2. Das medizinische Modell ist keineswegs zugunsten einer lernprozessorientierten Förderdiagnostik überwunden. Vielmehr dominiert immer noch die klassische Vorstellung, dass bei der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs die im Kinde liegenden verursachenden Variablen bedeutsam sind und keineswegs die schulischen Leistungen in ihrem Kontext und mögliche Fördervorschläge zur Verbesserung derselben. Zu Persönlichkeitsvariablen wie Intelligenz, Motorik, Konzentration und Teilleistungsstörungen finden sich 12,55 Äußerungen pro Gutachten und nur 5,22 Äußerungen zu schulischen Leistungen und gar nur 0,5 Äußerungen zu den Rahmenbedingungen in der Klasse, 0,71 Äußerungen zum schulischen Rahmen sowie nur 1,61 Äußerungen zum familiären Kontext.
3. Entscheidend für das Gutachten ist offensichtlich die Lernortbestimmung als zentraler, nicht weiter zu spezifizierender Fördervorschlag. Nur 0,59 Äußerungen pro Gutachten benennen zu fördernde individuelle Lernvoraussetzungen und 0,35 Äußerungen setzen sich mit schulischen Leistungen und schulischen Rahmenbedingungen auseinander.
4. Bei den eingesetzten diagnostischen Verfahren dominieren die Intelligenztests mit 0,83 pro Gutachten. Mit deutlichem Abstand folgen die Schulleistungs- (0,28 pro Gutachten) und Entwicklungstests (0,25 pro Gutachten).
5. Die allgemeine Qualitätsprüfung ergab, dass
– die Standards der klassischen Testtheorie kaum eingehalten werden,
– der diagnostische Prozess über die Dokumentation entsprechender Belege kaum nachvollziehbar und damit nachprüfbar dargestellt wird,
– der Zusammenhang zwischen Diagnostik und Förderung, in dem Sinne, dass Fördervorschläge plausibel aus den diagnostischen Daten abgeleitet werden, selten zu erkennen ist und
– die Fragestellung meist unkritisch übernommen und nur in Ausnahmefällen systematisch entwickelt wird.
Die Autoren sehen in diesen Daten ein regelrecht niederschmetterndes Ergebnis.
Kottmann (2006) bestätigt diese Ergebnisse und Einschätzung aufgrund einer Vollerhebung aller Überweisungsgutachten eines Schuljahres eines nordrheinwestfälischen Schulamtsbezirkes. Die aus 167 Gutachten gewonnenen quantitativen und qualitativen Daten wurden mittels Inhalts- und Clusteranalyse ausgewertet. Auch hier dominiert in den Gutachten die individuumzentrierte Sichtweise mit der Intelligenzmessung als zentralem Aspekt des Überweisungsverfahrens. Der angebliche und häufig bemühte grundsätzliche Wandel der Diagnostik hin zur Förderdiagnostik muss auf dieser Datenbasis zumindest angezweifelt werden, denn ein Schwerpunkt der Gutachten liegt immer noch in einer institutionsorientierten Zuweisungsdiagnostik.
Zusätzlich zur Analyse von 173 Gutachten aus Schulen zur Erziehungshilfe und Schulen für Lernbehinderte im Freistaat Sachsen, die ähnliche Mängel aufdeckt, wie die bereits erwähnten Studien, bat Schulze (2004) die Lehrkräfte, die die Gutachten verfasst hatten, die eigenen diagnostischen Kompetenzen einzustufen. 19 Prozent der Befragten sehen keine Notwendigkeit, ihre diagnostischen Kompetenzen zu verbessern, 27 Prozent melden diesbezüglich einen mittelmäßigen, 35 Prozent einen hohen Verbesserungsbedarf an und 19 Prozent machen hierzu keine Angaben. Zumindest 62 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass die eigenen diagnostischen Fähigkeiten und Kompetenzen durchaus verbesserungswürdig wären.
In den Berichten internationaler Vergleichsstudien und bei einer Reihe von Autoren ist immer wieder zu lesen, dass hohe diagnostische Kompetenzen sich vor allem dann positiv auf Schülerleistungen auswirken, wenn auf die differenzierte Diagnostik aufbauend individuell gefördert wird (Baumert & Kunter 2006; Deutsches PISA-Konsortium 2001; 2002; Helmke 2007; Hesse & Latzko 2009; Paradies, Linser & Greving 2007). Runow und Borchert (2003) prüften das Wissen von Lehrkräften über die Effektivität von Interventionen im sonderpädagogischen Arbeitsfeld. Dazu befragten sie schriftlich 375 Lehrkräfte von Förderschulen, Sprachheilschulen, Schulen für Geistigbehinderte und Grundschulen aus Norddeutschland bezüglich der Einschätzung der Effektivität von 20 gut evaluierten Interventionsprogrammen und -methoden. Nur vier dieser 20 Interventionsformen wurden adäquat eingeschätzt, die meisten wurden in ihrer Wirksamkeit deutlich überschätzt. Dieses Ergebnis legt nahe, dass ein Großteil der befragten Lehrkräfte eher wenig bis unwirksame Lehr- und Lernmethoden im Unterricht einsetzt. Die Sonderpädagogen unterschieden sich in ihren Bewertungen übrigens nicht signifikant von den Grundschullehrkräften. Eine vergleichbare Untersuchung führten Hintz und Grünke (2009) an der Universität Oldenburg mit 100 Studierenden der Sonderpädagogik und 101 Studierenden des kombinierten Grund-, Haupt- und Realschullehramtes aus höheren Semestern durch. Die Studierenden wurden gefragt, für wie effektiv sie sieben vorgegebene gut evaluierte Methoden zur Förderung lese-rechtschreibschwacher Kinder einschätzen und welche sie in der Praxis einsetzen würden. Ähnlich wie bei den Lehrkräften gab es bei der Einschätzung der Effektivität keine signifikanten Unterschiede zwischen den Studierenden der Sonderpädagogik und denen der Lehrämter für allgemeine Schulen. In beiden Gruppen besteht gleichermaßen die Tendenz, wirksame Konzepte zu unter- und unwirksame zu überschätzen, allerdings sind Studierende der Sonderpädagogik eher bereit, ineffektive Wahrnehmungs- und Motoriktrainings in der Förderung einzusetzen. Auch Schweizer schulische Heilpädagoginnen offenbaren in einer Online-Umfrage von Sodoge (2010) einen eklatanten Kompetenzmangel bei der Beurteilung von Konzepten, Materialien und Strategien zur Förderung lese-rechtschreibschwacher Kinder. Alle bekannten und zur Diskussion gestellten Fördermethoden halten sie für gleich wirkungsvoll und der Fokus ihrer Fördermaßnahmen zielt in erster Linie auf die ganzheitliche Stabilisierung der Persönlichkeit. Die große Bedeutung einer sprachspezifischen Förderung bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und die mittlerweile gut evaluierten Fördermethoden und Förderstrategien sind ihnen offensichtlich nicht hinreichend bekannt. Vergleichbare Kompetenzmängel decken Schmidt und Schabmann (2016) bei deutschen Referendaren auf.
In einer empirisch-qualitativen Studie von Luder et al. (2006) sollte die förderdiagnostische Praxis durch eine mündliche Befragung von 39 Schweizer Lehrerinnen und Lehrern an Klein- und Sonderklassen oder in Modellen der integrativen schulischen Förderungen untersucht werden. Dabei interessierten vor allem folgende Fragen: Welche förderdiagnostischen Konzepte verfolgen Lehrkräfte in der Praxis? Wie gehen sie bei der Erfassung des Lernstandes vor? Wie werden Förderziele bestimmt und Fördermaßnahmen geplant und wie erfolgt eine Evaluation und Anpassung der Fördermaßnahmen? Die Befragungsergebnisse zusammenfassend, halten Luder, Niedermann und Buholzer (2006) fest, dass vorhandene Materialien, Tests und förderdiagnostische Hilfsmittel zur Lernstandserfassung nur selten eingesetzt werden und dass sich die Lehrkräfte bei der Planung der Fördermaßnahmen sehr stark von der Situation beeinflussen lassen. Theoriegeleitete Konzepte zur förderdiagnostischen Arbeit stehen eher nicht zur Verfügung und sind somit auch nicht handlungsrelevant. Die Evaluation der Fördermaßnahmen erfolgt eher während der Förderung des Kindes; eine explizite und geplante Evaluation scheint dagegen in der Praxis nicht stattzufinden. Die Reflexion des förderdiagnostischen Prozesses als zentraler Aspekt der alltäglichen heilpädagogischen Tätigkeit ist relativ selten zu finden, stattdessen eher ein unprofessionelles, teilweise willkürlich anmutendes Vorgehen.
Gerne wird behauptet, dass sich die Beurteilung der Schüler durch ihre Lehrkräfte verbessere, wenn diese ihre Schüler besser kennen und verstehen. Oerke et al (2016) machen mit ihren Untersuchungsergebnissen auch diese Hoffnung zunichte. Der erste Eindruck einer Lehrkraft von einem Schulkind erweist sich als sehr stabil und durch spätere Erfahrungen kaum beeinflussbar. Darauf zu bauen, dass die diagnostischen Kompetenzen von Lehrern mit Zunahme der Berufserfahrung an Qualität gewinnen, stellt sich im Lichte empirischer Studien ebenfalls als unbestätigte Annahme heraus (Praetorius et al. 2011).
1.2 Diagnostische Aufgaben und geforderte Kompetenzen
Diese häufig beklagten Defizite bei den diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräften sind umso schmerzhafter, als eine Reihe wichtiger diagnostischer Aufgaben im pädagogischen Bereich zu bewältigen sind und da nachgewiesenermaßen andere Kompetenzen davon mit betroffen werden.
So fanden Klug et al. (2012) einen signifikanten Zusammenhang zwischen der diagnostischen Kompetenz und der Beratungskompetenz bei Lehrkräften. Obwohl korrelative Zusammenhänge nicht ohne Weiteres kausal interpretiert werden können, vermuten die Autoren, dass eine gründliche Diagnostik wohl einem guten Beratungsgespräch zeitlich vorausgeht und es ermöglicht. Internationale Vergleichsstudien zeigen unmissverständlich, dass Schulsysteme, in denen differenziert diagnostiziert und darauf aufbauend individuell gefördert wird, in vielen Beziehungen unserem deutschen Schulsystem überlegen sind (Deutsches PISA-Konsortium 2001; 2002). Auch Ingenkamp (1989) verweist auf zahlreiche Untersuchungen zur Bedeutung individueller Lernbedingungen von Schülern, in denen offensichtlich wird, dass der Lernerfolg der Schüler in erheblichem Maße von den diagnostischen Kompetenzen der Lehrkräfte abhängt und Paradies, Linser und Greving (2007) konstatieren, dass für das schwache Abschneiden Lernender die zu gering ausgeprägte Diagnosekompetenz von Lehrern verantwortlich sei, denn wer Lernrückstände nicht erkennt, kann diese auch nicht abbauen. Darüber hinaus seien diagnostische Kompetenzen zur Anpassung des Unterrichts an die Lernausgangslage erforderlich und ermöglichen rechtzeitige Präventionsmaßnahmen bei lern- und entwicklungsgefährdeten Kindern.
Die Aufgaben der Lehrer, bei denen diagnostische Kompetenzen erforderlich sind, werden von Langfeldt (2006) auf drei unterschiedlichen Ebenen beschrieben: der individuellen Ebene, der Klassenebene und der institutionellen Ebene. Auf der individuellen Ebene muss die Lehrkraft vor allem in der Lage sein, die individuellen Lernvoraussetzungen einzelner Schüler zu beurteilen, um diese angemessen fördern und fordern zu können. Auf der Klassenebene gilt es, die individuellen Unterschiede der Schüler zu erkennen, um z. B. effizientes, kooperatives Lernen in Gruppen zu organisieren oder die Lehrmethoden dem Niveau der Klasse anzupassen. Auf der institutionellen Ebene ist die Fähigkeit gefordert, faire und möglichst objektive Zeugnisse und Leistungsberichte zu erstellen und möglichst fehlerfreie Bildungsempfehlungen zu erteilen. Hesse und Latzko (2009) stellen folgenden Katalog zu expliziten diagnostischen Anlässen für Lehrkräfte zusammen:
• Planen von Unterricht
• Feststellen von Lernvoraussetzungen der Schüler
• Leistungsüberprüfung vor der Einführung neuer Themen
• Analyse des eigenen Unterrichts
• Konstruktion und Bewertung von Klassenarbeiten und Tests
• Bestimmung des Ausgangsniveaus: bei jeder Fördermaßnahme, vor jeder Nachhilfe oder Nachhilfeempfehlung, bei Lernschwierigkeiten einzelner Schüler, bei wichtigen Schullaufbahnentscheidungen, bei Übertritt in die 5. Klasse, Überprüfung der eigenen Bewertung und Zensurengebung.
Als Aufgabenbereiche einer sonderpädagogischen Diagnostik nennt Trost (2008):
• Die Beantwortung institutioneller Fragestellungen, womit Fragen nach der Schullaufbahn, nach Ein- und Umschulung, nach Zuweisung auch im vor- und nachschulischen Bereich gemeint sind.
• Die Beurteilung der Entwicklung und des Verhaltens von Menschen mit Behinderung, um gegebene Problemlagen zu verstehen und entsprechende förderliche Perspektiven zu entwickeln.
• Erziehungs- und unterrichtsbegleitende Lernprozessdiagnostik, um die Auswirkungen des eigenen pädagogischen Handelns einschätzen zu können und
• die Förderplanung, wobei nicht das Erstellen von Plänen, sondern der Prozess des Planens im Vordergrund stehen sollte.
Kany und Schöler (2009) sehen ebenfalls vielfältige Fragestellungen und damit verbundene diagnostische Aufgaben für Grund- und Sonderschullehrkräfte: Ermittlung der Schulfähigkeit, Feststellung des (sonder-)pädagogischen Förderbedarfs, Empfehlungen am Ende der Grundschule für die Schulform in Sekundarstufe I und letztendlich die Ermittlung der Leistungen und Leistungsfortschritte für die Planung der nächsten methodisch-didaktischen Schritte im Unterricht und der weiteren individuellen Förderung von Kindern mit Auffälligkeiten im Lernen und Verhalten.
Diese Aufzählungen machen hinlänglich deutlich, dass die Diagnosekompetenz als zentrale oder auch Kernkompetenz für erfolgreiches Unterrichten und pädagogisches Handeln zu betrachten ist. Nimmt man die derzeitige Debatte zur sonderpädagogischen Professionalität zur Kenntnis, so gehören laut Moser (2005) die diagnostischen Kompetenzen zu den zentralen Professionsmerkmalen. Im Zentrum steht in nahezu allen Kompetenzprofilen, so Moser (2005) weiter, die Diagnostik als Kern sonderpädagogischer Intervention, und dies gelte mittlerweile sowohl für schulische als auch für außerschulische Arbeitsfelder. Aufgrund der zunehmenden Heterogenität in der Grundschule durch Formen der flexiblen Eingangsstufe oder der Möglichkeiten der gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung stellt Seitz (2007) für die Grundschullehrkräfte eine Erweiterung diagnostischer Aufgaben und Kompetenzen fest, die bisher nur im Bereich von Sonderschulen bedeutsam zu sein scheinen. In diesem Sinne ist auch Kretschmann (2004) zu verstehen, wenn er für die Umsetzung von Integrationsmodellen fordert, dass Sonder- und Regelschullehrkräfte, sollen sie bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem oder sonderpädagogischem Förderbedarf nachhaltig kooperieren, über eine Schnittmenge von Diagnose- und Förderkompetenzen verfügen müssen.
Resümiert man die vielfältigen diagnostischen Anlässe und Aufgaben, überrascht es nicht, wenn Autoren wie z. B. Bundschuh (2010) fordern, Diagnostiker sollten über fachliche, diagnostische, didaktische und therapeutische Kompetenzen verfügen. Gleichzeitig drängt sich förmlich die Frage auf, wer diese vielen unterschiedliche Kompetenzen in sich vereinigen kann ( Kap. I.3 und Kap. I.4.2.4).
2 Psychologische Diagnostik
Die sonderpädagogische Diagnostik ist nach Bundschuh (2010) hinsichtlich ihrer Aufgaben, Handlungsfelder und Ziele eigenständig, hat jedoch viele Impulse gerade im Bereich der Methoden aus der psychologischen Diagnostik erhalten. Hesse und Latzko (2009) sind der Meinung, dass sich die pädagogische Diagnostik von der psychologischen nicht notwendig durch eigene Verfahren, Methoden und Theorien unterscheide, sondern nur durch den Bezug auf die pädagogische Fragestellung und Entscheidung und stellen auf diese Weise eine große Nähe zur psychologischen Diagnostik her. Insofern scheint es lohnenswert, sich zunächst der Grundlagen psychologischer Diagnostik zu versichern, um das Verhältnis der psychologischen zur pädagogischen und sonderpädagogischen Diagnostik zu klären und letztendlich auch auf diesem Wege das Besondere und Eigenständige an der sonderpädagogischen Diagnostik herauszuarbeiten.
2.1 Begriffsklärung
Die meisten Definitionen weisen darauf hin, dass die psychologische Diagnostik
• bei einer Fragestellung ihren Ausgang nimmt,
• theoriegeleitet gezielt Informationen sammelt und verarbeitet, die im Zusammenhang mit der Fragestellung für das Verständnis menschlichen Verhaltens und Erlebens bedeutsam sind,
• um dann auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen oder Prognosen über zukünftige mögliche Entwicklungen aufzustellen und
• um diese angestrebten und bewirkten Veränderungen letztendlich auch kontrollieren und evaluieren zu können (Jäger & Petermann 1999; Amelang & Schmidt-Atzert 2006; Petermann & Eid 2006; Hesse & Latzko 2009; Kubinger 2009; Pospeschill & Spinath 2009; Rentzsch & Schütz 2009; Amelang & Schmidt-Atzert 2012).
Für Schuck (2004a) stellt die pädagogisch-sonderpädagogische Diagnostik – und man achte auf die Ähnlichkeiten – im Kern einen Versuch dar, über die Reduktion der menschlichen Komplexität in der diagnostischen Situation zu Erklärungen, zu Prognosen und zu handlungsrelevanten Entscheidungen zu gelangen.
Psychologische Diagnostik ist nach der Definition von Amelang und Schmidt-Atzert (2006) eine Methodenlehre im Dienste der Angewandten Psychologie. Ihre Aufgabe besteht darin, »interindividuelle Unterschiede in Verhalten und Erleben sowie intraindividuelle Merkmale und Veränderungen einschließlich ihrer jeweils relevanten Bedingungen so zu erfassen, dass hinlänglich präzise Vorhersagen künftigen Verhaltens und Erlebens sowie deren evtl. Veränderungen in definierten Situationen möglich werden« (Amelang & Schmidt-Atzert 2006, 3).
Die Aufgaben und Fragestellungen werden, so Amelang und Schmidt-Atzert (2012), von ihren Anwendungsgebieten (Arbeits- und Organisations-, Forensische-,Pädagogische- und Klinische Psychologie) her bestimmt und so geht es im Rahmen der pädagogischen Psychologie z. B. um die Feststellung der Schulfähigkeit, die Eignung für weiterführende Schulen, das Feststellen eines sonderpädagogischen Förderbedarfs, die Eignung für bestimmte Berufsausbildungen oder um Erziehungsprobleme in Schule und Familie. Die psychologische Diagnostik konstruiert und verwendet weiterhin zur Bewältigung dieser vielfältigen Aufgaben spezifische Verfahren und Methoden wie Exploration, Interview, schriftliche und mündliche Befragung, psychometrische Tests und Verhaltensbeobachtung. Die theoretische Begründung und Fundierung erfolgt durch einen Rekurs auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der durch ihre Teildisziplinen (Differentielle und Klinische, Psychologie, Sozial-, Motivations-, Kognitions-, Sprach- und Entwicklungspsychologie) repräsentierten Gesamtpsychologie. Methoden, Anwendungen und Grundlagen konstruieren somit drei Seiten einer Art Spannungsfeld, in dem psychologische Diagnostik entsteht und fruchtbar wird ( Abb. I.1).
Abb. I.1: Das diagnostische Dreieck von Hossiep und Wottawa (eigene Darstellung)
2.2 Diagnostische Strategien
Viele zu untersuchende Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale sind nicht unmittelbar beobachtbar und deshalb nicht direkt erfassbar. Sie werden als hypothetische Konstrukte bezeichnet und müssen aus sichtbaren Verhaltensweisen, aus repräsentativen Verhaltensstichproben erschlossen werden. Diesen Prozess nennt man in der psychologischen Diagnostik nach Rentzsch und Schütz (2009) Operationalisierung oder die Übertragung theoretischer Konstrukte in messbare Variablen des Verhaltens. Solche psychologischen Konstrukte können sich auf relativ kurzfristige und veränderbare Erlebens- und Verhaltensmuster, sogenannte States (Zustände), beziehen oder auf längerfristige und eher stabile Erlebens- und Verhaltensmerkmale, sogenannte Traits.
Abb. I.2: Diagnostische Strategien (Rentzsch & Schütz 2009, 42)
Bei den diagnostischen Strategien, die den diagnostischen Prozess steuern, werden in der einschlägigen Literatur Selektions- und Modifikationsstrategien unterschieden (Pospeschill & Spinath 2009; Amelang & Schmidt-Atzert 2012; Krohne & Hock 2015).
Als Personenselektion werden im Rahmen der Selektionsstrategie geeignete Personen für bestimmte Anforderungen ermittelt (z. B. Konkurrenzauslese bei Studienfach oder Schulart) und als Bedingungsselektion wird versucht, geeignete Bedingungen zu bestimmen, unter denen eine Person mit bestimmten Eigenschaftsmerkmalen erfolgreich sein kann (z. B. Berufsempfehlung nach Eignungsdiagnostik). Die Selektionsstrategien basieren in der Regel auf der Annahme zeitlich stabiler Eigenschaften (Traits) und werden dem Bereich der sich auf das einmalige Erfassen eines Ist-Zustandes beschränkenden Statusdiagnostik zugeschrieben.
Innerhalb der Modifikationsstrategie soll die Verhaltensmodifikation, um ein Problemverhalten abzubauen, spezifische zu verändernde Verhaltensweisen einer Person ermitteln (z. B. die Modifikation aggressiver Verhaltensweisen). Die Bedingungsmodifikation sucht dagegen nach externen Bedingungen, deren Veränderung ein Problemverhalten reduziert (z. B. Änderungen im Familiensystem bei Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes). Hierbei steht eher die Veränderbarkeit von Erlebens- und Verhaltensmustern (States) im Mittelpunkt der Betrachtung, die überwiegend einer Prozessdiagnostik folgt und versucht, diese Veränderungen in wiederholten Messungen zu erfassen.
2.3 Diagnostischer Prozess
Die einschlägige Fachliteratur beschreibt den diagnostischen Prozess übereinstimmend als eine Aufeinanderfolge verschiedener Denk- und Handlungsschritte, wobei lediglich die Anzahl dieser explizit formulierten Schritte variiert (Jäger 2006; Paradies, Linser & Greving 2007; Kubinger 2009; Pospeschill & Spinath 2009; Rentzsch & Schütz 2009).
Als Ausgangspunkt für den diagnostischen Prozess dient eine Fragestellung oder Zielbestimmung. Der Diagnostiker wird mit einem Problem, einer Frage konfrontiert, aus der er zunächst eine differenzierte psychologische Fragestellung oder eine fachliche Zielbestimmung ableiten muss, indem er den in der Frage angesprochenen Sachverhalt präzisiert und operationalisiert. Ungenauigkeiten oder gar Fehler bei der Formulierung der Fragstellung oder Zielbestimmung wirken sich zwangsläufig ungünstig auf die Validität der Aussagen am Ende des diagnostischen Prozesses aus.
Nach der Präzisierung ist die Fragestellung in eine oder mehrere Hypothesen zu übersetzen, d. h., in psychologisch begründete und theoretisch fundierte Annahmen über das Zustandekommen des Problems, zur Erklärung oder Prognose eines Phänomens und damit auch darüber, welche Zustände oder Merkmale erfasst werden sollen. Diese Hypothesen werden dann im Lauf des diagnostischen Prozesses durch die Untersuchungsergebnisse bestätigt oder entkräftet.
Sind die Hypothesen formuliert, gilt es konkrete diagnostische Daten zu gewinnen. Hilfreich für das Bestimmen der Vorgehensweise und für die Auswahl adäquater Verfahren und Methoden ist eine gut operationalisierte und präzisierte Fragestellung. An die Planung des diagnostischen Vorgehens (wer, wann, wo, bei wem welche Daten erhebt) schließt sich dann die Durchführung der Untersuchung mit der Auswertung der Daten an. Die fach- und sachgerechte Deutung der Daten macht aus ihnen diagnostische Ergebnisse und führt zur Prüfung der bisher generierten Hypothesen. Eine nicht zufriedenstellende Hypothesenabsicherung ist in der Regel der Ausgangspunkt für das Entwickeln neuer Fragestellungen und das Aufstellen weiterer, zusätzlicher Hypothesen.
In das diagnostische Urteil werden alle vorliegenden diagnostischen Informationen bezugnehmend auf die Ausgangsfrage integriert und diese Datenintegration mündet ein in eine Diagnose oder Prognose, die als geprüfte Hypothese anzusehen ist. Wird der diagnostische Prozess nicht durch eine Intervention fortgeführt, findet er in der Regel durch ein psychologisches Gutachten sein Ende. Andernfalls stehen Entscheidungen über Indikation sowie Interventionsplanung an und die Beratung, Förderung oder Therapie wird diagnostisch im Sinne einer Verlaufs- und Erfolgskontrolle weiter begleitet.
Als Randbedingungen des diagnostischen Prozesses diskutiert Jäger (2006) allgemein-ethische oder berufsethische, rechtliche, gesellschaftliche und methodische Fragen, die vom jeweiligen Diagnostiker mitbedacht und beantwortet werden müssen:
• Genügt der Diagnostiker in seinem Vorgehen wissenschaftlichen Kriterien? Wo wurde eine Fragestellung angegangen, die mit den derzeitigen diagnostischen Möglichkeiten nicht gelöst werden kann?
Abb. I.3: Ablaufmodell des diagnostischen Prozesses (eigene Darstellung)
• Darf der Diagnostiker unter den gegebenen rechtlichen Bedingungen die notwendige und gewünschte Diagnostik vornehmen und besitzt er vor allem die Kompetenzen, um den diagnostischen Prozess regelgerecht durchzuführen?
• Inwieweit betrifft die individuelle Diagnose andere Personen, Personengruppen oder Institutionen und wer zieht welchen Nutzen aus ihr?
• Wie wirkt sich die Auswahl und vor allem die Qualität des eingesetzten Instrumentariums auf die Qualität der Hypothesenprüfung aus?
Da die Psychodiagnostik als methodische Disziplin im Dienste der Anwendung betrachtet wird und damit häufig der Vorbereitung und Fundierung praxisbezogener Entscheidungen dient, folgt die Diagnostik, so Pospeschill und Spinath (2009), weniger einem kausalen als vielmehr einem finalen Denkmodell. Geht es vor allem um die Veränderung von Personen, Situationen oder unerwünschten Zuständen, werden die im Zuge des diagnostischen Prozesses erhobenen Informationen nicht als Ursachen, sondern als Indikatoren für die Auswahl aus Alternativen verwendet. Es wird somit eben nicht nur festgestellt, was gegenwärtig ist, sondern vor allem auch, was in der Zukunft geschehen soll.
2.4 Normgerechte Beurteilung
Diagnostizieren heißt immer kategorisieren, klassifizieren und vergleichen und somit liegen jeglicher Diagnostik Vergleichsmaßstäbe oder Normen zugrunde. Das Ergebnis einer testpsychologischen Untersuchung ausgedrückt in Rohwerten oder in der Anzahl gelöster Aufgaben ist beispielsweise aus sich heraus nicht interpretierbar, sondern wird erst durch die Einordnung in ein Bezugssystem aussagekräftig. Als Bezugssysteme stehen grundsätzlich drei Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Statistische, soziale oder interindividuelle Norm
Die erbrachte Leistung wird hier verglichen mit einer Norm- oder Referenzpopulation, die z. B. aus einer Gruppe von Gleichaltrigen oder aus Schülern der gleichen Klassenstufe besteht.
2. Intraindividuelle oder Individualnorm
Der Bezugspunkt für die zu beurteilende Leistung einer Person ist deren frühere Leistung oder eine Leistung in anderen Bereichen. Wird z. B. der momentane Entwicklungs- oder Leistungsstand zu einem früheren in Beziehung gesetzt, kann der individuelle Lernzuwachs eines Schülers bestimmt werden, oder über den Vergleich zweier Leistungen ein und derselben Person in zwei unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsbereichen treten vorhandene individuelle Stärken und Schwächen dieser Person zutage.
3. Kriteriumsorientierte oder Sachnorm
Als Kriterium fungieren oft Lernziele, Bildungsstandards, Erwartungsprofile oder regelrechte Entwicklungsverläufe. Über den Vergleich der Leistung eines Schülers mit den Anforderungen, die in einem Lernziel formuliert sind, wird z. B. festgestellt, inwieweit dieses Lernziel vom Schüler bereits erreicht ist (vgl. Kany & Schöler 2009; Paradies, Linser & Greving 2007; Rentzsch & Schütz 2009).
2.5 Diagnostische Methoden
Komplexe Fragestellungen, wie z. B. die nach dem Vorhandensein einer Dyslexie oder die nach der angemessenen Schullaufbahn, lassen sich nicht mit einem Verfahren, einer Methode beantworten. Die Auswahl der notwendigen Verfahren und Methoden richtet sich wiederum nach der spezifischen Fragestellung, die Anlass und Ausgangspunkt für das diagnostische Handeln war.
Amelang und Schmidt-Atzert (2012) unterteilen die diagnostischen Methoden in Leistungstests (Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests, Intelligenztests, spezielle Fähigkeitstests, Entwicklungstests und Schultests), Persönlichkeitsfragebogen, nicht sprachliche und objektive Persönlichkeitstests, projektive Verfahren, Verhaltensbeobachtung, diagnostisches Interview und Gruppendiagnostik (Paardiagnostik, Familien- und Teamdiagnostik). Kubinger (2009) nennt zusätzlich noch
• Anamneseerhebung, in der die Vorgeschichte der untersuchten Person erfragt wird,
• Exploration, als das Erkunden bestimmter Sachverhalte und Stimmungen mittels Gesprächsführung,
• biografisches Inventar, das nach überprüfbaren Informationen aus der Lebensgeschichte fragt, die einen Einblick in die künftige in erster Linie leistungsbezogene Zukunft versprechen,
• Assessmentcenter, das die Qualität der Bewältigungsversuche einer Person bei berufsrelevanten Anforderungen erfasst und die
• Arbeitsplatzanalyse, mit deren Hilfe diejenigen psychologischen Bedingungen und Voraussetzungen untersucht werden, die eine bestimmte Berufstätigkeit an den Menschen stellt.
2.6 Ethische und rechtliche Bestimmungen
Es existiert kein spezifisches Gesetz zu den Pflichten und Rechten des Diagnostikers und die Anwendung von Testverfahren ist nicht explizit gesetzlich geregelt. Nur ansatzweise findet sich gelegentlich eine entsprechende Regelung in einem Landesschulrecht, aber dessen ungeachtet sind eine Reihe rechtlicher oder gesetzlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Diagnostizieren relevant.
Der Umgang mit diagnostischen Daten und Informationen unterliegt, so Rentzsch und Schütz (2009), beispielsweise der Verschwiegenheitspflicht und den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, wonach die Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen sind, Daten nur mit der Einwilligung der Betroffenen oder ihrer gesetzlichen Vertreter weitergegeben werden dürfen und die Betroffenen selbstverständlich das Recht auf Einsichtnahme in die diagnostischen Daten besitzen.
Ebenso unterliegt jeder Diagnostiker der Sorgfaltspflicht, was bedeutet, dass nur derjenige diagnostisch tätig werden darf, der eine qualifizierte Ausbildung durchlaufen hat und deshalb über die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügt. Gegen die Sorgfaltspflicht verstößt auch ein Arbeitgeber oder Vorgesetzter, wenn er psychologische Diagnostik an Unqualifizierte delegiert und eine solche Delegation an Unqualifizierte kann, nach Friedrichs (2006), durchaus als fahrlässig oder grobfahrlässig eingestuft werden. Die meisten einschlägigen Verlage haben aus diesem Grund eine freiwillige Vertriebsbeschränkung für psychologische Tests eingeführt, die den Zugang für Unbefugte erschweren oder gar verhindern soll. Die Anbieter legen in diesem Zusammenhang vertraglich fest, dass psychologische Tests nur von fachlich qualifiziertem Personal, insbesondere Diplom-Psychologen, erworben und angewendet werden sollen.
Schließlich stellt, so Friedrichs (2006), die psychologische Diagnostik häufig einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht eines anderen Menschen dar, der nur durch eine entsprechende Einwilligung gerechtfertigt ist. Eine solche Einwilligung des Betroffenen setzt implizit eine Qualifikation des Diagnostizierenden für seine Tätigkeit voraus. Denkbar wäre, dass ein Betroffener, hätte er um die mangelhafte Ausbildung des Untersuchers gewusst, seine Einwilligung nicht erteilt hätte. Für Friedrichs (2006) sind in diesem Zusammenhang auch mögliche Haftungsansprüche zu bedenken. Mitteilungen von Diagnosen und Untersuchungsergebnissen können z. B. bei manchen Menschen ein Trauma auslösen, das mit einem erheblichen finanziellen Schaden einhergeht. Stellen sich dann die mitgeteilten Testergebnisse und Diagnosen auch noch als falsch heraus, kann die Haftung empfindlich bis existenziell werden.
Jäger (2006) verweist auf allgemein- und berufsethische Bedingungen, unter denen ein diagnostischer Prozess ablaufen sollte, die in folgenden Anfragen an Diagnostiker zum Ausdruck kommen: Genügt das diagnostische Vorgehen wissenschaftlichen Kriterien? Wo wird eine Fragestellung angegangen, die mit den derzeitigen Methoden der psychologischen Diagnostik nicht zu beantworten ist? Wo kollidiert das konkrete Handeln mit den Ansprüchen und Erfordernissen der eigenen Berufsethik?
Letztendlich wird in den KMK-Standards zur Lehrerausbildung im Kompetenzbereich »Beurteilen« festgelegt, dass Lehrkräfte ihre Beurteilungsaufgaben gerecht und verantwortungsbewusst ausüben, indem sie z. B. Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe erfassen und bewerten (Paradies, Linser & Greving 2007).
2.7 Bewertungs- und Beurteilungsfehler
Breitenbach (2003) weist darauf hin, dass jedem Beobachter und Beurteiler aufgrund aktiv interpretierender und damit verändernder Wahrnehmungs-, Speicher- und Abrufprozesse eine Reihe von Beobachtungs- und Beurteilungsfehler unterlaufen können:
1. Güte- und Mildefehler
Diese häufig auch als Fehler der Großzügigkeit beschriebene Beobachtungsund Beurteilungsverzerrung entsteht durch die Tendenz, eine bestimmte Person grundsätzlich zu vorteilhaft zu beurteilen. Für den sonderpädagogischen Bereich ist zu beobachten, dass gerade Berufsanfänger kranken oder behinderten Kindern gegenüber besonders milde gestimmt sind. Bei ihnen ist unter Umständen das Motiv des »Helfen-Wollens« besonders stark ausgeprägt und sie sind deshalb nicht imstande, zwischen der diagnostischen und der pädagogischen Perspektive zu unterscheiden.
2. Fehler der zentralen Tendenz
Beurteiler neigen dazu, extreme Positionen bei der Bewertung zu vermeiden, und bevorzugen mittlere Ausprägungen. Sie verspüren offensichtlich eine gewisse Scheu, ein Merkmal als stark ausgeprägt einzustufen und scheinen sich bei einer Beurteilung wie »ein wenig« oder »mittelmäßig« wohler zu fühlen, vor allem wenn ihnen für die Beurteilung keine klar definierten Beurteilungsmaßstäbe oder -kriterien zur Verfügung stehen.
3. Logischer Fehler
Der logische Fehler besteht in der Tendenz des Beurteilers, Merkmale, die ihm logisch oder psychologisch als zusammengehörig erscheinen, auch ähnlich zu bewerten. Er entsteht oft auf der Grundlage impliziter und mehr oder weniger naiver Persönlichkeitstheorien oder auch im Zusammenhang mit einem Denken in Syndromen.
4. Halo- oder Hof-Effekt
Gemeint ist damit die Neigung eines Beurteilers, sich in der Beurteilung oder Beobachtung einer einzelnen Persönlichkeitseigenschaft vom Gesamteindruck oder von einer hervorstechenden Eigenschaft beeinflussen zu lassen. Die vorgefasste Meinung über ein Kind beeinflusst die Erzieherin bei der Einschätzung einzelner Merkmale dieses Kindes. Der Halo-Effekt hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem logischen Fehler. In beiden Fällen werden die Beobachtung und Beurteilung eines Merkmals durch bereits vorhandene Kenntnisse oder Meinungen verzerrt. Eine Abgrenzung ist jedoch dahingehend möglich, dass es beim Halo-Effekt um die Zusammengehörigkeit von Eigenschaften eines Individuums geht, während sich der logische Fehler auf die Affinität verschiedener Merkmale losgelöst von einem einzelnen, konkreten Individuum bezieht. Der logische Fehler ist vergleichsweise abstrakt. Er bedarf nicht des Bezugs zu einer realen Person, sondern zu einer mehr oder weniger naiven Persönlichkeitstheorie.
5. Kontrastfehler
Ein Kontrastfehler liegt vor, wenn die zu beurteilende Person im Kontrast zur Person des Beurteilers erlebt wird. Er umschreibt die Tendenz, eine Person hinsichtlich eines bestimmten Merkmals gegenteilig zu sich selbst zu beurteilen. So mag ein Beobachter, der sich selbst für einen ordentlichen, korrekten und systematisch arbeitenden Menschen hält, die beobachtete Person leicht als unordentlich und schlampig einschätzen.
6. Fehler der räumlichen/zeitlichen Nähe
Vom Beurteiler wird das als ähnlich bewertet, was räumlich oder zeitlich nahe beieinander beobachtet wird. Es kann sogar der Fall eintreten, dass in raumzeitlicher Nähe Liegendes als sinnvoll oder gar als kausal zusammengehörig betrachtet wird. Die momentanen Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes werden z. B. vorschnell mit der kürzlich erfolgten Scheidung der Eltern erklärt.
7. Gutachten, Befund oder Beobachtungsbericht als Fehlerquelle
Muss ein Bericht oder ein Gutachten angefertigt werden, so können bei der Übersetzung der diagnostischen Daten in den schriftlichen Bericht Verzerrungen auftreten. Die schriftliche Fixierung von Beobachtungen und Untersuchungsergebnissen führt häufig zu einer Verkürzung, da manches als nebensächlich oder unwichtig erachtet wird. Beurteiler sind meist bemüht, einen in sich stimmigen Bericht abzugeben. Dazu können Details, die nicht passen, unterdrückt oder an Stellen, wo Einzelheiten zur Herstellung eines Zusammenhangs notwendig wären, neue nicht diagnostizierte hinzugefügt werden.
Bewertungs- und Beurteilungsfehler können für Paradies, Linser und Greving (2007) durch folgende Maßnahmen abgemildert werden:
• Abgleich persönlicher Beurteilungen mit Kollegenurteilen,
• Vergleich mit einer großen Zahl von Gleichaltrigen z. B. über Vergleichsarbeiten,
• systematische, regelmäßige Vergleiche über einen längeren Zeitraum,
• transparente Leistungsbeschreibung bei jeglicher Beurteilung,
• systematische Datenermittlung nach eindeutigen Regeln und eine
• ausreichende Datenmenge für Diagnosen und Gesamturteile.
2.8 Zusammenfassung
Psychologische Diagnostik versteht sich als angewandte Wissenschaft und lässt sich definieren und inhaltlich fassen als Beantwortung von aus den Anwendungsfeldern stammenden Fragen und Problemstellungen, wobei auf Theorien und Erkenntnisse der verschiedenen psychologischen Disziplinen und auf vielfältige Methoden zurückgegriffen wird. Ein Prozessmodell beschreibt den Weg von der Erarbeitung einer psychologischen Fragestellung bis hin zu deren Beantwortung, wobei mit der Selektions- und Modifikationsstrategie zwei grundsätzlich verschiedene diagnostische Vorgehensweisen unterschieden werden.
Jede Diagnostik bedarf bestimmter Normen als Vergleichsmaßstäbe, um die gewonnenen Daten interpretieren und in ihrer Aussagekraft bewerten zu können, jeder diagnostische Akt unterliegt ethischen und rechtlichen Vorgaben und Bestimmungen und jeder Diagnostiker sollte sich bewusst sein, dass ihm eine Reihe von Bewertungs- und Beurteilungsfehlern unterlaufen kann.
3 Sonderpädagogische Diagnostik
Kretschmann (2003; 2004) zeichnet eine fachlich-historisch begründete Linie von der medizinischen über die psychologische zur pädagogischen Diagnostik, wobei er davon ausgeht, dass gerade zwischen der pädagogischen und der psychologischen Diagnostik keine scharfe Trennungslinie gezogen werden kann, sondern dass sich hier die Übergänge eher fließend gestalten, was auch in der Verwendung des Begriffs »psychologisch-pädagogische Diagnostik« durch manche Autoren zum Ausdruck kommt (Langfeldt & Tent 1999; Ricken 2005; Schuck 2000). Diese Linie ließe sich weiterführen hin zur sonderpädagogischen Diagnostik als eine bestimmte oder besondere Form pädagogischer Diagnostik und ein kurzes Verweilen auf dem Weg hin zu dieser sonderpädagogischen Diagnostik bei den Bestimmungsstücken und Problemlagen der pädagogischen Diagnostik erscheint angemessen und hilfreich.
3.1 Begriffsbestimmungen
3.1.1 Pädagogische Diagnostik
Die Diskussion zur Problematik der pädagogischen Diagnostik lässt sich treffend durch die beiden Extrempositionen kennzeichnen, die nach Bundschuh (2004) innerhalb der Pädagogik vertreten werden. Auf der einen Seite steht die Forderung nach der Abschaffung jeglicher Diagnostik, da sich durch die Diagnostik kein Gewinn für die Betroffenen ergebe und Diagnostizieren aus pädagogischer Perspektive an sich schon schädlich sei. Andererseits wird Diagnostik als ein notwendiger und integraler Bestandteil pädagogischen und didaktischen Handelns betrachtet. Ricken (2005) macht in einem geschichtlichen Rückblick eine enge Verbindung aus zwischen Veränderungsprozessen schulischer Strukturen und einem zeitweise verstärkten Interesse an der Diagnostik. Auch für Hesse und Latzko (2009) sind die Schwankungen in der Wertschätzung und Anwendung pädagogischer Diagnostik im deutschen Bildungswesen unübersehbar. So finden sich im Anschluss an die Analyse des Deutschen Bildungsrates (1970), die das Fehlen einer ausreichenden Schulung zur Erhöhung der Objektivität und Rationalität bei der Leistungsbeurteilung in der Lehrerbildung als einen wesentlichen Mangel im deutschen Bildungswesen erkennt, systematische Bemühungen zur Verbesserung der diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräften. Bereits gegen Ende der 70er-Jahre tritt die »Anti-Test-Bewegung« auf den Plan, die Versuche zur Objektivierung der Schülerbeurteilung ideologisch verteufelt und wieder zu einer Reduktion der Diagnostikausbildung in Lehramtsstudiengängen beiträgt. Dem vergleichbar scheint die »Nach-PISA-Zeit« der pädagogischen Diagnostik eine deutliche Renaissance und Wiederbelebung zu bescheren, was aber nicht verhindert, dass die Skeptiker und Kritiker mit den alten Argumenten erneut in den Diskurs eintreten. Im Angesicht einer Fülle von anerkannten theoretischen und empirischen Forschungsarbeiten zur pädagogischen Diagnostik erscheinen Hesse und Latzko (2009) diese immer wieder vorgetragenen gleichen Gegenargumente eher als Vorurteile, da diese Kritik an einem wissenschaftlichen Gegenstand stattfindet, »ohne diesen Gegenstand wirklich umfassend zu kennen oder differenziert zur Kenntnis zu nehmen« (Hesse & Latzko 2009, 17).
Wendet man sich den Bestimmungsstücken der pädagogischen Diagnostik zu, stößt man auf eine übereinstimmende Begriffsdefinition, wonach pädagogische Diagnostik alle diagnostischen Tätigkeiten umfasst, »durch die bei Individuen (und den in einer Gruppe Lernenden) Voraussetzungen und Bedingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse analysiert und Lernergebnisse festgestellt werden, um individuelles Lernen zu optimieren. Zur pädagogischen Diagnostik gehören ferner die diagnostischen Tätigkeiten, die die Zuweisung zu Lerngruppen oder zu individuellen Förderprogrammen ermöglichen sowie den Besuch weiterer Bildungswege oder die vom Bildungswesen zu erteilenden Berechtigungen für Berufsausbildung zum Ziel haben« (Ingenkamp 1991, 760). Entsprechend zur psychologischen Diagnostik werden hier auch für die pädagogische Diagnostik die prozessorientierte Veränderungsdiagnostik und die statusorientierte Zuweisungs- oder Selektionsdiagnostik als grundlegende diagnostische Strategien benannt. Gerade die Selektionsstrategie gibt jedoch seit Jahren immer wieder Anlass zu dem Vorwurf, die pädagogische Diagnostik werde nur zum Zwecke der Selektion benutzt und führe lediglich zur Etikettierung von Schülern. Hesse und Latzko (2009) geben in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass Lehrkräfte auch ohne wissenschaftliche diagnostische Verfahren und Kompetenzen Schüler gleichermaßen etikettieren können oder müssen, denn nicht die Diagnostik ist für die Selektion verantwortlich, sondern das Schulsystem, das auf Selektion ausgerichtet ist.
Im Unterschied zur psychologischen Diagnostik erstreckt sich die pädagogische Diagnostik gemäß Definition auf Lehr-, Lern- und Bildungsprozesse und wird damit auf ein bestimmtes Handlungsfeld bezogen. Kretschmann (2004) sieht hierin eine gewisse Engführung, die alle emotionalen und sozialen Probleme im Kontext schulischen Lernens ausspart. Alles offen hält dagegen die Definition von Kleber (1992), wonach sich die pädagogische Diagnostik als Diagnostik in pädagogischen Handlungsfeldern versteht. Petermann und Daseking (2015) betrachten die pädagogisch-psychologische Diagnostik lediglich als ein spezifisches Handlungsfeld der psychologischen Diagnostik.
Von Bundschuh (2004) wird eine stärkere Werteorientierung als typisch für die pädagogische Diagnostik herausgestellt und auch Mutzeck und Melzer (2007) betrachten Werte, Ziele und Konzeptionen (Menschenbild, Handlungs- und Störungskonzepte, Konzeptionen von Schule, Unterricht, Familie, Freizeit, Gesellschaft) als der (sonder-)pädagogischen Diagnostik vor- und übergeordnet, die das diagnostische Handeln wesentlich mitbestimmen und deshalb bei jeder diagnostischen Tätigkeit mitzudenken sind.
Was die Diagnoseinstrumente und Diagnoseverfahren angeht, so sind diese nach Kretschmann (2004) vorwiegend psychologischer Natur und Herkunft und solche, die im Zusammenhang mit pädagogischer Prävention und Förderung einzusetzen wären, müssten im Grunde erst noch entwickelt werden. Benötigt werden in diesem Zusammenhang
• domainbezogene und curriculumvalide Verfahren, die Lernfortschritte nicht nur punktuell, sondern auch kontinuierlich messen,
• entwicklungsbezogene Verfahren, die abbilden, auf welchen Entwicklungsstufen sich ein Kind bezüglich unterschiedlicher Entwicklungsbereiche befindet,
• prozessorientierte Verfahren, die feststellen, wie weit Kinder oder Jugendliche bestimmte Erwerbsprozesse, wie z. B. Lesen, Rechnen und Schreiben bewältigt haben,
• Verfahren, die lernbereichsspezifische Motivation erfassen,
• umfeldbezogene Verfahren, mit deren Hilfe schädigende und schützende Bedingungen des Umfeldes eines Kindes entdeckt werden können sowie
• Verfahren, die neben Störungen auch Stärken und besondere Begabungen eines Lernenden erkennen (Kretschmann 2004; 2006a).
3.1.2 Sonderpädagogische Diagnostik
Gemäß der Definition von Sonderpädagogik als einer Pädagogik unter erschwerten Bedingungen formuliert Schuck (2000), sonderpädagogische Diagnostik sei nichts anderes als eine pädagogische Diagnostik zur professionellen Begleitung und Gestaltung von Prozessen der Bildung, Erziehung und Förderung unter eben erschwerten Bedingungen. Unter Rückgriff auf die Anthropologie des Lernens von Loch (1982), der Lernen als widerständig beschreibt, als ein ständiges Bemühen, Lernhemmungen zu überwinden, die entstehen, weil die Lernfähigkeiten oder Kompetenzen eines Kindes nicht den Lernaufgaben, die eine Lebenssituation stellt, entsprechen, führt Breitenbach (2003) aus, dass sonderpädagogische Diagnostik immer dann gefragt ist, wenn diese zum Lernen gehörenden Lernhemmungen so gravierend sind, dass sie mit den im Umfeld vorhandenen erzieherischen Möglichkeiten nicht mehr zu bewältigen sind. Auf die sonderpädagogische Diagnostik aufbauend, erfolgt in der Regel eine entsprechende sonderpädagogische Förderung, die sich nach Kretschmann (2006a) ebenfalls durch eine Bereitstellung und Durchführung besonderer Hilfsangebote, die über das pädagogische Standardangebot deutlich hinausgehen, auszeichnet.
Die sonderpädagogische Diagnostik ist für Nußbeck (2001) keine besondere Diagnostik, die über eigene von der psychologischen Diagnostik unterscheidbare Theorien, Instrumentarien oder Kriterien verfügt. Ihre Spezifizierung bezieht sich einerseits auf ihre Klientel, nämlich auf Personen, denen eine besondere Förderung zukommen soll, und andererseits auf den Personenkreis, der diagnostiziert, folglich die Sonderpädagogen.
Bundschuh (2010) betrachtet die sonderpädagogische Diagnostik zwar als ein Teilgebiet der Sonder- und Heilpädagogik, definiert diese jedoch dann fast wortgleich zur Ingenkamp’schen Definition der pädagogischen Diagnostik.
Stellt die Abgrenzung zwischen der pädagogischen und psychologischen Diagnostik schon ein schwieriges Unterfangen dar, so erscheint die begrifflich-inhaltliche Trennung der sonderpädagogischen von der pädagogischen Diagnostik schier unmöglich und letztendlich bleibt immer nur der Bezug auf die spezifischen sonderpädagogischen Situationen, Problem- und Fragestellungen.
Petermann und Petermann (2006) erkennen bei ihrem Blick auf die sonderpädagogische Diagnostik aus psychologischer Perspektive als Besonderheit ein multimodales und multimethodales Vorgehen, das ähnlich wie die psychologische Diagnostik ein Problemlöse- und Entscheidungsprozess ist, der einerseits der Abklärung eines Status quo und andererseits aber auch der Verlaufskontrolle dient. Dabei werden nicht nur psychische Störungen, sondern auch subklinische Phänomene und Probleme, kognitive Störungen und verschiedene umschriebene Entwicklungsstörungen, Risiko- und Schutzfaktoren aufseiten des Kindes, seiner Familie und seines Lebensumfeldes sowie der sonderpädagogische Förderbedarf im Hinblick auf Unterricht, Erziehung, Therapie und spezifisches Training mit optimalem Förderort erfasst. Diese Definition führt vor Augen, dass auch in der sonderpädagogischen Diagnostik die Status- und Prozessorientierung als zentrale diagnostische Strategien zu betrachten sind und um welch breites und umfassendes Handlungsfeld es sich beim sonderpädagogischen handelt, wie vielfältig sich die Anwendungsbereiche, die Methoden und Verfahren und damit auch die Grundlagen in den Referenzwissenschaften darstellen.
Um dieses große Aufgabengebiet zu bewältigen, bedarf die heilpädagogische Diagnostik nach Bundschuh (2010) einer engen Verbindung insbesondere zur Entwicklungspsychologie, der pädagogischen Psychologie, der klinischen, der medizinischen und der Sozialpsychologie. Ähnliche inhaltliche Zusammenhänge und Bedingungen umreißt Kretschmann (2004) in einem Modul »Pädagogische Diagnostik« in der Ausbildung von Lehrkräften. Neben den Grundlagen der psychologischen und pädagogischen Diagnostik im engeren Sinne sollten sonderpädagogische Diagnostiker neben didaktisch-methodischen Kompetenzen auch über ein Metawissen zu Entwicklungsverläufen und Störungsbildern sowie zu Präventions- und Interventionskonzepten verfügen.
Entsprechend der psychologischen Diagnostik lässt sich auch die sonderpädagogische in einem diagnostischen Dreieck, und somit in einem Spannungsfeld von Anwendungen, Methoden und Grundlagen beschreiben und charakterisieren ( Abb. I.4).
Die Grundlagen der sonderpädagogischen Diagnostik entstammen der Allgemeinen Heil- und Sonderpädagogik und den einzelnen sonderpädagogischen Fachrichtungen (Geistigbehindertenpädagogik, Lernbehindertenpädagogik, Sprachbehindertenpädagogik, Verhaltensgestörtenpädagogik, Körperbehindertenpädagogik, Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik) ebenso wie den sogenannten Hilfs- oder Referenzwissenschaften (Allgemeine Didaktik, psychologische Diagnostik, pädagogische Psychologie, Entwicklungspsychologie, Soziologie, Psychiatrie/Neurologie, Augenheilkunde, Orthopädie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde). Anwendung findet sie in den Handlungsfeldern Frühförderung, Vorschule, Schule, Berufsausbildung, Arbeit, Wohnen, Freizeit und als Methoden sind neben den herkömmlichen psychologischen Methoden wie Anamnese, Verhaltensbeobachtung und psychologische Tests sonderpädagogisch spezifische wie Screeningverfahren, Fehleranalyse, curriculumbasiertes Messen, Kompetenzinventare oder Aufgabensammlungen, Rehistorisierung, Konsulentenarbeit oder das schulische Standortgespräch zu nennen.
Abb. I.4: Das Dreieck der sonderpädagogischen Diagnostik in Anlehnung an das diagnostische Dreieck nach Hossiep und Wottawa ( Abb. I.1) (eigene Darstellung)
Vor diesem Hintergrund ist es kaum vorstellbar, dass eine Lehrkraft in einer inklusiven Schule diese Fülle von fachspezifischen und diagnostischen Kompetenzen in sich vereint, um somit alle Schüler mit ihren extrem unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen verstehen und entsprechende individuell ausgerichtete Fördermaßnahmen entwickeln und durchführen zu können. Nur ein Team bestehend aus verschiedenen spezialisierten Fachleuten wird auch weiterhin diesen komplexen diagnostischen Aufgaben in der Sonderpädagogik gewachsen sein.
Nach Mutzeck (2004) verfügt die sonderpädagogische Diagnostik über ein weiteres, immer wieder hervorgehobenes charakteristisches Merkmal: Sie ist verstehende Diagnostik, die Außen- und Innenperspektive in den diagnostischen Prozess einbezieht. Kauter (1998a; 1998b) geht davon aus, dass menschliches Handeln zwei Seiten hat, nämlich eine Außenseite, die von anderen Menschen beobachtet werden kann, und eine Innenseite, die nur dem handelnden Subjekt selbst zugänglich ist. Will man das Handeln eines Menschen verstehen, um aus diesem Verständnis z. B. Förderhilfen abzuleiten, muss ein Zugang zur inneren Realität gefunden werden. Der Diagnostiker muss verstehen lernen, was einem Menschen bei seinem Verhalten durch den Kopf geht, welche Gefühle ihn bewegen und welche Ziele er mit seinem Handeln verfolgt. Dazu ist es notwendig, sich in die psychische Situation einzufühlen, die Perspektive zu wechseln, die Dinge mit den Augen des betroffenen Menschen zu sehen, die Sinnstrukturen des individuellen Handelns, die Welt- und Selbstsicht des Subjekts, seine Psycho-Logik zu erkennen. Ein in dieser Beziehung hilfreiches Konstrukt ist das Konzept des Lebensraums von Kurt Lewin (1969), das im Zusammenhang mit der Förderdiagnostik als Situationsdiagnostik ausführlich beschrieben wird ( Kap. I.4.2.2).
Vor allem im Umgang mit Menschen mit komplexer Behinderung stehen Diagnostiker immer in der Gefahr, durch ihr Tun den anderen zu depersonalisieren. Der Mensch verschwindet hinter seiner Diagnose und tritt mit seinen spezifischen Vorlieben, Begabungen, biografischen Erfahrungen gar nicht mehr in Erscheinung. Eine verstehende heilpädagogische Diagnostik, die aufzeigt, wie sich die Behinderung im Lebenskontext des betroffenen Menschen zeigt und die weiß, dass sich Lehr-, Lern- und Unterstützungsbedarfe eines Menschen nur aus seinen responsiven Verhältnissen heraus bestimmen lassen, wie es z. B. in der Konsulentenarbeit geschieht, entgeht der Gefahr der Depersonalisierung (Fornefeld 2008).
3.2 Diagnostische Zielsetzungen
In einem ersten Schritt werden in diesem Kapitel diejenigen Ansätze und Vorstellungen gesammelt, die verschiedene Zielsetzungen und Strategien innerhalb der sonderpädagogischen Diagnostik differenzieren. Anschließend kommen die Autoren zu Wort, die diese Unterschiedlichkeit leugnen und konsequenterweise sonderpädagogische Diagnostik mit Förderdiagnostik gleichsetzen. Diese Analyse führt dann, in Entsprechung zur psychologischen Diagnostik, zur Unterscheidung zweier grundsätzlich verschiedener Strategien: der Förderdiagnostik als Modifizierungsstrategie und der Platzierungsdiagnostik als Selektionsstrategie.
3.2.1 Spezifische Zielsetzungen und Strategien
Diagnosen können nach Kretschmann (2006a) in der Pädagogik zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden: zur Optimierung pädagogischer Angebote, zur Schullaufbahnlenkung und zur Schulentwicklung.
Im pädagogischen Handlungsfeld kommt der Optimierung pädagogischer Angebote eine besondere Bedeutung zu und in diesem Zusammenhang können Diagnosen eingesetzt werden
• um eine bestmögliche Anpassung der Lehrangebote an die Lernausgangslage der Lernenden zu erreichen,
• um rechtzeitig präventive Maßnahmen für lern- und entwicklungsgefährdete Kinder und Jugendliche bereitzustellen,
• um bei bereits manifesten Krisen und Störungen angemessen und effektiv zu intervenieren und
• um Leistungen zu bewerten (Kretschmann 2006a).