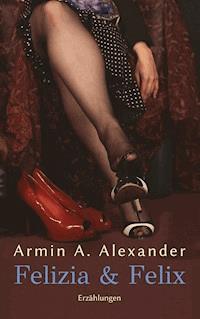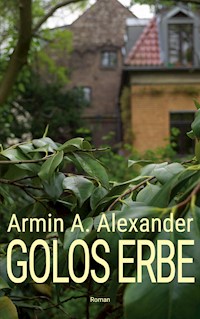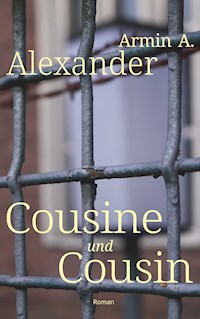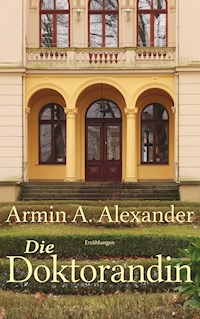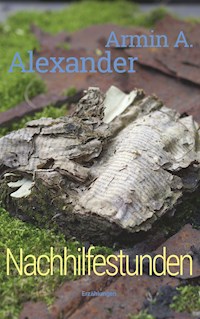Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Frühjahr 1985: In den Pharmalabors der Berger-Chemie wird nach einem verbesserten Rheumamittel geforscht, letztlich Routine. Die Ergebnisse der ersten Tierversuche sind jedoch ernüchternd. Kurz bevor man sich darüber verständigt, die Versuche abzubrechen, legen einige Tiere ein Verhalten an den Tag, als beeinträchtige das Mittel ihre Gedächtnisleistung. Am darauffolgenden Wochenende wird der Hefter mit den Protokollen, die jedoch unvollständig sind, bei einem Einbruch ins Labor gestohlen. Helene Jagenberg, eine an der Entwicklung beteiligte Chemikerin, hat die wichtigsten Teile mit nach Hause genommen, um einen ausführlichen Bericht zu schreiben. Kurz darauf wird sie entführt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frühjahr 1985: In den Pharmalabors der Berger-Chemie wird nach einem verbesserten Rheumamittel geforscht, letztlich Routine. Die Ergebnisse der ersten Tierversuche sind jedoch ernüchternd. Kurz bevor man sich darüber verständigt, die Versuche abzubrechen, legen einige Tiere ein Verhalten an den Tag, als beeinträchtige das Mittel ihre Gedächtnisleistung. Am darauffolgenden Wochenende wird der Hefter mit den Protokollen, die jedoch unvollständig sind, bei einem Einbruch ins Labor gestohlen. Helene Jagenberg, eine an der Entwicklung beteiligte Chemikerin, hat die wichtigsten Teile mit nach Hause genommen, um einen ausführlichen Bericht zu schreiben. Kurz darauf wird sie entführt.
Armin A. Alexander
QEL-250
Thriller
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2019 Armin A. Alexander
1. Auflage April 2019
Umschlag, Umschlagphoto und Satz:
Armin A. Alexander
Herstellung und Verlag:
BoD – Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN: 9783749414000
http://blog.arminaugustalexander.de
1.
»Mit diesen Worten möchte ich meine Ansprache zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier abschließen. Ich wünsche allen Mitarbeitern der Forschungsabteilung III ein frohes Fest und ein erfolgreiches 1985 und hoffe, Sie im neuen Jahr wieder in gewohnter Frische begrüßen zu dürfen.«
Doktor Sieberts etwa achtminütige Ansprache blieb sich seit Jahren im wesentlichen gleich. Selbst diese acht Minuten schienen vielen noch zu lang, nicht einmal so sehr, weil er dabei den Chef herauskehrte, sondern auf eine Weise näselte, die bereits die Grenze des Erträglichen überschritt, was jedem, außer ihm auffiel. Er war ein kleiner, vierschrötiger Mann mit grauen Augen und schütterem Haar, trug stets graublaue Maßanzüge mit farblich schlecht darauf abgestimmten Krawatten und galt als mittelmäßiger, dafür umso pedantischer Kaufmann. Ohne einen im Aufsichtsrat sitzenden Onkel wäre er nicht zum Leiter der Forschungsabteilung III der Berger-Chemie aufgestiegen.
Ihm wurde nur der Form halber Beifall gespendet, danach wandte sich jeder wieder dem Glas Sekt, das er in der Hand hielt und seinem Gesprächspartner zu. Im Anschluß seiner Ansprachen zog er sich meist in sein Büro zurück, in den Labors ließ er sich nur blicken, wenn es ihm unumgänglich erschien.
»Er hält wirklich jedes Jahr die gleiche Ansprache«, bemerkte Bertram Schulz, von einem künstlichen Seufzer begleitet, zu Helene Jagenberg.
»Kann schon sein. Ich habe nicht sonderlich darauf geachtet«, erwiderte sie abweisend, seine Gegenwart war ihr lästig.
Sie drehte das Sektglas ungeduldig in den schlanken, unberingten Händen mit den halblangen dunkelrot lackierten Nägeln.
Schulz stand im Ruf des Don Juans der Abteilung. Laut unbestätigten Gerüchten soll er bald jede Kollegin gehabt haben, die halbwegs hübsch war. Er war durchaus attraktiv mit einem gewissen, allerdings aufdringlichen Charme, kleidete sich in modischer Eleganz und roch nach teurem Aftershave. In seiner ›Sammlung‹ fehlte allein Helene, die ihm aber die kalte Schulter zeigte, was ihn nicht ruhen ließ. Sie war überdurchschnittlich groß, was ihren zum Kräftigen tendierenden Körper schlanker wirken ließ, mehr rote als braune taillenlange Locken, braune, unter dichten, nicht unschönen Brauen liegende Augen, ein mehr rundes als ovales Gesicht, mit stets perfektem Make-up, einer Vorliebe für kurze Röcke und hohe Absätze, wodurch ihre Beine mit den muskulösen Schenkeln, schön geschwungenen Waden und schmalen Fesseln besonders lang wirkten. Ihren üppigen Busen betonte sie mit enganliegenden Oberteilen. Sie hatte ihr Chemiestudium zügig abgeschlossen und war mit ihrer Dissertation bereits zur Hälfte fertig, als die meisten ihrer Kommilitonen, die mit ihr begonnen hatten, das Thema ihrer Diplomarbeit eingereicht hatten. Von Hause aus war sie finanziell gut gestellt, so daß sie sich manchen Luxus gönnen konnte.
»Sie sind etwas streng mit mir«, verzog Schulz leicht pikiert das Gesicht, es war aber zu aufgesetzt, so daß er damit bei ihr das Gegenteil erreichte.
Ostentativ wandte sie ihm den Rücken zu und begann eine Unterhaltung mit einer jungen Laborantin. Schulterzuckend zog er ab. Die wievielte Abfuhr mochte sie ihm wohl gerade erteilt haben? Er konnte es nicht mehr sagen.
»Er hält aber auch wirklich jedes Jahr dieselbe Rede«, seufzte die Laborantin.
»Nun ja«, meinte Helene achselzuckend. »Ihm wird wahrscheinlich nichts Besseres einfallen. Mit einer mehrfach erprobten Rede kann man wenig falsch machen. Letztlich sind Weihnachtsfeiern immer irgendwo gleich.«
»Da haben Sie vermutlich recht, Frau Doktor Jagenberg«, fuhr die junge Laborantin fort, ohne zu bemerken, wie Helene leicht säuerlich das Gesicht verzog. Sie mochte es nicht, auf der Arbeit von den Laboranten mit ›Frau Doktor‹ angeredet zu werden, für sie hatte das den unangenehmen Beigeschmack des Einschmeichelns. »Was soll man schon zu so einem Anlaß sagen?«
Helene enthielt sich einer Antwort. Ginge es nach ihr, würden zu solchen Anlässen nicht nur keine Reden gehalten, sondern Betriebsfeiern zu den unausweichlichen Jahrestagen ganz unter den Tisch fallen. Sie warf einen ungeduldigen Blick auf ihre Uhr. Warum Gemeinsinn heucheln, wenn man den Rest des Jahres, obwohl man unter der Woche täglich mindestens acht Stunden miteinander verbrachte, aber selten ein privates Wort wechselte und dazu neigte, in den Kollegen Konkurrenten auf die nächste Beförderung zu sehen und die Vorgesetzten es zur Selbstdarstellung nutzten? Schon in der Schule waren ihr solche Feiern zuwider gewesen.
»Wie werden Sie die Festtage verbringen«, riß die Laborantin sie aus ihren Gedanken.
»Ich werde meinen Vater in Wolfach besuchen wie jedes Jahr. Er ist froh, seine Tochter wenigstens über die Feiertage bei sich zu haben. Übers Jahr sieht er von mir ja nicht viel«, sagte sie höflich und bemüht, es nicht allzu gekünstelt klingen zu lassen, während sie sich leicht ungehalten mit der Linken eine Locke aus der Stirn strich.
»Er ist Arzt, nicht wahr?«
»Ja«, war Helene weiterhin bemüht, ihre Ungeduld nicht allzu offen zu zeigen.
Sie schaute bereits zum vierten Mal innerhalb von fünfzehn Minuten auf die Uhr.
»Es gibt nichts Schöneres, als das Weihnachtsfest im Schoß der Familie zu verbringen«, entgegnete die Laborantin – Helene versuchte sich an ihren Namen zu erinnern – mit verklärtem Gesichtsausdruck, ohne sich ihres abgegriffenen Allgemeinplatzes bewußt zu sein.
Wie würde sie wohl reagieren, wenn sie ihr sagte, daß sie das Weihnachtsfest am liebsten mit Sex mit einem potenten Mann verbringen würde? Aber sie würde es nicht sagen, es brachte nichts, die Gefühle anderer zu verletzten. Warum machten solche Anlässe sie immer aggressiv? Sie war doch sonst nicht so. Schulz schaute sie wieder an, als wollte er gleich über sie herfallen. Wann verstand er endlich, daß er der letzte Mann war, mit dem sie vögeln wollte? Er war weder ihr Typ, noch glaubte sie, daß er so gut sei, um vorbehaltlos auf ihre Kosten zu kommen. Daß er es mit so gut wie jeder trieb, war ihr dagegen herzlich egal.
Nach einem erneuten Blick auf die Uhr entschied sie, dem Anstand genüge geleistet zu haben und sich empfehlen zu können.
»Für mich wird es Zeit.« Sie stellte ihr halbgeleertes, schales Glas Sekt auf dem nächsten Tisch ab. »Ich will morgen früh losfahren und muß noch packen.«
Ehe die Laborantin zu einer Entgegnung ansetzen konnte, hatte sie den Konferenzraum verlassen. Schnellen Schrittes ging sie über den menschenleeren Flur zu ihrem Büro, nahm den Mantel von der Garderobe, legte ihn über den Arm und nahm Handtasche und Aktenkoffer – ein Designerstück, ein Geschenk ihres Vaters zu ihrem fünfunddreißigsten Geburtstag vergangenen Mai. Auf dem Weg zum Fahrstuhl mußte sie an Schulz’ Büro vorbei, in dem noch Licht brannte. Noch vor wenigen Minuten hatte sie ihn auf der Feier gesehen. Es sah ihm ähnlich, das Licht brennen zu lassen. Sie öffnete die Tür weit genug, um nach dem Lichtschalter greifen zu können. Noch rechtzeitig sah sie, daß er das Büro doch nutzte, wenn auch anders als üblich. Irmgard Reuter, Sieberts Sekretärin, eine attraktive, große korpulente Blondine Ende dreißig, war bei ihm. Sie hatte den Ruf, mit jedem Mann zu vögeln, der ihr gefiel und an Beziehungen nicht interessiert zu sein. Obwohl Helene sie mochte, weil sie bei den Männern den Ton angab, wollte sich keine Bekanntschaft zwischen ihnen aufbauen. Irmgard saß auf dem Schreibtisch, den Rock fast bis zur Taille hochgeschoben, so daß nicht nur die Ränder ihrer Halterlosen zu sehen waren, sondern auch das dichte, dunkle Schamhaar. Die Bluse hatte sie bis zum Nabel geöffnet, die großen schweren Brüste waren vom BH befreit. Er stand leicht seitlich. Sie küßten sich genüßlich, während er ihre Brüste massierte und sie ihm die Hose öffnete. Geräuschlos zog Helene sich zurück, nicht aus Diskretion, sondern weil sie keine Lust hatte, sich vom Anblick eines vögelnden Paares erregen zu lassen, von dem einer Bertram Schulz war.
Ihr gönnte sie es. Sie schien tatsächlich jeden zu nehmen! Wer weiß, wie oft sie bereits miteinander gevögelt hatten? Letztlich konnte ihr das egal sein.
Der Fahrstuhl kam relativ schnell. Sie betrat ihn und drückte auf den Knopf für die unterste Ebene der Tiefgarage.
Sie wollte nicht wissen, wie viele Quickies auf solchen Betriebsfeiern stattfanden und erinnerte sich, daß sie vor einigen Jahren auch mit einem Kollegen auf einer Betriebsfeier gevögelt hatte, allerdings in einer anderen Firma.
Der Fahrstuhl erreichte sein Ziel. Die Tür öffnete sich mit leisem Surren. Kühle, von Benzindämpfen erfüllte Luft schlug ihr entgegen. Es war still in der hell erleuchteten Tiefgarage, die über drei Geschosse reichte und über ebenso viel Fläche verfügte wie der Büro- und Verwaltungstrakt. Wer sich hier nicht auskannte, konnte sich problemlos verirren. Viele Fahrzeuge standen nicht mehr hier. Es war weit nach dem offiziellen Feierabend an einem Freitag. Daran denkend, daß sie ihren Mantel besser übergezogen hätte, ging sie leicht fröstelnd zu ihrem Wagen. Sie mußte, während das Klacken ihrer hohen Absätze auf dem Beton weithin schallend zu hören war, an die Kriminalfilme denken, in denen ein ahnungsloses Opfer, vorzugsweise eine schöne Frau wie sie, durch die Weiten einer solchen Tiefgarage ging, bis plötzlich hinter dem nächsten Pfeiler der maskierte Täter auftauchte, um sie in eine Ecke zu zerren und zu vergewaltigen oder sonst etwas mit ihr zu machen, das einen mutigen Helden auf den Plan rief. In der Gewißheit schmunzelnd, daß hierhin ebensowenig ein Unbefugter gelangen konnte, wie in den Tresor einer Bank, erreichte sie ihr luxuriöses Cabriolet. Sie schloß die Fahrertür auf und legte Aktenkoffer, Handtasche und Mantel auf den Beifahrersitz. Dann stieg sie ein und schlug die Tür zu, was laut durch die Tiefgarage hallte. Sie lehnte sich erleichtert zurück, schließlich warteten einige Tage ohne Siebert und vor allem ohne Schulz auf sie.
Sie startete den Motor, schaltete die Scheinwerfer ein und fuhr im Schrittempo zur Ausfahrt. Beim Verlassen der Tiefgarage mußte sie die Scheibenwischer einschalten, es hatte zu schneien begonnen. Der Himmel war seit zwei Tagen mit schweren Schneewolken verhangen, die nach rund einer Woche Frost aufgezogen waren, ohne daß es ein Quentchen wärmer geworden wäre. Eine dünne Schneedecke überzog bereits die Straßen. Sie hatte schon vor drei Wochen Winterreifen aufziehen lassen. Schließlich mußte sie um diese Jahreszeit im Schwarzwald mit verschneiten Straßen rechnen. Nun würden es auf der gesamten Strecke der Fall sein.
Minütlich nahm der Schneefall an Intensität zu, was gut im Licht der Straßenlaternen und der Scheinwerfer zu sehen war. Der Verkehrsfluß verlangsamte sich im gleichen Maße, wie der Schneefall sich steigerte. Trotz wiederholter Warnungen in Radio, Fernsehen und Zeitung fuhr die Mehrheit noch mit Sommerreifen. Sie stellte sich auf eine längere Heimfahrt ein und die Heizung hoch.
Sie brauchte über als eine Stunde länger zu ihrer in einem rechtsrheinischen Kölner Vorort gelegenen Wohnung. Bei dieser Witterung war sie froh, daß zum Haus eine Tiefgarage gehörte. Das Haus war fünfgeschossig mit zwei geräumigen Wohnungen je Etage. Die großen Balkone waren terrassenförmig angelegt, gingen nach hinten hinaus und boten einen ungehinderten Blick auf den Rhein.
Sie bog in die schmale Straße ein. Nur noch wenige Minuten und sie war im Warmen. Auf der Fahrbahn lag bereits dick der Schnee. Sie reduzierte auf Schrittempo. Der Schnee knirschte unter den Reifen. Ein junger Mann stapfte eilig durch den Schnee. Er hatte den Kragen seiner Jacke hochgeschlagen und den Blick gesenkt, damit ihm der Schnee nicht zu sehr ins Gesicht geweht wurde. Vor ihr versuchte ein Mann seinen Wagen, offenbar noch mit Sommerreifen, in die verschneite Einfahrt eines Hauses zu manövrieren. Sie bremste behutsam ab, um dem Wagen keine Möglichkeit zum Ausbrechen zu geben. Seiner dagegen war ins Schleudern geraten und blockierte nun die Straße. Er warf ihr einen entschuldigenden und zugleich leicht verzweifelten Blick zu. Sie nickte freundlich zurück, um seine Nervosität nicht noch mehr zu steigern. Innerlich konnte sie über soviel Naivität, zu dieser Jahreszeit noch mit Sommerreifen zu fahren, nur den Kopf schütteln. Sie wartete geduldig, bis es ihm im vierten Anlauf gelang, ohne erneut ins Schleudern zu geraten, in die Einfahrt zu fahren. Dann fuhr sie weiter. Fast zehn Minuten hatte das Manöver sie aufgehalten.
Die Tiefgarageneinfahrt zu ihrem Haus war bereits größtenteils vom Schnee befreit, obwohl es noch immer heftig schneite. Sie hielt vor dem Gitter, das Unbefugten die Zufahrt verwehrte, ließ das Fenster hinunter, steckte den Garagenschlüssel ins Schloß und drehte ihn um. Surrend und leicht quietschend fuhr das Gitter nach oben. Sie ließ den Wagen langsam hindurchrollen. Nachdem sie die Lichtschranke passiert hatte, senkte sich das Gitter wieder, diesmal laut ratternd und nicht quietschend. Sie fuhr auf ihren Stellplatz und stellte den Motor ab. Schlagartig umgab Stille sie.
In der Wohnung legte sie ihre Sachen auf der breiten, bequemen Couch ab, ehe sie in die Küche ging und sich ein Glas Cola einschenkte, das sie in einem Zug leerte, während sie rücklings an der Anrichte lehnte. Der Sekt hatte einen unangenehmen Geschmack hinterlassen. Sie drehte das leere Glas gedankenverloren in der Hand und dachte an ihren Vater, den sie sehr mochte. Im vergangenen Sommer hatte er seinen Sechzigsten gefeiert, wirkte aber gut zehn Jahre jünger und hatte die Dynamik eines Mannes ihres Alters. Er war etwas größer als sie. Ihre Mutter, an die sie keine Erinnerung besaß, hatte Mann und Tochter von einem Tag auf den anderen verlassen, als sie ein Jahr alt war, und nie wieder etwas von sich hören lassen. Das entsprach zwar nicht ganz den Tatsachen, sie schrieb ihrem Vater jedes Jahr zu Weihnachten eine Karte mit einem kurzen Gruß ohne Absender. Laut den Poststempeln kam sie viel in Europa herum. Offiziell waren ihre Eltern noch immer verheiratet. Er hatte sich nie scheiden lassen. Sie hatte nie nach dem Grund gefragt. Überhaupt sprach er nur selten und dann sehr allgemein mit ihr über ihre Mutter. Sie wußte letztlich nicht viel mehr wie ihr Alter und wie sie kurz vor ihrem Weggang ausgesehen hatte, weil sie Fotos von ihr gesehen hatte. Sie sah ihrer Mutter ähnlich. Bis zum Beginn der Pubertät hatte sie nie eine Freundin ihres Vaters kennengelernt, obwohl sie schon relativ früh wußte, daß er immer eine hatte. Erst nachdem sie ihren ersten Freund mit nach Hause gebracht hatte, stellte er ihr die erste vor. Es waren ausnahmslos attraktive und gebildete Frauen, einige sogar verheiratet, manche in seinem Alter, manche jünger, und als er noch keine vierzig war, einige sogar älter. Sie hatte sie nie gezählt. Manche seiner Beziehungen dauerten ein Jahr, viele etwa ein halbes bis ein Jahr, wenige kürzer und gelegentlich kaum länger als eine Nacht. Ihre Beziehungen unterschieden sich bezüglich der Dauer kaum von denen ihres Vaters, was sie relativ gleichgültig ließ. Zu einigen Freundinnen ihres Vaters hatte sie freundschaftliche Beziehungen aufgebaut. Die Dauer seiner derzeitigen Beziehung schien in einen persönlichen Rekord zu münden, sie erstreckte sich bereits über annähernd drei Jahre. Sie hoffte, daß er bei ihr bliebe. Wie es schien, wollte er es auch. Sie würde wahrscheinlich die Feiertage mit ihnen verbringen, wie im letzten Jahr.
Sie stellte das Glas in die Spüle, ging ins Wohnzimmer, legte eine Platte auf, zog die Jacke aus, ließ sich in die Polster der Couch sinken, streifte die Schuhe von den Füßen, legte die Beine auf den Couchtisch und lauschte der Musik.
2.
Der intensive Schneefall ließ erst in den frühen Morgenstunden langsam nach. Als um acht Uhr der Wecker summte und Helene aus dem Tiefschlaf riß, hatte er fast aufgehört. Der Himmel war weiterhin wolkenverhangen, das Thermometer um zwei Grad gesunken, so daß an Tauwetter nicht zu denken war.
Sie räkelte sich in ihrem breiten, kunstvoll verzierten Metallbett zwischen dunkelblauen Satinlaken. Wie nahezu jeden Morgen beobachtete sie das Bild, das der dem Bett gegenüberstehende und von Wand zu Wand reichende Spiegelschrank von ihr zurückwarf, wenn sie durch das dämmrige Winterlicht auch nicht allzuviel von sich sah. Sie betrachtete sich gerne im Spiegel, besonders beim Sex. Sie war stolz darauf keine Silikoneinlagen zu benötigen. Sie stand auf, legte einen seidenen Kimono über die Schultern und ging ins Bad.
Nach einer kurzen Dusche und einem schnellen Frühstück rief sie ihren Vater an, der sich verschlafen meldete. Da er gewöhnlich um diese Zeit bereits munter war, auch an einem Samstag, mußte es gestern spät geworden sein. Als sie im Hintergrund die Stimme seiner Freundin und das Rascheln von Stoff vernahm, wußte sie, daß er im Schlafzimmer abgenommen hatte. Sie mußte schmunzeln und war zugleich froh, daß er immer noch über ein geregeltes Liebesleben verfügte.
»Was kann ich für dich tun, Tochter«, unterdrückte er ein Gähnen.
Er nannte sie selten beim Vornamen, sondern meist ›Tochter‹.
»Nichts, ich wollte dich nur wecken«, lachte sie. »Nein, ernsthaft, ich wollte Bescheid sagen, daß ich bald losfahre.«
»Du bist also auch erst aufgestanden.«
»Nein, ich bin schon länger auf. Ich habe bereits geduscht und gefrühstückt.«
»Allein?« Die Hoffnung, daß dem nicht so wäre, war nicht zu überhören.
»Ganz allein. In mir hält es halt kein Mann lange aus.«
»Für die frühe Stunde bist du schon ganz schön frivol«, tadelte er sie nur schwach.
»Ich erinnere dich daran, daß du das auch ganz gut kannst«, lachte sie aufgekratzt. »Ich will dich nicht länger stören. Grüße Annegret von mir. Und, Papa …«
»Ja, Kind?«
»Sei lieb zu ihr. Sie verdient es.«
»Du kennst doch deinen alten Vater.«
»Eben drum«, meinte sie grinsend. »Bis heute Abend, Papa.«
Sie legte auf.
Auf der Höhe von Baden-Baden dämmerte es bereits. Am späten Nachmittag war es aufgeklart. Die Autobahnen waren zwar größtenteils vom Schnee geräumt, dennoch floß der Verkehr nur langsam. Sie verließ die Autobahn und fuhr weiter auf der Schwarzwaldhochstraße, die nur vereinzelt geräumt war. Der Mond schien von einem eisigen, klaren Himmel herab. Die dichte Schneedecke verhinderte, daß es richtig dunkel wurde und tauchte die Landschaft in ein gespenstisches Licht. Sie dachte an die Märchen und Geschichten von Hexen, Zauberern und anderen sonderbaren Gestalten, die in solch verschneiten, dunklen Tannenwäldern lebten. Es hätte sie nicht sonderlich überrascht, wäre hinter einer Kurve eine solche im Scheinwerferlicht aufgetaucht.
Sie erreichte Wolfach etwa eine Stunde vor Mitternacht. Der Ort wirkte um diese Zeit wie ausgestorben, nur die Hauptstraßen waren geräumt. Fast wäre sie im Schnee stecken geblieben, als sie in die Straße einbog, die zum Haus ihres Vaters führte, einem klassischen Schwarzwaldhaus. Ihr gelang es, im ersten Gang und im Schrittempo die Einfahrt zu erreichen, parkte hinter dem Geländewagen ihres Vaters und schaltete den Motor ab.
Kaum hatte sie den Schlüssel aus dem Schloß gezogen, wurde die Haustür geöffnet und ihr Vater und Annegret kamen heraus. Er strahlte, als hätte er seine Tochter jahrelang nicht gesehen. Annegret war dick vermummt. Ihr Vater dagegen trug lediglich einen Rollkragenpullover aus dicker Wolle und einen Kaschmirschal um den Hals, den Helene ihm letztes Weihnachten geschenkt hatte. Ihm schien die Kälte nicht viel auszumachen, die ihr entgegenschlug, als sie die Wagentür öffnete. Sie fror, trotz des Angorapullovers, der dunkelgrauen Lederhose, der Angoraunterwäsche und der gefütterten Stiefel. Ihre warme Daunenjacke lag noch auf dem Beifahrersitz.
»Da bist du ja endlich, Tochter.«
Annegret hielt sich im Hintergrund. Wenngleich sie sich gut mit Helene verstand, fühlte sie sich bei Szenen zwischen Vater und Tochter noch immer als Fremde.
»Obwohl es nicht überraschen sollte, daß ich bei dieser Witterung bedeutend länger von Köln benötige, hast du sicherlich seit acht Uhr keine ruhige Minute mehr zugebracht«, stellte sie fröhlich fest, während sie ausstieg und sich die Daunenjacke über die Schultern legte. »Ich kenne doch meinen alten Herrn. Guten Abend, Annegret.«
Annegret erwiderte ihren Gruß mit einem herzlichen Nicken.
Sie war eine sehr hübsche Frau. Sie konnte ihren Vater verstehen, daß er mit ihr zusammen war.
Annegret, rotblond, eher zierlich, Mitte vierzig, war eine im Privaten meist zurückhaltende, sympathische Frau mittlerer Größe – zwischen Helene und ihrem Vater fühlte sie sich klein geraten. Als Chefredakteurin einer Modezeitschrift kleidete sie sich nachvollziehbar damenhaft chic.
»Du kennst doch deinen alten Vater«, meinte er achselzuckend, während er die Reisetaschen aus dem Kofferraum hievte, den Helene aufgeschlossen hatte.
»Je oller, je doller«, grinste sie.
»Rotzfrech wie immer«, bezahlte er mit gleicher Münze.
»Von wem ich das wohl habe«, meinte sie lapidar, während sie den Kofferraumdeckel schloß.
Annegret stand schon wieder in der Tür, die sie schloß sie, als Vater und Tochter im Haus waren.
»Eisig.« Sie schüttelte sich und schälte sich aus der Pelzjacke.
»Das stimmt. In Köln war es schon kalt, was immer etwas heißen will. Ist es bei uns kalt, ist es wirklich kalt im Land, aber hier ist es ja kaum wärmer als in einer Tiefkühltruhe.«
»Ihr seid zu empfindlich. Ihr sitzt zuviel in euren warmen Büros. Ihr müßtet mehr draußen sein.«
»Danke, aber ich bin froh, wenn ich Anfang Januar für einige Tage beruflich nach Mailand muß«, war Annegret alles andere als begeistert von dem Vorschlag. »Da ist es etwas wärmer als hier – hoffe ich jedenfalls.«
»Du hast bestimmt Hunger, Tochter?«
»Und wie! Ich habe mich schon auf der Herfahrt auf deine Kochkünste gefreut.«
»Kochen kann dein Vater ausgezeichnet. Ich fürchte immer um meine Figur, wenn ich bei ihm bin.«
»Das kannst du jemandem erzählen, der sich die Hose mit der Zange anzieht. Annegret, du nimmst prinzipiell nicht zu, ganz gleich, was du ißt, und willst stets einen Nachschlag.«
»Mein Vater, charmant wie eh und je.«
»Setzt euch an den warmen Kamin, sonst erfriert ihr mir noch. Ich serviere gleich das Essen.«
»Deinen Worten entnehme ich, daß ihr auf mich gewartet habt.« Helene war nicht überrascht.
»Du kennst doch dein Vater.«
Helene zuckte mit den Achseln. Und ob sie ihn kannte! Eine bessere Mutter konnte sich kein Kind wünschen.
Nach dem Essen, an dem sich nicht nur Helene reichlich bediente, saßen sie bei heißem Tee vorm warmen Kamin.
»An was arbeitet ihr derzeit? Es ist nicht allein die Neugierde eines Vaters, sondern das Interesse des Arztes, schließlich will ich wissen, was in Zukunft an brauchbaren und weniger brauchbaren Medikamenten auf mich zukommt.«
»Stimmt«, pflichtete Helene ihm lachend bei, »es gibt eine Menge weniger brauchbarer und auch einige überflüssige Medikamente auf dem Markt, irgendwie muß den Patienten ja das überzählige Geld aus der Tasche gezogen werden. Nein, ernsthaft, wir arbeiten derzeit an etwas alltäglichem, einem Mittel gegen Rheuma, nichts was einen Nobelpreis bringen könnte, aber das hoffentlich einigen Linderungen verschafft. Es handelt sich nicht unbedingt um etwas Neues, soll aber besser verträglich sein, erfolgt die Einnahme über einen längeren Zeitraum. Siebert hat dem Mittel intern die Bezeichnung QEL-250 gegeben. Bisher hat noch niemand herausgefunden, nach welchem Muster er sie vergibt.«
»Dieser Siebert ist dir nicht sonderlich sympathisch«, entnahm Annegret ihrem Tonfall.
»Siebert ist eigentlich niemandem sympathisch. Er wird zwar von vielen respektiert, aber ich wüßte nicht, zu wem im Unternehmen er ein engeres Verhältnis hätte. Nicht einmal Irmgard, die seit bald vier Jahren seine Sekretärin ist, besitzt so etwas wie ein Vertrauensverhältnis zu ihm, obwohl sie es eigentlich haben müßte.«
»Irmgard, das ist doch die scharfe, dralle Rothaarige, von der du mir schon erzählt hast«, warf ihr Vater ein und erntete darauf den strengen Blick Annegrets, die Machoausdrücke nicht mochte. »Entschuldige, bitte, Anne, aber die Beschreibung stammt von meiner Tochter. Ich kenne diese Irmgard überhaupt nicht! Ich weiß nur, daß Helene gerne Freundschaft mit ihr schließen würde, sie aber offenbar nicht.«
»Sie will es nur darum nicht, weil sie bisexuell ist und ich nicht und sie an mir sexuell interessiert ist.«
»Letzteres kann ich nachvollziehen. Du bist schließlich eine gut aussehende Frau. Warum sollst du nicht auf Frauen und Männer gleichermaßen wirken«, meinte Annegret.
»Mir genügen die Männer«, entgegnete Helene kurz angebunden.
»Als Arzt würde ich deine Reaktion dahin deuten, daß du deine potentielle Homosexualität verdrängst«, meinte ihr Vater streng, dem es mißfiel, wenn jemand Annegret eine barsche Antwort gab.
»Quatsch«, reagierte Helene unwirsch. »Ich habe keine homosexuellen Neigungen. Eine Frau könnte mich nicht ansprechen, zumindest nicht sexuell.«
»Nun, als du mir von ihr erzähltest, hatte ich einen anderen Eindruck. Ich will dich zitieren: ›Sie hat schöne, lange, lockige, rote Haare, sinnliche Lippen, einen erstaunlich großen Busen, lange Beine mit kräftigen Schenkeln und schmalen Fesseln, sensible Hände. Ihre oft engen Röcke und die hohen Absätze ihrer Schuhe modellieren auf sehr anregende Weise ihren festen breiten Hintern heraus.‹ Du schwärmtest mir so von dieser Frau vor, wie du es gewöhnlich bei einem Mann tust, der dir gefällt. Das will zwar nichts heißen, aber ich glaube, daß du wie jeder Mensch einen homosexuellen Part in dir hast.«
»Papa, ich habe wirklich keine lesbischen Neigungen, glaube mir, sexuell läßt mich mein eigenes Geschlecht weitgehend kalt! Wahrscheinlich war ich ganz schön angesäuselt, als ich dir das erzählt habe, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.« Das entsprach nicht ganz den Tatsachen, wenn sie sich auch nur bruchstückhaft erinnerte.
»Eine schöne Frau kann mich durchaus sexuell ansprechen«, warf Annegret ein. »Ich hatte schon lesbische Erfahrungen, dein Vater weiß davon. Es war sehr schön. Solange die meisten Männer, von deinem Vater einmal abgesehen, meinen, daß allein ein strammer ›Junge‹ für eine Frau das alleinige Seelenheil bedeutet, solange wird man als Frau gerne die Zärtlichkeit einer anderen Frau in Erwägung ziehen. Eine Frau weiß oft besser, was eine Frau gerne hat. Natürlich gibt es auch Männer, die es wissen«, fügte sie hinzu und schaute Helenes Vater liebevoll an.
»Das mag ja alles stimmen, nur bei mir ist es anders«, hatte Helene keine Lust auf eine Fortsetzung dieser Debatte, nicht nur, weil sie fürchtete, sich in Widersprüche zu verstricken, sondern weil sie ihre Reaktion längst selbst als überzogen ansah, es aber aus falschem Stolz nicht zugeben wollte. »Ich weiß nur, daß keiner zu Siebert irgendeinen persönlichen Kontakt hat, nicht mal Schulz, der doch sonst wirklich mit jedem gutfreund sein will. Gestern abend, als ich auf dem Weg von meinem Büro zum Lift war, vögelten Irmgard und er in seinem Büro. Man muß sich eigentlich nur wundern, daß sie es überhaupt mit ihm macht«, sagte sie leicht verächtlich und spürte einen leichten Anflug von Eifersucht – ach verdammt, so falsch lag ihr Vater mit seiner Vermutung ja gar nicht!
»Vielleicht macht es ihr Spaß mit ihm«, vermutete ihr Vater. »Er mag beim Sex vielleicht anders sein.«
»Ich weiß nur, daß er nicht schwul ist«, entgegnete sie gereizt. »Ach, ich mag ihn einfach nicht! Er hat mich auf der Weihnachtsfeier schon wieder angebaggert!«
»Warum reagierst du auf das Thema Homosexualität eigentlich so heftig, das kenne ich nicht an dir? Von mir hast du das nicht. Ich kenne viele homosexuelle Menschen, die nicht anders sind wie wir normale Menschen. Als junger Mann habe ich einige in London kennengelernt, die wie deine Großeltern mit mir, vor den Nazis geflüchtet waren und die es dort oft genug auch nicht besser angetroffen hatten als bei dem irren Österreicher und seiner bayerischen Clique. Ich denke, du solltest als eine, die ’68 mit dem Studium begonnen und sich in der Studentenbewegung engagierte, die seinerzeit alle Spielarten mitmachte, auch eine Zeit in einer der sogenannten Kommunen lebte, daneben noch ein vorbildliches Studium absolvierte, etwas mehr Toleranz einer Minorität gegenüber zeigen. Ihr hattet seinerzeit wirklich einige gute Ideen, nur scheint mir vieles davon mittlerweile in Vergessenheit geraten zu sein.«
»Ja, Papa, ich weiß. Ich bin auch froh, daß du nicht wie andere Eltern warst, die ihre Kinder nicht mehr verstanden und in uns nur langhaarige Gammler sahen. Ich muß noch daran denken, wie du mich ’72 in der Kommune, in der ich wohnte, besuchtest. Himmel, waren da einige schrille Typen drunter! Fast alle haben später irgendwie den Sprung ins bürgerliche Leben zurückgeschafft. Das Elternhaus bleibt nicht ohne prägenden Einfluß. Die haben vielleicht geschaut, als mein Vater blieb und mit uns diskutierte und in vielem mit uns einer Meinung war. Oder an jenem Abend in der Szenekneipe, wo die Razzia war und einige von unserer Clique Gras bei sich hatten und du es schnell einsammeltest und auf der Wache den Beamten versichertest, daß du nur mit deiner Tochter und ihren Freunden einen netten Abend verbringen wolltest und keiner von ihnen je gekifft hätte, du nicht gewußt hättest, was dort verkonsumiert würde, während wir versuchten, wie brave Bürgerkinder auszusehen. Die ganze Zeit hattest du Hasch für mindestens zwei Jahre bei dir. Ich verstehe bis heute nicht, daß die Schmiere dich nicht durchsucht hat.«
»Das ist eben der Respekt, dem man einem Jünger Äskulaps gegenüber besitzt«, sagte ihr Vater gönnerhaft.
»Nein, mein alter Herr ist schon in Ordnung. Er hat bei keiner meiner Eskapaden etwas gesagt. Auch nicht als ich eine Zeitlang mit zwei Männer zusammenlebte und es auch gleichzeitig mit ihnen trieb«, sagte sie nicht ohne Stolz und auch Wehmut.
»Glaubst du denn, daß ich während unserer Exiljahre in London in der Boheme viel anders gelebt hätte? Schließlich war dein Großvater ein international anerkannter Maler, der zu den bekanntesten deutschen Künstlern seiner Generation gemeinsam mit Otto Dix und Max Beckmann gehört. Es wurde oft genug von einem zweiten George Grosz gesprochen.«
»Zumindest was die Sittenprozesse Anfang der ’20er Jahre anging, konnte Opa mit ihm mithalten«, meinte Helene schmunzelnd und versöhnt. »Nein, ernsthaft, es stimmt schon. Es liegt wohl in der Familie, auch wenn Sohn und Enkelin typisch bürgerliche Berufe ergriffen haben. Es fällt mir bis heute schwer zu glauben, daß Oma Opa für einige seiner erotischsten Werke der ’20er Jahre Modell gestanden hat. Ich kenne Oma halt nur als umtriebige ältere Dame, die sich rührend um ihre kleine Enkelin gekümmert hat. Weißt du, daß ich es immer schade fand, daß sie nach dem Krieg nie mehr in Deutschland wohnen wollten? Ich sah sie viel zu selten. Wobei ich sagen muß, daß sie beide doch etwas inkonsequent waren, in Limburg waren sie faktisch in Deutschland und doch wieder nicht. Es ist immer wieder schön über alte Zeiten zu sprechen«, meinte sie sichtlich verklärt.
»Dein Vater ist ein Quell interessanter Künstleranekdoten«, bestätigte Annegret. »Wen er alles von den Großen kennt!«
»Ich muß sagen, ich bedauere es manchmal, nichts von Opas Talent geerbt zu haben. Ich könnte mir gut vorstellen, eines dieser ungezwungenen Künstlerleben zu leben. Meine Kommunenzeit vermittelte mir einen guten Eindruck davon. Obwohl wir ja aus Protest gegen die Ignoranz des Establishments, dessen sturem Streben nach materiellen Reichtum, die halsstarrige Verdrängung der Nazivergangenheit, so lebten und nicht aus der Tatsache heraus, daß wir anders waren.«
»Die Vergangenheit habt ihr zwar ins Gespräch gebracht, aber verarbeitet ist sie bis heute nicht, kann sie auch nicht, solange sich zwei verfeindete Systeme gegenüber stehen. Solange es die DDR und unser halbes Deutschland gibt, das so frei wie es tut, nicht ist – die Alliierten haben immer noch auf den meisten Sachen den Daumen drauf, was vielleicht eine Zeitlang das Beste war, was diesem Land passieren konnte – leider leben wir jetzt in einem neuen Glaubenskrieg – bleibt das so«, sagte ihr Vater illusionslos.
»Wer weiß wie lange es die DDR und den Ostblock noch geben wird«, seufzte Helene.
»Länger als uns allen lieb sein kann und solange Hüben wie Drüben daran verdient wird, besteht kein Interesse an einem Ende des Status quo.«
»Ich weiß nicht, ob politische Diskussionen weit nach Mitternacht das Wahre sind«, gab Annegret zu bedenken. »Deine Tochter wollte uns etwas über ihre Arbeit erzählen oder du solltest uns etwas über deine Bohemienzeit oder über deinen Vater erzählen. Die Nazis verabscheue ich ebenso wie ihr. Zum Glück waren meine Eltern bereits in der Schweiz, als es richtig losging. Sie kehrten erst ’52 nach Hamburg zurück.«
»Also reden wir über Helenes Arbeit«, pflichtete er ihr bei. »Politik und Dummheit regen mich immer zu sehr auf. Wie weit seid ihr mit euren Versuchen?«
»Noch nicht allzu weit. Wir werden erst im neuen Jahr mit den Tests an den Laborratten beginnen. Wobei diese Ergebnisse immer mit Vorsicht zu genießen sind, auch wenn unsere Biologen es anders sehen. Eine Ratte ist letztlich doch kein Mensch. Umgekehrt kann man sich da allerdings nie so ganz sicher sein«, sie konnte sich diesen Einwurf nicht verkneifen. »Man kann aus Tierversuchen keine wirklich verläßlichen Rückschlüsse ziehen, wie ein Präparat auf die Psyche wirkt, schließlich sind Medikamente Drogen. Nebenwirkungen haben sie alle, sonst würden sie nicht wirken. Daher müssen in letzter Konsequenz auch Versuche an Menschen gemacht werden.«
»Ich halte Tierversuche auch nicht immer für das Geeignetste«, pflichtete ihr Vater ihr bei. »Besonders, wenn sie lediglich zur Befriedigung wissenschaftlicher Neugierde dienen.«
»Man könnte auch mit Computermodellen arbeiten, doch steckt das alles noch sehr in den Kinderschuhen, da der menschliche Körper als Computersimulation sehr aufwendig ist, und auch dann weiß man immer noch nicht, ob man alles erfaßt hat, schließlich gibt es immer noch eine kleine Gruppe, die anders auf einen Stoff reagiert als die Masse. Schließlich kann man sogar gegen Wasser allergisch sein. Vielleicht gibt es irgendwann einmal Computer, die leistungsfähig genug sind, solche Simulationen durchzuführen. Im Moment jedenfalls wäre es selbst für ein Unternehmen von der Größe der Berger-Chemie nahezu unbezahlbar für jede Forschungsgruppe einen eigenen Großrechner anzuschaffen, um wenigstens Grundlagen ohne Tierversuche zu erarbeiten. Die kleinen ›Personal Computer‹, die immer öfter in Büros anzutreffen sind, genügen ja lediglich als Schreibmaschinenersatz. Es wird sicherlich noch etwas dauern, bis sich da was ändert. Solange wird man um klinische und Tierversuche nicht herumkommen.«
»Mir tun die armen Tiere leid, die für Versuche herhalten müssen«, sagte Annegret teilnahmsvoll.
»Das können sie einem auch. Ich halte mich ungern im Tierversuchslabor auf. Es ist kurios, daß man Teile seiner eigenen Arbeit kritisiert und doch weiter macht.«
»Vielleicht ist die Gewißheit, Menschen, die leiden, helfen zu können, die einem hilft das Richtige abzuwägen und persönliche Vorbehalte unterzuordnen«, vermutete Annegret.
»Wahrscheinlich. Wenn dem nicht so wäre, hätte ich meine Arbeit längst aufgegeben.«
»Es freut mich zu hören, daß meine Tochter altruistische Neigungen besitzt«, lockerte ihr Vater das Gespräch etwas auf.
Helene überging diese Anspielung geflissentlich.
»Wir sollten langsam ins Bett gehen«, meinte Annegret nach einem Blick auf die Uhr, von einem herzhaften Gähnen begleitet. »Es war für alle ein langer Tag.«
»Eines der wenigen vernünftigen Worte an diesem Tag«, stimmte Helenes Vater zu.
3.
Seit drei Tagen regnete es nahezu ohne Unterbrechung. Der Himmel präsentierte sich als geschlossene schmutziggraue Fläche, nirgendwo ließ sich die Andeutung einer sich im Lichten befindlichen Wolkendecke erblicken. Die Stadt war in zwielichtiges Dämmerlicht getaucht, selbst um die Mittagszeit konnte nicht auf künstliches Licht verzichtet werden. Die Landschaft schien im endlosen Regen zu ertrinken. Die Feuchtigkeit schien überall zu sein, man war schon naß, kaum hatte man das Haus verlassen. Die konsequente Verweigerung des Thermometers die Zehngradmarke zu erreichen, geschweige zu überschreiten, trug nicht unbedingt zur Steigerung des Wohlbefindens bei, war wenig geschaffen, die Lebensgeister in Mensch, Fauna und Flora zu wecken, vieles wurde mit inneren Widerwillen gemacht, auch wenn man eine Tätigkeit sonst gern verrichtete. Nach einem überwiegend eisigen Winter folgte der April mit kühler Nässe, von Frühling keine Spur. Auch Helene blieb von diesem Hang zum Unwillen nicht verschont, zumal die Versuche mit QEL-250 entgegen aller Erwartung bisher erfolglos verlaufen waren.
»Ich verstehe es nicht«, rief Doktor Grasser, der leitende Biologe der Abteilung gereizt aus, nahm die Brille ab und legte sie auf seine Notizen.
Mit Daumen und Zeigefinger massierte er die Druckstellen, die die Brille auf der Nasenwurzel hinterlassen hatte. Er trank einen Schluck von seinem, schon seit geraumer Zeit erkalteten Kaffee, der längst kein belebend heißes Getränk mehr war, sondern nur noch eine kalte, bitterschmeckende, schwarze Brühe. Dem hiesigen Kaffee haftete ohnehin der Ruf an, ein besserer Muckefuck zu sein. Er war aber derart mit seinem Problem beschäftigt, daß er es nicht bemerkte.
Grassers alles andere als leiser Ausruf wurde von den Kollegen in seiner Nähe wahrgenommen.
»Was verstehen Sie nicht, Herr Kollege«, erkundigte sich Schulz, dem es nur selten gelang, seine Neugierde zu verbergen.
Mit einem großen Schritt war er bei Grasser und überflog dessen Notizen, die in einer klaren, steilen Handschrift erstellt waren. Allerdings wurde er nicht sonderlich schlau aus ihnen, da Grasser eine Art Kurzschrift verwendete, die nur er kannte und die es ihm erlaubte, auch umfangreiche Aufzeichnungen relativ kompakt darzustellen.
Grasser griff etwas achtlos nach seiner Brille, deren Gläser vom Fett der Fingerabdrücke leicht verschmiert waren und setzte sie wieder auf. Dann sortierte er mit leicht nervösen Fingern die auf dem Tisch verstreut liegenden Blätter, die er nochmals überflog und sagte zu Schulz:
»Laut meinen Berechnungen und langjährigen Erfahrungen hätten die Versuchstiere aller Gruppen, spätestens bei einer intravenös verabreichten Dosis von 2,8 mg eine, wie auch immer geartete Reaktion zeigen müssen. Wir haben aber allen schon über 3,6 mg verabreicht. Das sind fast dreißig Prozent mehr. Dennoch ist nicht die kleinste nachweisbare Reaktion erfolgt. Man könnte fast schon den Eindruck gewinnen, daß alle nur Salzlösungen verabreicht bekommen hätten und selbst dann hätte eine heftigere Reaktion erfolgen müssen, als es der Fall ist. Das ist es, was ich nicht verstehe, weil ich in all den Jahren, in denen ich bereits in diesem Metier tätig bin, so etwas noch nicht erlebt habe!«
»Sind Sie sicher, daß Ihnen nicht irgendwo ein Fehler unterlaufen sein könnte? Ich meine, wir machen alle einmal Fehler«, entgegnete Schulz mit einem nicht besonders intelligenten Gesichtsausdruck.
Grasser schaute ihn über den Rand der Brille, die ihm bis auf die Nasenspitze gerutscht war, leicht herablassend an. Seine Stimme nahm einen überlegenen Tonfall an und es lag ein nicht zu überhörender Tadel in seinen Worten, als er sagte: »Völlig, Herr Kollege, völlig. Sie dürfen mir ruhig glauben, dafür bin ich schon zu lange in diesem Geschäft.«
Schulz bemerkte, daß er mitten ins Fettnäpfchen getreten war und es besser wäre, nicht darin zu verweilen. Ehe er jedoch seinen Fauxpas irgendwie hätte gutmachen können, mischte sich Helene ins Gespräch.
»Ich meine, daß die Zusammensetzung der Präparate korrekt ist. Der Computer hat uns auch bescheinigt, daß, nach aller Erfahrung, allerspätestens bei 3,0 mg eine Reaktion hätte eintreten müssen. Es könnte natürlich sein, daß in der Computerberechnung ein Fehler ist«, räumte sie ein.
»Computer«, meinte Grasser verächtlich. »Ich verlasse mich lieber auf meine Erfahrungen. Und die sagen mir, daß eine Reaktion spätestens bei 2,8 mg hätte eintreten müssen und nicht erst bei 3,0 mg.«
»0,2 mg Differenz sind eigentlich nicht viel«, warf Schulz ein.
»Es gibt Stoffe da bedeuten 0,2 mg Differenz den sicheren Tod«, wies Grasser ihn zurecht, »das sollte Ihnen als promovierter Chemiker eigentlich bekannt sein.«
Schulz schwieg. Grasser schaffte es immer wieder, ihn als grünen Jungen dastehen zu lassen.
»Würde es stimmen, wäre die Arbeit der letzten drei Monate umsonst gewesen«, fuhr Grasser an Helene gewandt fort. Er mußte einen Seufzer unterdrücken, er verabscheute nichts mehr als eine Arbeit, die zu keinem brauchbaren Ergebnis führte. »Dennoch halte ich nicht viel von Computeranalysen. Diese Maschinen sind für wirklich komplexe Modelle viel zu langsam.«
»Das ist ein Umstand, mit dem wir in unserem Beruf rechnen müssen. Wissenschaft bedeutet auch, daß falsche Wege beschritten werden können, ohne daß man es zu Beginn bemerkt. Solange man aber feststellt, daß man sich geirrt hat und daraus die Konsequenzen zieht, ist das nicht weiter tragisch zu nehmen. Ich meine, daß man das nie außer Acht lassen sollte, wenn es noch so schmerzlich ist. Errare humanum est, sagten schon die alten Römer, wie mein alter Herr gerne mit einem Grinsen zu sagen pflegt. Wir sind schließlich alle nur Menschen, auch wenn das wie eine abgedroschene Phrase klingen mag«, sagte Helene freundlich, um den niedergeschlagenen Grasser, den sie auf besondere Weise mochte, etwas aufzurichten.
»Ja, ja, irren ist menschlich, sagte der Igel und kletterte von der Klobürste. Ich kenne die Sprüche. Darum geht es nicht, Frau Kollegin. Daß wir hier vielleicht einen falschen Weg beschritten haben, will ich nicht abschreiten, nach dem aktuellen Stand der Dinge kann davon ausgegangen werden, aber wenn diese Dinger«, war er erregt, bezeichnete er Computer immer als ›Dinger‹. Er besaß so gut wie kein Vertrauen in sie, im Gegenteil, für ihn waren sie eine Art Urform des Übels, die mehr Probleme schafften, als sie lösen könnten. »Wären diese Dinger wirklich zuverlässig, säßen wir hier nicht wie Studenten des ersten Semesters vor einem Problem des sechsten, die nicht wissen, wie sie es angehen sollen.«
Grasser begann sich in Rage zu reden. Sein Gesicht lief leicht rötlich an, sein stets etwas zu hoher Blutdruck meldete sich. Er war erhitzt und wurde zusehends kurzatmiger. Er mußte innehalten, ein leichtes Schwindelgefühl befiel ihn. Er kämpfte diesen kleinen Anfall nieder und bemühte sich um innere Ruhe.
»Es ist geschehen. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen es akzeptieren und einen anderen Weg wählen«, warf Helene beschwichtigend ein. »Wir sollten klären, ob wir die Versuchsreihen sofort abbrechen oder noch etwas weiterlaufen lassen.«
»Brechen wir sie sofort ab. Es bringt nichts, auf diesem Irrweg weiterzuwandeln. Es kostet nur Zeit und Geld. Außerdem müssen wir uns vor Siebert rechtfertigen.«
Schulz sprach damit lediglich aus, was die anderen lieber verdrängten, daß Siebert einer der größten Pfennigfuchser war, die es gab.
»Mein Gott, Siebert«, rief Grasser aus. »Ich finde, der Mann sollte sich um seinen Kram kümmern und uns unsere Arbeit machen lassen. Er ist Betriebswirt und kein Chemiker. Trotzdem mischt er sich fortwährend in unsere Angelegenheiten. Unser Verhalten ihm gegenüber kann schon fast als paranoid bezeichnet werden. Wir fürchten ihn wie Schüler ihren Klassenlehrer. Dabei ist er mehr auf uns angewiesen als wir auf ihn.«
Grasser hatte es nie verwunden, daß Siebert den Posten bekommen hatte, der eigentlich ihm zugestanden hätte. Er war schon halboffiziell für die Position gehandelt worden, bis aus heiterem Himmel Doktor Siebert aus der Personalabteilung zum Leiter der Forschungsabteilung III ernannt worden war. Begründet wurde es damit, Siebert wäre als Betriebswirt für diese Aufgabe besser geeignet als ein Wissenschaftler, da diese Position überwiegend mit kaufmännischen Aufgaben belastet sei.
»Da muß ich Ihnen recht geben«, pflichtete Helene ihm bei. »Siebert besitzt die Fähigkeit ein Biest zu werden, ohne dabei wie eines zu wirken. Es ist seine Art anderen zu begegnen, die er nicht für würdig hält, als seinesgleichen zu gelten. Ich mag ihn ebensowenig wie Sie.«
»Man sollte ihn nehmen wie einen Schnupfen; unbestreitbar lästig, aber unvermeidlich«, versuchte Schulz sich in der Kunst der Ironie, die er unter Begleitung eines reichlich dümmlichen Grinsens nachhaltig entschärfte.
»Wer will schon einen Schnupfen«, meinte Grasser, der sich wieder beruhigt hatte, mit einem Achselzucken.
Die Röte war aus seinem Gesicht gewichen. Er griff nach seiner Tasse, hielt sie mit beiden Händen umfaßt und starrte auf die schwarze erkaltete Brühe, die keinen appetitlichen Eindruck mehr machte. Er schüttelte sich, als befände sich eine obskure ekelerregende Substanz in der Tasse. Dann ging er zum Laborbecken, goß den Inhalt hinein und spülte sie mit klarem Wasser zweimal aus.
»Ich frage mich, warum ich mich immer dazu hinreißen lasse, diese grauenhafte Brühe zu trinken«, murmelte er kopfschüttelnd vor sich hin.
»Ich habe meinen Instant. Seit Siebert unsere Kaffeekasse umorganisiert hat und den Kaffee selbst besorgt oder besorgen läßt, was bei ihm auf dasselbe hinausläuft, bleibt einem kaum eine Wahl. Der Himmel weiß, woher er ihn bezieht. Ich habe bis dahin nicht gewußt, daß es heutzutage so etwas überhaupt noch gibt. Ich vermute fast, daß er ihn aus der DDR bezieht, immerhin leben Verwandte von ihm drüben«, sagte Schulz.
»Für Instant kann ich mich beim besten Willen nicht erwärmen«, gab Grasser kopfschüttelnd zurück. »Frisch gemahlener Bohnenkaffee ist noch immer das einzig vertretbare. Da bleibe ich lieber bei diesem undefinierbaren Zeug.«
»Dennoch, Instant ist um einiges besser als dieser Sud, dessen Zusammensetzung sich jeder Analyse widersetzt und mit noch so viel Milch und Zucker in nicht etwas halbwegs Genießbares zu verwandeln ist.«
»Ich habe da weiterhin meine Zweifel«, blieb Grasser bei seinem Standpunkt.