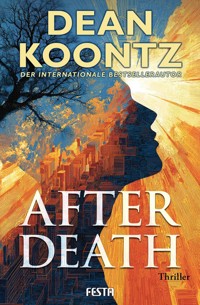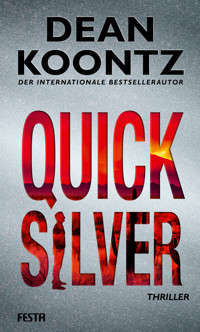
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Herkunft von Quinn Quicksilver ist ein Rätsel. Als Säugling wird er auf einer Wüstenstraße in Arizona ausgesetzt und wächst in einem Waisenhaus auf. Als er 19 Jahre alt ist beginnt der »seltsame Magnetismus« ihn zu steuern. Dieser unwiderstehliche Zwang rettet ihn sogar vor mehreren bewaffneten Männern, die versuchen ihn zu entführen. Auf seiner Flucht trifft Quinn schließlich auf Bridget und ihren Großvater Sparky, die ebenfalls von der unerklärlichen Kraft gesteuert werden. Das Trio rast durch die Sonora-Wüste, doch mit jeder zurückgelegten Meile kommt im Rückspiegel etwas Unheimliches näher und näher. Und Quinn erfährt etwas über sich, das noch viel beängstigender ist … Booklist: »Pocht vor Spannung. Ein weiterer Hit des Thriller-Meisters.« Bookreporter: »Mit Quicksilver reist Dean Koontz zurück in der Zeit und hat viel Spaß dabei.« Dean Koontz ist neben Stephen King der weltweit meistverkaufte Meister der dunklen Spannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Heiner Eden
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Quicksilver
erschien 2022 im Verlag Thomas & Mercer.
Copyright © 2022 by The Koontz Living Trust
Copyright © dieser Ausgabe 2023 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: Festa Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-057-1
www.Festa-Verlag.de
Rück deinen Stuhl heran
bis an den Rand des Abgrunds
und ich erzähle dir eine Geschichte.
F. Scott Fitzgerald
TEIL 1
LERNE MICH KENNEN
1
Mein Name ist Quinn Quicksilver – oder »Ku-Ku« für die gemeinen Kinder, als ich noch klein war –, aber ich kann meinen Eltern keinen Vorwurf machen, denn ich weiß nicht, wer sie sind. Kurz nach meiner Geburt wurde ich auf einem einsamen Highway ausgesetzt, sieben Meilen außerhalb von Peptoe, Arizona, wo 906 Leute so taten, als wäre der Ort, in dem sie lebten, tatsächlich eine Stadt. In eine blaue Decke eingewickelt und in ein weißes Körbchen aus Kunststoffschilf gebettet, hatte man mich auf dem mittleren von drei Teerstreifen abgestellt, wo ich kurz nach Sonnenaufgang gefunden wurde.
Man sollte glauben, dass es keinen schlechteren Start in ein Leben geben kann, aber seien Sie versichert, dass es noch viel schlimmer hätte kommen können. Zum einen war dies das Land der Kojoten. Hätte mich eine dieser Kreaturen gefunden, sie hätte mich nicht gesäugt, so wie die Wölfin es tat, die den ausgesetzten Romulus, den Gründer Roms, fand und rettete. Nein, sie hätte mich als eine Fast-Food-Essenslieferung betrachtet. Ich hätte auch von einem Sattelschlepper überfahren werden und als Pastete für Aasgeier enden können.
Zum Glück wurde ich von drei Männern auf dem Weg zu ihrer Arbeit gefunden. Der erste, Hakeem Kaspar, war ein Leitungsmonteur für den Verwaltungsbezirk, so wie in dem Song von Glen Campbell, den ich immer reizend, aber auch ein wenig seltsam fand. Natürlich hatte ich ihn damals, als ich auf dem Highway gefunden wurde, noch nicht gehört. Der zweite, Bailie Belshazzer, arbeitete als Chefmechaniker für einen der ersten Windparks im Land. Der dritte, Caesar Melchizadek, war der Pit Manager für die Blackjack-Tische in einem Indianercasino.
Laut einem Zeitungsartikel aus jener Zeit machte es mir Hakeem in dem Fußraum der Beifahrerseite seines Trucks von der Elektrizitätsgesellschaft bequem und fuhr mich zum Büro des County-Sheriffs. Bailie und Caesar folgten ihm in ihren Fahrzeugen. Warum sie es für nötig hielten, mich zu dritt den Gesetzeshütern zu übergeben, stand nicht in dem Artikel. Mehr wusste ich von diesen Männern nicht, bis ich, Jahre später und um mein Leben rennend, einen von ihnen in der Hoffnung aufsuchte, irgendein kleines Detail zu erfahren, das mir einen Hinweis darauf geben würde, wer und was ich bin.
Eine Sicherheitsnadel befestigte einen kleinen Briefumschlag an der Decke, in die ich eingewickelt war. Weder Hakeem noch Bailie noch Caesar hatten es gewagt, ihn zu öffnen, weil sie offenbar jahrelang Fernsehserien wie CSI geguckt hatten und befürchteten, dass sie die Fingerabdrücke des Kidnappers verwischen könnten. Entweder vermuteten sie, dass mich irgendein Unmensch entführt hatte, der dann die Nerven verlor und mich an jenem heißen Morgen meinem Schicksal überließ, oder sie glaubten, dass irgendwer meine Eltern verschleppt hatte und nun von mir ein Lösegeld verlangte. Als der Sheriff den Umschlag aufriss, fand er darin nur eine Karte, auf die QUINN QUICKSILVER und mein Geburtsdatum gedruckt waren.
In jenen Tagen gab es niemanden im Staat Arizona mit dem Nachnamen »Quicksilver«. Trotzdem vermuteten alle sofort, dass das mein Name war. Seither trage ich ihn mit mir herum. Natürlich steht der Name auch für Quecksilber oder Merkur, das flüssige Metall, das nach dem römischen Gott Mercurius benannt worden ist. Er war der Bote der anderen Götter und wurde für seine enorme Geschwindigkeit geschätzt – der Typ konnte wie verrückt beschleunigen. Und auch wenn Quinn als eine andere Form von Quentin verwendet wird, so entstammt der Name dem lateinischen Begriff quintus, was »der Fünfte« oder, in gewissen Zusammenhängen, auch »fünfmal« bedeutet. Vielleicht war es also gar nicht mein Name, sondern eine geheimnisvolle Botschaft, die »fünfmal beschleunigen« besagte, auch wenn man solch einen Tipp in Baby-Ratgebern genauso wenig findet wie die Anweisung »in Olivenöl und Basilikumblätter einlegen«.
Dann wurde ich zu einem Mündel des Countys, dem jüngsten, das je der Kinderbetreuung überlassen wurde. Keine Pflegefamilie war bereit, einen drei Tage alten Säugling aufzunehmen, dessen einziger Besitz eine besudelte Wickeldecke war und der, in den Worten von Sheriff Garvey Monkton, »seltsame blaue Augen und einen unheimlich festen Blick für solch einen winzig kleinen Wicht« hatte. Später dann wurde ich ins Mater Misericordiæ geschickt, ein Waisenhaus in Phoenix, das von katholischen Nonnen geführt wurde.
Als ich sechs Jahre alt war, wurde allen klar, dass ich nicht adoptierbar war. Unter Adoptivkindern gelten die Säuglinge als die begehrteste Altersgruppe und landen schneller in einem stabilen Zuhause, als man »Guddiguddigu« sagen kann. Das liegt daran, dass Babys in der Regel niedlicher als ältere Kinder sind, von Rosemarys berühmtem Baby vielleicht einmal abgesehen, aber auch daran, dass nicht genug Zeit vergangen ist, um von ihren leiblichen Eltern verkorkst worden zu sein. Jeder grinsende Säugling ist eine Persönlichkeit im Entstehen und somit empfänglich, zu einem Spiegelbild seiner Adoptiveltern geformt zu werden. Doch obwohl ich eigentlich niedlich genug war und dazu noch bereit, mich wie Lehm kneten zu lassen, gab es keine Abnehmer für Quinn Quicksilver.
Mein Scheitern, ein endgültiges Zuhause zu finden, lag nicht an dem mangelnden Einsatz der guten Schwestern des Mater Misericordiæ. Sie sind so unermüdlich und raffiniert wie jeder andere Nonnenorden auf diesem Planeten. Sie entwarfen einen Vermarktungsplan für mich, erstellten eine wundervolle PowerPoint-Präsentation und priesen mich den angehenden Eltern so aggressiv an, wie Disney es mit Zeichentrickfilmen über Prinzessinnen und drollige Tiere macht. Doch es half alles nichts. Viele Jahre später erfuhr ich von der Begründung, mit der einige der interessierten Adoptiveltern mir eine Abfuhr erteilten, aber vielleicht spare ich mir ihre Kommentare lieber für später auf.
Das Waisenhaus war außerdem eine Schule, denn Kinder, die sechs und älter waren, blieben oft dort, bis sie 18 wurden. Die Schwestern, die als Lehrerinnen dienten, waren ausgezeichnete Wissensvermittler, und die Kinder wussten, dass es besser war, sich ihrer Schulbildung nicht zu widersetzen. Wer sein Potenzial nicht ausschöpfte, verbrachte eine Menge Zeit damit, den Abwasch zu erledigen, Kartoffeln zu schälen und die Wäsche zu machen, alles Aufgaben, die einem fleißigen Lernenden erspart blieben.
Die Schüler des Mater Misericordiæ gewannen ständig städtische und staatliche Buchstabierwettbewerbe, Debattierklub-Turniere und Wissenschaftspreise. Folglich wurden viele von uns von einigen der herausragendsten jungen Intellektuellen des Staates vermöbelt.
Großzügige Unterstützer des Ordens stellten Stipendien fürs College und für die Handelsschule für alle Interessierten bereit, zu denen ich aber nicht gehörte. Ich strebte eine Karriere als Schriftsteller an. Eine tiefgreifende Ahnung sagte mir, dass der falsche Universitätskurs für kreatives Schreiben meinem Stil jede Originalität austreiben könnte und mich in einen literarischen Roboter verwandeln würde.
Schwester Agnes Mary leitete die Arbeitsvermittlung für solche Schüler, die keine weiterführende Schule besuchen wollten. Als ich 17 ½ Jahre alt wurde, benutzte sie ein paar meiner Textproben, um mir einen Job beim Herausgeber von Arizona! zu besorgen, einem Magazin über die Wunder des Staates und seiner Menschen. Zuerst erlaubten sie mir nicht, über zeitgenössische Personen zu schreiben, weil die sich viel leichter beleidigt fühlten als tote Leute. Stattdessen wurde ich beauftragt, interessante Orte und Bürger aus der geschichtenumwobenen Vergangenheit des Staates zu recherchieren und zu beschreiben, solange ich dabei Bordelle und Banditen außer Acht ließ.
An meinem 18. Geburtstag, nach nur sechs Monaten erfolgreicher Tätigkeit, konnte ich mir eine Einzimmerwohnung leisten und aus dem Waisenhaus ausziehen. Nachdem ich 18 Monate für das Magazin gearbeitet hatte, machte ich einen verhängnisvollen Fehler und befinde mich seitdem auf der Flucht vor finsteren Mächten.
Ich finde es unheimlich, dass ich, als ich diesen Fehler beging, binnen eines Tages und eine ganze Woche, bevor seine Tragweite deutlich wurde, meinen ersten Vorfall dieses, wie ich es eine Weile lang nannte, »seltsamen Magnetismus« hatte, als würde jemand mein Leben schreiben – nicht die Geschichte meines Lebens, sondern mein Leben selbst –, jemand, der wusste, dass die Zeit kommen würde, in der ich einen ganzen Haufen Geld brauchte, um meiner Ergreifung zu entgehen.
Dies war an einem Freitag Anfang Mai. Nachdem ich meine Aufgaben für die Woche erledigt hatte, nahm ich mir den Tag frei mit der Absicht, jede körperliche Anstrengung zu vermeiden, mich mit leeren Kohlenhydraten vollzustopfen und alte Alien- und Terminator-Filme zu streamen, bis mir die Augen bluteten. Stattdessen wurde ich immer unruhiger, noch bevor ich den ersten mit Schokolade überzogenen Donut gegessen hatte, und verspürte ein seltsames Verlangen, mich in meinen alten Toyota zu setzen und seine abgefahrenen Reifen zu testen, indem ich aus der Stadt raus und hinein in die Wüste fuhr. Ich weiß noch ganz genau, wie ich zu mir selbst sagte: »Was mache ich nur? Wohin fahre ich?« Dann hörte ich auf, mir solche Fragen zu stellen, denn mir wurde bewusst, dass ich, wenn ich mit einer etwas anderen Stimme sprechen und mir ein bestimmtes Ziel als Antwort geben würde, vielleicht unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung litt, und das wollte ich auf keinen Fall.
Mein Fahrtziel stellte sich nicht als eine Geisterstadt, sondern als eine Art Geisterkreuzung heraus, nicht aus den Tagen der Cowboys und Goldgräber des 19. Jahrhunderts, sondern aus den 1950ern. Ein Teil eines State Highways war von einer Fernstraße entbehrlich gemacht worden. Eine Texaco-Tankstelle mit Reparaturwerkstatt, ein Restaurant und eine große Wellblechhütte von unbestimmter Verwendung wurden dort von der erbarmungslosen Wüstensonne, dem Wind, den Insekten und der Zeit zugrunde gerichtet. Ich war schon einmal dort gewesen, sechs Monate zuvor, um mir einen Eindruck von dem Ort zu verschaffen, über den ich ein kleines, launiges Stück für das Arizona!-Magazin schreiben wollte.
Das große Schild auf dem Dach des Restaurants war von der jahrzehntelangen unerbittlichen Sonneneinstrahlung ganz verblasst und von Rednecks, die fanden, dass starke Drinks und Schusswaffen eine unterhaltsame Mischung ergaben, um einen Abend auf kaum befahrenen Nebenwegen zu verbringen, mit Löchern durchsiebt worden. Für gewöhnlich hatten diese Leute keine Frauen, die Einspruch erhoben, und keine Freundinnen, die ihnen reizvollere Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung boten. Meine Recherchen hatten ergeben, dass das Restaurant früher »Santinello’s Roadside Grill« hieß.
Ich parkte auf der rissigen, von der Sonne ausgebleichten Asphaltstraße, nahm eine Taschenlampe aus dem Handschuhfach, stieg aus meinem Wagen und näherte mich dem Santinello’s. Die Fenster waren schon vor langer Zeit herausgebrochen worden und die Vordertür hing an durchgerosteten Scharnieren.
Im Inneren stießen Lanzen aus Sonnenlicht durch die Fenster an der Ostseite und zwangen die Schatten, sich in den westlichen Teil des Gastraums zurückzuziehen, wo sie sich versammelten, als würden sie eine Verschwörung planen. Die Sitzecken, Tische und Stühle waren 1956 zusammen mit der Kücheneinrichtung verkauft worden. Der Wind hatte den Abfall und den Staub vieler Jahrzehnte ins Innere geblasen.
Keiner der Herpetologen, die ich befragte, hatte mir erklären können, warum ein paar Dutzend Schlangen, meist Klapperschlangen, zum Sterben hierhergekrochen waren. Bei meinem ersten Erkundungsbesuch hatte ich völlig die Fassung verloren, bis ich kapierte, dass sie luftgetrocknet, erstarrt und leblos waren.
Trotzdem schritt ich bei meinem erneuten Besuch mit aller Vorsicht an ihnen vorbei und ging in den Raum, der früher einmal die Küche gewesen war. Alles von Wert war schon längst weggeschafft worden, nur zerbrochene Holzkisten, in denen einst Orangen und anderes Obst und Gemüse gelagert worden waren, lagen gehäuft an einer Wand, zusammen mit allen möglichen leeren Konservendosen.
Bei meinem ersten Besuch hatte ich mich durch dieses Treibgut gewühlt und gehofft, dass etwas darin mir einen Aufhänger für einen rührenden Absatz über dieses Schiff namens Santinello’s liefern würde, das in den zerklüfteten Klippen des Fortschritts auf Grund gelaufen und dessen Besatzung ihrer lebenslangen Arbeit und des Traums von einer besseren Zukunft beraubt worden war. In den frühen Tagen meiner Autorenkarriere war ich überschwänglich wie ein Welpe und in meinem ehrlichen Bemühen, den Lesern eine emotionale Reaktion zu entlocken, zu solch einem ungewöhnlichen, wenn auch peinlichen Gemenge aus Metaphern imstande. Das ist lange her und ich bin nun viel reifer, da ich, während ich dies hier schreibe, ein Jahr damit verbracht habe, irgendwie am Leben zu bleiben und gleichzeitig die wahre Beschaffenheit der Welt nach und nach zu enthüllen und mich ihr anzupassen.
Jedenfalls reflektierte bei dieser ersten Erkundung etwas Grelles im Licht meiner Taschenlampe, als ich mich durch die Trümmer wühlte, und erregte meine Aufmerksamkeit. Als ich mich streckte, um einen Fetzen vergilbtes Papier von dem Gegenstand zu pflücken und ihn ganz zu enthüllen, krabbelte eine verwirrte Tarantel aus dem Abfall und huschte meinen Arm hinauf. Ich wusste, dass die Kreatur nicht giftig war, dass sie nicht beißen würde, dass ihrer Art nachgesagt wurde, sanftmütig zu sein, dass sie so etwas wie der Mohandas Gandhi der Arachniden war. Aber wenn eine haarige Spinne von der Größe eines Fußballs – zumindest schien es mir so – auf dein Gesicht zustürzt, dann meldet sich die Kampf-oder-Flucht-Reaktion mit voller Wucht. Ich taumelte zurück, schaffte es, das Ungetüm von meinem Arm zu stoßen, und verlor jegliches Interesse an dem Flitter, der zwischen dem Unrat gefunkelt hatte.
Nun war ich zurück, warum auch immer, und suchte mit meiner Taschenlampe nicht nach der Tarantel, bei der ich mich, so fand ich, für nichts entschuldigen musste, sondern nach dem Gegenstand, von dem die Spinne mich vertrieben hatte. Ich fand ihn: eine sehr alte Münze – aus purem Gold, ihrem Schimmer nach zu urteilen.
Während ich die schwere Münze zwischen meinen Fingern wendete, staunte ich, dass mein Unterbewusstsein sie am Tag der Tarantel als das erkannt haben musste, was sie war, und monatelang an diesem Wissen festgehalten hatte. Warum ich mich aber plötzlich veranlasst sah, nach all dieser Zeit an diesen Ort zurückzukehren, war für mich ein größeres Rätsel als die Frage, wie solch eine Münze in ein verlassenes Restaurant gelangt war, hier an dieser ehemals geschäftigen Kreuzung, die nun in allen vier Richtungen ins Nirgendwo führte.
Ich ließ die leblosen Schlangen in ihrem gespenstischen Frieden ruhen und fuhr zurück in die Stadt, wo ich einen Laden aufsuchte, der von antiken Möbeln aus Frankreich bis hin zu japanischen Bronzen aus der Meiji-Periode alles kaufte und verkaufte.
Der Besitzer, Julius Shimski, wusste alles, was es über alte Dinge zu wissen gab – Münzen, Briefmarken, Gemälde –, nicht zuletzt deshalb, weil er 98 war und sein Leben damit zugebracht hatte zu lernen. Julius hatte einen Mönchsring aus weißem Haar, Augenbrauen so üppig wie schneeweiße Raupen, blaue Augen so klar wie das Wasser im Garten Eden und ein Gesicht, das mit dem Alter nicht faltig geworden war, sondern sich geglättet hatte und nun dem Antlitz ähnelte, das er kurz vor seiner Brit Mila gehabt haben musste. In einem Profil über ihn im Arizona! hatte er seine rotwangige Erscheinung mit folgenden Worten erklärt: »Wenn man sich mit dem Wissen zu allen möglichen Themen vollstopft, macht es einen prall.« Ich habe das Profil nicht geschrieben, denn Julius war nicht tot, aber nachdem ich es gelesen hatte, ging ich hin und wieder in seinen Laden, um mit ihm zu plaudern.
Eigentlich ist der Laden mehr als nur ein Laden. Das zweigeschossige, mit Ziegeln verkleidete Stahlbetongebäude war so feuersicher konstruiert, dass nicht einmal der Teufel selbst es mit einem der zerstörerischen Funken aus seinen Fingern hätte anzünden können. Der Warenbestand ist mehrere Millionen wert und um überhaupt hereingelassen zu werden, braucht man einen Termin oder muss mit Julius bekannt sein. In jedem Fall gelangt man nur durch einen Vorraum aus kugelsicherem Glas hinein, und dort wird man nach Waffen abgetastet, bevor ein Summton die innere Tür öffnet. Als Julius gerade einmal 41 war und sein Geschäft in einem anderen Gebäude betrieb, wurde er unter Waffengewalt ausgeraubt und mit einer Pistole niedergeschlagen, woraufhin er diese Festung von einem Laden errichtete, denn, so sagte er es in seinem Profil: »Mit der Paranoia kann ich leben, aber nicht mit einer Kugel im Kopf.«
An jenem Freitag kümmerte sich Sharona, seine Enkelin, um den Verkaufsraum, was mich gleich doppelt glücklich machte, als ich sie aus dem gläsernen Vorraum erblickte. Mit ihrem samtschwarzen Haar und den dunklen Augen und der auserlesenen Anordnung ihrer Gesichtszüge ist sie eine dieser Frauen, die man nicht lange anschauen kann, ohne dabei die Fähigkeit zu verlieren, zusammenhängende Sätze hervorzubringen. Wenigstens geht es mir so. Sie ist 30, elf Jahre älter als ich, was heißt, dass ich aus ihrem Blickwinkel gesehen kaum die Pubertät hinter mir habe, während sie aus meinem Blickwinkel gesehen das Mädchen meiner Träume ist. Sie ist unter anderem eine Philatelistin, was nicht so sexy ist, wie es sich anhört. Sie weiß alles, was es über sammelwürdige Briefmarken zu wissen gibt. Genau wie ihr Großvater saugt sie Wissen wie ein Schwamm auf. Ich habe keinen Schimmer, warum sie nicht verheiratet ist. Auch wenn sie mir mit einer Zuneigung begegnete, wie sie eine Tante ihrem Lieblingsneffen entgegenbringen würde, träumte ich davon, eines Tages etwas zu tun – vielleicht eine Familie aus einem brennenden Haus retten oder einem verrückten Terroristen die Waffe abnehmen –, das sie veranlassen würde, mich mit ganz anderen Augen zu betrachten und mich als die romantische Gestalt ihrer Träume zu sehen.
Sie winkte und drückte dann auf den Türöffner. Ich lief an der Sammlung von Tiffany-Lampen und den mit Goldlack überzogenen japanischen Kisten vorbei, die aus der Taishō-Zeit bis in die Heisei-Ära datierten, und ging zu dem Verkaufstresen, wo sie stand. Eine Auslage mit unter Sammlern höchst begehrten Armbanduhren lag zwischen uns. Wäre ich für die bedrohliche Melodie empfänglicher gewesen, die das Schicksal für das, was noch kommen sollte, als Hintergrundmusik gewählt hatte, hätte ich diese Uhren vielleicht als ein Omen für meine ablaufende Zeit gesehen.
Stattdessen betrachtete ich Sharona mit einem Lächeln, das wahrscheinlich eher ein jungenhaftes Grinsen war, und verkündete: »Du siehst so Freitag aus«, womit ich eigentlich sagen wollte, dass sie heute hinreißend aussah.
Sie lächelte ihr Tante-an-Neffe-Lächeln. »Das hat noch nie jemand zu mir gesagt, Quinn. Wie sieht denn ein Freitag aus?«
»Na ja, genau wie du.« Eine nähere Erläuterung erschien mir unverzichtbar, und so fuhr ich fort: »Freitag ist der beste Tag von allen, findest du nicht auch? Die Arbeitswoche ist vorbei und der Montag liegt noch in ferner Zukunft, also sind wir eine Zeit lang ungebunden. Natürlich habe ich heute frei und du nicht, was vielleicht heißt, dass du die ganze Sache in einem anderen Licht siehst. Aber für mich, in diesem Augenblick, jedenfalls in dieser Woche, ist der Freitag großartig. Freitag ist wunderschön.«
Da. Ich hatte es tatsächlich ausgesprochen. Ich hatte ihr gesagt, dass sie wunderschön ist, auch wenn sie vielleicht einen Übersetzer brauchte, der ihr das, was ich meinte, verständlich darlegte.
Sie neigte ihren Kopf und sah mich an. »Du bist ja richtig aufgedreht, Quinn. Wie viel Kaffee hast du heute Morgen getrunken, mein Lieber? Mein Onkel Meyer war ein Acht-Tassen-am-Tag-Mann und bekam mit gerade mal 34 ein blutendes Magengeschwür. Drei Tage auf der Intensivstation.«
»Oh, kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Zwei-Tassen-Mann. Mehr brauche ich nicht, um mich aufzuladen. Eine gute jamaikanische Mischung.« Eigentlich trank ich nur selten Kaffee. Ich zog koffeinfreie Pepsi oder Coke vor, wollte aber nicht, dass sie mich für einen Jungen hielt, weil ich lieber Softdrinks anstatt einer guten Tasse Wachmacher trank. Ich schämte mich für meine Lüge, auch wenn es nur um so etwas Belangloses wie Kaffee ging. Um nicht noch tiefer in einem Sumpf aus falschen Darstellungen zu versinken, holte ich die Goldmünze aus meiner Hosentasche hervor. »Warum ich gekommen bin … Ich habe das hier gefunden. Ich denke, es könnte etwas wert sein.«
»Ich bin in erster Linie eine Philatelistin, auch wenn ich eine Menge über Tiffany, Jugendstil und Art déco weiß. Großvater ist der geniale Numismatiker.«
Der Klang von »Philatelistin« gefiel mir so gut, wenn sie es sagte, dass ich sie bitten wollte, es noch einmal auszusprechen, hielt mich aber zurück.
»Du weißt ja, wo Großvaters Büro ist. Ich funke ihn an und sage ihm Bescheid, dass du gleich bei ihm bist.«
Julius’ Büro lag hinten im Gebäude im Erdgeschoss. Ich lief durch einen Lagerraum voller Schätze und fand ihn hinter seinem Art-déco-Schreibtisch, der von Ruhlmann war. Das wusste ich, weil er mir einmal von seiner Geschichte erzählte, als ich ihn fragte, ob ich solch einen Tisch bei Ikea kaufen könne. Er betrachtete gerade eine Kakerlake mit einer Juwelierlupe.
»Was ist das?«
»Eine Brosche«, sagte er.
»Warum würde jemand eine Kakerlakenbrosche tragen wollen?«
Er blickte von der Lupe auf und zog seine buschigen Augenbrauen hoch. »Das ist keine Kakerlake. Das ist eine ganz andere Art von Käfer. Ein Skarabäus. Er ist aus Silber gemacht, das im Moment noch angelaufen ist, und mit einigen der feinsten Saphire, Rubine und Smaragde besetzt, die ich je das Vergnügen hatte zu sehen.«
»Kakerlake, Skarabäus – Käfer ist Käfer. Ich mag kein Ungeziefer.«
»Skarabäen waren den Pharaonen des alten Ägypten heilig.«
»Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihre Zivilisation untergegangen ist. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe.«
Er legte den mit Edelsteinen besetzten Skarabäus und die Lupe beiseite, um meine Münze zu betrachten. »Woher hast du sie?«
Ich erzählte ihm eine Version der Wahrheit, ohne zu lügen, erwähnte aber nicht die Tarantel, weil ich nicht wollte, dass er Sharona verriet, wie ich von einer einfachen Spinne verscheucht worden war. »Ist sie etwas wert?«
»Im Einzelhandel, von einem Sammler, würde sie 40.000 Dollar einbringen, vielleicht ein paar Tausend weniger.«
Ich war völlig baff. Ich hatte auf vielleicht einen Hunderter gehofft.
»Ach, du heiliger Bimbam!«, rief ich. So etwas sagten wir immer im Waisenhaus, um in der Gegenwart der Nonnen ungehobeltere Ausdrücke zu vermeiden. »Ich schätze, dann finde ich mal besser heraus, wem sie gehört.«
Julius runzelte die Stirn. »Wem sie gehört? Nach dem, was du mir berichtet hast, würde ich sagen, dass sie dir gehört. Es ist ja nicht so, dass einer der Besitzer des Restaurants noch am Leben wäre. Und wenn ich mich recht an den Artikel erinnere, den du für das Magazin geschrieben hast, wurde der ganze Grund und Boden dort vergesellschaftet und unterliegt nun der Gemeinfreiheit.«
»Dann gehört sie dem County. Oder Washington. Bestimmt gibt es einen Finderlohn.«
Ich hatte die ganze Zeit vor dem Schreibtisch gestanden. Nun deutete Julius auf einen Stuhl und sagte: »Setz dich. Du bist ja ganz benommen.«
Als ich ihm versicherte, dass es mir gut ging, sagte er mir noch einmal, dass ich mich setzen sollte, und zwar mit mehr Nachdruck, als ich es je von ihm gehört hatte.
»Was würde die Regierung wohl mit 40.000 Dollar anstellen?«, sagte er. »Einen Seifenspender für eine der Toiletten im Senat anschaffen? Die Schienen für einen Zug nach Nirgendwo um einen halben Meter verlängern? Hör zu, mein Junge, wenn du jemand anderes wärst, würde ich dir 26.000 bieten, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich die Münze innerhalb eines Monats einem Sammler für so ziemlich den Preis verkaufen kann, den ich dir genannt habe, also werde ich das Risiko auf mich nehmen und biete dir 30.000. So jung und so mittellos, wie du bist, ist dies ein Segen, für den du Gott danken solltest. Leb dein Leben einfach weiter.«
Vielleicht war ich unschuldiger, als es mir guttat, oder vielleicht wollte ich nicht, dass er mich für so jung hielt, also zu jung für Sharona, sollte sie sich urplötzlich in mich vergucken. Aus welchem absurden Grund auch immer sagte ich: »So jung bin ich gar nicht. Immerhin habe ich einen guten Job, meine eigene Wohnung. Ich habe gute Aussichten.«
»Junge, wenn du nicht jung bist, dann bin ich älter als tot.« Er lehnte sich auf seinem Stuhl vor und balancierte die Münze zwischen seinem Daumen und Zeigefinger. »Sag mir, dass du das Geld nimmst, oder ich werde sie werfen. Wenn ich sie werfe und Kopf gewinnt, spül ich sie das Klo hinunter, und wenn Zahl gewinnt, spül ich sie ebenfalls das Klo hinunter.«
»Sie machen Witze.«
»Wollen wir wetten?«
»Aber was ist das denn für eine Wahl?«
Er stand von seinem Stuhl auf. »Es ist die einzige, die ich dir anbiete. Ich werde mich nicht an deiner unverantwortlichen Verwirrung beteiligen. Und wenn du glaubst, dass ich zu alt bin, um dich davon abzuhalten, sie mir wegzunehmen, bevor ich sie das Klo hinunterspülen kann, ziehst du dir besser ein Suspensorium an und machst dich auf Schmerzen gefasst.«
Rückblickend betrachtet denke ich, dass mir die Vorstellung, plötzlich 30.000 Dollar zu besitzen, Angst machte. Ich war mit nichts in diese Welt gekommen und hatte 18 Jahre lang auf Kosten des Waisenhauses gelebt. Selbst mit meinem Job beim Arizona! hatte ich nie so viel Geld, um mir Sorgen machen zu müssen, dass ich es verlieren könnte. Ich wollte nicht als Narr dastehen, wenn ich 30.000 Dollar unbedacht ausgab, weil mich dann nicht nur Sharona als einen Loser abtun würde, sondern auch jede andere Frau mit Verstand.
Und so nahm ich die 30.000. Julius schrieb mir einen Scheck über 29.000 aus und gab mir 1000 in bar, damit ich die abgefahrenen Reifen an meinem verrosteten Toyota unverzüglich wechseln lassen und sogar noch ein bisschen feiern konnte. Ich ging geradewegs zur Bank und nahm eine Einzahlung vor.
Da Julius und ich dieselbe Bank hatten, riefen sie ihn zur Verifizierung an und schrieben mir das Geld gleich am nächsten Tag gut. Seitdem ist der Samstag mein liebster Tag der Woche.
Am nächsten Morgen, nachdem ich mich geduscht und eine Schüssel Cap’n Crunch gegessen hatte, packte mich wieder dieser seltsame Magnetismus, der mich schon zu der Geisterkreuzung gelockt hatte. Dieses Mal fühlte ich mich genötigt, zur Bank zurückzukehren und 4000 Dollar in Hundertern und Zwanzigern abzuheben. Ich gab nicht einen Cent davon aus. Ich nahm das Geld mit in meine Wohnung, verstaute es sicher in einem verschließbaren Plastikbeutel und schob den Beutel unter das Sitzkissen meines einzigen Sessels.
Ich erinnerte mich, einen Artikel gelesen zu haben, der von einer Zeit handelte, als Banken pleitegingen, und so nahm ich an, dass ich einfach nur Angst davor hatte, meinen plötzlichen Wohlstand wieder zu verlieren.
Am Montag ging ich während meiner Mittagspause noch einmal zur Bank und hob weitere 2000 ab, die ich auch in den Beutel steckte. Nachdem ich noch mal 3000 am Dienstag und 3000 am Mittwoch abgehoben hatte, machte ich mir langsam selbst Angst. Nein, ich fürchtete nicht, die Kontrolle zu verlieren. Vielmehr spürte ich, dass ich mich auf etwas vorbereitete, das schlimmer war als der Zusammenbruch von Banken, dass ich irgendwie wusste, dass Ärger im Anmarsch war, so wie ich gewusst hatte, wo ich die wertvolle Münze finden würde.
Am Donnerstag erschreckte ich mich selbst noch mehr, weil es mir nicht gelang, das Verlangen zu unterdrücken, einen kleinen Koffer zu kaufen und ihn mit zweimal Klamotten zum Wechseln und Toilettenartikeln zu packen. Ich legte den Koffer in den Kofferraum meines Wagens und stellte das Fahrzeug auf einem Langzeitparkplatz in einem Parkhaus in der Innenstadt ab. Ich bezahlte bar für eine Woche im Voraus.
Außerdem holte ich noch einmal 4000 von der Bank, wo sie bestimmt glaubten, dass ich entweder eine ernsthafte Spielsucht entwickelt hatte oder unter den Einfluss einer Frau geraten war, die sich nur mein Geld unter den Nagel reißen wollte.
Als ich am Freitagmorgen zur Arbeit erschien, waren zwei Plastikbeutel mit je 8000 Dollar darin mit Klebeband an meiner nackten Brust befestigt. Ich trug ein weites Hemd, damit es nicht so aussah, als würden mir plötzlich Brüste wachsen.
Zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, noch Herr meiner Sinne zu sein. Eine Woche war vergangen, seit ich an all dieses Geld gelangt war und mich darauf vorbereitete, auf die Flucht zu gehen. Dass mich meine Intuition dazu nötigte, solche Vorbereitungen zu treffen, bedeutete nicht, dass ich mich auf sie verlassen konnte. Eigentlich waren die meisten Menschen, die sich gezwungen sahen, ungewöhnliche Dinge zu tun, so plemplem wie ein Eichhörnchen auf Methamphetamin. Ich fragte mich, ob meine Angst vielleicht irrational war und ihren Ursprung in dem Schuldgefühl hatte, das ich wegen des Verkaufs einer Münze verspürte, die nicht mir gehörte. Da mich Nonnen großgezogen hatten, waren mir 18 Jahre lang alle Du-sollst-nicht-Gebote auf die gütigste, aber auch auf die nachdrücklichste Weise eingebläut worden. Es war nur allzu einleuchtend, dass ein Übermaß an moralischen Appellen mich in solch einem Maße sensibilisiert hatte, dass ich mich schuldig fühlte, weil ich eine auf der Straße gefundene Münze für mich behielt. Sicher war dieses drohende Unheil nichts weiter als eine Einbildung, eine Flipperkugel der Angst, die in meinem verwirrten Kopf umherschoss. Wenigstens war das eine Theorie, die ich in Betracht zog, bis diese Rüpel während meiner Mittagspause aufkreuzten.
2
Zwei Frittierköche, die eines Tages vielleicht so berühmt wie Andy Warhol sein werden, retteten mich vor einem Paar gut gekleideter Männer mit bösen Absichten.
Fünf Tage die Woche aß ich mein Mittagessen in einem Lokal gleich auf der anderen Straßenseite von den Redaktionsräumen des Magazins, weil ich ein Gewohnheitstier bin und der Laden sauber und das Essen gut und billig war. Das Lokal gehörte der Beane-Familie. Hazel Beane war eine 50-jährige Geschiedene, deren Ehemann, ein Anwalt, mit einer Klientin durchgebrannt war, für die er ein zehn Millionen Dollar schweres Urteil wegen des Todes ihres Ehemanns, Darnell Ickens, herausgeholt hatte. Die Geschworenen waren der einhelligen Meinung gewesen, dass ein Polizeibeamter mit einer übermäßigen Anwendung von Gewalt reagiert hatte, als er Darnell mit sechs Kugeln erschoss, nachdem der ihn mit einem Druckluftnagler angegriffen und viermal aufgespießt hatte. Hazel billigte noch immer Anwälte unter ihren Gästen, begrüßte sie aber nie mit einem Lächeln. Ihre Kinder – Phil und Jill, 26 Jahre alte zweieiige Zwillinge – waren ausgezeichnete Frittierköche und bedienten den Grill und die Pfannen mit Stil, auch wenn diese Arbeit nicht ihre Bestimmung war. Sie wurden geboren, um Künstler zu sein. Phil färbte seine Stachelfrisur lila und rasierte sich die Augenbrauen, während Jill ihre Stachelfrisur grün färbte und zu jeder Zeit einen schwarzen Pyjama und rote Schuhe trug. Noch war es ihnen nicht gelungen, viele ihrer Gemälde zu verkaufen, weil der Kunstbetrieb, so erklärten sie mir, die Marktfähigkeit des Künstlers und seines Images genauso sehr bewertete wie seine Werke, wenn nicht mehr, und so hing ihr großer Durchbruch davon ab, den passenden Look zu finden. In letzter Zeit dachten Phil und Jill ernsthaft darüber nach, sich die Köpfe kahl zu rasieren und sich von oben bis unten blau einfärben zu lassen. Jedenfalls ging ich für gewöhnlich immer bei Ende des Mittagsansturms über die Straße zum Beane’s Diner, damit ich am Tresen sitzen konnte, ohne dass mir ein anderer Gast eine Unterhaltung aufzwang und ich über so etwas Absurdes wie Politik oder so etwas Böses wie, nun ja, Politik plaudern musste. Ich war vielmehr daran interessiert, etwas über Kunst und die Kunstwelt zu erfahren, und davon wussten Phil und Jill viele packende Geschichten zu erzählen. An jenem Freitag waren die Sitzecken des Diners noch immer voll von diesen Angestellten der oberen Ebenen, die in ihrer Mittagspause herumtrödeln konnten, ohne von ihren Bossen eins mit dem Lineal über die Finger gezogen zu bekommen, doch die meisten der Hocker am Tresen waren unbesetzt.
Nachdem Jill eine faszinierende Anekdote über die bizarren surrealen Motive erzählt hatte, die unterschwellig in die Gemälde von Andrew Wyeth eingearbeitet waren, servierte Phil mir einen Hamburger mit drei Scheiben Käse, Salat, Tomaten und Mayonnaise. Die Pommes frites waren besonders knusprig, so wie ich sie am liebsten mochte. Ich spülte gerade meinen zweiten Bissen vom Hamburger mit einer Cherry Coke hinunter, als zwei Männer auf den Hockern neben meinem auftauchten, als wären sie von einem Zauberer heraufbeschworen worden. Ich hatte sofort ein schlechtes Gefühl bei den beiden, und obwohl ich noch einen dritten Bissen von meinem Burger nahm, hatte ich einige Mühe, ihn hinunterzuschlucken.
Die Neuankömmlinge waren mit schwarzen Anzügen, weißen Hemden und schwarzen Krawatten bekleidet. Sie trugen Sonnenbrillen, die sie in einer höchst eindrucksvoll synchronen Darbietung absetzten, zusammenklappten und in ihren Hemdtaschen verstauten.
Ich blickte nach links und der Typ dort lächelte mich an. Er war so gut aussehend wie ein Männermodel und hatte braune Augen, die fast goldfarben wie bei einer Katze waren. Da war etwas an seinem Lächeln, das sagte, dass es ihm zu leichtfiel und dass er die ganze Nacht lächelte, während er schlief, und dass es nicht bedeutete, dass er einen mochte oder dass er bei guter Laune war oder dass er überhaupt wusste, was ein Lächeln eigentlich ausdrücken sollte.
Der Typ rechts von mir war ein Schrank mit einem harten, flachen Gesicht und sah aus, als wäre er mehr als einmal mit Höchstgeschwindigkeit gegen eine Wand gerannt, nur so zum Spaß. Auch er lächelte, doch in seinem Fall verlangte solch ein Ausdruck volle Konzentration.
Der Mann mit den goldenen Augen sagte: »Ganz schön heiß heute.«
Ich sagte: »Nun, es ist Mai in Phoenix.«
»Du hast schon dein ganzes Leben in Phoenix verbracht, stimmt’s?«
»Größtenteils, ja.«
Der harte Kerl zu meiner Rechten sagte: »Gefällt’s dir in Phoenix besser als dort, wo du hergekommen bist?«
»Klar, mir gefällt’s hier recht gut. Ich erinnere mich kaum noch, wo ich hergekommen bin.«
Rightie blickte an mir vorbei zu Leftie und sagte: »Dieser junge Mann leidet an Gedächtnisschwund.«
Leftie legte sein ungezwungenes Lächeln ab und setzte stattdessen einen Ausdruck falschen Bedauerns auf. »Tut mir leid, das zu hören. Muss hart sein, so ganz ohne Erinnerungen.«
»Ich leide nicht an Gedächtnisschwund«, versicherte ich ihnen. »Ich komme aus Peptoe, Arizona, aber dort habe ich nur ein paar Tage nach meiner Geburt verbracht.«
Ich blickte zwischen den Männern hin und her, während sie gleichzeitig feierlich nickten.
Hazel Beane erschien, klatschte Speisekarten auf den Tresen und sagte: »Darf es was zu trinken sein für die Herren?«
»Warum geben Sie uns nicht noch eine Minute?«, sagte der Gutaussehende.
Sie beäugte ihn, dann seinen Partner, und sagte: »Sind Sie vielleicht Anwälte?«
»Nein, aber wir haben ein paar verhaftet.«
Das hätte Hazel erfreuen sollen, tat es aber nicht. Sie sagte zu mir: »Schätzchen, ist alles in Ordnung?«
Ich nahm einen tiefen Zug von der Diner-Luft, die nach Röstzwiebeln und dem brutzelnden Rindfleisch auf dem Grill duftete.
»Das weiß ich noch nicht.«
»Das hier ist ein guter Junge«, sagte Hazel zu meinen Sitznachbarn.
»Wenn Sie das sagen«, sagte Leftie.
Rightie fügte hinzu: »Wir haben nur sein Bestes im Sinn.«
Eine Kellnerin, Pinkie Krankauer, beugte sich an Rightie vorbei, um Phil zu sagen, dass sie zwei Bier vom Fass für Tisch vier brauchte. Nachdem er mir einen besorgten Blick zugeworfen hatte, machte sich Phil daran, das Bier zu zapfen, und überließ seiner Schwester die Arbeit am Grill.
Als Hazel sich widerwillig zurückgezogen hatte, sagte der Mann mit den goldenen Augen: »Dann erinnerst du dich nicht mehr, was in Peptoe passiert ist?«
»Ich wurde hierher in ein katholisches Waisenhaus gebracht, als ich drei Tage alt war. Und in einer Stadt mit 906 Einwohnern passiert ohnehin kaum etwas.«
»Seit damals gab es einen regelrechten Wachstumsschub«, sagte Leftie. »Jetzt sind’s 912.«
»Obwohl es jetzt eine Metropole ist«, sagte Rightie, »wäre ein kleines Baby, das mitten auf dem Highway ausgesetzt wird, auch im neuen und verbesserten Peptoe eine große Sache.«
»Tja, ich schätze, das ist wohl so. Hören Sie, von welcher Behörde sind Sie überhaupt? Ich habe ein Recht zu wissen, mit wem ich es zu tun habe.«
Der gut aussehende Typ zu meiner Linken holte eine Ausweismappe hervor. Er gehörte zur Internal Security Agency. Davon hatte ich schon einmal gehört, wusste aber nicht, wie sie sich von FBI, NSA, DSA, ATF, von der Homeland Security oder jeder anderen staatlichen Vollzugsbehörde unterschied. In diesen Tagen war Amerika auf der Bundesebene viel stärker überwacht als noch vor einem Jahrzehnt.
Leftie steckte seine Ausweismappe wieder ein und sprach leise, als würde jeder im Diner versuchen, ihn zu belauschen, was vielleicht sogar stimmte. »Hör zu, wir hätten in deiner Wohnung auf dich warten können, aber wir wussten ja nicht, welche Überraschungen du in der Hinterhand hast.«
»Überraschungen?«, sagte ich verdutzt.
Rightie flüsterte: »Versuch bloß keine Tricks …«
»Tricks?«, sagte ich.
»Mach’s einzigartig, mit all diesen Zeugen, und es wird eine große Geschichte draus. Wir glauben nicht, dass du eine große Geschichte haben willst.«
»Einzigartig?«, sagte ich. Wie es schien, war ich zu mehr als Ein-Wort-Antworten nicht imstande.
Eine halbe Minute lang sagte keiner von ihnen etwas. Sie starrten mich einfach nur an, und zwar auf eine Art und Weise, von der ich zuerst glaubte, dass sie einschüchternd wirken sollte. Aber als ich meinen Kopf von einer Seite zur anderen wandte, begriff ich, dass die knallharte Masche, die sie an den Tag legten, nicht nur ein Ausdruck ihres Agentendaseins war, sondern auch dazu diente, ihre Angst zu kaschieren. Sie fürchteten sich vor mir.
In meinen 19 Jahren hatte sich noch kein Mensch auf dieser Welt vor mir gefürchtet, nicht ein einziges Mal. Ich war von wütenden Verlierern beim Buchstabierwettbewerb vermöbelt worden, um Himmels willen!
Das Raubein mit dem eingedrückten Gesicht schluckte schwer, als wäre ihm einen Augenblick lang etwas in der Kehle stecken geblieben. Er sprach leise: »Der erste Typ wie du, den wir kennenlernten, dieser Kerl namens Ollie … Wir haben versucht, uns an einem netten, privaten Plätzchen mit ihm zu unterhalten.«
Der Mann zu meiner Linken, der eine Hand unter sein Jackett geschoben hatte, murmelte: »In der Sitzecke hinter uns sind zwei von unseren Leuten. Sie haben ihre Waffen gezogen und halten sie unter dem Tisch bereit.«
Rightie sagte: »Wir hatten Ollie in aller Ruhe unsere Absichten erklärt und ihm dargelegt, warum es in seinem eigenen Interesse wäre, mit uns zu kooperieren …«
»… aber von da an ging alles den Bach runter«, sagte Leftie.
Rightie sagte: »Er hat einigen von unseren Leuten ein paar echt gemeine Dinge angetan.«
Ihr wechselseitiges Geplapper schien einstudiert zu sein wie ein Sketch von Abbott und Costello, war aber nicht so lustig.
»Ich bin nicht gemein«, sagte ich kraftlos.
»Was wir von dir wollen«, sagte der ungehobelte Mann, »ist, dass du dir von uns hinter deinem Rücken Handschellen anlegen und dich hinaus zu unserem Van führen lässt. Wir müssen uns nur unterhalten, müssen es verstehen. Wir wollen dir nicht wehtun.«
»Aber das werden wir«, sagte Leftie, »wenn du einzigartig mit uns wirst. Also versuch keine Tricks.«
Rightie grunzte zustimmend. Er sprach so gedämpft, dass ich kaum das voce in seinem sotto voce hören konnte. »Wir schießen dir in den Kopf. Wir alle vier. Das hat schon einmal gut funktioniert.«
Das GQ-Model mit den goldenen Augen zischte: »Jaja, sehr gut sogar.«
Wie Sie sich vorstellen können, war ich mittlerweile so verängstigt, dass ich mich um die Haltekraft meiner Blase sorgte. »Hören Sie, meine Herren, Sie machen einen großen Fehler. Für wen Sie mich auch immer halten mögen, ich bin es nicht.«
Niemand, der unserem kleinen Drama am Essenstresen zusah, hätte mit Bestimmtheit sagen können, wer diese Männer waren. Vielleicht glaubten die Leute auch, dass sie Schergen der Mafia waren, der ich Geld schuldete. Später erfuhr ich, dass die ISA weithin verhasst ist, also wäre es wohl egal gewesen, wenn irgendwer gehört hätte, wie Leftie die Identität seiner Behörde bekannt gab.
Meine Aufmerksamkeit war so sehr auf Tweedledum und Tweedledee fokussiert, dass der ganze Diner in einem Nebel zu verschwinden schien. Ich schätze, sie waren genauso auf mich fokussiert, sodass sie gar nicht bemerkten, dass die Belegschaft des Lokals genug mitbekommen hatte, um beunruhigt zu sein. Hazel Beanes Leute waren die Art von Gastronomie-Patrioten, die für einen Freund einstanden, und hatten wortlos einen Eingriff um meinetwillen verabredet.
Nachdem sie einen Korb mit knusprigen Kartoffelsnacks aus der Fritteuse gehoben hatte, drehte sich Jill herum und pfefferte den heißen Inhalt des Korbs in das Gesicht von Rightie.
Als er zwei Halbliterbier gezapft hatte, vorgeblich um sie für die Kellnerin, die sie angefordert hatte, auf dem Tresen abzustellen, schleuderte Phil stattdessen den Inhalt des einen und dann des anderen Krugs in die goldenen Augen des Mannes zu meiner Linken, gerade als der Mann zu meiner Rechten eine Ladung Fritten, die er nicht bestellt hatte, serviert bekam. Hinter mir hörte ich Pinkie Krankauer sagen: »Denkt nicht mal dran«, bevor sie ein Tablett voll schmutzigem Geschirr in die Schöße der beiden Agenten in der Sitzecke kippte.
Wenn wir eine Woche zuvor eine Runde »Was würdest du tun?« gespielt und Sie mir das Szenario im Beane’s Diner beschrieben hätten, dann hätte ich gesagt, dass ich vermutlich auf meinem Hocker herumgewirbelt wäre, nur um auf dem Weg zum Ausgang auszurutschen und zu stürzen und von aufgebrachten ISA-Agenten geschnappt zu werden. Stattdessen überraschte ich mich selbst, indem ich mein Mittagessen beiseitefegte, über den Tresen hüpfte und mir die Deckung, die er bot, zunutze machte. Während ich den Kopf gesenkt hielt und an Jill vorbei in Richtung Küche huschte, schob sie einen Pfannenwender unter eine halb fertige Rindfleischfrikadelle, hob diese vom Grill und feuerte sie in das Gesicht des Typen, der sich noch immer Fritten aus den Augen wischte.
In der Küche waren Kühlschränke und Öfen und Arbeitstische sowie Pepe Chavez und Tau Hua. Er sagte »Quinn, alter Freund« und sie sagte »Was geht ab?«. Ich sagte »Hab’s eilig« und sprintete an ihnen vorbei. An der Hintertür schnappte ich mir einen Feuerlöscher aus seiner Wandhalterung, riss die Tür auf und erwartete Maschinengewehrfeuer.
Der Typ in der Gasse trug Jeans und ein Hawaiihemd, war aber groß und hellwach. Er sagte: »Hallo, Jungchen.«
Kein normaler Mensch nennt einen Fremden »Jungchen«, und so nahm ich an, dass er zur ISA gehörte, und schäumte ihn erbarmungslos mit dem Feuerlöscher ein. Während er wie Frosty der Schneemann in der heißen Phoenix-Sonne herumtorkelte, rannte ich westwärts, den Feuerlöscher unter dem Arm für den Fall, dass ich noch einem weiteren überhitzten Staatsbeamten begegnete.
3
Auf der nördlichen Seite der Gasse, hinter dem Dirty Harry Clean Now, wurde gerade der Kleintransporter der chemischen Reinigung mit frisch gewaschenen Klamotten beladen, die zurück zu den Kunden nach Hause gebracht werden mussten. Der Fahrer – Juan Santos, der oft im Beane’s Diner zu Mittag aß – schlug die Hintertüren des Transporters zu und sah mich kommen. Mit der Scharfsinnigkeit eines erstklassigen Lieferboten erkannte er sofort, dass ich auf der Flucht vor einer Bedrohung war, und winkte mich zur Beifahrerseite des Fahrzeugs hinüber. »Steig ein, wir hauen ab.«
»Er ist ein Gesetzeshüter. Du wirst Probleme bekommen.«
»Ich esse Probleme zum Frühstück«, sagte Juan. »Außerdem wird er uns nicht sehen.«
Ich warf einen Blick zurück und sah, dass das Jungchen in dem Hawaiihemd in die andere Richtung taumelte, weg von mir, orientierungslos und vorübergehend blind. Feuerunterdrückender Schaum fiel in Klumpen von ihm herab, als wäre er ein tollwütiger Höllenhund.
Keiner der anderen ISA-Agenten hatte es bisher aus dem Diner geschafft, wo sie wahrscheinlich noch immer unter einem Dauerbeschuss aus Nahrungsmitteln standen.
Widerwillig ließ ich den Feuerlöscher fallen. Wehrlos kletterte ich auf den Beifahrersitz, zog die Tür zu und rutschte nach unten, als Juan den Motor anschmiss. In der Luft hing die knackige Frische von dem schwachen, aber nachhaltigen Duft der Reinigungsmittel, die benutzt wurden, um die Klamotten auf den Kleiderständern hinten im Wagen zu bearbeiten, und ich nieste so kräftig, dass der Knorpel zwischen meinen Nasenlöchern ein paar Sekunden lang vibrierte.
»Gesundheit«, sagte Juan.
»Danke.«
»De nada.«
Am westlichen Ende der Gasse warf Juan einen Blick in den Seitenspiegel, um die Lage hinter uns zu betrachten. »Der Schaumtyp ist gerade in einen Pulk aus Mülleimern gestürzt.« Er bog nach rechts auf die Straße. »Du kannst dich jetzt aufsetzen.«
»Das glaube ich nicht. Die ISA ist hinter mir her. Sie haben ihre Augen überall.«
»Die Geheimpolizei?«
»Halb geheim«, sagte ich. »Jeder weiß, dass es sie gibt, aber keiner weiß, was sie machen.«
»Warum sind sie hinter dir her, Quinn?«
»Ich habe keinen Schimmer. Sie sagten, ich sei einzigartig.«
Juan schnaubte verächtlich. Ich kenne sonst niemanden, der auf solch unterschiedliche und jedes Mal ganz leicht zu deutende Arten schnauben konnte. »Jeder ist einzigartig, Amigo. Wenn das ein Verbrechen ist, müssen sie uns alle verhaften.«
»Vielleicht werden sie das irgendwann. Aber im Augenblick sind sie hinter mir her.«
»Willst du, dass ich dich über die Grenze schaffe?«
»Nach Mexiko? Nein, nein, nein. Du musst die Wäsche ausliefern.«
»Dann verspäte ich mich eben um einen Tag. Mr. Dai wird’s schon verstehen. Er ist ein netter Mann.«
Gi Minh Dai war in den 70ern als Teenager aus Vietnam geflohen und hatte, als er gerade einmal 20 war, eine Wäscherei aufgemacht, die sich als sehr erfolgreich erweisen sollte.
»Ich kenne gute Menschen in Mexiko. Sie werden dich gern aufnehmen.«
»Das ist lieb von dir, Juan, aber ich wäre dir schon auf ewig dankbar, wenn du mich nur zu dem Parkhaus fährst, in dem mein Wagen steht.«
Ich gab ihm die Adresse und er sagte: »Dein schrottreifer Toyota schafft’s vielleicht nicht mal bis nach Scottsdale.«
»Ich habe neue Reifen gekauft und diesen fantastischen Lufterfrischer, den ich an den Rückspiegel gehängt habe.«
»Ich hasse diesen Kiefernduft. Erinnert mich immer an Klosteine.«
»Er hat die Form einer Kiefer«, sagte ich, »riecht aber nach Orangen.«
»Warum haben sie ihm dann nicht die Form einer Orange gegeben?« Mit einem Schnauben brachte er seinen Frust über die Auslagerung der amerikanischen Industrieproduktion zum Ausdruck und beantwortete seine Frage selbst: »Made in China, das ist der Grund. Tja, eine gute Sache hat dein schrottreifer Toyota ja: Er ist so alt, dass er kein GPS hat. Sie können dich nicht per Satellit verfolgen.« Er bremste an einer Kreuzung, bis der Transporter zum Stehen kam, und blickte zu mir herunter, wie ich unterhalb des Fensters kauerte. Seine Miene war gütig und, so schien es mir, eher von Anteilnahme als von Mitleid erfüllt. »Wie sieht dein Plan aus, Quinn?«
»Plan? Nun, eigentlich nur, so lange in Freiheit zu bleiben, bis ich herausgefunden habe, warum sie hinter mir her sind. Es muss sich um ein Versehen handeln, einen Fehler. Ich muss das nur wieder in Ordnung bringen.«
»Ich sagte, dass ich Probleme zum Frühstück esse, und das stimmt. Maria, meine Schwester, sie ist aus dem Gefängnis entlassen worden und wohnt nun bei mir, bis sie wieder auf eigenen Füßen steht. Sie ist eine tolle Frau, kann aber überhaupt nicht kochen. Sie besteht darauf, mich nicht ohne ein herzhaftes Frühstück zur Arbeit gehen zu lassen, und jetzt hab ich den ganzen Tag lang Magenprobleme.« Er hielt inne. Als er so auf mich herunterblickte, erkannte ich den Augenblick, in dem seine Anteilnahme in Mitleid umschlug, ganz genau. »Maria hatte, bevor sie tat, was sie tat, auch keinen Plan.« Die Ampel sprang um und wir fuhren über die Kreuzung.
Ich sagte: »Was hat sie angestellt?«
»Um ins Gefängnis zu kommen? Sie hat sich über eine Kongressabgeordnete lustig gemacht und ein paar spöttische Memes ins Internet gestellt. Sie behaupteten, die Memes seien Drohungen gewesen.«
»Waren es Drohungen?«
»Ja – wenn du findest, dass es eine Drohung ist, jemanden als ein betrunkenes Streifenhörnchen darzustellen. Maria hat’s getan, aber sie hatte für das, was danach kam, keinen Plan. Ist zu einem Jahr verurteilt worden, hat neun Monate abgesessen.«
»Wer glaubt auch schon, dass man für so was einen Plan braucht?«
»Die Dinge haben sich verändert, Quinn. Bevor ich auch nur irgendwas sage oder mache, habe ich einen Plan, manchmal zwei oder drei.«
»Woher sollte ich bitte schön wissen, dass die ISA mich für einzigartig hält? Wer macht denn einen Plan für den Fall, dass er der Einzigartigkeit beschuldigt wird?«
»Ich sag ja nur, dass du besser einen Plan hast. Du kannst nicht ewig davonrennen.«
Gute zwei Minuten lang sprach keiner von uns. Sein Schweigen war ein mitleidiges Schweigen und meins war ein ängstliches und verwirrtes Schweigen. Meine Unfähigkeit, mir vorzustellen, wie ich einen Plan überhaupt anfangen sollte, machte mir so sehr zu schaffen, dass ich den Druck von mir nehmen wollte, indem ich das Thema wechselte. Ich schob mich in meinem Sitz hoch und sagte: »Ich habe mich schon immer gefragt, warum es Dirty Harry Clean Now heißt.«
Juan schnaubte eine amüsierte Zuneigung für seinen Arbeitgeber. »Die ersten beiden Jahre, die Gi Minh Dai in den Staaten verbrachte, hatte er drei Jobs und lebte günstig, um Geld für eine Wäscherei zu sparen. Als er sich einmal die Zeit nahm, ins Kino zu gehen, sah er diesen Eastwood-Film. Er liebte ihn. Hat ihn sich achtmal angesehen. Harry trug in dem Film ein paar coole Anzüge, und trotz all der Action sahen sie immer sauber und frisch gebügelt aus. Gi fragte sich, wo Harry sie reinigen ließ, und er glaubte, dass alle anderen sich dasselbe fragten. Zuerst wollte er den Laden Gi Minh Dai Nass- und Trockenreinigung nennen, aber dann entschied er sich für den anderen Namen, damit die Millionen von Menschen, die sich fragten, wo Harry seine Anzüge reinigen ließ, ins Dirty Harry Clean Now kamen. Sein Englisch war damals noch nicht so gut wie heute, also glaubte er, dass jedem klar sein würde, was der Name bedeuten sollte. Das Lustige daran ist, dass es funktioniert hat. Er besitzt jetzt drei Läden und verkauft mehr Nass- und Trockenreinigungen als sonst wer in Arizona. Weiß du, warum es funktioniert hat?«
Ich sagte: »Gi Minh Dai hatte einen Plan.«
»Ganz genau.« Juan hielt am Straßenrand vor dem sechsgeschossigen Parkhaus, in dem ich meinen Wagen abgestellt hatte. »Fass einen Plan, Amigo.«
»Das werde ich«, versprach ich. »Irgendwie, auf die eine oder andere Weise, werde ich einen Plan fassen. Danke fürs Mitnehmen. Ich begreife jetzt erst, dass es ein großes Risiko war, einem Flüchtigen Beihilfe zu leisten.«
Juan lächelte. Er hatte ein warmes Lächeln. Wenn es noch wärmer gewesen wäre, hätte er damit Brot toasten können. »De nada. Und außerdem hatte ich einen Plan. Wenn die Typen von der ISA uns angehalten hätten, dann hätte ich die Pistole unter meinem Sitz hervorgeholt, dich erschossen und behauptet, dass du mich entführt hast und ich dir deine Waffe abnehmen konnte.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und so sagte ich: »Oh.«
Juans Lächeln weitete sich zu einem breiten Grinsen. Sein Grinsen war so breit, dass ich dabei an einen Halloween-Kürbis denken musste. »Ich mache Witze, Quinn. Ich mag dich viel zu sehr, um dich zu erschießen. Aber ich wünschte, du wärst nicht so daneben.«
Entsetzt sagte ich: »›Daneben‹ ist ganz schön hart.«
»Eigentlich nicht. Ich mag dich viel zu sehr, um dir Honig um den Mund zu schmieren. Reiß dich am Riemen, Amigo. Aber bewahre dir deinen Sinn für Humor, oder du verlierst noch den Verstand, wie es gerade so viele tun.«
Ich öffnete die Tür und sagte: »Das mache ich. Ich werde mich am Riemen reißen.«
»Noch etwas. Hast du ein Smartphone?«
Ich fischte es aus meiner Jackentasche. »Apple. Willst du, dass wir in Kontakt bleiben?«
»Eigentlich nicht. Ich will, dass du kräftig auf das Handy trittst und es in den nächsten Gully wirfst. Es hat GPS. Sie können dich aufspüren, solange du es mit dir herumträgst.«
»Aber ich habe all diese Apps. Ich habe Wetter und Karten und Podcasts.«
»Wenn du überleben willst, musst du von jetzt an ein Schlitzohr sein, Quinn.« Er streckte mir sein Handy entgegen. »Es ist ein Einweghandy mit Prepaid-Karte. Nichts Besonderes. Ich habe beim Freischalten nicht meinen Namen verwendet.«
»Ich kann dein Handy nicht annehmen«, sagte ich.
Er warf es mir zu und ich fing es auf. »Und noch eine Sache, Amigo. Hast du schon mal von 360-Grad-Nummernschild-Scannern gehört?«
»Soll ich mir einen besorgen?«
Er schnaubte auf eine andächtige Weise und rollte die Augen. »Jesus, Maria und Joseph, behütet diesen Jungen. Quinn, jeder Streifenwagen und viele andere Fahrzeuge der Regierung sind mit Scannern ausgestattet, die sämtliche Kennzeichen um sie herum erkennen und in Echtzeit an das 100.000 Quadratmeter große Datencenter der National Security Agency in Utah übermitteln. Du wirst bestimmt ein halbes Dutzend Mal gescannt, bevor du überhaupt aus der Stadt raus bist. Wenn sie wirklich so scharf auf dich sind, wie du es sagst, dann werden sie jedes Mal, wenn du gescannt wirst, verständigt und stöbern dich eher früher als später auf.«
»Woher weißt du das alles?«
»Wie könnte ich das nicht wissen? Das ist eine Sache, die jeder in diesem neuen Amerika wissen sollte.«
»Heißt das, ich soll mein Kennzeichen abmontieren?«
»Das wäre ein Anfang.«
Der Verkehr huschte an uns vorüber und die Sonne blitzte in den Windschutzscheiben der Autos auf. Ich stieg aus dem Transporter und sah zu ihm hinüber. »Was, wenn mich ein Cop anhält, weil ich kein Kennzeichen habe?«
»Dann bist du erledigt wie ’n verbrannter Burrito. Ganz sicher, dass du keinen Abstecher nach Mexiko unternehmen willst?«
»Ja, ich muss hierbleiben und meinen Namen reinwaschen. Das ist alles ein schreckliches Missverständnis.«
Nach einem gereizten Schnauben sagte Juan: »Vaya con Dios.«
»Ja, du auch«, sagte ich und schloss die Tür.
Als er davonfuhr, stand ich in der sengenden Sonne und fühlte mich klein und allein. Mein Schatten schien sich zu strecken, um zu verschwinden, als wollte er nicht mit dem Rest von mir in einem Sarg enden.
Ein Ford F-150 Crew Cab fuhr in meine Richtung. Auf seiner offenen Ladefläche wölbten sich Grünabfälle unter Plastikplanen wie bauchige Pilzköpfe. Anstatt wie ein wütendes Rumpelstilzchen auf meinem Smartphone herumzuhüpfen und auf mich aufmerksam zu machen, warf ich es zwischen die Planen, damit die ISA ihm eine Weile lang durch Phoenix hinterherjagen konnte.
4
Das weitläufige Parkhaus verfügte über einen Fahrstuhl und ein Treppenhaus, doch beide fühlten sich wie Fallen an. Die Auffahrten, von denen es auf jeder Ebene zwei gab, waren zweispurig. Ich lief sie bis zur sechsten Etage hinauf.
Damals fühlte ich mich in solch riesigen öffentlichen Parkgebäuden nicht sicher. Es waren nicht zu schnell fahrende Fahrzeugführer, die mir Sorge machten, auch wenn einige von ihnen zu glauben schienen, auf einer Modellrennbahn unterwegs zu sein. Die massigen Stützpfeiler hielten die Decken davon ab, auf mich niederzustürzen, also zerbrach ich mir auch nicht den Kopf darüber, unter einem Trümmerberg erdrückt zu werden. Straßenräuber gingen nur selten ihrer Tätigkeit in diesen Gebäuden nach, weil es nicht genügend Ausgänge für einen schnellen Abgang gab. Trotzdem kamen mir Parkhäuser immer unheimlich vor, besonders wenn ich mich auf den nicht so umtriebigen oberen Etagen aufhielt. Vielleicht erzeugten die Lüftungsventilatoren diese schwachen, flüsternden Geräusche, die sich anhörten, als würden Kobolde unter den Fahrzeugen Komplotte schmieden, wenn sie meine Füße vorbeilaufen sahen. Vielleicht lösten der Mangel an Tageslicht und der granitgraue Beton und die schweigenden Fahrzeuge, die wie Särge aufgereiht dastanden, Gedanken an den Tod in mir aus. Manchmal fühlte es sich an, als stünde ich kurz davor, auf etwas zu stoßen, das nicht von dieser Welt war, wie eine Bande blasser, verwilderter Kinder mit rauchigen Augen und scharfen Zähnen, das großstädtische Gegenstück des 21. Jahrhunderts zu den Jungs von der Insel aus Herr der Fliegen.
Später sollte mir natürlich klar werden, dass diese Gefühle einer unterbewussten Wahrnehmung von finsteren Wesen entsprangen, die unter uns leben und wie Menschen aussehen und nicht auf Parkhäuser beschränkt sind – die ganze Welt ist ihr Spielplatz.
Jedenfalls musterte ich, als ich die sechste und oberste Ebene erreicht hatte, die Fahrzeugreihen voller Argwohn und erwartete fast, zwischen ihnen ein Männerpaar in dunklen Anzügen und mit Sonnenbrillen zu entdecken, eines wie das Duo, das mich am Tresen des Diners in seine Mitte genommen hatte. Angesichts der Tatsache, dass ich dem ersten Team, das mich verhaften sollte, entkommen konnte, war es vielleicht übertrieben, die ISA als allwissend und allgegenwärtig zu betrachten. Aber auch wenn die Regierung so tief in den Schulden steckt, dass sie praktisch pleite ist, und auch wenn der Dollar heute nicht mehr wert ist als ein Zehncentstück in den 1950ern, können die Bundesbehörden noch immer fast so schnell Geld drucken lassen, wie Bäume gefällt werden können, was bedeutet, dass eine Einrichtung wie die ISA, wenn sie losgelassen wird, den Namen Legion trägt, denn sie sind viele. Ich fühlte mich beobachtet, obwohl niemand da war, um mich zu beobachten, und belauscht, obwohl niemand auf der Lauer nach mir lag. Ich näherte mich meinem Toyota mit größter Vorsicht und wünschte mir, ich hätte einen frischen Feuerlöscher und einen Tarnumhang dabei.
Außer meinem Koffer und einem Ersatzreifen lag in meinem Kofferraum noch ein einfacher Werkzeugkasten. Ich schaffte es schnell, das Nummernschild abzuschrauben.
Zu jenem Zeitpunkt begann ich etwas an den Tag zu legen, das man vielleicht als kriminelle Durchtriebenheit beschreiben konnte, auch wenn ich es lieber als die Gewieftheit eines zu Unrecht beschuldigten Mannes auf der Flucht betrachtete. Ein Porsche stand neben meiner Rostlaube. Ich löste das Nummernschild von dem Wagen, schraubte es an den Toyota und klemmte dann das Nummernschild des Toyota an das schickere Fahrzeug. Der Besitzer des Porsche würde die Kosten für ein neues Kennzeichen tragen müssen und, bis er kapierte, was geschehen war, dem Risiko ausgesetzt sein, dass rachsüchtige ISA-Agenten seinen Wagen stürmten.
Andererseits war die Wahrscheinlichkeit, dass Mr. Porsche mir ähnlich genug war, um in einem Fall von Identitätsverwechslung niedergeschossen zu werden, eher gering. Und außerdem wollte die ISA mich nicht töten. Sie wollten mich verhören und, je nachdem, was sie mit »einzigartig« meinten, vielen unerfreulichen Tests und möglicherweise ein paar explorativen Operationen unterziehen, aber bestimmt nichts Schlimmerem.
Trotzdem, ich wusste, als ich das Parkhaus hinunterfuhr, dass die guten Schwestern des Mater Misericordiæ die Kosten und die Unannehmlichkeiten, die ich dem Besitzer des Porsche aufgebürdet hatte, nicht gutheißen würden. Wäre ich noch immer im Waisenhaus, würden sie mich eine Woche lang die Kartoffeln schälen lassen.
Wenn mich das, was ich Mr. Porsche angetan hatte, auch peinlich berührte und ich mich auch um meine Zukunft und mein Leben sorgte, was ich wirklich tat, so war ich aber auch mit mir selbst zufrieden, denn ich hatte einen Plan gefasst, während ich die Nummernschilder austauschte.
Hätte ich eine Liste der Kunden gehabt, die Juan Santos heute noch beliefern musste, ich hätte versucht, ihn zu finden und mich bei ihm für seinen Hinweis auf die Notwendigkeit eines Plans zu bedanken. Ich war so erfreut, endlich einen zu haben, dass ich nicht nur meinen Dank zum Ausdruck bringen, sondern auch meine Begeisterung mit ihm teilen wollte.
Mein Plan war es, nach Peptoe, Arizona, zu fahren und die drei Männer ausfindig zu machen, die mich vor 19 Jahren in einem Korb in der Mitte des Highways gefunden hatten. Die meiste Zeit meines Lebens war ich so gewöhnlich wie Sand in der Wüste gewesen, doch dieser seltsame Magnetismus, der mich in letzter Zeit von hier nach dort geführt hatte, schien ein Beleg dafür zu sein, dass etwas an mir tatsächlich einzigartig war. Vielleicht hatten Hakeem, Bailie und Caesar damals einen wichtigen Umstand verschwiegen oder etwas gesehen, das ihnen zu jenem Zeitpunkt unbedeutend erschien, das aber ein wichtiges Teil des Puzzles war, das ich bin.
Damals waren sie nicht alt gewesen, aber nun, nach zwei Jahrzehnten, waren womöglich einer oder mehrere von ihnen schon gestorben.
Vielleicht waren sie auch aus Peptoe weg in eine aufregendere Stadt gezogen, so eine wie Gila Bend oder Tombstone.
Ich war schon immer ein Optimist, denn Pessimisten haben nur selten Spaß und grämen sich meist geradewegs in eines der schrecklichen Schicksale, vor denen sie sich ihr ganzes Leben lang fürchten. Natürlich ist auch einem Optimisten kein durchweg glückliches Leben garantiert. Du kannst immer noch deinen Job am selben Tag verlieren, an dem dein Haus abbrennt und dein Ehepartner dich wissen lässt, dass er oder sie den Sheriff erschossen hat. Doch anders als der Pessimist glaubt der Optimist, dass das Leben einen Sinn hat, dass jedes Unglück auch erhellend ist und dass sogar die Absurdität einer solchen Anhäufung von Schicksalsschlägen wenigstens ein bisschen komisch wirkt, wenn erst einmal genug Zeit vergangen ist. Das ist der Grund, warum Optimisten, wenn sie einmal alles verloren haben, Jahre später häufig reicher und glücklicher als je zuvor sind, während Pessimisten oft erst gar nichts zu verlieren hatten.
Als ich meinen Toyota aus dem Parkhaus hinaus in den fließenden Verkehr bugsierte, war ich davon überzeugt, Hakeem, Bailie und Caesar gesund und munter in Peptoe vorzufinden. Ich konnte schon in drei Stunden dort sein und noch am selben Abend mit dem ersten von ihnen sprechen.
Bei allem, was Juan Santos über die Notwendigkeit wusste, einen Plan zu haben, so wusste er doch nicht alles über dieses Thema. Im Jahre 1785 warnte der Dichter Robert Burns in einem Werk mit dem Titel An eine Maus, dass die besten Pläne, ob Mann, ob Maus, »aft a-gley« endeten. Man muss sich nicht mit schottischen Dialekten auskennen, um zu wissen, dass er der Maus nicht gerade versprach, dass ihre Pläne ihr ganz bestimmt ein behagliches Dasein und edlen Käse bescheren würden.