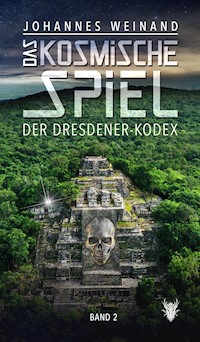9,99 €
Mehr erfahren.
Im 3. Reich wird das Sonderkommando K mit der Untergruppe Typhon gegründet. Typhon hat die Aufgabe, die Quellen der Welt zu kartografieren. Mit dem Ende des 2. Weltkrieges gerät das Projekt Typhon in Vergessenheit. Erst 70 Jahre später ist es soweit. Das Buch mit den Koordinaten aller Quellen der Welt wird gefunden. Mit der Sprengung des Assuan- und Hoover-Staudammes und gleichzeitiger Kontaminierung durch Ebola-Viren zeigen die Terroristen ihr Absicht, die Welt zu erpressen, um die Doktrin des 3. Reiches wieder zu etablieren. Bernd Rassmussen bekommt den Auftrag, die Terroristen zu jagen. Durch gute Recherche gelingt es ihnen, die Original-Koordinaten zu bekommen. Mit diesem Wissen werden sie zu den Gejagten. Der Gegner versucht mit allen Mitteln, das Team um Bernd Rassmussen zu töten. Es gelingt ihnen, die Kontaminierung des Zam Zam Brunnens in Mekka zu verhindern. Durch diesen Schachzug bündelt Bernd die Kräfte des Gegners auf sein Team.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Johannes Weinand
Rassmussen Band 3
Savant
Johannes Weinand
Savant
Thriller
Rassmussen Band 3
Impressum
Rechtsinhaber/Autor: Weinand Johannes, [email protected]
Covergestaltung: Constanze Kramer, www.coverboutique.de
Bildnachweis: ©Gilang Prihardono – stock.adobe.com
©Chansom Pantip - shutterstock.com
©kiuikson, ©AntonMatyukha - depositphotos.de
Lektorat: Klaus-Dietrich Petersen/Inga Heininger
© 2022 Johannes Weinand
ISBN Softcover:
978-3-347-59925-3
ISBN Hardcover:
978-3-347-59926-0
ISBN E-Book:
978-3-347-59927-7
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Bibliographische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiographie, detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
Wie alles begann
1933. Deutschland nach der Machtübernahme. Der Reichstag erstrahlte im neuen Glanz einer Diktatur, die durch Adolf Hitler und seinen Gefolgsleuten inszeniert wurde. Eine Diktatur, die die erste parlamentarische Demokratie dieses jungen Staates mit Gewalt ablöste, und das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte einläutete. Banden von Männern, gekleidet in dem dunklen braun der Lettow Hemden. Gekennzeichnet mit Hakenkreuz- Sturmbinden, patrouillierten sie durch die Straßen der Städte und verbreiteten Hoffnung und Angst.
Der dumpfe Glanz des Herbstes, gepaart mit der beginnenden hegemonischen Politik einer Machtelite, ließ die Hauptstadt des Landes in einem neuen Licht erscheinen und erschütterte die alten Strukturen der Weimarer Republik. Die Schönheit und Leichtigkeit der Menschen, die aus der Weimarer Zeit gekommen waren, war verschwunden sie hatten einem brutalem System Platz gemacht, das in der Lage war, die Welt ins Chaos zu stürzen.
Im Schatten riesiger Gebäude sponnen die Spinnen des Chaos ihr festes Netz. Ihre Schergen sollten in den nächsten 12 Jahren Völker in den Abgrund reißen, bis die Weltgemeinschaft in der Lage war, diesem System Herr zu werden. Eine Erbschaft von 80 Millionen Toten hinterlassend konnten vereinzelte Strukturen des Naziregimes bis in die heutige Zeit überleben, um erneut den Versuch der Destabilisierung zu unternehmen. Die hervorgerufene Traumatisierung der ganzen Welt würde noch viele Generationen andauern und ein eigenes Kapitel in der deutschen Geschichte bilden, das viele Narben hinterließ. Unbeeindruckt, nicht in die Zukunft schauend und besessen von dem arischen Gedankengut, begann der Holocaust und der Pest-Gestank der Weltherrschaft nahm seine Formen an.
In einem abgedunkelten Raum des Reichstages saßen 6 Männer und eine Frau, die noch nicht wissen konnten, dass sie mit ihren Ideen die Zukunft beeinflussen würden und damit das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte vollständiger machten. Blind gehorchend schmiedeten sie einen Plan, der die Welt an den Rand eines neuen Exodus führte.
„Wem unterstellen wir das Kommando, Freiherr?“ Kam die zackige Frage von General Günther.
„Die Frage stellt sich noch nicht, General Günther.“
„Welche dann?“
„Welcher Behörde unterstellen wir das Kommando, und sollte Himmler über die zu erwartenden Ergebnisse direkt informiert werden, General?“
„Natürlich nicht. Erst wenn konkrete Ergebnisse vorliegen, sollen wir Himmler informieren. Es dürfen auch nicht so viele Leute von diesem Projekt wissen. Sie haben aber eine Idee, wie das zu bewerkstelligen ist, Freiherr?“
„Wir unterstellen das Unternehmen dem Sonderkommando K.“
„Sonderkommando K, davon habe ich noch nie gehört.“
Der hagere Freiherr schaute den General lässig an und klärte den Mann, der ihn kritisch musterte und ihm gegenübersaß, auf. Instinktiv merkte der Freiherr, dass ihn der General nicht mochte.
„Sonderkommando K ist eine Forschungseinheit, die alle Expeditionen und Forschungseinrichtungen des Dritten Reiches kombiniert und koordiniert, und dabei für uns und das Reich die wichtigsten Ergebnisse herausfiltert.“
„Wieso weiß ich nichts davon?“ Die Frage kam hart und zeigte den Anwesenden, dass der General gewohnt war zu kommandieren.
„Absolute Geheimsache, General. Himmler hat mich direkt damit beauftragt, Sie darüber zu informieren und Sie dann dem Sonderkommando zu unterstellen.“
Der hagere Mann gab jedem ein Kuvert.
„Darin stehen die Informationen, die Sie brauchen. Ab sofort gehören Sie keiner Einheit und keinem Stab mehr an. Sie unterstehen allein Dr. Ernst Schäfer, dem Leiter dieser Forschungseinheit.“
Der General schaute den Freiherrn entsetzt an.
„Das können Sie nicht machen. Meine Familie ist seit Generationen mit dem Militär verbunden. Ich werde das Militär nicht verlassen. Ich verlange sofort ein Treffen mit dem Reichsführer Himmler.“
Der Freiherr stand auf und schaute den General ernst, aber auch abschätzend an.
„Ihr letztes Wort, General Günther?“
Der ältere Mann stand wütend auf.
„Wie respektlos behandeln Sie mich eigentlich? Das wird Konsequenzen für Sie haben.“
Langsam griff der Freiherr in seine Jackentasche und holte eine Pistole hervor, hob sie an und schoss dem General in den Kopf. Der Schuss aus der kleinkalibrigen Pistole ließ den Mann nicht nach hinten schleudern, sondern langsam auf seinen Sitz zurückfallen. Seine brechenden Augen schauten den hageren Freiherrn erstaunt und gleichzeitig vorwurfsvoll an.
„Tja, General, ich habe Himmler gesagt, dass Sie nicht der Richtige sind.“
Die Tür wurde aufgerissen, und ein junger Offizier stürmte mit vorgehaltener Waffe in den Raum. Ohne den jungen Mann eines Blickes zu würdigen, sagte der Freiherr: „Weber, räumen Sie den Kadaver weg, und schreiben Sie seiner Familie ein Beileidsschreiben. Das Übliche.“
Freiherr von Eisenitz zögerte einen Augenblick und berichtigte sich: „Nein, warten Sie.“
Er stützte seinen Kopf kurz ab und überlegte, dann sprach er weiter: „Sie schreiben: In Ausübung seiner Pflicht und Treue gegenüber Adolf Hitler und dem Groß Deutschen Reich. Heil, Hitler.“
Wie im Chor antworteten die anderen vier Männer, während die Augen der Frau kurz aufblitzten.
„Heil, Hitler.“
Weber packte den Toten unter den Armen und schleppte ihn aus dem Raum. Durch den plötzlichen Tod all seiner Muskeltätigkeiten beraubt, durchnässte der Urin die Hose des Mannes und hinterließ auf dem Boden eine geruchsintensive Spur.
Angewidert schaute der Freiherr dem Toten hinterher, dabei bemerkte er abfällig: „Noch nicht einmal im Tod hat er genug Disziplin.“
Dann schnellte sein Kopf zu den vier verbliebenen Männern und der Frau, die keineswegs erschreckt den Freiherrn anschauten.
„So, meine Herren, gnädige Frau, ich glaube Sie haben die Dringlichkeit des Anliegens gegenüber dem Führer verstanden.“
Die vier nickten, und ein Oberst des Heeres ergriff das Wort: „Das war deutlich genug, Freiherr. Trotzdem bleibt die Frage offen: Wer leitet das Unternehmen?“
Der hagere Mann, mit einem Scheitel, der wie eine Narbe den Kopf zierte, schaute den Soldaten lächelnd an.
„Das liebe ich an Ihnen, Oberst Lausitz. Immer auf das Ziel fixiert. Deswegen waren Sie für mich die erste Wahl.“
Unbeeindruckt schaute der Mann den Sprecher an.
„Und?“
„Ja, ich habe da einen jungen unternehmenslustigen Mann. Er ist ein vielsprachiger Sportler, hat dazu noch großes Durchhaltevermögen und ist Adolf Hitler eng verbunden.“
Der Freiherr legte eine kurze Pause ein. Die vier Männer schauten ihn gespannt an, bis ihn Oberst Lausitz fragte: „Wie heißt der junge Mann, den Sie so über den Klee loben?“
Die Antwort kam schnell und kompromisslos. Sie ließ keinen Widerspruch zu: „Freiherr von Eisenitz.“
„Noch nie von ihm gehört. Ist er mit Ihnen verwandt?“
„Kann ich mir vorstellen. Ja, er ist mein Neffe.“
Wieder ergriff der Oberst das Wort: „Lassen wir den Mann doch erst einmal außen vor. Ich vertraue Ihrer Qualifikationswahl, Freiherr. Worum geht es eigentlich wirklich?“
Leise und distanziert antwortete Freiherr von Eisenitz: „Genau das ist die Gretchenfrage, Oberst. Worum geht es?“
Wieder entstand eine Pause.
„Uns steht jetzt eine Mammutaufgabe bevor. Meine Herren, Sie haben vier Wochen Zeit, das Projekt zu organisieren. Ihnen stehen Mittel zur Verfügung, die Ihre Vorstellungskraft sprengen werden.“
„Machen Sie es nicht so spannend, Freiherr.“
„Die Kartographierung aller Quellen auf der Welt.“
Der hagere Mann merkte, wie die Nachricht bei den Anwesenden einschlug.
„Alle Süßwasserquellen nehme ich an, Freiherr? Wahrlich eine Mammutaufgabe.“
„Sehen Sie sich der Aufgabe gewachsen, meine Herren?“
Wieder meldete sich Oberst Lausitz zu Wort, der sich langsam zum Wortführer herauskristallisierte.
„Bevor ich meine Fähigkeiten dem Führer zur Verfügung stellen kann, habe ich noch eine Frage, Freiherr.“
„Fragen Sie, Oberst.“
„Können wir auf die Ergebnisse früherer Expeditionen zurückgreifen?“
„Die da wären?“
„Freiherr.“
Die Stimme klang ein wenig mitleidig und zeigte trotz der Vorfälle, die wenige Minuten vorher stattgefunden hatten, eine gewisse Respektlosigkeit, die der Freiherr durchaus registrierte, aber auch akzeptierte.
„Wir sitzen doch nicht hier, weil wir inkompetent sind. Himalaya-Expeditionen haben schon stattgefunden, Expeditionen ins Amazonasbecken sind nicht zu vergessen, dazu kommt noch das Geheimprojekt Neuschwabenland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Führer die Leute in irgendwelche Gegenden schickt, damit es ihnen gut geht.“
„Woher wissen Sie das alles, General?“
„Gerüchteküche. Aber das ist jetzt vollkommen uninteressant. Können wir auf die Daten zurückgreifen?“
„Sie können, Oberst.“
„Sehen Sie, das erleichtert die Aufgabe erheblich. Ich bin dabei und glaube, dass wir Ihnen in 4 Wochen ein brauchbares Ergebnis liefern können.“
„Die anderen Herren und die Dame?“
Der Freiherr schaute in die Runde. Ein beifälliges Nicken war die Antwort.
„Gut, dann sind wir uns einig.“
„Noch etwas, Freiherr. Welche Qualifikation bringt denn Ihr Eisenitz mit?“
„Wasserfachmann. Weber.“
Der Ruf kam kurz und hart. Die Tür wurde aufgerissen, und Weber antwortete: „Freiherr.“
„Rufen Sie meinen Neffen Eisenitz in der Burg an. Er soll die nächste Maschine nehmen und hier in Berlin antanzen.“
„Jawohl, Freiherr.“
„Meine Herren, gnädige Frau.“
Wieder leutselig, wandte er sich an die kleine Gruppe.
„Weber wird Sie mit Dr. Schäfer bekannt machen. Dann kleiden Sie sich aus. Ab sofort ist nur noch Zivilkleidung erlaubt. Sie gehören keiner Waffengattungen mehr an. Sie bekommen außerdem spezielle Ausweise, die Ihnen viele Türen öffnen werden. Sollten Sie auf irgendwelche Probleme stoßen, zögern Sie nicht, mich anzurufen.“
Die Männer und die Frau, die bisher unscheinbar noch kein Wort gesagt hatte, verließen den Raum, nicht ohne noch ein
zackiges „Heil, Hitler“ in den Raum zu brüllen.
Der Freiherr setzte sich, trommelte mit den Fingern auf den Tisch und lächelte vor sich hin.
24 Stunden später
Ein junger blonder Mann, mit militärisch kurz geschnittenen Haaren, schritt neugierig die Treppe des Reichstagsgebäudes hinauf. Den Seesack geschultert, schaute er sich interessiert um. Erstaunt nahm er die vielen Uniformierten wahr, die sich auf dem großen Platz aufhielten, mit Passanten oder Ihresgleichen sprachen, oder einfach nur die anwesenden Menschen beobachteten. Ab und zu hörte er ein gedämpftes „Heil, Hitler“. Ein Arm flog hoch, und die Hacken knallten zusammen. Junge Frauen flanierten in den Armen von steif daher gehenden, hochdekorierten Uniformierten über den Platz, um die bewundernden Blicke anderer junger Uniformierter einzufangen, die allein oder in Gruppen dastanden und sich besprachen. Dabei stahl sich manch verstecktes Lächeln auf deren Lippen und die Augen senkten sich, um umrahmt von errötenden Wangen, ein Bild des Interesses abzugeben.
Ein kalter Sturm kündigte den nächsten Schauer an. Die Leute, die sich auf dem Platz aufhielten, schauten kritisch fröstelnd in den Himmel. Die Wolken, getrieben von der Härte des Sturmes, fegten über das Firmament. Sie lösten sich auf, um sich später wieder mit anderen zu vereinen, bis sie abgelöst von anderen Wolken hinter dem Horizont verschwanden. Das Heulen des um die Gebäude pfeifenden Windes erinnerte Jahre später manche der Dastehenden und vielleicht noch lebenden Soldaten an das Heulen der Sirenen welche die die Staffeln von Bombern der Alliierten ankündigten und die Menschen in die Tiefe der überfüllten Bunker jagten.
Der junge Freiherr von Eisenitz mochte sie gerne, diese aufreibende Stimmung. Während die Leute fluchtartig den großen Platz verließen, als der Regen sich sintflutartig auf dem Asphalt des Platzes verteilte, schritt der junge Mann mitleidig lächelnd auf den Eingang des großen Gebäudes zu. Mit einem schnellen Schritt trat er ein und entkam so der nächsten Böe, die mit ganzer Macht an der Tür rüttelte. Zielsicher steuerte er auf eine junge, gutaussehende Frau zu und sprach sie mit einem verstohlenen, aber auffordernden Lächeln an.
„Können Sie mir bitte sagen, wo ich den Freiherrn von Eisenitz treffen kann?“
Die junge Frau deutete auf eine Tafel und lächelte ungeniert zurück.
„Ein Zivilist unter so vielen Soldaten? Aber gehen Sie einmal zu der Tafel, da können Sie sehen, wo das Büro von Freiherr von Eisenitz ist.“
Dabei deutete sie mit dem Finger an ihm vorbei. Langsam drehte er sich um und sah neben der großen Treppe eine Hinweistafel. Er zeigte mit dem Finger der rechten Hand auf seine Augen.
„So ist es, wenn man nur Augen für eine hübsche Frau hat.“
Sofort errötete die junge Frau und drohte ihm mit dem Zeigefinger der rechten Hand.
„Sie sind ja ein ganz Schlimmer.“
Ein entwaffnendes Lächeln auf den Lippen, antwortete er ganz einfach: „Vielen Dank für die Hilfe.“
Er drehte sich um, grüßte noch einmal und ging zu der Tafel, die neben der Treppe stand. Er suchte kurz, und es dauerte auch nicht lange, da hatte er den Namen des Freiherrn von Eisenitz gefunden. Mit schnellen Schritten lief er die Treppe hoch.
Im ersten Stock angekommen, studierte der junge Mann eine weitere Tafel, die an einem dicken Pfeiler gegenüber der letzten Stufe an der runden Marmorsäule montiert worden war. Er wandte sich zackig nach rechts und konnte schon von weitem die Zahl 114 erkennen. Den Seesack immer noch auf den Schultern, ging er mit raumgreifenden Schritten auf die Tür zu, und klopfte an. Eine weibliche Stimme forderte ihn auf hereinzukommen. Der junge Mann öffnete die Tür und trat ein. Eine unpersönliche Sekretärin begrüßte ihn eisig. Auch sein Lächeln konnte ihrer Mine nichts abgewinnen.
„Sie wünschen?“
„Ich wollte zu dem Freiherrn von Eisenitz.“
„Wen darf ich denn melden?“
„Freiherr von Eisenitz.“
„Nein, ich meinte Sie. Wie heißen Sie?“
„Freiherr von Eisenitz.“
Ein abschätzender Blick traf den jungen Freiherrn. Sie stand auf und verschwand hinter einer angrenzenden Tür. Kurze Zeit später wurde die Tür aufgestoßen, und der Onkel des jungen Mannes stand im Türrahmen.
„Komm in meine Arme, Paul.“
Die beiden begrüßten sich herzlich, während die Sekretärin wieder hinter dem Schreibtisch verschwand und die beiden abschätzend anschaute.
„Paul, was möchtest du trinken?“
„Wie immer, Onkel.“
„Luise, lassen Sie bitte einen halben Liter frische Milch bringen.“
Die Sekretärin nickte sparsam.
„Komm Paul, lass uns das Unternehmen besprechen. In vier Wochen geht es los. Der Führer hat seine Zustimmung gegeben, und der Plan wird unter Oberst Lausitz ausgearbeitet.“
Die beiden verschwanden im Büro und schlossen die Tür hinter sich. Sie wurden nur noch einmal gestört, als Luise die Milch brachte und sich zum Feierabend verabschiedete. Die beiden waren wieder alleine und benahmen sich wie die Pennäler, als sie sich über frühere Zeiten unterhielten.
„Erzähl, Paul, wie ist es dir ergangen?“
Paul fing an und wurde nur noch unterbrochen, als er zu der Tätowierungszeremonie der SS kam.
„Und, haben Sie dir die SS-Nummer unter den Arm gestochen?“
„Nein. Leibold schaute mich dämlich an, als er den Brief von dir las.“
Paul schaute seinen Onkel an und verstellte die Stimme: „Na, bekommt das Jungchen eine Sonderbehandlung?“
Beide lachten.
„Was soll ich in der Zeit machen, während geplant wird?“
„Du genießt die Hauptstadt mit ihren Vorzügen. Ab und zu schneist du ins Planungsbüro rein, erkundigst dich nach dem Stand der Dinge. Dir wird dann Bescheid gesagt, wenn es soweit ist.“
„Wo soll ich in der Zeit wohnen?“
„Ich habe da ein sehr nettes Etablissement, da wird für dich gesorgt, physisch, wie auch psychisch.“
„Hübsche Damen?“
„Sehr hübsche Damen, mein Junge.“
75 Jahre später
Der 2. Weltkrieg hatte schon lange seine furchtbaren Schatten und Ängste verloren. Es waren andere schlimme Ereignisse an seine Stelle getreten, die die Menschheit aber nicht mehr aufnahm, weil die Informationspolitik sie mit so vielen schlechten Nachrichten überschütteten, dass sie ihre Gehirne abschalteten. Einige fragten sich, ob es ein gewolltes Procedere war, um die Hemmschwelle des Menschen nach unten zu projizieren. Vielleicht um eine schleichende Destabilisierung auszulösen. Aber auch das war den meisten egal, denn Partys und Ablenkung ließ sie an andere Sachen denken, da hatten Probleme, die andere machten, keinen Platz mehr.
Die Sicht war klar, und die Mai-Luft ließ erahnen, dass es ein heißer Sommer werden sollte. Ein leichter Wind streichelte das Wasser des Nord-Ostsee-Kanals, und sein Kräuseln zeigte dem Seemann, dass der Wind aus Osten kam. Die Menschen, die im Schatten der Hänge des Kanals wohnten, hoben fröstelnd ihre Schultern, um so das Gefühl zu erwecken, der in der Luft stehenden Kälte entkommen zu können.
Die beiden Männer, die auf einem Hügel am Rande des Kanals standen, schauten zuerst nach Westen und dann nach Osten. Während im Osten eine beladene Fähre den Kanal querte, konnten sie im Westen die Umrisse der Radarhochbrücke ausmachen. Unruhig schauten sich die Männer an.
„Wenn Karl etwas schneller bohren würde, bekämen wir die Sprengung hin, wenn kein Schiff hier vorbeifährt.“
Der Vorarbeiter schaute den Ingenieur traurig lächelnd an.
„Schon wieder im Zeitdruck?“
„Wann nicht?“
„Harter Beton“, sagt der Vorarbeiter.
„Wie üblich, was aus dem 2. Weltkrieg kommt, ist immer hart. Was mussten sie sich auch gerade die Flak-Stellung auf dem Windmühlenberg aussuchen. So ein Relikt aus dem 2. Weltkrieg ist immer mit Problemen verbunden.“
„Der Büro- und Wohnkomplex liegt dafür aber sehr gut. Vom Kanal aus gut einsehbar und von der Straße auch.“
Die beiden wurden in ihrem Gespräch unterbrochen. Karl kam aus dem Bunker.
„Kommt mal her, dass müsst ihr euch ansehen.“
Der Ingenieur drehte sich zum Vorarbeiter um.
„Was habe ich gesagt? Schwierigkeiten. Wenn Karl nicht weiter macht, ist etwas faul. Was ist los?“
„Wir können nicht weitermachen. Hinter der Wand ist ein Hohlraum. Bevor ich nicht weiß, was dahinter ist, läuft gar nichts.“
Die drei erreichten die Wand, in der sieben Löcher gebohrt waren. Der Vorarbeiter hielt die Hand vor ein Loch.
„Fühlt mal, Luft wie aus einem Eisschrank. Hast du mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet?“
„Habe ich schon probiert. Geht nicht, die Wand ist zu dick, die Löcher zu dünn und der Raum zu groß. Da muss eine Kamera rein.“
„Wer macht so etwas?“
„In dem Fall der Denkmalschutz.“
„Noch einmal große Scheiße. Was die Bande in ihre gichtigen Finger bekommen, das halten die fest.“
„Da geht kein Weg daran vorbei. Ich rufe mal an. Am Ende finden wir noch das Bernsteinzimmer.“
„Ha ha, finde ich nicht gerade witzig, Karl.“
Karl, der Sprengmeister, rief das Amt für Denkmalschutz an und legte wenig später wieder auf.
„Sie sind in zwei Stunden da.“
„Wie hast du das so schnell hinbekommen?“
„Das passiert ja nicht zum ersten Mal. Meist ist es ganz harmlos, und die Jungs ziehen schnell wieder ab.“
„Ok, dann lass uns warten.“
Zwei Stunden später fuhr ein blauer VW Bus vom Amt für Denkmalschutz auf den Parkplatz. Ein älterer Mann mit Kinnbart stieg aus, im Schlepptau zwei junge Männer. Zielstrebig steuerte er auf den Bauwagen zu und öffnete kraftvoll die Tür.
„Hallo, Karl, wo brennt es denn jetzt schon wieder?“
„Hallo, Pit.“
Die beiden Männer begrüßten sich herzlich, und Karl stellte ihm den Ingenieur und den Vorarbeiter vor.
„Der alte Flak-Bunker muss weg, aber er ist doppelwandig. Absolut ungewöhnlich. Wir haben nicht die Ausrüstung, da hereinzuschauen.“
„Bekommt man in jedem Baumarkt. Was soll schon dahinter sein?“
Pit drehte sich zu Dirk, einem seiner Assistenten, um.
„Jungs, geht mal herein und schaut durch die Löcher.“
„Ok, Chef.“
„Und ihr, gebt mal einen Kaffee aus.“
Die beiden jungen Männer gingen zu ihrem VW-Bus, entnahmen dem Fahrzeug einen Koffer und verschwanden damit im Bunker. Derweil saßen die drei Männer im Bauwagen und warteten bei einer Tasse Kaffee auf das Ergebnis, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde. Einer der Assistenten enterte mit bleichem Gesicht den Bauwagen.
„Chef, das müssen Sie sich ansehen.“
„Was ist los, Dirk?“
„Müssen Sie sich ansehen“, stammelte er nur.
Und schon war er wieder auf dem Weg zum Bunker.
„Dirk“, rief der Chef des Denkmalschutzes hinter dem Davoneilenden her. Der drehte sich nur um und drängte.
„Kommen Sie“, dabei winkte er mit der linken Hand auffordernd. Kopfschüttelnd standen die Männer auf.
„Wenn das ein Fake ist, gibt es ein Unwetter.“
Die anderen drei Männer schauten sich belustigt an und gingen gemeinsam in den Bunker. Kalte Luft schlug ihnen entgegen, und automatisch fingen sie an, sich unwohl zu fühlen. Kein Geräusch drang mehr an ihre Ohren, nur die, die sie selbst verursachten. Ängstlich schaute sich Pit um.
„Keine Angst, Pit, ist für die Ewigkeit gebaut“, knurrte der Sprengmeister lahm.
„Wenn du das sagst.“
Sie gingen durch eine Eisentür, die von der Form nach außen gewölbt war. Mit vier großen Hebeln konnte sie nach außen gesichert werden. Pit rümpfte leicht die Nase.
„Ein altes Farb- und Öllager, es ist bestimmt noch von der Flak Einheit, die hier gelegen hat in der Zeit des Kalten Krieges.“
„Vom Umweltschutz hatten die auch noch keine Ahnung. Was ist los, Jungs?“
Der andere Assistent reichte dem Leiter des Denkmalschutzes den Monitor, während Dirk den Kamerakopf bewegte und den Raum hinter der Wand aufnahm. Die drei standen vor dem Monitor und deckten ihn voll ab. Die anderen drei, die nichts sehen konnten, hörten nur.
„Scheiße, scheiße, scheiße, das gibt es doch nicht.“
„Was ist los, Pit, klär uns mal auf.“
Die Stimme des Denkmalschutzexperten veränderte sich um Nuancen, sie wurde klirrend.
„Bis auf Karl, alle heraus hier.“
An den Vorarbeiter gewandt, sagte er dann: „Keiner verlässt die Baustelle, keiner kommt hier herein.“
„Was ist los, Pit?“
„Raus hier, aber schnell.“
Die Stimme wurde schrill. Kopfschüttelnd verließen die Männer den Bunker.
„Karl, du hast doch Knetmasse, um den Bunker abzudichten?“
„Ja.“
„Sofort alle Löcher dichtmachen.“
„Kannst du mir…“
„Jetzt nicht, mach schnell.“
Karl dichtete die Löcher ab. Sie verließen den Raum und den Bunker. Pit verschloss sorgfältig die Außentür.
„Was hast du gesehen, Pit?“
„Pandemie-Viren.“
„Sind die mutiert, so dass du sie mit bloßem Auge sehen kannst?“
„Du bist ein Vollidiot, es standen da Reagenzgläser mit der Aufschrift verschiedener Virenstämme in den Regalen.“
Jetzt wurde auch Karl blass und bemerkte entsetzt: „Was Adolf uns da wohl hinterlassen hat?“
Sie eilten in den Bauwagen, wo die anderen sie schon mit fragenden Augen erwarteten. Pit ließ keinen zu Wort kommen.
„So, hört mir mal zu, keine Fragen, keine Telefonate. Es werden auch keine Telefonate angenommen. Karl, wer war noch, nachdem du die Löcher gebohrt hast, im Bunker?“
„Nur wir, hier im Bauwagen.“
„Das erleichtert die Sache ungemein. Keiner darf per sofort mit den anderen Bauarbeitern in Kontakt kommen. Die Baustelle wird so lange stillgelegt, bis das Gesundheitsamt Entwarnung gibt. Jetzt lasst mich erst einmal telefonieren.“
Pit nahm sein Handy und wählte eine Nummer, dann sprach er mit dem zuständigen Beamten und legte wieder auf.
„Keiner geht pinkeln oder kacken.“
An den Vorarbeiter gewandt, gab er folgende Befehle: „Treib alle Leute auf der Baustelle zusammen. Du darfst keinen direkten Kontakt zu ihnen haben. Es besteht hohe Infektionsgefahr.“
Es dauerte keine fünf Minuten, da ruhten die Arbeiten auf der Baustelle. Ratlose Gesichter, teilweise ängstlich, aber auch neugierig, schauten auf das kleine fahrbare Häuschen, in welchem die saßen, die direkten Kontakt mit dem Bunker hatten. Der Vorarbeiter kam von den anderen Bauarbeitern zurück.
„Die Leute wissen Bescheid, so jetzt klär uns auf.“
Der Chef des Denkmalschutzes ließ eine kleine Pause auf die Anwesenden wirken, dann fixierte er jeden Einzelnen und begann: „Ein Raum, circa 4 x 3 Meter. Ein Tisch in der Mitte und an der Wand gestapelte Reagenzgläser mit der Beschriftung von Pocken, Pest, Influenza und noch einige andere, die ich nicht kenne. Dann noch einige kleine Behälter mit Insekten. Mehr konnte ich aber nicht erkennen. Die Gläser waren ziemlich verstaubt.“
„Und wieso ein Tisch?“
„Woher soll ich das wissen? Auf dem Tisch stand ein Kasten, der verschlossen war.“
Der Ingenieur meldete sich zu Wort.
„Ach, die Viecher sind doch sicherlich so alt, die haben doch schon alle das Zeitliche gesegnet.“
Dabei wollte er aufstehen. Die Hand von Pit schoss vor, und umklammerte den Arm des Ingenieurs wie einen Schraubstock. Er zwang den Mann wieder auf den Platz zurück und hauchte nur die Worte: „Sitzen bleiben, wir sind für so einen Fall extra geschult worden. Wir wussten, dass unser Freund aus dem Dritten Reich mit Viren gearbeitet hat. Nur keiner wusste, wohin er die Büchse der Pandora ausgelagert hatte. Es hat den Anschein, als hätten wir sie geöffnet.“
„Und was jetzt?“
„Jetzt kommt das Full Service Team. Ich höre sie schon.“
Die Männer lauschten und hörten das Rattern von Rotoren, vermischt mit dem Heulen der Polizeisirenen, ergab es ein erschreckendes Szenario. Gut geschulte Leute riegelten den Bauplatz ab. Der Helikopter war außerhalb der Umzäunung gelandet, anderes Personal baute ein Zelt im Areal auf. Dann klopfte es an der Bauwagentür.
„Ausziehen, alles und einzeln herauskommen.“
Eingeschüchtert von so viel Machtdemonstration, zogen sie sich aus.
„Wo geht es jetzt hin?“
Pit, der anscheinend wusste, worauf es hinauslief und wie der Vorgang ablief, kommentierte das weitere Vorgehen: „Es folgt die Dekontamination. Schon einmal etwas von ABC gehört, mein Freund? Die Sachen bekommt ihr wieder, wenn sie entseucht sind.“
„Erste Klasse Grundschule, klär uns auf.“
Pit ging nicht auf den Kommentar ein.
„Atomare, biologische, chemische Entseuchung. Danach geht es nach Kiel, da wird eine Isolierstation vorbereitet.“
„Und wie lange soll die Scheiße andauern? Wir haben nicht die Zeit.“
„Kommt auf die Inkubationszeit der einzelnen Viren an.“
„Aber unsere Familien müssen doch Bescheid wissen.“
„Macht euch keine Gedanken, es wird alles geregelt.“
Mittlerweile hatten sie sich bis auf die Haut ausgezogen, und Pit ging mit gutem Beispiel voran.
„Wir sind soweit.“
„Ok, der Erste.“
Er öffnete die Tür. Der Anblick, der sich ihnen bot, war futuristisch. Mit speziellen Schutzanzügen gekleidete Männer und Frauen liefen draußen herum und bedeckten gerade den Bauwagen mit einer Plane. Vor ihm stand ein Mann, der auch mit einem Schutzanzug gekleidet war.
„Ich bin Prof. Schröder, Virologe und Leiter des Teams. Ziehen Sie das da bitte an.“
Dabei deutete er auf einen am Boden liegenden Schutzanzug, der sich in der Farbe von den anderen abhob.
„Während Sie sich anziehen, geben Sie mir bitte Ihre Daten und sagen Sie mir, was passiert ist.“
Pit gab seine Daten ab und erzählte dem Virologen, was sich abgespielt hatte. Als er auf den hinter ihnen liegenden Bunker zu sprechen kam, wurde der Virologe neugierig und unterbrach ihn kurz.
„Wo ist der Bunker?“
Pit zeigte hinter sich, in südwestliche Richtung. Der Mann gab einigen Leuten einen Wink, die dann wortlos in die angedeutete Richtung gingen und mit der Dekontamination in Richtung des Bunkers begannen.
Pit hatte sich in der Zeit angezogen und wurde zum Zelt geführt.
Nach und nach kamen auch die anderen dran. Dann ging einer nach dem anderen, nachdem sie sich in einem speziellen dafür konstruierten Isolierraum wieder ausgezogen hatten, in eine dafür vorgesehene Desinfektionsdusche. Nach der Desinfektion bekamen sie neue Kleidung und einen andersfarbigen Schutzanzug. Auf dem Weg zum Transporthubschrauber wurden sie von mehreren Sicherheitsleuten begleitet, die sie bis nach Kiel auf die Isolierstation eskortierten.
Nigeria
Nigeria mit seiner quirligen Hauptstadt verursachte bei Benno Faller, dem Leiter des Deutschen Instituts für Virologie, mit dem Spezialgebiet Ebola, immer ein leichtes Prickeln unter der Haut, aber auch ein gewisses Unwohlsein. Es war anders als in Deutschland. Man musste wachsam sein, und seine Augen überall haben. In diesem Land wurde Sicherheit großgeschrieben, und Benno Faller wusste um die Gefahren, die um ihn herum lauerten.
Er war schon seit geraumer Zeit in diesem afrikanischen Land, das am Golf von Guinea lag und von Ländern wie Benin, Niger, dem Tschad und Kamerun eingerahmt wurde. Es hatte eine ganze Zeit gedauert, aber langsam fing es an, ihm zu gefallen. Sein Körper und sein Kopf hatten sich an diese Art des Lebens gewöhnt. Es war ein Rhythmus, gepaart mit einer Leichtigkeit, die er von zu Hause nicht kannte. So ging die Wachsamkeit in ihn über wie etwas ganz Normales, und er brauchte nicht mehr darüber nachzudenken, was er tat, um seine Sicherheit zu gewährleisten.
Wie jeden Tag, so auch heute, schloss er die Eingangstür seines Hauses, ging mit erhöhtem Adrenalinspiegel einen Schritt von der Tür weg und sicherte mit einem kurzen schnellen Blicken die Umgebung. Immer sprungbereit wie ein Panther, der sich nie sicher war, ob er beobachtet wurde, um dann bei Gefahr wieder zu verschwinden.
Er lebte mit Arbeitskollegen in einem etwas besseren Viertel von Abuja. Wie sie nörgelnd sagten, wohnten sie im Gral. Umgeben von hohen Mauern, die bis zur Spitze mit Stacheldraht gesichert waren, war der Komplex um einen Swimming-Pool herum gebaut worden, den nur die Weißen benutzen durften.
Das einheimische Personal war froh, eine so gute und sichere Arbeitsstelle bekommen zu haben. Meistens wurden die Stellen anhand von Bestechungsgeldern vergeben.
Er lebte allein. Familie hatte er keine, sonst hätte er auch nicht die Möglichkeit bekommen, nach Nigeria zu gehen und dickes Geld zu verdienen. Nicht, dass ihn das Geld reizte, es war die Aufgabe, die im Vordergrund stand, Geld war für ihn nur Beiwerk.
Ein Staat in Afrika, der nicht nur durch seine rasant wachsende Bevölkerung berühmt war. Diese Bevölkerung beherbergte mehr als 500 Sprachen, ein Eldorado für Linguisten, wenn da nicht die Boko Haram wären. Bekannt durch ihre große Brutalität und Rücksichtslosigkeit, verzögerten sie die Entwicklung dieser ehemals von den Franzosen besetzten Kolonie. Aber auch diese brutale Gruppe konnte es nicht verhindern, dass Goldgräber aus aller Welt in dieses rohstoffreiche Land kamen, um sich ihren Teil am Reichtum zu sichern. Es war Klondikstimmung ausgebrochen.
Benno Faller, der immer noch vor der Tür stand, konnte nichts Außergewöhnliches feststellen, und so sank sein Adrenalinspiegel auf normales Niveau zurück. Auch das Leben auf der Straße zeigte ihm nichts Ungewöhnliches. So drehte er sich wieder um, drehte den Schlüssel im Schloss der Tür um und hörte am Klacken des Schlosses, dass der Zylinder eingerastet war. Dann ging er leichten Schrittes, immer noch sichernd, den gepflasterten Weg hinunter, bis er das gusseiserne Tor erreicht hatte. Dieses wurde von einem Rundbogen umrahmt, an die sich die hohe Mauer, die um das Grundstück führte, anschloss. Die Appartements und Häuser, die sich in diesem Grundstück befanden, waren ausschließlich von Deutschen und Holländern bewohnt. Auch dieses Tor schloss er auf, öffnete das Eisentor vorsichtig, schaute auf die Straße und sicherte zuerst die nähere Umgebung, dann erst ging er vollends auf den schmalen Fußgängerweg, zog das Tor leise wieder zu und schloss ab.
Es war eine angenehme Luft, geschwängert von dem Duft der Blumen, die vermischt mit dem Geruch der Wüste eine Herbheit hatte, den Menschen nicht kreieren konnten. Benno genoss es, morgens immer eine Stunde früher im Büro zu sein. Die langsame Fahrt am Markt vorbei, der gerade erst im Aufbau war, oder durch enge Straßen, wo dann die Einheimischen geschäftig zum Markt strömten. Die Geräuschkulisse, die dabei erzeugt wurde, war erstaunlich und voller Energie. Sie stellte einen Staat dar, der den Spagat vollzog, aus der Steinzeit in die Zukunft durchzustarten. Aber der Virologe sollte diese Luft nie wieder so wahrnehmen, wie er sie jetzt roch.
Das bestellte Taxi wartete schon. Das Deutsche Institut für Virologie hatte dafür gesorgt, dass es den Männern und Frauen, die um Benno Faller arbeiteten, an nichts fehlte. Es war fast westlicher Standard, der hier erreicht wurde.
Bei dem Sichtungsgespräch für Nigeria wurde er gefragt, ob er Bodyguards brauchte. Er lehnte ab, immer mit einem lockeren Spruch auf den Lippen.
„Solange ich noch laufen kann, brauche ich keine Bewachung.“
Die Dame, die das Einstellungsgespräch mit ihm führte, schaute ihn dabei merkwürdig an. Ein stilles Lächeln kam über seine Lippen, als er daran dachte. Schließlich bekam er den Job dank seiner Qualifikationen.
Der Fahrer schaute verkrampft nach vorne, und in Bennos Gehirn manifestierte sich kurz der Gedanke der Vorsicht. Aber bevor er ihn richtig wahrnahm, war er auch schon wieder verschwunden.
Benno begrüßte den Mann wie immer, indem er leicht die Hand hob.
„Hello, good morning.“
„Good morning, Sir.“
Der Virologe öffnete die hintere Tür und ließ sich beruhigt in das Polster sinken. Er merkte sofort, dass etwas nicht stimmte, kam aber nicht mehr dazu zu reagieren. Ein stinkiger Jutesack wurde über seinen Kopf gestülpt, und etwas Hartes traf seine Schläfe. Sofort fiel er in Ohnmacht und hörte nicht mehr die Worte des Mannes, der neben ihm saß.
„Los, fahr ins Institut.“
„Ja, Sir.“
Sie fuhren durch die Stadt, durch die sich schon in diesen frühen Morgenstunden dichter Verkehr wälzte. Dabei kamen sie teilweise nur sehr langsam voran. Unruhig schaute der Fahrer immer wieder nach hinten, wo der Kopf des Weißen auf dem Schoß des neuen Fahrgastes lag. Es hatte den Anschein, als würde der neue Fahrgast die Fahrt durch die Hauptstadt genießen, wenn da nicht die große Pistole mit Schalldämpfer gewesen wäre, die stetig, ohne sich zu bewegen, auf das rückwärtige Polster des Fahrersitzes zielte. Trotz der Pistole beruhigte sich der Chauffeur etwas und konzentrierte sich mehr auf den Verkehr in den Straßen. Er bog von der Hauptstraße ab, fuhr zwei Querstraßen weiter und blieb vor dem Institut für Virologie, dessen Leiter Benno Faller war, stehen. Benno Faller regte sich. Ungeachtet dessen, setzte der Unbekannte seine Pistole mit Schalldämpfer hinter dem Fahrersitz an das Polster und schoss. Mit ungläubigen Augen ruckte der Körper kurz nach vorne, um dann wieder in seine alte Stellung zurückzufallen. Dann hob der Schütze seine Waffe noch ein zweites Mal und hielt dem Chauffeur die Waffe in den Nacken und drückte abermals ab. Wie von einem Katapult geschleudert, fiel der Oberkörper des Mannes nach vorne und wurde dann von dem Schützen wieder nach hinten gerissen, so saß der Chauffeur wieder mit entspanntem Gesicht in seiner alten Position. Der Schütze beugte sich vor, zog den Autoschlüssel aus dem Schlitz des Anlassers und ließ ihn achtlos auf den Boden fallen. Der Motor erstarb sofort. Im Zurücklehnen zog er die Handbremse an. Dann drückte er Benno Faller die Kehle zu, bis er wieder das Bewusstsein verlor, dabei murmelte er: „Ist nicht persönlich, mein Junge.“
Die Tür des Instituts wurde geöffnet. Zwei Schwarze erschienen und steuerten zielsicher auf das Taxi zu.
„Nehmt ihn und bringt ihn herein.“
Die beiden nahmen den Virologen unter den Armen und zogen ihn hinter sich her. Die Tür wurde von innen aufgehalten. Der Weiße ging lässig hinterher, schloss die Tür hinter sich und instruierte den Posten, der davor Stellung bezogen hatte. Dann ging er weiter ins Labor. Im Gebäude wimmelte es nur so von Bewaffneten, die sichernd aus den Fenstern schauten. Der Betrieb in dem Institut hatte noch nicht begonnen, und es waren sehr wenige Leute da, die aber allesamt im Labor auf dem Boden saßen und ängstlich ihre Bewacher anschauten.
„Setzt ihn auf den Stuhl und weckt ihn.“
Die Männer rissen Benno Faller den Jutesack vom Kopf und überschütteten ihn mit Wasser. Zuerst zeigte er keine Reaktion, dann brabbelte er vor sich hin, bis er vollends erwachte. Bevor der Weiße die erste Frage stellen konnte, dauerte es noch etwas. Der Fremde schaute ungeduldig auf die Uhr und sagte mehr zu sich selbst: „Los mach schon, die Zeit läuft uns davon.“
Als Benno wach wurde, stellte sich der Weiße breitbeinig vor ihn und gab ihm ein paar heftige Ohrfeigen, die seinen Kopf hin und her schleudern ließen.
„Herr Faller, ich brauche die Ergebnisse der Studie über mutationsfähige Ebola-Viren. Ich weiß, dass sie im Tresor sind. Geben Sie uns bitte die Kombination.“
Benno Faller brauchte einen Moment, bis er den Sinn der Worte begriff. Der Fremde gab ihm die Zeit.
„Was wollen Sie damit, und wer hat Sie darüber informiert? Das ist streng geheim.“
„Streng geheim, das gibt es nicht, Herr Faller. Es ist alles käuflich, speziell wenn es um den Preis eines Lebens geht. Also, ich habe sehr wenig Zeit.“
„Sie können mich mal.“
Mit einer fließenden Bewegung seiner Hand, die den Mann schnell als Killer kennzeichnete, zückte der Fremde seine Pistole. Er ging zu den am Boden kauernden und schoss dem erstenbesten in den Kopf. Völlig ruhig kam er zurück zu dem Virologen.
„Ich bin Überzeugungstäter, Herr Faller. Ich bin auch überzeugt, dass Sie mir die Kombination geben.“
Trotz seines brummenden Schädels und seines schmerzhaften Nackens schaute Benno Faller dem Mann in die Augen.
„Die paar Leute, die Sie hier erschießen, sind das Opfer wert. Denn, wenn diese Viren freigelassen werden, gibt es eine größere Pandemie als zu Zeiten der Spanischen Grippe.“
„Wohl wahr, Herr Faller, deshalb brauchen wir diese kleinen Mistviecher ja. Also, was ist?“
„Nein.“
Wieder ging der Mann zu einem der Sitzenden und exekutierte ihn mit einem gezielten Schuss in den Nacken. Dabei zuckte nicht ein einziges Mal das feingeschnittene Gesicht.
„Sie sehen, dass es mir egal ist, und Familie habe ich auch keine. Ich lebe nur für die Forschung.“
„Das wissen wir alles, Herr Faller.“
In der Stimme des Mannes hörte man keine Erregung.
„Bearbeitet ihn.“
Zwei junge Schwarze gingen auf den Deutschen zu, rissen ihn an den Armen hoch, während ein dritter ihm den Gewehrkolben in den Unterleib rammte. Benno Faller klappte zusammen wie ein Taschenmesser. Der nächste Stoß mit dem Gewehrkolben ging auf seine rechte Kopfhälfte. Ein hässliches Knacken zeigte an, dass etwas gebrochen wurde. Als der Fremde das Knacken hörte, wirbelte er herum.
„Nicht den Kopf, ihr Idioten.“
Er ging zu dem Virologen, der in den Armen der Schwarzen hing und nahm seinen Kopf an den Haaren hoch, dann fühlte er seinen Puls.
„Scheiße, der kann nichts mehr sagen. Wer war das?“
Alle schauten einen jungen Schwarzen an, der seine Kalaschnikow immer noch in beiden Händen hielt. Abgestandener Schweiß stand in dem Raum, und die Augen quollen dem jungen Mann fast aus den Augen, als er sah, dass der Fremde mit einer ruckartigen Bewegung den Arm mit der Pistole hob und kurz auf seinen Kopf zielte. Das trockene Plop des Schusses, verursacht durch den Schalldämpfer, hörte sich in dem Raum an, wie der Überschallknall eines Flugzeuges. Das kleine kreisrunde Loch, das sich auf der Stirn des Mannes bildete, stand in einem seltsamen Kontrast zu seiner tiefschwarzen Hautfarbe. Wie in Zeitlupe sackte der Schwarze in sich zusammen.
„Nehmt alle Computer mit und den Tresor auch. Los, beeilt euch.“
Als hätten sie einen Startschuss gehört, sprinteten die Männer los. Er beugte sich zu dem Schwarzen, der neben ihm stand.
„Legt sie alle um.“
4 Monate später
Kaduna, eine nördlich der Hauptstadt gelegene Stadt, die fast dieselbe Größe wie Abuja hatte. Sie beherbergt ein Gefängnis, welches nur als Loch zu bezeichnen war. Wer es schaffte, durch das Tor zu kommen, bekam keine weitere Chance im Leben. Die, die verschwinden sollten, wurden in das Loch geschafft. Es war einer jener Orte, wie sie es überall auf der Welt gab. Mord und Totschlag war an der Tagesordnung. Es wurden keine Unterschiede gemacht. Ob du Schwerverbrecher oder unschuldig hinter die Mauern gekommen bist, dein Name hörte auf zu existieren, genau wie dein Leben, das nur du alleine als wertvoll erachtetest.
Es waren vier Monate her seit den Ereignissen in der Hauptstadt. Ein Konvoi mit Gefangenen schlängelte sich durch das nördliche Nigeria. Als sie das Hauptgefängnis der Stadt erreichten, waren die Gefangenen mehr tot als lebendig. Je nach Schwere der Anschuldigung wurden die Männer in die Gefängnisse der Stadt verteilt.
Als alle die Pritschen der Lkws verlassen hatten, lag auf der Ladefläche nur noch ein Weißer, unfähig sich zu bewegen oder zu sprechen. Es war Benno Faller, nur noch ein Schatten seiner selbst. Der ehemals durchtrainierte Virologe war nicht mehr wiederzuerkennen. Nur seine Augen zeigten noch eine winzige Flamme des Lebens. Der Fahrer, der für den Transport zuständig war, winkte den Aufseher zu sich. Scheine wechselten den Besitzer, der sie gelangweilt nachzählte.
„Er soll verschwinden.“
Der Andere nickte nur ausdruckslos und gab dem Fahrer eine Wegbeschreibung.
„Liefere ihn da ab, die wissen Bescheid.“
Der Fahrer schloss die Ladeluke, setzte sich ins Führerhaus und bewegte sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Außenbezirk.
Er merkte es nicht mehr, wie die Kugel durch das offene Seitenfenster pfiff und in der Schläfe ein hässliches Loch hinterließ. Der Wagen machte einen leichten Schwenker, dabei war er nicht besonders schnell. Die Tür der Fahrerseite wurde aufgerissen, ein anderer Schwarzer griff nach dem Lenker und wuchtete dabei die Leiche auf die Beifahrerseite. Dann erst setzte er sich richtig hinter das Steuer und korrigierte das Fahrzeug. Alles ging blitzschnell und war gut durchorganisiert. Er schob den linken Arm aus dem Fahrzeug und hob den Daumen. Ein Jeep setzte sich vor den Truck, und die Fahrt ging entspannt Richtung Kano. Penibel auf die richtige Geschwindigkeit und Verkehrssituation achtend, um nicht aufzufallen, durchquerte der Truck die Stadt, um im Norden in ein traditionelles Viertel einzufahren. Vor einer einfachen Hütte hielt das Fahrzeug, und ein in einem traditionellen Gewand gekleideter Mann trat in die Wärme der Sonne. Mit langen Schritten ging er um das Fahrzeug herum.
„Gut, gut, öffnet die Laderampe.“
Die Umstehenden beeilten sich, den Befehl auszuführen und schlugen die Plane hoch. Als sie den Weißen liegen sahen, deuteten sie aufgeregt auf die Ladefläche.
„Da liegt einer, Herr.“
Schnell enterte der Mann den Truck, ging auf Bodo Faller zu und schaute ihn an.
„Sollen wir ihn in die Wüste bringen?“
Der Mann überlegte kurz.
„Bringt ihn in die Hütte, holt einen Arzt und meine Tochter.“
Ohne zu antworten, nahmen die Männer den Verletzten hoch und schleppten ihn in die Hütte, die im westlichen Stil eingerichtet war.
„Da rein, legt ihn aufs Bett, dann verschwindet ihr wieder. Ihr wisst, was mit dem Truck zu tun ist?“
„Ja, Herr.“
So wie der junge Schwarze die Worte aussprach, zollte er dem anderen hohen Respekt. Ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern, setzte sich der große Schwarze in einen Korbsessel und dachte nach, als er von einer großen, überaus hübschen Frau gestört wurde.
„Papa, was ist denn jetzt schon wieder?“
„Galenia, ich habe da jemanden, der braucht deine Fürsorge.“
„Deine Gutmütigkeit wird dir eines Tages noch den Hals kosten.“
„Ich nenne es eher eine Spekulation in die Zukunft.“
„Im Nebenzimmer?“
„Ja, der Doktor kommt auch gleich.“
Die junge Frau öffnete die Tür und schaute hinein.
„Das ist ja ein Weißer.“
„Ich bin nicht farbenblind, Tochter.“
„Du weißt, Weiße machen uns immer Ärger.“
„Ich weiß, Tochter.“
„So, wie er aussieht, ist er in 24 Stunden tot.“
„Ist noch Leben in ihm?“
„Ein Fünkchen.“
„Dann mach ein Feuer daraus.“
In dem Moment kam ein Mann in die Hütte.
„Hallo, Paufilio, was kann ich heute für dich tun?“
„Morgan Tud, wir haben deine Hilfe lange nicht benötigt.“
„So, wie du aussiehst, brauchst du sie auch nicht. Vielleicht deine Tochter?“
„Du meinst Galenia? Ich brauche dich noch. Deswegen werde ich sie dir nicht zur Frau geben.“
„Das ist kein Argument, Paufilio.“
Sie horchten auf, als sie die Stimme Galenias hörten.
„Ihr beiden sollt nicht um meinen Körper schachern. Ich bestimme selbst, wen ich heirate.“
„Tja, Morgan Tud, das sind heute die selbständigen Frauen der Hausa. Aber beeile dich.“
Der Arzt verbeugte sich höflich vor Paufilo und ging in den angrenzenden Raum. Galenia war schon beim Patienten und hatte ihn ausgezogen. Es zeigte sich, dass beide ein gutes Team waren. Ohne die junge Frau zu begrüßen, wurde Morgan Tud gleich sachlich.
„Was hast du bis jetzt festgestellt, Galenia?“
„Stark dehydriert, am ganzen Körper blaue Flecken, aber keine Anzeichen eines Bruches. Innereien weiß ich nicht. Sorgen macht mir sein Kopf. Ich habe ihn schon gereinigt. Besser geht es nicht, er hat zu lange Haare, aber eine vernarbte Stelle auf der rechten Kopfseite habe ich bemerkt.“
Der Arzt fasste mit den Fingern über die Stelle und spürte eine schmale Eindellung.
„Sieht so aus, als hätte er einen mit dem Gewehrkolben bekommen. Schädelbruch, aber ohne Bruch der Nähte.“
Er griff in seine Tasche und holte einen Rasierer hervor.
„Während ich ihm eine Kochsalzlösung anlege, rasierst du seinen Kopf. Ich spritze ihm ein Schmerzmittel. Dann nimmst du ihm noch Blut ab.“
Schnell nahm die junge Schwarze den elektrischen Rasierer und schor dem Weißen mit schnellen Strichen den Kopf. Nur um die Wunde herum wurde sie vorsichtig. Paufilo stand am Türrahmen und beobachtete die beiden.
„So gefällst du mir, Morgan Tud. Wenn er transportfähig ist, kommt er zu dir.“
„Puls und Blutdruck sind recht normal, ich nehme ihn gleich mit.“
Galenia untersuchte die Stelle am Kopf und fühlte vorsichtig darüber. Aber der Patient zeigte keine Reaktion.
„Schneller harter Schlag, das hat ihn vor einem Schädelbruch bewahrt.“
Auch Morgan Tud untersuchte die Stelle.
„Was macht ein Weißer in diesem Zustand hier, Paufilo? Das ist Boko Haram Gebiet. Entweder Sie waren daran beteiligt, oder Sie wissen nichts davon.“
„Ich nehme eher das Zweite an. Von dem ersten wüsste ich. Wir haben ihn auf der Ladefläche eines Trucks gefunden, der zur Außenstelle des Gefängnisses unterwegs war.“
„Will ich gar nicht wissen, Paufilo. Sollen wir ihn melden?“
„Nein. Wie lange hat er die Verletzung?“
„Nach der Narbe zu urteilen, drei bis sechs Monate.“
„Es gibt kein offizielles Statement, dass ein Weißer fehlt. Da ist irgendetwas, was den Mann interessant macht. Wird er es überleben, Morgan Tud?“
„Wenn ich sehe, wie alt die Verletzung ist und dann die goldenen Hände deiner Tochter, dann hat er gute Chancen. Obwohl er ein Weißer ist, ist er ein zäher Bursche.“
Die Stimme Paufilos wurde hart und ließ keinen Widerspruch zu.
„Galenia, du sorgst für ihn und Morgan Tud, du machst ihn gesund. Mein Gefühl hat mich noch nie betrogen.“
Galenia ging an ihrem Vater vorbei, blieb kurz stehen und grinste.
„Dein kaufmännisches Gefühl, das Gefühl deiner Lenden, das Gefühl der Hausa, oder das Gefühl als Mafia Boss?“
Paufilo legte die Miene der Unschuld auf.
„Morgan Tud, wenn meine Tochter weiter über mich herfährt, bekommst du sie doch zur Frau. Was hat sich ihre Mutter nur dabei gedacht, als sie mich bat, auf das Kind aufzupassen? Die ganze westliche Erziehung taugt nichts, ich hätte sie nie studieren lassen sollen. Sie hat den Respekt vor mir verloren.“
Galenia, die genauso groß wie ihr Vater war, nahm seinen Kopf und gab ihm einen Kuss.
„Du wirst es überleben, Papa.“
„Da bin ich mir nicht so sicher, Tochter. Ich bin ja nicht mit Söhnen gesegnet. Und wer soll den Laden übernehmen?“
„Nimm einen von deinen Unehelichen, Papa. Da hast du genug zur Auswahl. Einige haben sogar studiert.“
Paufilo grinste nur hinter seiner hübschen Tochter her und machte sich seine eigenen Gedanken.
„Paufilo, er wird viel schlafen. Wenn er die Fahrt mit einem Truck übersteht, wird er jetzt die Fahrt ins Krankenhaus auch überstehen.“
Die beiden Männer gaben sich die Hand.
„Ich stelle ihm Wachen hin, Morgan Tud.“
Der Arzt nickte nur.
„Ma as Sal amah, Morgan Tud. “
“Ma as Sal amah, Paufilo.”
Deutschland, Flensburg
Langsam fand sich das Team um Bernd Rassmussen im Briefing-Raum ein, als letzte kam Pauline Chen. Mit einem umwerfenden Augenaufschlag, den Raum sichtend, ging sie gleich auf Dr. Karla Schmidt zu.
„Hast du Bernd schon gesehen?“
„Ich dachte, er hat bei dir übernachtet?“
Mit einem weiteren Augenaufschlag, Karla anschauend, meinte sie: „Hatte er auch. Aber nach der letzten Yoga-Übung klingelte das Telefon. Das war heute Nacht um drei Uhr, und da war er auch schon weg.“
Die Spitze kam schnell wie ein abgefeuerter Pfeil.
„Hat er eine andere Geliebte?“
Pauline tat absolut unbeeindruckt und antwortete schnell: „Dann schneide ich ihm sein bestes Stück ab.“
„Schmeiß es nicht weg, ich nähe ihn wieder dran.“
Pauline kam nicht mehr dazu zu antworten. Die Tür des Briefings-Raumes wurde aufgerissen, sofort machte sich gespannte Aufmerksamkeit breit. Es war äußerst selten, dass Bernd Rassmussen so in einen Raum kam. Groß und präsent lehnte er am Türrahmen und musterte jeden Einzelnen.
„Habt ihr was zu schreiben da?“
Alle nickten.
„Gut, Aufgabenverteilung. Pauline und Karla fliegen mit mir. Los verschwindet, in 30 Minuten ist Abmarsch nach Hamburg. Kleines Gepäck, Maximum 3 Tage. Pauline, nimm für mich Sachen mit.“
„Pelz oder Sonnenbrille?“
„Es geht nach Nigeria, vergesst eure Pässe nicht. Los, auf was wartet ihr noch? Ab die Post.“
Ohne eine weitere Frage zu stellen, verschwanden die beiden. Sie wussten, dass weitere Informationen folgen würden.
„Bille, du übernimmst hier die Leitung. Ruf bei Sergio an, wir brauchen Informationen über Benno Faller. Er arbeitet für ein virologisches Institut in Nigeria. Forschungsgebiet Ebola.“
„Scheiße.“
„Das kannst du laut sagen. Wenn du mit Sergio sprichst, ich brauche eine Wasserprobe aus Mekka.“
„Aus Mekka, du meinst doch nicht dieses Mekka?“
„Doch, dieses Mekka meine ich.“
„Grundgütige Scheiße, was geht denn hier ab?“
„Das willst du gar nicht wissen, Bille.“
In dem Moment steckte ein weiterer Angestellter den Kopf in den Briefing-Raum.
„Macht mal den Fernseher an. Nachrichten, sie haben den Assuan Staudamm gesprengt.“
„Er hatte Recht, es fängt an.“
„Bernd, klär uns auf, was fängt an?“
„Später.“
In diesem Moment klingelte das Handy von Bernd. Er stellte die Verbindung her.
„Rassmussen, hallo Georg, ja, ich habe es gerade gehört. Wir sind schon dran. Wir brauchen Tickets nach Nigeria. Mir egal, wie du das anstellst. Ja, es geht uns an. Was ich für Informationen habe? Zuerst ist der Assuan Staudamm dran, dann der Hoover Staudamm. Wir nehmen an, dass es nur ein Teil einer Versuchsreihe ist. Dann wird es ernst. Als nächstes wollen sie sich die Quellen von Mekka vornehmen, und was dann kommt, dazu können wir noch nichts Konkretes sagen. Wir brauchen alle Vollmachten, alles was nötig ist. Ich informiere die Amerikaner, alles weitere später. Ich tappe auch noch im Dunklen. Danke.“
Bernd unterbrach die Verbindung.
„Ihr habt gehört, was hier abgeht, größte Geheimhaltung. Bille, wir brauchen Wasserproben vom Nil, unterhalb des gesprengten Damms. Auch das sollen die Amerikaner machen. Sag Sergio noch, dass er sofort den Hoover Damm sichern lassen muss, er ist der Nächste, der dran ist. Ach ja, ich brauche Information über einen Paufilo aus Nigeria. Karl, du hilfst ihr. Bodo, du fährst uns nach Hamburg. Alles, was ihr erfahrt, direkt in Paulines Computer.“
„Alles klar, Bernd. Hast du schon einen zeitlichen Ablauf?“
„Nein, außer, dass der Hoover Staudamm morgen dran ist.“
Es dauerte keine 20 Minuten, als die beiden Frauen mit leichtem Gepäck wieder im Büro eintrafen.
„Wir können jetzt los.“
„Gut, Bodo wartet schon. Waffen lasst ihr hier. Wir bekommen neue, wenn wir in Nigeria sind.“
Sie hasteten zum Auto und stiegen ein. Kurz nachdem sie Flensburg verlassen hatten, klingelte das I-Phone von Bernd Rassmussen.
„Sergio hier. Hallo, Bernd. Bille hat mir wirres Zeug erzählt.“
„Hast du die Nachrichten noch nicht gehört, Sergio?“
„Doch habe ich. Was weist darauf hin, dass der Hoover Staudamm gesprengt wird?“
„Meine Information, Sergio. Ich bekam heute Nacht eine SMS von meinem alten Schulkollegen Benno Faller. Er ist Virologe in einem Institut in Deutschland und leitet das Institut mit dem Fachbereich Ebola in Nigeria. Es war eine komische SMS, als wäre er in Not. Er hat mir diese Details durchgegeben. Nr. 1 ist schon eingetreten. Nr.2 da seid ihr dran. Das Wasser wird vorher mit Ebola-Viren kontaminiert sein. Du weißt, was das beim Colorado bedeutet?“
„Oh, Gott.“
„Also, ihr verfolgt die SMS zurück. Sie kommt aus Nigeria. Mehr weiß ich aber auch nicht. So wie die Nachricht geschrieben war, stand mein Freund unter sehr hohem Stress. Wir werden Waffen in Nigeria brauchen.“
Es wurde einen Moment still.
„Ich melde mich gleich wieder.“
Die beiden jungen Frauen schauten Bernd verwirrt an.
„Das stimmt doch nicht, Bernd, oder? Wer ist so krank?“
„Es stimmt, und ich weiß es nicht.“
„Wie kommst du auf Benno Faller?“
„Ein alter Schulkollege von mir. Wir waren so etwas wie Blutsbrüder, und das bindet für das Leben.“
Pauline hatte in der Zeit am Lap-Top gearbeitet, in der sich Bernd und Karla unterhielten.
„Benno Faller, Virologe, Leiter des Virologischen Instituts in Nigeria, Hauptstadt Abuja.“
„Genau der, Pauline. Hast du noch mehr über ihn in deinem allwissenden Speicher?“
„Das Virologische Institut von Abuja, in dem er arbeitete, wurde vor fünf Monaten aufgegeben. Angeblich Sicherheitsbedenken, wegen der Gruppe Boko Haram.“
„Was wurde aus der Stelle von Benno Faller?“
„Steht nicht drin.“
Bernd überlegte kurz und drehte sich zu seinem Mitarbeiter Bodo Bauer um.
„Bodo, du fährst zu dem Institut. Pauline, wo ist das?“
„Berlin.“
„Du hast es gehört. Alles, was du dort über Benno Faller hörst, meldest du. Mach ruhig etwas Druck. Benno gibt nicht so einfach seinen Job auf. Er ist bodenständig und lebt nur für seine Forschung. Keine Angehörigen, keine Familie, nichts.“
„Wie langweilig.“
Konnte Pauline nur bemerken. In dem Moment klingelte das I-Phone von Bernd erneut.
„Sergio?“
„Planänderung, Bernd. Ihr fliegt nicht direkt nach Nigeria. Das dauert zu lange. Wenn ihr in Hamburg seid, bekommt ihr einen Lear Jet von uns, der bringt euch nach Niamey, der Hauptstadt des Niger, dort werdet ihr von den Franzosen in Empfang genommen, eingekleidet und bewaffnet. Dann fliegen sie euch direkt nach Kano. Da kam die SMS her. Du hast Pauline dabei?“
„Ja.“
„Dann übermittle ich ihr den Standort von Benno Fallers Handy.“
„Gut, wir halten dich auf dem Laufenden.“
„Noch etwas, Bernd. Ihr habt nur 12 Stunden, um den Mann zu finden. 12 Stunden halten die Nigerianer die Füße still, wenn die Franzosen ins Land kommen. Die Franzosen helfen euch dabei. Ihr bekommt ein kleines Sonderkommando mit.“
„Sag deinen französischen Freunden, nur in Zivil. Ich will keine militärische Aktion daraus machen. Ansonsten bin ich der Einsatzleiter, kein wenn und kein aber.“
„Gebe ich so weiter, Bernd. Die Nachricht müsste jetzt bei Pauline angekommen sein.“
Pauline nickte nur.
„Ok, wir hören von euch.“
Bernd unterbrach die Verbindung und steckte das I-Phone weg.
„Pauline, alle Informationen über Kano, Boko Haram und Paufilo.“
„Wird gemacht, Chef.“
Der Flug verlief ruhig und brachte keine neuen Erkenntnisse. Erst, als sie in Niamey landeten, stieß Pauline Bernd an.
„Bodo hat was.“
Bernd las das Schreiben sorgfältig durch. Karla hatte mitgelesen.
„Lass mich deine Gedanken erraten, da stinkt etwas.“
„Genau, Karla. Pauline, deine Analyse.“
„Warum sollten sie ein Forschungsinstitut in Nigeria dicht machen, wenn Ebola auf den Höhepunkt zusteuert und das Problem Boko Haram mehr den Norden Nigerias betrifft? Und zudem keine Informationen über Benno Faller zur Verfügung stehen. Klingt alles sehr merkwürdig. Sehr wahrscheinlich sind auch noch öffentliche Gelder im Spiel. Da macht man eine derartige Forschungseinrichtung nicht einfach dicht.“
Bernd schüttelte bestätigend den Kopf.
Als die Maschine stand, wurden sie von dem französischen Kommandeur empfangen.
„Hallo, Monsieur Rassmussen, ich begrüße Sie bei den Legionären im Niger. Ich bin Elias Delille. Sergio hat mich informiert, soweit er etwas wusste. Wir stehen zu Ihrer Verfügung.“
„Das ist sehr angenehm, Monsieur Delille, dass Sie deutsch mit mir sprechen. Mein französisch ist etwas eingerostet.“
„Nennen Sie mich Elias, Monsieur Rassmussen. Ich komme aus dem schönen Elsass, und da ist die zweite Muttersprache deutsch.“
„Ich bin Bernd, Elias. Das sind meine Mitarbeiter, Pauline Chen und Dr. Karla Schmidt.“
Der französische Kommandeur verbeugte sich höflich.
„Mademoiselle, es ist mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen.“
Bernd hatte schon die Nummer seines Mitarbeiters Bodo Bauer gewählt.
„Hallo, Bodo. Fühle der Bande noch einmal auf den Zahn. Nimm jeden einzelnen Mitarbeiter auseinander und verlange Personalakteneinsicht. Setz dich mit Staatssekretär Bauer in Verbindung, damit, wenn sie sich sperren, wir einen Durchsuchungsbeschluss bekommen. Sage ihm eindringlich, dass es um Ebola geht, das dürfte bei der Staatsanwaltschaft die Glocken zum Klingen bringen.“
Bernd unterbrach die Verbindung.
„Entschuldige, Elias, es war wichtig, wir dürfen keine Zeit verlieren.“
Elias Delille schaute Bernd Rassmussen gespannt und auch fragend an.
„Worum geht es denn, dass die NSA involviert ist, die Franzosen mitarbeiten dürfen und die Deutschen das Kommando haben?“
Bernd nahm den durchtrainierten Mann am Arm und führte ihn etwas abseits der Gruppe.
„Elias, streng geheim.“
Der Profiler zögerte noch leicht und gab sich dann einen Ruck.
„Es geht um Ebola als Waffe. Du hast vom Assuan Staudamm gehört?“
Der Franzose nickte, und Bernd erzählte ihm das, was er wusste. Elias hörte ihm geduldig zu und unterbrach den Deutschen nicht ein einziges Mal. Mittlerweile hatten sie den Hangar erreicht, und Elias schaute seinem Gegenüber in die Augen.
„In deiner Haut möchte ich nicht stecken, Bernd. Wir sollten keine Zeit verlieren.“
Sie öffneten den Hangar, an einem der Tische saßen vier weitere Legionäre und spielten Karten. Elias stellte Bernd und die beiden Frauen den Männern vor. Als die Legionäre die immer freundlich lächelnde Pauline sahen, die in ihrer zurückhaltenden Art nicht auf sich aufmerksam machte, sprachen sie ihren Chef an.
„Kommandant, mit den Weibern sollen wir nach Nigeria? Die stehen uns nur im Weg.“
Ehe der Elsässer antworten konnte, waren Pauline und Karla auf die Soldaten zugelaufen. Wie abgesprochen, entwaffneten sie gerade denjenigen, der ihnen am nächsten stand, schoben dessen Messer an die Kehlen der Verdutzten und die Pistole an die Schläfe des dritten und vierten Legionärs.
„Kommandant Delille, ihre Männer sind schlappschwänzige Hobbysoldaten. Was ist, wenn die Boko Haram kommen, kann man sich auf sie verlassen?“
Bernd kannte den Sinn der beiden für Emanzipation, deswegen hatte er mit einer Reaktion gerechnet und beachtete die beiden nicht weiter. Die Legionäre versuchten sich nicht weiter zu bewegen. Elias schaute belustigt auf die Szene, und mit weicher Stimme sprach er zu seinen Männern: „Ja, Leute, ich glaube, ich lasse euch hier. Die zwei Damen sind Schutz genug für Bernd und mich.“
Pauline schaute den Kommandanten auffordernd an.
„Monsieur Delille, dürfen wir sie umbringen?“
„Nur zu Mademoiselle, sie sind ihr Geld nicht wert und wenn sie die Kadaver in die Wüste geschleppt haben, dann können sie sich ihre Ausrüstung aussuchen.“
Karla schaute Pauline an.
„Das Wegschleppen ist mir zu anstrengend. Ich glaube wir lassen sie leben.“
Pauline nickte nur. Entspannte sich und entlud die Pistole, legte sie dann auf den Tisch vor sich und warf das Messer auf eine Holzplatte, die an der Wand hing. Mit einem trockenen Klack blieb die Klinge in einiger Entfernung in der Wand stecken. Etwas belämmert saßen die Elitesoldaten da und wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Karla, die sich zu Bernd stellte, beugte sich zu ihrem Chef und ehemaligen Freund.
„Na, Bernd, wie waren wir?“
„Wer hat dir das beigebracht?“
„Pauline, sie dachte, ich könnte etwas Training gebrauchen.“
„Verstehe einer die Weiber.“
Wieder an den Franzosen gewandt.
„Wo können wir uns umziehen?“
Elias zeigte ihm den Weg.
„Die Ausrüstung liegt bereit, sucht euch etwas aus.“
Die anderen waren schon vorgegangen und kamen in einen Raum, der vom Hangar abgeteilt war. Auf dem Tisch lagen Gewehre, Pistolen, Messer und Handgranaten. Pauline stand schon am Tisch und erklärte Karla die einzelnen Waffen.
„Ich sehe, dass die Damen sich wohl fühlen.“
Die vier Legionäre waren hinter den beiden Männern in den Raum gekommen.
„Los, zieht euch um, alle.“
Die Männer schauten ihren Kommandeur fragend an und deuteten auf die beiden Frauen. Auffordernd sprach der Franzose den Soldaten an: „Und was ist?“
Der Mann bekam einen hochroten Kopf, als er versuchte, seinem Kommandeur zu antworten, mit den Augen aber bei Pauline und Karla hing, die sich mittlerweile umgezogen hatten. Sie hatten sich aus einem Stapel Zivilkleidung die passenden Hemden und Hosen ausgesucht.
„Also, wir haben keine Zeit für solche Spielchen.“
Ohne seinen Chef noch einmal anzuschauen, eilten die vier an den Tisch, zogen sich um und versorgten sich mit Waffen. Bernd und Elias folgten ihnen und zogen sich auch um.
„Hast du die Koordinaten, Bernd?“
Der Profiler wandte sich an Pauline.
„Pauline, versorge Elias mit allen nötigen Informationen.“
Die junge Asiatin schlug ihr Laptop auf und gab dem Kommandeur die Informationen. Elias schaute sich die Position auf der Karte an.
„Kano, das kenne ich. Dann noch im traditionellen Viertel.“
Er schaute die Gruppe zweifelnd an.
„Was ist, Elias?
„Wir sind alle Weiße. Das ist das Territorium der Schwarzen. Von da aus lebt Boko Haram. Da kommen wir nicht ungeschoren raus.“
„Ich weiß, Elias, das macht die Sache doch so interessant.“
„Du hast eine seltsame Art von Humor. Wie willst du vorgehen?“
„Pauline, Satellitenaufnahme, bitte.“
Die junge Frau berührte einige Tasten und hatte schnell Kontakt.
„Ein russischer Militärsatellit ist momentan der einzige, auf den wir zurückgreifen können.“
„Beste Auflösung, Pauline.“
Wieder arbeitete die junge Frau schnell und effizient. Bald erschien auf dem Bildschirm ein größeres, gemauertes Haus, das im Stil einer Hütte gebaut war.
„Das ist unser Ziel.“
„Also, wie willst du vorgehen?“
„Traditionell, Elias, ohne großen Aufwand. Zwei dieser kleinen Maschinengewehre im Hubschrauber und eine Kiste voll mit den Handgranaten.“
Dabei zeigte Bernd auf eine Kiste und sprach weiter: „Der Pilot mit Co-Pilot und zwei deiner Männer bleiben in der Maschine, setzen uns ab, und wir gehen den Rest zu Fuß. Dabei bleiben deine Leute in der Maschine in 50 bis 70 Meter Höhe über uns. Karla, verteile bitte die Ohrmikros.“
Der Kommandeur griff in seine Brusttasche und holte ein eigenes Mikro heraus.
„Vergiss dein Mikro, Elias. Wir platzieren noch einen Störsender im Hubschrauber. Unsere sind darauf abgestimmt. Das wird eine besonnene Aktion. Kleine Bewaffnung, aber ausreichend Munition. Wir werden auf diesem Platz abgesetzt.“
Bernd zeigte auf einen großen Platz, der 100 Meter vom Zielort entfernt lag.
„Dann gehen wir die Straße entlang, direkt zum Haus.“
„Das klappt nie, Bernd.“
„Elias, wir wollen Informationen haben, keinen Krieg entfachen.“
Karla legte vorsichtig ihre Hand auf den Unterarm des Kommandeurs.
„Vertrauen Sie ihm, er hat seine eigene Art, an so eine Sache heranzugehen.“
Elias schaute Karla tief in die Augen.