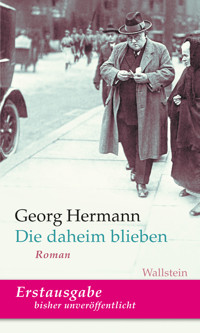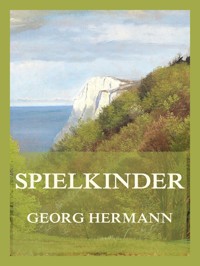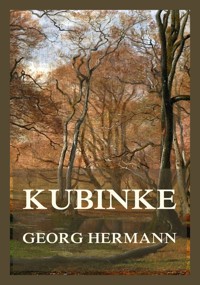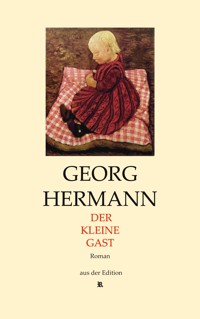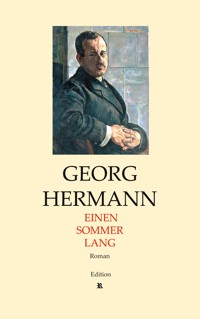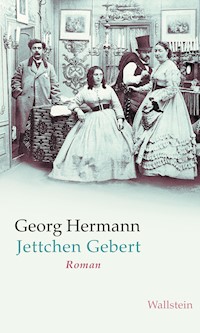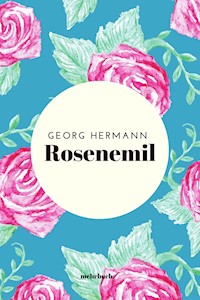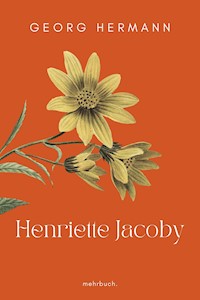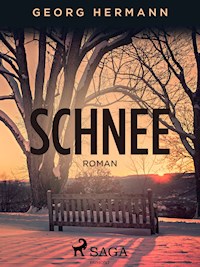Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Georg Hermanns neben "Jettchen Gebert" wohl berühmtester und wichtigster Roman spielt kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert im Berlin des Ganoven-, Zuhälter- und Dirnenmilieus. Emil Lehmann, wegen seiner Vorliebe für Rosen "Rosenemil" genannt, verdient sich als Vertreter für Trivialromane einen kümmerlichen Lebensunterhalt. Das ändert sich, als er Lissi Morgen trifft, als Prostituierte unter dem Namen Polenliese bekannt und begehrt. Die Polenliese führt in nun in die Berliner Unterwelt ein. Er übernimmt die Rolle ihres Beschützers und sammelt erste kriminelle Meriten, als er eine Bewährungsprobe als Einbrecher mit Bravour besteht. Als er eines Tages die Diamantenberta kennenlernt, eine Edelhure, die mit ihren Diensten für die bessere Gesellschaft Berlins reich geworden ist, verlässt er die gutmütige Polenliese, die diesen Kummer nicht überlebt und Selbstmord begeht. Aber auch für den Rosenemil wendet sich bald das Blatt und die rosigen Zeiten nehmen ein Ende ... Georg Hermanns naturalistisch geprägter und von Gerhart Hauptmanns berühmten naturalistischen Werken sowie von Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" beeinflusster Roman besticht durch seine präzisen Milieubeschreibungen und durch seine Schilderung der Großstadt Berlin in einer bewegten Zeit und bietet noch heute eine faszinierende Lektüre für jedermann.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Hermann
Rosenemil
Roman
Saga
Rosenemil
© 1935 Georg Hermann
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517260
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com.
Eigentlich waren »die Linden« durchaus nicht das, was man von ihnen erwartete und was sie zum Traum jedes deutschen Patrioten in jeder kleinen Stadt zwischen Elbe und Weichsel machten. So wenig damals wie heute. Seit hundert und mehr Jahren sprach man von ihnen, als ob sie wunder etwas wären. Man besang sie zur Tagesund Nachtzeit, in Berliner Briefen und in Calots Manier und in Hunderten von Couplets aus den Berliner Possen.
Aber die alten niedrigen Häuser hüben und drüben waren, bis auf ein paar, wirklich nichts besonderes. Außerdem, wenn man nun da dachte, es wären hier an dem breiten Mittelweg und am Reitweg ausgesucht alte und schöne Lindenbäume, die hoch und dicht und laubschwer in die Luft stiegen, und ihre Schattenzelte über die ganze breite Prachtstraße hinwarfen über Mittelweg, Reitweg und Fahrdämme bis zu den Häuserreihen, so war keine Rede davon und das Ganze ein Reinfall.
Und das komischste weiterhin war: es waren gar nicht alles Linden. Es waren Roßkastanien darunter und auch Rüstern.
Gott ja ... vielleicht, daß die Bäume mit den Jahrhunderten und Jahrzehnten die Stadtluft nicht mehr vertragen hatten, die immer dicker und rußiger geworden war. Vielleicht, daß der Boden um sie zu hart und unzuträglich wurde, und daß dann noch später, nach 1830, die Gasrohre den Wurzeln schadeten. Vielleicht auch, daß man es noch viel später nicht heraus hatte, wie man solchen Stadtbäumen inmitten der Straße mit ihrer Schildkrötenschale von Asphalt und Granit Wasser zuführen konnte. Möglich auch, daß sie vorzeitig morsch wurden und mit abfallenden Ästen dann den Verkehr gefährdeten und entfernt werden mußten. Genug also – es waren zwar noch einige Wahrzeichen an alten, ehrwürdigen und schönen Bäumen dabei, die sich aus ihrer dünnen Jugend erinnerten, wie der alte Fritz auf seinem weißen Condé unter ihnen, Schritt vor Schritt, von den Jungens umtobt, dahergezockelt kam, wie Jumbo auf seinen Schimmel bei Brökmann in Affentheater. Aber die meisten Linden und Bäume überhaupt hier »Unter den Linden« ... das Gros hier waren Kümmerlinge ... Kümmerlinge mit schlechten, verbogenen Ästen ... Mieker, die spät grün wurden und dünn, dürftig und zerzaust blieben, und die sehr früh schon, wenn draußen noch niemand von ihren Brüdern daran dachte, wieder gelb wurden und kaum viel später dann auch schon wieder kahl waren. Jene im Tiergarten, hinten jenseits des Tors, und die langen Baumzeilen der Charlottenburger Chaussee waren darin ganz anders.
Seitdem aber, und das war noch nicht lange, nicht viel länger als ein Dutzend Jahre, die großen Monde der Kohlenstiftlampen zur Nacht ihren grellen Mondschein und die Schattenmuster der Blätter über dem Asphalt spielen ließen, wurden die früh erkahlten Bäume sogar jeden Herbst ein zweitesmal wieder munter und trieben aus den Zweigenden – wenn auch vereinzelt und dürftig – wiederum lichtgrüne Blattfächer, die sich gar keine Zeit mehr nehmen konnten, von neuem gelb zu werden, sondern die, wie sie waren, von ihrem Großstadtschicksal ereilt wurden, also: an dem ersten Frostabend wieder abfielen. Und kaum nach zwölf von den rollenden Straßenbürsten zusammengefegt und gegen die Bordschwellen gestoßen wurden, um des morgens um fünf dann, von den Kolonnen der Straßenkehrer zu Haufen getrieben, und vor sechs schon, in eine braune Sauce von Schlamm gehüllt, von den Kehrichtwagen weggebracht zu werden. Wirklich ein Großstadtschicksal.
Also die Linden jedenfalls hatten nichts von dem, was sich der Provinzfremde von ihnen erträumt und was sich für ihn von früh an mit dem Namen »Unter den Linden« verbunden hatte, nämlich: markiges, stolzes, traditionsschlichtes Preußentum, das sich nunmehr über Kurfürsten, Könige und Kaiser, Blüchers, Bismarcks und Moltkes hoch gehungert hatte bis zum historischen Eckfenster, hoch gehungert zu einem mächtigen und einem großmächtigen Deutschland mit Handel, Heer und Flotte in zweihundertjähriger, ruhmreicher Geschichte. Denn Geschichte – was die wenigsten wissen – ist immer ruhmreich; und je blutiger sie ist, desto ruhmreicher ist sie.
Das historische Eckfenster nebenbei war ... trotzdem die Fremden da immer noch einen Augenblick stehenblieben und hinaufsahen, als glaubten sie das nicht ..., schon vor fünfzehn Jahren leer geworden und trug somit jetzt erst seinen Namen mit Recht. Denn Geschichte ist zumeist – was auch die wenigsten ahnen! – Vergangenes und ein leerer Rahmen, dessen Inhalt sich unwiderruflich verflüchtigte.
Ja – und wer etwa, als Provinzfremder, nach seiner Zeitung sich fürder in dem Glauben wiegte, daß hier die Linden herunter Tag und Nacht Eleganz und Reichtum, Hof und Gesellschaft, Wissenschaft und Künste sich ein Stelldichein gäben, vornehme Engländer und andere Exoten mit lordhafter Gelassenheit in Smokings von Pool durch das Gewühl flanierten, aus den Reihen der Equipagen die Damen von Welt den grüßenden Gardeoffizieren aller Farben und Ränge, vom Generalfeldmarschall aufwärts, zulächelten, und die internationale Diplomatie in großer Gala mit ihren tiefdekolletierten Ladies egalweg zu Empfängen fuhr oder von solchen sich hinwegbegab ... große, aber schlichte Parlamentarier dazu auf der stillen Seite gedankenvoll dahin trippelten, und daß die Bankgewaltigen der nahen Bankburgen aus der Behrenstraße zwischen ihren weltumspannenden Finanzplänen auf der Gehseite etwas frische Luft schöpften und sich zu ihrer Erholung ein wenig mit den Koryphäen der Wissenschaft – Mommsen, Treitschke, Dubois-Reymond, Virchow und Helmholtz – grade über die letzten Ergebnisse ihrer Forschungen unterhielten ... was ihnen nebenbei um 1903 schon schwer gefallen wäre, es sei denn, sie hätten deren Geister zitiert ... also, wer als Provinzfremder sich in diesem Glauben wiegte, der schmeichelte sich, wie Glasbrenners Schusterjunge, einer Irrung. Und wer hingekommen war, um den jungen Kaiser zu sehen ... das heißt, er war das vor fünfzehn Jahren gewesen, und nun war er gerade im besten Mannesalter ... wer also aus Zossen gekommen war, um den Kaiser zu sehen, und nun glaubte, daß er im Husarendolman an der Spitze einer muntern und bunten Kavalkade von jungen Prinzen und Adjutanten täglich fünfmal die Linden herauf- und heruntersprenge, oder huldvoll aus einer Kalesche mit betreßten Lakaien vorn und hinten dem stets jubelnden Volke zuwinkte, der mußte sich, sofern er nicht sehr viel Glück hatte, in seinem kaisertreuen Provinzgemüt bitter in solchen Hoffnungen enttäuscht sehen. Und wenn er etwa meinte, daß dort Reihen stolzer, weiß- und weitleuchtender Marmorbänke ihn einluden, sich etwas auszuruhen, so mußte er schon eine Viertelstunde weiter bis zur Siegesallee gehen, um in solchen edlen, aber kühlen Schönheiten zu schwelgen. Nein, die Bänke hier unter den Linden waren besonders alt und erbärmlich, lang, schmal, morsch und ohne Lehnen meist ... der Verschönerungsverein zu Hause in Zossen hätte sich geschämt, solche Bänke hinzustellen, und so er solche vordem erstellt hätte, so hätte er sie längst zu Brennholz zerhacken lassen. Und ein derart armseliges Gesindel, wie es sich da auf den Bänken breit machte, hätte dort in der Hauptstraße, ja sogar in der Bahnhofstraße die Polizei nie geduldet.
Das konnte draußen auf ’n Kietz bleiben, aber doch nicht da, wo der ganze vornehme Fremdenverkehr von Zossen hindurchströmte.
Wirklich, was da alles herumsaß, war keine Zierde. Ein Paar bartstoppelige, verbummelte Studenten, die zwar den Weg bis an die Universität, aber nie bis in sie hinein mehr fanden –; vor allem, wenn die Sonne schien und es, wie heute, nicht regnete. Grau und schwammig, oder klein, dürr und stoppelig waren sie ... je nachdem, ob sie erst beim Bier oder schon beim Fusel waren. Studenten noch aus der Hartlebenzeit mit verknautschten Havelocks, unter denen sie keine Jacke mehr hatten, da die grade in der Jägerstraße bei Peten Nachhilfestunde hatte. Mit zerknautschten Bibis mit durchgeschwitzten Huträndern und -bändern und buntmeliert von Wind und Wetter. Solche, die ewig einen Packen von Bibliotheksbänden unter den Arm geklemmt hatten, die sie wiederbringen mußten, und in die sie nie hineingeblickt hatten. Oder, wenn sie es getan hatten, aus denen sie nie etwas Verwertbares herausgelesen hatten.
Ein paar Soldaten auf Urlaub, die dumm um sich glotzten, waren es. Und Nutten mit Augenringen und Dauerlächeln von drüben aus der Passage, die eine Arbeitspause machten, Siebzehnjährige, auf dreizehn zurechtgemacht, in zu kurzen Sommerfetzchen und Rubenshüten aus lichtblauem Samt, der angeschmuddelt war wie eine Prager Kaffeehausgardine. Strichjungen von vorn auf den Tiergartenbänken vorm Tor waren es, die jedem Passanten, in dem sie einen Fremden vermuteten, frech zuzwinkerten und nachzwitscherten ... Strichjungen mit geschminkten Köpfen aus den Schaufenstern der Friseure. Mit kleinen frechen Strohhüten und Baubaujäckchen und gebundenen Lavalliers unter den breiten Kragen der Etonboys, Strichjungen, die eben auch mal die Wache aufziehen sehen wollten.
Und dazwischen zwei oder drei jener alten, dicken verschlampten Halbirren – das heißt, sie waren eigentlich Ganzirre; aber da sie niemand etwas taten und harmlos waren, weder bettelten noch Leute belästigten, sich eben nur zeigten (wenn sie auch manchmal die Kinder beschimpften, die hinter ihnen herzogen), so lag kein Grund vor, sie einzusperren! – also zwei, drei jener verwebbten, alten, komischen Frauensbilder, die, Gott weiß weshalb, grade in dieser Gegend zwischen Passage, Linden und Friedrichstraße, vor Habel und Kranzler, Tag und Nacht mit ihren Röcken, die aus verschollenen Türkenschals geschnitten waren, mit ihren pelzbesetzten Capes aus längst vergangenen Tagen, die verknautschten Morcheln von braunem Stroh mit violetten Seidenschleifen schief auf dem grauen Dutt, der wie ein Wollknäuel verfilzt war, und vor allem mit ihren riesigen, bestickten Pompadours, die bis zum Überquellen mit allerhand Lumpenzeug gefüllt waren, und mit mysteriösen Bündeln alter Zeitungen, die mit Bindfaden umschnürt waren, und die sie ängstlich, als sollten sie ihnen entrissen werden, unter den Arm geklemmt hatten. Ja, die waren es, die also hier, und grade hier, in mehreren Exemplaren gleich, und nirgens sonst in dem weiten Berlin, wohl von irgend welchen fixen Ideen beherrscht, viele Stunden am Tag auf und ab wandelten, um sich dem Volke zu zeigen. Sie waren keineswegs klein und verhutzelt etwa, sondern groß, dick und schwammig, stumpf und von tierischem Ernst, mit ledernen, faltigen Gesichtern, in denen nie auch nur das Wetterleuchten eines Gedankens aufzuckte, und hinter deren winzigen Augen der bodenlose Abgrund des Nichts unheimlich heraufdämmerte. Jetzt aber hatten sie wohl ihre täglichen Bahnen noch nicht aufgenommen, saßen hier auf den Hungerbänken und mimmelten Brotstücke in sich hinein.
Zwischen Pennbrüdern saßen sie, die aneinander gelehnt, mit offenen Mündern – aber Sohle und Oberleder klafften bei ihnen noch mehr auseinander und ließen armselige verbundene Füße sehen – mit offenen Mündern schwitzend schliefen. Denn sich auf die Bank legen, wie sie es gern gewollt hätten, durfte man ja hier doch nicht – da kam gleich der Blaue und zog einen hoch. Aber gegen so’n bißchen einnicken konnte er doch nichts haben. Der Mensch kann doch müde sein! Und wenn eben der eine nach rechts fallen wollte, so legte er sich automatisch wieder nach links an und schlief weiter. Und wenn der andere nach links fallen wollte, so lehnte er sich automatisch wieder rechts an und schlief gleichfalls weiter. Wenn man lange Zeit auf Bänken schläft, lernt man so etwas.
Ja, und auf den Bänken saß eigentlich sonst niemand. Doch – ein paar armselige Kontrollmädchen aus dem Westen, die vom Alex – daher der Name Kontrollmädchen – von der Kontrolle kamen, und ohne Hut, als Dienstmädchen, entschminkt und grau, simpel angezogen in Kattunkleidern, jetzt auf dem Heimweg die langen Linden herunter und durch den Tiergarten bis nach der Schwerinstraße sich etwas ausruhten. Sie saßen da in Sonne und Blattschatten und stellten staunend fest, daß es am Vormittag auch ganz nett auf der Straße mal war. Und dazwischen so Achtgroschenjungens und Krimis. Aber die kannte jeder hier von denen da auf den Bänken, weil sie jeden Tag kamen. Denn die Linden mußten immer nach verdächtigen Königsmördern abgesucht werden, ehe der Kaiser durchfuhr. Weil das Leben eines Monarchen doch heilig ist und nicht genug vor der Liebe seines Volkes geschützt werden kann.
Auf den Stühlen aber zwischen den Bänken, denn da gab es auch Stühle, kleine, altmodische, eiserne, gelbgestrichene Stühlchen, wie sie bei den Pariser Lokalen draußen stehen – auf den Stühlen saßen Pärchen und allerhand bessere Leute, die sich schon deshalb für feiner hielten, weil sie eben auf den Stühlen saßen und außerdem nicht zwischen denen da sitzen wollten, wo sie ja doch nur etwas fangen könnten. Aber sie taten meistens unfreundlich-überrascht, wenn der Wärter mit seinem Drahtstecken (er suchte auch hier Papier auf) angehumpelt kam, und ehe jene noch aufstehen konnten, von seinem Block einen Schein riß, auf dem schwarz auf weiß zu lesen war, daß die Benutzung dieses Stuhls einen Sechser kostete. Aber wenn sie bezahlt hatten, machten ihnen meist die ganzen Linden keinen Spaß mehr, und sie standen dann auf, und sie hingen sich ein, und sie gingen weiter. Im Tiergarten, der dahinten zwischen den Säulen des Brandenburger Tores grün verdämmerte, war es hübscher und kostete auch nichts.
Nein, ich vergaß, richtige Kolporteure saßen da auf den Hungerbänken, mit Wachstuchtaschen voll mit Gesundheitstee, Modeblättern und Probeheften von dem Fortsetzungsroman, die, das ahnte die Abnehmerin der »Verfolgten Gräfin« gar nicht, sofern sie ein Zettelchen – nur der Form wegen, damit es seine Richtigkeit hätte, wenn er übermorgen käme, das Heft wieder zu holen, wie der lustige, redselige junge Mann behauptete –, die, wenn sie also dieses Zettelchen unterschrieben hatten, vor Gott und Menschen und Gerichten sie zwangen, auch die übrigen neunundvierzig Hefte der »Verfolgten Gräfin«, das Stück zu zweieinhalb Silbergroschen, abzunehmen. Für das Geld hätten sie sich den halben Fontane kaufen können. Aber sie wollten das ja gar nicht, und sie fühlten sich viel besser bei der »Verfolgten Gräfin«, und so waren sie letzten Endes doch nicht betrogen. Außerdem hätten sie ja lesen können, daß auf dem Zettel, den sie unterschrieben hatten, ganz unten, ganz fein, in Diamantschrift stand: Mündliche Abmachungen haben keine Gültigkeit.
Ja, was sollte er denn nu machen, überhaupt?! ... Denn mit der »Verfolgten Gräfin« war es auch Essig. Nicht ein Heft hatte er heute vormittag – und dabei war Sonnabend sonst kein übler Tag – unter die Leute gebracht. Nicht einen einzigen Dummen hatte er gefunden. Und dabei hatte er – die Hacken tun mir noch weh – die ganze Fidizinstraße, Haus für Haus, Tür für Tür, bis in den dritten Hof, bis in den vierten Stock mit abgeklappert. Und vormittags ist doch die bessere Zeit. Da sind die Männer nicht da. Nich mal aufgemacht hatten die meisten. Und ehe er nur ein Heft aus dem Wachstuch genommen – denn man muß erst schmusen –, da hatten sie ihm die Tür vor der Nase zugeschmissen, und er stand wieder draußen, wie Nulpe. Nee, da in der »Verfolgten Gräfin« lag auch kein Geschäft mehr drin für einen jungen Menschen, wie er einer war. Das hat keine Zukunft nicht. Das kann vielleicht noch was für den ollen versoffenen Mann da drüben sein mit seiner Wachstuchmappe – das is sicher auch einer aus de Branche! –, aber nich für einen Menschen, wie ich bin.
Und mit Brennerts Gesundheitstee sah ja die Sache noch viel belämmerter aus, da traute er sich gar nicht mehr unter die Leute mit. Da warnte man schon öffentlich in de Zeitungen vor. Da sollten sogar ein paar Todesfälle vorgekommen sein. Also der Tee war jut. Von den Tee konnte das nich gekommen sein. Wenn einer sterben will, sterbt er auch so. Und außerdem sterben ja bei de Ärzte genug Leute, die gar nicht gleich sterben brauchen. Gut war der Tee. Er hatte ihn zwar nicht probiert – die »Verfolgte Gräfin« hatte er auch nicht gelesen (so’n Quatsch las er gar nicht) –, aber was sollte er auch mit dem Tee? Gesund war er ja Gott sei Dank. Fehlen tat ihm gar nichts. Wär auch schlimm, wenn ihm mit sechsundzwanzig schon was fehlen würde. Naja, zum Militär genommen hatten sie ihn nicht, aber das war Zufall. Sie brauchten an dem Tag grade keine mehr. Und er war mit unter de letzten, die sie untersucht hatten. Wenn sie ihn angemustert hätten, hätte er gesehen, daß er gleich die Knöpfe kriegt und kapituliert, hätte seine zwölf Jahr runtergerissen und wär bei’s Gericht gegangen. Er hat schon in de hundertsiebenunddreißigste eine besonders schöne und schwungvolle Klaue geschrieben. Überhaupt war er immer in der Klasse prima gewesen. Naja, zu seinem Beruf, da kann man eben nur helle Leute mit Rednergabe gebrauchen. Gott sei Dank, er war weder auf den Kopf, noch auf den Mund gefallen. Aber da bei’s Militär hätte er sicher auch ein gutes Leben gehabt. Da is noch keiner verhungert. Da sorgt Willem für.
Und nu mit einemmal: jetzt kam und kam er nicht mehr raus aus dem Schlamassel. Wat hat man denn for’n Leben vor sich! Und was hat man so in de letzten Jahre for’n Leben gehabt? Eigentlich bin ich doch verdammt runtergekommen. Nicht nur in de Kleidung. So’n blauer Anzug wird auch nich besser, wenn man ihn so alle Tage trägt. Und der Strohhut; wenn er noch ’n paarmal so von Regen durchgewaschen wird, da is doch de Krempe hin. Länger wie zwei Sommer hält so’n Hut von Tietz nich. Oder ist es sogar schon der dritte? Und einen neuen Jummikragen hätte ich auch schon wieder haben müssen. Das einzige is, daß man sich noch am Körper sauber hält.
Und von de Stiefel will ich janich reden. Naja, des sieht man nich so, weil des Oberleder noch jut aussieht; aber vorgestern bei dem Guß in de Schwiebusserstraße, bis ich in de Kneipe gerannt bin, hab ick jedacht, ick laufe in zwei Fußbäder.
Wenn ich jetzt mal einen von meinen alten Brüdern treffe aus dem Schönhauser F. C., denn tue ich, als kenn ich se nich. Denn sie tun ja auch, als ob sie mir nich kennen ... Wer mich jetzt so sieht, kann sich auch nicht vorstellen, daß ich noch neunundneunzig noch Mittelstürmer beim Schönhauser F. C. gewesen bin, und daß die janze Bande ohne mich beim Verbandsspiel kläglich hinten abgerutscht wäre. Ick hör noch heute, wie der janze Platz schreit: »Lehmann! Lauf, Lehmann! Feste! Feste!« Und die andern haben einfach nur: »Emil!« geschrien. So beliebt war ich. Und dabei war eine Bullenhitz. Da is heute Dezember dagegen.
Und beim Gauturnen in Bernau habe ich für meine Riege in Kür zwei Kränzemir geholt. Zehn Punkte haben gerade gefehlt, und wir hätten den silbernen rausgstochen. Daß sie ihn aus die Naunynstraße damals gekriegt haben, das war einfach Schiebung gewesen. Und heute! ... Heute brächte ich nich mehr ’ne einfache Kippe zusammen. Naja, des wohl schon, aber – ob auch eine mit ... eine mit Untergriff, des wäre doch mehr als fragwürdig, Emil Lehmann! Von de Sturzwelle will ich janich reden.
Denn der junge Mensch da, der Kolporteur auf der Hungerbank zwischen den beiden verbummelten Studenten mit den Bücherpakken und in den Havelocks, dem Schwammigen, der noch beim Bier war (wenn auch bei niederen Sorten), und dem kleinen Spitzigen, der schon beim Fusel war (wenn auch erst bei besseren Sorten), der junge Mensch, der da saß, der hieß Emil Lehmann. Nach seiner Mutter, die Auguste Lehmann, oder richtiger die lahme Juste, denn sie war etwas kreuzlahm und ging wie eine Pfeffermühle, gerufen wurde und Krawattennäherin gewesen war. Aber das war nun auch gewesen. Wie sie damals dann, wo er nicht da war: damit hatte ja die Sache angefangen: er dachte nicht gern daran – sechs Wochen hatte er in Alt-Moabit in Untersuchung gesessen. Auf ne falsche Anzeige hin: er sollte das Geld, die hundertfünfzig, aus de Vereinskasse geklaut haben. (Und dabei war das bestimmt der Krutowski, der ihn angezeigt hatte, selbst gewesen, der falsche polnische Hund, der! Der is sicher nach ihm nochmal zurückgekommen, so daß er gar nich der Letzte war, denn er hat ja auch den Schlüssel zu gehabt.) Behandelt hatten sie ihn in Moabit wie ein Stück Mist. Und nachher hat’s einfach geheißen, er kann nun wieder gehen. Die Verdachtsgründe reichten nicht aus zur Erhebung der Anklage. Sowie der Mensch dem Staat in die Hände fällt, denn is er eben geliefert. Also, daß se damals, als er nich da war, nach de Charité gekommen war. Un nachher hat man ihm nich mal sagen können, wie er rauskam, wo se lag. Das hätte ja nu nich sein brauchen. In ihrer Art is se jut gewesen. Und seitdem is das immer mehr mit mir runtergegangen. Und jetzt weiß ich bei Gott nich mehr, wovon ich heute mein Schlafgeld bezahlen soll. Vorige Woche bin ich schon mit de Hälfte hängen geblieben.
Und Emil Lehmann, der Kolporteur, starrte mit seinen sehr braunen und großen Augen den langen Mittelweg mit den Baumreihen hinunter, ganz dahinten hin, über all die Menschengruppen und Einzelgänger fort, die sich in der Sonne durcheinander schoben, auf das Brandenburger Tor, das da ganz hinten wie ein durchbrochenes Türschloß mit seinem wuchtigen Säulengefüge lag, und über dem die Nike die Rosse ihrer Quadriga als ein heroischer Schatten auf dem lichtblauen, von Wolkenfedern leichtbewimpelten Sommerhimmel dahinlenkte ... starrte dahin, als ob da irgendwo zu lesen wäre, was er nun eigentlich in dieser Welt mit ihrer Milliarde Menschen, und in diesem Berlin mit seinen bald drei Millionen Menschen, die hier durcheinanderwimmelten, und von denen doch jeder, oder fast jeder, wußte, wo er hingehörte – eigentlich da nun machen sollte!
Ob man nun als fliegender Händler mehr verdient wie als Kolporteur? Ach Gott, det sieht nur so aus; und alle Nase lang hat man mit de Polizei Krach; nee, des hat och keene Zukunft für mich. Um Weihnachten, so drei Wochen, geht so vielleicht der Laden, und die janze übrige Zeit kann man ebensogut in den Rauchfang kieken. Jott ja, Spaß ja würde das machen. Emil Lehmann sah sich so deutlich und bildhaft selbst auf dem Hausvogteiplatz stehen: »No passen se mal Achtung, meine Herrschaften! Hier sehn Sie mein’n Patent-Porzellan-Universalkitt ... da kann ein Wagen drüberfahren ...« Naja ..., das würde wohl schon mehr Spaß machen, als immer so den ganzen Tag det Treppengeländer mit den Rockärmel scheuern ... Aber des sieht auch nur so aus! Und denn kommt der Blaue un sagt: »Jehnse weiter, machense mir hier keine Schwierigkeiten!« Ein Jeschäft liegt auch nicht drin. Des hat keene Zukunft für mich. Und wenn ick det wirklich zum Winter mit aufnehme, davon kann ick noch lange nich heute mein Schlafgeld zahlen.
Der Kolporteur drehte sich um, stierte jetzt nach der anderen Seite hin. Da hinten, wo sich die Baumwipfel teilten, ritt auf seinem braunen breiten Ofen der alte Fritz zur Stadt hinein, auf den dicken roten Daumen des Rathausturms zu, ganz dahinten. Seit siebzig Jahren tat er das und kam doch nicht weiter. Aber da war auch nirgends zu lesen, was er eigentlich machen sollte.
Wenn er nu hier jetzt so zwanzig, dreißig Scheine selbst unterhauen würde, das würde keiner merken. Handschriften konnt’ er ne Menge machen ... und Namen erfinden ... Dutzende, soviel se wollten, und denn sich von de Kasse de Zaster einfach noch ein letztes Mal dafür abheben, und dann sich dünne machen und türmen ... Nee, nee ... Drei hatte Schultze schon verknacken lassen in der Zeit, wo er für ihn reiste ... Nee, nee, det kann man ooch nich machen. Und Vorschuß auf Provision jibt’s nich!
Der Kolporteur drehte sich nochmal um, stützte die seltsamen, kleinen, aber sehr kräftigen und leicht rötlich behaarten Hände auf die Knie und starrte gerade vor sich hin ... da drüben auf die Ecke der Friedrichstraße. Und so groß da auch Loeser & Wolff stand, er sah es doch nicht ... Ja, er sah da eigentlich ganz etwas anderes, er sah da oben, wo die goldenen dicken Buchstaben »Loeser & Wolff« auf dem Schilde saßen, und über dem Geschiebe der Omnibusse, die sich in der schmalen Friedrichstraße – und gerade hier war sie besonders schmal – drängten, und deren Verdecke – denn heute fuhren alle oben – dicht besetzt waren und bunt vor Menschen in der Mittagssonne flirrten – bis weit, bis zum Viadukt der Stadtbahn hin, auf der gerade eine schwarze und lichtumspielte Lokomotive hielt und weißen Dampf in das Blau des Himmels zischen ließ und stoßweise in Ringen und Wolken hinaufrauschte, der langsam, aber fröhlich zerflatterte –, gerade da über der Ecke sah er, gleichfalls wie aus Rauch geformt, aber nicht heiter und zerflatternd, sondern groß, grau und scheußlich, seine Schlafmutter, die Radowski’n aus de Zingststraße.
Des also war das Letzte: Jott – er hätte ja auch mit ihr eigentlich was anfangen können! Sie hat schon manchmal sone Andeutungen zu ihm gemacht; und denn hätte sie des eben mit’n Geld nich so genau genommen. Denn for die Liebe tut sone olle Person allens. Aber es soll doch schon mal vorgekommen sein, daß ein Mann mit eene Frau, die seine Mutter sein könnte ... ja, und nachher schmeißt einen Radowski raus, und man hat auch nischt. Und wozu des? Der olle Radowski kann enem schon so leid genug tun. Aber im gleichen Augenblick schien es ihm, als ob die da oben bei »Loeser & Wolff« sich bewegte. Als ob sie mit einem Scheuertuch herumwirtschaftete und dabei auch nicht viel anders wie ein Scheuerlappen aussah. Nur daß man, daß man sie nicht auswringen konnte. Dazu war sie zu dick. Nee, nee, sowas faß ick doch nich mit ne Feuerzange an. Und der Kolporteur wußte nich: wurde ihm so grün um den Magen, weil er an sein Schlafgeld gedacht hatte, oder weil er seine Schlafmutter so greifbar und traurig deutlich da oben schweben sah. Oder weil er seit halb sieben nich einen Happen mehr in den Leib gekriegt hatte außer der Lorke von halbkaltem Kaffee und der pappigen Dreierschrippe. Oder kam des allens zusammen?!
Nee, nee, des kommt janich in Frage. So tief is Emil Lehmann noch lange nich jesunken.
Aber plötzlich löste sich auf dem Hintergrund von »Loeser & Wolff« die brave Schlafmutter, die Radowski ... sie war nebenbei, das muß zu ihrer Ehre gesagt werden, eine ganz gute Frau, und sie hatte mit Schlafburschen in jeder Beziehung noch ganz andere Erfahrungen gemacht, als sie je mit Lehmann hätte machen können. Eigentlich tat sie nur so. Wenn se mal nicht gleich zahlten, gings ja auch. Denn es waren doch man arme Luders, sone Schlafburschen! Plötzlich war im Hirn des Kolporteurs da auf der Hungerbank neben den beiden verbummelten Studenten und den beiden Kontrollmädchen, oder in der Mitte zwischen den Vieren, die Vision der Radowski glatt verschwunden und ausgelöscht. Aus dem simpeln Grunde, weil die Wirklichkeit immer stärker als der Traum ist. Sofern nicht der Traum stärker als die Wirklichkeit ist! Und dieses elendige grüne Gefühl um den Magen herum war gleichfalls weggepustet vor der Wirklichkeit aller Wirklichkeiten.
Und das da drüben war Wirklichkeit, was dahinten auf der rechten Seite drüben ankam, übergroß, wie man sich Königinnen vorstellt als Kind. Naja, größer wie er war sie eigentlich ja auch nicht. Aber bei Frauen sieht das gleich so aus. Und vielleicht machte sie auch der lichte Fälbelhut, der schräg auf den schwedenblonden Haarmengen auflag, und über dem ein Kranz von Silberreihern in der Sonne wie Schilf im Abendwind zitterte – eine ganze Reiherkolonie mußte deshalb ausgerottet sein – noch stattlicher, als sie schon ohnehin eigentlich war.
Und die Boa aus lichtblauen Schwanendaunen machte sie noch breiter um die Schultern, als sie schon dadurch erschienen, daß die Dame sehr, aber auch sehr zerbrechlich, bis zur Wespentaille geschnürt war. Und dadurch, was sie gewiß nicht war – denn sie neigte stark zur Rundlichkeit – schlank und füllig zugleich erschien, statiös in dem silbergrauen Taftkleid, das sie – und sie hatte den vergißmeinnichtblauen Sonnenschirm nach außen gekehrt – mit einer Geste von unnahbarer Hoheit (so schien das dem Kolporteur auf der Bank wenigstens) hinten herum gerafft ... Sonst hätte wohl den Boden noch mehr der Glockenrock geschleift, der, das ahnte man, einfach atemberaubend von Jupons geschwellt war. Wirklich, trotz des Lärms und trotz der Entfernung bis drüben hin, glaubte der Kolporteur ordentlich die Seide knistern zu hören ... Denn davon stand immer in den Romanen im Lokalanzeiger. Und das merkwürdigste, das schönste an der Dame: sie hatte ein paar solche Kugeln von sprühenden, lackschwarzen Augen ... wie eine Spanierin an der Litfaßsäule aus dem Wintergarten, und mit denen sah sie, spähte sie zu den Bänken herüber ... Aber trotzdem es ganz schnell geschah und ganz unauffällig, schien es dem Kolporteur, als ob sie gerade ihn da gesucht hätte, und sogar, als ob ein Schimmer von Wohlgefallen – wenn solche feine Dame überhaupt einem armen Hund gegenüber, wie er doch war, sowas zeigte – über ihr rosiges Antlitz (so stand auch im Lokalanzeiger immer!) gehuscht wäre.
Ach, Emil Lehmann war gewiß ein gewiefter Junge eigentlich, aber so recht wußte er eben doch noch nicht Bescheid. Und er ahnte gar nicht, daß diese Dame nur deshalb so strahlende und nachtschwarze Augen hatte, weil man kein Mittel erfunden hatte, sie veilchenblau zu färben, wie es eins gab, die eigenen nachtschwarzen Locken, die durchaus nicht sehr üppig gewesen waren, genau auf die Nuance der schwedenblonden falschen Zöpfe einzufärben, die sie geschickt zu einer wonnigen, einheitlichen und stolzen Fülle verstärkten. Es gab viele, die sich der Dame nur dunkel erinnerten. Denn es war schon vor fünfzehn Jahren sehr kompromittierend gewesen, sie zu haben. Aber in allerbesten Kreisen – wie Nichtkenner des Lebens sagen – bester Ton, sagen zu können, sie gehabt zu haben. Heute war sie auch diesen Kreisen entrückt und hatte sich noch besseren zugewandt. Aber trotz Schminke und aller Aufmachung, sie war, das sah der arme Kerl eigentlich gar nicht, eine geradezu verdammt schöne Person, deren seltene spritzige und fast geistreich bewegte Schönheit kein noch so raffinierter Schönheitssalon bisher hatte verderben können. Und sie gab schon mit sich etwas an. Gottfried Keller sagt über seine Judith im »Grünen Heinrich«, sie wäre eine Frauensperson gewesen, die der Teufel gern hat. Das war mehr. Das war eine, die den Teufel gerne hat. Und trotzdem war sie gerade so, wie man sich das Laster nicht vorstellt ... Das war ihr Trick. Sie war und blieb immer grande dame und Herrscherin.
Ja, und wenn sie jetzt die Haare schwedenblond trug, so hatte sie das nicht leichtfertig und aus Modenarrheit gemacht, sondern weil sie ... damals, als sie sich gedreht und von heute auf morgen ihrer alten Klientel untreu wurde, erkannte, daß das gewünscht wurde und ihr ungeahnte geschäftliche Vorteile bot. Einfach weil in der Welt die alte Grunderfahrung des »les extrêmes se touchent« – und in ihrer Welt noch ganz besonders! – immer noch zu Recht bestand. Denn ihr neugewonnener Kundenkreis bestand dank eines geschickt ausgebauten Systems, in dem auf Seide gedruckte, patschuliduftende Visitenkarten, indiskrete Fotos und Hotelportiers, Liftboys und Oberkellner eine vermittelnde, gutdotierte Rolle spielten, aus Ausländern. Europäer wurden ungern darin aufgenommen ... Nur als Lückenbüßer vielleicht einmal. Speziell Amerikaner waren es. Und von diesen wieder Südamerikaner, Mittelamerikaner, Kubaner. Meist auch breitschultrige Argentinier, blitzäugige Mexikaner. Manchmal sogar pockennarbige, gegen Damen sehr galante und großzügige, in zu weite Anzüge gehüllte, Brillantringe am kleinen Finger tragende, mit goldenen Uhren versehene, mit dicken Brieftaschen und Scheckbüchern begabte Herren ... die nur einen kleinen Fehler hatten, daß ihnen noch einige Tropfen Neger- oder Indianerblut unter der grünlich-violetten Haut rollten, und daß sie das stumpfschwarze, manchmal seltsam-frühzeitig schon graumelierte Haar sehr gestriegelt und mit Stangenpomade gefestigt trugen, weil es immer wieder, so sehr sie es auch in Ketten legten, die Tendenz kundtat, sich der krausen Form ihrer Vorväter einerseits zu erinnern. Während sie, gerade im Gegenteil, einzig und allein an ihre Vorväter andererseits erinnern wollten, die schon mit Cortez und Pizarro und ähnlichen Straßenräubern gelandet sein sollten. Wie sie behaupteten.
Sonst aber, außer dieser Narretei, daß sie durchaus nicht einsehen konnten, daß ihre braunen, roten oder schwarzen Urmütter von ehedem – und wer es immer gewesen sein mochte: eine Fürstin, eine Häuptlingstochter oder eine Viehmagd – von tausendmal höherem Adel waren als diese weißen Götter ... außer dieser Achillesferse, die nie berührt werden durfte, waren sie – ganz im Gegensatz zu den Kerlen von einst – meist sehr freundliche und wohlerzogene, witzige und sogar manchmal literarisch recht versierte Leute und echte Kavaliere, die wußten, was sie einer Frau, die ihnen ihre Huld zuwandte, schuldig waren, und die sich manchmal sogar mit einer hidalgohaften Geste zu einer kaum verständlichen Großzügigkeit in Geschenken verstiegen. »Gefällt dir diese Zigarettendose, meine weiße Taube? Sie gehört dir!« Und wenn sie pures Gold war und ein Monogramm aus Brillanten trug, »ich besitze noch mehr davon.«
Ja, und diese Kavaliere kannten eben aus ihrer Heimat alle Nuancen von Schwarz. Sie waren mit Schwarz übersättigt. Sie waren kaum überbietbare Kenner darin. Wohl aber waren sie, was Blond anbetraf, Ignoranten und unschuldsweiße Lämmer und fielen auf jeden Schwindel herein.
Außerdem – und das war vielleicht ebenso wichtig – sprachen sie meist ein sehr unvollkommenes Deutsch, diese Herren der ABC-Staaten. Ein Deutsch, das selten über »Kellner, noch uno Ei« herauskam. Das aber genügte ihrem regen Unterhaltungsbedürfnis nicht, wenn sie einmal mit einer Dame ausgehen und sich einen amüsanten Abend machen wollten oder gar öfters mit dieser Dame zusammensein wollten ... Und so war ihnen natürlich jemand lieber, der von Haus aus französisch wie eine Pariserin und amerikanisch mit echtem Broadwayklang und dazu, das gehört sich, italienisch wie eine Florentinerin sprach – und immerhin soviel von der edlen Sprache des Cervantes verstand, um auch mal in vertraulichen Situationen ... und zum Schluß kann ja auch der gepflegteste Plantagenbesitzer nicht immer nur den Salonkavalier spielen ... einen Witz zu erfassen, über den selbst ein Maultiertreiber in den Kordileren das Gesicht grinsend verzogen hätte. Ja, und dafür gab es eben, so merkwürdig das klingt, eben doch in dem ganzen großen, großen Berlin und in der weiten Friedrichstadt ... keine Konkurrenz, die in Frage kam und alles so vereinte ...
Entweder konnte sie mit den Kunden reden, dann war sie eine Spinatwachtel. Oder sie war ein schickes Weib, dann sprach sie französisch wie in Französisch-Buchholz. Oder sie krakehlte und klaute Brieftaschen. Das hatte sie nicht nötig: vor ihr gingen die Brieftaschen von selbst auf. Nein, Konkurrenz hatte sie nicht. Oder sie war nicht aus gutem Hause, sondern kam aus dem Toppkeller. Oder sie hatte nicht das Temperament, wie das die Kavaliere von da drüben gewöhnt sind, und verstand vom Beruf nichts. Bei ihr konnte man alles haben. Sogar auch Liebe und Herzensneigung. Wenn es verlangt wurde.
Ja, und so kam es, daß diese Dame nicht nur vollauf beschäftigt war, sondern eigentlich nur noch längere und lohnende Engagements in der letzten Zeit annahm. Jedoch von alledem ahnte, wie gesagt ... draußen hinter dem Belle-Alliance-Platz bei seinen Kunden, in seinem Revier und vorm Schönhausertor, wo er früher gelebt hatte, und am Humboldthain, wo er heute da wohnte bei der Radowski, da fand er sich in den Menschen mit einem Blick zurecht und kannte sie aus dem Effeff ... von alldem aber ahnte der Kolporteur Emil Lehmann nichts. Ihm war bis zum Weinen – aber der Hunger kam auch wieder – fast unglücklich, als diese wunderherrliche Frauensperson da drüben sich plötzlich abwandte und sich vor ein Schaufenster stellte, so daß er nur noch ihren schönen, langen Rücken und den Glockenrock und den violetten Sonnenschirm in der Hand, die das Kleid raffte, in violetten Glacés, die weit den Arm heraufgingen, sehen konnte ... Wirklich die Bilder da, spinatgrüne Buchenwälder und Frauen, die in Seidenbetten Reizwäsche zeigten, und andere, die ohne solche auf Wolken ruhten ... siebentausend echte Ölgemälde und andere Kunstgegenstände, stand über dem Laden, wurden hier ständig meistbietend versteigert! ... die Bilder schienen sie sehr zu fesseln, die Dame ... Kunstfreundin war sie. Vielleicht wollte sie ihrem Mann eins davon zum Geburtstag schenken. Oder sich eins zum Geburtstag wünschen. Denn die besseren Leute finden so was schön und geben eine Masse Geld für so was aus ...
Aber dann kam auch schon von drüben mit einer Queenzigarette im Mundwinkel solch ein Mann zu ihr lässig herübergeschlendert zwischen den wartenden Droschken und Omnibussen hindurch ... ziemlich groß, so um die dreißig, in den Jahren, wo der Mann auszulegen beginnt ... also so ein richtiger Gentelmann mit einem lichtgelben Gehrock, der in zwei Flügel auseinanderstrebte und sehr auf Taille gearbeitet war, und mit einer Tubarose im Knopfloch. Einen grauen, steifen, runden Hut hatte er tief in die Augen gedrückt: Kein Kavalier von Reznicek konnte ihn besser tragen. Das gescheitelte Haar darunter stand ihm überhaupt wie zwei Fledermausflügel über die Ohren weg, und sein semmelblonder Schnurrbart war sorgsam in jene aufstrebende Form gebracht, die echte Kavaliere gerade bevorzugten. Er wäre unvollkommen gewesen ohne den Stock mit dem Elfenbeinknopf, den er unter die rechte Achsel geklemmt hatte, und ohne das Kettenarmband, das ihm über den gelben Handschuh fiel, mit dem er das Pfefferrohr umklammerte. Und ohne das dicke Plastron, das durch einen Hundekopf mit Rubinenaugen zusammengehalten wurde.
Wie gesagt, Emil Lehmann kannte sich hier in der Friedrichstraße nur sehr oberflächlich aus, sonst hätte er gleich gesehen, daß dieser Mann da, mit dem Gesicht wie eine Wassersemmel, ohne daß er dabei häßlich war ... die Nase war klein und zierlich, der Mund war es, und das Kinn war es, und die rosigen Bäckchen waren es, wenn auch die Haare ziemlich in die Stirn hineinwuchsen ... nur einen Wunsch und eine Genugtuung kannte, für einen Gardeoffizier in Zivil ... seinethalben sogar für einen geschaßten ... gehalten zu werden. Und daß es ihm nur sehr unvollkommen wenigstens gelang, diesen Wunsch bei anderen in Erfüllung gehen zu lassen.
Denn in diesem Gesicht herrschte eine solche Reglosigkeit und so eine eisige Leere, und die grauen Augen unter den silberweißen und ganz dünnen Brauen waren so kalt, stier und unbewegt, daß das Innere von Grönland dagegen als eine erfreuliche Landschaft bezeichnet werden muß. Sein Blick, in dem ein Funken Roheit in einem Bottich von Stumpfsinn schwamm, haftete an nichts, ging durch alle Dinge hindurch, war weder freundlich noch böse, nicht mal heimtückisch, weder gleichgültig noch beteiligt, nur leer, leeer, leeeer.
Und dieser feine Hund da geht nu so einfach an der vornehmen Frau da am Schaufenster vorbei. Er sieht sie scheinbar gar nicht und telegrafiert ihr nur solch bißchen aus den Augenwinkeln zu. Und dann macht er halb kehrt und geht mit seinen wehenden Rockschlippen ... (ach, Leinengamaschen hat er auch ... unsereiner hat Löcher in de Stiebel!) ... einfach in den Hausgang zwischen den Zauberladen mit dem Totenkopf und der Puppe von dem Inder, der die Augen rollt vor seinem schwarzen Tischchen und an die Scheibe klopft ... einfach da rein ... Und die feine Dame tut, als hat sie ihn überhaupt nicht gesehen, und schaut sich immer noch den spinatgrünen Buchenwald an in der Bilderhandlung. Und dann geht se einfach hinterher.
»Also soooo macht man das?!! Man braucht nur so rumzulaufen mit ’n Schwalbenschwanz, und die allerfeinsten Damen laufen einem einfach wie’n Hundchen nach«, denkt der arme Kerl da auf der Bank. »Des is ja doch pfui Deibel!! Und nachher wundert sich der Mann zu Hause, wo seine Frau bleibt!«
Wie gut es doch andere Männer haben! Ich kann mir nich mal jetzt ne Bockwurst mit Kartoffelsalat am Friedrichstraßenbahnhof bei Aschinger ... Denn muß ich die Groschen schon aus alle Taschen zusammenkratzen ... und solch ein feiner Pinkel gibt vielleicht einen blauen Lappen aus, wenn er sone Frau ne Viertelstunde haben kann.
Ach, kiek mal, da kommt er doch schon wieder aus’n Hausgang raus, der feine Pinkel mit seinem grauen Judenhelm! Soso ... det is wohl nischt geworden?! Und da tapert er wieder mit seinem Stock unterm Arm. (Mensch, komm bloß nich unter die Räder!)
Also, also ein Monokel mit ’ne schwarze Litze trägt der Patentfatzke auch. Des habe ick mir gedacht, des der da in de Konjakstube jeht. Du willst dir wohl für die nächste Abfuhr Mut antrinken? Mensch, ein feiner Mann stößt nich de Tür mit’m Fuß auf!
Die beiden Mädchen neben Emil Lehmann hatten die ganze Zeit noch kein Wort miteinander gesprochen, trotzdem sie doch zusammengehörten. Jetzt puffte die eine die andere an: »Hast du gesehen?« sagte sie. Sonst nichts.
»Ich bin doch nich blind geworden«, sagte die andere. »Des war der Turfkarl«, sagte die erste wieder. Mit einem Ton, der deutlich durchschimmern ließ: an sowas Feines kommen wir armen Luder janich ran. In unsern janzen Leben nich. Dadazu muß man geboren sin’.
Ja, da kam nu auch wieder die Dame von vorhin. Ganz heiter, als ob nichts geschehen, kam sie aus dem Hausgang getänzelt. (Nein, das lag ihr nicht: Sie schritt!) Also, eine wunderschöne und feine Person! Doch ob sie ne Dame, war dem Kolporteur jetzt nicht so ganz sicher mehr. Aber es kann auch Zufall gewesen sein, daß sie beide in dem gleichen Haus – da wohnt ’n Anwalt! – oben zu tun hatten. Kommt also heraus, bleibt wieder stehen, sieht sich nach allen Seiten um. (Worauf wartet sie denn?!) Mit ihrem Fälbelhut mit dem Zaun von Reiherfedern ... sowas is doch nur für die Reichen da! ... hebt ihren Sonnenschirm und winkt einem Wagen, also einem prachtvollen Landauer mit ’n paar Staatsgäulen vor, der mit einem Ruck – Brrrrr – hält ...
Gott, is der Mann braun in seinem kurzen Sommermäntelchen. Aber wie er ihr grüßt und sie ihn anlacht ... Wat ruftse da? ›O mio Panschite‹, was heißt’n des? Also, das is ihr Mann wohl. Aber eenen duften Hut hat der. Den möcht ich haben. Ich glaube, sone lappigen Dinger, sone Panamas kosten ’n Haufen Jeld. So setzt man sich nur in son Wagen, wenn man des von früh gewöhnt is. Und der Kutscher ... wie auf Draht gezogen! Wie die Pferde die Beine schmeißen. Und wie gut das auf ’n Asphalt klappt. So leben die Leute, und unsereener kann nich mal aschingern jehn!
Der weiße, lichte Zaun von Reiherfedern auf dem lichtblauen Hut und die Boa aus blauen Schwanendaunen um ihren sehr festen und doch weichen, schlanken Hals da waren das letzte, was Emil Lehmann von der Dame sah.
Auch die beiden als Dienstmädchen maskierten Kontrollmädchen hatten der da im Wagen neidvoll und respektvoll zugleich und schweigend wieder nachgesehen. So ungefähr wie ein Soldat zweiter Klasse einem General.
»Die Diamanten-Berta«, sagte die eine tonlos.
»Ach wirklich?« fragte die andere tonlos.
»Na ... dahinten in de Equipage«, meinte die erste wieder mit leuchtenden Augen. Aber vielleicht hatte sie auch Schwindsucht. Denn darauf wird sie nicht untersucht auf dem Alex ... Und das Fieber setzte um diese Zeit ein. »In de Ecklipaje.« Denn Fremdworte sind Glücksache. Mal trifft man’s und mal nicht.
Und dann fielen sie wieder in ihr stilles Elend zurück. Und auch Rosenemil, aber es wäre zu verfrüht, ihn so zu nennen, starrte wieder nach den Häusern und den vornehmen Läden mit all den breiten Spiegelscheiben in Broncerahmen – das machte man jetzt hier so! – hinüber. Zu den echten Ölbildern und den echten Elfenbeinschnitzereien »Venus züchtigt Amor«. Alles, was man hier braucht, war eigentlich schon in solchen Grüppchen zusammen! Zu Brillanten, die auf dem schwarzen Grund sich drehten. Dem Zauberladen. Dem Korb roter Hummern. Und den Lotterielosen, die gewinnen mußten. Und er ahnte eigentlich wenig davon, daß die Häuser hier so herum genauso wie die Menschen waren. Sie sahen von außen, wenn man an ihnen vorbeiging, ganz gut aus. Man durfte nur nicht hineingehen. Ja, es war sogar besser, wenn man selbst vermied, stehen zu bleiben. Dann nämlich waren es nur falsche Brillanten und die Ölbilder übermalte Photographien; und der Kognak verschnittener mit Methylalkohol. Und Lotterielose, die Glück bringen sollten, und die so todsichere Nieten waren, wie Lotterielose und Menschen es nur sein können.
›Da drüben ha’ck vor fünfzehn Jahren gestanden. Eine Kälte war des, man konnte sie mit Messern schneidern‹, denkt Rosenemil, ›grün und blau bin ick jefroren. Und hab immer jeschrien ... damals bin ick eben elf Jahre jewesen oder so rum.‹ »Ausführliches Programm der Beisetzung seiner Majestät Kaiser Wilhelm des ersten, ausführliches Programm ...«! Ihm ist, als hörte er seine eigene, helle Jungenstimme durch die Kälte ... ›Jott – was man doch so allens jemacht hat, um zu ein paar Jroschen nebenher zu kommen, von früh an: mit Hampelmänner auf dem Arkonaplatz bin ich herumgezogen.‹
Seine Mutter fällt ihm ein, die war verdammt hinterher, daß er das Jeld auch richtig zu Hause abgab. ›Wat hat die doch immer (jetzt ha’ck doch jar keenen Hunger mehr) jesungen immer? Ach ja, wat denn?
»Wat Unter de Linden
Als Hoju kommt in’n Topp
Dat schmeißt man uff de Frankfurter Linden
Den Schlächter an’n Kopp
Aber nich so grob, aber nich so grob!
Schmeißt doch den Schlächter de Knochen an’n Kopp.«
Plötzlich bekommt er es mit der Scham. Er hat ganz laut vor sich hingesungen, und er is eigentlich, so keß und frech er auch tut, ein scheuer Mensch, der sich nicht gern vor den Leuten herausstellt. ›Na, nu werd ick mir mal dünne machen‹, denkt er.
»Das is ja ungemein ulkig, lieber Freund«, sagt, als er eben aufstehen will, der eine der beiden verbummelten Studenten zu ihm, »wissense, wo das eigentlich her is?« sagt es mit einer ganz hohen und dünnen Fistelstimme, »irgend eine alte Posse?«
»Nee«, meint Emil, »des kann ich Ihnen auch nicht sagen. Des hat nur meine Mutter immer jesungen.«
»Du, Spitzmaus«, brummt der andere, und seine Stimme war so tief unter dem Meeresspiegel menschlicher Stimmen, wie jene über ihm schwebte, »heute gehn wir aber nicht in de akademische Lesehalle mehr und spielen keine Partie Schach mehr.«
»Sie haben aber’n komischen Namen«, sagt der Kolporteur. (Wenn die Leute mit ihm zu reden anfangen! Warum soll er denn da den Mund halten?) ... »Hieß Ihr Herr Vater und Erzeuger auch Spitzmaus?«
»Recht haste, Laubfrosch, wozu sollen wir den angebrochenen Vormittag mit geistiger Arbeit vergeuden?« piepst der Dünne und grient still vor sich hin mit seinen zwinkernden Äugelchen. »Der Laubfrosch hat nämlich ne Schallblase«, sagt die Spitzmaus und zeigt auf den breiten Blähhals seines bierfreudigen langjährigen Kommilitonen. Denn sie waren beide zur gleichen Zeit aus der Suevia geschaßt worden, wenn auch der eine jetzt sechsunddreißigstes Semester und der andere erst fünfunddreißigstes Semester war. Geschaßt und seitdem nie wieder auf die Beine gekommen. »Nu steht doch im großen Brehm, daß sich die Spitzmäuse von Laubfröschen nähren. Aber au Kontrolleur: er ernährt sich geistig von mir.«
Der kleine Mann in seiner Talentwindel lehnt sich zurück und blickt den Kolporteur überlegen an. Aber er sieht nur viel älter aus. Schnaps bringt runter.
»Haben Sie schon mal auf einem Heukahn geschlafen, junger Mann?« fragt er leutselig und feixt vor sich hin. Denn er kennt seinen Dostojewski, und den »Raskolnikow« hat er zehnmal von Anfang bis zu Ende gelesen. Die Spitzmaus ist überhaupt ne sehr gebildete Haut. Im Gegensatz zu Laubfrosch, der von Hause her doof war und sein bißchen Verstand längst in Bier ertränkt hat. Und Spitzmaus hat wirklich die letzte Nacht drüben im Humboldthafen auf einem Heukahn geschlafen. Aber auf einem Heukahn schlafen, das wußte Spitzmaus nun, das liest sich zwar bei Dostojewski ganz poetisch und rührend, doch in Wahrheit ist es dumpfig und staubig und stachlig, riecht schlecht und ist zudem nicht mal weich und keineswegs, selbst in einer Juninacht keineswegs (und darauf muß man wieder einen nehmen!) durchaus nicht gerade besonders warm. Und Halme und Grannen und allerhand Schmutz und halbverendetes Ungeziefer kommen einem in Mund, Nase und Ohren dabei. Nur literarisch ist es ein Erlebnis; aber im Leben – wie so vieles! – eine Sache, die nicht kennengelernt zu haben, einen Vorteil bedeutet.
Heute aber würde er bei Laubfrosch schlafen in der Lothringerstraße. Das heißt, in der Lottumstraße. Und das heißt, wenn er es aushielt. Denn wenn Laubfrosch betrunken heimkam, so duldete er nicht, daß man das Fenster aufmachte, wenn er gebrochen hatte. Aber wenn er es aushielt, würde er heute doch lieber bei Laubfrosch schlafen als auf einem Heukahn. Gott ja, gescheite Menschen können auch ebensogut zum Teufel gehn wie dumme; und dumme ebenso gut, ja meist besser, es zu etwas bringen wie gescheite. Das hängt von Dingen ab, die mit dem Hirn nichts zu tun haben, sondern mit den Trieben.
Hinten, von der Passage in der Friedrichstraße her, kam jetzt so ein dumpfes, so ein dumpfes Rasseln, Klingeln, Murmeln. Blechern und hoch etwas dazwischen. Stampfen und Quietschen. Und so langsam löste es sich daraus: Dadada, bumbumbum, dadada-bumbumbum: ein Militärmarsch. Welcher, war noch nicht recht herauszuhören. Auch die Wagen und Menschen drängten sich schneller und mit mehr Rhythmus aus der engen Straße hervor. Wie ein geschlagener Feind flohen sie gleichsam vor der Musik her. Und bei Kranzler und drüben bei Bauer ballten sich die sommerbunten Menschenmassen.
»Tsching, Tsching, bumbum und tschingdada kommt im Triumph der Perserschah«, piepste Spitzmaus, »gehn wir, Laubfrosch«, er weinte fast, »Lilienkron ist es! Lilienkron Ignorant! Nicht Dehmel! Flüchten wir, ehe uns der Militarismus hier überrennt.« Und Spitzmaus zieht den Laubfrosch, der sich nur ungern bewegt, von der Bank auf, »rudis indigestaque moles«, piepst er; »Ovid, Ovid! Wenn du noch soviel übersetzen kannst: eine rohe und unbewegliche Masse!« Aber das machte sich nur Spitzmaus so. Denn – indigestus heißt eigentlich gar nicht unbewegt.
»Turgenjew hat gesagt«, kam es von tief unter dem Meeresspiegel des menschlichen Organs herauf, »wenn du auf einem Sofa sitzt und du sitzt gut da, so stehe nie auf, denn du weißt nicht, ob du es noch mal so gut im Leben haben wirst.«
»Ist das ein Sofa?« quiekt Spitzmaus, und alle Falten um seinen mimmelnden Mund, denn trotz der fünfunddreißig war sein Zahnbestand gemach schon wie ein durchgerodeter Wald geworden, den selbst der überhängende, ausgefranste Schnurrbart, der durch Zigarrenstummel angesengt war (wer Zigarren raucht, sengt sich nicht so leicht den Bart an. Aber wer Zigarrenstummel raucht, nachdem andere die Zigarre geraucht haben, kommt verdammt leicht in Gefahr, sich den Schnurrbart zu verbrennen. Besonders dann, wenn er über den Mund hängt) ... alle Falten und seine angerötete spitze Nase liefen zu einem konzentrischen Grinsen auseinander, als wäre sein Gesicht ein Tümpel, in den ein Junge einen Stein geworfen hätte. »Auf dieser Bank von Holz hat schon der große Kurfürst der Liebe gepflegt. Ich schätze solche historischen Reminiszenzen nicht!«
Rosenemil horchte erstaunt auf: der Mann wäre für seinen Beruf zu brauchen gewesen. Mit der Schnauze kam er nicht mal mit. Aber Rosenemil übersah das eine, daß Spitzmaus überhaupt zu keinem Beruf mehr zu brauchen war.
Und als Spitzmaus den schweren Laubfrosch ohne Hebebaum von der Bank hochbekommen hatte und die beiden Packen ungelesener Bibliotheksbücher unter den Flügeln ihrer Havelocks verschwunden waren (wie ein Mensch das aushält bei der Hitze!), wandte er sich nochmal an Rosenemil: »Junger Mann«, piepste er, »Zukunft des deutschen Landes, Sie haben mir ein Liedchen gelehrt.« Und seine verglasten Augen schwammen über den Kolporteur da unter ihm auf der Bank fort. Denn er liebte es nicht sehr, Leute anzusehen. Und außerdem wäre doch sein Blick etwas unsicher gewesen, weil er sich des Morgens hatte aufwärmen müssen. »Nu, junger Mann, will ich Ihnen eins lehren, ein für Sie sehr, sehr beherzigenswertes und von mir in grünen Jahren sehr beherzigtes Liedchen.«
Und Spitzmaus fistulierte mit seiner dünnen Glasschneiderstimme:
»Unter’n Linden, unter’n Linden
Gehn spazier’n die Mägdelein,
Wenn de Lust hast anzubinden,
Denn spazierste hinterdrein ...
Biste an’n Pariserplatz
Is se sicher schon dein Schatz.«
Nur die Gesten machte er nicht dazu wie ein italienischer Straßensänger, denn was brauchte die ganze Welt zu sehen, daß er kein Jackett unter dem Havelock hatte.
»Dein Schatz, dein Schatz, dein Schatz«, piepste er immer noch, als er von Laubfrosch schon ein ganzes Stück weggezogen war und die Musik wie eine alle andern Geräusche der Straße vor sich wegfegende und zudeckende Sturzwelle drüben zwischen Bauer und Kranzler hervorquoll zwischen den beiden Menschenwällen, die sich da aufgetürmt hatten. Alles war in Erregung, elektrisiert durch diddadada tamtamtam, didadada tamtamtam, rrre rrrembemrrrr emmbemmmbemm. Nur die beiden Paare von Pennbrüdern auf der Bank, bei der Alten mit dem Rock aus dem Türkenschal, wachten nicht auf. Sie wechselten nur etwas die Lagen. Vielleicht dachten die vier Dioskuren, daß der andere doch selbst für eine Penne ungebührlich schnarchte.
Zuerst tänzelte ein berittener Blauer auf einem pirouettierenden Braunen vorneweg. Dann kam eine ganze Horde von Mitläufern, die schon seit der Belle-Alliance-Straße mitgelaufen waren und deren Scharen sich in Reihen formiert hatten: jeder neue sprang in das Glied und in Tritt ein, sowie er sich vom Bürgersteig gelöst hatte. Und dann kam erst die Musik und die Triangeln, die Posaunen, die Trompeten, die Querhölzer und die Trommeln, die ganze Kollektion jener Tamtam-Instrumente. Und der Tambourmajor mit seinem Stock stelzte wie ein Kronenreiher vorneweg. Der Tambourmajor stelzte mit seinem bepuschelten Stock, den er nur wenig höher in die Luft warf als die Soldaten hinter ihm die Beine in den weißen Leinenhosen. Denn die warfen sie ungefähr, wenn auch nicht ganz so hoch, wie die weißen, flatternden Roßschweife auf ihren Paradehelmen mit den blanken Schuppenketten.
Rosenemil sprang auf. Und wenn er noch so müde und verstimmt war, dem konnte er nicht widerstehen. Schon mit acht Jahren damals hatte ihn die Mutter verdroschen, wenn er weggelaufen war, weil er sehen wollte, wie die Wache aufgezogen wurde, und sie sich dann ängstigte, wenn er zum Essen nicht nach Hause kam.
Im Moment war sein Hunger weg. Seine Mißstimmung. Alles. Mindestens ein Jahr war er mit der Wache nicht mehr mitgelaufen. Und er drängte sich durch die Menschen an den Straßenrand, und obwohl der Schutzmann ihn aufhalten wollte, der da stand, um das Militär vor den Belästigungen durch den Plebs zu beschützen ... aber wenn man ihm den bunten Rock anzieht, dann heißt der Plebs Stütze von Staat, Thron und Altar ... wutschte er doch da in den Troß, der, mitpfeifend und Beine schmeißend, im Takt der Zirkuspferde vorantrabte. Die Wollinerstraße hatte ihre ganzen vierten Höfe ausgespien und ihnen alles noch nachgeschmissen, was sie an Ballonmützen und Halstüchern und Vorhemden besaß, in denen zwar Kragenknöpfe, aber auf denen keine Kragen saßen. Einer hatte sogar grünsamtene Morgenschuhe. Ihn mußte die Wache überrascht haben, wie er ging und stand. Wie einen Pompejaner ein Vesuvausbruch. Es war sicher kein Gardematerial, das da mitrannte. Halbwüchsige Jungens, die aus der Fürsorge entlaufen waren, Schulkinder, die die letzte Stunde geschwänzt hatten. Einer sogar, der lahmte und wie eine Wippe machte beim Gehen. Kesse Luden, die Schirmmütze über dem linken Auge und die Haarlocke in die Stirn gedreht. Wirklich, der bessere Teil der Berliner Bevölkerung schien sich nicht daran zu beteiligen. Alle aber schmissen sie die Beine und sahen stier geradeaus. Nicht einer rechts oder links.
Und so sehr auch der Kolporteur, denn er war ja bis vor acht Jahren hundertmal so mit der aufziehenden Wache mitgelaufen, später, wo er ordentlich war, hatte er es dann bleiben lassen, aber in den letzten Jahren, wenn er so vom Treppenlaufen müde war und auf ner Bank saß oder ’nen Frühschoppen – aber das kam selten vor! – nahm und die Wache gerade vorbeikam, hatte er doch nicht widerstehen können und war mitgezogen. Mal vom Belle-Alliance-Platz und mal von der Maikäferkaserne. Oder vom zweiten Garderegiment. Wer dran war.
Und das hatte ihm Spaß gemacht und frischte ihn immer auf. Vor allem die Märsche mitzupfeifen. Er kannte jeden Ton besser wie ’n alter Kavalleriegaul. Aber vielleicht, daß der Musikgeneral, der Oberaugust von de Füsiliere, sein Handwerk nicht recht verstand, denn es brachte ihm heute keinen rechten Schwung in die Knochen. Vielleicht, daß da gerade besonders übles Gesindel mittobte und er sich unbewußt klarwurde, wie weit der Abstand zwischen dem vornehmen Patentfatzken da mit dem grauen Judenhelm oder jener Dame mit der himmelblauen Federboa war, die da zu dem mahagonibraunen Mann in die Equipage gestiegen war, und dem miesen Gesocks hier (wie er sich sagte), das da die Vorhut des Militarismus bildete ... genug, grade vor dem ollen Fritz da oben, der von seinem Sockel aus zu Pferd griesgrämig und verknurrt und ehern diese Parade abnahm, grade da haute er wieder ab ... Grade davor sprang er wieder aus der Reihe heraus aufs Trottoir herüber. Obwohl ihm der Blaue nachschnauzte: »Aus der Reihe tanzen jibts hier nich!« Kaum zweihundert Schritt hatte er übern Asphalt mitgestampft. Mochten die da nachher ihre Jriffe vor der Hauptwache zum millionstenmal klopfen, »Jeweeehr app« schreien und ihre blöden Meldungen »melde jehorsamst« sich gegenseitig ins Gesicht brüllen. Wat jeht mir des an, das Affentheater! Dadavon krieg ick doch keen warmen Löffelstiel in’n Bauch.
Und langsam ließ der Kolporteur so auch die Mitläufer des Militarismus – denn rechts und links schob sich noch eine bunte Masse die Bürgersteige und den Mittelweg entlang – nicht die Vorhut aus der Wollinerstraße, sondern die besseren Mitläufer des Militarismus, an sich vorüber; guckte nochmal zum historischen Eckfenster hinauf, an den mit dem grauen Bart erinnerte er sich zwar nicht, aber an »ausfüüüüührliches Proooojram der Beisetzung seiner Majestäät Kaiser Willem des Ersten«, und stand plötzlich vor dem weißen Marmordenkmal seiner alten Frau, die da mit einem Spitzenschleier, lang hingelehnt, in einem sehr absonderlichen Stuhl saß wie (aber das sagte sich Rosenemil nicht) weiland Agrippina, die Mutter Neros, weiß wie Kandiszucker gegen eine dunkle Wand von Taxusbüschen.
›Ja, aber was soll man eigentlich nun machen?‹ dachte er so und sah von der alten Augusta fort, die er gesehen und doch eigentlich nicht gesehen hatte, auf das grüne Tuch des Rasens und auf die Kette von Monatsröschen, die gerade hier an dem niedern Eisenzäunchen ihre roten Köpfchen hochstreckten. ›Jott, wie hübsch die doch waren‹, dachte er, ›des is ja doch ’n janz neues Kardinalrot. Des kenne ich noch janich bei die Sorte. Wie des leuchtet, wie’n Kuß im Dunkeln!‹
Denn das eine war merkwürdig: der Kolporteur hatte von früh an geradezu eine närrische Vorliebe für Blumen. Wie oft war er von Muttern verkeilt worden, wenn er wieder welche von de Anlagen geklaut und unter die Jacke zu Muttern nach Hause gebracht hatte. Er konnte einfach an keinem Blumenladen vorbei. Und besonders im Winter, wenns draußen kalt war und die Scheiben beschlagen, ja stückweise sogar gefroren waren, suchte er so lange, bis er ein kleines Guckloch fand, um da hineinzustarren; und jede neue Rose, die aufkam, jede neue kupferrote Chrysantheme im November beim Blumenschmidt freute ihn unbändig. Er hatte auch mal Gärtner werden wollen. Naja, und jetzt war er sogar was besseres und gebildeteres geworden.
Also der Blaue da drüben, der mußte ja nach drüben nach der Wache kieken, ›der wird sich auch nicht gleich umdrehen‹, sagte sich der Kolporteur und bückte sich schnell und scheinbar absichtslos herab. Fünf Finger und een Jriff. Das kannte er von früher. Knipste mit den Nägeln ein Zweigchen mit drei Rosendolden ab, schob sie in die Seitentasche und zupfte erst da ein Röschen ab, um es so ganz beiläufig und unauffällig ins Knopfloch sich zu stecken. Klein und leuchtend wie eine Rosette der Ehrenlegion.
Plötzlich wurde ihm ganz heiß auf der Stirn, und es war ihm, als ob ihm da unter dem verbogenen Rand seines Strohhuts hundert Nadelspitzen aus der Haut schlugen, und das grüne Gefühl um den Magen war wieder da, stärker als vorher. »Jott noch mal«, sagte es in ihm, »du hast doch beide Hände frei?! Du hast doch ne Tasche heute jehabt, Emil?! Eine schwarze Wachstuchtasche mit zweiundzwanzig ›Verstoßene Jräfinnen‹ und ein Kilo Gesundheitstee? Auf de Bank haste se noch gehabt, Emil! Wo is denn die Tasche mit eenmal hin? Des is jut! Da muß ick mindestens vier Mark de Leute ersetzen. Zweiundzwanzig ›Verstoßene Jräfinnen‹! Mir rechnen se det Heft mit fuffzehn Pfennje. Det macht ... macht: dreimarkdreißig. Den armen Mann fliegt auch noch« – innerlich weinte er, und es fehlte wenig, daß er es auch sichtbar tat – »ooch noch die eene Taube weg.«
Und schon rannte er wieder los, zurück, aber diesmal rannte er wirklich. Und der Blaue, der sich wieder umgedreht hatte, blickte ihm stumpf und mißtrauisch nach: der Bruder da mußte doch was ausgefressen haben! Aber da sich niemand um den Mann kümmerte, ihm nachsetzte oder rief, haltet den Dieb, jing ihn ja die Sache jarnichts an, erst wenn eene Belästijung des Publikums dadurch stattfindet, hatte er einzujreifen.
»Un die Mappe«, japste Rosenemil beim Dauerlauf. Jetzt war ihm kalt, und er bibberte beinahe, »die Mappe, die scheene Wachstuchmappe.« (Also das war übertrieben; sie war nie schön gewesen, und jetzt war sie schon zehnmal in den Nähten und auch so gerissen und mühselig von Frau Radowski – denn sie sorgte mütterlich für ihre Schlafburschen – wieder zusammengeflickt worden.)
»Die müßte ja da noch liegen ...«, beruhigte sich der Kolporteur ..., »reg dir man wieder ab, Emil. Wer soll mir armet Luder noch wat klaun? Und wat soll denn eener damit anfangen? ... Wat kann denn in Jottes Namen eener mit zweiundzwanzig ›Verstoßene Jräfinnen‹ anfangen?! Und mit dem Tee! ... Da is er doch morgen ne Leiche mit ... Neenee, det rührt keener an.«