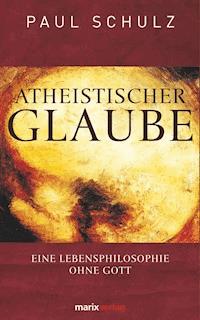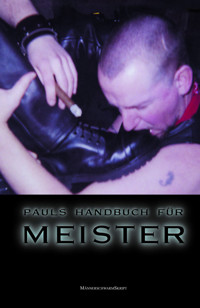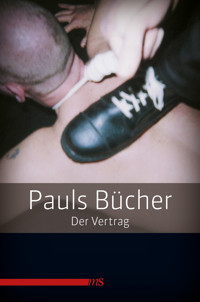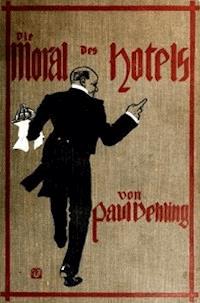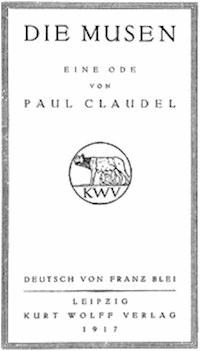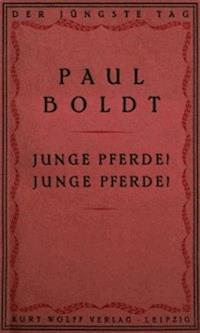0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Ähnliche
The Project Gutenberg eBook, Rousseau, by Paul Hensel
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Rousseau
Author: Paul Hensel
Release Date: December 20, 2013 [eBook #44474]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ROUSSEAU***
E-text prepared by Jana Srna, Norbert H. Langkau, and the Online Distributed Proofreading Team (http://www.pgdp.net)
Nach einem Delvauxschen Stich der Büste von Houdon.
Aus Natur und Geisteswelt Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen180. Bändchen
Rousseau
VonProf. Dr. Paul Henselin Erlangen
Zweite AuflageMit einem Bildnisse Rousseaus
Druck und Verlag von B. G. Teubner in Leipzig 1912
Copyright 1912 by B. G. Teubner in Leipzig. Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechts, vorbehalten.
Eugen Kühnemann gewidmet
Vorwort zu ersten Auflage.
Es war meine Absicht, in diesem Buch nur eine Darstellung von Rousseaus Gedanken zu geben, und auch hierbei nur diejenigen zu berücksichtigen, die für die mit Rousseau einsetzende Bewegung wertvoll gewesen sind. Eine allseitige Darstellung von Rousseaus Denkarbeit bietet das mustergültige Werk von Brockerhoff: J. J. Rousseau, sein Leben und seine Werke. 3 Bde. Leipzig 1863-1874, das, in einzelnen Teilen veraltet, doch noch immer die beste Gesamtdarstellung Rousseaus ist. Von anderen Darstellungen seien genannt: Möbius in »Ausgewählte Werke« I, Leipzig 1903; Höffding, »Rousseau und seine Philosophie«, Stuttgart 1897. Morleys Rousseau ist in den wichtigsten Gesichtspunkten veraltet, aus Jules Lemaîtres vielbesprochenem Buche über Rousseau vermochte ich nichts zu lernen. Von Spezialarbeiten über Rousseau, denen ich zu Dank verpflichtet bin, seien genannt: Fester, Rousseau und die deutsche Geschichtsphilosophie, Stuttgart 1890; Haymann, J. J. Rousseaus Sozialphilosophie, Leipzig 1898; Liepmann: Rechtsphilosophie des J. J. Rousseau, Berlin 1898; Gierke: Althusius; Stammler: Die Lehre vom richtigen Recht, Berlin 1902; Erich Schmidt: Richardson, Rousseau und Goethe, ferner die ganz vorzüglichen Arbeiten von Jansen: J. J. Rousseau als Botaniker und J. J. Rousseau als Musiker, Berlin 1885, sowie Texte, J. J. Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire, Paris 1895 und die schönen Aufsätze von Ste. Beuve in den Causeries de Lundi.
Von einer ausführlichen Darstellung der Lebensschicksale Rousseaus glaubte ich mich bei der Aufgabe, die ich mir gestellt, für dispensiert halten zu können. Rousseau wie Goethe haben eine Biographie über sich unmöglich gemacht, indem sie sie selbst schrieben. So wie sie die Ereignisse ihres Lebens dargestellt haben, so werden sie in der Erinnerung der Nachwelt weiter leben, gleichgültig, ob der Bericht in Einzelheiten auf Wahrheit beruht oder nicht. Sesenheim wird niemals »Sessenheim« werden, Wintzenried nie ein Ehrenmann. Für diejenigen Leser, die orientiert sein wollen, habe ich eine synchronistische Tabelle über Leben und Schriften Rousseaus beigefügt; die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Seiten dieses Buches.
Erlangen, 24. Juni 1907.
Dr.Paul Hensel.
Vorwort zu zweiten Auflage.
Ich freue mich des Zufalls, daß diese zweite Auflage im Jahre der zweihundertsten Wiederkehr von Rousseaus Geburtstag erscheint. Gibt doch die rege Teilnahme, die Deutschland an diesem Gedenktag nimmt, die beste Gewähr dafür, daß wir uns der Bedeutung Rousseaus für unser Geistesleben dauernd bewußt geblieben sind. Ich würde mich freuen, wenn diese Schrift auch ihren Teil dazu beitragen könnte, dies Bewußtsein rege zu erhalten. Bis auf einige kleine Nachbesserungen habe ich keine Veranlassung gehabt, Veränderungen vorzunehmen.
Erlangen, 10. Juni 1912.
Dr.Paul Hensel.
Inhaltsverzeichnis.
Erstes Kapitel. Der Mensch.
Kenntlich genug heben sich zwei Typen unter den großen Geistern in Wissenschaft und Literatur voneinander ab: die großen Beginner und die großen Vollender. Es sind die letzteren, die man im eigentlichen Sinne des Wortes als klassisch bezeichnen kann. Ihnen ist es gegeben, jede Regung, welche sich in der vor ihnen liegenden Epoche zur Geltung gebracht hatte, mit vollendeter Klarheit zusammenzufassen und auszusprechen, ihr Stil verrät die Sicherheit und Schärfe des zu sich selbst gekommenen Bewußtseins, sie bringen das auf die einfachste, sinnreichste Formel, sprechen das mit vollendetem Schwung aus, was die Herzen der Besten der Mitlebenden erfüllt. Was sie geben, kann nicht mehr überboten werden, sie sind der Zeitgeist in Menschengestalt, und deshalb werden ihre Werke auch dauern, wenn die Menschheit schon längst zu anderen Zielen vordringt; denn in diesen Werken spricht sich eine lange Entwickelung bedeutsam aus. Sie stehen jenseits von wahr und falsch, sie sind klassische Kunstwerke. So hat Voltaire geschrieben; mit Recht galt er den Besten seiner Zeit als das unerreichte Muster des philosophischen Denkens, der poetischen Darstellung, der treffenden Satire. Er sagte das, was jeder seiner Leser zu sagen sich sehnte, aber er sagte es so, wie sie es niemals vermocht hätten. In ihm kulminiert die ganze Geistesrichtung, die wir als die Zeit der Aufklärung bezeichnen; sie kulminiert in ihm, aber sie erschöpft sich auch in ihm. Da erblicken wir neben Voltaire einen Mann ganz anderen Schlages, dem es nicht darauf ankommt, die Bestrebungen seiner Zeit in klarsten und reinlichsten Umrissen festzuhalten, einen Mann, der eine andere Welt, eine neue Zeit, die nur er ahnt, im Busen trägt und der sich nun bemüht, diese Fülle der Gesichte der Mitwelt zu künden, dessen Sprache, bald pathetisch, bald ermahnend und scheltend, mitunter einen fast grotesken Eindruck macht, der den Mitlebenden nicht als ein Heros erscheint, sondern als eine Mischung von Narrheit, Fanatismus und Paradoxie: dieser Mann ist Rousseau. Können wir Voltaire mit der Sonne im Zenith vergleichen, der mit siegender Klarheit überallhin ihre Strahlen versendet, vor deren Glanz sich die lichtscheuen Tiere in ihre Höhlen verkriechen, so erscheint uns Rousseau wie ein Gestirn im Aufgang, dunkleren Scheines, dessen Strahlen mit Nebeln und Schwaden zu ringen haben, das sich zur Klarheit noch nicht durchgekämpft, nicht durchgerungen hat. Wie Macaulay Carlyle, wie Lessing Kant, so tritt Voltaire Rousseau gegenüber; neben der Zeit, die sich ganz selber begriffen hat und nun froh des Erreichten zur Rüste gehen will, tritt die junge, die kommende Zeit, unklar über sich und über ihr Schicksal, aber von dem dunkeln Drange beseelt, ihren Weg zu wagen auf alle Gefahr. Nach Voltaire konnte kein Größerer mehr kommen, sein Name gilt noch heute als Feldgeschrei hüben und drüben, er ist der abschließende Geist. Rousseau weist dauernd hinaus in die unbekannte Zukunft, hin auf die großen Männer, denen er die Wege ebnen sollte. Daher sind auch seine Schriften so voll von Unklarheiten, von Widersprüchen, von Halbheiten auf der einen, von Übertreibungen auf der anderen Seite. Das ruhige Gleichmaß, welches die Seele in Voltaires Schriften findet, vermögen Rousseaus Gedanken nicht zu geben. Aber wir erleben bei ihm das erste Aufdämmern des Tages, in dem unsere Arbeit wie unser Leben verläuft. Verfolgen wir das Beste, was wir in unserem Leben finden, in die Vergangenheit, so stoßen wir auf den Namen Rousseaus.
Um das Werk Rousseaus zu verstehen, ist es nicht notwendig, jeden einzelnen Vorgang seines reichbewegten Lebens zu kennen, wohl aber ist es gerade bei ihm unerläßlich, zu wissen, wie er Leben und Menschen ansah. Seine Werke sind nichts anderes, als die Folgerungen aus seiner Stellung zu den Lebenswerten, und daher muß man diese Stellungnahme kennen lernen, will man die Werke nicht nur äußerlich beurteilen, sondern verstehen. Die wichtigste Hilfe hierfür hat uns Rousseau selber in seinen Confessions gegeben. Dies merkwürdige Buch, das erst nach dem Tode des Verfassers im Druck erschien, ist, nachdem der erste Enthusiasmus, den es erregte, verrauscht war, in seinem biographischen Wert vielfach angezweifelt worden, aber mit Unrecht. Immer wieder erneute Nachprüfungen haben ergeben, daß Rousseau hier nicht nur die objektive Wahrheit über sein Leben geben wollte, wie die ersten Worte seines Buches es aussprechen, sondern, daß er sehr wohl auch subjektiv in der Lage war, es zu können. Namentlich ist jedes Erlebnis, das mit einem Gefühl in seiner Seele verbunden war, mit erstaunlicher Sicherheit im Gedächtnis festgehalten und tritt mit der ganzen Frische des unmittelbaren Geschehens vor den Leser hin.
Es ist kein Zufall, daß die Kindheitserinnerungen einen breiten Raum in den Confessions einnehmen. Das Leben des Kindes ist viel mehr Gefühl als das des Erwachsenen, und Rousseau konnte daher seine Kinderzeit sich ungleich lebhafter vergegenwärtigen, als es der Durchschnittsmensch vermag, der die Gefühle ebenso schnell vergißt, wie er sie intensiv durchlebt.
Vor allem tritt uns hier die Liebe zur Heimat entgegen; wir müssen uns hüten, dies Gefühl erst als nachträglich entstanden und dann in die Erlebnisse der Kindheit zurückprojiziert zu verstehen. Es war in dem damaligen Genf, das eingeklemmt zwischen Frankreich und Savoyen, einen beständigen Kampf um seine Freiheit und seinen Glauben führen mußte, ein starker Patriotismus vorhanden, vergleichbar dem Verhältnis des antiken Vollbürgers zu seinem Stadtstaat. Aus dem Plutarch, der dem beständig lesenden Knaben schon früh in die Hände fiel und in der vorzüglichen Amyotschen Übersetzung bis in seine letzten Tage sein Lieblingsbuch blieb, lernte er, dies Gefühl zu idealisieren. Es war sein Stolz und seine Freude, als er späterhin mit seiner Heimatstadt sich wieder ausgesöhnt hatte, das »citoyen de Genève« auf das Titelblatt seines Hauptwerks setzen zu können. Kein Ereignis hat so tiefen Eindruck auf den reizbaren Mann gemacht, als die Verfolgung, die von der Regierung seines geliebten Genfs gegen ihn eingeleitet wurde.
Um so erstaunlicher muß es scheinen, daß er diesen Heimatsboden, der ihm so viel bedeutete, verließ, das kalvinistische Bekenntnis, in dem er erzogen war, ohne jeden ernsten Kampf abschwor, und zwar, wie die Confessions zeigen, durch keine erheblichen Gründe dazu veranlaßt. Furcht vor Strafe, weil er beim Umherschweifen in Wald und Feld die Stunde des Schließens der Stadttore versäumt hatte, veranlaßte ihn, den heimischen Boden zu meiden. Der Übertritt zum Katholizismus war dann die fast notwendige Folge dieses ersten Schrittes. Die Erklärung für ein so planloses Handeln liegt eben darin, daß die Planlosigkeit im Charakter Rousseaus tief angelegt war. Immer wieder läßt er sich aus scheinbar gesicherten Wegen durch irgendein zufälliges Geschehen hinausdrängen. Alle seine Versuche, die er, der Stimme der Klugheit folgend, in seinem Leben gemacht hat, um zu einer bürgerlich gesicherten Existenz zu gelangen, sind gescheitert und mußten bei seinem Charakter scheitern. Eine Tätigkeit, die den ganzen Menschen täglich in Anspruch nahm, war für ihn unmöglich, weil eine solche Tätigkeit vielleicht den Verstand, nie aber die Phantasie befriedigen kann. Rousseau blieb auch darin ein Kind, daß ihm die Welt, in der er lebte, überwiegend eine Welt der Träume geblieben ist. Es ist merkwürdig, wie lange in ihm der kindliche Glaube fortlebte, daß das Leben morgen beginnen werde, und es ist durchaus verständlich, daß tiefe Schatten der Verstimmung und des Mißmuts, die sich zuletzt zum Wahnsinn verdichten, in sein Leben fallen, als er allmählich das Trügerische dieses frohen Kinderglaubens einsieht, als es ihm deutlich wird, daß dies Leben, so wie es ist, weitergelebt werden muß bis zum Tode.
Zu dem verhängnisvollen Entschluß, seine Vaterstadt zu meiden, wurde Rousseau vielleicht auch dadurch getrieben, daß er wie David Copperfield aus früheren besseren Verhältnissen sich herabgedrückt sah in eine niedrigere Sphäre des Lebens zu untergeordneten Genossen; in eine Lebensstellung, die auch für die Zukunft nichts bieten konnte als eine kleinbürgerliche Existenz, die im grellsten Kontraste zu den Bildern stand, die seine durch Romane genährte Phantasie dem werdenden Jüngling vorspiegelte. Aber wir können noch einen tieferen Punkt finden, der uns die Abneigung Rousseaus vor geregelter Tätigkeit verständlich macht, und dieser besteht in einer eigentümlichen Trägheit, die Rousseau angeboren war, und die ihn sein ganzes Leben hindurch nicht verlassen hat. Diese Behauptung mag paradox erscheinen bei einem Manne, der eine lange Reihe von Bänden geschrieben, der über ein umfangreiches Wissen gebot, der Zeit seines Lebens hart arbeiten mußte, und der es verschmähte, sich für seinen Unterhalt auf die Börse seiner Freunde oder königliche Pensionen zu verlassen. Wer aber die Confessions und namentlich Rousseaus Briefe aufmerksam durchliest, wird leicht ersehen, daß trotz dieser gewaltigen Arbeitsleistung Trägheit den Grundzug seines Charakters bildete.
Soviel ich sehen kann, hat Rousseau nur an einem Werk, der Nouvelle Héloïse, mit Lust und Liebe gearbeitet; bei allen seinen anderen Werken lastete die Arbeit auf ihm wie ein Alb, den er abzuschütteln trachtete. Er war glücklich, wenn er im Augenblick leben, im Augenblick aufgehen konnte. Die Tätigkeit, durch die er seinen Lebensunterhalt erwarb, das Abschreiben von Noten, hatte er deshalb gewählt, weil sie seinem Geist die Freiheit ließ, weil er bei dieser Beschäftigung weiterträumen konnte, weil sie keine größeren Anforderungen an ihn stellte, als der Tag sie verlangte, und weil sie mit dem Tag erledigt werden konnte. Es wäre ihm unmöglich gewesen, sich in den Dienst einer großen Aufgabe zu stellen, die sein ganzes Leben in Anspruch genommen hätte. In noch markanterem Sinne als in dem Goetheschen sind seine Arbeiten Gelegenheitsarbeiten. Das nimmt ihnen nichts von ihrem Wert, aber es zeigt uns, wie ich glaube, das tiefste Motiv für Rousseaus Kulturfeindschaft. Es gibt Naturvölker, die bei Berührung mit der europäischen Kultur alle Lebensfreude, allen Willen zum Leben verlieren, die verwelken und aussterben, weil dieses atemlose Hasten und Treiben sie übermannt und vernichtet. Bei vielen Kulturmenschen ist eine ähnliche Unterströmung im Bewußtsein vorhanden, die in Zeiten der Abspannung bedrohlich an die Oberfläche tritt. Bei Rousseau war sie dauernd Grundstimmung seines Lebens. Er erkannte die Forderungen der Gesellschaft nicht als berechtigt an, das ganze System, auf dem sie basierten, das System sozialer Kultur wurde ihm verhaßt, weil ein Leben, wie er es wünschte und ersehnte, mit zunehmender Kultur immer unmöglicher wird. Was dem Kulturmenschen unerträglich ist, das tatenlose und wunschlose Hindämmern des Naturmenschen, ohne Aufgaben, die das Leben halten und ihm die Richtung geben, gerade dies war das Ziel der Sehnsucht Rousseaus.
Allerdings tritt zu diesem negativen Begriff der Natur als Nichtkultur auch ein positiver, auch er tief eingebettet in die Grundstimmung von Rousseaus Seele. Wenn es ihn freute, im zwecklosen Dahinschlendern den Menschen und ihren Anforderungen zu entgehen, so sprach doch noch gewaltiger zu ihm die Schönheit der Landschaften, die er durchwanderte, das unmittelbare Gefühl, Gott näher zu sein, wenn er sich von seinen Werken und nicht denen der Menschen umgeben sah. So konnte Rousseau Schönheiten da erkennen, wo seine kultivierten Zeitgenossen nur die Reize der Stadt und des Ziergartens vermißten, so wurde er allmählich zu einem Bewunderer und Liebhaber der Pflanzenwelt in ihrer anspruchslosen und zwecklosen Schönheit, so vermochte er von allen Schmerzen und Enttäuschungen, die ihm das Leben brachte und bringen mußte, seine Seele immer wieder rein zu baden im wunschlosen Genuß der Wunder, die Gott den Menschen, die reines Herzens sind, offenbart.
Die Liebe zur Musik, die Rousseau von den frühesten Zeiten seiner Kindheit an bis zu seinem Tode durchs Leben begleitet und das Leben verschönt hat, hängt mit seinem auf das Beschauliche gerichteten Naturell auf das innigste zusammen. Die Musik, die von allen Künsten die unmittelbarste Beziehung zum Gefühl hat, mußte für Rousseau der adäquate Ausdruck seines Verhältnisses zu den Dingen werden, und so finden wir ihn Jahre seines Lebens auf das eifrigste mit der Theorie und Praxis dieser seiner Lieblingskunst beschäftigt. In einem eigentümlichen Kontrast zu seinen Bestrebungen für die Einführung einer neuen auf Zahlenverhältnisse gegründeten Notenschrift steht seine Opposition zu dem Rationalismus der damals herrschenden französischen Musik, und doch ist dieser Kontrast ein nur scheinbarer. Was ihn bei Rameau und Lully abstieß, war ihr Bestreben, die Kunst zu verkünsteln, Pathos an Stelle des Affekts, Rhetorik an Stelle der Leidenschaft zu setzen. Damit war sehr wohl vereinbar, daß Rousseau in der Darstellung der Notenschrift den einfachsten, übersichtlichsten Zahlenverhältnissen vor unseren komplizierten Zeichensystemen den Vorzug gab. Der Inhalt sollte so natürlich, die Form so einfach wie möglich sein. Was Rousseau unter diesem natürlichen Inhalt verstand, das klingt bis zum heutigen Tage aus den zu Herzen gehenden Liedern des »Devin du village« heraus.
Rousseaus Verhältnis zu den Wissenschaften läßt sich nicht auf eine so einfache Formel bringen. Ein systematisches Studium war mit seiner ganzen Naturanlage unvereinbar. So oft er auch den Versuch machte, sich die für einen Gelehrten der damaligen Zeit fast unumgänglich notwendige Beherrschung der lateinischen Grammatik anzueignen, so oft scheiterte er in diesem heißen Bemühen. In keiner einzigen Wissenschaft, selbst in denen nicht, die er am mächtigsten gefördert hat, kam er zu einer wirklich fachmännischen Beherrschung des Details. Was ihn nicht von der Gefühlsseite her zu erregen vermochte, das konnte er nie dauernd seinem geistigen Besitzstand einverleiben. Dafür aber ermöglichte es ihm sein scharfer Verstand, wenn er in den Dienst des Gefühlsinteresses gestellt wurde, in überraschend kurzer Zeit aus einem weitschichtigen Material die wesentlichen Gesichtspunkte herauszuholen, neue Fragestellungen zu formulieren, mit blendender Logik die Argumente der Gegner zu widerlegen und den eigenen Folgerungen siegreiche Kraft zu verleihen. Niemals ist bei Rousseau sein Wissen totes Besitztum geworden, immer war es Bestandteil seines Lebens, weil es nur im Zusammenhang mit dem Lebensgefühl erworben und behauptet werden konnte.
Bringen wir einen so beanlagten Menschen in Beziehungen zu seinen Mitmenschen, so werden wir uns ernster Besorgnisse nicht erwehren können, und spielen sich vollends diese Beziehungen in der Kulturwelt des 18. Jahrhunderts ab, so sind schwere Zerwürfnisse unvermeidlich. Wohl hatte Rousseau recht, wenn er sich als zur Freundschaft geboren bezeichnete. Das Bedürfnis, mit Freunden zu leben, hat ihn ebenso wie die Liebe zur Musik durch sein ganzes Leben begleitet. Mit schwärmerischer Glut schloß er sich mitunter an ganz unbedeutende Menschen an; erst die Gegenwart des Freundes machte ihm das Leben lebenswert und gab den Freuden der Natur wie der Musik ihre letzte abschließende Weihe. Was Rousseau in der Freundschaft suchte, war der vollendete Einklang gleichgestimmter Seelen, die Ergänzung und Erhöhung beider Freunde durch ihren unauflöslichen Bund. Auch der leiseste Mißklang konnte und mußte dies Verhältnis stören, Rousseau spielte in der Freundschaft sozusagen va banque, er wollte alles besitzen oder nichts; hier war jeder Kompromiß unerträglich. Ob diese Anforderungen jemals von der Wirklichkeit erfüllt werden können, läßt sich bezweifeln. In dem Frankreich des 18. Jahrhunderts wurde jedenfalls die Freundschaft ganz anders verstanden als sie in Rousseau lebte, und so waren die schwersten Konflikte gerade mit denen, die er eine Zeitlang seine Freunde genannt hatte, nahezu unausbleiblich. Namentlich wird dies in seinem vielbesprochenen Verhältnis zu Grimm und Diderot, den Führern der Enzyklopädisten, deutlich. Wie faßten diese Männer die Freundschaft auf? Vor allem als eine enge Bundesgenossenschaft gegen die gemeinsamen Feinde in Staat, Kirche und Literatur. Gemeinsame Feldzüge und literarische Unternehmungen zu verabreden, bei fröhlichem Zusammensein die Raketen des Witzes steigen zu lassen, den eigenen Geist im Gedankenaustausch mit dem Freunde zu stärken, den letzten Taler und die letzte Flasche mit dem Freunde zu teilen, das war es, was ungefähr ihren Inbegriff der Freundschaft bildete; das war sicher nicht wenig, aber für Rousseaus glühende Seele lange nicht genug. So war er dauernd in der Lage, sich durch seine Freunde verletzt zu fühlen, ohne daß sie eine Ahnung davon hatten, ihn verletzt zu haben, und sie in Situationen zu bringen, die für ihn ganz selbstverständlich, für die Freunde aber äußerst peinlich waren. Ein Beispiel möge dies veranschaulichen: Als Rousseau seinen in Vincennes gefangen gehaltenen Freund Diderot besuchte, traf er ihn in Gesellschaft des Gouverneurs des Schlosses; ohne die Anwesenheit des Fremden zu beachten, stürzte er sich weinend in die Arme des Freundes. Dieser aber entzog sich dem allzu lebhaften Ausbruch der Rührung Rousseaus und sagte halb entschuldigend zu dem Gouverneur: »Sie sehen, mein Herr, wie mich meine Freunde lieben.« Es war Diderot peinlich, in Gegenwart des Fremden Gegenstand einer so stürmischen Zärtlichkeit zu sein; Rousseau dagegen hätte nie daran gedacht, daß ein Freund in solchen Augenblicken an die Gegenwart eines Fremden denken könnte. Auch David Humes maßloses Erstaunen bei dem stürmischen Verhalten, das Rousseau zeigte, ist wohl verständlich; die Freundschaft durfte eben niemals über das Maß hinausgehen, das Konvenienz und gute Lebensart für das Verhältnis der Menschen zu einander unabänderlich festgesetzt hatten. Beide Teile waren vollkommen im Recht: die einen verstanden die Freundschaft, wie ihre Umgebung sie verstand, Rousseau trug ein anderes Ideal der Freundschaft in seiner Brust, das erst durch ihn die frühere Auffassung in den Herzen der Menschen verdrängen sollte.
Damit hängt zusammen, daß Rousseau nicht geneigt war, dem Begriff der Freundschaft die landesübliche weite Ausdehnung zu geben. Gegenüber dem ganzen Kreise der Finanzaristokratie, in die ihn die erste Zeit seines Pariser Aufenthaltes eingeführt hatte, konnte er ein sehr merkbares Mißtrauen nie überwinden, und namentlich war er diesen Männern und Frauen gegenüber, die gewohnt waren, für Geld alles kaufen zu können, eifersüchtig und öfters sogar taktlos darauf bedacht, seine ökonomische Selbständigkeit zu wahren. Ein wirklich inneres Verhältnis zu ihnen konnte er schwer gewinnen. Sehr merklich sticht dagegen der Ton aufrichtiger Hochachtung ab, den er in seinen Beziehungen zu den Vertretern der Geburtsaristokratie, mit denen er später in Berührung kam, unabänderlich festzuhalten wußte. Die Briefe an den Marschall von Luxemburg, Herrn von Malesherbes, Prinz Conti, Lord Maréchal Keith sind vollgültige Zeugen dafür, daß Rousseaus demokratische Gesinnungen ihn nicht verhinderten, sich dem Zauber, der von rechten Aristokraten auszugehen pflegt, gern und willig zu überlassen.
Eine gesonderte Betrachtung fordert Rousseaus Verhältnis zu den Frauen, die ja in seinem Leben eine große und oft verhängnisvolle Rolle gespielt haben. Häufig ist Rousseaus Sinnlichkeit als durchaus auf Genuß beruhend dargestellt worden. Aber diese Ansicht hält vor einer genauen Analyse nicht stand. Seiner ganzen Anlage nach lebte er auch hier viel mehr in einer Welt der Gefühle als der Dinge. Worauf es ihm ankam, das war die Idealisierung der Wirklichkeit durch das Medium der Liebe, und so konnte es denn nicht anders sein, als daß das Sehnen nach der Vereinigung mit der Geliebten und nicht diese Vereinigung selber für Rousseau den Gipfel des Glückes bedeutete. Dies tritt ganz deutlich in dem Verhältnis zu seiner »Mama«, Madame de Warens, hervor. So ist es denn auch leicht erklärlich, daß seine erotische Phantasie mitunter nicht von einer liebenswerten Frau angeregt wurde, sondern daß sie, gewissermaßen von selber angeregt, sich nun ihren Gegenstand suchte. Es ist nicht richtig, daß Madame d'Houdetot Rousseau zur Schöpfung seiner Julie (in der Nouvelle Héloïse) angeregt hat oder, daß diese der Ausdruck seiner Liebe zu Madame d'Houdetot war, sondern es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß Rousseau Julie liebte, und Madame d'Houdetot zu dieser Liebe hinaufidealisierte. Auch die Erscheinung der Doppelliebe, die