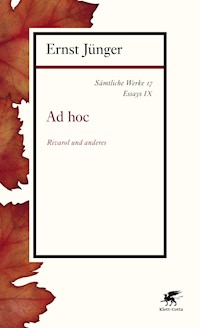
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ad hoc« – Jüngers Gelegenheitsschriften und -reden erlauben Einblicke in seinen Familien- und Freundeskreis, wenn er etwa seinem Bruder zum Geburtstag gratuliert. Doch auch die »Gelegenheit« nutzt er zur tiefergehenden Reflexion. Der vorliegende Band entspricht Band 14 der gebundenen Ausgabe. Der siebzehnte Band versammelt zumeist kürzere Arbeiten Ernst Jüngers, die stets einem konkreten Anlass verpflichtet waren. Doch gehorchen die Reflexionen etwa über Alfred Kubin oder André Gide keinesfalls einem wie auch immer gearteten Zwang; vielmehr zeigen sie zum einen die Vernetzung Jüngers, zum anderen ermöglichen sie Aufschlüsse über ihn selbst, denn auch im Blickwinkel auf den Anderen wird seine Sichtweise erkennbar. Dies gilt insbesondere für die beiden Geburtstagsgrüße an seinen Bruder und die »Familiäre Notiz«, aber auch die Preisreden und Nachrufe, die letztlich zeigen, dass der »Jahrhundertmensch« Jünger mit seinen beinahe 103 Jahren viele seiner Weggenossen überlebte. Im Einzelnen enthält der Band: – Caspar René Gregory – Alfred Kubins Werk: Nachwort zum Briefwechsel, – Die Staubdämonen – Nachruf auf André Gide – Geburtstagsbrief an William Matheson – Karl O. Paetel zum 50. Geburtstag – An Friedrich Georg zum 65. Geburtstag – An Friedrich Georg zum 70. Geburtstag – Brief nach Rehburg – Nelsons Aspekt. Hans Speidel zum 70. Geburtstag – Erinnerungen an Henry Furst – Zwei Besuche. In memoriam Jean Schlumberger – Ausgehend vom Brümmerhof. Alfred Toepfer zum 80. Geburtstag – Post nach Princeton – Alonso de Contreras – Kriegsstücke von drüben – Vorwort zu »Blätter und Steine« – Geleitwort zu Hans Speidels »Invasion 1944« – »Antaios«. Zeitschrift für eine freie Welt. Ein Programm – Dankansprachen bei der Verleihung des Rudolf-Alexander-Schröder-Preises, des Immermann-Preises, des Straßburg-Preises, der Freiherr-vom-Stein-Medaille, des Schiller-Preises des Landes Baden-Württemberg – Durchbruch? Paul Toinet – Rivarol – Paul Léautaud. »In Memoriam« – Postscriptum zu Paul Léautaud
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ERNST JÜNGER – SÄMTLICHE WERKE
Tagebücher I-VIII
Band 1 Der Erste Weltkrieg
Band 2 Strahlungen I
Band 3 Strahlungen II
Band 4 Strahlungen III
Band 5 Strahlungen IV
Band 6 Strahlungen V
Band 7 Strahlungen VI, VII
Band 8 Reisetagebücher
Essays I-IX
Band 9 Betrachtungen zur Zeit
Band 10 Der Arbeiter
Band 11 Das Abenteuerliche Herz
Band 12 Subtile Jagden
Band 13 Annäherungen
Band 14 Fassungen I
Band 15 Fassungen II
Band 16 Fassungen III
Band 17 Ad hoc
Erzählende Schriften I-IV
Band 18 Erzählungen
Band 19 Heliopolis
Band 20 Eumeswil
Band 21 Die Zwille
Supplement
Band 22 Verstreutes – Aus dem Nachlaß
Ernst Jünger
Sämtliche Werke 17
Essays IX
Ad hoc
Klett-Cotta
Die 22 Bände der Sämtlichen Werke, die zwischen 1978 und 2003 bei Klett-Cotta erschienen sind (1–18: 1978–1983; Supplemente 19–22: 1999–2003), enthalten Ernst Jüngers Fassung letzter Hand. Ihr folgt diese Taschenbuchausgabe in Seiten- wie Zeilenumbruch. Offensichtliche Fehler wurden korrigiert, die posthum erschienenen Supplementbände integriert. Der vorliegende Band entspricht Band 14 der gebundenen Ausgabe.
Impressum
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Reihengestaltung Ingo Offermanns, Hamburg, unter
Verwendung von Illustrationen von Niklas Sagebiel, Berlin
Gesetzt von pagina, Tübingen
Datenkonvertierung: Lumina Datamatics GmbH
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96317-5
E-Book: ISBN 978-3-608-10917-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
AD HOC
INHALT
Caspar René Gregory
Alfred Kubins Werk
Nachwort zum Briefwechsel
Die Staubdämonen
Nachruf auf André Gide
Geburtstagsbrief an William Matheson
Karl O. Paetel zum 50. Geburtstag
An Friedrich Georg zum 65. Geburtstag
An Friedrich Georg zum 70. Geburtstag
Familiäre Notiz
Brief nach Rehburg
Nelsons Aspekt.
Hans Speidel zum 70. Geburtstag
Erinnerungen an Henry Furst
Zwei Besuche.
In Memoriam Jean Schlumberger
Ausgehend vom Brümmerhof.
Alfred Toepfer zum 80. Geburtstag
Post nach Princeton
Alonso De Contreras
Kriegsstücke von Drüben
Vorwort zu »Blätter und Steine«
Geleitwort zu Hans Speidels »Invasion 1944«
Antaios. Zeitschrift für eine freie Welt.Ein Programm
Zur Verleihungdes Rudolf-Alexander-Schröder-Preises
Zur Verleihungdes Immermann-Preises der Stadt Düsseldorf
Zur Verleihungdes Straßburg-Preises
Zur Verleihungder Freiherr-vom-Stein-Medaille
Bei einem Empfang der Stadt Laon
Zur Verleihungdes Schiller-Preises des Landes Baden-Württemberg
Durchbruch? Von Paul Toinet(Übersetzung)
Rivarol
Leben und Werk
Maximen
Politik
Literatur
Philosophie
Notizen
Anekdoten
Anhang
Zur Literatur
Zu den Maximen
Zur Übersetzung
Zu einzelnen Stellen
In Memoriam. Von Paul Léautaud(Übersetzung)
Postscriptum zu Paul Léautaud
Bibliographische Notiz
CASPAR RENÉ GREGORY
1
Im August des Jahres 1914 lag in der Leipziger Universität eine Liste aus: »Wie wollen Sie dem Vaterlande helfen?«
»Als Mädchen für alles«, antwortete Professor Gregory, der damals im achtundsechzigsten Lebensjahr stand. Wenige Tage später meldete er sich beim Infanterieregiment 106 als Kriegsfreiwilliger. So sollte dem Hochschullehrer und Ehrendoktor mancher Universität gelingen, was fünfzig Jahr zuvor dem Studenten nicht gelungen war: mit der Waffe ins Feld zu ziehen. Als Einundsiebzigjährigen traf ihn das Soldatenlos.
Caspar René Gregory entstammte einer französischen Emigrantenfamilie. Sein Vorfahr René Grégoire – der Name wurde später amerikanisiert – fühlte sich als Reformierter in der Heimat nicht wohl und begleitete daher im Jahre 1779 Lafayette bei seiner zweiten Fahrt nach Amerika. Sein Enkel Henry Duval Gregory, der Vater unseres Gregory, lebte als Lehrer und Besitzer einer Privatschule in Philadelphia. Die Mutter, geborene Jones, war Engländerin. Sie zeichnete sich durch die strenge Frömmigkeit aus, die der Familie eigentümlich war und in der Landschaft William Penns den ihrem Wesen gemäßen Hintergrund fand. Der Ehe entwuchsen zehn Kinder, von denen Caspar René als das dritte am 6. November 1846 geboren wurde.
Der Knabe verlebte eine glückliche Kindheit innerhalb der großen Familie, in der Frömmigkeit, Liebe und Sparsamkeit regierten – Tugenden, die seinem Leben die Prägung geben sollten. Bis zum fünfzehnten Lebensjahr besuchte er die Schule des Vaters und bezog dann die Universität seiner Heimatstadt.
In diese Zeit fiel der Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges, an dem auf seiten der Nordstaaten teilzunehmen der heiße Wunsch des kaum dem Knabenalter Entwachsenen war. Er mußte sich jedoch seiner Jugend wegen gedulden. Als Achtzehnjähriger tat er dann einige Monate lang Dienst, bis der Friedensschluß dieser ersten militärischen Laufbahn ein Ende bereitete. Er hatte sich also, wie er später sagte, zweimal im Leben als Freiwilliger gemeldet: einmal zur Zeit der Vorderlader bei der amerikanischen Miliz und fünfzig Jahre später in Deutschland zu Beginn des Weltkrieges.
Gern wäre Gregory Offizier geworden; das Strenge und Ritterliche des Berufes zog ihn mächtig an. In dieser Neigung wie in manchem anderen Zuge seines Wesens dürfen wir wohl das Erbe des Urgroßvaters sehen. Wunsch und Wille der Eltern hatten den Sohn jedoch zum Theologen bestimmt. Daher besuchte er nach dem militärischen Zwischenspiel wiederum die Universität von Philadelphia und von 1867 bis 1873 das theologische Seminar von Princeton. Dort ging er neben seinem Studium dem angesehenen Gelehrten Charles Hodge als Adlatus zur Hand. Hodge, der in Halle und Berlin studiert hatte, bereitete eine umfangreiche Glaubenslehre vor. Gregory besuchte in seinem Auftrag häufig auswärtige Bibliotheken, um die Zitate zu vergleichen. Auf einer dieser Reisen lernte er den Professor Ezra Abbot kennen, der es verstand, die besondere Aufmerksamkeit des jungen Theologen auf sein eigenes Arbeitsgebiet zu lenken: auf die Vergleichung neutestamentlicher Handschriften, die damals vor allem durch deutsche Gelehrte gefördert worden war. Neigung und Veranlagung Gregorys, der hier seine Lebensaufgabe erkannte, kamen Abbot dabei entgegen.
Er war es auch, der Gregory auf Constantin von Tischendorf hinwies, der damals an der Universität Leipzig den Lehrstuhl innehatte, von dem aus nach ihm Gregory lange Jahre hindurch wirken sollte. Die Gestalt dieses Gelehrten, den eine kritische Ausgabe des Neuen Testamentes und fast mehr noch die Entdeckung des Codex Sinaiticus, einer griechischen Bibel aus dem vierten Jahrhundert, berühmt gemacht hatten, übte auf Gregory eine große Anziehung aus. Er beschloß, um jeden Preis sein Studium an der Quelle selbst zu beenden.
Nach mancherlei Schwierigkeiten schiffte er sich am 10. Mai 1873 nach Deutschland ein, wo es ihm jedoch nicht vergönnt war, Tischendorf, der schwerkrank darniederlag und bald darauf starb, noch persönlich kennenzulernen. Dafür sollte dem jungen Gregory die Aufgabe zufallen, das letzte Werk des Verstorbenen abzuschließen, das unvollendet geblieben war.
In Leipzig, der alten und berühmten Stadt, die nunmehr sein dauernder Wohnsitz wurde, begann eine Zeit der strengsten Arbeit für ihn. Im Besitz nur sehr bescheidener Mittel war der Student und noch der junge Gelehrte darauf angewiesen, sich neben dem Studium auch nach anderer Beschäftigung umzutun. Übersetzungen, Zeitschriftenaufsätze, Buchbesprechungen, Hilfsdienste im Rahmen der amerikanischen Kapelle forderten einen langen und peinlich ausgenutzten Arbeitstag. Durch Mitwirkung an der »Theologischen Literaturzeitung« gewann er zu deren Herausgeber Adolf Harnack ein enges und freundschaftliches Verhältnis. 1876 schloß er seine Doktorarbeit ab, um sich dann ganz der vergleichenden Handschriftenkunde des Neuen Testaments zu widmen.
In diesem Jahr begann Gregory bereits seine Hauptarbeit, die Einleitung zu der großen, von Tischendorf hinterlassenen Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, die die Witwe ihm zur Bearbeitung anvertraut hatte. Diese Einleitung beschäftigte ihn nicht weniger als achtzehn Jahre lang. Sie umfaßt über vierzehnhundert Seiten und gilt als das für die Fachwissenschaft grundlegende Werk. An viertausend Handschriften des Neuen Testaments werden in ihr angeführt und vergleichend gewürdigt. Das eingehende Studium dieser Schriften brachte den Besuch oftmals weit entfernter Bibliotheken mit sich; Reisen nach Frankreich, Italien, Österreich und England, später nach dem Berge Athos, Konstantinopel, Holland, Dänemark und Schweden unterbrachen die stille, mit Bienenfleiß betriebene Tätigkeit.
Im Jahr 1881 erwarb Gregory die deutsche Staatsangehörigkeit. 1884 habilitierte er sich als Privatdozent, 1889 wurde er zum außerordentlichen, 1891 zum ordentlichen Professor ernannt, nachdem er ehrenvolle Rufe von drei amerikanischen Universitäten abgelehnt hatte. 1894 schloß er sein Hauptwerk ab. Damit erhielt sein Name einen festen und dauernden Rang innerhalb der wissenschaftlichen Welt.
Mit dem wachsenden Ruf gestalteten sich auch die äußeren Lebensverhältnisse günstiger. Im Jahre 1886 vermählte er sich mit Mary Watson Thayer, der Tochter des amerikanischen Theologen Henry Thayer. Aus der glücklichen Ehe gingen ein Sohn und drei Töchter hervor.
In Stötteritz, einer Vorstadt von Leipzig, siedelte sich Gregory in späteren Jahren auf eigenem Boden an. Seit 1913 liegt das Haus, das er bewohnte, im Schatten des Völkerschlachtdenkmals. Von dort aus machte er viele Jahre hindurch, eine den Leipzigern wohlbekannte Erscheinung, jeden Morgen und bei jedem Wetter zu Fuß den langen Weg zum Zentrum der Stadt, um in der Universität und den Bibliotheken sein Arbeitspensum zu bewältigen. Neue Werke wurden begonnen und vollendet; manche studentische Generation zog an seinem Lehrstuhl vorbei. Erfolge und Ehrungen reihten sich immer dichter an die Kette sinnvoll erfüllter Tage, deren gleichmäßiger Fluß nur durch zahlreiche Reisen unterbrochen wurde.
2
Diese kurzen Daten deuten die bescheidene und exakte Lebensführung eines Gelehrten an, eines Mannes, erfüllt von jenem arbeitsamen Idealismus, der in den geistigen Bezirken nicht selten ist. Eigenartig dagegen ist der Charakter, der sich in und neben diesem der Wissenschaft gewidmeten Leben entfaltete.
Gregorys soldatische Neigung wurde bereits als Wesenszug erwähnt. Wenn überhaupt eine in soldatischen Formen geführte Existenz, wie auch Nietzsche sie rühmte, für den Gelehrten große Vorteile besitzt, so trifft das für den Textforscher in besonderem Maße zu. Das Fundament der Textkritik bildet eine möglichst lückenlose und umfassende Kenntnis der Handschriften, einer unübersehbaren Menge von uralten Dokumenten, die vielfach ebenso mühselig zu erreichen wie schwierig zu entziffern sind. Diese Kenntnis setzt einerseits eine disziplinierte Arbeitskraft voraus, andererseits ein ebenso großes Maß an peinlicher Ordnung und Zuverlässigkeit. Diese Tugenden bilden das unerläßliche Handwerkszeug einer fruchtbaren Textkritik, auf der dann wiederum die Textreform zu fußen vermag. Wie lang und schwierig der Weg bis zu den Ergebnissen ist, läßt sich am besten aus der Tatsache ersehen, daß Gregory, als der Tod ihn im hohen Alter erreichte, noch nicht zum letzten Ziel, der Festlegung eines eigenen Wortlauts, vorgedrungen war.
Eine weitere Vorbedingung solcher Forscherarbeit ist die Vertrautheit mit einem sprachlichen Rüstzeug äußerst mannigfaltiger Natur. Das bekannte Wort: »Wieviel Sprachen jemand beherrscht, soviel Mal ist er ein Mensch« läßt sich gut auf Gregory beziehen, der sowohl über eine große Sprachgewandtheit verfügte als auch über den tieferen Sprachsinn, der nicht immer mit ihr verbunden ist. Diesem Sprachsinn, der von vielen seiner ehemaligen Hörer gerühmt wird, verdankte Gregory die Fähigkeit, Stellen der Schrift nicht nur dem philologischen Verständnis, sondern auch dem Gemüt zugänglich zu machen. Er war nicht nur ein vorzüglicher Kenner alter und lebender Sprachen, sondern auch von Schriftarten. Das erleichterte ihm ebensosehr seine Reisen wie seinen ausgedehnten Briefwechsel, der ihn mit Gelehrten in vielen Ländern verband.
So ist es denn kein Wunder, daß Gregory mit den Jahren der Mann wurde, der die meisten der bekannten neutestamentlichen Handschriften gesehen, gelesen und gründlich studiert, viele als erster entziffert und gar manche selbst in den Bibliotheken uralter Klöster Europas und Asiens entdeckt hatte. Unter vielen anderen Ergebnissen seiner Arbeit verdankt die Textforschung ihm die Feststellung des echten Schlusses des Markus-Evangeliums.
Nicht minder als bei der philologischen Arbeit kamen ihm seine soldatische Zucht und Lebensführung auch auf den Reisen zugute. Sparsamkeit und Bedürfnislosigkeit befähigten ihn, die zur Verfügung stehenden Mittel gleichsam zu vervielfachen. Es machte ihm nichts aus, zuweilen nur von Brot und Früchten zu leben, selbst in Ländern des Orients die letzte Wagenklasse oder auf See das Zwischendeck zu benutzen, ja sogar weite Strecken zu Fuß zurückzulegen. So durchwanderte er noch als Sechzigjähriger die Wüste von el-Kantara in Palästina, deren unwirtliches Gebiet er in neun Tagen durchquerte. Mehr als einmal geriet er auf solchen Wanderungen in unmittelbare Lebensgefahr.
Als wertvoller Gewinn dieser Art zu pilgern galt ihm die genaue Bekanntschaft mit der Art und dem Leben fremder Völker, wie sie vor ihm bereits Renan zugute gekommen war. Gregory war ein liebevoller Beobachter des einfachen Volkes mit seinen Freuden und Leiden, seinen Handwerken, Festen und Spielen, seiner bescheidenen Behaglichkeit. Er pflegte sich auch in Leipzig auf dem Wege zur Universität in das Treiben zu vertiefen, das dort das Gewirr der Höfe und Gassen belebt.
Die Durchdringung von Glauben und praktischer Lebensführung gehört zu den Kennzeichen der calvinistischen Erziehung, die Gregory dem Elternhaus verdankt. Sie erstreckte sich auf die verschiedensten Gebiete, von der sozialen Fürsorge bis zum Küchenzettel, von der politischen Tätigkeit bis zum Schnitt der Kleidungsstücke, die der Professor seinen Handwerkern in Auftrag gab. Auf viele seiner Schüler und Bekannten hat das einen bleibenden Eindruck gemacht und auch als Beispiel gewirkt.
Andere wiederum haben besonders hinter den sozialen Handlungen Gregorys einen »amerikanischen Geschmack« und etwas für unsere Verhältnisse Unpassendes gesehen. Konnte ein deutscher Universitätsprofessor etwa einen barfüßigen Jungen, der sich an einer Scherbe verletzt hatte, durch ganz Leipzig in einem Handwagen vor sein Elternhaus fahren oder an einem kalten Regenabend so lange Straßenbahnweichen stellen, bis der durchnäßte Straßenbahner sich in einem nahen Lokal bei einer Tasse Kaffee aufgewärmt hatte? Gregory konnte es. Wie alle starken Persönlichkeiten wurde er durch die Form am wenigsten gehemmt. Er war tief überzeugt vom Anspruch auf Achtung, den alles Lebendige besitzt. Darin erinnerte er an seinen großen Landsmann Walt Whitman, den Dichter der »Grashalme«:
Ich glaube, ein Grashalm ist nicht geringer als das Tagwerk der Sterne,
Und die Ameise ist nicht minder vollkommen, und des Zaunkönigs Ei und ein Sandkorn,
Und die Baumkröte ist ein Meisterstück des Höchsten,
Und die Brombeerranken würden die Hallen des Himmels schmücken.
So sagte Gregory: »Der Lampenputzer, der Straßenkehrer, der Kloakenreiniger kann ein edler, gebildeter Mensch sein« und rief damit in einer Versammlung Heiterkeit hervor. So stellte er sich im Kriege für abgehetzte Frauen vor Bäckerläden an, so nahm er auf einer Zwischendeckfahrt über das Mittelmeer eine jüdische Auswandererfamilie gegen die Späße des Schiffsvolks in Schutz.
Gregorys Wesen strebte zu einer Gleichheit, die nichts mit dem Zollstock zu schaffen hat und die ihm Bedürfnis des Herzens war. Das spürt man in seinen Reden und Schriften auch dort, wo er sich der Ausdrucksweise seiner Zeit und seiner Generation bediente, wie etwa in seinen Ausführungen zu dem, was er den sozialen Ton nannte:
»Du mußt den sozialen Ton suchen. Was ist er? Er ist der Grundton eines Wesens. Es ist der Ton, auf den Dein Wesen gestimmt ist. Wo dieser Ton ist, da bist Du mit. Du steckst darin. Er spricht nicht die Hälfte, sondern das Ganze Deines Selbstes aus. Dein Kopf und Dein Herz sind darin. Du siehst, Du bist der Ton, und der Ton ist Dein Selbst. Ja, aber der andere? Das ist das Merkwürdige. Dieser Ton ist auch der Grundton des Wesens des anderen. Er ist ebenfalls darauf gestimmt. Du hast eine Baßstimme, und er hat eine Fistelstimme. Dein ›Morgen‹ ist mächtig, und seines ist schmächtig. Aber beide haben denselben Grundton. Laß Deine Stimmgabel ruhen. Du triffst ihn nicht. Nur das Leben kann die Wellen dieses Tones messen. Dieser Ton ist der Grundton des menschlichen Wesens. Er ist keinem Menschen fremd. Triffst Du ihn nicht, findest Du ihn nach allem Suchen nicht, so bist Du verstimmt. Laß Dein Herz herausnehmen und es neu machen. Stimme Dich um. Du hast es nötig.«
Man hat Gregory einen Urchristen genannt. Eine seiner Reisen führte ihn in die Nähe Tolstois. Er hatte den lebhaften Wunsch, den Grafen zu besuchen, versagte es sich jedoch aus Rücksicht gegenüber dem von aller Welt Überlaufenen. Ost und West, russisches und amerikanisches Christentum wären sich in den beiden Männern begegnet, doch vielleicht hätten sie trotz aller Verschiedenheit den Grundakkord getroffen – eben das, was Gregory »den sozialen Ton« nannte.
3
Nach der Einberufung änderte sich an diesem Leben nichts als die äußere Form; der Sinn blieb sich gleich. Unter blutjungen Menschen, Schülern, Studenten, Arbeitern und Bauernsöhnen stand die schmächtige, weißhaarige Gestalt in Reih und Glied, marschierte mit ihnen zum Schießen und zu Felddienstübungen aus. Gregory setzte seinen Ehrgeiz darein, auch hinter dem Jüngsten nicht zurückzubleiben, ja es ihm noch zuvorzutun. Wenn es irgend ging, hielt er darüber hinaus um 6 Uhr morgens noch die gewohnte Vorlesung in der Universität. Am 9. Oktober des ersten Kriegsjahres wurde er Gefreiter, am 27. Unteroffizier.
Die Vorgesetzten wollten ihn schonen, ihn in der Heimat zurückhalten, um ihn den unmittelbaren Gefahren des Krieges zu entziehen. Es drängte ihn jedoch, das, was er begonnen hatte, ganz zu tun, und er erreichte es, den Marschbefehl an die Front für sich zu erwirken. Im Mai 1915 rückte er zur 47. Landwehrbrigade ins Feld. Er wurde zunächst mit der Führung der Gräberlisten beauftragt und hatte auch hier großen Widerstand zu überwinden, ehe er in den Gräben Dienst tun durfte. Die Stellung lag in der Champagne bei Fresnes, Vitry und Courcy, im Bannkreis der schweren Festungsgeschütze von Reims. Jeder, der selbst dort »in der Kreide« gelegen hat, kennt die aufreibenden Anforderungen des Grabendienstes in jenem Gelände und zu jener Zeit.
Für das Winterhalbjahr 1915/16 forderte die Universität Leipzig Gregory gegen seinen Willen an. Er beeilte sich, nachdem er die letzte Vorlesung dieses Semesters gehalten hatte, am 1. Mai 1916 zur Truppe zurückzukehren. Dort tat er in der alten Stellung Zugführerdienst und setzte die Arbeit an den Gräberlisten fort. Am 16. November 1915 war er zum Leutnant befördert worden.
Auch in diesem letzten Abschnitt tritt der Charakter und treten die Tugenden dieses Mannes sichtbar hervor – oft in einer Summe scheinbar belangloser Kleinigkeiten, hinter denen seine Haltung sich verrät. Sein Regiment sagte ihm »Anspruchslosigkeit, Diensteifer, gerechte und unermüdliche Fürsorge für seine Untergebenen« nach. Mut gehörte zu seinem Charakter, war aber für ihn keine Sache, um die man Aufhebens macht. Er meldete sich freiwillig, als Offiziere für die Somme-Schlacht angefordert wurden. Er irrte vor den Gräben herum, um einen verwundeten Patrouillengänger zu bergen, und es bedurfte des Einspruchs von Kameraden, um ihn daran zu hindern, selbst auf Patrouille zu gehen.
Die Tätigkeit bei den Gräbern war keineswegs ohne Gefahr. Viele von ihnen lagen im Bereich des Infanteriefeuers, andere selbst vor den eigenen Stellungen, so das Grab von Hermann Löns, der in dieser Gegend als Kriegsfreiwilliger im Füsilierregiment 73 gefallen war. Auch dessen letzte Ruhestätte suchte Gregory zu ermitteln, wie viele andere.
Seltsam berührt es, wie selbst die Beschäftigung mit den Gräbern mit Gregorys Berufung in Einklang steht. So wird berichtet, daß er am Körper eines jungen, bei Kriegsbeginn gefallenen Franzosen, der nach zwei Jahren umgebettet wurde, einen durch die Erde fast ganz zerstörten Brief an die Mutter fand und mit peinlicher Sorgfalt aus dem zerbröckelten Papier wieder zusammenfügte, um ihn über das Rote Kreuz nach Frankreich zu senden. Er entdeckte dabei, daß dieser Gefallene gleich ihm den Vornamen René geführt hatte. Soldbücher, Erkennungsmarken, Briefe und kleine Fundstücke dienten ihm, die Namen von unbekannten Gefallenen zu ermitteln; und unwillkürlich erinnert man sich hier seiner Beschäftigung mit alten Pergamenten und Papyri.
Caspar René Gregory zog nicht trotz, sondern wegen seines Christentums ins Feld. Das bezeugen die Erinnerungen seiner Kameraden an ihn und viele Stellen seines mit großer Bescheidenheit geführten Tagebuchs. Hier ist ein Mensch in einer Zeit, in der es sehr schwierig geworden ist, ein Mensch zu sein. Es zog ihn dorthin, wo es am schwersten war, nicht seinetwegen, sondern wegen der anderen.
»Ich habe gehofft, daß die Unterordnung eines alten Mannes das Sich-Unterordnen einem jüngeren Manne leichter machen würde. Diese Hoffnung hat mich nicht getäuscht. Oft habe ich Kameraden bemerkt, die hurtiger herbeisprangen, weil der alte Kerl schon da war. Auch habe ich unzählige Male erlebt, daß Kameraden aus Freundlichkeit und Güte zugegriffen haben, um mir eine Sache zu erleichtern.«
Und: »Ein Einzelner kann wenig tun. Aber ich möchte meinen Zentimeter schieben.«
Sein Bursche weiß von ihm zu berichten: »Er war zu mir wie ein Vater und hat mir viel von seinem Leben erzählt. Unsere Mahlzeiten nahmen wir gemeinschaftlich an einem Tische ein. Er aß dasselbe Essen wie ich, aus der Feldküche. Als ich zu ihm hinkam, sagte er gleich: ›Meine Stube können Sie so gut bewohnen wie ich.‹ Auch nahm er an meinen Familienverhältnissen teil.«
4
In der Feuerzone im weiteren Sinne weilte Gregory die ganze Zeit hindurch Tag und Nacht, denn alle Orte, an denen er zu tun hatte, lagen in Reichweite der Geschütze, die oft genug ihr Blutopfer forderten. Nicht selten war er es, der den Gefallenen den letzten Gruß über das Grab nachrief: »Durch das Tor des Todes sind sie in das höhere Leben gerückt … Unsere Blicke haben sich nicht auf die Verwesung des fleischlichen Leibes, sondern auf den Schwung des befreiten Geistes zu richten … Glückauf! von dem Vergänglichen zu dem Ewigen! Glückauf!«
Diese Worte sollten auch für ihn selbst gelten. Am 22. März 1917, wenige Tage, nachdem er erste Frühlingsblumen von einem Grabe gepflückt hatte, um sie der Mutter des Gefallenen zu senden, stürzte Gregory mit dem Pferde, und ein schwerer Bluterguß zwang ihn, bis in die Osterzeit hinein in Neuchâtel das Bett zu hüten. Der Ort war in jenen Tagen häufig dem Feuer französischer Geschütze ausgesetzt. Der Kranke befand sich dabei in doppelter Gefahr, denn sein Zustand hinderte ihn, nach den ersten Schüssen die unterirdischen Deckungen aufzusuchen. So finden wir als letzte Aufzeichnung in seinem Tagebuch: »Nach Tisch starkes Geschützfeuer mit über uns hinwegsausenden Granaten. Um 4.15 Uhr nachmittags Schneegestöber und dann Sonnenschein!«
Unmittelbar nach dieser Aufzeichnung wurde der Ort durch neue Einschläge erschüttert. Gregory war allein im Haus. Eines der Geschosse durchschlug die Mauer, explodierte in einem neben dem Krankenzimmer gelegenen Raum und riß in die innere Wand, an deren anderer Seite das Bett stand, ein breites Loch. Ein Eisensplitter traf den Liegenden am Unterleib. Die Wunde war tödlich; noch am Abend desselben Tages, des 9. April 1917, starb Gregory den Soldatentod. Auf dem Friedhof von Villers-devant-le-Thour fand er, zusammen mit vier gefallenen Kanonieren, die letzte Ruhestatt.
ALFRED KUBINS WERK
NACHWORT ZUM BRIEFWECHSEL
Mit Alfred Kubin verbinden mich Erinnerungen, die weit zurückreichen. Gleich vielen anderen empfand ich für Kubins Werk zunächst die Anteilnahme des naiven Lesers und Betrachters, den seltsame Themen und Bilder in ihren Bann ziehen. Das führte zu einer langen Korrespondenz und endlich zu freundschaftlichen Beziehungen.
Die früheste dieser Erinnerungen reicht bis in den August 1914 zurück. Damals erschien in den Schaufenstern der Buchhandlungen eine Federzeichnung Kubins mit dem Titel »Der Krieg«. Diese Zeichnung entstammte einer bereits im Jahr 1903 veröffentlichten Mappe; sie war also nicht durch das aktuelle Ereignis inspiriert. Sie hätte vielmehr zu jeder anderen Zeit als sinnvolle Aussage gegolten, und auch in jedem anderen Land. Das gehört zu den Kennzeichen der Kunstwerke.
Mir ging es damals wie wohl manchem anderen, der das Bild betrachtete: Es rief einen starken, doch unbestimmten Eindruck auf mich hervor. Da war ein Heer mit Fahnen und Lanzen, in ameisenhafter Verkleinerung sich kaum vom Boden abhebend. Ihm gegenüber ein turmhoher Koloß mit Helm und Schild homerischer Helden, in der Faust eine saturnische Waffe, halb Keule, halb Schlachtmesser. Das Ungeheuer, das bis zu den Hüften passabel scheinen mochte, hatte mit Hufen bewehrte Elefantenfüße, von denen der rechte wie der Stößel eines Mörsers oder wie ein Schmiedehammer über dem Heer schwebte. Gleich würde er zustampfen, gleichviel wohin, auf Reiter und Fußvolk, auf Fürsten und Troßknechte.
Ein solches Bild, vor allem in bewegten Tagen, spricht uns an wie ein Zuruf auf einem Bahnhof, wenn der Zug abfährt. Wir stutzen, doch nur für einen Augenblick. Freilich bleibt eine Berührung, eine Erinnerung. So ging es auch mir – ich habe später diese Zeichnung noch oft betrachtet und darüber nachgedacht. Wie jedes Sinnbild erfaßt sie eine Ambivalenz; sie vereint verschiedene Ansichten derselben Größe auf einem Blatt. Gewöhnlich pflegt von einem Gegenstand der eine diese, der andere jene Seite zu erblicken; und auch im Lauf des Lebens wechseln Wertungen und Ansichten.
In dieser Zeichnung hatte Alfred Kubin zwei entgegengesetzte Aspekte vereint – einen Gegensatz, der von den Astrologen als jener zwischen dem hohen und dem niederen Mars bezeichnet wird. Mars ist nicht nur Herr des Schwertes, sondern auch des Schlachtmessers. Kubin sah ihn gerüstet mit dem Helm des Ares, der den Händeln der Götter und Menschen vorsteht, und zugleich mit den Waffen eines Nachtmahrs, der in finsteren Träumen erscheint.
Allerdings wiegt der Albdruck vor; das Grauen, die Weltangst, dominiert. Das liegt nicht nur an Kubins eigentümlicher Sicht, sondern auch daran, daß sich in dem mythischen Gegensatz ein epochaler verbirgt, der unserer Zeit im besonderen angehört. Seit kurzem sprechen wir, wie von einer klassischen Physik, von einem klassischen Kriege – und diese Formulierung deutet an, daß jener Krieg, dessen Gesetze Clausewitz beherrschte, der Vergangenheit angehört. Er hat die historische Realität verloren, ähnlich wie der antike Helm des Dämons auf unserem Bild. Wenn man den Namen nennt, beschwört man ein Unbekanntes, Ganz-Anderes herauf. Eben darin besteht das Wesen von Kubins Kunst, das man als die Beschwörung der anderen Seite bezeichnen kann. Das bringt mich auf die zweite Begegnung mit seinem Werk. Auch sie war zufällig.
Es war im Herbst 1916 – ich war vom Urlaub zurückgerufen worden und mußte in Cambrai über Nacht bleiben. Ein langer, einsamer Abend stand bevor. Die Feldbuchhandlung war noch geöffnet; die Auswahl war dürftig – mir fiel ein Buch mit dem Titel »Die andere Seite« in die Hand. Ich erstand es, vor allem der Bilder wegen, und gern nahm ich in Kauf, als ich mich darein vertiefte, daß es mich den Schlaf kostete. Das anbrüchige Quartier verschwand, als ich den Maler auf seiner Reise in die Traumstadt Perle begleitete – einer Reise, die ich inzwischen oft wiederholt habe. Auch hier erfuhr ich wie bei jenem ersten Bilde: daß die wiederholte Betrachtung den Eindruck verstärkte, nicht minderte. Damals war die »Andere Seite« für mich ein faszinierendes Abenteuer mit gefährlichen, phantastischen und auch makabren Ausflügen. Sie verbirgt aber weit mehr, nämlich die in einem Albtraum geschaute Vision künftiger Schrecken und Schicksale, und ist in dieser Bedeutung auch heute noch kaum erkannt worden.
Das Buch ließ mich von nun an nicht mehr los. Mehr als ein Dutzend Jahre nach jener nächtlichen Lektüre rezensierte ich die dritte Auflage der »Anderen Seite« in Ernst Niekischs »Widerstand«:
»Man sagt mit Recht vom Menschen, daß er auf Vulkanen zu tanzen pflegt. Es hat für das rückschauende Auge einen grausigen Reiz, ihn unbekümmert sein alltägliches Leben treiben, seine Feste feiern zu sehn, während ein geheimer Uhrzeiger unbeirrbar, Zoll für Zoll, der Stunde der Katastrophe entgegenrückt. So sieht man in Pompeji, der untergegangenen Stadt, in der sich das Leben, wie von aller Zeit abgeschlossen, bis auf den heutigen Tag in seinen zartesten und flüchtigsten Abdrücken erhalten hat, noch die unbeholfenen Zeichnungen, die die Kinder an die Mauern kritzelten, und man sieht dort noch das Liebespaar, das sich in ebenderselben Stunde umarmte, als der Gipfel des Vesuvs auseinanderbarst und der Berg sich bis in seine Grundfesten spaltete.
Freilich hat es unter den großen Massen, die einem vernichtenden Ereignis entgegenlebten, auch immer jene Einzelnen gegeben, denen die Vorahnung des Zukünftigen bereits wie ein Albdruck auf dem Herzen lag. Wir besitzen mancherlei Beispiele dafür, so das merkwürdige Buch »Ruinen«, in dem Volney bereits Jahre vor der Französischen Revolution diesen Zusammenbruch in unverkennbaren Zügen schilderte, so die Prophezeiung, die Cazotte, dem Verfasser des »Verliebten Teufels«, zugeschrieben wird und nach der er dem eleganten Publikum eines übermütigen Abends ohne Ausnahme den Tod unter dem Beil des Henkers voraussagte.
An solchen Prophezeiungen ist die Geschichte reich; sie sind umstritten, doch weniger merkwürdig, als es auf den ersten Blick erscheint. Die Vorstimmung der großen Katastrophen gleicht einer Krankheit, die in den Gliedern liegt, ehe sie sichtbare Symptome zeitigt, und oft ist ein Traum ihr warnendes Vorzeichen. Leicht wird es überhört; wir sollten es ernst nehmen, denn in den Träumen empfinden wir feiner und sicherer als sonst. Hier wird eher geflüstert als gesprochen, und die Gestalten, die auftauchen, sind eher zu ahnen und vorzuahnen, als daß sie zu erkennen und zu benennen sind. Ebensowenig sonderbar ist es, daß solche Ahnungen gerade dem Künstler zukommen, denn das Reich der Träume, das Aufwachsen von Gestalten aus dem Unbewußten, die rätselhaften Zeichen, die in die Dinge geritzt sind und zu tieferer Erforschung locken – das alles ist ihm vertraut. Ja man kann sagen, daß gerade er mit seinen Wurzeln jenem Grunde verflochten ist, in dem das Zukünftige, das Notwendige sich vorbereitet, und daß dieses, möge es nun ein Anfang oder ein Untergang sein, in seinem Werk zum Ausdruck kommen muß. Hier braucht man nicht mehr nach einzelnen Prophezeiungen zu suchen, das ganze Werk enthüllt dem kundigen Auge seine prophetische Natur.
Mannigfaltig gestuft sind die Formen, in denen die Vernichtung aufzutreten vermag, und oftmals bunt wie die Farben, die der Herbst auf den Blättern niederschlägt. Jeder kennt die berühmten Sonnenblumen van Goghs. Sie sind wahrhaft aus Gold, aber aus einem Gold, das bereits in der Glut des Schmelztiegels unter einem letzten Aufglanz zu zerfließen beginnt. Es ist dasselbe Gold und dieselbe Sonnenblume, von der der Salzburger Dichter Trakl, dem ›alle Wege in schwarze Verwesung münden‹, sagt:
Im Spülicht treibt Verfallnes, leise girrt
Der Föhn im braunen Gärtchen; still genießt
Ihr Gold die Sonnenblume und zerfließt.
Durch blaue Luft der Ruf der Wache klirrt.
Ich möchte hier auf ein Dokument aufmerksam machen, das den Verfall in einer konsequenten und vom Willen abgelösten Form demonstriert: den schon vor dem Kriege bei Georg Müller erschienenen Roman ›Die andere Seite‹ von Alfred Kubin, der freilich als Zeichner einen weit bekannteren Namen besitzt. Wir haben hier einen Angsttraum vor uns, der den Ausdruck eines phantastischen Romans gefunden hat. Er zeigt uns, wie es auch hätte kommen können, ja wie es vielleicht noch kommen kann.
Dieser Roman stellt wohl seit E. Th. A. Hoffmann das größte Ereignis auf dem Gebiet des Phantastischen dar. Wie alle Leistungen dieser Art ist er einem geistigen Boden entwachsen, der als ungewöhnlich, ja als krankhaft bezeichnet werden kann. Der Psychiater würde hier reiche Ausbeute finden – Zwangsvorstellungen, Sehstörungen, Halluzinationen, Wachträume, Hysterie, Ängste, Chaos, Desorientierungen, Absencen, regelrechte epileptische Anfälle – daran dürfte kein Mangel sein. Aber das sind untergeordnete Fragestellungen. Wichtig ist vielmehr, daß hier ein Tastvermögen von empfindlichster Feinheit, lange bevor ein ›Zauberberg‹ geschrieben wurde, den langsamen Angriff der Verwesung, ihr unterirdisches Kriechen erfaßt, ihre auflösende Unerbittlichkeit, ihre Schauder, ihre Visionen, ihre verräterische Süßigkeit.
In einer asiatischen Einöde, jenseits der Grenzen aller Geographie, liegt eine seltsame Stadt, eine Art von architektonischem Trödelladen, zu dem jede alte Stadt Europas einige verbrauchte und verwohnte Gebäude beigetragen hat. Alte Mühlen, verrufene Kneipen, Mietwohnungen, Bordelle, Verwaltungsgebäude, sonderbare Türme, Bohèmecafés, an weit verstreuten Plätzen auf Abbruch gekauft, sind unter unendlichen Mühen hierher geschafft und in ihrer alten Ordnung wieder aufgebaut. Das Mobiliar entspricht diesen Wohnungen – Großväterhausrat, aus allen Ecken und Enden der Welt zusammengesucht, wurmstichig, zerschlissen, verstaubt – so wie man es liebt, wenn man, von verblaßten Farben und unbestimmten Gerüchen umgeben, sich seinen Träumereien hingeben will.
Träumer sind es auch, die in dieser Stadt, die stets von dichten Nebeln umschlossen ist, von einem mächtigen Wesen, Patera genannt, versammelt worden sind. Höchst sensible Naturen, Dämmerungswesen, absonderliche Spezies der Gattung Mensch, wie sie am Ende alter, verbrauchter Familien aufzutreten pflegen, verschrobene Rentiers, verwelkte Lebemänner, hysterische Frauen, mannigfaltige Gestalten, die von Goya, Daumier, Doré oder Félicien Rops gezeichnet sein könnten, bilden eine Gesellschaft, die äußerlich vielleicht nicht sonderlich von der einer kleinen Provinzstadt verschieden ist. Nur tritt das Unsinnige eines verbrauchten und stockig gewordenen Lebens, die durch den Mangel an Aufgaben und Werten hervorgerufene Verantwortungslosigkeit, das Grauenvolle einer zufällig gewordenen Existenz deutlicher hervor. Das kündet sich an, indem die anfänglich noch vorhandene Wirklichkeit des Lebens immer tiefer in den trügerischen Abgrund des Traumes versinkt. Die Grenzen der Persönlichkeit, die sittlichen und gesellschaftlichen Werte lösen sich auf. Das Zufällige dringt zerstörend in jede Zelle ein, der Raum verwischt sich, die Zeit verschwimmt, das Nebensächliche und selbst das Läppische wird bedeutungsvoll.
Der Dämon dieser seltsamen Landschaft ist Patera, ein mächtiger Geist, dessen Kraft das Leben der Traumstadt speist. Das Leben der Menschen ist ein Traum, den Patera in hunderttausend Gestalten träumt. Aber dieser regierende Geist ist krank, und in demselben Maße, in dem er verfällt, breitet sich in der Stadt das Chaos aus.
Die eigentliche Leistung des Romans besteht nun darin, daß die Erkrankung und das Absterben einer überpersönlichen Macht bis in die kleinsten Einzelzüge des ihr unterworfenen Lebensgebietes hinein verfolgt und sichtbar gemacht wird. Selbst die unbelebte Materie ist diesem rätselhaften Prozeß unterworfen: so treten in den Gebäuden Risse und Sprünge auf, Möbel und Bücher zerfallen zu Mehl, gewebte Stoffe lösen sich in einen feinen Schimmel auf. Gleichzeitig teilt sich gesellschaftlich die Traumstadt langsam in eine Vielheit anarchistischer Individuen auf, die dennoch durch die Tatsache verbunden sind, daß sie gemeinsam, jeder auf seine Art, demselben Untergang zutreiben. Zuweilen werden alle blitzartig zu Boden gestreckt: Patera hat einen Anfall gehabt. Gut wird geschildert, wie fast bis zuletzt die gesellschaftlichen Formen bestehen bleiben, nur füllen sie sich mit immer phantastischeren Inhalten aus. Endlich erfolgt der absolute Zusammenbruch.
›Von dem hochgelegenen französischen Viertel schob sich langsam wie ein Lavastrom eine Masse von Schmutz, Abfall, geronnenem Blut, Gedärmen, Tier- und Menschenkadavern. In diesem in allen Farben der Verwesung schillernden Gemenge stapften die letzten Träumer herum. Sie lallten nur noch, konnten sich nicht mehr verständigen, sie hatten das Vermögen der Sprache verloren. Fast alle waren nackt, die robusteren Männer stießen die schwächeren Weiber in die Aasflut, wo sie, von den Ausdünstungen betäubt, untergingen. Der große Platz glich einer gigantischen Kloake, in welcher man, mit letzter Kraft, einander würgte und biß und schließlich verendete. – Verrenkte Arme und Beine, gespreizte Finger und geballte Fäuste, geblähte Tierbäuche, Pferdeschädel, zwischen den langen gelben Zähnen die wulstige blaue Zunge weit vorgestreckt, so schob sich die Phalanx des Unterganges unaufhaltsam vorwärts. Greller Lichtschein flackerte und belebte diese Apotheose Pateras.‹
Patera ist tot.
Der Reiz dieses Romans, der bisher nur einen kleinen, aber aufmerksamen Kreis von Kennern gefunden hat und dessen Inhalt hier nur angedeutet werden konnte, besteht einmal in der unübertrefflichen Art, in Bildern zu sehn. Man hat dem Zeichner Kubin den Vorwurf gemacht, mit literarischen Mitteln zu arbeiten, man könnte dem Dichter den umgekehrten Vorwurf machen – vorausgesetzt, daß man für derartige Pedanterien Sinn hätte. Hier ist eine Kraft, die sowohl mit dem Wort wie mit dem Stift etwas ganz Bestimmtes und Unverkennbares zu bilden weiß: ich habe eine solche Begegnung in unserer Zeit immer als einen ganz seltenen und eigentlich unverdienten Glücksfall aufgefaßt. Und es ist für mich gewiß, daß man die besten Nachtstücke Kubins noch in einer Zeit mit Aufmerksamkeit betrachten wird, die von der unseren so weit entfernt ist wie wir von der Callots.«
Seit diesen frühen Begegnungen hörte ich nicht mehr auf, mich mit der Graphik und den Schriften Kubins zu beschäftigen; sein Opus wurde für mich zur Fundgrube. Ich möchte hier nur die Federzeichnung »Der Mensch« erwähnen, deren Anblick mich erschütterte: eine nackte Gestalt, die mit fliegendem Haar auf einem Spiralband hinabfährt, dessen Anfang und Ende im Dunkel verborgen sind. Ich sah das Bild im Winter 1921, in trüber Zeit, in der nicht nur das eigene Schicksal, sondern auch das des Landes fragwürdig geworden war. Hier fand ich die persönliche und die politische Ungewißheit in eine höhere und unabänderliche eingebettet, die sie stärker und doch auch tröstlicher empfinden ließ. An diesen Eindruck knüpfte sich der erste Brief, den ich nach Zwickledt sandte und mit dem eine Korrespondenz begann, die sich über Jahrzehnte ausdehnte.
Es wäre nun irrig, anzunehmen, daß Kubin großer Motive wie des Krieges oder des Menschen bedurft hätte, um die andere Seite der Welt und des Lebens zu beschwören; seine Meisterschaft erweist sich nicht minder im Blick, den er auf die kleinen und unscheinbaren Dinge richtete. Er hört die Nebengeräusche, mustert das Strandgut, durchspäht die verrufenen Orte, die Sümpfe, das Rankenwerk. Ein wurmstichiger Wegweiser wird zur Schicksalsfigur, ein verrostetes Fahrrad zum Symbol des Vergänglichen.
Wir würden solche Darstellungen unterschätzen, wenn wir sie als skurrile Einfälle nähmen, ohne die Dimension zu ahnen, aus der sie sich hervorheben. Kubin überrascht durch seine Aussage, doch wirkt er dauernder und tiefer durch das Unausgesprochene.
Einmal, am Westwall, erhielt ich von ihm aus dem Salzburgischen eine Postkarte, eine Photographie, auf der ein Schloß abgebildet war. In eines der Giebelfenster hatte er ein Kreuz gezeichnet und darunter die mit einem Ausrufungszeichen versehene Anmerkung »Da hats Vampyrnester«. Ich will zugeben, daß die Adnote mich zunächst erheiterte. Offenbar hatte er dort als Feriengast im Zwielicht hin und wieder Fledermäuse ein- und ausfliegen sehen, wie das in alten Gebäuden ja nicht selten ist. Aber es gehört eben zu den Kennzeichen dieses Geistes, daß sich ihm hinter der vertrauten Erscheinung mächtige Perspektiven eröffnen – so sieht er hier in den Dämmerungswesen, die ein anderer kaum wahrnimmt, die Vorboten der unergründlichen Nacht.
Erhöhte Sensibilität, wie sie den Künstler auszeichnet und oft ihm zum Verhängnis wird, sieht das Geheimnis und ahnt auch die Gefahren im Alltäglichen. Ich möchte hier einen ganz andersartigen, doch auch mit seherischer Kraft begabten Autor zitieren – nämlich Léon Bloy. Dieser belustigt sich einmal in einer offenbar gegen Huysmans gerichteten Bemerkung über Geister, die zur Schilderung des Bösen schwarze Messen und einen großen dämonischen Apparat benötigen – und dabei den ins Auge springenden Satanismus ihres Kolonialwarenhändlers an der Straßenecke übersehen.
Dem ließe sich, besonders in heutiger Zeit, manches hinzufügen. Ich will lieber kurz auf die Sensibilität zurückkommen. In ihr begegnen sich der Künstler, dessen Rolle man als die eines vorgeschobenen Tastorgans der zeitgenössischen Gesellschaft bezeichnen kann, und die Welt mit ihrer musterbildenden Kraft. Dieses Widerspiel, dieses Gewebe von Stoff und Imagination, hat Kubin in besonderem Maß beschäftigt; er hat es erfahren und auch darüber nachgedacht. Ein Absatz aus einem seiner Briefe möge es andeuten. Er schreibt aus Zwickledt am 5. Mai 1940:
»Von allen Großen welche empfehlen daß der Maler vom Bewurf zum Teil abgeblätterter Wände, Tapeten, Felsen etc – studieren soll auf Gestaltungen hin – ist Leonardo der Bekannteste – Mir ist das natürlich ein oft gehabtes Erlebnis – Aber erstaunlich war es als ich vor vielen Jahren bei Mondschein mein aus dem Bett gerutschtes Plumeau für den Rückenakt eines schrecklichen Riesen eineinhalb Stunden lange ansehen mußte – so plastisch arbeitete da die Seele im Stoff.«
Der Eindruck erhöhter Empfindsamkeit bestätigte sich durch die persönliche Begegnung, als ich Kubin im Herbst des Jahres 1937 in Zwickledt aufsuchte. Derartiges verrät sich vor allem in den Arabesken und Nuancen; und in diesem Sinne sind einige Notizen aufzufassen, die einem Brief an meinen Bruder Friedrich Georg entnommen sind. Ich schrieb ihn unmittelbar nach dem Besuch:
»… Am nächsten Morgen fuhr ich dann über Nürnberg nach Passau und blieb dort über Nacht. Während des letzten Teiles der Fahrt kann man bereits spüren, daß man der magischen Residenz des Meisters Kubin näher kommt; die Landschaft beginnt einen Eindruck zu erwecken, der sich wohl am besten mit unserem Wort von den ›böhmischen Dörfern‹ andeuten läßt. Unmerklich, aber tief dringen uns fremdartige, östliche Elemente in sie ein, vielleicht sogar letzte balkanische Ausläufer.
Diese Vorstellung wurde mir noch deutlicher, als Kubin mich am anderen Vormittag in Wernstein vom Bahnhof abholte. Er trug einen kurzen Radmantel um die Schultern und sah etwas größer und voller aus, als ich es erwartet hatte. Umgekehrt hatte er sich gedacht, daß ich wie ein Recke aus Artus’ Tafelrunde bei ihm einziehen würde. Wir stiegen dann durch ein Seitental nach Zwickledt hinauf und machten unterwegs, um eine invalide Stampfmühle zu betrachten, einen kurzen Aufenthalt.
Das Haus oder Schlößchen, das Kubin seit über dreißig Jahren bewohnt, eben das mit einem kleinen Glockenstuhl geschmückte Zwickledt, stellte sich als ein äußerst verwohntes, vielleicht aber gerade deshalb um so gemütlicheres Gehäuse dar. Es scheint, daß der Besitzer die Mauern und Möbel soviel wie möglich ihrem eigenen Leben überläßt und daß die Zeit recht ungestört an ihnen arbeiten soll, so wie man Früchte in Weingeist setzt, damit er ihnen das Aroma entzieht. Dies fand ich recht spürbar; so war es, als ob der Kalk an den kahlen Wänden als eine Art von feiner, kreidiger Paste sich voll von dem Fluidum gesogen hätte, wie es das Bewohnen erzeugt. Auch die Möbel sind in diesem Sinne merkwürdig; so fiel mir ein roter, verschlissener, aber sorgfältig gehegter Sessel auf, dann die von Würmern benagte Platte des Arbeitstisches, ein Schirmständer aus bemaltem Porzellan, eine Sammlung von Nippsachen und dergleichen mehr. Sehr in dieser Ordnung schien es mir, daß die in alten Rahmen hängenden Spiegel, die ich auf den Fluren und in den Zimmern sah, gänzlich erblindet waren; die Folie war gekräuselt und wie von zahllosen Regentropfen betupft.
Ich blieb in Zwickledt einen Tag, den wir mit Essen, Trinken, Schlafen und dem Betrachten von Bildern und alten Photographien recht angenehm zubrachten. Kubin schätzt das behagliche Leben; er läßt in den Schlafzimmern einheizen, der Gemütlichkeit wegen auch abends warm servieren und dergleichen mehr. Seine Frau war gerade verreist, dafür sorgten zwei Mägde für unsere Bequemlichkeit. Für Kubin ist die matriarchalische Verfassung, wie sie etwa von Hoffmann in ›Datura fastuosa‹ so verlockend geschildert wird, die einzig angemessene. Es gibt darüber hinaus vielleicht Naturen, die in gewissem Sinne nie aus dem embryonalen Leben hinausfinden, und vielleicht hängt damit auch das Bestreben zusammen, sich in das Haus einzuspinnen wie in einen Leib. Ebenso wurde mir unter diesem Winkel sogleich sehr deutlich seine ungemeine Sensibilität, ein gesteigerter Hautsinn, wie ihn der Hase in seinen Tasthaaren oder die Fledermaus in ihren Ohren besitzt. Dieser ängstlichen Witterung entspricht dann wieder eine lebhafte Munterkeit nach vollzogener Sicherung; so überraschte er mich einige Male, indem er mich bei einer treffenden Bemerkung schnell und vertraulich mit dem Finger antippte. Übrigens erzählte er mir, daß es zu seinen Schwächen gehöre, in einem veralteten Lexikon die Namen von Krankheiten nachzuschlagen, deren Symptome er sich dann einbildet, sodaß seine Frau ihm schon prophezeien mußte, daß er gewiß noch einmal am Kindbettfieber eingehen würde. Auch ist er leicht geneigt, an verzweigte Konspirationen, etwa der Postbeamten, zu glauben, die gegen ihn und seine Sicherheit gerichtet sind.
Am Abend unterhielten wir uns bei einer Flasche Sekt über dies und jenes, so auch über eine Gründung von Silberfuchsfarmen, die seine Phantasie lebhaft beschäftigte. Es handelte sich dabei nach Zeitungsberichten um einen über die ganze Welt verzweigten Konzern mit eigenen Zuchtfüchsen, Tierärzten, Terrains, der aber nur in den Köpfen einiger Schwindler existierte, die seit Jahren Beiträge dafür einzogen, bis sich dann das ganze Unternehmen wie Rauch verflüchtigte. Nachrichten dieser Art üben auf Kubin eine ungemein anregende Wirkung aus. Dem entspricht auch seine Teilnahme für ganz bestimmte historische Abschnitte und Persönlichkeiten, wie die des dritten Napoleon. Diese Teilnahme steigert sich noch, wenn auf irgendeine Weise das Exotische in die Dinge einzuspielen beginnt, wie etwa bei Maximilian von Mexiko oder bei Abdul Hamid, dem letzten Sultan der Türkei.
Das alles ist natürlich eng verbunden mit dem Österreichertum. Dieses Land stellt ein Refugium fast verschollener Dinge dar, und Kubin meinte, daß man in ihm gar nicht wisse, was für ein Paradies da noch zu verlieren sei. Auch bezeichnete er gerade eine gewisse Schlamperei als eines der für ihn unentbehrlichen Medien. Selbst die Technik, die dem doch durchaus zu widerstreben scheint, sieht er gern in anbrüchigen und absonderlichen Verfassungen, durch die ironische Brille des Verfalls.
Ich dachte auf dem Heimwege über dieses und anderes, das mir an ihm aufgefallen war, nach, und es wurde mir dabei das gewaltige Reich des Schwundes ein wenig deutlicher. Kubin bewegt sich in den Vorhöfen, von denen die Residenz des Königs Tod umgeben ist, und dazu gehört doch letzten Endes die ganze Welt. Er kennt den Genuß, den das Leben gerade unter dem Aspekt des Vergänglichen gewährt, und er ist mit der Morbidezza der Dinge vertraut, die ja alle bestimmt sind, früher oder später Triumphstücke des Todes zu sein. Ich dachte an das Breughelsche Bild vom Babylonischen Turm, an dem hier mit Macht und hohen Plänen gearbeitet wird, während er dort bereits, ohne daß jemand darauf achtet, zerbröckelt und zerfällt. Insofern Kubin das weiß, weiß er mehr, als man in unserer so planmäßigen Zeit begreift und wohl auch vertragen kann, er gilt daher auch als nicht positiv. Ich hatte indessen den Eindruck, daß er sich darüber durch eine sehr angenehme Art von geheimer Ironie zu trösten versteht.«
Soweit der Brief. Er mag einiges Licht auf den außerordentlichen Tastsinn dieses Künstlers werfen, auf seine oft durch tiefe Melancholien beschattete Empfindsamkeit. Eine andere Frage bleibt die nach der realen Entsprechung ––– die Frage nach dem, was da ertastet und gespürt wurde. Sie zu beantworten, versuchte ich in einer bereits im Jahr 1931 veröffentlichten Studie »Die Staubdämonen«.
DIE STAUBDÄMONEN
Die bildende Kunst, und die Malerei im besonderen, bietet im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts eine verwirrende Mannigfaltigkeit der Stilarten dar. Dennoch ist es wahrscheinlich, daß diese Mannigfaltigkeit für den Betrachter der Zukunft zu einem sehr einheitlichen Dokument der menschlichen Ausdruckskraft zusammenschmelzen wird. Was sich hier in vielfachen Spielarten als das gemeinsame Thema wiederholt, das ist die Katastrophe, der Untergang einer Welt, von der der Mensch durch Farben und Konturen Zeugnis zu geben sucht. Ob die Farbe in den bunten Tönungen des Herbstlaubes oder in den Lichtreflexen überhitzter Metalle dahinschmilzt, ob das Gefüge unter explosiven Erscheinungen zerreißt oder ob die Linie zu eisiger, geometrischer Kälte gefriert – das ist nur der Unterschied von Fragestellungen, die auf ein und dieselbe Substanz bezogen sind.
Das Phänomen hat Stellungen von äußerster Einsamkeit, innerhalb deren sich der Appell des bedrohten Individuums am Rande der Sinnlosigkeit vollzieht und auf keine Möglichkeit der Verständigung mehr Anspruch erhebt. Dies ist überall dort der Fall, wo mit abstrakten Mitteln gearbeitet wird.
Leichter dagegen fällt der Zutritt dort, wo der Ausdruck sich einer symbolischen Bildersprache zu bedienen sucht. Hier fällt unter den Zeitgenossen die Gestalt Alfred Kubins ins Auge, in dessen graphischem Werk der Einbruch der zerstörenden Mächte in den überkommenen Raum sich deshalb mit besonderer Deutlichkeit widerspiegelt, weil er auf eine symbolische, den reinen Zeiterscheinungen übergeordnete Weise geschildert wird. Die unmittelbare Wirkung ist um so stärker, als sie auf Beschreibung beruht, und zwar auf einer Art der Beschreibung, die nicht etwa als eine Übersetzung des Wortes durch den Zeichenstift aufzufassen ist, sondern die aus der tieferliegenden Zone einer unmittelbaren Einsicht schöpft.
Der erste Eindruck, den die Betrachtung einer solchen Zeichnung erregt, ruft einen gewissen Taumel, eine Störung des inneren Gleichgewichtes hervor, die in der Wahrnehmung begründet liegt, daß hier die gewohnte Ordnung, das Gefüge unserer Welt in seiner Festigkeit getroffen ist. Die Mittel, durch die dieses Erschrecken hervorgerufen wird, sind verschiedener Art. Sie beruhen einmal darauf, daß der sichtbare Zusammenhang dieser Welt in einer zunächst fast unmerkbaren Weise zerrissen wird. Diese Welt ist alt geworden, ihre Sprünge, Ritzen und Fugen treten etwas deutlicher hervor, und dieses Etwas genügt, das Ungeziefer, die Scharen der Ratten und Mäuse ahnen zu lassen, die unter den Böden und in den Gewölben und Kellern verborgen sind. Dann aber gibt es Stellen wie Glas, die so dünn geworden sind, daß man sie nicht mehr zu betreten wagt. Endlich aber sind die Dinge zweideutig geworden; sie rufen sogleich die Frage hervor, inwiefern ihnen noch zu trauen ist. Leben und Tod, Gesicht und Maske, Traum und Wirklichkeit fließen seltsam ineinander ein; das Bewegliche scheint erstarrt und das Starre unheimlich bewegt zu sein. Den Häusern, Bäumen, Gerätschaften und selbst dem Gerümpel haftet ein menschlicher und oftmals tückischer Charakter an, während der Mensch stumpf, tierisch oder automatenhaft im Bilde steht. Daher kommt es, daß das Auge diesen Anblick als eine Aufforderung zum Suchen empfindet; es sieht sich vor das Bild als vor ein Rätsel gestellt.
Diesem ersten Eindruck entspricht die Symbolik der einzelnen Gegenstände, die zeichenhaft, etwa wie die Bilder des Tierkreises oder wie Figuren in einem Wappen, zur Darstellung kommen – in einer Sprache, die mit instinktiver Sicherheit gesprochen wird. Hinter dieser Sprache verbirgt sich die bedeutsame Fähigkeit, Vorgänge unserer Zeit durch Mittel zur Anschauung zu bringen, die nicht dem zeitlichen Bestand entnommen sind. So ist die eintönig rotierende Bewegung der Technik ausgedrückt durch Landschaften, die ein Gewirr von Uhren oder Mühlen erfüllt. Die rasche Vergänglichkeit, die zu den Eigenschaften der Maschine gehört, wird augenscheinlich, wenn man einen Gaukler auf einem jener ersten hohen und seltsamen Fahrräder am Ufer eines urzeitlichen Sumpfes entlangfahren sieht. Überhaupt gleichen alle Maschinen auf Kubins Bildern zerstörten Kinderspielzeugen; sie befinden sich in einem Zustand, der die Vögel einladen könnte, Nester in ihnen zu bauen, und es ist ebenso scherzhaft oder gespenstisch, sie in Bewegung zu sehen, wie wenn ein verrostetes Uhrwerk zu schnarren beginnt.
Daß die hier angewandte Symbolik eine Todessymbolik ist, enthüllt sich nicht nur aus dem Alter, der Wurmstichigkeit und dem hoffnungslosen Verfall des Mobiliars ihrer Welt. Sie treibt auch ein Tier- und Pflanzenleben hervor, das zum Untergang in deutlicher Beziehung steht. Wir finden Sumpf- und Moorgewächse, Schilf, Binsen, Schachtelhalme, Erlen, verwitterte Weiden, die Ringe der Pilze im Moos und die Geheimschrift der Flechten auf brüchigem Gestein. An Tieren kehren häufig wieder der Hund, dem die Witterung für gefährliche Annäherungen gegeben ist, der Rabe, die Schlange, die Katze mit gesträubtem Fell und das scheuende Pferd. Auch fehlt nicht der gewaltige gestrandete Fisch, der schon früh in der deutschen Malerei auftaucht und die Menschen als Vorbote ungewöhnlicher Ereignisse schreckt.
In der Wahl der Orte, die immer Schlachtfeldern gleichen, auf denen die Zeit über das Leben triumphiert, zeigt sich eine große Mannigfaltigkeit. Die reine Landschaft ist öde, oft von Schnee bedeckt, durch dichte Regenvorhänge verhüllt oder von Erderschütterungen zersprengt. Die Wälder und Gebüsche sind wie aus Überschwemmungen aufgetaucht, mit Zweigen, in denen sich der Seetang mit treibendem Röhricht zu langen Bärten verflochten hat. Andere Bilder wieder zeigen einen Grad der absoluten Versteinerung, wie er auf Mondlandschaften zu vermuten ist. Auf wiederum anderen haben sich die Linien zu einem Gewimmel zersetzt, das an Aufgußtierchen erinnert, die aus feuchtem Stroh gezüchtet sind, und das zu mikroskopischer Entzifferung lockt. Der Zustand der Häuser, Dörfer und Städte ist ruinenhaft; sie strömen fast durchweg die Stimmung gefährlicher, verlassener oder verrufener Orte aus. Oft wird der Blick auf Dinge gerichtet, die ein saturnischer Einfluß regiert, auf Brücken, Wegweiser, Mühlräder, Zifferblätter, Meilensteine, Kreuzwege oder Pfade, deren Spur sich im Dunkel verliert.
Das Leben der Personen wird in traumhaften Augenblicken gesehen; es ist von dämonischer Aktivität oder von einer dumpfen, pflanzenhaften Eingesponnenheit. Figuren treten auf, deren Erscheinung auf eine gespenstische Weise überrascht, und andere, die nicht ahnen, daß man sie bei ihrem geheimsten Treiben belauscht. Es wird hier die beklommene Neugier des Märchens rege, wie sie Kinder vor verbotenen Kammern befällt. Eine Art der Tätigkeit, deren Sinn oder deren Sinnlosigkeit dem Täter selbst verborgen ist, wird wie durch Mauerritzen, Schlüssellöcher oder altertümliche Fernrohre gesehen. So fällt der Blick auf den Angler, der unbeweglich am Rande des Weihers sitzt, auf gnomenhafte Gestalten, die in Kellern oder Bodenkammern einsam am Werke sind, auf den Selbstmörder, der seinen Strick befestigt, auf den Geizigen, der im Gewölbe seine Schätze zählt, oder auf den Irren, der aus dem Fenster seiner Zelle gleichmütig auf einen Schwarm von Fliegenden Fischen starrt.
Alle diese Tätigkeiten aber, und seien es die eines pflügenden Bauern oder eines arbeitenden Handwerkers, sind nur mit geheimem Erstaunen zu betrachten – mit dem Erstaunen darüber, wie sie in ihrer grenzenlosen Isolation überhaupt noch möglich sind. Der Eindruck, den sie hervorrufen, ist ungefähr so, als würde man in einer zerstörten Stadt einen einzelnen Menschen bei einer Beschäftigung antreffen, die eigentlich einen blühenden Zustand des öffentlichen Lebens zur Voraussetzung hat.
Dieser Eindruck verstärkt sich dort, wo das Bildwerk Kubins die politisch-gesellschaftliche Sphäre berührt. Die Wirkung ist hier um so eindringlicher, als kein irgendwie gesellschaftskritischer Standpunkt beabsichtigt ist und die Vorgänge sich in abgelegenen, verstaubten, unterirdischen oder ganz phantastischen Räumen vollziehen. Die Berufe sind zweideutig geworden; der Arzt, der Staatsmann, der Metzger, der Gelehrte, der Gärtner, der Diplomat sind in Dinge vertieft, hinter denen ein verborgener, anrüchiger Nebensinn zu erraten ist. In demselben Maß, in dem die Ordnung zweifelhafter wird, in dem die Feiertagsgewänder wie mürber Zunder abbröckeln und die Konvention sich in ein groteskes Marionettentheater verwandelt, erheben sonderbare Existenzen, die an den Rändern der Gesellschaft auftauchen, Anspruch auf Gültigkeit. Spielleute, Zigeuner, Gaukler, Volksredner, falsche Propheten, Quacksalber, Schaubudenfiguren, Possenreißer, Schlangenbändiger, Bärenführer, Wahnsinnige, balkanische und exotische Typen dringen in die Städte ein, die gleichzeitig der Einbruch elementarer, urweltlicher und tierischer Mächte bedroht. Erdbeben, Brände, Überschwemmungen, vulkanische Ausbrüche, dumpfe, mörderische Gewalten, Fabelwesen, Schwärme von Insekten und Schlangen treten auf als die Vollzugsorgane eines apokalyptischen Untergangs.
Deutlicher noch wird der Sinn dieser Visionen, die sich in Traumreichen, dunklen Vierteln oder Märchenstädten abspielen, wenn man sie zu Kubins Stammesart in Beziehung bringt. Was sich hier im besonderen spiegelt, das ist der Untergang des alten Österreich, wie er etwa auch in der Lyrik Trakls schmerzlich zu spüren ist. Aber dieser Untergang wird nicht dort gezeichnet, wo er weltgeschichtlich sichtbar, nicht dort, wo er auf den Schlachtfeldern besiegelt wird. Den einzigen Anklang daran finden wir vielleicht in der Gestalt des Feldzeugmeisters Benedek, einem der wenigen Porträts, die Kubin gezeichnet hat. Weit bestürzender ist, daß der Verfall, der unerbittliche Angriff der Zeit voll Angst im kleinsten, verborgensten Umkreis beobachtet wird: dort, wo die Totenuhr tickt, der Schimmel sich langsam ausbreitet und die Motte im Zeuge nagt. Der Tod tritt in die Bürgerstuben ein und betastet mit seinen Fingern den Plunder der Fransen und Stoffe, er nimmt eine vergilbte Photographie von der Wand, um sie zu betrachten, es amüsiert ihn, eine Spieluhr aus den Biedermeiertagen aufzuziehen, er blickt in die verstaubten Salons mit den Augen eines Kellners, der während einer sinnlosen Orgie gleichgültig seine Rechnung addiert.
Kubin erkennt am Untergang der bürgerlichen Welt, an dem wir tätig und leidend teilnehmen, die Zeichen der organischen Zerstörung, die feiner und gründlicher wirkt als die technisch-politischen Fakten, die auf der Oberfläche angreifen. Sein Werk wird daher bestehen bleiben als einer jener Schlüssel, die verborgenere, geheimere Räume erschließen als der historische Bericht. Es stellt eine Chronik dar, als deren Quellen das Knistern im Gebälk, die Risse im Mauerwerk und die Fäden der Spinngewebe zu betrachten sind.
»Linien, Kreise, Figuren – da steckts. Wer das lesen könnte!« wie Büchners Wozzek sagt.
NACHRUF AUF ANDRÉ GIDE
Begegnungen mit berühmten Männern sind nicht unbedenklich; sie führen leicht zum Verlust einer Illusion. Das ist begreiflich, wenn wir die Emanation bedenken, mit der ihr Werk uns berührt. Wir treten mit hohen Erwartungen an sie heran. Dem standzuhalten, muß zu ihrem Talent noch ein persönlicher Zauber hinzukommen.
Dieser Zauber war André Gide verliehen, wie alle bestätigen, die ihn gekannt haben. Auch mich hat seine starke menschliche Nähe ergriffen an einem Tag, an dem ich vor Jahren bei ihm zu Gaste war. Ich frage mich in der Erinnerung, worauf dieser Eindruck beruhen mochte, und finde, daß sich zu ihm zwei entgegengesetzte Eigenschaften verbunden und ergänzt haben. Einmal war es ein junger, heiterer Mensch, mit dem man zu sprechen meinte, etwa ein Hirt in seiner freien Natürlichkeit. Dann wieder konnte er Züge eines alten Weisen, vielleicht eines gütigen Chinesen, annehmen, eines gelehrten Mandarins, der sich beim Tee mit seinen Gästen über Ideogramme unterhält. Es will mir scheinen, als ob ich nur in solchen Augenblicken bemerkte, daß er eine Brille trug. Diese Polarität, in der Jugend und Alter sich durchdrangen, war bezeichnend für ihn.
Zum Opus werden sich Berufenere äußern – ich möchte nur auf das Verhältnis zur Wahrheit hinweisen, die es beherrscht. Es war notwendig verbunden mit letzten, richterlichen Differenzierungen des Wortes – mit der »Goldwaage im Ohr«. Zugleich äußerte sich in der Kühnheit, mit der das Wort vertreten wurde, ein hoher Grad von Freiheit, und gerade darin liegt die eminente Bedeutung André Gides in einer Zeit, in der man immer befürchten muß, daß die letzten freien Menschen aussterben.
Der Redlichkeit untrennbar verschwistert ist die Gerechtigkeit. Ich nenne den Namen dieses Mannes auch mit persönlicher Dankbarkeit, als einer von jenen, für die er das Wort ergriff zu einer Zeit, in der das Mut erforderte. Er zählte zu den Geistern, die den Haß nicht kennen; ihr Urteil gleicht dem Lichtstrahl, der durch das Trübe dringt.
Daß in André Gide ein wahrer, freier, gerechter Mensch von uns gegangen ist: das ist weit schmerzlicher, als daß ein großer Künstler aus dem Leben schied. Menschliche Größe wiegt schwerer als Meisterschaft. Am schönsten ist es, wenn sie, wie hier, die Meisterschaft erhöht.
Was wird man in hundert Jahren wissen von diesem Werk? Darüber läßt sich streiten – ich möchte glauben, daß auch dann das große »Journal« nicht zu entbehren sein wird für Geister, die sich rückblickend den feineren Strukturen unserer Zeit zuwenden. Was die Aufzeichnungen der Goncourts für unsere Kenntnis der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bedeutet haben, das setzen die von André Gide bis in die Mitte des 20. fort. Da wird man wie auf dem Lithographenschiefer aus zartesten Abdrücken erraten können, was uns beschäftigte und uns zu denken gab. Es ist wohl möglich, daß dem Leser des 21. Jahrhunderts dann manches verschlossen sein, doch vieles auch weniger problematisch erscheinen wird, weil es inzwischen zu Lösungen gekommen ist. Eines wird er jedoch gewiß bestätigen: daß in unserer Zeit nicht leicht zu leben war.
Das gilt für jedes, auch das einfachste Leben; die Zeit wiegt mit Atlasgewicht. Schwer ist es, sie zu tragen und zu ertragen; und Höhen zu gewinnen, auf denen Wort und Freiheit sich vereinen, ist wenigen vergönnt. Das überdauert die Epoche, und in diesem Sinne hat André Gide erfüllt, was Schiller als Zeichen der Meisterschaft rühmt:
Denn wer den Besten seiner Zeit genug getan,
Der hat gelebt für alle Zeiten.
GEBURTSTAGSBRIEF AN WILLIAM MATHESON
Lieber Herr Matheson, wie kommt es, daß ein Gegenstand in dem Bereich, in dem wir sammeln, wertvoll und wertvoller wird? Diese Frage schoß mir vor einigen Tagen durch den Kopf, oder vielmehr vor einigen Nächten, als ich nach alter schlechter Gewohnheit viel zu spät die Lampe gelöscht hatte. Sie wissen ja als Freund der Bücher, daß die nächtliche Lektüre zu den Lastern gehört, die wir am frühesten erwerben und am spätesten ablegen. Möge Ihnen und mir vergönnt sein, ihm so lange zu frönen, wie das Licht uns scheint.
In diesem Falle hatte ich mich einem erprobten Schlafvertreiber gewidmet, nämlich dem Präsidenten de Brosses, der in den »Vertraulichen Briefen« seine Italienreise von 1739/40 mit einer Frische schildert, die auch heut noch das Herz erquickt.
Sie wissen, daß bei geschlossenen Augen die Gedanken noch eine Weile weiterlaufen und sich mit dem Gelesenen beschäftigen, ehe der Schlaf uns überkommt. So ging es mir auch bei dieser Gelegenheit, indem in meiner Erinnerung eine Fußnote des Übersetzers auftauchte, die besagte, daß de Brosses schon früher als Autor aufgetreten sei, und zwar eines seit langem verschollenen Buches über den Kult der Fetische. Das ist ein Titel, der gewisse Begierden in mir erweckt – oder auch schon erweckt haben mußte, wie ich mich entsann. Hatte ich nicht vor vielen Jahren an den Seine-Quais für einige Sous eine Broschüre erstanden, die diesen Titel trug?
Der Gedanke beunruhigte mich; er machte mich wieder hellwach. Ich drehte das Licht an und schlug zunächst im de Brosses die Daten nach. Das Buch über die Fetische war ohne Angabe des Autors, Verlegers und Druckortes in Genf erschienen. Es gilt als Rarität. Indessen war der Verfasser den Zeitgenossen nicht unbekannt geblieben, denn Voltaire, der als Pächter eines de Brosses’schen Gutes einen Streit mit dem Autor hatte, bedachte ihn mit dem Spottnamen »Le Fétiche«.
Meine Neugier begann zu wachsen. Ich ging barfuß in die Bibliothek und wühlte in den theologischen Schriften herum. In der Tat, meine Erinnerung hatte mich nicht getrogen: das Werk befand sich in meinem Besitz. Im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte war es durch eine Reihe von Händen gegangen, auch hin und wieder zu Antiquaren gewandert, die ihre Vermerke und Preise auf das Vorsatzblatt geschrieben hatten, doch hatten sie den Verfasser nicht entdeckt. Diesen Vermerk zu machen, blieb mir vorbehalten; ich tat es mit Genuß und legte mich dann zur Ruh.
Es hatte sich dadurch nichts am Bestande meiner Bibliothek geändert, und doch hatte sich eine Kombination vollzogen, durch die ein Zuwachs gewonnen war. Mein Verdienst daran war freilich gering: den Zuwachs verdankte ich dem bibliophilen Übersetzer und Herausgeber der deutschen Ausgabe, die 1918 in München erschienen ist.
Gewonnen hatte ich durch einen Einblick in den geistigen Zusammenhang der Bücherwelt. Darauf beruht die Freude an der schönen oder seltenen Edition. Das gilt auch für den bibliophilen Wert, der auf der Kennerschaft und Hingabe einer Schicht von Liebhabern und Sammlern beruht. Ohne sie wäre das alles Ballast, totes Papier. Der Wert ist nicht in Zahlen auszudrücken – daß die Dinge einen Preis haben, ist ein grobes Zeichen dafür, daß sie kostbar sind.
Worin beruht also der Wert alter und seltener Drucke, einer Handschrift oder eines Briefes, der vor langem geschrieben ist? Einmal gewiß in einer Schicht, die unseren Augen verborgen bleibt und in sich Genüge findet nach dem Goetheschen Worte: »Doch im Innern ists getan.« Aber dieser geheime Sinn und Reiz, diese verborgene Schönheit müssen entdeckt werden, und das verdanken wir den Liebhabern. Wirkliche Kenntnis wird ja immer auf Liebe gegründet sein.





























