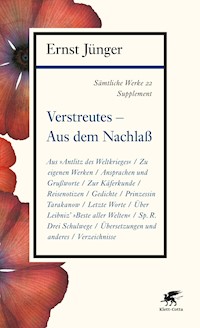
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Abschluss des Gesamtwerks! Der Supplement-Band komplettiert die 22 Bände der »Sämtlichen Werke« Ernst Jüngers. Der vorliegende Band folgt der gebundenen Ausgabe. Entnommen wurde das Tagebuch »Siebzig verweht V (Strahlungen VII)«, das in Band 7 dieser Ausgabe gemeinsam mit »Siebzig verweht IV (Strahlungen VI)« zu finden ist. Aus Band 18 der gebundenen Ausgabe wurden die frühe Fassung von »Eine gefährliche Begegnung« sowie das chronologische Werkverzeichnis überführt. Besonders wichtig in diesem Band sind die bislang unveröffentlichten Reisenotizen aus den Jahren 1948–1963, die ergänzt sind durch die Aufzeichnungen einer Reise des Schülers im Jahre 1909 nach Buironfosse in Frankreich und durch das Tagebuch eines Aufenthaltes der Geschwister Jünger auf Juist im Juni 1969. Von ähnlicher Bedeutung sind die »Prinzessin Tarakanow« und die lange erwartete Erzählung »Sp.R. Drei Schulwege«. Auch sind erstmals versammelt die Vor- und Nachworte des Autors, etwa zu »Afrikanische Spiele«, »Auf den Marmorklippen« und »Jahre der Okkupation«. Ein Nachwort von Liselotte Jünger als der Herausgeberin des Bandes gibt Erläuterungen zu seinem Inhalt und zur Einbeziehung der Arbeiten aus dem Nachlass. Aus dem Inhalt: Aus »Das Antlitz des Weltkrieges« / Zu eigenen Werken: Vor- und Nachworte / Ansprachen und Grußworte / Zur Käferkunde / Reisenotizen / Gedichte / Prinzessin Tarakanow / Letzte Worte / Sp.R. Drei Schulwege / Übersetzungen / und anderes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ERNST JÜNGER – SÄMTLICHE WERKE
Tagebücher I-VIII
Band 1 Der Erste Weltkrieg
Band 2 Strahlungen I
Band 3 Strahlungen II
Band 4 Strahlungen III
Band 5 Strahlungen IV
Band 6 Strahlungen V
Band 7 Strahlungen VI, VII
Band 8 Reisetagebücher
Essays I-IX
Band 9 Betrachtungen zur Zeit
Band 10 Der Arbeiter
Band 11 Das Abenteuerliche Herz
Band 12 Subtile Jagden
Band 13 Annäherungen
Band 14 Fassungen I
Band 15 Fassungen II
Band 16 Fassungen III
Band 17 Ad hoc
Erzählende Schriften I-IV
Band 18 Erzählungen
Band 19 Heliopolis
Band 20 Eumeswil
Band 21 Die Zwille
Supplement
Band 22 Verstreutes – Aus dem Nachlaß
Ernst Jünger
Sämtliche Werke 22
Supplement
Verstreutes – Aus dem Nachlass
Klett-Cotta
Die 22 Bände der Sämtlichen Werke, die zwischen 1978 und 2003 bei Klett-Cotta erschienen sind (1–18: 1978–1983; Supplemente 19–22: 1999–2003), enthalten Ernst Jüngers Fassung letzter Hand. Ihr folgt diese Taschenbuchausgabe in Seiten- wie Zeilenumbruch. Offensichtliche Fehler wurden korrigiert, die posthum erschienenen Supplementbände integriert. Der vorliegende Band folgt der gebundenen Ausgabe. Entnommen wurden das Tagebuch »Siebzig verweht V (Strahlungen VII)«, das in Band 7 dieser Ausgabe gemeinsam mit »Siebzig verweht IV (Strahlungen VI)« zu finden ist, sowie »Eine gefährliche Begegnung« (Band 21 dieser Ausgabe). Aus Band 18 der gebundenen Ausgabe wurden die Nachworte zu eigenen Werken sowie das chronologische Werkverzeichnis überführt.
Impressum
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Reihengestaltung Ingo Offermanns, Hamburg, unter
Verwendung von Illustrationen von Niklas Sagebiel, Berlin
Gesetzt von pagina, Tübingen
Datenkonvertierung: Lumina Datamatics GmbH
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96322-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10922-1
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
INHALT
Aus: »Das Antlitz des Weltkrieges«
Stoßtrupps
Der letzte Akt (Teildruck)
Zu eigenen Werken
Nachwort zu »Afrikanische Spiele«
Geleit zu »Der Friede«
Widmung von »Atlantische Fahrt«
Vorwort zu »Jahre der Okkupation«
Über die Ausgabe der »Werke«
Auf eigenen Spuren
Vorwort zu »Ad hoc«
Adnoten zu »Auf den Marmorklippen«
Zu »Aladins Problem«
Post festum
Ansprachen und Grußworte
Bei Verleihung der Ehrenbürgerwürdeder Gemeinde Wilflingen
Zu Christiane Helmholtz’ Büste des Autors
Einleitende Worte zur Lesungwährend einer Kapitelsitzung der Ritterdes Ordens Pour le Mérite
Zum fünfzigsten Jahrestag des Kriegsausbruchsam 2. August 1914
Zu einer Lesung in Biberach
Dank für eine Ehrung in Amriswil
Grußwort zum Schützenfest in Wilflingen
Grußwort an den Musikverein Wilflingen
Geleitwort zu einer Ausstellung
Einleitung der Dankrede bei der Verleihungdes Goethe-Preises
Geleitwort zu »Wilflingen. 900 Jahre Geschichte«
Über die Bekanntschaft mit Serge Mangin
Zur Käferkunde
Geleitwort zu »Käfer. Form und Farbe – Fülle und Pracht«von Franz Peter Möhres
Über den Sammler
Auf Subtiler Jagd. Zu einer Plastikvon Gerold Jäggle
Geleitwort zu »Der Heldbockkäfer«von Volker Neumann
Splitter
Zu »Auf tausendjähriger Karawanenstraße durch dieMongolei« von Edgar von Hartmann
Zur Rechtschreibreform
Hoff, o du arme Seele
Aus dem Nachlaß
Reisenotizen
Buironfosse. 1909
Feilspäne. Ravensburg 1948
Schweiz. Mai/Juni 1950
Turigliano. 1950
Florenz. Oktober 1951
Pully-Lausanne. 1954
Sardinien. 1955
Sardinien. März/April 1957
Sardinien. Herbst 1957
Sardinien. 1958
Damaskus. 1961
Sardinien. Frühjahr 1961
Pressac. Paris. Karlsruhe. 1961
Ägypten. Sudan. Sinai. 1962
Benicasim. September 1962
Sardinien. 1963
Juist. 1969
Gedichte
Unser Leben
Im Namen aller fahrenden Scholaren
Aus der Festzeitung 1912:
Motto
Selbstbildnis
Nachwort des Dichters
Der Legionär
Aus den Notizheften des Ersten Weltkriegs:
Mein Tagebuch. Was auf die weißen Seiten
Die Fastnacht der Hölle
Ich wünsche Glück und Kummer
Zu Kubins Bild »Der Mensch«
Gleichschaltung
Drei Silben
Au Général Speidel
Prinzessin Tarakanow. Fragment
Letzte Worte. Fragment
Über Leibniz’ »Beste aller Welten«
Sp. R. Drei Schulwege
Übersetzungen
Vom Äther. Aus Maupassants »Rêves«
Das Paris eines Parisers. Von Paul Léautaud
Nachwort
Verzeichnisse
Chronologisches Werkverzeichniszu den Bänden 1–22
Alphabetisches Inhaltsverzeichnisder Bände 1–22
AUS: »DAS ANTLITZ DES WELTKRIEGES«
STOSSTRUPPS
Als nach der Marneschlacht die Stellungen der sich im Westen gegenüberliegenden Heere eine immer größere Festigkeit gewannen und jene Gewirre von Gräben, Drahtverhauen und Stützpunkten entstanden, die man mit dem Namen Stellungssystem bezeichnete, änderten sich auch die Anschauungen, die man über den Sturmangriff aus dem Frieden mit in den Krieg genommen hatte. Solange die angreifende Truppe sich deckungslosen oder höchstens flüchtig eingegrabenen Schützenlinien gegenübersah, genügten die Maßnahmen und Vorbereitungen, die ihr von den Übungsplätzen und Manöverfeldern der Friedensausbildung geläufig waren. Sie bestanden in einer mehr oder weniger langen und ausgiebigen Erschütterung des Gegners durch Gewehr- und Artilleriefeuer, an die sich nach sprunghafter Annäherung unter gegenseitiger Feuerunterstützung der letzte Anlauf mit der blanken Waffe schloß. Der Einbruch erfolgte in den langen Linien, in denen der Feuerkampf ausgefochten war, sie wurden im Laufe des Gefechtes durch eingeschobene Unterstützungen aufgefüllt und sollten im Augenblick des Sturmes eine überwältigende Stärke besitzen.
Schon in den großen Herbstschlachten des Jahres 1914, besonders in Flandern, zeigte es sich jedoch, daß diese Methode den hinter Drahtfeldern aufgestellten Maschinenwaffen des Verteidigers gegenüber zu unerträglichen Verlusten und endlich zum Scheitern jedes Angriffes überhaupt führen mußte. Die Verluste an junger Mannschaft auf den Ebenen vor Ypern legten blutiges Zeugnis dafür ab. Je mehr sich dann die Stellungen verdichteten und verstärkten, desto sorgfältiger mußte die Vorbereitung werden, ehe man es wagen konnte, den ungedeckten Menschen über das, wenn auch noch so schmale, Gebiet vorzuschicken, das ihn vom Gegner trennte. Denn wenn es auch nur Minuten oder vielleicht sogar Sekunden waren, die dem Verteidiger zum Zielen und Schießen blieben, so genügte diese Zeit doch, um mit Maschinenwaffen die Fläche leerzufegen wie einen Tisch. Außerdem zwangen die immer dichter werdenden Drahtverhaue den Angreifer, seinen Aufenthalt im gefährlichen Raume auszudehnen und sich dicht vor den Mündungen der Gewehre und in Wurfweite der Handgranaten aufzurichten, um die Hindernisse zu übersteigen oder Gassen durch sie zu brechen.
Die Vorbereitung des Angriffes mußte daher bald eine Wucht gewinnen, von der man sich im Frieden noch keine Vorstellung gemacht hatte. Dies drückte sich vor allem in der Steigerung des Artilleriefeuers aus, das sich bereits in den ersten Monaten des Krieges noch durch den Einsatz von Minenwerfern und anderen, auf kurze Entfernungen wirkenden Waffen verstärkte. Ferner wurde sowohl die Wirkung des Feuers wie die des menschlichen Angriffes noch dadurch summiert, daß sie sich nicht mehr auf die Breite erstreckte, sondern an bestimmten Orten überwältigend zusammengefaßt wurde.
In bezug auf die angreifende Mannschaft stellte sich heraus, daß die körperlichen, geistigen und moralischen Eigenschaften, die der erste Einbruch in einen so stark gerüsteten und verschanzten Gegner erforderte, weit über den Durchschnitt der Leistung hinausgingen, der in einem Massenheere vom Einzelnen erwartet werden konnte. Die Überwindung solcher Schrecknisse, wie sie dieser erste und entscheidende Teil des Angriffes dem kämpfenden Menschen entgegenstellte, mußte einer ausgesuchten Schar von Sturmsoldaten übertragen werden. Ihr lag es ob, die Bahn zu brechen und den Stein ins Rollen zu bringen.
An diesen zeitlichen, räumlichen und persönlichen Bedingungen bildete sich der Stoßtrupp in seiner Eigenart heraus. Aus dem Heereskörper schieden sich kleine ausgesuchte Verbände, die imstande waren, das feindliche Feuer blitzschnell zu unterlaufen, an die Wirkung der eigenen Feuermaschinen sofort den Einsatz der menschlichen Kraft zu schließen und auf engem Raume geschlossen in die verteidigte Stellung zu stoßen, um sie auseinander zu reißen. Um uns ein Bild zu machen, wie sich die Tätigkeit dieser Verbände in der Wirklichkeit abspielte, müssen wir uns zur Stunde des Angriffes auf eine der großen beschossenen Ebenen Nordfrankreichs versetzen, auf denen sich unter jahrelangen Kämpfen das Schicksal des Krieges entschied.
Wir befinden uns in einer scheinbar menschenleeren Einöde, auf der wie in einer vulkanischen Landschaft seit Tagen die Sprengkegel unzähliger Geschosse steigen und fallen und in deren Weite der Donner der Abschüsse und Explosionen so zur Gewohnheit geworden ist, daß ihn das Ohr kaum noch vernimmt. Weit im Gelände verstreut arbeiten die Artillerien der beiden Heere wohlverborgen gegeneinander an, es ist, als ob diese Arbeit von einer Naturkraft geleistet würde, die sich den Augen des Betrachtenden verbirgt. Ebenso öde und verlassen wie das Land rings umher liegen die Gräben unter den Wolken von Geschoßqualm und Staub, ihre Aufwürfe heben sich vom Boden ab wie ein eng aneinander geflochtenes Netz, so daß die schmale Grenze des Niemandslandes kaum zu erkennen ist. Sie sind mit Menschen überfüllt, die, in der Enge von Stollen und Unterständen zusammengepreßt, seit langem die Stunde des Angriffes erwarten. Nur vereinzelt stehen wenige Posten, die, in Betonstände oder kleine Nischen gedrückt, fast schutzlos dem Unwetter preisgegeben sind, um jederzeit die unter der Erde lauernden Besatzungen alarmieren zu können.
Plötzlich ändert sich das Bild. In dem Augenblick, in dem ein letzter furchtbarer Feuerstoß die Landschaft erschüttert, der alle bisherigen Schrecknisse weit in den Schatten stellt, beginnt der Graben sich an verschiedenen Stellen mit Mannschaften zu füllen. Langsam kriechen sie aus den niedrigen Eingängen der Erdlöcher hervor, um sich an Punkten zu sammeln, vor denen schmale Gassen in die Drahtverhaue geschnitten sind. Sie sind schwer bewaffnet, mit Handgranaten gefüllte Säcke hängen vor ihrer Brust, sie tragen kurze Karabiner am Riemen um den Hals, und auch an ihren Koppeln ist eine Reihe verschiedenartiger Waffen und Werkzeuge befestigt. Einige tragen Maschinengewehre, andere geballte Ladungen, Brandröhren und Sprengkisten. Die Führer halten Uhr und Pistole in der Hand.
Zur bestimmten Sekunde, während noch die letzten Granaten in die feindliche Stellung schlagen, schwingen sie sich auf den Grabenrand und überschreiten das Hindernis. Nun ändert sich mit einem Schlage der leblose Eindruck des Feldes, überall jagen kleine Rudel von Menschen durch Nebel und Dampf, und wenn auch einige Gewehrschüsse fallen und hier und da ein Maschinengewehr einsetzt, so spielt sich doch alles so plötzlich und überraschend ab, daß die Stoßtrupps die gefährliche Stelle schon überwunden haben, ehe sich die Besatzung drüben vom Schrecken der Beschießung erholt hat. Man sieht, wie sie sich vor den zerschossenen Drahtresten auf der anderen Seite in Granattrichter werfen, und gleich darauf kreiseln Handgranaten in schwerfälligem Fluge hinüber, um in einer milchweißen Wolke zu explodieren. Eine geballte Ladung geht hoch und reißt eine breite Lücke in den Draht. Dann folgt ein letzter Sprung, und der schwerste Teil der Aufgabe, der eigentliche Einbruch, ist geglückt. Damit ist die Arbeit aber noch keineswegs beendet, denn der Einbruch erfolgte ja nur an Punkten, während auf das Getöse der Handgranaten hin der angegriffene Graben in seiner ganzen Breite lebendig wird. Nun beginnt erst die eigentliche Technik des Aufrollens, bei dem unter fortwährenden Handgranatenwürfen Schulterwehr um Schulterwehr in erbittertem Kampfe genommen wird. Das Vordringen ist maschinenmäßig geregelt, Werfer, Beobachter und Träger arbeiten, fast ohne ein Wort oder einen Zuruf zu wechseln, Hand in Hand. Wo ein stärkerer Widerstand auftaucht, wird mit Gewehrgranaten und Maschinengewehren nachgeholfen, Gewehrträger riegeln die Seitengräben ab, um Überraschungen und Rückschlägen vorzubeugen. Signalraketen zur Verständigung der Artillerie steigen hoch, in die Eingänge der Stollen werden geballte Ladungen geworfen, und wo Barrikaden den Weg versperren, verlassen einige Schützen den Graben, um sie rechts und links zu umgehen. Bald sieht man die Handgranatenwölkchen der einzelnen Abteilungen sich nähern, die eingeschlossenen Reste der Besatzung ergeben sich oder werden niedergemacht. Nun ist es Zeit, in die in die Tiefe der angegriffenen Stellung führenden Gräben einzudringen, denn schon beginnt sich der Graben mit nachdrängender eigener Mannschaft zu füllen. Die eigentliche Aufgabe des Stoßtrupps, der Einbruch, ist vollbracht.
DER LETZTE AKT
Um den Weltkrieg an der westlichen Front von Anfang bis zu Ende zu überstehen, dazu gehörte unter anderen Glücksfällen auch unzweifelhaft der der Verwundung. Die Verwundung, insofern sie weder zu schwer noch zu leicht war, zählte bei den alten Kriegern zu den Glückstreffern, die die große Lotterie des Krieges in Bereitschaft hielt. Zu leicht durfte sie deshalb nicht sein, weil sie dann nur einen kurzen Aufenthalt im Feldlazarett dicht hinter der Front zur Folge hatte und ihre schönste Frucht, den vierzehntägigen Heimaturlaub, nicht ausreifen ließ. Ein rechter Treffer aber, der sogenannte Salon-, Kavaliers- oder Heimatschuß, wurde mit einem Vergnügen begrüßt, von dem man sich zu Beginn des Feldzuges noch nichts hatte träumen lassen. Unter den Rufen, die aus einer ins Gefecht ziehenden Truppe erschollen, konnte man daher häufig Gratulationen vernehmen, die den ihr entgegenkommenden marschfähigen Verwundeten galten.
Zu einem besonders glücklichen Zufall wurde die Verwundung kurz vor Gefechtshandlungen, die mit der Vernichtung größerer Truppenteile endeten. Im Verlaufe des Krieges, mit der Steigerung der großen Materialschlachten, ereignete es sich immer häufiger, daß von den bei einem Großangriff in der vordersten Stellung liegenden Bataillonen auch nicht ein einziger Mann wiedergesehen wurde. Dies war eine nur allzu erklärliche Folge des Verfahrens, das sich für solche Angriffe herausgebildet hatte. So begann die Wirkung des Vorbereitungsfeuers zunächst alle rückwärtigen Verbindungen zu zerstören, teils um die Verständigung der Kämpfer mit den Stäben und der Artillerie unmöglich zu machen, teils um die Reserven zu verhindern, die vordere Linie zu verstärken. Durch dieses Verfahren wurde die Besatzung der vordersten Verteidigungszone wie durch eine große Feuerglocke überdeckt und von jeder Hilfe abgeschlossen. Erfolgte dann endlich der Angriff, so blieb die Abriegelung durch Feuer bestehen, so daß auch den wenigen Überlebenden jedes Entrinnen unmöglich war. So kam es, daß diejenigen, die die letzten Mitteilungen vom Schicksal einer solchen Truppe zu machen vermochten, die auf dem Anmarsch Verwundeten waren und daß man die nächste, ungewisse Nachricht erst durch den feindlichen Heeresbericht oder durch die Briefe Gefangener erhielt. In vielen Fällen hörte man erst nach dem Kriege Genaueres über die Augenblicke, in denen der Einbruch des Gegners geschehen war. Eine solche Verwundung entzog mich bei Combles dem Schicksal meines Bataillons, das am Abend bei Guillemont in Stellung gehen sollte und das bald darauf bis auf den letzten Mann verschollen war. Das spurlose Verschwinden einer so großen Einheit in der Schlacht war uns damals noch zu neu, um nicht einen mächtigen Eindruck in uns zu hinterlassen – ebenso neu wie die ganze Art dieses Krieges, die mit der Sommeschlacht begann, und um diese handelte es sich hier. Die ganze ungeahnte und noch nie erlebte Wucht des Feuers machte den Eindruck einer Naturkatastrophe, und die Schwere der Verluste war diesem Eindruck angemessen. … <Teildruck>
<Der weitere Text wurde nicht abgedruckt, da er fast wörtlich übereinstimmt mit den entsprechenden Passagen von »In Stahlgewittern« (Bd. 1 der Sämtlichen Werke, S. 100 ff.).>
ZU EIGENEN WERKEN
NACHWORT ZU »AFRIKANISCHE SPIELE«
Die Erzählung des Herbert Berger gehörte recht lange meinen unveröffentlichten Papieren an. Ich möchte diese kleine Schrift dem Sinne nach als meine erste betrachten, obwohl sie später entstanden ist – als ein Experiment, dessen Ausgang ergibt, daß man die Kraft nicht an jedem beliebigen Punkte ansetzen kann. Die Zeiten der Klingerschen Dramen, deren Helden sich beiläufig erkundigen, in welchem Erdteil sie sich gerade befinden, sind leider vorbei. Vielleicht kehren sie verändert zurück. Mit den Lichtern der bürgerlichen Welt sind auch die Illusionen ihrer farbigen Ränder verblaßt. Der Einzelne lebt heute unter veränderten Bedingungen, und es scheint mir ein lohnendes Gegenstück, ihn aufzusuchen, wo er sich als Punkt im Koordinatensystem der Totalen Mobilmachung bewegt – etwa hoch über nächtlichen Wolken schwebend während des einsamen Absprunges in ein von Grund auf feindliches Reich. Welcher Art sind die Kräfte, die so seltsame Bilder ermöglichen?
Die Veröffentlichung von Büchern ist von jeher ein Wagnis gewesen; sie ist es heute noch in einem besonderen Sinn, von dem man sich früher nichts träumen ließ. Es scheint, daß der Druck die Bücher in zunehmendem Maße zu verändern beginnt, und zwar in einer Weise, die den Wirkungen des Lichtbildes oder der künstlichen Stimme entspricht. Ich nehme an, daß der Autor, der seine Bücher in den Auslagen der Buchhändler erblickt, ein wachsendes Gefühl der Befremdung empfinden muß; seine Veröffentlichung gleicht dem Wurf in einen Raum, der einer veränderten Physik untersteht. Oswald Spengler führte diese Wirkung auf den Leser zurück; er, dessen so einsamer Tod mich lebhaft ergriff, machte übrigens auf der vorletzten Seite seiner »Jahre« zu unserem Thema eine jener Anmerkungen, wie man sie unter Auguren schätzt.
Was aber den Leser betrifft, so mache ich Ausnahmen, wenngleich ich zugebe, daß ein Echo die Leistung verändert und daß gerade sein Beifall Besorgnis erweckt. Es gibt jedoch auch vereinzelte Beobachtungen, die diesem Befund widersprechen – so entdeckt man in manchen Filmen feine und fast dämonische Züge, und man hat auch den Eindruck, daß sich Organe entwickeln, die diese Berührungen zu erfassen imstande sind.
Aber auch davon abgesehen, ist es ohne Zweifel ein Zeichen der Schwäche, wenn der Geist sich über die wachsende Monotonie und Uniformierung der Anschauung, die nicht zu leugnen ist, beklagt. Wenn wirklich Eigenart vorhanden ist, so ist sie es am wenigsten, die diese Monotonie zu scheuen hat – wie man denn auch den Wuchs und die Umrisse von Bäumen besser auf Ebenen als im Dickicht des Waldes erkennt. In der Tat deuten sich solche Verhältnisse an; das Versteckspiel wird schwieriger, und man weiß heute über weite Räume hinweg sehr genau übereinander Bescheid. Die Luft wird härter, aber zugleich durchsichtiger, und damit treten die Maße deutlicher hervor.
Die erste Fassung dieser Spiele zeichnete sich von der vorliegenden durch eine stärkere Lösung aus, in der der gute Paul Ekkehard mit seiner Bande den Ausschlag gab. Es gibt jedoch Unternehmungen, denen der Mißerfolg das einzig Angemessene ist, wenn man nicht zur immer noch beliebten romantischen Täuschung seine Zuflucht zu nehmen gedenkt. Dies gilt im besonderen für jedes Bestreben, das sich der Kälte der heraufziehenden technischen Ordnungen zu entwinden gedenkt. Das Feld, auf dem wir uns zu schlagen haben, ist mit geometrischer Schärfe abgesteckt; es gibt hier kein Ausweichen. Auch der Exotismus gehört zu den romantischen Ausflüchten; dies erinnert mich an die Bemerkung von Léon Bloy über jene Leute, die dem Teufel unter fremden und absonderlichen Verkleidungen nachspüren und bei diesem Bestreben den weit stärkeren Satanismus ihres Kolonialwarenhändlers übersehen, der an der nächsten Ecke wohnt. Das Verständnis so vorzüglicher Bemerkungen setzt jedoch Erfahrung voraus.
Neben der Erinnerung an ganz ähnliche Zustände, deren sich wohl jeder mehr oder minder deutlich zu entsinnen vermag, entnahm ich einige landschaftliche Züge dem Rosenschen Buch. Unter Umständen könnte auch der Pädagoge hier einige Anregungen finden, obwohl zwischen den Aufgaben des Autors und denen des Pädagogen Unterschiede bestehen. Der Pädagoge hat sich nach den Gesetzen der Erziehung zu richten, der Autor dagegen nach denen der Schilderung, wobei er es dem Leser überlassen darf, welche Lehre er zu ziehen gedenkt. Dieses Verhältnis wird leicht übersehen; auch tritt es wie alle solche Einteilungen niemals rein an den Tag, denn einmal muß der Lehrer auch in der größeren Schule des Lebens erfahren sein, und andererseits gibt es moralische Gesetze, von denen der Autor sich nicht entbinden darf. So würden wir einen Kriminalroman als anstößig empfinden, an dessen Ende statt der Ordnung das Verbrechen triumphiert, obwohl dies im Leben häufig geschieht.
Die Art und Weise, in der sich die jungen Leute ruinieren, ist mannigfaltig genug; sie wiederholt sich in den Stücken des Terenz nicht weniger als in Werthers Leiden oder im spanischen Schelmenroman. Es scheint fast, als ob im Leben ein gewisser Abschnitt unumgänglich sei, in dem man die Verhältnisse, in die hinein man geboren ist, als abgestanden und verstaubt empfindet und in denen man in seinen Vätern und Erziehern die natürlichen Feinde erblickt. Wir sehen das sowohl bei Robinson wie bei Stendhal, und sowohl bei Kleist, der nach Boulogne, als bei Friedrich dem Großen, der nach London zu entweichen gedenkt. Solche Abschnitte scheinen zum Risiko des Lebens zu gehören; sie sind oft geschildert, und ihre Kenntnis ist wichtig genug. In den Köpfen der jungen Leute sieht es oft wunderlich aus, und hier Änderung zu bewirken, genügt nicht die Belehrung allein. Hierfür gibt auch die Fremdenlegion ihr Beispiel ab, denn trotz aller Warnungen und Schreckensbilder hat es den Franzosen seit Simplizius’ Zeiten nie an Dummen gefehlt, die ihnen ihre Straßen und Grenzplätze ausbauten, und dieses Schauspiel ist ärgerlich genug. Da also die Vernunft nicht genügt, hier Abhilfe zu schaffen, muß man auf andere Mittel sinnen – und das einzig wirksame scheint mir darin zu bestehen, daß man im eigenen Lande ähnliche Einrichtungen schafft. Freilich sind in dieser Beziehung die imperialen Staaten begünstigter, denn wie erschlossen liegt nicht die Welt für den jungen Engländer da? Hier fließt das besondere Wagnis in das Strombett des Staates ein, und die Abenteuer der Churchill und Lawrence sind Weltabenteuer im Dienst. Es gibt indessen auch Räume, die sich eben erst erschließen und die sich der kühne Sinn, ohne sich in die Ferne zu verlieren, wohl zu erobern vermag. Zu ihnen zählt das Luftreich, in dem sich der Mensch wie ein Adler bewegt.
Überhaupt mehren sich die Anzeichen, daß der Elementargeist uns näher rückt. Die Gefahr wird brennender, und damit vermindert sich notwendig die Schulfuchserei. Wir treten in einen seltsamen Abschnitt ein, in dem man zugleich natürlicher und künstlicher lebt, auf jeden Fall aber gefährlicher, und Hoffmanns Visionen gewinnen Realität. Aber noch dringt die Ahnung künftiger Ordnungen verworren in unser Dasein ein wie die verwehten Takte einer fernen Musik. Halten wir uns vorläufig an den schönen Spruch von Théophile Gautier: »La barbarie nous vaut mieux que la platitude.« Das ist in der Tat eine Alternative, über die sich reden läßt; vor allem, wenn man befürchtet, daß der Mensch sich zu beidem zugleich zu entschließen gedenkt. Dieser Gedanke taucht jedesmal in mir auf, wenn mich mein Weg an einem unserer neuzeitlichen Denkmäler vorüberführt – ich meine jene ungeheuren Bomben, die man auf Betonsockeln in die öffentlichen Anlagen stellt.
Diese naiven Sinnbilder, durch die wir die banalen Kunstwerke unserer Väter ersetzen, sind die Symbole eines Zustandes, in dem wir seit über zwanzig Jahren begriffen sind, und noch ist kein Ende davon abzusehen. Die Nachwelt täte jedoch unrecht, uns allzusehr zu bedauern, denn auch im Feuer ist Leben, wie das Beispiel des Salamanders beweist. Auch steht es uns frei, uns zuweilen im Vergangenen zu erholen; ich tat das mit dieser Niederschrift, und es würde mich freuen, wenn sie auch den Leser nicht allzusehr langweilte.
GELEIT ZU »DER FRIEDE«
Die Schrift »Der Friede« wurde im Winter 1941 in ihren Grundzügen entworfen und lag im Sommer 1943 in dieser Fassung vor. Inzwischen hat die Lage der Dinge sich geändert; nicht aber geändert haben sich die Heilmittel, durch die allein Europa und darüber hinaus die Welt gesunden kann.
Es ist mir ein Bedürfnis, den Lesern des Manuskriptes für die Sorgfalt zu danken, mit der sie das Geheimnis bewahrt haben – so mancher von ihnen trotz aller Schrecken der Gefangenschaft. Besonders gedenke ich des Generals Heinrich von Stülpnagel, des ritterlichen Mannes, unter dessen Schutze die Schrift entstand.
Gewidmet sei die Arbeit meinem lieben Sohn Ernst Jünger; auch er hat sie gekannt. Nachdem er sich, fast noch ein Knabe, im Widerstande gegen die innere Tyrannis bewährt und auch in ihren Kerkern geschmachtet hatte, fiel er am 29. November 1944 im Marmorgebirge von Carrara mit achtzehn Jahren für sein Vaterland. So haben sich die Besten der Völker nicht geschont. Ihr Opfer und der Schmerz, den sie uns hinterließen, wird fruchtbar sein.
Kirchhorst bei Hannover den4. April 1945
WIDMUNG VON »ATLANTISCHE FAHRT«
Den deutschen Kriegsgefangenen in England
Aus meinen Manuskripten wählte ich dieses, weil es Erinnerungen an Sonne und Raum enthält. Die Erde ist groß. Möge es einladen zu geistiger Begleitung und Wanderschaft. Ich sende es nach drüben mit herzlichem Dank für die Briefe, die ich aus den Lagern erhielt, und mit dem Wunsche, daß recht bald die Stunde für die Rückkehr in die Heimat schlägt, die Euch entbehrt.
Kirchhorst, 24. März 1947
VORWORT ZU »JAHRE DER OKKUPATION«
Ein Tagebuch hat kein Thema; es hat kaum eine Form. Es will die erste, flüchtige Berührung mit der Wirklichkeit und ihren Eindruck fassen; darin liegt seine Begrenzung und sein Reiz.
Auch mit »Jahre der Okkupation« ist kein Thema, sondern ein Rahmen, ein zeitlicher Abschnitt gemeint. Er gliedert sich den fünf vorangegangenen, während des Zweiten Weltkriegs entstandenen Teilen des Tagebuches an und soll sie abschließen.
Die Geschichte der Okkupation wird so bald nicht geschrieben werden, schon deshalb, weil der Zustand, hier mehr, dort weniger sichtbar, andauert – nicht nur länger, als man befürchtet hatte, sondern vielleicht auch länger, als man ahnt. Die Besetzung zählt zu den Formen, die den Verlust der nationalen Souveränität ankünden. Wie dieser Verlust selbst, so wird auch sie unmerklich ihren Sinn verändern im Übergang zu Einheiten, die zugleich stabiler und umfassender sind. Der Schmerz freilich läßt sich nicht abkaufen. Er gehört zur notwendigen Mitgift, die ein neuer Stand einfordert.
Ein gutes Beispiel der Katastrophe gibt der Katarakt – auch was ihr Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit betrifft. Das Auge ruht auf einer Wasserfläche, auf der es viele Boote sich frei bewegen sieht. Nur wenige der Insassen spüren den feinen Sog, der wie der Tastarm eines fernen Ungeheuers um die Kiele spielt. Allmählich wird die Strömung stärker, und das Belieben mindert sich. Die Ufer werden steiler, dunkler; die Boote beginnen zu kreiseln und werden in eine Richtung gepreßt; die Fahrt beschleunigt sich. Das Brausen des großen Falles wird hörbar und schwillt an, bis es die Stärke des Donners erreicht. Dort droht Vernichtung; ihr Wirbel ist unvermeidlich; man muß ihn bestehen oder untergehen. Die Freiheit ist geschwunden; der Zwang wird absolut.
Jenseits des Katarakts rücken die Ufer wieder auseinander; die Wasser beruhigen sich allmählich, die Freiheit stellt sich auf neuer Ebene und unter neuen Gesetzen wieder her. Das ist ein Schauspiel, das sich wiederholt. Einmal auch wird der Strom ins Meer münden. Dort ist die Freiheit absolut.
Ein solcher Wechsel hat viele Schichten; er wird in vielen Kammern sowohl empfunden wie durchdacht. Er hat seine primitive Seite wie in der Antike: wenn die Männer gefallen sind, breitet sich der Schrecken über die Wehrlosen aus. Daran ändert nichts, daß er sich der technischen Mittel bedient, zu denen auch die Propaganda gehört.
Wunderbar ist demgegenüber der geistige Zustrom, der die physische Not begleitet, als ob Hunger, Schmerz und Gefahr ein Innerstes aufschlössen. Das war mir bereits in Frankreich und Rußland aufgefallen, wo ich den Vorgang als Okkupant betrachtete, und dann in erhöhtem Maße im deutschen Vaterland. Man traf da nicht nur Geister, die Schuldige suchten, sondern auch solche, die sich selbst vor ihr inneres Forum zogen und Ausschau nach unbeschrittenen Wegen hielten, Menschen, deren Optimismus bis auf die Grundfesten, aber auf eine fruchtbare Weise, erschüttert war. Das war sehr schön. Es zeugte von einer Berührung der alten Tiefe; der materielle Aufstieg, der ihr folgte, ist nur ein Abglanz davon.
Die Lose, die ausgeworfen wurden, waren ungleich verteilt. Was den einen nur streifte, vielleicht im Letzten sogar förderte, vernichtete den anderen. Das deutet auf eine Zuordnung von Schuld und Sühne, die sich der menschlichen Berechnung, dem Streben nach irdischer Gerechtigkeit entzieht. Was in den Individuen wirkt, ist nicht zu isolieren; sie handeln und leiden für viele andere mit. Dafür gaben diese Jahre eine gute Anschauung.
Ich habe zweimal regelmäßig Tagebuch geführt: während des Ersten und Zweiten Weltkriegs und der Jahre, die sie umrandeten. Gern verzichte ich auf eine dritte Anregung. Das Selbstgespräch wurde mit der Festigung der Verhältnisse allmählich schwächer, ging auf undatierte Einfälle über oder lebte auf Reisen wieder auf. Da es einem Trieb entsprach und ihn befriedigte, entschwand es auch bald der Erinnerung. Dazu kommt, daß die Publikation auch immer eine Trennung bedeutet, und das vor allem in Zeiten, in denen zwei mächtige Leidenschaften, die Furcht und der Haß, vorwiegen. So ließ ich die Blätter lange im Schreibtisch liegen, und zwar unter der Überschrift »Die Hütte im Weinberg«, die ihrer Stimmung entspricht.
Wie mögen die Lücken entstanden sein, die mir bei der Abschrift aufgefallen sind? Es ist möglich, daß größere Arbeiten die Aufzeichnungen unterbrachen, möglich auch, daß Teile verlegt oder verloren gegangen sind. Aber auch so waren Streichungen angebracht. Sie betrafen vor allem die Anmerkungen zu einer umfangreichen Lektüre, besonders dort, wo entlegene Gebiete gestreift wurden. Herausgenommen wurde ferner eine Anzahl in sich abgeschlossener Stücke, die ich unter dem Titel »Sgraffiti« zurücklegte. Sie sollen, als dritte Stufe, die beiden Fassungen von »Das Abenteuerliche Herz« vervollständigen.
»Jahre der Okkupation« bedeuten auch und bedeuten vor allem »Jahre der Beschäftigung«. Beide Bedeutungen durchdringen und ergänzen sich. Viele werden das aus ihrer Erfahrung bestätigen. Wenn der äußere Druck wächst und die schlimmen Botschaften sich häufen, wenn die Wahrnehmung des Unheils sich in den Nächten zum Albdruck verstärkt, sucht und findet der Geist seine Zuflucht nicht nur im Vergangenen, in dem, was die Väter an Gedachtem und Geformtem hinterließen, sondern auch in der Einsamkeit der Wälder, in den Frucht- und Blumengärten, den Bibliotheken, den Traumwelten. Er prüft die Bahnen, die sich in der Katastrophe schneiden, indem sie konzentrisch in sie hinein-, und, sich zu neuen Möglichkeiten, neuen Hoffnungen weitend, aus ihr hinausführen. Ungeahnte Hilfe wird ihm zuteil.
Jahre der Okkupation sind in diesem Sinne auch Jahre der Fruchtbarkeit.
Basel, 12. August 1958
ÜBER DIE AUSGABE DER »WERKE«
In der Form, in welcher meine Schriften nach dem Vergleich der Handschriften mit allen Ausgaben und Fassungen in die Gesamtausgabe übergehen, sind sie endgültig fixiert. Die Bücher sind nicht mit einem Mal entstanden, sondern haben sich im Laufe der Jahre ausgebaut wie Wein, der im Keller noch Sorge erfährt.
Die Aufnahme einer Einzelschrift in ein Gesamtwerk hat etwas Abschließendes; die Absicht des Autors wird sichtbar im Rahmen seiner Zeit und seiner Existenz.
Der Autor arbeitet nicht für die Wissenschaft, sondern er gibt ihr den Stoff. Das gilt auch dort, wo er irrt, gilt für die Fassungen.
In welchem Umfange stehen dem Autor denn überhaupt Veränderungen an seinem Werke zu? Das ist eine umstrittene Frage, doch kann an der Berechtigung, sein geistiges Eigentum zu verwalten, kein Zweifel sein. Diese Verwaltung beschränkt sich auch nicht auf das Museale, Archivarische oder Kommentatorische. In diesem Falle würde sich die Aufgabe des Autors bedeutend vereinfachen, ja er würde sie vielleicht besser Hilfskräften anvertrauen. Es ist hier aber ein grundsätzlicher Unterschied zwischen einer vom Autor persönlich und einer nach seinem Tode besorgten Ausgabe. Selbst im zweiten Falle werden Angleichungen an die gültigen Regeln für statthaft gehalten, wie wir es bei den Klassikerausgaben sehen. Ein solches Durchgehen der Texte fördert nicht nur die Einheitlichkeit und Lesbarkeit, sondern überhaupt das Gefühl, daß eine Regel besteht und geachtet wird. Wenn darüber hinaus veraltete Wendungen, flüchtige Moden und Manieriertheiten ausgemerzt oder wenigstens beschnitten werden, so ist das auch ein Gewinn. In allen Lebensaltern treten gewisse stilistische Vorlieben auf, die sich bald wieder verlieren. Wenn man solche Passagen nach Jahren wieder liest, empfindet man die Manier mit Recht als störend; mit ihrer Erhaltung ist weder dem Autor noch dem Leser gedient. Hierin liegt einer der Vorteile einer vom Autor besorgten Ausgabe; ein Bearbeiter könnte solche Änderungen nicht verantworten. Eine andere Frage ist die der Auswahl. Mit der Aufnahme von Gelegenheitsarbeiten wie Geburtstagswünschen, Einleitungen und Beiträgen zu Sammelwerken, Zeitungs- und Zeitschriftenaufsätzen ist Vorsicht geboten; sie vermehren den Umfang auf Kosten der Qualität. Aber auch hier gibt es Ausnahmen.
Die Streichung ist meist eine Verbesserung. In der Jugend neigt der Mensch zu Überheblichkeiten, in der Mitte des Lebens zu Banalitäten, im Alter zu Wiederholungen. Es ist gut, wenn er diese Mängel beim Blick auf das Ganze seines Werkes bemerkt. Wenn er einer Ungerechtigkeit, einer Plattheit, einem offensichtlichen Irrtum sein Placet versagt, wird das seiner geistigen Physiognomie zugute kommen, trotz aller Anmerkungen törichter Freunde und gehässiger Gegner, die ihm gewiß nicht erspart bleiben.
AUF EIGENEN SPURENANLÄSSLICH DER ERSTEN GESAMTAUSGABE
Oft habe ich mich gefragt, was die Unzufriedenheit mit den eigenen Texten bedeuten mag und mit ihr der ameisenhafte Trieb, am beschriebenen und bedruckten Papier herumzuminieren, sobald es mir wieder vor Augen kommt: das Gefühl, daß die Deckung der Aussage mit dem Gemeinten nicht genügt und daß der Satz besser, schlichter und treffender formuliert werden kann. Der Aufwand an Zeit, wahrscheinlich sogar an verlorener Zeit, ist zum mindesten wert, daß man sich Gedanken darüber macht.
Gewiß ist da einmal das Bedürfnis nach handwerklicher Sorgfalt und Sauberkeit. Wenn in die Werkstatt des Schreiners ein Schrank, eine Truhe zurückkehren, die er in seiner Jugend baute, so wird er außer den Spuren, die Zeit und Nutzung hinterließen, auch Mängel finden, die auf Maß und Anlage beruhen.
Die Sprache ist wie das Holz ein Stoff, an dem die Arbeit lohnt; sie wird zum Spiel an ihm. Das Auge, das dem Text folgt, gleicht der Hand, die über eine gefügte Fläche gleitet: hier hemmt ein Sprung und dort ein kleiner Widerstand. Doch zeugt bereits die Wahrnehmung für einst geglückte Mühe; der Splitter stört nur am gehobelten Brett.
Das Wort muß treffen wie eine Klinge, die gut geschliffen ist. Wenn wir nach Jahren die Schneide prüfen, indem wir sie bei geschlossenen Augen mit dem Finger streifen, bezeugt die Schärfe ihre Güte – nicht sie gefährdet, wohl aber die Scharte: hier versagte der Stahl am Stoff, den er durchschnitt.
Eine solche Arbeit, bei der die Zeit im Fluge verstreicht, setzt ein Mehr voraus, einen der großen organischen Bestände, die, wie die alten Wälder, immer seltener werden und zu denen die Sprache gehört. Sie ist ererbter Reichtum, ist ein Palast, den zu durchwandern ein Leben nicht genügt. In ihm zu dienen: das zählt zu den Mühen, die nicht ermüden, zu den Dingen, die man noch ernst nehmen kann.
Den bildenden Künstler pflegen Skrupel, ob der Wurf geglückt sei, lebhafter zu beunruhigen. Das beruht darauf, daß er stärker im Raum als in der Zeit schafft; er komponiert im Nebeneinander, während der Vortrag im Nacheinander geschieht: ein Wort folgt dem anderen.
Das Bild steht seiner Natur nach im Licht und ist prima vista zu beurteilen. In der Geschichte, dem Roman, dem philosophischen System, in jeder Darstellung, der die Sprache als tragendes Mittel dient, kann es gelungene Stellen geben, Oasen, die für den Anmarsch durch trockene Passagen reichlich entschädigen.
Raphael Mengs, ein strenger Arbeiter, der sich, wie viele gute Maler, auch mit der Theorie seiner Kunst beschäftigte, hat offenbar darüber nachgedacht. In seiner Charakteristik dieses Meisters erwähnt Casanova ein Gespräch, das er mit ihm im Jahre 1768 zu Madrid führte, und zwar über eine Magdalena, an der die Arbeit kein Ende nahm. Mengs sagt darin unter anderem:
»Neunundneunzig von hundert Kennern könnten das Bild für vollendet halten; mir aber liegt am Urteil des hundertsten, und mit seinen Augen betrachte ich das Bild. Sie müssen wissen, es gibt auf der Welt überhaupt nur relativ fertige Bilder, und auch diese Magdalena wird erst fertig sein, wenn ich aufhöre, an ihr zu arbeiten, und auch dann nur relativ vollendet, denn sicherlich würde sie noch vollendeter sein, wenn ich einen Tag länger daran arbeitete. Wissen Sie, daß in Ihrem ganzen Petrarca nicht ein einziges Sonett wirklich vollendet ist? Nichts auf dieser Welt ist vollkommen, es sei denn eine mathematische Konstruktion.«
Vorzüglich, bis auf die Verschmelzung von Vollkommenheit und Perfektion im letzten Satz, in dem sich der Übergang vom barocken zum klassizistischen Geist ankündigt und mit ihm das Vordringen berechenbarer, erlernbarer Elemente in die Poesie und die bildende Kunst.
Erst aus dieser Verwechslung erklärt sich die wachsende Fron, die das mathematische Denken dem Leben aufzwingt und in dem nicht nur die Formel das Wort ersetzt, sondern auch das Wort selbst zur Formel zu werden droht. Hier allerdings kann, zwar nicht Vollkommenheit, doch Perfektion erreicht werden. Daher geht es in der berechenbaren Welt ebenso offensichtlich voran wie in der musischen zurück. Das läßt, ohne daß damit ein Werturteil gefällt werden soll, eine Anzehrung des Humanen an der Wurzel vermuten, da zum Menschen die Unvollkommenheit gehört. Sie begrenzt ihn als eng mit seiner Freiheit und seinem Versagen verknüpftes Kennzeichen. Das gilt auch für die Kunst, das eigentliche Zeugnis seiner Art. Gebiete, auf denen Berechenbares vorwiegt, wie die Architektur, verweist man daher mit Recht an die Ränder der musischen Welt.
Persönliches Temperament wird mitspielen. Der alte Léautaud, der es mit seiner Autorschaft so ernst nahm, daß er in grünster Jugend, um eine Notiz zu sichern, sogar die Schäferstunde zu unterbrechen pflegte, vertrat die Ansicht, daß der erste Wurf unwiederholbar sei und daher mit seinen Schwächen besser als jeder revidierte Text. Sein großer Meister Stendhal hätte ihm darin kaum zugestimmt, wie man aus den Manuskripten schließen darf.
Hier, wie so oft im Leben, gilt alles und auch das Gegenteil. Der Stil eines Menschen, sein behaviour bis zu den kleinen alltäglichen Gewohnheiten, ja gerade dort, etwa die Art, in der er Brot schneidet oder die Treppe hinaufsteigt – das reicht tief in die Gründe, ist Ausdruck des ihm verliehenen Charakters und seiner Prägung, mag man es als Erbe auffassen oder als horoskopischen Zug, als das »Gesetz, nach dem er angetreten« ist.
Die astrologischen Definitionen sind schärfer als die psychologischen. Die Sterne bieten einen festeren Rahmen; sie greifen tiefer ein.
Wie aber soll ich die typischen Züge des Widders, der zu den Feuerzeichen zählt, in Einklang bringen mit dem Bienenfleiß an abgelegten und halbvergessenen Texten, mit der Vorliebe für verstaubte Böden, dem Wiedergang auf alten Wechseln überhaupt? Der Widder neigt zur Überschreitung gesetzter Grenzen, zu Fahrten und Zügen in fremde Reiche, läßt Bahnen von Rauch und Feuer hinter sich. Nautisch gesprochen, bestätigen Minen seine Route, wenn er längst in anderen Gewässern, Meerengen und Archipelen sich bewegt. Sein Wesen bedarf der Widerstände, die ihn aufhalten. Das gilt physisch wie metaphysisch; sein Äon hat Tiefe und Spannweite. Moses und Alexander tragen sein Zeichen; eine Doppelreihe ruhender Widder führt auf das hunderttorige Theben zu.
Die Sonne im Zenit ist dem nicht ungünstig. Mediterrane, ägyptische, nubische Sonne wirft ein steiles Licht auf die bewegten Bilder, oft unbarmherzig, aber zwingend, wo Köpfe auf dem Spiel stehen: der des Pompejus in aussichtsloser Verhandlung vor dem Delta oder der des Crassus im mesopotamischen Sand. Die Kreise der Parther werden enger; die Bahn der Pfeile verschwimmt im Staub, den die Hufe aufwirbeln. Der Triumvir hat bereits das aufgespießte Haupt des Sohnes geschaut. Der Herr über Syrien und den Tempelschatz von Zion streckt vergeblich die Hand nach Wasser aus. Am Ringe blitzt der Karneol, in den der behelmte Kopf der Roma eingegraben ist. Noch trügen schattige Bilder auf dem roten Vorhang; es ist sehr heiß, doch noch nicht heiß genug. Bald wird sich ein Geheimnis offenbaren, das jeden Frühling übertrifft.
Wie aber ist es mit den Rückzügen? Besonders mit den geglückten Rückzügen? Hier müssen andere Zeichen mitsprechen, vielleicht der Krebs in guter Position. Der geglückte Rückzug erhebt und wandelt die äußersten Punkte, die erreicht wurden, zu Wendemarken der Lebensbahn. Das beruht unter anderem darauf, daß er einen tieferen Wert der räumlichen Bewegung, nämlich den dichterischen, enthüllt. Der Zug Alexanders nach Indien, der Napoleons nach Ägypten würden sich anders darstellen, wenn sie zum Untergang geführt hätten. »Ich liebte ihn, weil er Gefahr bestand.«
Hier streifen wir das Gebiet der maladie de relais – das heißt: jener Art von Krankheit, die neuen Vorspann gibt, stärkere Vitalität einbringt. Mit dem Vorstoß ins Unwegsame bis hart an die Nähe des Todes wird neuer Einstand gezahlt. Das gleicht den Knoten im Bambusrohr. Sie stärken den Halt, doch mit ihm die Biegsamkeit. Theologisch gehört hierher, was in Halle die »heilsame Verzweiflung« genannt wurde.
Der Einwand liegt nahe und ist auch oft gemacht worden: daß mit dem geglückten Rückzug auf die Dauer wenig gewonnen sei. Die maladie de relais bedeutet Umstieg auf einer großen und im ganzen unangenehmen Fahrt. Die Erde liebt den Sohn, der frühe heimgeht; die Götter lieben den, der frühe fällt. Er fand die gute Pforte, wählte das große Schiff. Da gibt es, selbst an der indischen Grenze, kein Umsteigen mehr. Nicht umsonst treten die Söhne kaum in die Träume ein, zu denen die Ahnen andrängen.
Was bedeutet der Aufschub, der mühsame Zins an die Zeit? Gewonnene Zeit ist auch verlorene Zeit; das erweist sich, wenn der Schlußstrich gezogen wird. Wer Zeit hat, wird der Zeit nicht nachlaufen. Wer Zeit hat, wird auch etwas mehr als Zeit haben: Zeit gewährende, Zeit löschende Macht. Das ist der eigentliche Reichtum, an dem man den Herrn erkennt – vor allem dort, wo die Zeit knapp zu werden beginnt.
Immerhin bleibt der Augenblick des Glückes, die große Wandlung, die Errettung im Zeitlichen wunderbar. Sie kann im Mythos, in der Geschichte ein Trauma bleiben, das durch Jahrtausende Hoffnung und Zuversicht gibt. Wasser des Lebens sprang aus dem Felsen in der Wüste; die Woge des Roten oder der Götterwind des Gelben Meeres verschlangen die feindlichen Heerscharen.
War daran die gewonnene Zeit der Gewinn? Wohl kaum, denn solche Schicksalswenden leuchten über Untergang und Tod, auch den von Völkern, hinweg. Sie werden exemplarisch für den Lebensweg als solchen, indem Zeitloses sichtbar wird. Das begründet den Wert der Bibel als des Buchs der Bücher und, nota bene, jedes Buches, das diesen Namen verdient.
Der Tod behält das letzte Wort. Damit bestimmt sich auch das Provisorische der geglückten Rückzüge, Schicksalswenden, Rettungen und Heilungen, der vordergründigen Sorgen überhaupt.
Alles ändert sich freilich, wenn wir es nicht nur im Vordergrunde, sondern auch als Vordergrund sehen: den Glücksfall als Lichtstrahl großer Sonnen, der durch die Fenster unseres Hauses fällt. Was flüchtig wärmt, ist Abglanz des großen Feuers; die Werte sind Abglanz absoluter Macht. In Staaten, Reichen und Kulturen Häuser aufzurichten, zu deren Schmückung Wissen und Künste wetteifern: das ist menschlicher Dienst. Ein solches Haus ist Gleichnis und kann daher nicht währen; es hat seine Zeit und verweht wie ein Rauchopfer. Das Vergebliche gehört zum Ruhm und zur Größe des Opferdienstes, wie zur Kunst und zum Kultus das Wissen, daß das Ziel nicht erreicht werden kann.
Zeitliche Dauer ist insofern von Bedeutung, als sich ein anderes in ihr verrät, wie in Roma aeterna die Ewige Stadt. Das Unzulängliche konvergiert zum Unzugänglichen.
Daß sich im Augenblick des Glückes mehr verbirgt als die Lösung eines durch die Zeit geschürzten Knotens oder die Überwindung einer Stromschnelle, das wird vom Glücklichen leicht übersehen. Doch wurde ihm im flüchtigen Blick die Quelle des Lichtes offenbar. Dort ruht mehr als sein individuelles Glück. Er nahm die Gabe als neue Wegzehrung an. Wenn er die Münze ein wenig schärfer ins Auge faßte, so würde er in ihr den Obolos erkennen, der ihm dereinst als Fährgeld dienen wird.
Das Beste zu vergessen, sich selbst zu billig zu nehmen, ist des bildlosen Menschen Gefahr. Wären die Träume nicht, so würde er sich spurlos amortisieren; so aber bringt die Nacht ihm die großen Figuren zurück. Da regt sich der Urstrom unter dem Alltagshäutchen; aus der Hülle des Bettlers tritt der König hervor.
Zu billig ist auch, was der Mensch vom Seher und seiner Deutung verlangt. Glücksstunden, Warnung vor den Iden, Termine für Beginnen und Unterlassen: das bleiben Daten innerhalb der Fahrzeit, Ortungen vorm Katarakt.
Die echte Deutung vermag mehr. Sie achtet nicht auf die Knoten am Faden, den die Parzen spinnen; sie sieht das Muster, das aus ihm gewoben wird. Nun erst wird sichtbar, daß Notwendiges sich hinter dem Chronologischen verbirgt. Die Wahrheit wird zwingend, und oft zu stark für den Betroffenen.
Daß der Mensch seine Aufgabe nicht löst, daran ändern alle schönen Nachrufe nichts, weder die des Pfarrers am Grabe noch die des Historikers. Andererseits stirbt keiner vor der Erfüllung seiner Aufgabe. Der Widerspruch löst sich dadurch, daß Teile des Lebens sich im Unberechenbaren abspielen. Von dort aus wird die Waage ins Gleichgewicht gebracht. Ein winziger Anstoß genügt. Das gilt für die Kindheit, die Träume und auch für das Sterben, bei dem eine unendlich kurze Spanne ein Leben aufwiegen kann. Es erinnert an die endlosen Brüche – etwas ganz anderes müßte die Zahl ergänzen, damit sie sich abrundet. So wird die Hast durch Ruhe, das Handeln durch Nichthandeln gekrönt.
Daß er die Aufgabe nicht erfüllt, weiß jeder; und besser noch als am Tage weiß er es zur Nacht. Daher die Qual der Prüfungsträume; sie betreffen die irdische Leistung und das Gericht. Ein heiteres Erwachen folgt.
Auf der anderen Seite hält die Welt nicht, was sie dem Menschen verspricht. Das ist eines der tragischen Themen, variierend vom Scheitern des Großen Einzelnen in seinem Willen oder seiner Güte bis zur Enttäuschung jeder neuen Generation. Immer wieder sieht man sie kommen, Großes glaubend und wollend, und dann in Geschäften und widrigen Händeln verbraucht. Sie leiden stärker, wenn sie glaubten, was in den Büchern steht. Trotz allem lebt die Welt von dem, was sie mitbringen. Sie lebt vom Gedicht.
Die Arbeit an dieser nunmehr abgeschlossenen Ausgabe hat zehn Jahre, wenn auch nicht ausgefüllt, so doch in Anspruch genommen – für ein literarisches Unterfangen eine beträchtliche Zeit.
Im einzelnen die Erwägungen zu erörtern, die der Edition vorausgingen und sie begleiteten, würde zu weit führen. Sie betrafen zunächst die Gliederung des Stoffes und seine Darbietung, also Inhalt und Form in den Umrissen. Auch die Bestimmung der Richtlinien für Satz, Druck, Orthographie mußte der Erteilung des ersten Imprimaturs vorausgehen.
Eine Gesamtausgabe ist mehr als eine Summe von Einzelschriften; sie sollte zum mindesten ihren eigenen Duktus aufweisen. Der Autor wird sich an die von ihm gewählten oder gebilligten Gesetze halten – selbst dort, wo er inzwischen eine bessere Lösung erkannt zu haben glaubt.
Das Vorhaben gehörte zu jenen, die ebenso stark abschrekken wie anziehen und deren Ausführung man gern hinauszögert. Es bedeutete zum mindesten die verantwortliche Prüfung der vorliegenden Texte in dreifachem Arbeitsgang. Ähnliches war bei den meisten Schriften bereits geschehen und hatte sich bei manchen mehr- oder vielfach wiederholt. Der Aufwand, den eine sorgfältige Durchsicht von Satz zu Satz erfordern würde, war vorauszusehen.
Vorauszusehen waren auch grundsätzliche Einwendungen gegen jede mögliche Bearbeitung. Doch kann an der Berechtigung des Autors, sein geistiges Eigentum zu verwalten, kein Zweifel sein. Diese Verwaltung beschränkt sich auch nicht auf das Museale, Archivarische oder Kommentatorische. In diesem Falle würde die Aufgabe sich bedeutend vereinfachen, ja besser Hilfskräften anvertraut. Es besteht aber ein grundsätzlicher Unterschied zwischen einer vom Autor persönlich und einer nach seinem Tode besorgten Ausgabe.
Ein solches Durchgehen der Texte fördert nicht nur ihre Lesbarkeit, sondern überhaupt das Gefühl, daß eine Regel besteht und geachtet wird. Werden darüber hinaus veraltete Wendungen, flüchtige Moden und Manieriertheiten ausgemerzt oder wenigstens beschnitten, so ist auch das ein Gewinn. Wenn man solche Passagen nach Jahren wieder liest, empfindet man sie mit Recht als störend; mit ihrer Erhaltung ist niemand gedient. Da zudem nichts Gedrucktes verlorengeht, stellt die erneute Bemühung weniger einen Ersatz als eine Zugabe, eine Bereicherung dar.
Hierin liegt einer der Vorteile vom Verfasser besorgter Ausgaben; ein Editor könnte solche Bemühungen nicht verantworten. Auch die Streichung ist meist eine Verbesserung. In der Jugend neigt der Mensch zu Überheblichkeiten, in der Mitte des Lebens zu Banalitäten, im Alter zu Wiederholungen. Es ist gut, wenn er diese Mängel beim Blick auf das Ganze seines Werkes bemerkt. Wenn er einer Ungerechtigkeit, einer Plattheit, einem offensichtlichen Irrtum sein Placet versagt, wird das seiner geistigen Physiognomie zugut kommen.
Das Historische soll dem Elementaren und damit auch dem Musischen gegenüber zurücktreten. Das gehört zu den Spielregeln. Zugleich soll auf diese Weise die Wirklichkeit schärfer erfaßt werden. Das eben ist der Sinn der »Fassungen«, während ihre Methodik sich im Dienst an der Sprache verbirgt. Darüber unterrichtet am besten der Vergleich mit früheren Auflagen, deren Berücksichtigung jedoch nicht in den Rahmen dieser Ausgabe gehört.
Eine Ausnahme bildet die Einreihung der Erstfassung von »Das Abenteuerliche Herz«. Wie jene Jahre überhaupt, so ist auch der Text, der in ihnen entstand, mir fremd geworden – doch da ich immer wieder nach ihm gefragt werde und er selbst bei den Antiquaren kaum aufzutreiben ist, mag er hier seinen Platz finden. Beide Fassungen decken sich zudem kaum zu einem Drittel und geben ein Beispiel nicht nur für die Ablösung von expressionistischen durch magisch-realistische Tendenzen, sondern auch für Art und Umfang einer solchen Revision.
Unverändert blieb außerdem »Der Arbeiter«. Hier läßt sich also nicht von »Fassung« sprechen, falls man von Lichtenbergs Maxime: »Die meisten Auflagen werden vom Autor vor dem Erscheinen veranstaltet« absehen will.
Gerade diese Lagebeurteilung ist mir indessen von Anfang an als ein Netz mit weitgespannten Maschen erschienen, an dem sich die detaillierte Arbeit lohnen würde; Leopold Ziegler bezeichnete sie als »Griff an den Wurzelhals«. Kleinere und größere Schriften, die seitdem entstanden, sind als Ansätze aufzufassen. Näheres darüber ist in »Maxima – Minima« gesagt.
Das alles noch einmal aufzulösen und in ein Mosaik zu bringen, das von den kosmischen und atmosphärischen Veränderungen zu den geologischen und organischen, sodann von den chthonischen über die mythischen und historischen zu den transhistorischen Figurationen aufsteigt, ist eine Aufgabe, die ich vielleicht dem intelligenten Leser überlassen muß. Damit gewinnt er den Blick auf die Symptome: die technischen, politischen, sozialen und ethnischen Umwälzungen. Sie alle sind notwendig: gegründet die Gipfel, begründet die Einstürze. Das zu bejahen, weit über das leidende Ich und seine Bindungen hinaus, wird erst im Rückblick möglich sein.
Verlockend war trotz allen Mühen die Aussicht, einen vorläufigen Abschluß zu gewinnen, auch wenn Zufriedenheit nicht erreicht würde. Jedes letzte Wort ist ein vorletztes, ist nicht mehr als ein Anklopfen in der Hoffnung, daß sich einmal die Tür öffne. Es bleibt, wie gesagt, beim Entwurf, bei der Annäherung, bei der Einkreisung des Absoluten durch mehr oder minder gelungene Gleichnisse.
Wo wir das Wort nicht als gängige Münze verwenden und mehr als reine Mitteilung beabsichtigen, muß es jenseits der Sprache gefunden werden, bevor es ergriffen werden kann. Indem wir es aussprechen, gewinnt es an realer, verliert an metaphysischer Macht. Doch bleibt noch Schweigendes, Unausgesprochenes an ihm haften wie Erdreich am Wurzelwerk.
Zu den günstigen Zeichen gehört, wenn sich dem Autor selbst nach Jahren der verborgene Sinn eines Satzes enthüllt. Das ist ein Gleichnis des Lebensweges überhaupt. Spät geht uns auf, daß Dinge, mit denen wir uns lange beschäftigen, einen anderen, einfachen Sinn haben. Gut, daß wir sie ernst nahmen.
Zu danken habe ich an dieser Stelle für mannigfache Hilfe und Teilnahme. Zunächst den Toten: dem unvergessenen Verleger Benno Ziegler und der lieben Perpetua, beiden für treuen Beistand bis in die Tage ihrer schweren Leiden hinein.
Bekannten und unbekannten Freunden bin ich verpflichtet für Anregungen, Hinweise, Berichtigungen, Lesungen, Auszüge, Beschaffung und Sicherung von Daten, kurzum für Handreichungen unter oft erheblichen Zeitopfern. Mein Dank gilt namentlich Dr. Hans Peter des Coudres, Bibliotheksdirektor in Hamburg, Karl Oskar Paetel in New York und Dr. Armin Mohler in München für bibliographische Ermittlungen, Erika Gerlach, Bibliothekarin in Remscheid, für die vergleichende Lektüre der verschiedenen Ausgaben von »Strahlungen« und Lina Oldenburg, Studienrätin in Hamburg, für die intensive Durchsicht von »Besuch auf Godenholm«.
Als glückliche Fügung darf ich die Hilfe betrachten, die mir durch meine Frau Liselotte zuteil wurde – nicht nur dank ihrer großen editorischen Erfahrung und der Partnerschaft an allen Erwägungen, Korrekturen und Korrespondenzen, sondern auch der täglichen Unterhaltung mit dem Hausgeist über die Sprache und ihre verwandelnde Kraft.
Dank endlich dem Freund und Verleger Ernst Klett als dem eigentlichen Initiator der Ausgabe, nicht zuletzt auch für die unerschöpfliche Geduld immer neuen Korrekturen gegenüber bis in den Umbruch und die Revision hinein.
Wilflingen, 10. Oktober 1964
VORWORT ZU »AD HOC«
Ad hoc: unmittelbare Hinwendung zur Person, zum Gremium, zur Sache durch das gesprochene oder geschriebene Wort, das sich an ein bestimmtes Datum knüpft – ein Jubiläum, eine Ehrung, einen Geburtstag, einen Tod.
Solche Anlässe pflegen sich bei steigendem Alter zu mehren, wenn Wurzeln und Zweige sich ausbreiten und mit dem Verflochten-Sein die Zahl der Verpflichtungen wächst.
Für den Autor wird das leicht zum Problem, das ihn mit seinem Für und Wider angeht, sobald er die Post öffnet. Sein Schaffen, auf ruhigen Fortgang angewiesen, wird aktuell beansprucht; in die Wellenzüge drängen sich Spitzen ein. Damit droht weniger ein Zeitverlust als Unterbrechung der eigenen Zeit, die nicht der Uhr konform läuft und in die schwer sich wieder einzuschwingen ist.
Dazu kommt, daß die Gesellschaft offenbar die Fähigkeit einbüßt, Feste zu feiern, durch die sie in und mit den Ihren sich selbst harmonisch ehrt und genießt. Auch hier tritt mehr und mehr der Apparat mit seinen Medien an Stelle der herzlichen Zuwendung.
Ein Ad hoc bedarf also eines starken Anlasses – doch wenn der freudig ergriffen wird, führt es auch über ihn hinaus. Dem Eros der Person antworten Verehrung, Bewunderung, Freundschaft, der Anziehung der Sache die Neigung des Liebhabers. So mag es den Tag überdauern, da mehr als ein Datum, mehr als ein Ereignis bestätigt wird.
Wilflingen, den 29. Januar 1970
ADNOTEN ZU »AUF DEN MARMORKLIPPEN«
Ich war schon schlafen gegangen, als der Wagen sich mit abgeblendeten Lichtern dem Weinberg näherte. Nächtliche Besuche waren schon, wenn nicht unheimlich, so doch suspekt. Ich bat den Bruder, mich zu vertreten, und legte mich wieder zur Ruh.
Dann hörte ich durch die Wand das Gespräch, das sich entwickelte – nicht Worte und Sätze, sondern die wachsende Intensität. Ich stand auf, ging im Pyjama hinüber und begrüßte die Gäste – waren es drei oder vier? Ich habe ihre Zahl vergessen und auch die Namen, bis auf den einen, den des später Hingerichteten.1 Auch habe ich vergessen, worüber gesprochen wurde – vielleicht nicht einmal über Politik. Doch es herrschte ein seltsamer consensus, wortlose Übereinstimmung. Das war die Episode, aus der sich der »Besuch Sunmyras« entwickelte.
Es muß einige Tage später gewesen sein, als wir uns in einem der kleinen Nester am Bodensee zum Gangfischessen versammelten: der Fürst Sturdza, der Komponist Gerstberger, der Bruder und andere. Am Westwall wurde bereits geschanzt. Es wurde viel getrunken; ich übernachtete in Ermatingen bei Gerstbergers. Am Morgen weckte mich sein Gesang.
Ich wußte nicht mehr, was sich in der Nacht ereignet hatte, doch war sie bildreich gewesen; der Tieftrunk kann in eine Art von Trance führen. Nur daß die schönen Städte am Ufer brannten und die Flammen sich im Wasser spiegelten, war mir bewußt. Es war der Vorbrand gewesen, wie man ihn in Westfalen und Niedersachsen kennt.
In guter Laune begleitete ich den Komponisten durch die Obstgärten. Der Herbst war vorgeschritten; reife Äpfel lagen auf dem Weg. Die Morgensonne beschien die Reichenau. Die Handlung hatte sich bis in die Einzelheiten geformt. Sie war nur noch ins Wort zu übertragen, zu erzählen, was ohne Hast im Frühling und Sommer des Jahres 1939 geschah. Die Korrekturen las ich schon beim Heer.
Ein Begleitumstand, nämlich die Gefahr des Unternehmens, ist viel beredet worden – mich hat er nur am Rande beschäftigt, schon deshalb, weil er am Kern der Sache vorüberging und in den politischen Vordergrund abzweigte. Daß der Text auch in diesem Sinn herausforderte, war mir und meinem Bruder nicht weniger bewußt als dem Lektor der »Hanseaten«, Weinreich, und ihrem Leiter Benno Ziegler, dem die Publikation auch sofort Unangenehmes einbrachte. Das kulminierte schon in der ersten Woche mit der Beschwerde des Reichsleiters Bouhler bei Hitler, die ohne Ergebnis blieb. Über die Einzelheiten wurde ich ziemlich genau unterrichtet; auch das strengste Regime ist durchlässig.
Ich lag inzwischen am Westwall und las im Bunker Kritiken, auch von ausländischen Zeitungen, in denen der politische Bezug mehr oder minder deutlich betont wurde. Auch an Zuschriften fehlte es nicht. »Wenn bei uns zwei oder drei in der Ecke standen und sich unterhielten, so war es nicht über den Feldzug in Polen, sondern über das Buch.« So eine Gießener Studentin, après coup. Einige Auflagen waren schnell vergriffen; als es mit dem Papier schwierig wurde, ließ die Armee das Buch in eigener Regie drucken, einmal in Riga, einmal in Paris, wo auch bald die vorzügliche Übersetzung von Henri Thomas erschien.
Es wurde früh begriffen, selbst im besetzten Frankreich, daß »dieser Schuh auf verschiedene Füße paßt«. Kurz nach dem Kriege hörte man von Schwarzdrucken in der Ukraine und in Litauen. Die einzige offizielle Übersetzung jenseits des Eisernen Vorhanges erschien 1971 in Bukarest.
Soviel zum Politischen. Wenn ich das, wie meine Freunde mir vorwerfen, eher bagatellisiert habe, so hatte ich meine Gründe dazu. Wenngleich die politische Lage mit ihrem Albdruck diesen Angriff aus dem Traumreich heraus entfaltete und das sogleich in diesem Sinn erfaßt wurde, ging die Begegnung doch zeitlich wie räumlich über den Rahmen des Aktuellen und Episodischen hinaus.
Wachsende Allergie gegen das Wort »Widerstand« kam hinzu. Ein Mann kann mit den Mächten der Zeit harmonieren, er kann zu ihnen in Kontrast stehen. Das ist sekundär. Er kann an jeder Stelle zeigen, wie er gewachsen ist. Damit erweist er seine Freiheit – physisch, geistig, moralisch, vor allem in der Gefahr. Wie er sich treu bleibt: das ist sein Problem. Es ist auch der Prüfstein des Gedichts.
10. Dezember 1972
__________
Anmerkungen
1 <Tatsächlich war der Besucher Heinrich von Trott zu Solz der Bruder des hingerichteten Adam.>
ZU »ALADINS PROBLEM«
Aladins Problem ist die Wunderlampe: materielle, geistige, erotische Macht strömt unvermutet auf den Einzelnen zu. Wird er an ihr scheitern oder zu Grunde gehen?
Den Rahmen der Handlung stellt der Versuch, die Kultur wieder dort zu begründen, wo sie begonnen hat: mit dem Totendienst. Die Orte: ein Berliner Begräbnisinstitut und eine Kaserne zu Liegnitz in Schlesien. Die Zeit: die Gegenwart.
Namen, Orte und Daten sind lediglich Motive, die keine historische Realität beanspruchen, sondern entfernt an sie anklingen.
POST FESTUM
DANKSAGUNG BEI DER FEIER MEINES 80. GEBURTSTAGES ZUGLEICH NACHWORT ZUR ZWEITEN GESAMTAUSGABE
Achtzig Jahr alt zu werden, ist kein Verdienst. Wohl aber ist es eine Leistung in diesem, unserem Jahrhundert, das als ein Zeitalter großer Wirren und Übergänge in die Geschichte eingehen wird. Persönlich hatte ich an ein solches Alter nicht gedacht, es nicht einmal erhofft. Dreißig Jahre schienen mir schon enorm. Wäre in meiner Jugend ein Dämon gekommen, sie mir anzubieten und keinen Tag darüber, so hätte ich mit ihm paktiert. Ich denke dabei nicht an die Gefahren des Ersten Weltkrieges. In dieser Hinsicht war ich Optimist. Doch die vitale Ladung drohte die Individualität zu sprengen; sie schien eher für eine Rakete als für ein Fahrzeug angelegt. Indessen weiß unsere Zeit ja beides zu verbinden: Konstanz im Explosiven ist eines ihrer Kennzeichen. Aderlässe muß man in Kauf nehmen.
Neben der Unruhe des geborenen Widders plagte mich von Anfang an das Gefühl, der herrschenden Ordnung nicht konform zu sein – sei sie politisch durch die Monarchie, die Republiken, die Diktatur bestimmt, sei sie ökonomisch durch den homo faber und seine Trabanten abgeweidet oder theologisch durch Fuchsgeister entmythisiert.
So hatte ich gegen einen immer heftigeren Strom zu schwimmen, meist mit Widerwillen, manchmal auch mit Lust: im Niemandslande, wenn die Dinge elementar wurden ––– doch öfter mit Molières siebenfach wiederholter Frage: »Que diable ai-je à faire dans cette galère?« – Was zum Teufel habe ich auf dieser Galeere zu tun? und das besonders, wenn sie an das Sklavenschiff von Melvilles »Benito Cereno« zu erinnern begann. Wie wenig sich darauf ändert, sieht man, wenn man die Opfer, aber auch, wenn man die Richter vergleicht.
Von Jahr zu Jahr bedrückte mich stärker auch ein Leiden, das Hölderlin dem Hyperion zuschreibt: das Gefühl, ein Fremdling im eigenen Vaterland zu sein. Dafür zeugen an Geist und Körper Stigmen und Narben unglücklicher, doch unauslöschlicher Liebe, die dem Volk und nicht der Parteiung gilt. Ich habe dafür mit guter Münze gezahlt, so mit dem Sohn, der 1944, aus dem Gefängnis entlassen, sich zur Front meldete und bei Carrara gefallen ist. Er wußte zu unterscheiden zwischen Innen und Außen, zwischen Volk und Partei, zwischen dem, was sein Gewissen verstörte, und dem, was heraufdrohte. Diese Unterscheidung schwindet im Weltbürgerkriege, und dort vor allem, wo er als Nationalkrieg verloren wurde und die historische Substanz vernichtete. Es bleibt zu hoffen, daß die Werte sich im Abgrund sublimieren und neu gefaßt werden:
Wenn aus der Tiefe kommt der Frühling in das Leben,
Es wundert sich der Mensch, und neue Worte streben
Aus Geistigkeit, die Freude kehret wieder
Und festlich machen sich Gesang und Lieder.
So findet vieles sich, und aus Natur das Meiste.
(Hölderlin)
Wunderlich bleibt, daß dabei überhaupt etwas bestellt wurde, daß sich der Mut nicht verlor. Der Erfolg, wenn überhaupt davon die Rede sein kann, ist eher Zugabe, ist eine Prämie. Hier gilt ein Spruch des Heraklit, über den ich oft gesonnen habe: »Der Walkschraube Bahn, ob gerad oder quer, ist einunddieselbe.« Das soll wohl heißen: Hat einer sein Feld gepflügt, so liegt sein Verdienst in der Leistung, gleichviel, wie die Furchen ausfielen, wenn er nur die Hand am Griff behielt.
In diesem Sinne betrachte ich mein Werk. Ich maße mir darüber kein Urteil an, und ich trete auch nicht in die Polemik ein, die meiner Person und meiner Arbeit gilt. Ich weiß, daß ich Zeit meines Lebens vielen ein Ärgernis gewesen bin. Das begann schon in der Schule, wo ich meine Lehrer als der zugleich beste und schlechteste Schüler irritierte, und es setzte sich bei den Preußen fort, die mir ihren höchsten Orden gaben und denen ich als unbequemer Untergebener ein Dorn im Auge war. Die Ambivalenz begleitete mich durch die mehr als sechzig Jahre meiner Autorschaft, und es ist zu erwarten, daß sich daran auch wenig ändern wird. Vom Unvollkommenen bin ich überzeugt – dem gilt die Selbstkritik: die Einsicht, daß trotz unablässigem Bemühen dem Wort das Letzte nicht abzugewinnen ist. Es bleiben Anklänge.





























