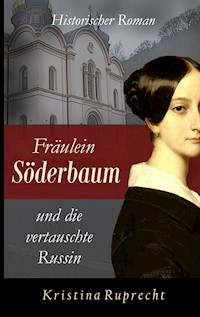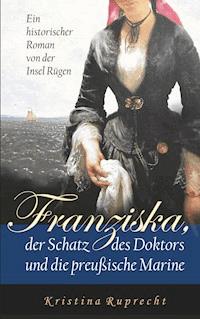Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mai 1650. Langenschwalbach bereitet sich auf die kommende Kursaison vor. Zu den ersten Besuchern des aufstrebenden Badeortes gehören der Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels samt Familie, Hofstaat und Leibgarde ebenso wie die berühmt-berüchtigte Kurtisane Athenais, die mit Page und Kammerzofe anreist. Die Ankunft der Gäste sollte eigentlich ein Grund zur Freude für die Gastwirtin Rosalie Mette sein, die nach einer Jugend in den Feldlagern des Dreißigjährigen Krieges endlich ein eigenes Wirtshaus besitzt. Aber die Sorge um ihren Sohn Jakob, der brutal überfallen wird, ruft alte Erinnerungen wach. Am landgräflichen Hof stirbt eine Dame kurz nach ihrer Ankunft an einer Vergiftung durch Sadebaumtinktur. Ihr Tod soll als fehlgeschlagener Abtreibungsversuch vertuscht werden. Simon Prätorius, der Arzt, der keine schweren Krankheiten mehr behandeln will und nur widerwillig den Fall übernommen hat, glaubt nicht an diese Erklärung und will der Toten Gerechtigkeit widerfahren lassen. Als der Hauptmann der landgräflichen Leibwache und ein weiterer Kurgast, ein reicher Tuchhändler, mit den gleichen Symptomen erkranken, wird klar, dass es sich um Giftanschläge handelt. Der Landgraf beauftragt den Arzt mit der diskreten Suche nach dem Täter. Bald fällt der Verdacht auf die Dame Athenais. Aber war sie es wirklich oder liegen die Wurzeln des Verbrechens tiefer in der Vergangenheit? Besteht ein Zusammenhang mit dem Überfall auf Jakob? Gemeinsam mit Rosalie versucht Prätorius den Fall aufzuklären, und auch Jakob will wissen, was ihm passiert ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch:
Langenschwalbach im Mai 1650. Zu den ersten Besuchern des aufstrebenden Badeortes gehören der Landgraf samt Familie, Hofstaat und Leibgarde ebenso wie die berühmt-berüchtigte Kurtisane Athenais. Die Ankunft der Gäste sollte eigentlich ein Grund zur Freude für die Gastwirtin Rosalie Mette sein, die nach einer Jugend in den Feldlagern des Dreißigjährigen Krieges endlich ein eigenes Wirtshaus besitzt. Aber die Sorge um ihren Sohn Jakob, der brutal überfallen wird, ruft alte Erinnerungen wach. Am landgräflichen Hof stirbt eine Dame kurz nach ihrer Ankunft an einer Vergiftung durch Sadebaumtinktur. Ihr Tod soll als fehlgeschlagener Abtreibungsversuch vertuscht werden. Simon Prätorius, der Arzt, der keine schweren Krankheiten mehr behandeln will und nur widerwillig den Fall übernommen hat, glaubt nicht an diese Erklärung und will der Toten Gerechtigkeit widerfahren lassen. Bald fällt der Verdacht auf die Dame Athenais. Aber war sie es wirklich oder liegen die Wurzeln des Verbrechens tiefer in der Vergangenheit? Besteht ein Zusammenhang mit dem Überfall auf Jakob? Gemeinsam mit Rosalie versucht Prätorius den Fall aufzuklären, und auch Jakob will wissen, was ihm passiert ist.
Der vorliegende Roman ist auch als e-Book erhältlich.
Die Autorin:
Kristina Ruprecht studierte Germanistik und Politikwissenschaft in Stuttgart und arbeitete als PR-Texterin und freie Journalistin in den Bereichen Wirtschaft und IT.
2004 siedelte sie nach Bad Schwalbach um und fand dort eine so interessante Ortsgeschichte vor, dass sie praktisch dazu gezwungen war, einen Roman zu schreiben.
„Sauerwasser und Jungfernpalme“ ist ihr erster historischer Roman. Ihre Kurzgeschichten sind inzwischen in diversen Anthologien zu finden. Weitere historische Romane, die auf Rügen und in Bad Ems spielen, sind in Vorbereitung.
Inhaltsverzeichnis
Langenschwalbach, Mai 1650
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Dramatis Personae
Im Gasthaus ‚Vier Elstern‘:
Rosalie Mette – Wirtin
Jakob Mette – ihr Sohn
Anna – kochendes Küchenmädchen
Stefan – Stallknecht
Betti – Hausmagd
Franz – Bursche für alles, Annas Bruder
Die alte Grete – Nachbarin
Oswald Lieffenbruch – Frankfurter Tuchhändler
Ottilie Lieffenbruch – seine Frau
Balthasar – Koch der Lieffenbruchs
Peter – Küchenjunge der Lieffenbruchs
Baron von Gnekow – arm, aber verliebt
Friedrich – sein Knappe
Im Gasthaus ‚Zur Kette‘:
Isidorus von Eenvelde – reicher Holländer
Simon Prätorius – sein Leibarzt
Sebastian/Bast – Prätorius’ Diener
Im Gasthaus ‚Zum Bären‘:
Marianna Wippel – die alte Wirtin
Georg Wippel – ihr Sohn, Wirt
Die Dame Athenais – erfolgreiche Kurtisane
Carolus/Karl – ihr falscher Mohrendiener
Clorinde – ihre Zofe
Heinrich Cuculus - Kurgast, Anatom, Forscher
Im Gasthaus ‚Zur Stadt Frankfurt‘:
Edvin Aelluen, Baron von Sønderham
– schwedischer Kurgast
Im Schloss:
Ernst von Hessen-Rheinfels – der Landgraf
Josephus Hirundulus – sein Leibarzt
Isabella von Hattenberg – Hofdame
Diana von Oberheim – Hofdame
Franziska von Beulwitz-Drusingen – Hofdame
Hubertus von Greiffenstein – Oberst der Leibwache
Bartholomäus von Niederschnitz – sein Stellvertreter
Im Wald:
Die lahme Liese – geheimnisvolle Kräuterfrau
Im Krieg / Rückblenden:
Bartel – Soldat der Katholischen Liga
Josefa – seine Frau
Flori – ihr Sohn
Claire von Felseney – glücklose Braut
Hannes Mette
– Rosalies Mann, Marketender und Pferdehändler
Wilhelm von Heimbach – dankbarer Offizier
Langenschwalbach, Mai 1650
Kapitel 1
Die Dame Athenais ist da!“, verkündete der Page mit dem schwarzen Gesicht. Er setzte einen Fuß nach vorne, klappte in der Hüfte zusammen und malte mit der rechten Hand einen großzügigen Schnörkel in die Luft. „Meine Herrin möchte, dass der Wirt dieses Gasthauses davon unverzüglich in Kenntnis gesetzt wird.“
Rosalie Mette musste grinsen. Jedes Mal wenn der falsche Mohr mit den Pluderhosen und den Schuhen aus zerschlissenem roten Samtstoff eine seiner Verbeugungen vollführte, leuchtete ein erstaunlich hellhäutiger Nacken zwischen den dunklen Locken hervor.
„Meine Herrin wohnt im Gasthof ‚Zum Bären‘ in der Unterstadt und empfängt dort den Besuch von edlen Kavalieren.“
Rosalie kramte aus dem Beutel an ihrem Gürtel eine Kupfermünze und warf sie dem Jungen zu. „Meine Empfehlung an Athenais, ich werde sie nicht vergessen.“
Der Junge machte einige Schritte rückwärts, so, als sei Rosalie eine hohe Dame, der man nicht den Rücken zuwenden dürfe, verbeugte sich noch einmal und rannte davon.
Rosalie konnte es nicht lassen, ihm nachzurufen: „Vergiss in Zukunft nicht, deinen Hals auch hinten mit Ruß einzureiben!“
Mit einem breiten Grinsen winkte ihr der Page noch einmal zu, dann verschwand er wie der Blitz um die Hausecke. Er musste die Botschaft seiner Herrin auch noch in den anderen Gast- und Logierhäusern der Straße verbreiten. Rosalie konnte sich vorstellen, dass er für diese Nachricht oft genug Beschimpfungen oder Ohrfeigen erntete.
Sie schloss die Hintertür und kehrte zu dem kalten Rinderbraten zurück, den sie in Scheiben geschnitten hatte, als der Besucher auftauchte. Anna, die Küchenmagd, die auf der anderen Seite des Küchentisches schwitzend einen Brotteig knetete, schaute Rosalie fragend an. „Es war ein Mohr mit einer frohen Botschaft für unsere männlichen Gäste.“
Anna runzelte zuerst die Stirn, dann hatte sie die Anspielung verstanden. „Oha!“ Sie nickte anerkennend. „Wenn sich die Dame einen Mohren leisten kann, dann scheinen die Geschäfte nicht schlecht zu laufen. Schade, dass ich nicht die Tür geöffnet habe“, fügte sie hinzu. „Ich habe noch nie einen gesehen.“
„Da hast du nichts verpasst“, sagte Rosalie. „Es war kein richtiger. Stell dir einfach einen schwarz angemalten Lausebengel vor.“ Sie besaß bei diesem Thema eine gewisse Autorität, immerhin hatte sie einmal aus der Ferne einen Blick auf einen echten Schwarzen werfen können. Das war vor vielen Jahren gewesen, in einem der zahllosen Feldlager, die in ihrer Erinnerung in einem Nebel aus Staub, Weindunst und Pferdegeruch verschwammen. Dieser Mohr war der Leibdiener eines Herzogs gewesen. Rosalie erinnerte sich noch genau an das Leuchten seiner Haut, ein schimmerndes Braun, wie bei einer frisch aufgebrochenen Kastanie. Meilenweit entfernt von dem stumpfen Schwarz der Kohlenfarbe, die der Junge der Athenais im Gesicht gehabt hatte.
Im Hintergrund der großen Küche hatte der Koch von Rosalies Logiergästen hektisch in einer zischenden Pfanne gerührt. Jetzt löschte er das Hühnchenragout mit einem kräftigen Schluck Wein ab und meldete sich zu Wort: „In Frankfurt laufen sie zu Messezeiten scharenweise herum. Jeder hat dort einen Mohren.
Nicht nur Leute von Adel, auch reiche Bürger und Kaufleute. Das ist da nichts Besonderes.“
Rosalie und ihre Küchenmagd tauschten einen Blick. Sie kannten den Koch kaum, er arbeitete erst seit drei Tagen hier. Und fast ebenso lange schon versuchte er, auf Rosalie Eindruck zu machen. Begonnen hatte er damit in dem Moment, in dem er in Erfahrung gebracht hatte, dass sie sowohl Witwe als auch die alleinige Besitzerin der ‚Vier Elstern‘ war.
„Dann kannst du ja von Glück sagen, dass dich die Lieffenbruchs noch nicht gegen einen Mohren ausgetauscht haben“, meinte Anna.
Ohne überhaupt in die Richtung der vorlauten Küchenmagd zu schauen, schüttelte der Koch den Kopf. „Die Mohren kochen nicht so gut wie ich. Aber der Kammerdiener des Herrn sollte sich vorsehen!“
Anna bekam einen Hustenanfall und Rosalie begann, im Regal hektisch nach einem Wetzstahl für ihr Messer zu suchen. Der Koch schien nicht zu bemerken, dass die beiden kurz davorstanden, loszukichern. Er rührte weiter im Ragout und fügte verschwenderisch Pfeffer hinzu. Ottilie Lieffenbruch, seine Herrin, hatte eine Schwäche für seltene und teure Gewürze.
Obwohl die Saison jetzt im Frühsommer erst begann, wohnten in den ‚Vier Elstern‘ bereits zahlungskräftige Gäste: der Frankfurter Tuchhändler Lieffenbruch samt Gattin, Kammerdiener und Zofe. Dazu kamen noch sein Koch und ein Küchenjunge. Das Ehepaar wollte in Langenschwalbach die Sommermonate verbringen und mit dem berühmten Heilwasser seiner Kinderlosigkeit abhelfen.
Die schönen Räume im ersten Stockwerk, von deren Fenstern aus man das Treiben auf der Straße und am Brunnen beobachten konnte, ebenso wie ein großer Teil der Dienstbotenquartiere unter dem Dach waren damit schon belegt.
Für die Wirtin bedeutete das natürlich Grund zur Freude, aber gleichzeitig hatte sie wie jedes Jahr Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen, dass Herd und Bratspieß, Tische und Bänke in ihrer Küche jetzt auch dem Personal der Gäste zur Verfügung standen. Der Koch der Lieffenbruchs, Balthasar, und sein Gehilfe Peter hatten das Recht, den Raum zu nutzen, als sei es ihr eigener – und jede Unterstützung zu fordern, die sie benötigten.
Dieser Gedankengang brachte die Wirtin zu einem näherliegenden Problem zurück. „Wo ist eigentlich dein Küchenjunge?“, fragte sie den Koch.
Balthasar kippte schwungvoll einen Löffel Fleischbrühe in den Topf, dann blickte er sich in dem niedrigen Raum um. „Der verschwindet bei jeder Gelegenheit.“
„Du solltest ihn besser erziehen.“ Rosalie sah schon voraus, dass sie oder Anna wieder einmal die Arbeiten übernehmen mussten, die eigentlich Aufgabe des Küchenjungen waren.
Der Koch zuckte mit den Schultern. „Ich habe ihm oft genug gesagt, dass ihn eine Tracht Prügel erwartet, wenn er nicht bei der Hand ist.“
„Ich hoffe, er erinnert sich beizeiten daran.“
Anna sah von ihrem Teig auf, blies sich ein paar Haarsträhnen aus dem geröteten Gesicht und deutete mit dem Kinn auf den Braten. „Wir haben noch eingemachte Kirschen vom letzten Jahr, die sollten wir endlich aufbrauchen. Zu dem kalten Fleisch könnte ein Kirschkompott passen.“
Rosalie nickte. „Gute Idee, das kannst du machen, solange der Brotteig gärt.“ Zwar hatte sie das Mädchen als Küchenmagd eingestellt, aber im Grunde konnte sie alle Aufgaben eines Kochs übernehmen. Als Kind hatte Anna ihrem Vater geholfen, der als Küchenmeister in einem der guten Gasthäuser in der Unterstadt arbeitete. Dabei hatte sie sich einiges abgeschaut. Über ihre eigenen Kochkünste machte sich Rosalie wenige Illusionen. Die hatten zwar jahrelang für eine Marketenderschenke ausgereicht, in der die Wirtin zähes Pferdegulasch und steinharten Käse zum Wein unbekannter Herkunft auf Strohbündeln servierte. Aber die Gäste der ‚Vier Elstern‘ waren anspruchsvoller.
Rosalie schnitt den Braten vollends in Scheiben. Dann teilte sie mit dem Messer den zerfaserten Anschnitt in zwei Hälften, kommandierte „Mund auf“ und steckte eines der Stücke Anna zu. Das andere aß sie selbst. Ob der Koch der Lieffenbruchs etwas dazu zu sagen hatte, interessierte sie wenig.
Während die Küchenmagd ihren Braten kaute, spannte sich die Haut über einer längst verblassten Narbe auf ihrer rechten Wange. Rosalie hatte in den letzten Jahren weitaus Schlimmeres gesehen, aber Anna litt unter diesem Makel. Das wusste die Wirtin inzwischen – auch wenn die Küchenmagd nie darüber redete. Ihre Unsicherheit versteckte sie hinter ihrem frechen Benehmen. Dabei war Anna durchaus ansehnlich, fand Rosalie. Mit dem schweren honigfarbenen Zopf, der ihr bis zur Hüfte baumelte, und ihrer wohlgeformten Figur ließ sie das einfache Kleid aus grobem ungefärbtem Tuch aussehen, als käme es aus der Hand eines richtigen Schneiders. Und nicht aus jener der alten Grete von nebenan, der die Mieder stets zu eng oder zu weit gerieten und die die Röcke grundsätzlich immer so einsäumte, dass sie bereits nach wenigen Wochen ausfransten.
„Ich hätte ihn mit noch mehr Honig bestreichen sollen – dann wäre der Braten knuspriger geworden.“ Der Koch war unbemerkt an den Tisch getreten. Er stand sehr dicht neben Rosalie. „Ich glaube, euch Süßmäulchen würde es dann noch besser schmecken.“ Wenn er lächelte, dann sah man seine hervorstehenden Schneidezähne. Rosalie erinnerte er immer an ein Kaninchen. Allerdings an ein Kaninchen, das viel zu mager war, als dass sie es jemals in einen ihrer Kochtöpfe gelassen hätte.
„Ich finde den Braten gut so, wie er ist.“ Anna packte den Brotteig in den runden Korb, in dem er aufgehen sollte, und rieb sich die Teigreste von den Fingern.
Rosalie musterte die gebrauchten Töpfe und Pfannen, die sich an der Feuerstelle drängten. Um die eingebrannten Soßen- und Bratenreste sollte sich eigentlich der Küchenjunge kümmern. Aber der war weit und breit nicht zu sehen.
Das Bürschchen würde hart arbeiten müssen, wenn es endlich auftauchte. Und wenn er das, was er tun musste, mit einem schmerzenden Hinterteil tat, dann geschah es ihm nur recht, dachte die Wirtin. Während Anna den Krug mit den eingemachten Kirschen aus der Speisekammer holte, stapelte Rosalie schimpfend die schmutzigen Töpfe neben den Wassertrog, der zum Abwaschen diente.
Nachdem das Scheppern des Geschirrs verstummt war, konnte man in der mittäglichen Stille das schnelle Klappern von Hufen hören. Ohne seinen hastigen Galopp zu verlangsamen, bog ein Pferd in den Durchgang ein, der zu den Ställen des Wirtshauses führte.
War da ein neuer Gast angekommen? Warum hatte der es so eilig? Rosalie wischte die Hände an ihrer Schürze ab und ging zu dem breiten glaslosen Fenster hinüber, von dem aus man den Hof der ‚Vier Elstern‘ überblicken konnte. Im Winter wurde die Maueröffnung mit einem Holzladen verschlossen. Jetzt im Sommer verhinderte nur ein geschmiedetes Gitter, dass unerwünschte tierische oder menschliche Gäste in die Küche eindrangen. Von hier aus sah man den gegenüberliegenden Pferdestall, den Misthaufen und die Remise für die Wagen der Gäste. Die Scheune mit Schweine- und Hühnerstall, die rechtwinklig an das Haus angebaut war, sowie eine niedrige Steinmauer grenzten den Hof gegen die Nachbargrundstücke ab.
Die Wirtin warf nur einen kurzen Blick nach draußen, dann eilte sie mit klappernden Holzpantinen zur Hintertür hinaus. Vor der Stalltür stand mit hängendem Kopf Jakobs falbfarbenes Maultier. Rosalie sah, dass das Lederzeug zerrissen war. Als sie näher trat, bemerkte sie auch die großen Schweißflecken auf Hals und Flanken des Vierbeiners. Ihr Magen schien sich plötzlich in einen Stein zu verwandeln. Dieses Muli sollte doch mit ihrem Sohn auf dem Weg nach Mainz sein. Heute am frühen Morgen hatte Jakob den Vierbeiner am Brunnen mit zwei Fässern Sauerwasser beladen. Wie üblich wollte er das heilkräftige Wasser bei einem Händler abliefern, einige Einkäufe in der Stadt erledigen und spätestens am übernächsten Tag wieder zurück sein.
Rosalie erinnerte sich, dass sie darauf bestanden hatte, dass dies die letzte Tour dieses Frühjahrs werden sollte, denn mit der beginnenden Kursaison wurde Jakobs Hilfe in Gasthaus und Stall dringend gebraucht. Jetzt wünschte sie sich nichts sehnlicher, als die Zeit noch einmal zurückdrehen zu können und ihm die Reise rundweg zu verbieten.
Auf der struppigen Flanke des Maultiers entdeckte sie einen Fleck getrockneten Blutes. Es stammte nicht von einer Verletzung des Vierbeiners, wie sie schnell feststellte. Rosalies Knie wollten nachgeben. Sie lehnte sich kurz gegen den warmen Körper des großen Tieres. War das die Rache des Schicksals, die sie insgeheim fürchtete? Die Rache dafür, dass der Wohlstand, in dem sie lebte, mit Blut erkauft war?
Das Maultier stupste die Frau mit der Schnauze an. Es wusste, dass es im Stall Heu und Hafer gab. Rosalie griff mechanisch nach den Zügeln und führte das Tier hinein. Sie hätte den alten Knecht Stefan rufen können, damit der das Muli versorgte, aber im Moment musste sie allein sein. Während sie die Handgriffe vollführte, die ihr schon ein halbes Leben lang vertraut waren, dem Tier die Reste von Packsattel und Zaumzeug abnahm, Wasser und Heu holte, waren ihre Gedanken immer noch bei Jakob.
Als das Maultier zufrieden sein Heu kaute, trat Rosalie durch das Hoftor hinaus auf die Straße. Sie klammerte sich an die Hoffnung, dass Jakob seinem Maultier folgte. Das war doch die wahrscheinlichste Möglichkeit, redete sie sich immer wieder ein: Das Muli war vor etwas erschrocken, hatte sich losgerissen und unterwegs die Fässer verloren. Jakob würde bald nach Hause kommen, erschöpft und wütend, aber wohlauf.
Das Städtchen lag wie ausgestorben in der Mittagssonne. Nur ein einsamer Lastenträger mit breitrandigem Hut und Kiepe war unterwegs. Selbst die Enten, Gänse und Schweine, die sonst die Ufer des Baches neben der Straße bevölkerten, hatten sich in den Schatten der Büsche zurückgezogen. Rosalie wusste, dass der verschlafene Eindruck täuschte. In wenigstens zwei Stunden würde auf den Straßen des Ortes und am Brunnen wieder der übliche Trubel herrschen.
Vor allem, nachdem gestern auch der Landesherr zu seiner alljährlichen Kur angekommen war. Mit seiner Ehefrau und den beiden kleinen Söhnen wollte Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels die nächsten Monate hier verbringen. Neben dem größten Teil seines Hofstaates aus Beratern, Sekretären und Edeldamen hatte er auch seine Leibgarden mitgebracht. Von den Bürgern Langenschwalbachs wurde diese Eskorte mit gemischten Gefühlen betrachtet. Über kurz oder lang würden die Gardisten in den Gasthäusern des Ortes ihren Sold in Wein, Frauen und Glücksspiel umsetzen. Wie sie sich dabei benahmen, das blieb abzuwarten. Rosalie war das gleichgültig, sie hatte viele Jahre damit verbracht, Soldaten Wein einzuschenken. Sie schüttelte den Kopf, um diese Erinnerungen zu verscheuchen.
Müde setzte sich die Elsterwirtin auf die Stufen, die zum Haupteingang ihres Gasthauses emporführten. Wenn sie daran dachte, was Jakob widerfahren sein könnte, dann fühlte sie sich ausgelaugt und alt. Es hatte ein halbes Leben lang gedauert, dorthin zu kommen, wo sie heute war. Und eine ihrer Triebfedern war der Gedanke an Jakobs Zukunft gewesen. Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen.
Kapitel 2
Der Mann lag ausgestreckt auf dem Rücken, mitten auf der Landstraße. Die Söldner, die das Frachtgut des Grafen von Eenvelde gegen Wegelagerer schützen sollten, waren sofort ausgeschwärmt, als sie ihn entdeckt hatten, und durchsuchten das Gebüsch in der näheren Umgebung.
„Genauso lag er da, als wir ihn fanden“, informierte einer der beiden Männer, die den Bewusstlosen bewachten, Simon Prätorius. Der andere griff nach den Zügeln des Pferdes und hielt es fest, während der Arzt abstieg und ein Stöhnen unterdrückte. Er war es einfach nicht mehr gewohnt, lange Strecken zu reiten. Als er neben dem Liegenden schwerfällig in die Hocke ging und nach dem Puls fühlte, sah er, dass es sich um einen jungen Burschen handelte, der lediglich ein grobes Hemd und eine vielfach geflickte Hose trug. Wahrscheinlich ein Handwerker- oder Bauernsohn, dachte Prätorius. Unter der rechten Schulter sickerte Blut hervor und vermischte sich mit dem Straßenstaub.
„Lebt er noch?“, fragte der erste Söldner.
Prätorius nickte und ließ sich dann von ihm helfen, den Verletzten so weit auf die Seite zu drehen, dass er die Schulter inspizieren konnte. Offensichtlich hatte der Bursche einen Messer- oder Degenstich abbekommen.
„Wegelagerer?“, der Haushofmeister des Grafen von Eenvelde war hinter Prätorius getreten und schaute fragend auf ihn hinunter.
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwelche Reichtümer dabeihatte.“ Der Arzt tastete mit routinierten Bewegungen den Schädel des Verletzten ab. Er hatte nicht so viel Blut verloren, dass die Schulterwunde die alleinige Ursache für seine Bewusstlosigkeit sein konnte.
„Wenn er etwas zum Essen dabeihatte, dann reicht das hierzulande schon als Grund für einen Überfall.“ Der Haushofmeister zwirbelte nervös seinen Schnurrbart. „Wir sollten sehen, dass wir weiterkommen.“
Prätorius hatte eine kräftige Beule am Hinterkopf des Burschen entdeckt. Als er leicht darauf drückte, stöhnte der, schlug die Augen auf und murmelte etwas Unverständliches.
Der Arzt richtete sich auf. „Hole meinen Diener“, befahl er dem Söldner.
„Sie wollen ihn verarzten?“, der Haushofmeister zog die Brauen hoch. „Wir wissen doch gar nicht, wer er ist.“
„Wir können ihn nicht hierlassen und in Langenschwalbach wird sich schon herausstellen, wohin er gehört.“
„Dann verbinden Sie ihn meinetwegen und packen ihn auf einen der Wagen. Hauptsache, wir fahren bald weiter.“
Prätorius nickte knapp. Er verstand, unter welchem Druck der Haushofmeister stand. Auf den drei Frachtwagen reisten der Hausrat und der Proviant des Grafen von Eenvelde, eines reichen holländischen Adligen, der mit seiner Familie die gesamte Sommersaison im Kurbad verbringen wollte. Die Einrichtungsgegenstände für die bestellten Zimmer sowie das Personal hatte er samt Haushofmeister und neuem Leibarzt vorausgeschickt. Auf diese Weise war sichergestellt, dass er bei seinem Eintreffen sein Quartier bereits so vorfand, dass es ihm an nichts mangelte.
Die schwerfälligen Wagen mit ihrer kostbaren Fracht wären eine erstrebenswerte Beute für jede Räuberbande. Und davon gab es zurzeit wahrlich genug. Zwar war der Krieg nach drei Jahrzehnten endgültig zu Ende, aber die Soldaten der riesigen Heere, die plötzlich ohne Aufgabe und Einkünfte dastanden, verschwanden nicht von heute auf morgen von den Straßen. Wegelagerer würden noch auf Jahre hinaus die Gegend unsicher machen und das einzige Gewerbe treiben, das sie beherrschten: Rauben und Töten. Auch wenn der Besitz des Grafen von Eenvelde zu seinem Schutz von einer kleinen Söldnertruppe begleitet wurde – wie ein Kampf mit einer Bande von halb verhungerten, zu allem entschlossenen früheren Soldaten ausgehen würde, das wollte niemand wirklich herausfinden.
Nachdem der verletzte Bursche verarztet und auf einem der Wagen auf einen Teppichstapel gelegt worden war, kletterte Simon Prätorius wieder auf das Pferd. Sein Diener Sebastian folgte ihm mit dem Packpferd, als er voranritt und die langsamen Frachtwagen überholte. Zwischen den Bäumen konnte man bereits den Kirchturm von Langenschwalbach sehen. Das Risiko, hier noch überfallen zu werden, war gering. Der Arzt trieb sein Pferd an. Seit Mainz waren sie im Schlenderschritt hinter den langsamen Wagen hergeritten, aber nun reichte es ihm. Er wollte endlich ankommen.
Die Straße führte bergab. Auf der linken Seite war eine Art Parkanlage zu sehen, die von einem kleinen Bach durchflossen wurde. Rechts lagen Gärten, dann begann eine Häuserzeile. Bei den meisten dieser neu und wohlgepflegt aussehenden Fachwerkbauten handelte es sich, den Schildern nach zu urteilen, um Wirts- oder Logierhäuser. Es war kaum ein Mensch zu sehen. Ein ruhiges, verschlafenes Örtchen schien dieses Langenschwalbach zu sein. Genau das, was Prätorius brauchte, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.
„He, Sie da!“ Eine Frau war von der Eingangstreppe eines der Wirtshäuser aufgestanden und trat nun in die Mitte der Straße.
Dem Arzt fielen sofort alle Anekdoten ein, witzige und weniger lustige, die er über Damenbekanntschaften in Kurorten gehört hatte. Sie endeten üblicherweise damit, dass dem männlichen Opfer das Fell über die Ohren gezogen wurde. Er hatte keine Lust, bereits bei der Anreise zur Hauptperson einer solchen Geschichte zu werden. Also tat er so, als ob er nichts gehört hätte und ritt einfach weiter.
Leider hatte er seinem Diener nicht die entsprechenden Verhaltensmaßregeln mitgeteilt. Er hörte, wie das Hufgeklapper hinter ihm erstarb und sich stattdessen eine Diskussion zwischen Sebastian und dem Frauenzimmer entspann. Prätorius wandte sich um. Sein Diener stand bereits neben seinem Pferd und das Weib redete aufgeregt auf ihn ein. Um die Moral der hiesigen Frauenzimmer war es anscheinend noch schlimmer bestellt, als er gehört hatte.
„Was soll das denn bedeuten?“, rief er ungehalten, „Bast, du bist noch im Dienst. Deine Geschäfte mit der hiesigen Damenwelt können warten, bis ich dich nicht mehr brauche.“
Die Frau fuhr herum.
Jetzt sah Prätorius, dass er sich getäuscht hatte. Abgesehen davon, dass die Frau für eine Hure viel zu unfreundlich schaute, war ihr Gesicht nicht geschminkt und auch ihre Kleidung wies nicht den Flitterkram auf, mit dem sich die willfährigen Damen üblicherweise behängten. Die verschmierte Schürze und die sonnengebräunte Haut ließen vielmehr vermuten, dass es sich bei der Frau um das ehrbare Eheweib eines Handwerkers handelte.
„Ich habe Ihren Diener lediglich darauf hingewiesen, dass sein Pferd lahmt.“ Sie deutete auf das beanstandete Tier. Die Stute hatte das Hinterbein angezogen und stellte den Huf nur mit der Spitze auf den Boden.
„Und das womöglich schon den ganzen Tag.“ Die Frau klang so erbost, als sei es die Schuld des Herrn, wenn das Pferd seines Dieners lahm ging.
Vielleicht handelte es sich bei ihr um die Gattin des örtlichen Hufschmiedes, überlegte Prätorius, damit wäre ihr Interesse an dem Pferd erklärt. Möglicherweise lauerte sie hier auf Kundschaft, die sie gleich an ihren Mann verweisen würde. Wenn er zu ihm ginge, dann würde der ein Steinchen aus dem Huf des Pferdes popeln zu einem Preis, für den Prätorius anderswo goldene Hufeisen bekäme. Über die Geschäftstüchtigkeit der Einheimischen in Kurorten hatte er gleichfalls schon genügend Schauergeschichten gehört.
„Wir werden uns darum kümmern“, knurrte er. Dann wendete er wieder sein Tier und ritt davon, ohne das Frauenzimmer noch eines Blickes zu würdigen.
Inzwischen hatte er das Schild des Gasthauses ‚Zur Kette‘ entdeckt. In diesem vornehmen und großen Logierhaus hatte der Graf von Eenvelde sämtliche Räume für sich und sein Gefolge vorbestellen lassen. Das Gebäude war nur durch die bergab zum Unterflecken führende Straße und den Bach vom landgräflichen Sommersitz getrennt.
Bevor Prätorius in den Hof einbog, warf er noch einen Blick über die Schulter. Sebastian hatte nicht mehr gewagt, aufs Pferd zu steigen. Unter dem strengen Blick der unbekannten Frau folgte er seinem Herrn zu Fuß und zog die beiden Tiere am Zügel hinter sich her.
Prätorius übergab sein Pferd an einen wartenden Stallknecht und ließ sich vom Wirt die Zimmer zeigen. Für ihn waren zwei winzige Kammern vorgesehen, deren Fenster zum Wirtschaftshof gingen. Hier würde er sich schnell eingerichtet haben. Er schaute sich nach Sebastian um, der gerade mit den Satteltaschen die Treppe heraufgepoltert kam. Das vordere Zimmer war bereits mit zwei Stühlen und einem Schreibtisch ausgestattet. Auf den Tisch stellte der Arzt die beiden Kästen, die seine Reiseapotheke und das Chirurgenbesteck enthielten. Das Bündel mit den Utensilien für den Aderlass legte er daneben. Die Blutegel, die er in einem kleinen Gefäß mitgeführt hatte, waren krepiert. Aber er hatte erfahren, dass es hier eine Apotheke gab, also konnte er neue bekommen – falls er sie brauchte.
Der andere Raum war ausschließlich zum Schlafen gedacht. Nachdem sich Sebastian in die ihm zugewiesene Dachkammer verzogen hatte, platzierte Prätorius das Miniaturbild von Frederika auf dem Nachttisch neben dem schmalen Bett.
Die beiden Hemden und die Hose hatte sein Diener in die Truhe unter dem Fenster gelegt, wie er mit einem Blick feststellte. Die Sachen nahmen sich in dem geräumigen Behältnis einfach lächerlich aus. Eine Motte, die in der Truhe auf Futtersuche ginge, würde verhungern, bevor sie Prätorius’ Kleider gefunden hatte.
Der Arzt hoffte, dass seine Anwesenheit im Haushalt der van Eenveldes lediglich dazu diente, das Ansehen der Familie zu steigern. Bevor er wegen der Stelle des Leibarztes vorsprach, hatte er sich erkundigt: Sowohl der Graf als auch seine Frau und Tochter erfreuten sich einer sehr robusten Gesundheit. Das Kurbad suchten sie nur wegen der hier gebotenen Zerstreuungen in frischer Luft und angenehmer Gesellschaft auf.
Nach dem Lärm auf dem Hof zu urteilen, waren jetzt die Frachtwagen eingetroffen. Prätorius öffnete einen Fensterflügel und streckte den Kopf hinaus. Kaum dass die Knechte die Fuhrwerke zum Stehen gebracht hatten, begannen die Bediensteten des Gasthofes mit dem Abladen. Jedes einzelne Gepäckstück löste eine Diskussion darüber aus, wie damit zu verfahren sei. Was war darin? Kam es in die Küche, in die Wohnräume der Herrschaft, sollte es gelagert werden? Und wie: Im Stall? Im Keller? Der Haushofmeister des Grafen von Eenvelde rang die Hände und der Wirt des Logierhauses hatte genug damit zu tun, nur die wichtigsten der Fragen, die von allen Seiten auf ihn einprasselten, zu beantworten.
Ein Korb mit Kapaunen verlor seinen Deckel. Die Vögel flatterten gackernd durch den Hof und vergrößerten noch das allgemeine Durcheinander. Schimpfend und lachend fingen Mägde und Küchenjungen das Geflügel wieder ein. Weitere Körbe mit Perl- und Rebhühnern wurden vorsichtiger vom Wagen gehoben. Etliche in Leinwand gehüllte Schinken kamen ebenfalls zum Vorschein und strömten einen so würzigen Duft aus, dass alle Umstehenden Hunger bekamen. Der Wirt sorgte dafür, dass zwei kräftige Knechte die Schinken sofort in der Vorratskammer in Sicherheit brachten.
Ein Koch lüftete vorsichtig eine Plane, unter der schrille Schreie hervordrangen. Zum Vorschein kam ein großer Käfig, in dem ein Vogel saß. Er hatte buntes Gefieder und einen eigenartig geformten Schnabel. Als das Tier das Treiben im Hof beobachten konnte, stellte es sein Kreischen ein und begann noch unmelodischer als eine Krähe zu krächzen. Der Haushofmeister, der sich mit einem spitzengesäumten Tuch immer wieder den Schweiß von der Stirn tupfte, griff ein, als der Vogel gemeinsam mit den Hühnern in die Ställe geschafft werden sollte. Er vertraute den Käfig einem Lakaien an, der sich mit ihm in Richtung der Wohnräume entfernte. Zwei Fuhrleute wuchteten einen unhandlichen Gegenstand vom Wagen herunter. Als die Plane verrutschte, enthüllte sie ein mit Einlegearbeiten verziertes Cembalo. Einige bunt gekleidete Männer aus dem Gefolge des Grafen stürzten hin und trugen das Instrument vorsichtig ins Haus.
Von seinem Fenster aus sah Prätorius, dass das Weib, das ihn auf der Straße angesprochen hatte, ebenfalls in den Hof gekommen war. Sie redete mit dem Wirt und dem Haushofmeister, wobei sie immer wieder auf den Pritschenwagen zeigte, auf dem der Bursche lag, den der Arzt auf der Landstraße aufgesammelt hatte. Jetzt kletterte das freche Frauenzimmer auch noch auf den Wagen. Sie schlängelte sich zwischen Menschen und Gepäckstücken durch und kniete neben dem bewusstlosen Burschen nieder. Prätorius warf das Fenster zu und begab sich in den Hof. Das war sein Patient!
Unten angekommen, drängte er sich durch die hin- und herlaufenden Diener und schnauzte das Weib über die niedrige Seitenwand des Wagens hinweg an: „Was wollen Sie hier?“
„Was haben Sie mit meinem Sohn gemacht?“, fauchte die Frau zurück. Sie hatte den Kopf des Burschen auf ihren Schoß gebettet, streichelte ihm zärtlich über die Stirn und funkelte Prätorius wütend mit goldbraunen Augen an. Die einfache weiße Haube war verrutscht und einige Locken ringelten sich über die Schultern, die viel zu mager waren, als dass sie dem herrschenden Schönheitsideal entsprochen hätten.
„Wir haben ihn auf der Straße aufgesammelt. Wurde wohl von einer Bande Wegelagerer überfallen.“
Die Frau erbleichte.
„Er hat einen Schlag auf den Kopf und einen Messerstich in die Schulter bekommen“, fuhr Prätorius fort. „Beides dürfte nicht tödlich sein. Er hat einen harten Schädel und nicht viel Blut verloren.“
Die Frau musterte den Mann misstrauisch. „Woher wollen Sie das so genau wissen?“
„Ich bin der Leibarzt des Grafen von Eenvelde.“
„Oh.“ Die Frau schien zu ahnen, dass sie sich auch vorstellen sollte. „Mein Name ist Rosalie Mette. Ich bin die Wirtin der ‚Vier Elstern‘. Das ist das kleine Gasthaus am Ortseingang. Sie sind gerade daran vorbeigekommen.“ Sie beugte sich mit einem besorgten Gesichtsausdruck wieder über ihren Sohn.
Prätorius schämte sich ein wenig dafür, dass er die Wirtin für eine geldgierige Hure gehalten hatte. Um sein schlechtes Benehmen wiedergutzumachen, winkte er einige Knechte heran und befahl ihnen, den verletzten Burschen vom Wagen zu heben und dort hinzubringen, wohin die Frau es befahl. Nachdem diese Sache geregelt war, wollte Prätorius nur noch in sein Zimmer zurückkehren. Von der Reise schmerzte ihm jeder Knochen im Leibe.
An der Tür hielt ihn der Wirt des Logierhauses zurück. „Sie sind doch Arzt!“
Als Prätorius bejahte, zog ihn der Mann am Ärmel. „Ein Lakai des Landgrafen möchte Sie sprechen“, sagte er. Der Wirt der ‚Kette‘ führte den Arzt in ein elegant eingerichtetes Zimmerchen, das vom Eingangsflur abging. Augenscheinlich war es dafür gedacht, dass hier Besucher der Logiergäste in angemessener Umgebung warten konnten, bis sie vorgelassen wurden.
Der Lakai hatte sich nicht hingesetzt. Die Hände auf dem Rücken verschränkt stand er mitten im Raum. Als Prätorius eintrat, räusperte er sich. „Eine Dame aus dem Hofstaat hat gesundheitliche Probleme und der Leibarzt des Landgrafen ist noch nicht eingetroffen. Aus diesem Grund möchte die betreffende Dame Sie zu sich bitten.“
„Selbstverständlich.“ Eine andere Antwort gab es unter diesen Umständen nicht. Auch wenn Prätorius sich mehr als alles auf der Welt wünschte, es gäbe sie. Er wollte niemanden behandeln, der womöglich ernsthaft krank war. Und schon gar keine Dame. Das alles erinnerte ihn nur wieder an Frederika und sein Versagen. Er war doch hierhergekommen, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Trotzdem saß er schon kurz darauf am Bett einer neuen Patientin.
Isabella von Hattenberg gehörte zu den Hofdamen der Landgräfin. Sie war bleich im Gesicht und saß halb in dem geschnitzten Bett aus dunklem Holz. Zusammen mit einem kleinen Tisch und einer Kleidertruhe bildete es die einzige Einrichtung des weiß getünchten Kämmerleins. Auf der anderen Seite des Bettes stand Isabellas Zofe, ein junges Mädchen, das verschreckter dreinschaute als seine Herrin.
„Die meisten Leute kommen hierher, um ihre Gesundheit wiederzuerlangen“, sagte Isabella von Hattenberg mit einem verzerrten Lächeln. „Ich muss jedoch gestehen, ich habe mich besser gefühlt, bevor ich hierherkam.“
Die Hofdame litt unter Leibschmerzen und Übelkeit. Ihre Beschreibung der Symptome war aber so ungenau, dass Prätorius keine konkrete Diagnose stellen konnte. Er hoffte im Stillen, dass es nicht die Seitenkrankheit wäre, bei der sich ein winzig kleiner Darmfortsatz entzündet und die meist zum Tode führte. Alles, nur das nicht, dachte er.
Er konnte der Patientin nur raten, im Bett zu bleiben, außer mit Wasser verdünntem Wein nichts zu sich zu nehmen und ihn rufen zu lassen, falls sich ihr Zustand verschlimmerte.
Isabella bedankte sich für seine Bemühungen.
Kapitel 3
Am nächsten Morgen waren Rosalie Mette und ihre Leute wie immer früh auf den Beinen. Zwar bereiteten Koch und Küchenjunge das Frühstück für ihre Herrschaft, aber die Wirtin musste trotzdem stets greifbar sein. Außerdem war die übliche Hauswirtschaft zu besorgen. Die Hühner, die Schweine und die Pferde brauchten Futter, die Eier mussten eingesammelt, der Gemüsegarten versorgt und das Mittagessen für die Schenke vorbereitet werden.
Rosalie sah zuallererst nach ihrem Sohn. Nachdem die Knechte ihn gestern in seine Kammer gebracht hatten, hatte sie selbst den Verband an seiner Schulter entfernt und die Wunde behandelt. Wer würde schon einem unbekannten Arzt trauen? Sie wusch den Stich mit Kamillen- und Schafgarbenabsud aus, danach fühlte sie sich besser. Heute Morgen wirkte Jakob schon wieder recht munter. Allerdings fühlte sich seine Stirn fiebrig an und deshalb lehnte Rosalie jede Diskussion zum Thema Aufstehen ab. Es bereitete ihr Sorgen, dass der Junge keinerlei Erinnerungen an den Überfall hatte.
„Ich war mit dem Maultier und den gefüllten Fässern auf dem Pfad, der am Ende des Kurparks den Berg hinaufführt. Danach weiß ich nichts mehr, bis mich dieser Herr auf seinen Wagen legen ließ.“
„Der Arzt sagt, dass er dich auf der Poststraße nach Mainz aufgesammelt habe.“
Jakob runzelte die Stirn. „Ich bin sicher, dass ich den Pfad durch den Wald entlanggegangen bin. Das mache ich immer so, das ist eine Abkürzung.“
Rosalie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Aber vorerst war sie einfach froh, dass sie ihren Sohn wiederhatte. Außer den beiden verlorenen Fässern waren keine Verluste zu beklagen, und damit konnte sie leben.
Balthasar musterte die Wirtin misstrauisch, als sie vor sich hin summte, während sie die frischen Eier in den Vorratsschrank räumte.
„Sie sind heute gut gelaunt“, stellte er fest, „legen die Hühner gerade besonders viel?“
„Ich freue mich, dass Jakob wieder da ist.“
„Ja, das ist verständlich“, sagte Balthasar und legte den Kochlöffel zur Seite. „Hier sollte wirklich ständig ein Mann im Haus sein. Es ist nicht richtig, dass Sie alleine für alles verantwortlich sind.“ Er sah die Wirtin erwartungsvoll an.
„Ich komme zurecht.“ Rosalie wandte sich wieder dem Vorratsschrank zu.
Anna kam in die Küche, sie hatte die Gaststube ausgefegt und die Tische geputzt. Sie schnüffelte und trat zum Herd.
„Riecht gut. Was ist das?“
Balthasar nahm den Deckel von einem Kochtopf. „Das ist Reis mit Mandeln und Zimt.“
„Mmh“, sie schnappte sich einen Löffel und tauchte ihn in den weißen Brei. Nachdem sie probiert hatte, nickte sie Rosalie zu: „Kochen kann der Mann!“
„Natürlich kann ich kochen!“, sagte Balthasar beleidigt. „Ich gehöre zu den besten Köchen Frankfurts und ich kann gar nicht zählen, wie oft schon versucht wurde, mich abzuwerben. Und das waren nicht nur Bürgerliche, da waren auch Barone und Grafen dabei. Aber ich bleibe bei meiner Herrschaft. Jedenfalls so lange, bis ich ein eigenes Wirtshaus eröffne.“
„Schön für die Lieffenbruchs“, meinte Rosalie.
„Holla Wirtschaft!“ In der Gaststube ertönten schwere Schritte, Sporen klirrten.
Rosalie ging hinüber. Ein Mann schaute sich in dem niedrigen holzgetäfelten Raum um. Als er Rosalie hörte, wandte er sich ihr mit einer schnellen Bewegung zu, die so gar nicht zu seinem behäbigen Aussehen passte.
„Scheint hier gemütlich zu sein. Gibt es auch einen guten Wein?“, er richtete die hellen Augen auf Rosalie.
„Natürlich“, sagte diese, „weißen und roten vom Rhein und wir haben auch welschen und ungarischen.“
Der Mann knurrte anerkennend und nickte. „Der wird auf jeden Fall verkostet.“
Dann schien ihm wieder einzufallen, dass er nicht hier war, um sich nach den Getränken zu erkundigen. „Jetzt lauf los, Mädchen. Hol mir den Wirt her und auf dem Weg bringst du mir einen Schoppen von dem ungarischen.“ Er setzte sich auf eine der breiten Holzbänke, die an den Wänden der Stube angebracht waren, und legte seinen Hut vor sich auf den Tisch. Rosalie sah, dass die dunklen Locken, die, wie die Mode es verlangte, bis auf den breiten, weißen Kragen wallten, bereits von einigen silbrigen Strähnen durchzogen waren. Der Mann kam ihr vage bekannt vor.
„Den Wein bringe ich Ihnen gerne“, sagte sie, „aber was den Wirt betrifft, müssen Sie schon mit mir vorliebnehmen. Dieses Gasthaus gehört mir.“
„Oha!“, der Mann betrachtete sie aufmerksam von oben bis unten. „Ich kann mir vorstellen, dass du viele Stammgäste hast.“
„Mein Wein ist gut und das Essen ist auch nicht zu verachten“, sagte Rosalie einfach.
Unter dem eindrucksvollen Schnurrbart hoben sich die Mundwinkel des Besuchers zu einem Grinsen. „Dann war das wohl dein Sohn, der gestern auf der Straße nach Mainz von Wegelagerern überfallen wurde?“
Rosalie nickte.
„Ich bin Hubertus von Greiffenstein und ich möchte deinem Sohn ein paar Fragen stellen“, sagte der Gast.
„Seit wann interessiert sich die Leibgarde des Landgrafen für Überfälle auf einfache Bürger?“ Rosalie war eingefallen, wo sie diesen Mann schon einmal gesehen hatte: Er führte die Soldaten des Ernst von Rheinfels bei seinem Einzug in Langenschwalbach an.
„Seit der Landgraf beschlossen hat, seinen Hof über die Sommermonate hierher zu verlegen.“
Rosalie konnte sich vorstellen, dass es einen schlechten Eindruck machte, wenn die Gäste des Landgrafen bei Ausflügen oder auf der Jagd um ihr Leben fürchten mussten. „Jakob erinnert sich nicht, was passiert ist.“
„Ich möchte ihn trotzdem sehen“, sagte der Oberst.
Rosalie führte ihn in die Kammer, wo Jakob wach auf seinem Strohsack lag und an die Decke starrte. Als sich der vierschrötige Besucher in den kleinen Raum schob, versuchte der Bursche sich aufzurichten, sank jedoch mit einem schmerzverzerrten Gesicht wieder zurück.
„Bleib ruhig liegen.“ Der Mann zog den dreibeinigen Schemel heran und setzte sich darauf. Dann schaute er Rosalie an. „Jetzt wäre der Wein angebracht.“
Es passte der Wirtin gar nicht, hinausgeschickt zu werden, aber mit dem Befehlshaber der gräflichen Leibgarde wollte sie sich nicht anlegen. Als sie mit einem Becher des ungarischen Weines zurückkehrte, wirkte Greiffenstein enttäuscht. Er nahm einen großen Schluck aus dem Becher, den Rosalie ihm reichte, und nickte anerkennend. „Dein Wein ist gut, aber dein Sohn ist nicht sehr hilfreich.“
„Ich sagte ja bereits, dass er sich nicht erinnert“, meinte Rosalie.
„Was sollen Wegelagerer an dem Pfad gemacht haben, den ich gegangen bin?“, fragte Jakob, „da kommt außer ein paar Bauern sonst niemand vorbei – und bei denen ist nichts zu holen.“
„Du bist aber an der Straße gefunden worden.“
„Ich weiß nicht, wie ich dort hingekommen bin!“
Hubertus von Greiffenstein trank wieder einen großen Schluck Wein.
Da wurde die Tür der Kammer von außen geöffnet und Balthasar musterte misstrauisch die Gesellschaft, die sich um den Strohsack herum versammelt hatte. Besonders lange blieb sein Blick an dem untersetzten Oberst mit dem zinnernen Weinbecher in der Hand haften, der es sich auf dem Schemel gemütlich gemacht hatte und seinerseits den mageren Koch interessiert betrachtete.
„Du wirst in der Küche gebraucht“, sagte Balthasar mit einem vorwurfsvollen Unterton zu Rosalie.
„Was ist denn los?“
„Die bestellten Gänse sind immer noch nicht da. Ich weiß nicht, was ich meiner Herrschaft heute Abend servieren soll!“
„Ich werde mich darum kümmern“, sagte Rosalie. Als Balthasar immer noch stehen blieb und keine Anstalten machte, sich zurückzuziehen, fügte sie hinzu: „Später.“
Balthasar schloss zögernd die Tür von außen.
Greiffenstein grinste. „Neugieriger Patron.“
Rosalie wurde rot und ärgerte sich darüber.
„Wenn dein Sohn sich wieder erinnert, dann lass es mir ausrichten.“ Greiffenstein erhob sich mit einem leisen Ächzen und reichte Rosalie den leeren Becher. „Es hat mich sehr gefreut, dich und deinen Wein kennenzulernen“, sagte er mit einem Blick in den Ausschnitt ihres Kleides.
Kapitel 4
Prätorius hatte eine unruhige Nacht verbracht. Die Tatsache, dass man ihm die Verantwortung für eine Patientin aufgeladen hatte, die womöglich wirklich krank war, zerrte an seinen Nerven. Um sich nicht noch länger mit den verschiedensten Erwägungen und Befürchtungen in den Laken zu wälzen, stand er früh auf. Er wollte sich in Ruhe im Ort umschauen, bevor seine neuen Herrschaften ankamen und Anspruch auf seine Zeit und seine Aufmerksamkeit erhoben.
Mit einem flüchtigen Nicken grüßte Prätorius den Haushofmeister der Eenveldes, der sich in der Hofeinfahrt mit dem Wirt unterhielt, und schlenderte dann davon. Trotz der frühen Stunde waren schon erstaunlich viele Menschen auf der Straße. Rüschengeschmückte Kavaliere, die sich mit oder ohne Pagen, mit Hunden oder ohne, hoch zu Ross oder zu Fuß zeigten. Juwelenbehängte Damen in ihren Morgenkleidern waren mit Gesellschafterinnen und Zofen unterwegs zu dem heilkräftigen Brunnen. Auch einzelne Mägde und Lakaien strebten mit Karaffen und Kannen zum Wasser. Sie holten das kostbare Nass für ihre Herrschaften, die zwar nicht aus dem Bett fanden, aber ihre Trinkkur trotzdem nicht vernachlässigen wollten.
Vor dem Tor, das in den Hof des landgräflichen Schlosses führte, standen etliche Gaffer. Seit das Schlösschen bewohnt wurde, bildete es die Hauptattraktion für die müßigen Kurgäste. Hier war immer etwas los. Lieferanten und Händler gingen mit ihren Waren ein und aus – vor allem Schneider, Goldschmiede und Zuckerbäcker. Kuriere oder Soldaten galoppierten aus dem Tor und man konnte spekulieren, in welchen wichtigen Aufträgen sie unterwegs waren. Mit etwas Glück konnte man einen Blick auf eine in Samt und Seide gekleidete Dame erhaschen oder sogar auf den Landgrafen selbst.
Prätorius beschloss, auf dem Rückweg von seinem Spaziergang ins Schloss hineinzugehen und seine Patientin zu besuchen. Vielleicht war sie über Nacht ja überraschend genesen. Wenn sie nur zu viel gegessen hatte, dann lag das durchaus im Bereich des Möglichen. Die Symptome, die sie ihm geschildert hatte, konnten auch von einer kräftigen Magenverstimmung herrühren.
Vor dieser Visite würde er jedoch bei dem Jungen vorbeischauen, den er gestern von der Straße gesammelt hatte. Das wäre nur recht und billig, denn schließlich musste er sich davon überzeugen, dass der Bursche auch die richtige Behandlung bekam.
In dem Moment, als Prätorius vor den ‚Vier Elstern‘ anlangte, wurde die Tür von innen geöffnet und ein militärisch aussehender Mann trat ins Freie. Mit einer knappen Bewegung setzte er den mit einer wallenden Straußenfeder geschmückten Hut auf und gab der Krempe einen leichten Klaps, damit sie sich unternehmungslustig wölbte. Auch wenn schon einige Jahre vergangen waren, seit sie sich zuletzt gesehen hatten, erkannte Prätorius den Herrn von Greiffenstein sofort. Der Oberst stutzte ebenfalls nur kurz, als der Arzt auf ihn zukam, dann breitete er die Arme aus und zerquetschte ihm fast den Brustkorb mit seiner Umarmung.
„Was machen Sie hier?“, wollte er wissen, während er Prätorius auf den Rücken klopfte, als sei der ein braves Schlachtross.
„Bin Leibarzt des Grafen von Eenvelde“, hustete der Arzt zwischen zwei Schlägen hervor.
„Und deswegen treiben Sie sich um diese Morgenstunde vor dem Gasthaus der reizenden Rosalie herum?“ Der Oberst lachte dröhnend. „Was sagt denn Ihre bezaubernde Frederika dazu?“
Prätorius spürte, wie er erbleichte. Der Morgen hatte plötzlich seinen Glanz verloren. „Sie ist vor zwei Monaten gestorben.“
Der Oberst machte ein betroffenes Gesicht. „Das tut mir leid.“
Seine Hand war auf dem Rücken des Doktors liegen geblieben. „Sie müssen sich schrecklich fühlen“, sagte er mit seiner üblichen Direktheit.
Prätorius nickte. Dann wechselte er das Thema: „Ich wollte nach Rosalies Sohn sehen.“
„Viel Aufmerksamkeit für den jungen Dachs“, meinte der Oberst, „ich war auch gerade bei ihm und habe ihn befragt. Leider scheint er das Gedächtnis verloren zu haben. Aber sonst wirkt er schon wieder recht munter und seine Mutter ist ein appetitlicher Happen.“
„Was haben Sie denn mit der ganzen Sache zu tun?“
„Nachdem ich hörte, was gestern passiert ist, habe ich den hiesigen Amtmann unterrichtet, dass ich selbst die Sache in die Hand nehme. Solange der Landgraf in diesem Ort weilt, darf es solche Überfälle einfach nicht geben.“ Der Oberst grinste. „Außerdem brauchen meine Männer eine Beschäftigung. Wenn sie untätig herumsitzen, kommen sie nur auf dumme Gedanken. Wollen Sie sich uns morgen anschließen? Wird sicher eine hübsche Jagd, wenn wir die Wälder nach den Wegelagerern durchkämmen.“
Prätorius schwieg. Greiffenstein wusste genau, dass es ihn wahrlich nicht lockte, über Stock und Stein zu galoppieren, stets in Gefahr, von einem tiefhängenden Ast aus dem Sattel gewischt zu werden oder durch einen unverhofften Hopser seines Reittieres Bekanntschaft mit dem nächsten Graben zu machen.
„Jetzt muss ich weiter“, Greiffenstein klopfte seinem Freund zum Abschied noch einmal auf die Schulter. „Demnächst trinken wir etwas zusammen und reden. In diesem Gasthaus ist der Wein wirklich gut!“ Er ging hinüber zu seinem schweren Schimmel, den ein Knecht festgehalten hatte, während der Oberst in den ‚Vier Elstern‘ war. Greiffenstein warf dem Mann eine kleine Münze zu, stieg in den Sattel, winkte in Prätorius’ Richtung, rief „Weidmannsheil!“ und trabte davon. Die kurze Strecke bis zum Schloss zu Fuß zurückzulegen, war dem Oberst offensichtlich nicht in den Sinn gekommen.
Der Arzt sah ihm nach. Für seinen Geschmack lebten sie in viel zu verschiedenen Welten, um sich wirklich zu verstehen. Der alte Soldat, der nahezu sämtliche Feldzüge des Hauses Hessen-Kassel mitgemacht hatte, und der nicht mehr ganz junge Simon Prätorius, der erst nach dem Tod seiner Frau wieder die Niederlande und die Universität zu Leiden verlassen hatte.
Als er die ‚Vier Elstern‘ betrat, hatte er kaum Zeit, sich in der leeren Gaststube umzuschauen. Bevor sich seine Augen an das Dämmerlicht, das die Butzenscheiben einließen, gewöhnt hatten, streckte die Wirtin schon ihren Kopf aus der Küchentür. „Was wünschen Sie?“, ihre Stimme klang barsch.
„Ich möchte mich lediglich erkundigen, wie es Ihrem Sohn geht“, sagte Prätorius steif.
„Da sind Sie heute nicht der Erste.“ Die Wirtin wandte sich um und sagte etwas zu jemandem in der Küche, das Prätorius nicht verstand.
Dann kam sie heraus und schloss die Küchentür hinter sich. Rosalie schaute den Arzt verlegen an. „Entschuldigen Sie bitte mein Verhalten, der Koch meiner Logiergäste treibt mich noch zur Weißglut.“
Bevor Prätorius etwas dazu sagen konnte, redete sie weiter. „Ich möchte mich aufrichtig für das bedanken, was Sie für meinen Sohn getan haben.“
„Wie fühlt er sich heute?“
Rosalie hob die Schultern. „Den Umständen entsprechend, möchte ich meinen. Allerdings kann er sich nicht erinnern, wie er dort hingekommen ist, wo Sie ihn fanden.“
„Das kann nach einem kräftigen Schlag auf den Kopf passieren. Möglicherweise findet er sein Gedächtnis nach einigen Tagen oder Wochen wieder.“
„So lange muss er aber nicht liegen bleiben?“, fragte Rosalie alarmiert, „sonst sollte ich ihn schnell festbinden.“
Prätorius lachte. „Ich denke, wenn Sie es fertigbekommen, dass er noch drei Tage das Lager hütet, dann reicht das. Er wird sich schonen, wenn ihm danach ist.“
Rosalie atmete auf. „Sie wissen ja, wie Burschen sind.“
Prätorius betrachtete die Wirtin von der Seite. Sie war nicht mehr ganz so jung, wie man angesichts ihrer schlanken Figur glauben konnte, das verrieten die Fältchen um die Augen und am Hals. Ebenso wie die Tatsache, dass sie einen fast erwachsenen Sohn hatte. Trotzdem strahlte sie eine Art von Kraft und Gesundheit aus, die anziehend war. Auch wenn man sie wahrhaftig nicht als schön bezeichnen konnte. Dafür war ihre Haut zu braun und ihre Figur nicht üppig genug. Sie erinnerte ihn an die Buche, die im Garten seines Leidener Stadthauses wuchs und die Frederika so gemocht hatte. Schlank und elegant.
Der Gedanke an seine verstorbene Frau machte ihn wieder traurig, aber anscheinend hatte sein Gesichtsausdruck nichts von seinen Gedanken verraten, denn Rosalie lächelte ihn an. Sie griff zu dem Weinkrug, der auf einem Tisch neben der Küchentür stand, und füllte einen Zinnbecher. „Hoffen wir, dass die Schuldigen an dem Überfall auf meinen Sohn gefasst werden.“ Sie reichte Prätorius den Becher.
„Immerhin will sich der Befehlshaber der Leibwache persönlich darum kümmern.“ Er nahm einen Schluck. Der Wein war stark. Die in vielen Gasthöfen geübte Praxis, den Wein gehörig mit Wasser zu strecken, schien hier nicht in Mode zu sein.
Rosalie wiegte den Kopf. „Mal sehen, was dabei herauskommt.“
„Es waren doch Wegelagerer?“
„Das sagt der Oberst. Jakob hat berichtet, dass er sich nicht erinnern kann. Nach der Ansicht des Obersts ging es den Räubern um die Fässer. Er meint, dass sie wohl glaubten, es wäre Wein.“
„Der Oberst interessiert sich eben sehr für Wein.“ Diese Bemerkung war Prätorius einfach herausgerutscht und die Vertraulichkeit, die darin steckte, war ihm sofort peinlich.
Rosalie kicherte. „Ich glaube, der interessiert sich auch für ganz andere Dinge.“ Dann schaute sie den Arzt neugierig an. „Ich habe den Eindruck, dass Sie den Oberst gut kennen?“
Eigentlich betrachtete sich Prätorius nicht als Klatschmaul, aber es war lange her, dass er sich mit einer Frau gemütlich unterhalten hatte. Rosalie lächelte ihm ermutigend zu und füllte seinen Becher auf. Sie schien es nicht eilig zu haben, in ihre Küche zurückzukommen.
„Greiffenstein habe ich vor ein paar Jahren in den Niederlanden kennengelernt, als er ärztliche Hilfe brauchte. Wie er mir erzählt hat, war er zuvor auf Besuch bei einem Bekannten und ist mit ihm zusammen auf die Jagd gegangen.“
Rosalie nickte. „Da kann so allerlei passieren.“
„Allerdings. In Greiffensteins Fall ging die Begegnung mit einem Wildschwein noch recht glimpflich für ihn aus. Er rückte dem Tier mit einer Saufeder zuleibe, aber der Keiler wollte sich wohl nicht widerstandslos mit der Lanze abstechen lassen. Er wehrte sich und brachte Greiffenstein mit seinen Hauern eine tiefe Risswunde am Oberschenkel bei.“
„Puh!“, Rosalie schenkte Wein nach.
„Greiffenstein ließ die Wunde durch den örtlichen Bader nähen und glaubte, damit sei die Sache erledigt. Aber das war sie nicht.“
Prätorius trank den Becher leer und legte die Hand darüber, als Rosalie nachschenken wollte. Für heute Vormittag hatte er genug. „Die Wunde heilte nicht richtig und begann sich zu entzünden. Als der Oberst dann auch noch Fieber bekam, entschloss er sich, einen richtigen Arzt aufzusuchen, und landete bei mir. Ich steckte ihn in meinem eigenen Gästezimmer ins Bett, öffnete die Naht wieder und sorgte dafür, dass der Eiter abfloss und alles richtig verheilte.“ Prätorius lächelte Rosalie an. „Greiffenstein ist der festen Überzeugung, dass ich sein Bein gerettet habe. Während seiner Genesungszeit haben wir öfter miteinander Schach gespielt und uns irgendwie angefreundet.“
Er erwähnte nicht, dass Frederika oft bei den Gesprächen und Schachpartien zugegen gewesen war. Manchmal hatte sie sich mit einer Stickerei beschäftigt, oft saß sie aber auch einfach dabei und beteiligte sich an den Gesprächen. „Er ist ein alter Haudegen“, pflegte sie immer zu Simon zu sagen, „aber ein netter.“