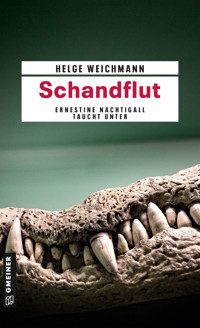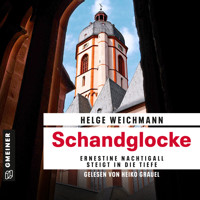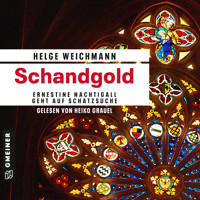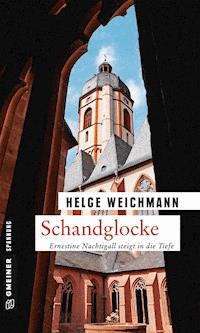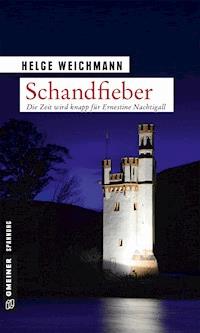
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historikerin Tinne Nachtigall
- Sprache: Deutsch
Die Historikerin Tinne gehört einem Forschungsprojekt an, das mittelalterliche Heilrezepte auf ihre heutige Wirksamkeit prüft. Bald schon laufen die Dinge aus dem Ruder: Eine Explosion verwüstet das Labor, einer der Forscher stirbt an Tollwut, Hunde und Katzen verschwinden von den Mainzer Straßen. Als schließlich eine Reliquie der Heiligen Hildegard von Bingen gestohlen wird, stoßen Tinne und der Lokalreporter Elvis auf ein gut gehütetes Geheimnis aus der Zeit der mystischen Ordensfrau. Doch damit werden sie von Jägern zu Gejagten ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helge Weichmann
Schandfieber
Kriminalroman
Zum Buch
Unter Quarantäne Es läuft gerade nicht rund für die Historikerin Tinne Nachtigall: Von heute auf morgen wird sie zur Aushilfs-Mama erklärt und muss sich um eine Fünfjährige kümmern. Und ausgerechnet jetzt hat ihr Mitbewohner Axl ein Hardrock-Tonstudio im Keller eingerichtet. Auch beruflich gerät einiges aus den Fugen. Eine Zusammenarbeit mit dem Pharmakologischen Institut zur Erforschung mittelalterlicher Heilmethoden entwickelt sich zum Desaster, eine Explosion verwüstet das Labor, einer der Mitarbeiter verschwindet spurlos. Gemeinsam mit dem Reporter Elvis beginnt Tinne die Fäden aufzudröseln. Die Spur führt nach Bingen, wo vor fast 1.000 Jahren die Mystikerin Hildegard die Heilmittel der damaligen Zeit zusammenfasste. Doch ihre Schrift »Causae et Curae« gilt als verschollen. Zwischen Kräutermedizin und modernen Pharmainteressen suchen Tinne und Elvis nach der Wahrheit. Plötzlich sind die beiden mittendrin in einem Kampf, den Hildegard von Bingen einst angefangen hat, der aber bis heute noch nicht entschieden ist.
Helge Weichmann wurde 1972 in der Pfalz geboren und ist seit 25 Jahren in Rheinhessen zu Hause. Während seines Studiums jobbte er als Musiker sowie als Kameramann und bereiste zahlreiche Länder, bevor er sich als Filmemacher selbstständig machte. Seine Kreativität lebt er in vielen Bereichen aus: Er betreibt eine Medienagentur, arbeitet als Moderator, fotografiert, filmt, zeichnet und schreibt. Weichmann ist begeisterter Hobbykoch, Weinliebhaber und Sammler von Vintage-Gitarren. Mit der chaotischen Historikerin Tinne Nachtigall und dem dicken Reporter Elvis hat Helge Weichmann zwei liebenswerte Figuren geschaffen, die ihre ungewöhnlichen Abenteuer mit viel Pfiff, Humor und Improvisationstalent meistern.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Schandglocke (2017)
Schwarze Sonne Roter Hahn (2017)
Schandkreuz (2016)
Schandgold (2014)
Schandgrab (2013)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ebenso sind die genannten Firmen, Institutionen, Universitäten, Museen und Forschungseinrichtungen fiktiv oder, falls real existierend, in fiktivem Zusammenhang genutzt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Branko Srot/Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5834-7
Zitat
Sowohl des Menschen Körper als auch seine Taten können erblickt werden.
Vielmehr aber liegt inwendig in ihm, was keiner sieht und keiner kennt.
Hildegard von Bingen (1098 – 1179)
Mystikerin, Äbtissin und Naturwissenschaftlerin, katholische Heilige
Prolog
Bingerbrück, 28. Juli 1175
Die Luft knisterte vor statischer Aufladung, das nahende Gewitter setzte Bäume und Sträucher unter Spannung. Auch das gedrungene Klostergebäude schien den Atem anzuhalten, Mensch und Tier warteten auf die Urgewalt, die sich in himmelhohen Wolkentürmen abzeichnete. Der bleiche Vollmond war kaum auszumachen, allzu schnell schloss das schwarze Gewölk jede Lücke am Firmament.
In der aufgeladenen Atmosphäre klang das Wiehern von Pferden fremd und schrill, ihre Hufe schlugen hart auf den gepflasterten Hof. Die ankommenden Reiter sahen klein aus vor dem Kloster, die hohen Mauern von Rupertsberg überragten sie wie eine uneinnehmbare Burg. Obwohl es fast Nacht war, brannte kaum ein Licht in dem Gebäude, nur hier und dort war flackernder Kerzenschein in einem der Fenster zu erahnen.
Die fünf Männer sprachen kein Wort und stiegen eilig von ihren Pferden. Ihre Gesichter waren ernst, als sie einen sechsten Mann vom Sattel zogen. Seine Arme waren mit Lederriemen gefesselt, Schweiß ließ seine Haut glänzen, er torkelte zur Seite, sie mussten ihn auffangen. Einen Wimpernschlag später stürmte er voran, mit schier unmenschlicher Kraft versuchte er, ihren Händen zu entkommen. Seine Sehnen spannten sich und ließen die Arme aussehen wie die Glieder eines Raubtiers, roh und wild. Mit aller Gewalt drückten ihn die Männer nieder. Am Boden riss er den Kopf zurück und schrie, ein viehisches Jaulen, dem nichts Menschliches innewohnte. Mit gebleckten Zähnen schnappte er nach jedem, biss um sich in der kalten Luft, Blut und Speichel troffen von den Lippen, seine Augen rollten und zeigten ein Spiegelbild des vollen Mondes als fiebriges Irrlicht. Jemand versuchte, ihm die Stirn zu tupfen, doch schon knallten die Zähne zusammen, wo eben noch die helfende Hand war. Noch immer hatte keiner ein Wort gesagt.
In dieser Sekunde fielen die ersten schweren Tropfen, mit sattem Geräusch zerplatzten sie auf den Steinen. Ein Blitz flammte auf und machte aus den Gesichtern grelle Fratzen, einen Wimpernschlag später rollte der Donner, so tief, dass er den Boden beben ließ. Die Elemente brachen los, schon hatten sich die Tropfen in einen Vorhang aus Wasser verwandelt, der die Kleider durchnässte und das Pflaster schlammig machte. Einer der Männer führte die Pferde davon, die die Augen aufrissen und angstvoll wieherten, die anderen zogen den Gefesselten voran. Wieder schrie er, sein Jaulen wurde verschluckt vom nächsten Donner, ein Windstoß verwirbelte den Sturzregen und trieb die Gruppe zum Klostereingang.
Der Anführer hieb seine Fäuste gegen das Holztor, gleichzeitig ließ ein zweiter die kleine Türglocke bimmeln, sie tanzte nervös und schickte einen schrillen Klang über den Hof. Wieder trommelten die Fäuste.
»Macht auf, rasch!« Die Stimme des Mannes war das Befehlen gewohnt. »Ich fordere euch auf: öffnet! Im Namen des Pfalzgrafen Konrad!«
Das Trommeln und Rauschen des Regens übertönte jede Reaktion im Inneren des Gebäudes. Die Neuankömmlinge schauten sich kurz an und griffen den rasenden Mann fester, der von Krämpfen geschüttelt wurde. Konrad aus dem Hause der Staufer hatte die Pfalzgrafenwürde von seinem Halbbruder Friedrich Barbarossa verliehen bekommen, er hielt den Familienbesitz der Staufer und war als Herr über Schönau und den Wormsgau ein geachteter Mann. Jemand, den man nicht warten ließ. Gerade hob der Wortführer nochmals die Faust, da erklang das Geräusch eines Riegels, die Tür öffnete sich einen Spaltbreit. Als weißer Klecks erschien das Gesicht einer Nonne, die Wangen vom Alter eingefallen, die Stirn unter dem schwarzen Skapulier versteckt. Ein Auge war milchig blind, das andere zwischen Falten und wuchernden Brauen kaum zu sehen.
Der Mann ließ seine Faust sinken. Es war ihm anzusehen, dass er sich zügeln musste, um die Tür nicht aufzustoßen. Mühsam dämpfte er seine Stimme.
»Schwester, Graf Konrad ist bei uns. Er braucht Hilfe. Eilt Euch.«
Hinter der Nonne erschienen weitere Flecken, blasse Frauengesichter, manche runzlig, manche fast noch kindlich. Im Kloster Rupertsberg lebten 46 Nonnen, es hätte mehr als die doppelte Zahl sein können, so viele Zugangsbitten gab es. Der gute Ruf des Benediktinerinnen-Konvents ging weit über das Binger Land hinaus, man sagte den Nonnen große Kenntnisse in theologischen Fragen nach, aber auch eine sichere Hand in der Kräuter- und Heilkunde.
Diese medizinischen Fähigkeiten waren es, die die Leibgarde des Grafen trotz des bedrohlichen Wetters zum Rupertsberg getrieben hatte. Sie schoben Konrad nach vorn, dessen glühende Augen unstet zuckten und dessen blutiger Mund ihn wie ein Ungeheuer aus einer bösen Sage aussehen ließ. Die Sturzbäche aus Schweiß vermischten sich mit dem Regenwasser aus seinen Haaren und kündeten von dem Feuer, das in ihm brannte.
Die einäugige Nonne öffnete die Tür so weit, dass der Wortführer halb eintreten konnte.
»Was fehlt ihm?«, fragte sie.
Er zögerte eine Sekunde und schlug das Kreuzzeichen, bevor er antwortete. »Das Schandfieber. Wir fürchten, es ist das Schandfieber.« Den nächsten Satz sprach er so leise, dass der Wind seine Worte von den Lippen riss. »Bringt ihn zur Äbtissin, Schwester. Helft uns, bevor ihn das Fieber zum Mannwolf macht.«
Die Nonne richtete ihr gesundes Auge auf den Pfalzgrafen, der nach wie vor von starken Händen gehalten wurde. Er bog die Brust nach vorn, sein Körper krümmte sich, als wolle er in der Mitte durchbrechen. Das Röcheln aus seiner Kehle klang erstickt, seine Augen verdrehten sich, nur noch das Weiße war zu sehen.
Über den Mannwolf redeten die Menschen in den Dörfern hinter vorgehaltener Hand. Die Alten nannten ihn Werwolf – Wer, das fast vergessene Wort für Mann. Eine Kreatur, die von der menschlichen in die wölfische Gestalt wechselte.
Die unheimliche Metamorphose begann als normales Fieber, wie es oft über die Menschen kam und nach einigen Tagen wieder verschwand. Doch wenn das Fieber blieb und Juckreiz mit sich brachte, Brennen, Unruhe und wechselhafte Launen, dann wusste man, dass das Böse in diesen Körper gefahren war. Bald schon wurde der Kranke immer mehr zum Tier, er lief auf allen vieren, griff alles und jeden an und heulte wie seine neuen Brüder in den Wäldern. Wer dem Schandfieber verfiel, so sagten die Leute, hatte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Einen Pakt, der die Seele raubte und den Leib zur Bestie werden ließ.
Am Hof des Pfalzgrafen hielt man solche Geschichten für das Geplapper der Bauern, für Märchen, mit denen die einfachen Leute ihre Kinder erschreckten. Bis Konrad eines Tages mit fiebrigen Augen im Bett lag und das Feuer nicht aufhören wollte zu brennen. Die Verwandlung begann, schleichend erst, dann immer rascher. Der Medikus wusste bald schon keinen Rat mehr, der Pfarrer konnte trotz langer Nächte auf den Knien keine Besserung bewirken. Ganz im Gegenteil, Pfalzgraf Konrad verlor jeden Tag etwas von seiner menschlichen Seite und wurde immer mehr zum Tier. In ihrer Verzweiflung entschlossen sich seine Vertrauten, in Bingerbrück Rat zu suchen, bei einer Frau, deren medizinisches Wissen als einzigartig galt.
Die alte Nonne beobachtete Konrad, sah, wie sein Wesen zwischen Erschöpfung und Aggressivität pendelte, als würden eine menschliche und eine viehische Seite in ihm kämpfen. Schließlich gab sie seinen Begleitern mit einem Wink zu verstehen, dass sie ihn hereinbringen sollten.
Krumm wie ein knotiger Baum wandte sie sich um, winkte eine junge Nonne herbei und wisperte ihr etwas ins Ohr. Das Mädchen schlug die Augen nieder und deutete eine Verbeugung an. Während die Männer die Tür aufstießen und wilde Sturmböen den Regen hineinrissen, verschwand die kleine Gestalt in einem der Gänge.
Die Kerzen in ihren eisernen Wandhaltern flackerten im Wind, der unter der Kammertür durchzog, fetter schwarzer Qualm stieg auf und ließ die Luft wogen wie ein lebendiges Wesen. Bauchige Flaschen fingen das flackernde Licht ein, in trüber Flüssigkeit schwammen Wurzeln und faserige Kräuter. Raumhohe Regale aus schwarzem Holz waren angefüllt mit Pergamenten, verschnürten Schriftrollen und Büchern mit brüchigen Lederrücken. Am Arbeitstisch saß eine alte Frau, dünn und groß, eingehüllt in das schwarze Habit der Benediktinerinnen. Vor ihr verteilten sich hölzerne Messinstrumente, eiserne Gewichte, eine filigrane Waage und eine Vielzahl von Tiegeln mit Pulvern und Salben. Auf einer Handschrift mit blassen Zeilen lag ein geschliffener Beryll wie ein übergroßer Tropfen, seine Brechung ließ die Buchstaben groß und verzerrt aussehen. Leise murmelnd schob die Greisin den Stein weiter, Letter für Letter, Zeile für Zeile, die Vergrößerung half ihr, die Zeichen zu entziffern. Hin und wieder griff sie nach einem Federkiel und machte eine Notiz auf Lumpenpapier, dessen grobe Oberfläche die Tinte breit auslaufen ließ.
Ein zartes Klopfen ertönte. Die alte Frau hielt nicht inne in ihrem Gemurmel, erst als sich die Tür einen Spaltbreit öffnete, ließ ihre Hand den Beryll ruhen. Der Lufthauch, der hereinfuhr, brachte die Kerzen noch stärker zum Flackern, das Dämmerlicht verlieh ihrem faltigen Gesicht einen gespenstischen Widerschein.
»Ent… entschuldigt, Mutter Äbtissin. Schwester Bergund schickt mich.« Die Stimme der jungen Nonne war kaum zu hören, ihre Augen waren groß und versuchten, all das zu erfassen, was in der Studierstube verborgen war und Außenstehende selten zu sehen bekamen. Sie wartete auf eine Antwort. Als diese ausblieb, fasste sie sich ein Herz und sprach weiter.
»Graf Konrad ist angekommen, sein Gefolge hat ihn gebracht. Er ist krank, sehr sogar. Schwester Bergund lässt ihn ins Hospiz bringen. Sie fragt nach Euch.«
Zäh verrannen die Sekunden, die Greisin rührte sich nicht. Endlich erklang ihre Stimme, hoch und rau wie ein ungestimmtes Instrument.
»Was?«, fragte sie knapp.
»Das Fieber. Schwester Bergund sagt, das Fieber hat ihn gepackt. Das Schandfieber.«
»Das Schandfieber?«, wiederholte die alte Frau mehr zu sich selbst. Danach schwieg sie. Nach einer Weile beugte die Nonne ihren Kopf, zog sich zurück und ließ die Tür sanft zufallen.
Im Inneren der Kammer schloss Hildegard von Bingen die Augen und verharrte, als wolle sie Kraft sammeln im Gebet. Das Schandfieber. Die Verwandlung in einen Mannwolf. Wo hörte medizinisches Wissen auf, wo fingen Legenden an? Hildegard wusste mehr über Krankheiten und Seuchen als die Bauern unten in den Dörfern, viel mehr. Sicher, Gott im Himmel gab das Leben und nahm es, ohne dass die Sterblichen seinem Willen zu widersprechen hatten. Doch das bedeutete keineswegs, dass man die Gebrechen des Leibes in stiller Duldung hinnehmen musste, o nein. Denn Gottvater selbst ließ in der freien Natur diejenigen Hilfsmittel gedeihen, die den Kampf gegen das Siechtum unterstützten – es war an den Menschen, diese Gaben zu nutzen.
Die Kenntnisse um diese Heilkräfte waren überall im Land verstreut, in den Klöstern, bei den Hebammen und Kräuterweiblein, dazu kamen viele fahrende Wundärzte oder Bader mit speziellem Wissen und neu gemischten Tinkturen. All diese Schriften und Rezepturen sammelte Hildegard nun schon seit vielen Jahrzehnten, sie studierte die obskursten Rezepte, kochte sie nach, prüfte die Wirksamkeit und fertigte Abschriften mit eigenen kritischen Kommentaren an. Auf diese Weise hatte sie nach und nach ihr Wissen über Entstehen und Vergehen des Menschen gewonnen, über Pflanzen, die heilten, über das empfindliche Gleichgewicht der Säfte, die das Leben im Fluss hielten. Und über Krankheiten, die vom Teufel selbst zu stammen schienen. Krankheiten wie das Schandfieber.
Hildegard konzentrierte ihre Gedanken wieder auf das Hier und Jetzt, holte Luft und zwang ihren dünnen Körper zum Aufstehen. Mit 76 Lebensjahren hatte sie ein Alter erreicht, das mehr als außergewöhnlich war und in dem sie die Gnade Gottes spürte. Ihre Hände, mager und faltig wie Klauen, zogen ein Pergament aus dem Regal, eng beschrieben in ihrer feinen Handschrift, mit Maßangaben und Hinweisen zur Dosierung. Nachdem sie eine der Kerzen näher an den Arbeitstisch gerückt hatte, nahm sie einen winzigen Löffel und konzentrierte sich auf die Sammlung an zerstampftem Pulver und Tinkturen.
Über das ›Fieber der Schande‹ wusste Hildegard viel. Mehr sogar, als ihr lieb war. Mit sicheren Bewegungen machte sich die greise Klosterfrau daran, dem Schandfieber entgegenzutreten, das im Körper des Pfalzgrafen wütete.
Köln, 3. März 2009
Der Waidplatz war Mist. Echt Mist. Julius Caesar musste an sich halten, um nicht die Augen entnervt zu verdrehen. Doch jede Bewegung – auch die seiner Augen – wurde peinlich genau überwacht. Eine Handvoll Kinder hatte sich vor ihm in Position gebracht und linste argwöhnisch, um ihn bei einem Zucken oder einem winzigen Zittern zu ertappen.
Wieder war Caesar nahe daran, die Augen zu rollen. Kinder waren das undankbarste Publikum. Eigentlich war sich die ganze Welt einig, die Kids von heute könnten keine Minute still sitzen und würden ständig auf ihr Handy glotzen. Tja, zumindest in seinem Fall stimmte das nicht. Die Knirpse schauten ganz genau hin und legten dabei eine schier unendliche Geduld an den Tag. Und natürlich waren sie nicht nur die pingeligsten, sondern auch die knauserigsten Zuschauer. Von drei Euro Taschengeld gab niemand etwas ab. Die Mütter, die in einigem Abstand auf einer Bank saßen und gleichzeitig aufeinander einschwatzten, interessierten sich nicht für ihn und würden ebenfalls keinen Cent lockermachen. Das wusste er aus Erfahrung.
Nein, den Waidplatz würde er kein zweites Mal wählen, beschloss Caesar, der mit bürgerlichem Namen Piet Klumm hieß. Der Standort am nördlichen Ende der Severinstraße war eh nur ein Notbehelf gewesen, weil in den Fußgängerzonen die besten Plätze bereits besetzt gewesen waren von Musikern, Gauklern und Straßenmalern. Sich dazwischen zu mogeln, kam als Alternative nicht infrage – das Ordnungsamt hatte einen scharfen Blick auf die erforderlichen Mindestabstände zwischen den »Schaustellern im öffentlichen Verkehrsraum«, wie es so schön im Beamtendeutsch hieß. Also entschloss sich Piet, sein Glück hier zu versuchen. Eine schlechte Entscheidung.
Der Platz an sich war nicht verkehrt, ein paar Bäume, ein paar Bänke, rechts erhob sich die Kirche St. Georg, weiter nördlich begann der Innenstadtbereich. Der Baustellenlärm aus der Severinstraße nervte zwar, dort wurde für die neue U-Bahn-Verbindung Nord-Süd die Erde aufgerissen. Aber nun ja, wo bitte schön gab es in Köln zurzeit keinen Baustellenlärm?
Zahlreiche Einkäufer waren unterwegs, zum Glück auch viele Touristen, denn die Einheimischen gaben keinen Cent. Trotzdem funktionierte es nicht, aus irgendeinem Grund blieb – außer den Kindern – kein Mensch stehen bei der reglosen Julius-Caesar-Statue, die komplett mit Toga, Schwert und Lorbeerkranz vor sich hinstarrte und nur gegen Kleingeld zum Leben erwachte.
Dazu kam, dass der graue Betonklotz hinter Piets Rücken ihn an sein ganz persönliches Scheitern erinnerte. Nun, »Scheitern« war vielleicht etwas übertrieben, immerhin hatte er sein Germanistikstudium nach 18 Semestern freiwillig abgebrochen. Weil er bis dahin allerdings weder seine Zwischenprüfung abgelegt noch ein einziges Hauptseminar erfolgreich beendet hatte, war die Exmatrikulation nur noch Formsache gewesen. Das war nun sieben Jahre her, seither arbeitete Piet im Media Markt in den Köln Arcaden auf der Deutzer Seite, Hi-Fi-Abteilung. Dienstags war sein freier Tag, den nutzte er, um als »Living Doll«, als Lebende Statue, ein kleines Extrageld zu verdienen. Das war eine verrückte Idee seiner Exfreundin Nora gewesen, er hatte sich breitschlagen lassen und mit der Zeit Spaß daran gefunden. Zuerst als Napoleon, das war ziemlich einfach, weil die Hand in der Knopfleiste bequem feststeckte und man nur hochmütig schauen musste. Aber Napoleon kam nicht gut an, also wechselte er zu Julius Caesar. Steinstatue, komplett in Weiß, weiße Kleider, weiße Riemensandalen und sogar ein weiß geschminktes Gesicht.
Caesar lief besser, meistens jedenfalls, an guten Tagen nahm Piet locker 100 Euro ein. Aber heute war kein guter Tag, der graue Kasten hinter ihm ließ ihn zusätzlich grübeln. Vielleicht hätte er doch den Hintern hochkriegen und sein Studium fertig machen sollen?
Das massige Bauwerk, 20 Meter hoch, 50 Meter breit, war das Historische Archiv der Stadt Köln. Piet brauchte sich nicht umzudrehen, er hatte die fensterlose, kachelähnliche Fassade sehr gut vor seinem geistigen Auge. Im ersten Semester war es Pflichtprogramm gewesen, an einem Rundgang durch die schier endlosen Gänge teilzunehmen, die mit mehr als 30 Kilometern Archivgut gefüllt waren. Auch später, im Grundstudium und während Piets zaghafter Hauptseminar-Versuche, hatte er immer wieder in dem Gebäude zu tun gehabt. Hier lagerten unzählige Bücher und Folianten, die bis ins Hochmittelalter zurückgingen, an die 70.000 Urkunden, mehr als 100.000 Karten sowie zeitgenössische literarische Nachlässe. Heinrich Böll zum Beispiel hatte all seine Schriften dem Archiv vermacht, ebenso Jacques Offenbach. Ein wahres Eldorado für Literaturwissenschaftler also, weshalb man von den Studenten erwartete, dass sie ihre Buchrecherchen nicht nur auf die Unibibliothek beschränkten, sondern den Weg hierher in die Severinstraße fanden. Piet bemühte sich, ein Seufzen zu unterdrücken, während er an die alten Zeiten dachte. Klar, die dunklen, drückenden Archivräume hatten etwas Deprimierendes gehabt, aber ein Studienabschluss, das wäre etwas gewesen. Besser als Hi-Fi-Beratung und caesarisches Stillstehen.
Apropos! Eben bückte sich eine junge Frau und ließ ein paar Münzen in das mit Samt ausgeschlagene Körbchen fallen. Ruckartig veränderte Piet seine Siegerpose, lockerte die Knie, streckte die Arme und verbeugte sich kaiserlich-huldvoll vor der Frau. Teufel, die kleinen Bewegungen taten gut! Doch schon nahm er wieder Aufstellung, eine andere Pose diesmal, leicht auf das Schwert gestützt, die Augen in die Ferne, und … freeze.
Die Kinder quiekten und stießen sich gegenseitig an, nur um noch genauer hinzuschauen. Na toll. Piet spielte mit dem Gedanken, es für heute sein zu lassen. Es war fast 14 Uhr, einen freien Platz in der Innenstadt konnte er vergessen. Die ersten halbwegs warmen Tage waren angebrochen, da überrannten die Straßenkünstler förmlich die City.
Während er noch haderte, fiel ihm auf, dass sich die Baustellengeräusche hinter ihm veränderten. Etwas tat sich, Autos hupten, Menschen riefen, dazu erklang ein stetiges Rauschen, das – Piet musste erst nach einem passenden Vergleich suchen – nach einem immer weiter anschwellenden Gebirgsbach klang. Dann kam ein neues Geräusch dazu, dumpf und unterschwellig, es schien aus der Erde selbst zu kommen und klang, als wäre etwas Uraltes dort unten zum Leben erwacht.
Nun war es endgültig um Julius Caesars Beherrschung geschehen. Er drehte sich um – und sperrte Augen und Mund auf. Die Kinder johlten, weil sie ihn endlich bei einer Bewegung ertappt hatten. Doch dann wurde eines nach dem anderen still und starrte wie gebannt in die Severinstraße.
Das Rauschen und das dumpfe Grollen kumulierten, darüber waren Panikschreie zu hören und das Quietschen von Bremsen. Das Gebäude des Stadtarchivs, der mächtige graue Klotz, neigte sich nach vorn, ein kleines Stück, noch ein Stück. Piet konnte nicht glauben, was er sah. Die Mauern bröckelten, die Nachbarhäuser wurden mitgezogen, ihre Fenster splitterten, Ziegel verrutschten und knallten weiter unten in den abgesperrten Bereich der Baustelle, dann kippte die gesamte Häuserfront. Unwillkürlich ging Piet einige Schritte zurück, um Abstand zu gewinnen von dem, was dort geschah. Wasser spritzte hoch, die Mauern zerbarsten, die Betonstücke schoben sich nach unten in die Baugrube hinein. Staub wallte, und plötzlich waren da Bücher, sie quollen aus jeder Lücke, aus jedem Riss, viele, Hunderte, Tausende, noch mehr, sie begleiteten das zerfallende Gebäude und verschwanden inmitten von Steinbrocken und aufgewühltem Erdreich.
Piet stolperte weiter nach hinten und konnte es immer noch nicht fassen. Erst als eine haushohe Staubwolke heranwehte und die Menschen rechts und links schreiend vorbeirannten, kam Leben in ihn. Er fuhr herum, warf das Schwert zur Seite und stürmte mit wehender Toga davon.
Hinter ihm kam das, was bis vor einer Minute das größte deutsche Kommunalarchiv gewesen war, langsam zur Ruhe, einzelne Steine bröckelten nach, Wasser und nasser Sand schwappten träge über die Straße.
Das Gedächtnis der Stadt Köln lag im brackigen Schlamm einer U-Bahn-Baustelle begraben.
Aushang am Schwarzen Brett des Instituts für Allgemeine Botanik, Universität Mainz
ERSTER TEIL
Freitag, 10. November 2017
Mit weißen Handschuhen blätterte Tinne behutsam durch die alten Blätter. Vor ihr lag ein ledergebundener Wälzer, »Von Kranckheyten des Leybes«, ein gewisser Dr. Johann zu Isslingen hatte darin im 15. Jahrhundert allerlei obskure Heilrezepte zusammengefasst. Links und rechts stapelten sich weitere Bücher und Loseblattsammlungen, meist Kopien und jüngere Abschriften, teilweise aber auch Originale wie der Foliant vor ihr. Ein Notebook war aufgeklappt, alte Stiche und kolorierte Pflanzenzeichnungen gruppierten sich auf dem Bildschirm. Die Tür zum Labor stand offen, hier arbeiteten gerade die anderen Mitglieder der AG Mittelaltermedizin.
Eigentlich war Tinnes Fachbereich, das Historische Seminar, drei Ecken weiter im Philosophicum untergebracht. Dort hatte die AG nach einer wissenschaftlichen Kraft gefragt, die sechs Monate lang in Teilzeit Übersetzungen und Literaturrecherchen übernehmen sollte. Tinne bekam das Projekt aufs Auge gedrückt, sodass sie nun mehrmals pro Woche im Pharmazeutischen Institut arbeitete, einem betongrauen Kasten mit schmalen Fensterreihen im Staudinger Weg. Anfangs ärgerte sie sich, dass sie den Schwarzen Peter bekommen hatte, doch mittlerweile fand sie das Projekt spannend.
Nur an den Geräuschpegel hatte sie sich bis heute nicht gewöhnt. Medizinische Laborarbeit war in ihrer Vorstellung bisher eine recht leise Sache gewesen. Ihre Arbeit im Pharmazeutischen Institut belehrte sie rasch eines Besseren, gerade jetzt war der Geräuschteppich wieder einmal mit der Probelautstärke von Steelram zu vergleichen: Die Sequenzierer brummten, ein piepender Dauerton kam aus einem der Messgeräte, die Zentrifuge jaulte, dazu plärrte auch noch ein Radio. Professor Sörensen und Magdalena standen neben dem Brutschrank, beugten sich über Petrischalen und diskutierten den Zustand der Kulturen. Linus hockte abseits und zerstampfte mit mechanischen Bewegungen grüne Blätter und Samen in einem Tiegel. Erik fehlte noch immer, keiner hatte etwas von ihm gehört oder wusste Näheres.
Tinne machte sich Notizen und warf einen Blick auf die Liste, die die Pharmazeuten für sie zusammengestellt hatten. Ihre wichtigste Aufgabe war es, die Pflanzenbezeichnungen in den alten Rezepturen eindeutig zuzuordnen. Das war gar nicht so einfach, denn im Laufe von Jahrhunderten hatte sich die deutsche Sprache verändert und mit ihr viele Namen, dazu kam, dass jede Region ihre eigenen Ausdrücke hatte. Inzwischen wusste Tinne: Wenn ein mittelalterlicher Heilkundiger im Badischen von einem »Burrle« geschrieben hatte, nutzte sein fränkischer Kollege »Borres« und der Bader in Mittelhessen »Bockler«. Sie hatte einige Ausdauer beim Recherchieren gebraucht, um herauszufinden, dass damit unser heutiges Binsenkraut gemeint war.
Darüber hinaus kämpften Professor Sörensen und sein Team mit der Vielzahl an Mengenangaben, die ebenso bunt gemischt waren wie die Pflanzenbezeichnungen. Tinne schlug sich mit »Meres« herum, mit »Loepfel«, »Quast«, »Handt« und »Becher«. Jede Bezeichnung musste abgeglichen werden mit Alter und Herkunft des Rezepts, damit die jeweilige Zutat im korrekten Mengenverhältnis genutzt werden konnte. Tinne mochte solche Aufgaben, es machte ihr Spaß, sich in eine Frage zu verbeißen und so lange nach Quellen zu suchen, bis sie die passende Antwort fand. Die Arbeit im Pharmazeutischen Institut war allerdings sehr mühsam, viele Spuren führten ins Nichts, entweder weil eine Bezeichnung schon lange aus der Überlieferung verschwunden war. Oder aber weil ein Quacksalber seinerzeit eine wohlklingende Pflanze einfach nur erfunden hatte, um davon abzulenken, dass sein »Medikament« aus Pferdemist und saurer Milch bestand.
»Entschuldigung, Ernestine, darf ich dich eine Sekunde stören?« Sie schrak hoch. Linus stand neben ihr. Er hatte eine altmodische Höflichkeit an sich, die wie aus der Zeit gefallen wirkte. Obwohl er körperlich nicht gerade ein Ausbund an Attraktivität war, mochte sie seine Umgangsformen. In Zeiten, in denen an Bushaltestellen jedes zweite Wort »ey« oder »Alter« war, kam ein höfliches Auftreten bei ihr gut an.
»Hast du etwas herauskriegen können wegen des Speltzkrauts? Ich hatte dir gestern einen Zettel geschrieben und auf deinen Platz gelegt.« Seine Augen blinzelten sekündlich. Dieser Tick ließ ihn hektisch wirken, selbst wenn er stillstand.