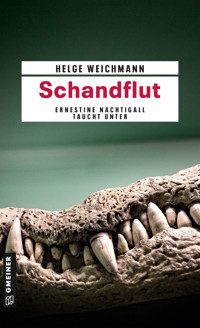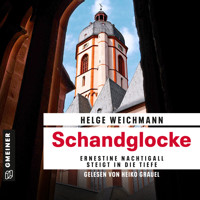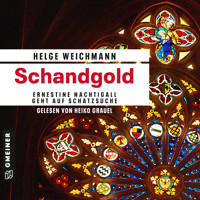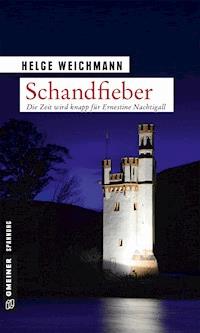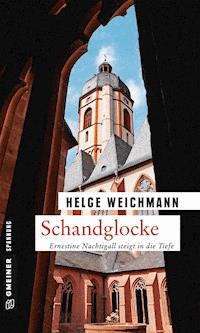Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historikerin Tinne Nachtigall
- Sprache: Deutsch
In Bodenheim bei Mainz wird ein uraltes Hexengrab gefunden. Durch ein Unwetter freigespült, zeichnen die Leichen einer verbrannten Frau und eines verstümmelten Kindes ein Bild des Grauens. Plötzlich versetzen nächtliche Bannzeichen, Opferrituale und ein grausamer Mord die Menschen in Angst und Schrecken. Ist der »Fluch der Hexe« neu erwacht? Einzig die Historikerin Tinne ahnt, dass die Knochen im Grab ein anderes, sehr viel schlimmeres Geheimnis hüten. Als sie endlich die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart findet, ist ihre eigene Hinrichtung eine längst beschlossene Sache …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helge Weichmann
Schandkreuz
Kriminalroman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2016
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Helge Weichmann
ISBN 978-3-8392-4974-1
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ebenso sind die genannten Firmen, Institutionen, Universitäten, Museen und Forschungseinrichtungen fiktiv oder, falls real existierend, in fiktivem Zusammenhang genutzt.
PROLOG
Bodenheim, 4. März 1613
Die Felder und Wingert lagen als Flickenteppich um das Dorf ausgebreitet, ein wütendes Heer aus Wolkenschatten jagte darüber. Immer neue Formen türmten sich auf, der strenge Ostwind riss sie im nächsten Moment schon wieder auseinander. Das Dämmerlicht und der Kirchturm, der sich als messerscharfe Silhouette in die Höhe hob, beflügelten Georgs Fantasie, er erkannte geballte Fäuste in der Wolkenwand, groteske Pferde, danach eine Teufelsfratze, aus der Hörner wucherten. Es kam ihm vor, als würde Gott, der Allmächtige, damit seinen Groll zeigen.
Georg Plumenschein war mit vier anderen Männern auf dem Weg zum Bodenheimer Friedhof. Der Wind zerrte gierig an ihren Kleidern, einzelne Schneeflocken wirbelten umher. Die schwarze Soutane von Pastor Cornelius flatterte und ließ ihn wie eine monströse Fledermaus aussehen. Georg fror. Er konnte seine Hände nicht in die Hosensäckel stecken, um sie zu wärmen, denn er trug einen sorgfältig behauenen Stein bei sich. Die frostige Märzluft ging ihm durch Mark und Bein, doch er wusste, dass die Kälte nicht nur von außen kam. Nein, sein Inneres war zu Eis erstarrt, seit er und seine Familie zum Ziel des Bösen geworden waren. Und heute wartete eine Aufgabe auf ihn, die so grässlich war, dass er kaum daran denken konnte. Jeder Schritt kostete ihn Überwindung, sogar seine Seele war schwer geworden in den letzten Wochen und Monaten.
Die anderen Männer stapften mit ebenso verbissenen Gesichtern gegen den Sturmwind an. Reinhart, der Bruder von Georgs Frau Judith, hatte einen ledernen Beutel umgeschnallt, Metall klapperte darin im Rhythmus seiner Schritte. Er war ein wahrer Riese, seine mächtige Gestalt schob sich ungebeugt voran. Was auch immer dort tief im Boden auf sie wartete – Reinhart würde nicht zögern, es zu packen. Viel zu sehr brannte der Hass in ihm auf das, was seiner Schwester angetan worden war.
Die beiden anderen waren Feldknechte, die der Pfarrer mitgebracht hatte, rohe Männer mit breiten Nasen und faulen Zähnen, die Spaten bei sich trugen. Pastor Cornelius hatte viele Worte und sogar eine Handvoll Pfennige gebraucht, um die Männer zum Mitkommen zu bewegen. Denn die Kunde von dem, was jede Nacht auf dem Friedhof geschah, hatte seine Runde durch Bodenheim gemacht wie ein böser Hauch. Seitdem schlossen sich abends Türen und Fenster, Kreuze wurden geschlagen, Gebete gemurmelt, kein Mensch wagte sich nach Einbruch der Dunkelheit aus dem Haus. Noch nicht einmal Georgs Brüder waren bereit gewesen, ihn auf seinem Weg zu begleiten und bei dem zu helfen, was getan werden musste.
Die Männer betraten den Friedhof. Die schiefen Grabtafeln wurden vom Wind umstrichen, die kahlen Äste der Bäume bogen sich, als würden Teufel in ihnen hausen. Über alledem thronte das schwarze Kirchengebäude. Georg hatte das Gefühl, 1000 verborgene Augen würden ihrem frevelhaften Tun zusehen. Wie um sich zu schützen, fuhren seine Finger die eingemeißelten Worte auf dem Stein nach, den er bei sich trug. Die Knechte schauten ihm scheu zu. Ein Geruch von ungewaschenen Kleidern und Branntwein wehte zu Georg herüber. Aha, die beiden hatten ihre Münzen wohl direkt in die erstbeste Schenke getragen und sich Mut angetrunken. Er konnte es ihnen nicht verdenken und hatte ebenso wie sie das Gefühl, nicht hierher zu gehören. Der Friedhof wollte sie nicht auf seinem Boden dulden, Georg glaubte zu spüren, wie eine unheimliche Macht ihn wegzudrängen versuchte. Dieselbe Macht, die das schreckliche Geheimnis unter der Erde nährte und am Leben hielt.
»Magnificat anima mea Dominum et exsultavit spiritus meus …«
Ohne dass es Georg bewusst wurde, flüsterte er die lateinischen Worte in einem zitternden Stakkato. Ihr Klang versprach die beruhigende Nähe zum Herrgott, obwohl sie für ihn nur leere Hüllen waren, auswendig gelernt durch jahrelange Wiederholung. Georg konnte kein Latein, natürlich nicht. Das war die Sprache der Pfaffen und der Mönche, das gemeine Volk, dem er angehörte, blieb davon ausgeschlossen.
Georg war Handwerker, Bäcker, ebenso wie sein Vater und vor ihm dessen Vater. Doch der Taglohn, der die Plumenscheinen Jahrzehnte über die Runden gebracht hatte, schrumpfte immer weiter. Seit die Sommer kühler geworden waren und auch regnerisch, blieben die Bodenheimer Scheunen leer, und das Vieh siechte auf den Weiden. Das, was die Menschen in das kleine Backhaus brachten, war Hadenkorn und Hirsebrei, so wässrig, dass Georg nur noch harte Fladen aus dem Ofen zog statt echtem Brot. Hohlwangig drückten ihm die Bauersfrauen einen halben Pfennig in die Hand als Backgeld, und der musste sogar für zwei Tage reichen. Und so darbten Georg und seine Familie, die Mauern des Backhauses bröckelten, die Feuchtigkeit kroch ungehemmt in die Wohnstube und ließ die Erwachsenen frösteln und die Kinder husten.
Vor einem Jahr hatten sich die Dinge dann zum Besseren gewendet. Georg wurde zum Kirchberg ins Hubgericht geholt, wo der Bodenheimer Richter Adam Ebersheim auf ihn wartete. Ebersheim war jemand, mit dem man ungern zu tun hatte, ein ernster Mann mit grauen Augen, der alleine auf dem Gerichtsanwesen lebte und nie zu lächeln schien. Georg wurde von der lähmenden Furcht befallen, dass ihn jemand angeklagt haben könnte. Denn Richter Adam war vom Probst des St. Alban-Stifts, Anton Waldbott von Bassenheim, als Amtmann eingesetzt worden und verwaltete in dessen Namen die weltliche Gerichtsbarkeit. Doch es stellte sich heraus, dass der Anlass ein erfreulicher war: Adam Ebersheim teilte ihm mit, dass er seine Familie und einige Anverwandte von Mainz nach Bodenheim an den Treyerhof holen würde, der dem Gericht angeschlossen war. Er beauftragte Georg, ab sofort zweimal pro Woche im Backhaus des Hofes Lohnarbeit zu verrichten. Nichts war Georg lieber, und seither feuerte er regelmäßig den Treyerschen Steinofen an, um aus dem guten Mehl des St.Alban-Stifts duftendes Brot für die Ebersheimer zu backen. Die Arbeit brachte ihm Regelgeld, einen stolzen Doppelschilling Taglohn, und damit war die ärgste Not vorbei. Die Familie Plumenschein gehörte nun nicht mehr zu den Ärmsten der Armen, und Georg wurde nicht müde, dem Herrgott dafür zu danken.
Er spürte eine Hand auf dem Rücken und schrak zusammen. Reinhart stand neben ihm, der Wind zerrte an seinem Vollbart und ließ die Haare flattern.
»Auf, Schwager, auf. Nicht verzagen. Auf.«
Inmitten seiner Gedanken war Georg stehen geblieben, ohne es zu bemerken. Die Übrigen schauten ihn an, ernste Gesichter, jeder trug schwer an dem, was vor ihnen lag.
»Es muss ein Ende haben. Denk an dein Weib, Gott sei ihr gnädig. Es ist schon genug Schlimmes passiert.« Reinhart gab ihm einen Stoß und schulterte seinen Beutel. Metall klapperte.
Oh ja, es war genug Schlimmes passiert. Georg packte den Stein fester. Wieder fuhr er die Buchstaben nach, die der Steinmetz Brendel unter den strengen Augen von Pastor Cornelius dort eingemeißelt hatte. Danach war der Stein vom Pfarrer gesegnet worden, mit Weihwasser und Chrisam hatte er drei Kreuze darauf gezeichnet und starke Gebetsworte gesprochen. Uralte Worte. Einen Bann.
Denn Georg und seine Familie waren von einem Übel befallen worden, gegen das normale Gebete nutzlos waren. Wo das Licht des Herrn schien, war Satans Schatten nicht weit, das wusste Georg. Und genauso war es gekommen: Kaum erfreuten sich die Plumenscheinen an dem Regelgeld, als sich auch schon andernorts ein schwarzes Herz mit Missgunst füllte. Das Böse suchte sich das leichteste Opfer der Sippe, die reinste Seele, und begann sein Werk der Zerstörung. Während die Tage und die Wochen dahin gingen, musste Georg zusehen, wie seine Familie immer stärker in den Bann dieser gottlosen Macht geriet. Und ausgerechnet diejenige Hand, die er um Hilfe anging, erwies sich als Hand des Satans. Er hätte es wissen müssen. Schon vorher hatten die Leute gemunkelt, schon vorher waren Sachen passiert, die einen Christenmenschen nicht ruhig schlafen ließen, doch er hatte es als Geschwätz abgetan, als das Geschnatter der Weiber. Ein Fehler. Ein todbringender Fehler.
Inzwischen hatten die Männer mehrere Grabreihen passiert und erreichten eine Fläche, die erst vor Kurzem zugeschüttet worden war. Der Wind hatte ein Leichentuch aus Schneeflocken darüber gelegt, Eiskristalle schabten über den rauen Boden und zischten die Männer in einer fremden bösen Sprache an. Georg sah aus den Augenwinkeln, dass Reinhart sich bekreuzigte. Unwillkürlich machte er die Bewegung mit und hoffte, dass der Allmächtige seine schützende Hand über ihnen ausgebreitet hielt.
In den letzten Monaten hatte Georg immer wieder um sein Vertrauen zu Gott kämpfen müssen. Wenn Judith ihn mit eiskalten Händen umfasste und er spürte, wie sich ihr schwacher Körper aufbäumte, wenn Franck, sein Sohn, von Krämpfen geschüttelt wurde und seine Augen wie schwarze Teiche im weißen Gesicht lagen, dann betete er mit aller Inbrunst, immer und immer wieder. Doch kein Rosenkranz, kein Ave Maria halfen, keine Nacht auf den Knien und keine Kerze in der Bodenheimer St.Albans-Kirche. Auch Pastor Cornelius wusste bald schon keinen Rat mehr. Also trat Georg in seiner Not an den Mann heran, auf dessen Hof er zweimal pro Woche arbeitete und der im Dorf viel bewegen konnte: Adam Ebersheim. Der greise Richter hörte Georg zu, und als er geendet hatte, passierte etwas Seltsames mit seinem Gesicht: Er lächelte, als habe Plumenschein ihm ein Geschenk gemacht.
Ebersheim nahm sich der Sache an, und er tat es mit der ihm eigenen Gründlichkeit. Bald schon wurde eine Anklage vorgetragen, bald schon stapfte der Büttel durch die Straßen, bald schon sorgte die scharfe Befragung dafür, dass die teuflischen Pläne kein Geheimnis mehr blieben, und dann, endlich, zogen die Bodenheimer Bürger an einem kalten Februarmorgen zum Richtplatz am Anger.
Damals, vor knapp vier Wochen, hob Georg sein Gesicht zum Himmel. Die grauenvollen Schreie waren in seinen Ohren ein Wohlklang, der Brandgeruch schien ihm der reinste Weihrauch. Das Böse fiel seiner gerechten Strafe anheim und wurde vom Angesicht der Erde getilgt. Von den Flammen verzehrt, von den Flammen gereinigt. Nun würde der Segen Gottes wieder auf der Familie Plumenschein liegen, da war er sich sicher.
Doch er täuschte sich, so schlimm, wie man sich nur täuschen konnte. Bald schon zeigte sich, dass der Tod nicht etwa das Ende war, sondern erst der Anfang.
Georg schüttelte seine Erinnerung ab und konzentrierte sich wieder auf das Hier und Jetzt. Das neu aufgeschüttete Grab vor ihm war eine Wunde, die man in die Erde gerissen hatte. Der Wind hielt einen Augenblick den Atem an und schien ebenso zu lauschen wie die Männer. Da hörten sie es, leise erst, dann immer deutlicher: Ein geisterhaftes Schmatzen kam aus dem Grab und ließ ihnen das Blut in den Adern stocken. Danach folgte schweres Atmen, das in ein wässriges Blubbern überging.
»Er zehrt sie«, murmelte Reinhart, »Herrgott, er zehrt sie.« Der große Mann trat unwillkürlich einen Schritt zurück und schlang die Arme um sich wie ein Kind, das sich vor Schlägen schützen will. Die Knechte standen leichenblass daneben, einer fing an zu schlottern, seine Zähne schlugen aufeinander. Georg konnte seine Augen nicht von der Graberde nehmen, die feucht und frisch und klebrig aussah. Sein Verstand weigerte sich, das Geschehen aufzunehmen, während das unheimliche Schmatzen und Atmen erneut anfing. Mahlende Kiefer. Mein Fleisch … mein Blut … Unaufhörlich drehten sich die Worte in seinem Kopf.
Pastor Cornelius holte ein silbernes Kruzifix hervor und hob es in die Höhe. Gleichzeitig gab er den Knechten einen Wink, die mit zitternden Gliedern zu den Schaufeln griffen.
»Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adiuramus te per Deum vivum …«
Der Wind riss den Exorzismus von den Lippen des Pfarrers, während die Spaten in den Boden fuhren. Georg spürte, wie nackte Angst nach ihm griff, Todesangst. Mein Fleisch … mein Blut …
Die Erde klatschte zur Seite. Mein Fleisch … mein Blut …
Reinhart schüttete den Inhalt seines Beutels aus. Schmiedeeiserne Nägel, Ketten und ein Hammer rasselten zu Boden. Mein Fleisch … mein Blut …
Georg griff den viereckigen Stein fester. Mein Fleisch … mein Blut …
»… per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum, qui sic dilexit mundum …«
Die Knechte waren auf dem Boden des Grabes angelangt, ihre Spaten stießen auf groben Leinenstoff. Bestialischer Gestank machte sich breit. Mein Fleisch … mein Blut …
Das Ding, das unter dem Tuch lag, bewegte sich und ließ Erde zur Seite rieseln. Das Schmatzen ertönte erneut, laut und obszön. Panisch warfen die beiden Männer ihre Schaufeln weg, kletterten aus der Grube und rannten schreiend davon. Mein Fleisch … mein Blut …
»… et a tyrannide diaboli emit pretio magno …«
Mit einem Ruck riss Reinhart den Stoff zur Seite und offenbarte, was in der feuchten Erde verborgen lag. Der Anblick war schlimmer als alles, was Georg bisher gesehen hatte, er wollte herumfahren, weglaufen bis ans Ende der Welt, ebenso, wie es die Knechte getan hatten. Doch er blieb wie angewurzelt stehen. Mein Fleisch. Mein Blut.
Pastor Cornelius gab einen würgenden Laut von sich, seine Fingerknöchel waren weiß, so fest hielt er das Kreuz umklammert. Seine Lippen bewegten sich, er murmelte einen Satz. Georg brauchte einen Augenblick, um zu merken, dass der Pastor diesmal nicht Latein gesprochen hatte. Das Gesicht des Gottesmannes sah im Zwielicht gespenstisch aus, seine Augen waren groß vor Entsetzen. Er wiederholte seine Worte, und nun endlich verstand Georg, was er sagte:
»Die Hölle quillt über. Die Toten kehren zurück.«
Auszug aus dem »Mainzer Anzeiger« (vormals »Täglicher Straßen-Anzeiger«)
Ausgabe vom 25. November 1857, Seite 3
Es war am Mittwoch den 18. November, 3 Minuten vor 3 Uhr am Nachmittage, wo Schreiber dieses sich anschickte, aus dem Otto’schen Kaffeehause in der großen Emeransgasse in den Stadttheil Kästrich zu gehen, als ein entsetzlicher Knall ertönte und gleichzeitig auch alle an dem Lokale befindlichen Fensterscheiben sammt Rahmen zerschellten und die meisten Anwesenden mehr oder minder verwundeten. Eine außerordentliche, wie von einem Orkan getriebene Staubwolke ließ sich nieder und bedeckte die Dächer. In dieser, von Angst und Schrecken gepeinigten Lage flüchteten Alle in’s Freie, aber auch hier war es nicht minder gefährlich, denn Schornsteine, Ziegeln, Fensterscheiben, ganze Thüren und losgelöste Stücke Holz waren noch im Herabstürzen und die Straßen vom Glase übersäet. Lautlos sah man sich gegenseitig an, das Schweigen wurde hin und wieder von dem verzagten Rufe: ‹Was ist geschehen?› unterbrochen, als man in der Richtung nach dem Kästrich die fürchterlich starke Rauchsäule, aus deren Mitte blutrothe Flammen hervorleuchteten, wahrnahm. ‹Der Pulverturm ist in die Lufft geflogen!› hieß es mit einemmale.
Der meist von ärmeren Leuten bewohnte Kästrich war eine einzig rauchende und brennende Ruine, unter deren riesigen Trümmerhaufen ganze Familien begraben lagen, und das herzzerreißende Geschrey der gräßlich Verwundeten und verstümmelten Eltern und Kinder drang aus ihnen heraus. Es waren unauslöschlich der Erinnerung sich eingehende Scenen voll Thodtesangst und Verzweiflung.
Unsere Mainzer Löschmannschaft unter Führung des um unser Städtisches Löschwesen wohlverdienten Caminfegers Herrn Carl Weiser war rasch bereit, Zeit und Erwerb zum Opfer zu bringen, um den bedrängeten Bürgern zu Hilfe zu eilen. Man mußte von dem Muthe, der Sicherheit, der Hingebung und Ausdauer, mit dem jeder einzelne Mainzer sein Geschäft besorgte und von der Disciplin, Ordnung und Stille, mit der unsere Spritzen blos nach den Signalen der Führer bedient wurden, Augenzeuge gewesen seyn um die Verdienste der wackeren Männer zu würdigen und zu erkennen, wie viel im Löschwesen in kurzer Zeit in Mainz geschehen ist. Mit wahrhaft bewundernswerter Schnelle standen die Spritzenmannen, 80 Köpfe starck, schon um 30 nach 3 Uhr vor dem Kästrich bereit. Und sofort wurden die Spritzen geschoben, im Laufschritte nach der Brandtstelle gebracht und das Werck in Angriff genommen.
Jedoch die Gefahr war noch nicht vorbei, denn kaum waren die ersten Hilfeleistungen im Gange, da kam ein neulicher Schreckensruf, daß noch eine größere Explosion nachfolgen werde, weil in den anstoßenden Minen beim Pulverturme noch eine Masse Pulver lagerte. Dank der eilenden Täthigkeit und Umsicht des österreichischen Militärs und preußischen Militärs, welche unaufhörlich Wasser in die Minen ließen, ging diese Gefahr vorüber und der übrige Theil der Stadt wurde von der Vernichtung bewahrt. Bald schon huben unsere Löschmannen an, all Brennbares aus den Kasernen und Stollen zu thragen, sogar noch vielerlei Correspondenzen und Chassepots des Departements. Es wurde bodens im Arsenal in Sicherheit verbracht, um dem schlimmen Feuer keinen Vorschub zu lassen, diese Thaten brachten nocheinmal ein Gutes.
Doch welch schlimmer Anblick bietet sich dem, der heuer durch zerschmettertes Scheibenglas und durch geborstenes Mauerwerck seinen Weg nimmt: Nach zuverlässigen Mittheilungen beträgt die Zahl der in Folge der Explosion eingetretenen Todesfälle 42, der ganz zerstörten Häuser 57, die der theilweise zerstörten, an denen meistens die Dächer zertrümmert sind, 64. Besonders hat auch der Dom seine herrliche Glasmalerey eingebüßt und die Evangelische Kirche und die Synagoge sind schwer nieder gegangen.
Noch 2 Tage und 3 Nächte loderten die Flammen auf dem Kästrich, und endlich hub ein Wehklagen an und ein Jammer: was Unglück hat unsere schöne Stadt getroffen, was Leid müssen wir dulden!
Partenheim, 8. Juni 1989
Winterabende im heißen Badewasser. Der erdige, pfefferminzige Geruch von Wick VapoRub war in der Erinnerung von Kriminaloberkommissar Seithkorn genau damit verbunden – warme Glieder, Schaumkronen auf dem Wasser, emsige Wellen, die am Rand des Zubers leckten.
Eine süße Sekunde lang erlaubte er sich, mit geschlossenen Augen an längst vergangene Rituale zu denken, an die gestärkte Schürze der Mutter, ihre resoluten Hände, die die Wassertemperatur prüften, an das geschäftige Poltern des Vaters, wenn er unten in der Werkstatt kaputte Möbel mit unendlicher Geduld für den Weiterverkauf herrichtete. Arm waren die Zeiten gewesen, damals in Koblenz, kalte Nachkriegsjahre, in denen der warme Badezuber ein seltener köstlicher Luxus war. Und natürlich gab es damals noch kein Wick VapoRub, aber die Kernseife und die Kräutersäckchen, die die nackte Bubenhaut beim Schrubben zum Glühen brachten, rochen genauso. Noch heute war Baden für Seithkorn etwas Besonderes, etwas Würdevolles, obwohl das Wasser inzwischen aus dem Hahn kam und die Wanne so groß war, dass er und seine vier Brüder damals gemeinsam hineingepasst hätten.
Der Kommissar packte seine Erinnerungen sorgfältig weg und öffnete die Augen einen Spalt. Er versuchte, den Raum vor sich mit Leben zu füllen. Der bequemste Sessel stand vor dem Fernsehgerät, das, groß und braun, den Mittelpunkt des Zimmers bildete. Wenige Bücher, keine Pflanzen. Die Wände kahl, kaum Bilder. Kein einziges Familienfoto, keine persönlichen Attribute, die dem Mann, der hier gewohnt hatte, einen Charakter gaben.
Vielleicht hätte der Geruch, der sich im Laufe vieler Jahre in einer Wohnung festsetzt, Seithkorn weitergeholfen. Der Kommissar war im Gegensatz zu vielen anderen Männern sensibel, wenn es um Gerüche ging. Doch die Schicht aus VapoRub, die unter seiner Nase verstrichen war, überdeckte alle natürlichen Gerüche. Gleichzeitig machte sie den Gestank nach verfaultem Fleisch erträglich, der die Räume des Hauses in Partenheim ausfüllte wie eine böse Wesenheit.
Er trat nach draußen ins Sonnenlicht. Vor dem letzten Haus der Vordergasse parkten drei Opel Rekord im weiß-grünen Polizeilack und ein Bulli der Kriminaltechnik. Sieben, acht Neugierige hatten sich versammelt, in den umstehenden Häusern wehten die Vorhänge und verrieten, dass dahinter wissbegierige Augen und schwatzhafte Münder lauerten. Der Briefträger, ein weinerlicher Mann mit dem Rückgrat eines Aals, hatte die Polizei informiert. Seit Wochen hatte er den Bewohner des Hauses nicht zu Gesicht bekommen, nichts Ungewöhnliches, Walter Gurock lebte zurückgezogen. Heute hatte er geklingelt und geklopft, weil er eine Unterschrift brauchte, erst vormittags, dann nachmittags. Keine Antwort. Schließlich war ihm aufgefallen, dass er von verdächtig vielen Fliegen umschwirrt wurde. Als er dann sah, dass die Fliegen aus dem Briefschlitz heraus nach draußen gekrochen kamen, hatte er bei den Nachbarn Sturm geklingelt und die 110 gewählt.
Seithkorn schaute sich um. Das Grundstück machte einen vernachlässigten Eindruck, die Beete waren verwildert, das Gras wucherte in die Höhe. Insekten summten um ihn herum, als wären sie erbost über sein Eindringen. Das Gebäude, ein altes einstöckiges Arbeiterhäuschen, sah nicht viel besser aus als der Garten, die Fenster starrten vor Schmutz, Dachziegeln fehlten, der Putz fiel von den Wänden. Ein krankes Haus, schoss es Seithkorn durch den Kopf, es hat Ausschlag und verliert Haare. Und es blutet. Einige Stellen des Mauerwerks waren so von Bodenfeuchtigkeit vollgesogen, dass sie tatsächlich wie Wunden aussahen.
Langsam ging er ins Wohnzimmer zurück. Die Kriminaltechniker hatten das Haus in Beschlag genommen, sie verteilten hier ein Pulver und tupften dort eine Winzigkeit auf. In ihren weißen Ganzkörperanzügen sahen sie aus wie Wesen von einem fremden Gestirn. Auch Seithkorn trug einen solchen Anzug, der ihn schwitzen ließ. Der Kommissar war ein Mann von beeindruckender Physis, Schuhgröße 47, seine Arme füllten die Hemdsärmel, Haare quollen aus der Nase, dem Kragen und dem Nacken. Trotzdem vermochte er, sich leise zu bewegen, ganz so, als habe sich ein kleinerer, zarterer Mann in dem ungeschlachten Äußeren versteckt. Seinen Augen entging kaum eine Kleinigkeit, seine Beobachtungsgabe war auf den Fluren der Mainzer Kripo legendär.
Eine weiße Gestalt stand reglos in der Mitte des Wohnzimmers und inhalierte die Umgebung. Sieh an, der ›Kaka‹ wagte eigene Schritte!
›Kaka‹ war die Mainzer Variante der Abkürzung KKA, Kriminalkommissaranwärter. Die Neulinge, frisch von der Polizeischule, durften oft nur Handlangerarbeiten verrichten – Protokolle tippen, endlose Asservatenlisten ausfüllen, Ordner sortieren. Doch der ›Kaka‹, den Seithkorn seit vier Monaten in seinem Team hatte, war gut, richtig gut. Der Junge dachte mit, hatte ein Gespür für Situationen und vertrat seine Meinung mit einer Vehemenz, die manchmal schon fast trotzig war. Und das mochte Seithkorn allemal lieber als Duckmäuser, die sich einschüchtern ließen und jedem nach dem Mund redeten.
»Und, was meinst du? Was ist los, was haben wir für einen Typen hier?«
Der junge Mann, knapp 20, rührte sich nicht. Die Konzentration war förmlich zu spüren, mit der er jedes Detail aufsaugte. Schließlich drehte er sich in Zeitlupe um.
»Was wir sehen, ist nicht spannend.« Seine Stimme war tief und ohne jeden Akzent, Seithkorn hörte ihm gern zu. »Viel spannender ist, was wir nicht sehen. Das, was nicht da ist. Persönliches, Erinnerungen, Wichtigkeiten und Nichtigkeiten.«
Unmerklich nickte Seithkorn. Genau das war sein eigener Eindruck. Mit einer Handbewegung gab er dem anderen weiter das Wort.
»Jeder, wirklich jeder trägt Puzzleteile aus seinem Leben mit sich. Ein Foto der Klassenfahrt. Der erste Urlaub mit Kumpels. Ein Bild am Strand oder auf dem Gipfel. Eine Postkarte von einem Freund oder der großen Liebe. Ein Rezept, das man gerne mag, ein Witzbildchen oder eine Anstecknadel. Und hier?« Der junge Mann drehte sich einmal um seine Achse. »Nichts. So neutral wie ein Hotel. Alles funktional, aber ohne jeden persönlichen Pinselstrich.«
Mit dem Finger strich Seithkorn sanft über das VapoRub unter seiner Nase, während er zuhörte. Er wollte wissen, wo er die Berührung zuerst spürte – am Finger oder an der Oberlippe. Es war die Oberlippe, ganz klar.
»Und was lernen wir über ihn?«
Der ›Kaka‹ lächelte ein dünnes Lächeln. »Er ist ein flüchtiger Besucher auf diesem Planeten gewesen. Mit Stelzen unterwegs, um keine Spuren zu hinterlassen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen: auf der Flucht. Auf der Flucht vor seiner eigenen Vergangenheit.«
Wieder nickte Seithkorn. Dieselben Gedanken waren ihm gekommen, als er das Haus mit offenen Augen durchschritten hatte. Er fand den Mann bemerkenswert, der nun in seinem eigenen Keller aufgebahrt war.
Die beiden traten in den Flur, dort wartete Dr. Winfried Hamm auf sie. Der Gerichtsmediziner trug einen wallenden Bart und wilde Haare, Seithkorn wusste, dass er seit Jahren die Rolle des Räubers Hotzenplotz beim Finther Kindergartenfest spielte und dafür wie gemacht schien. Im wirklichen Leben war er ein friedliebender Mensch und ein hervorragender Mediziner.
»Kommt mal mit, ich hab da ein paar Sachen entdeckt, die solltet ihr euch anschauen.«
Die Schmeißfliegen im Haus waren schwirrende Wegweiser, die sie unmissverständlich in den Keller leiteten. Dort stand eine Tür offen, die schiere Masse der Fliegen schien sich zu einer Wesenheit zu ballen.
»Alter um die 45.« Dr. Hamm drehte sich halb um, während er voranging. »Schlechter Allgemeinzustand. Die Verletzungen sind, soweit ich es sehen kann, prä mortem zugefügt worden.« Leise und wie zu sich selbst fügte er hinzu: »Beträchtliche Schmerzen, ganz sicher.«
Der Kellerraum war von Scheinwerfern beleuchtet. Seithkorn bemühte sich, durch den Mund zu atmen, das Wick VapoRub war chancenlos gegenüber dem intensiven Verwesungsgestank. Er hatte sich direkt nach dem Eintreffen kurz hier unten umgesehen, dann aber das Feld den Kriminaltechnikern überlassen.
»Wann ist es passiert?«
Dr. Hamm wiegte den Kopf. »Schwer zu sagen, da muss ich die Analysen abwarten. Ganz grob – vielleicht einen Monat. Maximal sechs Wochen.«
Sechs Wochen. Seithkorn warf einen Blick auf das, was einmal ein menschliches Gesicht gewesen war, und wurde wütend. Sechs Wochen, in denen niemand den Mann vermisst hatte. In denen die Nachbarn wahrscheinlich jeden Tag auf das Haus geglotzt und sich die Mäuler zerrissen hatten, aber keiner war auf die Idee gekommen, einmal nachzuschauen. Erst mussten dem Postboten die Schmeißfliegen aus dem Briefschlitz entgegen krabbeln, bis etwas geschah. Schöne, zivilisierte und ach so soziale Welt!
Er wurde ruhiger, als er sich den grotesk aufgedunsenen Leichnam anschaute. Der Körper lag auf einem Tisch wie auf einer Bahre, die Arme und Beine waren mit Stricken auseinandergezogen und festgezurrt. Die Verwesung hatte ihm alles Menschliche geraubt, selbst die Farben sahen falsch aus. Ihm war klar: Die Nachbarn hatten gar keine Chance gehabt, dem Mann zu helfen. Selbst wenn sie schon am nächsten oder am übernächsten Tag nach ihm gesehen hätten, wären sie zu spät gekommen. Zu diesem Zeitpunkt starrte Walter Gurock längst schon an die Zimmerdecke – aus leeren, blutigen Höhlen, in denen einmal seine Augen gewesen waren. Seithkorn zwang sich, in das zerstörte Gesicht zu sehen.
»Hast du rauskriegen können, was man mit ihm gemacht hat?«
»Die Augen sind ausgehebelt worden, ich würde sagen, mit einem Löffel oder einem ähnlichen Hilfsmittel. Die Zunge ist abgetrennt, ziemlich tief, nahe beim Zungenbein. Scharfes, halb gebogenes Werkzeug, eine Geflügelschere vielleicht. Und die Ohren fehlen. Der komplette Knorpel ist weg, mit einer geriffelten Klinge angeschnitten und abgerissen.« Dr. Hamm schaute auf. »Wie vorhin schon gesagt – alles vor Eintritt des Todes und bei vollem Bewusstsein.«
»Woran erkennst du das?«
»Die Wunden haben noch stark geblutet. Nach Eintritt des Todes wäre das nicht passiert, es gibt keinen Kreislauf und damit keine Blutzirkulation mehr. Und dann das hier.«
Er deutete auf den rechten Unterarm des Toten. Der Kommissar bemühte sich, konnte in dem zähflüssigen Gewebebrei aber nichts erkennen. Aus den Augenwinkeln sah er, dass es dem ›Kaka‹ genauso ging.
»Unter größten Schmerzen bringen die Muskeln eine dermaßen massive Gegenbewegung auf, dass dünne Knochen brechen können. Das ist hier bei der Ulna der Fall, bei der Elle.«
Seithkorn entdeckte den gesplitterten Knochen und merkte, dass ihm flau wurde. In den vielen Jahren bei der Kripo hatte er schon einiges gesehen. Aber ein Mann, den man so gefoltert hatte, dass er sich selbst die Knochen brach – das war eine neue Dimension der Brutalität. In Mexico City mitten im Drogenkrieg mochte man so etwas kennen. In Partenheim, einem 800-Seelen-Dorf in Rheinhessen, schien eine solche Tat geradezu absurd.
Dr. Hamm riss ihn aus seinen Gedanken.
»Ich will euch aber etwas anderes zeigen, deswegen habe ich euch geholt.«
Er schob den rechten Arm der Leiche zur Seite. Die Tischplatte bildete ein wirres Muster aus getrocknetem Sekret, Blut und Körpersäften, die halb skelettiert Hand kratzte mit einem Geräusch darüber, das Seithkorn einen Schauer über den Rücken jagte.
»Da, seht ihr’s?« Mit dem Kinn deutete er auf die Stelle, an der eben noch die Hand gelegen hatte. Die beiden Polizisten beugten sich nach vorne. Schwarze Krusten, Schlieren. Mit zusammengekniffenen Augen starrte Seithkorn auf die Tischplatte wie auf ein Vexierbild. Was sollte er denn … Da schnellte die Hand seines jungen Kollegen vor und deutete auf eine verwischte Struktur. Von einer Sekunde zur nächsten hob sich ein Muster aus dem Wirrwarr hervor.
»Was …«, Seithkorn blinzelte, »was ist denn das?«
Dr. Hamm zuckte die Schultern. »Keine Ahnung, hab ich noch nie gesehen. Ein Baum vielleicht, Wurzeln, so etwas. Aber was auch immer es ist – der Mann hat es beim Sterben mit seinem eigenen Blut gemalt. Ich gehe mal davon aus, dass es wichtig für ihn war. Und damit dürfte es auch für euch wichtig sein.«
Er wartete geduldig, bis die beiden Männer das Symbol aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet hatten. Dann trat er einen Schritt nach vorne, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
»Das wirklich Spannende kommt aber jetzt. Schaut mal her.«
Vorsichtig zog er das Hemd des Mannes auf. Die ehemals weißen Handschuhe des Gerichtsmediziners sahen aus wie die Aquarelle eines verrückten Malers, der mit Körpersäften und Blut statt mit Farbe gearbeitet hatte. Seithkorn hörte, wie der junge Polizist neben ihm scharf die Luft einzog, als das Hemd zur Seite rutschte. Der von Verwesungsgasen geblähte Bauch war übersät mit schwarzen Knoten, einige kaum sichtbar, einige daumendick. Das Gewebe dazwischen war offen, Krusten und klaffende Löcher waren zu sehen. Die Kraterlandschaft setzte sich zu den Beinen fort, bis sie von der Hose verdeckt wurde. Unwillkürlich musste der Kommissar an die Höllendarstellungen des Hieronymus Bosch denken.
»Malignes Melanom. Schwarzer Hautkrebs.« Dr. Hamm machte eine Bewegung, die den gesamten Körper des Toten einschloss. »Flächige Ausbreitung, Stadium vier von vier. Endstadium. Aller Wahrscheinlichkeit nach längst schon Metastasen in den Lymphknoten, in der Leber, in der Lunge und im Gehirn.«
Seine knappe Beschreibung hing wie ein biblischer Abgesang im Raum, wieder fühlte sich Seithkorn in ein Gemälde von Bosch hineinversetzt.
»Hat er …«, seine Worte gingen in einem Krächzen unter, er räusperte sich, um den Belag aus toter Luft und Grausamkeit von der Kehle zu bekommen, »hat er sich nicht, also, behandeln lassen oder so?«
Der Gerichtsmediziner fuhr sich durch seinen wilden Bart. »Ganz offensichtlich nicht. Beim malignen Melanom ist die erste und wichtigste Therapie das Herausschneiden des primären Tumors. Je früher, desto besser. Hier ist nichts passiert, der Krebs ist einfach weiter gewuchert. Ich würde sagen: Dieser Mann ist in den letzten Jahren bei keinem Arzt gewesen.«
Nach einer Sekunde des Schweigens ging der ›Kaka‹ in die Knie und brachte sein Gesicht ganz nah an den Leichnam heran, als könne er ihm dadurch seine Geheimnisse entlocken.
»Warum?«
Dr. Hamm ließ einen leisen Schnaufer hören. »Was weiß ich. Sturheit vielleicht. Ach je, der Doktor, was soll der schon machen? Oder Angst. Gerade Männer sind da ganz groß drin, vor lauter Schiss vor schlechten Nachrichten den Kopf in den Sand zu stecken.«
Seithkorn schwieg. Seine Intuition sagte ihm, dass dieser Mann einen ganz anderen Grund gehabt hatte, warum er nicht zum Arzt gegangen war. Er merkte, dass er schon wieder mit dem Finger an seinem VapoRub rieb. Vorsichtig malte er eine liegende 8 um seine Nasenlöcher. Die liegende 8, Zeichen der Unendlichkeit. Unendliche Qualen, die Gurock hatte erdulden müssen.
»Endstadium, sagst du. Wie lange hätte er noch gehabt?«
»Kann ich dir genauer sagen, wenn ich ihn obduziert habe. Aber wenn ich mal grob schätze: ein paar Monate. Kein halbes Jahr mehr.«
Die Blicke der beiden Polizisten trafen sich. Der junge Kollege war beileibe kein Ausbund an Schönheit, seine Züge waren lang, die Ohren auch, dazu kam ein Überbiss, der Seithkorn an einen Wiederkäuer erinnerte. Doch er sah in den wachen Augen von Kriminalkommissaranwärter Laurent Pelizaeus dieselbe Frage aufglimmen, die er sich selbst stellte: Warum folterte jemand einen Mann zu Tode, der in ein paar Monaten eh gestorben wäre?
ERSTER TEIL
Mittwoch, 8. Januar 2014
»Dürfmtragafilminsein?«
Tinne schloss die Augen, schüttelte leicht den Kopf und konzentrierte sich. Verflixt, der Wein stieg ihr ganz schön in die Birne, sie hatte kein Wort verstanden. Mit einem netten Lächeln beugte sie sich vor und versuchte, das Stimmengewirr in der Weinstube auszublenden.
»Noch mal bitte, Anna-Lena?«
»Dürfen im Vortrag auch Filme drin sein?«
Ah so. Mit einer winzigen Bewegung schob Tinne ihr Glas ›Määnzer Hotvollée‹ nach hinten, als könne der Abstand zum Weißen Burgunder ihren Schwips vertreiben. Wie peinlich, sich vor den Augen ihrer Studenten so gehen zu lassen!
»Also ja, im Prinzip schon. Wenn Sie passendes Material finden können, macht es auf jeden Fall Sinn, es zu sammeln und untermauernd einzupflegen.«
Mein Gott, was redete sie denn für einen Stuss? ›Untermauernd einzupflegen‹! Und hatte sie nicht gerade ein wenig gelallt? Die beiden gezeichneten Gesichter auf der ›Hotvollée‹-Flasche grinsten sie höhnisch an, die Stimmen der jungen Leute und das Prasseln des Winterregens an den Scheiben vermischten sich zu einem akustischen Einerlei.
Tinne saß mit zwölf Studenten im Weinhaus Michel in der Mainzer Altstadt, sie besprachen das Proseminar im Fach Neueste Geschichte, das Tinne im kommenden Semester halten würde: Verstädterung als gesamtgesellschaftliches Phänomen zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Beim gemeinsamen Vorbereitungstermin vor einigen Wochen hatte Tinne halb im Spaß die Idee ins Spiel gebracht, das nächste Treffen nicht im kahlen Philosophicum auf dem Uni-Campus, sondern in einer Weinstube stattfinden zu lassen. Zu ihrer Überraschung waren die Studenten sofort einverstanden gewesen und schlugen das Weinhaus Michel vor. Tinne mochte die urige Weinstube mit der im Rheinhessischen Dialekt verfassten Speisekarte gerne, und so kam es, dass Referatsthemen, Literaturlisten und Prüfungsanforderungen heute in der Mainzer Altstadt besprochen wurden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!