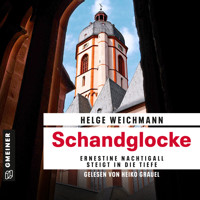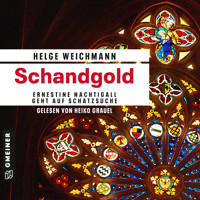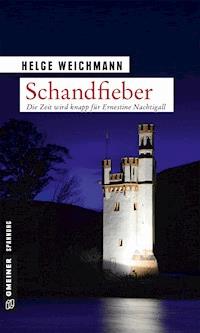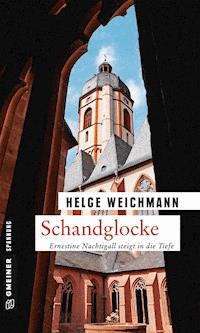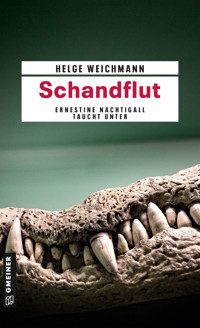
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historikerin Tinne Nachtigall
- Sprache: Deutsch
Mainz ächzt unter der Sommerhitze, der Rhein führt Niedrigwasser. Da wird ein Toter am Flussufer gefunden - zerfleischt von einem Krokodil. Die Historikerin Tinne war mit dem Mann unterwegs, doch ein Unfall hat ihre Erinnerung an die letzten sieben Tage ausgelöscht. Was ist in dieser Zeit geschehen? Gemeinsam mit dem Lokalreporter Elvis beginnt sie, ihre eigene Spur zurückzuverfolgen. Dabei stoßen sie auf ein dunkles Geheimnis, das in den Kanalschächten unter der Stadt verborgen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helge Weichmann
Schandflut
KRIMINALROMAN
Zum Buch
Reicht dein Atem? Nach einem Unfall wacht die Historikerin Tinne im Krankenhaus auf. Die letzten sieben Tage sind aus ihrem Gedächtnis gelöscht, und der Mann, mit dem sie in dieser Zeit unterwegs war, liegt tot im Rhein – von einem Krokodil zerfleischt. Mit der Unterstützung von Elvis, dem dicken Lokalreporter, versucht sie die vergangene Woche zu rekonstruieren. Im Zentrum ihrer Ermittlungen steht schon bald das Naturhistorische Museum, dessen Ausstellungsräume in einem mittelalterlichen Kirchenschiff untergebracht sind. Was hat es mit dem mysteriösen Kellerraum auf sich, der vor Jahrzehnten aus dem Grundriss getilgt wurde? Welches Geheimnis birgt die paläontologische Sammlung in Nierstein? Und warum bricht die Strom- und Wasserversorgung in der Rheinstraße immer wieder zusammen? Auf der Suche nach der Wahrheit steigen Tinne und Elvis in die Mainzer Kanalisationsschächte hinab, die in der Sommerhitze trockengefallen sind. Doch dort unten ist etwas verborgen, das besser unangetastet geblieben wäre …
Helge Weichmann wurde 1972 in der Pfalz geboren und ist seit 25 Jahren in Rheinhessen zu Hause. Während seines Studiums jobbte er als Musiker und Kameramann und bereiste zahlreiche Länder, bevor er sich als Filmemacher selbstständig machte. Seine Kreativität lebt er in vielen Bereichen aus: Er betreibt eine Medienagentur, arbeitet als Moderator, fotografiert, filmt, zeichnet und schreibt. Er ist begeisterter Hobbykoch, Weinliebhaber und Sammler von Vintage-Gitarren. Mit der chaotischen Historikerin Tinne Nachtigall und dem dicken Reporter Elvis hat Helge Weichmann zwei liebenswerte Figuren geschaffen, die ihre ungewöhnlichen Abenteuer mit viel Pfiff, Humor und Improvisationstalent meistern.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
SOKO Ente (2019)
Schandfieber (2018)
Schandglocke (2017)
Schwarze Sonne Roter Hahn (2017)
Schandkreuz (2016)
Schandgold (2014)
Schandgrab (2013)
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ebenso sind die genannten Firmen, Institutionen, Universitäten, Museen und Forschungseinrichtungen fiktiv oder, falls real existierend, in fiktivem Zusammenhang genutzt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Teresa Storkenmaier
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Chettaprin.P / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-6198-9
Widmung
Gewidmet Herrn ARNULF STAPF in ehrenvollem Andenken.
* 6.5.1935 † 16.6.2019
PROLOG
Königswinter, 14. Juni 1966
Die Kugeln schoben sich träge voran, Dutzende, Aberdutzende, es mussten Hunderte sein. Die orangefarbenen Bälle sahen fremd aus im trüben Rheinwasser, bunte Kleckse im graublauen Einerlei.
»Ich frag’ mich, wo die so viele von den Dingern hergekriegt haben.« Bodo Schmidtskath beobachtete die Masse an Kugeln durch den Kamerasucher. Die Optik vergrößerte den Bildausschnitt, alles schien zum Greifen nah. »Ich meine, 20 Orangen sind kein Problem, 50 auch nicht, aber die schmeißen ja Unmengen davon ins Wasser. Die müssen einen ganzen Laster davon besorgt haben.«
Rieke Vong, die eigentlich Ulricke mit ck hieß und ihren Namen hasste, hörte nur mit halbem Ohr zu. Ihre Aufmerksamkeit galt dem Nordmende Globetrotter, den sie in ihrer Armbeuge hielt und schwenkte, um den Empfang zu verbessern. WDR 2 sendete über UKW, das Signal war hier am Rand des Siebengebirges immer wieder unterbrochen. Rauschen und Kratzen übertönten die Stimme des Sprechers, der über die aktuellen Geschehnisse in Bonn berichtete.
Mit hochgerecktem Radio drehte Rieke sich um sich selbst, schließlich ging sie ein paar Meter und stieg die Uferböschung hinauf. Hier wurde der Empfang besser, aus dem Rauschen schälte sich eine blecherne Männerstimme.
»… haben wir noch keine neuen Informationen über den Verbleib. Auf der Terrasse des Bundeshauses stehen die Menschen dicht an dicht, auch an den Straßen parken Autos, man sieht Schaulustige, jung und alt, Familien mit Kindern, viele mit Ferngläsern, einige tragen Fotoapparate bei sich. Im Wasser treiben Orangen, immer neue Früchte werden vom Fluss herbeigespült. Die städtische Ordnungsbehörde hat mitgeteilt, dass es zumeist jugendliche Störenfriede sind, Halbstarke, die flussaufwärts diese Vielzahl an Orangenfrüchten ins Wasser werfen. Durch Kraftwagen und Handkarren sind sie schnell und mobil, sodass die Behörden ihrer nicht einfach habhaft werden können.«
»Weißte, was mir mein Papa erzählt hat?« Bodo nahm sein Auge nicht vom Sucher, während er mit Rieke redete. »Die haben gestern sogar ein Luftschiff gehabt, irgendwo gemietet oder so, und dann haben sie die Orangen von oben reingeschmissen ins Wasser. Stell dir das mal vor, was für ein Aufwand!«
Rieke winkte ab und lauschte der Stimme aus dem Radio. Das Rauschen wurde wieder stärker, sie bog die Antenne in eine andere Richtung. Erfolglos. Verärgert ging sie die Böschung herab.
»Mistempfang hier. Das ist eine blöde Stelle, eine ganz blöde. Woher sollen wir bitte schön wissen, was los ist, wenn wir nichts hören?«
»Da haben wir doch lang und breit darüber geredet.« Bodos Knochen knackten, als er seine unbequeme Lauerposition hinter der Kamera aufgab und sich streckte. »Hier haben wir die besten Chancen auf ein gutes Bild. Weiter unten sind zu viele Leute, und flussaufwärts kommen wir nicht nahe genug ans Wasser ran.«
Tatsächlich hatten sie gestern mit Bodos Mofa eine Stunde lang gesucht, bis sie diesen Platz entdeckt hatten. Ein schmaler Streifen Kies erlaubte es ihnen, direkt am Wasser zu stehen, Bäume schotteten sie von der Straße ab. Am gegenüberliegenden Ufer erhoben sich die Häuser von Mehlem, dem südlichsten Stadtteil von Bonn. Auf ihrer Seite des Rheins gab es nur Ufergrün und die Bundesstraße 42, die Siedlungsgrenze von Königswinter lag einige Hundert Meter flussabwärts. Hinter ihnen erhob sich der bewaldete Rücken des Drachenfelses, so nannten ihn die Leute. Kein anderer Mensch war zu sehen, sie hatten den Platz ganz für sich allein.
»Und hey, stell dir vor, wenn wir wirklich ein Foto kriegen. Dann haben wir endlich Bakschisch, wie wir wollten!«
›Bakschisch‹, das war ihr Ausdruck für Geld. Rieke hatte das Wort aus einem Buch, Bodo fand es witzig, und seither redeten sie von Bakschisch, wenn sie schauten, was sie am Wochenende unternehmen konnten und ob sie sich einen Abstecher ins Eiscafé gönnen durften.
Bodo war 17, Rieke 16. Seit einem knappen halben Jahr waren sie ein Paar, das durfte natürlich keiner erfahren, am wenigsten Riekes Eltern. Aber mit dem Bakschisch, das sie für eine gelungene Aufnahme bekommen würden, könnten sie sich ein Stück Freiheit kaufen, das wussten sie ganz genau. Einen gemeinsamen Urlaub vielleicht, eine Woche Italien oder so. Den Eltern würden sie eine Geschichte auftischen, und dann … Spaghetti und Rotwein in Rimini, nachts allein am Strand, das Meer rauscht … Auf Bodos Gesicht machte sich ein verzücktes Lächeln breit, während er sich seinen Tagträumen hingab.
»Hallo? Schaust du endlich mal?« Rieke holte ihn in die Wirklichkeit zurück und deutete mit hochgezogenen Brauen auf die Kamera. Er gab ihr einen schnellen Kuss und beugte sich wieder nach unten zum Sucher. Die Agfa Ambiflex gehörte seinem Vater, der das Fotografieren seit vielen Jahren als Hobby betrieb und eine teure Ausrüstung besaß. Bodo hatte ihm etwas von einem Schulprojekt vorgeflunkert, woraufhin sein Vater ihm tatsächlich die Kamera, das Stativ und das hochgeschätzte 240er Teleobjektiv lieh. Mit seinem letzten Bakschisch kaufte Bodo zwei Kodak Ektachrome, während Rieke ihrem großen Bruder den Nordmende Globetrotter abschwatzte. Dergestalt ausgerüstet brummten sie mit dem Mofa zu ihrem Beobachtungsposten und behielten den Rhein nun schon zwei Stunden scharf im Blick. Es war kurz vor zwölf mittags. Eigentlich hatten sie Schule, doch sie hatten gemeinsam entschieden, dass es heute Wichtigeres gab als Unterricht. Eine solche Gelegenheit kam so schnell nicht wieder!
»Diese blöden Orangen. Da wirst du ja verrückt beim Gucken«, murmelte Bodo. Die Früchte tanzten im Wasser, einige hatten sich in Strudeln verfangen und wirbelten durcheinander. Rieke strengte ihre Augen an. Sie suchte einen orangefarbenen Ball, der sich auf ungewöhnliche Art bewegte. Der vielleicht stillstand oder gegen den Strom schwamm. Doch nein, keine Chance, die bunten Punkte narrten ihre Augen. Sie musste es ihrem Freund und dem starken Teleobjektiv überlassen, nach der einen, ganz besonderen Kugel zu suchen. Mit gestrecktem Arm und hoch erhobenem Radio kletterte sie wieder die Böschung hinauf, um eine Stelle zu finden, an der die Reporterstimme gegen das Rauschen ankam. Das Nordmende pfiff und knisterte, Rieke kam sich doof vor, als sie sich drehte und den Apparat schwenkte. Wie in der Tanzschule, und die hatte sie noch nie gemocht.
Bodo behielt derweil den Fluss im Auge und drehte am Schärfering. Diese Umweltschützer und ihre Orangen! Na ja, andererseits – eigentlich machten diese Leute ja alles richtig. Zu viel war passiert in den letzten vier Wochen: die Stangen, die Tennisnetze, die Radioreportagen, die Fernsehnachrichten. Die Menschen am Ufer. Nein, irgendwann reichte es.
Aber hier und jetzt ging ihm die Orangenflut auf die Nerven. Schon wieder trug der Fluss eine neue Ladung heran, eine schwimmende Armee in farbiger Uniform. Bodo konzentrierte sich auf das, was er im Sucher sah. Da, bewegte sich einer der bunten Bälle nicht auf eine seltsame Art? Schnell tastete er nach dem Auslöser der Agfa, seine Hände wurden feucht. Nein, Fehlalarm, die Orange schwappte weiter flussabwärts wie ihre zahllosen Geschwister.
Er zerbiss einen Fluch zwischen den Lippen. Das Medieninteresse war riesig, jeder Sender in Deutschland brachte Berichte, es gab sogar Anfragen aus dem Ausland. Doch gute Fotos waren Mangelware und wurden teuer gehandelt. Sehr teuer. Bisher gab es nur Schnappschüsse in Schwarz-Weiß, oft verwackelt oder überbelichtet. Er wusste, dass er mit der Ausrüstung seines Vaters besser ausgestattet war als mancher Berufsfotograf. Eine gelungene Bilderserie in Farbe – damit könnte er bei jeder großen Zeitschrift anklopfen und seinen Preis nennen. Dann wäre endlich Bakschisch da, um mit Rieke die Zukunft planen zu können.
Mitten in seine Gedanken platzte die Stimme seiner Freundin. Rieke stand oben auf der Böschung und hatte eine Stelle gefunden, an der der Empfang gut war.
»Eben kommt ’ne aktuelle Meldung rein!«, rief sie aufgeregt. »Und zwar, warte …«, ihre Ohren klebten förmlich an dem Radio, »… es ist, eh, sie sagen …« Wieder hörte sie zu, während Bodo die Kamera wie ein Maschinengewehr schwenkte, als wollte er den Fluss in seiner ganzen Länge ablichten. Ein paar Sekunden tönte nur die krächzende Stimme aus dem Lautsprecher, dann ließ Rieke das Gerät langsam sinken. »Am Alten Zoll.« Ihre Stimme klang enttäuscht. »Gerade eben, es ist eine Direktübertragung.«
Bodo spürte, wie die Anspannung aus seinem Körper wich und sich Ernüchterung breitmachte. Der Alte Zoll lag fast zehn Kilometer flussabwärts mitten im Bonner Stadtgebiet. Zu weit weg. Viel zu weit. Dazu kam, dass dort jede Menge Trubel herrschte, Menschen, Reporter, Fotografen. Nun würde jemand anders die Bilderserie schießen. Sie hatten sich den falschen Platz ausgesucht.
Wortlos trottete Rieke heran, ihrem Gesicht sah Bodo an, dass sie genauso niedergeschlagen war wie er. Aus der Traum vom Bakschisch.
»He, pack mal an.« Bodo hob das schwere Metallstativ in die Höhe. Wenn sie sich beeilten, schafften sie vielleicht noch die letzte Stunde in der Schule und konnten sich eine Ausrede für ihr Fehlen einfallen lassen.
Mitten in der Bewegung stockte er, als Riekes Hand ihn packte. Der Blick seiner Freundin richtete sich starr auf den Fluss hinter ihm. »Da …«, mehr brachte sie nicht heraus. Er fuhr herum und bekam große Augen. Was war das denn?
Hektisch knallte er das Stativ auf den Boden und drehte die Kamera herum. Der Fokusring, schnell! Kaum hatte er das Bild scharfgestellt, da schnappte er auch schon nach Atem. Das konnte doch nicht sein! Klick, ratsch, klick, ratsch, er schoss Bild um Bild, sein Daumen konnte den Film kaum schnell genug weiterspulen. Klick, klick, noch mal.
Riekes Blick hing wie gebannt auf der Wasseroberfläche. Am Alten Zoll, hatte es geheißen. Weit weg von hier.
Sie drehte den Kopf und schaute ihrem Freund zu, der ein Foto nach dem anderen schoss. Das, was hier vor ihren Augen geschah, konnte nur eins bedeuten: Ihnen war soeben eine echte Sensation vor die Linse geraten.
ERSTER TEIL
Samstag, 8. September 2018
Irgendwo glomm ein Licht. Es witschte hin und her und ließ sich nicht packen, vielleicht stand das Licht aber auch still, und es waren Tinnes Augen, die zuckten. Sie konnte es nicht sagen, und es erschien auch nicht wichtig. Unterwassergefühl, so nannte sie diese Situation. Kam immer wieder, das Unterwassergefühl. Druck auf den Ohren, murmelnde Stimmen, komische Lichter. So, als würde sie sich der Oberfläche nähern. All das ließ nach einer Weile nach, dann sank sie wieder tiefer, dorthin, wo alles schwarz und ruhig war.
Jetzt ließ das Unterwassergefühl aber nicht nach. Es blieb, das Licht, das Murmeln, es wurde heller, immer heller. Tinne wollte zuerst nicht, nein, wieder zurück ins Dunkel, aber dann ergriff sie Neugier. Was waren das für Lichter und Stimmen?
Sie fuhr Fahrstuhl nach oben, höher und höher. Der Druck ließ nach, die Stimmen kamen näher, ein Strahl, aber nicht wie das Leuchten davor, grell, es schnitt ihr in die Pupillen. Mit einem Brummen drehte sie den Kopf, und plötzlich befand sie sich im Hier und Jetzt.
»Das blendet!«, murmelte sie vorwurfsvoll und gab dem Arzt einen Schubs, der ihr mit einer kleinen Lampe in die Augen leuchtete.
»Oh, ’tschuldigung.« Der Arzt trat reflexartig zurück, anscheinend war er ebenso verdattert wie Tinne. Sie blinzelte und versuchte, ihre Umgebung einzuordnen. Ein Raum, weiße Decke, Neonröhren, ein geschmackloses Bild, ein trapezförmiger Griff an einer Stange über ihr. Hinter dem Arzt stand eine Schwester mit Solariumhaut. Ein Krankenhauszimmer.
»Was … was?« Es wurde kein vollständiger Satz daraus, weil ihr Hirn sie mit Versatzstücken überflutete, die zusammenhanglos umhertrieben.
Der Arzt machte einen Schritt auf sie zu, da schob sich eine andere Gestalt dazwischen. Direkt vor Tinne tauchte ein Gesicht auf, das sie gut kannte und das für sie in dieser Sekunde der schönste Anblick der Welt war. Laurent.
»Tinne! Tinne, du bist wieder wach! Gott sei Dank, wir … wir haben uns ja solche Sorgen gemacht, du … du bist, also … es …« Der Redeschwall endete, als sich der Arzt behutsam in den Vordergrund drängte.
Ein Gefühl der Erleichterung machte sich in Tinne breit. Was auch immer passiert sein mochte und wo auch immer sie sich befand – Laurent war hier, damit erschien ihr alles nur noch halb so schlimm. Der Arzt richtete das Wort an sie und zückte erneut seine Lampe, da ließ sich Tinne auch schon vom Gefühl der Entspannung davontreiben. Der Raum wurde dunkel, das Unterwassergefühl kam zurück.
Tinne saß auf dem Bett, das Kissen im Rücken. Sie trug ihr Nachthemd mit der Henne Ginger aus ›Chicken Run‹als Motiv und ärgerte sich. Ihre Ausflüge in die Wirklichkeit hatten sich aneinandergereiht wie Luftblasen, jedes Mal war sie konzentrierter und aufnahmefähiger gewesen, inzwischen konnte sie sich einigermaßen orientieren. Auch körperlich fühlte sie sich wieder auf der Höhe, abgesehen von aufgeschürften Oberarmen und einem schillernden Hämatom an der Stirn. Keine weltbewegenden Blessuren. Sie lag in der Mainzer Universitätsmedizin, in der Poliklinik, so viel wusste sie immerhin, viel mehr allerdings nicht. Es waren immer wieder Ärzte bei ihr gewesen und hatten banale Fragen gestellt, wie sie heiße, wo sie wohne, welcher Tag heute sei und Ähnliches. Doch keiner wollte ihr sagen, was los war.
»Können Sie jetzt bitte mal einen halben Satz darüber verlieren, was ich hier mache?« Es tat ihr leid, dass der Assistenzarzt ihren Ärger abbekam, der gerade ihren Blutdruck maß und allerlei Reflexe testete.
»Tut mir leid, Frau Nachtigall, ich, eh, also, gleich kommen der Professor und der Chef der Neurologie, und dann, ja, dann wird sich alles klären.«
»Ein Neurologe?! Wozu brauche ich einen Neurologen?«
Er antwortete nicht und schaute dermaßen konzentriert auf sein Klemmbrett, dass Tinne den Mund zuklappte. Die Erwähnung des Neurologen verursachte ein mulmiges Gefühl. Was machte ein Neurologe genau? Irgendwelche Nervensachen wohl. Was hatte sie damit zu schaffen?
Wenig später öffnete sich die Tür, eine Phalanx an Ärzten kam herein, umschwärmt von Assistenten und Studenten. Die beiden zentralen Gestalten, zwei Männer mit weißen Kitteln, grau melierten Haaren und fast identischen Brillen, waren von gegensätzlicher Statur: einer klein und dick, der andere groß und dünn. Eine Aura von Wichtigkeit, die an Arroganz grenzte, umwehte sie, als sie sich mit Namen und professoralem Titelschmuck vorstellten. Tinne hatte die Namen eine Sekunde später schon wieder vergessen und taufte die beiden heimlich Dick und Doof.
»Hören Sie, ich würde unheimlich gerne erfahren, warum ich hier bin«, legte sie los und schämte sich für ihr ›Chicken Run‹-Nachthemd, das ihr ein großes Stück Ernsthaftigkeit nahm und das sie nie und nimmer als Krankenhauskleidung eingepackt hatte. Aber wenn sie es nicht getan hatte – wer dann? »Habe ich eine Bombe abbekommen, bin ich überfallen worden? Haben Marsmenschen mich entführt und Versuche mit mir gemacht?«
»Frau Nachtigall.« Einer der Professoren, Doof, überhörte ihren Fragenkatalog und neigte sich gönnerhaft nach unten. Die Assistentenschar machte sich bereit, Kugelschreiber klickten. »Sie wissen, wie lange Sie hier in der Klinik sind, nicht wahr?«
»Ja, seit heute Nacht. Wenigstens das hat man mir verraten.«
»Und Sie haben keine Erinnerung daran, was Ihnen zugestoßen ist?«
Seine leise, verständnisvolle Stimme klang nach Klischee-Psychiater in einer Vorabendsoap. Tinne wurde lauter, nicht nur aus Ärger, sondern auch, um ihre Angst zu übertönen.
»N-E-I-N, zum hundertsten Mal! Das habe ich Ihren Kollegen schon oft genug gesagt!«
Dick mischte sich ein, seiner Stimme hörte man an, dass sie normalerweise Kasernenhofstärke hatte und nun mühsam gedrosselt wurde.
»Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern?«
Tinne hatte ihr Gedächtnis selbst schon danach durchforstet, die Antwort lag in aller Ausführlichkeit parat.
»Ich bin gestern Mittag zu Hause gewesen und hab für die Uni gearbeitet. Meine beiden Mitbewohner sind auch da gewesen, Axl und Bertie. Dann hat das Telefon geklingelt, also mein Handy. Der Anruf kam von Jason, einem Kumpel von Axl. Wir haben ein paar Takte gequatscht. So, das war’s, mehr weiß ich nicht.«
Ihr kam eine Idee. Moment mal, sie hatte doch eine ordentliche Beule am Kopf.
»Bin ich … bin ich die Treppe runtergefallen? Von unserer Wohnung oben zum Eingang unten?«
Dick und Doof schauten sich wissend an. Stille, bis auf die Stifte der Assistenten, die eifrig auf Papier kratzten. Tinne hatte genug, Wut und Angst quollen über wie ein Vulkan. Sie stand auf, hielt sich einen Moment am Bett fest und versuchte, trotz Hennen-Shirt einen halbwegs seriösen Eindruck zu machen.
»Gut, danke, das reicht. Wenn hier keiner gewillt ist, mir zu sagen, was los ist, dann gehe ich jetzt heim.« Sie machte Anstalten, ihre Sachen zu packen.
»Frau Nachtigall, welches Datum haben wir heute?« Doofs Psychiaterstimme ließ sich in keiner Weise von Tinnes Aktivitäten beeindrucken. Sie räumte weiter und sprach in ihre Tasche, damit niemand die Tränen in ihren Augen sah.
»Samstag, den 1. September. Habe ich Ihren Kollegen aber auch schon gesagt. Ungefähr ein Dutzend Mal.«
Sie hoffte, dass man das Zittern in ihrer Stimme nicht hören konnte. Dick und Doof flüsterten Kommentare zu ihren Assistenten, Tinne kam sich vor wie ein Studienobjekt. Was in aller Welt ging hier nur vor, was war mit ihr geschehen? Die Professorenschaft hatte sich bestimmt nicht versammelt, um ihr Händchen zu halten.
Die Tür öffnete sich, karottenrote Haare erschienen. Bertie! Tinne musste sich beherrschen, um nicht hinzurennen und sich hinter ihrem Mitbewohner zu verstecken. Bertie ließ die Schar Weißkittel links liegen, kam herein und steuerte direkt auf Tinne zu.
»Mensch, du bist wach! Wie geht’s dir, wie fühlst du dich, tut dir was weh, wir haben uns irre Sorgen gemacht!«
»Bertie!« Jetzt liefen die Tränen. »Was ist denn los, hier sagt mir keiner was! Ist … ist was mit mir, hab ich … irgendwie einen Tumor oder so was?«
Er nahm sie in den Arm und drückte sie fest. Obwohl Bertie ihr nur knapp bis zur Schulter reichte, fühlte es sich unglaublich tröstlich an. Die Kasernenhofstimme von Dick kam von hinten:
»Sie da, raus hier. Das ist ein Arztgespräch, Sie haben hier nichts zu suchen!«
Er hätte genauso gut gegen eine Wand reden können. Bertie hielt Tinne fest und wiegte sie hin und her. »Ach Quatsch, du hast einen Unfall gehabt heute Nacht. Ein Auto hat dich erwischt, du bist ordentlich auf die Birne geknallt, das ist alles. Keine Knochen kaputt, nichts gerissen.«
Die Erleichterung schwappte über Tinne wie eine Welle, sie fühlte sich mit einem Mal federleicht, die Tränen strömten. Ein Unfall, sie hatte sich den Kopf angeballert. Na gut, die Beule würde sie verkraften. Ihre Gedanken wirbelten durcheinander, sie wollte raus hier, zurück in ihr Leben, dort weitermachen, wo sie herausgerissen worden war.
»Ich … ich muss an der Uni anrufen«, schluchzte sie. »Heute Vormittag hätte ich eine Stadtexkursion leiten sollen, und ich hab nicht Bescheid gegeben, dass ich ausfalle. Da muss ich mich schleunigst drum kümmern.«
Bertie blieb merkwürdig still und streichelte ihr nur unbeholfen den Rücken. Tinne spürte förmlich, wie die Ärzte sie mit Blicken durchbohrten. Sie machte sich los.
»Stimmt etwas nicht, Bertie?«
Doofs Psychologenstimme hatte deutlich an Schärfe gewonnen.
»Sie verschwinden sofort, oder ich rufe den Wachdienst und lasse Sie rausschmeißen. Dann haben Sie gleich auch noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch am Bein.«
Er trat einen drohenden Schritt auf Bertie zu, dieser ignorierte ihn jedoch nach wie vor.
»Hör zu, Tinne«, begann er zögerlich, »da ist tatsächlich noch was. Laurent hat mit den Ärzten geredet, und sie sagen, du hättest gestern mit Jason telefoniert, bei uns in der Kommune, stimmt doch, oder?«
Sie nickte stumm, unfähig, ein Wort herauszubringen.
»Das, hm, das ist aber nicht …«
»Sie sagen kein Wort mehr!« Doof keifte regelrecht. »Sie gefährden den Heilungsprozess, wenn Sie jetzt ohne Vorbereitung …«
»Ach, halt doch einfach mal den Rand, du Vollhorst«, schnauzte Bertie ihn an. Doofs Mund blieb offen stehen, er war wohl schon lange nicht mehr mit einer solch direkten Art konfrontiert worden. Die Assistenten schauten dem Schlagabtausch zu wie einem Tennisspiel.
Bertie packte Tinne bei den Schultern, obwohl er dazu die Arme ein Stück nach oben strecken musste.
»Das mit dem Telefonat und so, das ist nicht gestern gewesen, Tinne. Das war vor einer Woche.«
Eine lautlose Bombe detonierte in Tinnes Hirn. Eine Woche. Unmöglich. Sieben Tage. Nein.
»Ich … ich bin seit einer Woche hier?«, hauchte sie und merkte, wie ihr Kreislauf schlappmachte. Zum Glück stand das Bett direkt hinter ihr, sie ließ sich darauffallen.
»Nein, der Unfall ist tatsächlich erst heute Nacht passiert. Aber so, wie es aussieht, hast du dabei dein Gedächtnis verloren. Wir haben heute den 8. September, nicht den 1.«
Tinnes Verstand brauchte ein paar Sekunden, um Berties Worte zu erfassen. Ihr fehlte eine komplette Woche ihres Lebens.
*
Die Waffe schwenkte leicht zur Seite, von ruhiger Hand gehalten, kein Zittern war zu spüren. Der Kopf einer jungen Frau erschien im Fadenkreuz. Sie stand bis zur Hüfte im Rhein und planschte mit den Armen, um sich an das kühle Wasser zu gewöhnen. Ihre Aufmerksamkeit galt dem unebenen Flussboden, sie tänzelte auf dem Kies und achtete nicht auf das, was hinter ihr geschah.
Die Stelle lag einsam, ein Stück flussabwärts der Schiersteiner Brücke. Kräne und Gerüste in luftiger Höhe zeigten, dass der Umbau der Brücke voranging, doch heute, am Samstag, ruhten die Arbeiten. Bäume schotteten den Uferbereich von den Mombacher Schrebergärten ab, keine anderen Menschen waren zu sehen. In der Flussmitte tuckerte ein Rheinschiff, zu weit entfernt, um Einzelheiten erkennen zu können.
Die Hand korrigierte die Position der Waffe um eine Winzigkeit, die Zielmarkierung erfasste den Hinterkopf der Frau. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, riss die Hand den Abzug durch. Ein scharfer Wasserstrahl schoss aus dem Super Soaker, klatschte an das blonde Haar und wanderte weiter über den nackten Rücken.
Die junge Frau, Svenja, quiekte und versuchte, den Strahl mit den Händen abzuwehren. »Iiiih, du Arschkeks, mach weg! Hör auuuuuf!« Sie wand sich zwischen Schimpfen und Lachen. Karlo, ihr Freund, hielt weiter drauf und pumpte den Druckbehälter des Soakers auf. Das Ding konnte was, zwölf Euro beim Philipps Sonderposten, schoss meterweit mit richtig viel Druck. Svenja ging ihrerseits zum Angriff über, bückte sich und schaufelte Fontänen in Karlos Richtung. Er fackelte nicht lange, packte seine Freundin und zog sie mit in den Fluss. Nach ein paar kalten Sekunden fühlte sich das Wasser herrlich an.
»Hammeridee!«, prustete Svenja und tauchte ihren Kopf unter, um ihn zu kühlen. Die beiden hatten sich spontan entschlossen, die Renovierung der Schrebergartenlaube zu unterbrechen und eine Badepause zu machen. Die Hütte gehörte Karlos Eltern, diese nutzten sie kaum und hatten den jungen Leuten erlaubt, sie nach eigenem Geschmack umzugestalten. Momentan staute sich die Hitze in der hölzernen Laube, der Geruch nach Farbe wurde dadurch potenziert und stach unerträglich in die Nase. Eine Schwimmrunde war genau das Richtige, um den Kopf frei zu bekommen. Wobei – von »Schwimmen« konnte nicht wirklich die Rede sein, dazu führte der Rhein im Moment zu wenig Wasser. Die Uferbereiche lagen im Trockenen, der helle Flussboden zog sich Dutzende Meter dahin, bis endlich das Wasser anfing. Ähnlich flach ging es weiter, Karlo und Svenja hätten hineinwaten müssen bis zum Freiwasser. Eine gefährliche Angelegenheit, denn durch das geschrumpfte Flussbett war die Strömung stärker als sonst, dazu kamen die Schiffe, die sich durch die enge Rinne quälten. Also begnügten sich die beiden mit dem hüfttiefen Wasser.
»Tut supergut, oder? Sollten wir öfter machen.« Karlo wurde schon wieder frech und versuchte, Svenja unterzutauchen. Geschickt wich sie aus und spritzte ihm eine Ladung Wasser ins Gesicht.
»Ja, definitiv. Schöner als Wände pinseln.« Sie streckte sich aus, um so viel Abkühlung wie möglich zu bekommen. Die hochsommerlichen Temperaturen waren heftig, seit Wochen ächzte Deutschland unter einer Hitzewelle, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hatte. Der Sommer 2018 schickte sich an, sämtliche Rekorde zu brechen.
Karlo pumpte seinen Super Soaker auf und legte an. Svenja paddelte mit den Armen, um stromaufwärts zu entkommen. Als der Strahl auf sie prasselte, tauchte sie unter und strampelte halb schwimmend, halb laufend voran. Dabei stieß sie gegen etwas, das im Wasser schwamm. Erschrocken riss sie den Kopf hoch, bekam Wasser in den Hals und musste husten. Einen Wimpernschlag später zuckte sie voller Panik zurück und schrie gellend. Karlo ließ den Soaker fallen. Im Nu sprang er zu seiner Freundin und fing sie auf, als sie nach hinten stürzte.
»Was …«, fing er an, dann sprang er ebenfalls zurück. »Scheißescheiße«, presste er hervor und zog Svenja mit sich. Instinktiv suchte er Abstand von dem, was da im Wasser lag.
Vor ihnen trieb der Körper eines Menschen. Die Wellen spielten mit seiner Kleidung und ließen sie auf und nieder schwappen, der Kopf war weit nach hinten überstreckt. Rote Schlieren zogen sich um die Leiche wie ein feiner Schleier. Gespeist wurden sie aus Löchern und herausgerissenen Fleischteilen. Der Oberkörper und das verzerrte Gesicht waren regelrecht perforiert, sie sahen aus, als hätte ein Wahnsinniger mit einem Schraubendreher darauf eingestochen, immer und immer wieder.
Svenja ballte die Fäuste vor dem Mund und schrie in hohen, schrillen Tönen. Sie wollte nicht hinsehen und konnte gleichzeitig den Blick nicht abwenden von dem Toten mit den zerfetzten Gesichtszügen, der in einer blutigen Wolke im Flusswasser schwebte.
Sonntag, 9. September 2018
Tinne hatte das siebte Taschentuch vollgeheult. Sie lehnte schlaff an Laurents Schulter und blinzelte die Tränen aus den Augen. Am Küchentisch gegenüber saßen Bertie, Axl und Elvis mit besorgten Gesichtern.
»Und … und es ist irgendwie ganz komisch. Als würde etwas fehlen. Ich …«, Tinne suchte nach Worten. »Ich weiß ja noch nicht mal, was wir hier gemeinsam gemacht haben. Ich meine, haben wir gekocht und gequatscht? Oder ist was los gewesen, hatten wir Besuch? Wer hat eingekauft? Wie sind Joghurt und Karotten in mein Kühlfach gekommen? Habe ich die selbst geholt oder hat einer von euch die Sachen mitgebracht?«
Axl und Bertie schauten sich an.
»Öh, also … es ist nix Spannendes passiert«, meinte Axl behutsam. »Eine ganz normale Woche halt, wir haben hier ein paar Mal abends zusammengehockt, einmal mit dem Elvis, einmal mit der Brigade. Der Schornsteinfeger ist vorbeigekommen, und Bertie hat vergessen, den Papiermüll rauszustellen, jetzt quillt die Tonne über. Das war’s im Großen und Ganzen.«
»Und du hast bei mir angerufen«, ergänzte Elvis. Der dicke Reporter musste sich anstrengen, um seine brummige Miene trotz der Sorge um Tinne beizubehalten. »Du hast mir das Ohr abgekaut wegen ein paar begriffsstutziger Studenten und einer Straßenbahn, die dir vor der Nase weggefahren ist, obwohl deine Uhr noch locker eine halbe Minute Zeit angezeigt hat. Alles in allem also nichts Weltbewegendes, würde ich sagen.«
Tinne biss die Zähne zusammen, um nicht sofort wieder loszuheulen. Na und? Selbst wenn es die langweiligste Woche im ganzen Jahr gewesen war – es war ihre Woche, ihre Zeit, und jemand hatte sie ihr gestohlen.
Der einwöchige Filmriss fühlte sich an, als habe sie einen blinden Fleck auf ihrer inneren Netzhaut. Sie hatte ein oder zwei Mal zu viel gebechert und einen Blackout bekommen. Klar war es im Nachhinein peinlich, wenn man sich von den anderen erzählen lassen musste, wie man es nach Hause geschafft hatte. Aber letztendlich hatte es immer etwas von einer Gaudi, ein Lacher eben. Hui, das letzte Glas gestern hat mich ganz schön umgehauen, haha.
Diesmal ging es aber nicht um eine durchzechte Nacht mit ein paar verlorenen Stunden. Nein, ihr Alltag, ihr normales Leben hatte ohne sie stattgefunden. Eine fremde Tinne war an die Uni gegangen und hatte Seminare gehalten. War abends und nachts mit Laurent zusammen gewesen. Hatte in der Kommune mit Bertie und Axl Zeit verbracht. Wer konnte sagen, was die fremde Tinne in dieser Woche noch alles getan hatte. Absprachen mit ihren Studenten getroffen? Bankgeschäfte getätigt? Etwas gekauft, etwas bestellt, eine Reise gebucht? Sich mit jemandem gestritten, einem Freund böse Worte an den Kopf geworfen, und die echte Tinne wusste nichts davon?
Schon wieder kamen die Tränen. Sie hatte das Gefühl, auf eine schräge Weise unvollständig zu sein. Laurent, der bis jetzt kaum etwas gesagt hatte, nahm sie sanft beim Arm und führte sie in ihr Zimmer. Tinne sackte auf die orangefarbene Couch.
»Was ist passiert bei dem Unfall?«, schluchzte sie. »Ich muss es ganz genau wissen.« Sie hatte alles schon zigmal erzählt bekommen, wollte es aber immer wieder hören. Vielleicht würden die Wiederholungen irgendwann ihre Erinnerung zurückbringen.
»Du bist vorgestern Nacht in ein Auto gelaufen. Auf der Großen Bleiche, Höhe Deutschhausplatz«, berichtete Laurent geduldig. Tinne schloss die Augen und konzentrierte sich auf seine tiefe, volle Stimme. Kamen die Bilder in ihren Kopf zurück?
»Es war spät, richtig spät, Viertel vor eins. Das Auto ist ein Toyota Corolla gewesen, die Fahrerin war eine ältere Frau, Marta Hinrichs, 64 Jahre. Sie hat ausgesagt, dass sie auf keinen Fall zu schnell gefahren ist und dass du ganz plötzlich da warst. Ohne zu schauen oder zumindest langsam zu machen, bist du auf die Straße gerannt, sie hat nicht mehr rechtzeitig bremsen können und dich mit dem rechten Kotflügel erwischt.«
Tinne wartete auf die Szenen, auf irgendeine Erinnerung. Nachts, die Große Bleiche. Ein Auto kam heran. Doch nein, ihr Kopf fühlte sich an wie ein schwarzes Loch.
»Frau Hinrichs hat den Unfall sofort gemeldet und auch direkt einem Alkohol- und Drogentest zugestimmt. Beides negativ. Und unsere Sachverständigen haben die Bremsspuren analysiert. Das Auto ist tatsächlich nicht zu schnell gewesen. Sie ist einfach nur eine harmlose alte Dame, die nachts über die Große Bleiche gefahren ist.«
Laurent schwieg. Mufti stromerte durch die Tür und sprang auf Tinnes Schoß. Der große Kater mit dem Garfield-Fell besaß eine untrügliche Antenne für die Stimmung in der Kommune. Wenn es jemandem schlecht ging, tauchte er mit großer Zuverlässigkeit auf und bot kätzischen Trost. Tinne war dankbar für das warme Bündel und zauste dem Kater das Fell.
»Du hattest nichts bei dir, keinen Ausweis, keinen Geldbeutel. Nur dein Handy. Über die Vertragsnummer hat der Notdienst dann deinen Namen und deine Adresse rausgekriegt.« Der Kommissar langte herüber und strich über Muftis Lieblingsstelle zwischen den Ohren. Als Antwort erhielt er ein zufriedenes Schnurren. »Du hast wahnsinniges Glück gehabt. Bei dem Aufprall hätte sonst was passieren können. Du bist so übers Auto gerutscht, dass du mit dem Kopf auf die Straße gedonnert bist, alles andere ist unverletzt geblieben.« Er versuchte ein kleines Lächeln. »Und dein Schädel ist ja bekanntermaßen so dick, dass ihm nichts etwas anhaben kann.«
Tinne lächelte dünn zurück, obwohl sie lieber losgeheult hätte. »Was hab ich da gemacht? Warum bin ich auf die Straße gerannt, ohne zu gucken? Mitten in der Nacht?« Die Fragen galten eher ihr selbst, denn ihr war klar, dass Laurent darauf keine Antwort wusste.
Dieser streichelte mechanisch weiter und wählte seine Worte sorgfältig aus. »Sie, also Frau Hinrichs, hat gemeint, du hättest irgendwie«, er zögerte, »ängstlich ausgesehen. Gehetzt. Als wärst du vor irgendwas weggelaufen oder so. Todesangst, das Wort hat sie benutzt. Du bist gerannt, als hättest du Todesangst.«
Tinne glitt tiefer in das schwarze Loch. Todesangst? Sie war vor etwas davongelaufen? Mitten in ihren Grübeleien wurde ihr bewusst, dass Laurent noch etwas zurückhielt.
»Was noch?«, fragte sie. Der Kommissar schob den Kiefer vor, als überlegte er, wie viel er ihr verraten könnte.
»Was noch?« Ihr Ton klang fordernd.
»Hm, also, du hast ein ordentliches Hämatom am Kopf, von dem Sturz. Es gibt aber noch Abschürfungen an den Händen und den Ellbogen, die sind im Krankenhaus auch behandelt und desinfiziert worden.«
Unwillkürlich strich Tinne über ihre Arme. Das rote Antiseptikum wusch sich allmählich ab, am Anfang hatte ihre Haut ausgesehen wie eine Fleckenlandschaft. Die wunden Stellen hatte sie für eine Folge des Aufpralls auf der Straße gehalten. Bis jetzt.
»Diese Abschürfungen, die sind nicht vom Unfall«, fuhr Laurent langsam fort. »Es ist Abrieb an deiner Haut gewesen, Substratspuren. Und zwar von Backsteinen.«
»Backsteinen?«, wiederholte Tinne begriffsstutzig.
»Ja. Du musst irgendwo an einer Backsteinmauer oder so etwas entlanggeschliddert sein, mit ziemlichem Karacho. Und da ist noch was.«
Sie fragte sich, ob sie das alles eigentlich hören wollte. Was um alles in der Welt war ihr in dieser Nacht zugestoßen?
»Deine Kleider. Du hast Jeans angehabt und einen Longsleeve. Darüber einen Fleece. Und eine Windjacke.«
Tinne verstand, was er meinte. Die Temperaturen waren seit Wochen mörderisch, selbst nachts fiel das Thermometer selten unter 25 Grad. Die Hitze staute sich überall, kein Lufthauch ging. Niemand trug freiwillig Jeans und Fleece, erst recht keine Jacke.
»Was sind deine letzten Erinnerungen?«, fragte Laurent sanft. »Erzähl mir davon.«
Auch dieses Thema hatten sie inzwischen ein Dutzend Mal durchgekaut. Doch der Kommissar wusste, wie wichtig ihr die ständigen Wiederholungen waren, und er hörte ihr immer wieder aufs Neue zu. Dafür liebte sie ihn unendlich.
»Ich hab eine ganz normale Uniwoche gehabt, nicht viel los, es sind ja gerade Semesterferien.« Tinne schloss die Augen, um besser nachdenken zu können. »Am Donnerstag bin ich abends mit Carola und Eva weg gewesen, im Kamin. Wir haben Flammkuchen gegessen, lecker wie immer. Und dann, am nächsten Tag …« Sie zögerte. Der Fluss der Erinnerungen wurde zum Rinnsal. »Am nächsten Tag, am Freitag, war ich zu Hause. Es gab dicke Luft, Axl und Bertie haben sich wegen irgendwas gestritten. Aber es hatte nichts mit mir zu tun, deshalb bin ich in meinem Zimmer geblieben. Ich hab am Schreibtisch gehockt und Seminararbeiten korrigiert. Und dann kam dieser Telefonanruf. Von Jason.«
»Jason wer?« Laurents Stimme klang sanft wie Seide und half Tinne, die Szenen zu packen, die immer schemenhafter wurden.
»Jason Zwane. Ein Typ aus Südafrika, holländischer Abstammung, wohnt seit ein paar Jahren hier in Mainz. Fotograf, und ein ziemlich guter. Ich kenne ihn, weil er die Coverfotos für ›Steelram‹ gemacht hat.«
Sie spürte mehr, als dass sie sah, wie Laurent nickte. ›Steelram‹ war die Hardrock-Band ihres Mitbewohners Axl. Er und seine Mitmusiker hatten letztes Jahr im Keller der Kommune 47 ihre erste eigene CD aufgenommen.
»Seitdem ist Jason ein paar Mal hier gewesen«, fuhr sie fort. »Ein netter Kerl, ein bisschen schräg, seine Spezialität sind Fotos von ›Lost Places‹. Von verlassenen Gebäuden, von Kasernen, Krankenhäusern, Villen, Kirchen, Theatern, so was in der Art. Alles halb verfallen, aber irgendwie hat es schon seinen Zauber. Es gibt eine regelrechte Community im Netz, und Jason hat da echt einen guten Namen.«
»Okay, Lost Places und Coverfotos. Aber was hat er von dir gewollt, warum hat er angerufen?«
Tinne redete weiter und versuchte, den hauchfeinen Faden der Erinnerung nicht abreißen zu lassen.
»Das war irgendwie komisch. Er weiß, dass ich Historikerin bin, ›Historikwissenschaftlerin‹, so nennt er es immer, find’ ich ziemlich ulkig. Er spricht gut Deutsch, das R klingt halt Englisch, und in der Satzmelodie hört man den Holländer, aber sonst richtig gut. Jedenfalls, er hat am Telefon erzählt, er wolle mir irgendetwas zeigen.« Sie runzelte die Stirn und bemühte sich, die blassen Gedanken zu erhaschen. Wie aus weiter Ferne hörte sie Jasons Stimme:
… muss ich dir zeigen. Wann können wir …?
Seine Worte wurden leiser.
Ein großes Ding für dich als Historikwissenschaftlerin. Und ich meine echt groß …
Der Rest verhallte im Nichts. Tinne merkte, dass sie halblaut mitgesprochen hatte.
»Ein großes Ding für dich«, wiederholte Laurent nachdenklich, als hätte er die Worte zum ersten Mal gehört. »Was hat er damit gemeint?«
Tinne schlug die Augen auf. Erneut versiegte ihre Erinnerung an dieser Stelle, danach kam nur noch Schwärze. Auch dieses Mal war der Faden gerissen. Mutlos hob sie die Schultern. »Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ob er sich überhaupt noch mal gemeldet hat, ob wir uns getroffen haben – da ist nur ein riesiges Nichts.« Wieder stiegen ihr die Tränen in die Augen, sie schämte sich dafür.
»Hast du ihn denn inzwischen erreichen können, diesen Jason?«
Stumm schüttelte Tinne den Kopf. Schon im Krankenhaus hatte sie unendlich oft versucht, ihn anzurufen. Doch es ging immer nur die Telekomansage dran, und ihre Rückrufbitte hatte er bisher ignoriert.
Laurent wollte etwas sagen, da unterbrach ihn sein iPhone. Am Klingelton erkannte Tinne, dass es ein dienstlicher Anruf war. Er ging ran, hörte ein paar Sekunden zu und stand auf. Mufti nahm die Bewegung mit kritischem Blinzeln zur Kenntnis.
»Das ist Tara gewesen. Tut mir leid, ich muss los, zur Rechtsmedizin.«
Ein rascher Kuss, dann verschwand er, Tinne blieb allein im Zimmer zurück. Sie spürte, wie ihre Gedanken um das schwarze Loch kreisten, das ihre Erinnerungen verschluckt hatte.
*
Eine unpassende Mischung flutete in Laurents Nase. Es dauerte eine Sekunde, bis er die Gerüche unterscheiden konnte: Pizza Hawaii und Formaldehyd. Gewagte Kombination.
François, Taras Assistent, öffnete die Tür zum Hades für ihn. Der Lockenkopf kaute an einem Pizzaviertel und grinste den Kommissar an.
»Tach, Herr Pelizaeus. Auch ein Stück?«
Dieser schüttelte den Kopf. Man musste wohl hier arbeiten, um inmitten von Leichen eine mittägliche Pizza genießen zu können.
Der ›Hades‹, wie der Sektionskeller genannt wurde, lag im Tiefgeschoss des Instituts für Rechtsmedizin auf dem Kästrich. Herrin über die stählernen Seziertische war Dr. Tara Feh, eine gut aussehende Halbirin mit grünen Augen. Obwohl sie sich in aller Regel unter eher morbiden Umständen trafen, mochte Laurent die Rechtsmedizinerin. Meist flachsten die beiden und zogen sich auf, doch heute begrüßte Tara ihn nur knapp und führte ihn direkt zu einem der Tische. Ein Tuch bedeckte einen liegenden Körper, die Umrisse bildeten eine Berg-und-Tal-Landschaft. Der Kommissar merkte, wie sich sein Nacken verspannte. Taras Konzentriertheit verhieß nichts Gutes. Dazu kam, dass sie sogar heute, an einem Sonntag, arbeitete und ihn herbestellt hatte. Er ahnte, dass der Tote aus dem Rhein einige unliebsame Überraschungen für ihn bereithielt.
»Männlich, um die 30, gesunder Allgemeinzustand. Die Verletzungsgenese ist bemerkenswert.« Mit diesen Worten schlug sie das Tuch zurück.
Laurent rührte sich nicht. Das Zurückweichen vor den Spuren des Todes hatte er sich schon lange abgewöhnt. Wozu auch, der Schnitter hatte seinen eigenen Plan, ob man seine Existenz nun verdrängte oder nicht.
Er ließ die Augen über den Körper schweifen, der vor ihm lag. Bei der Bergung im Fluss war er gestern zwar dabei gewesen, doch dort hatten Blut und Wasser die Einzelheiten verwischt. Nun offenbarte die inzwischen klinisch saubere Haut zerfranste Löcher, die den Oberkörper und den Kopf perforierten. Gleichmäßig aneinandergereiht wie Perlen auf einer Schnur stanzten sie sich in Gewebe und Knochen. Der Geruch nach Ananas und Käse, der noch immer in der Luft lag, ließ das Ganze ins Groteske abgleiten.
Tara folgte seinen Blicken und nahm die Frage vorweg. »Tierbisse. Kegelförmige, einspitzige Zähne, alle homodont, also von gleicher Form. Erheblicher Beißdruck, ich würde sagen, bis zu einer Tonne.« Sie zögerte einen Augenblick, als wollte sie den Augenblick der Wahrheit hinauszögern. »Ich habe eine Weile recherchieren müssen, bin mir inzwischen aber ziemlich sicher. Dieser Mann ist von einem Krokodil getötet worden.«
Es dauerte eine Weile, bis das Wort bei Laurent sackte. Er merkte, wie sich alles in ihm dagegen sträubte. Ein Krokodil. Im Rhein. Unmöglich.
»Das … das kann aber …«, fing er lahm an, doch Tara unterbrach ihn.
»Pass auf, das ist noch nicht alles.« Er sah ihr an, wie sie ihre Erkenntnisse innerlich sortierte. »Weißt du, wie Krokodile und Alligatoren töten?«
Er riss seinen Blick von dem durchlöcherten Leichnam und überlegte. Im Fernsehen liefen zwar allenthalben Sendungen, die die exotische Wildnis samt gefährlicher Tiere ins heimische Wohnzimmer brachten. Doch meist beschäftigte er sich dabei mit Hausarbeiten oder schlief ein, sodass der Bildungsauftrag auf der Strecke blieb.
»Sie beißen ihre Beute tot?«, schlug er zaghaft vor.
»Nein. Sie schwimmen ans Ufer, schnappen ihr Opfer mit den Zähnen und ziehen es ins tiefere Wasser. Dort ertränken sie es.«
Laurent schaute zwischen dem toten Mann und Tara hin und her.
»So ist es auch hier gewesen? Er ist ertrunken?«
»Ja. Die Bissverletzungen wären zwar ebenfalls letal gewesen, aber die Todesursache ist Ertrinken, ganz eindeutig. Die Zahnbereihung an der Leiche lässt auf ein Tier von drei Meter Rumpflänge schließen, Minimum. Das reicht, um einen ausgewachsenen Mann zu packen und unter Wasser zu ziehen. Aber jetzt kommt etwas, das mir Kopfzerbrechen bereitet.«
Kopfzerbrechen? Eine Leiche mit Krokodilspuren machte dem Kommissar schon Kopfzerbrechen genug, er wollte gar nicht hören, was Tara noch auf Lager hatte. In einem Winkel seines Hirns war er schon damit beschäftigt, die Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei zu koordinieren. Der Rhein musste abgeriegelt werden für die Jagd nach einem Drei-Meter-Krokodil.
»Ich habe seine Lungen untersucht«, fuhr Tara fort. »Sie sind mit Flüssigkeit gefüllt gewesen, das ist nicht weiter verwunderlich. Aber jetzt kommt’s: Sobald der Tod eintritt und die Atembewegung zum Stillstand kommt, verbleibt flüssiges Substrat dort ziemlich lange. Selbst wenn eine Leiche im Wasser treibt, gibt es kaum Austausch mit dem äußeren Medium.«
Laurent wusste nicht, worauf sie hinauswollte. »Ja und? Hatte er denn etwas anderes als Wasser in den Lungen?«
»Nein, Wasser ist schon richtig. Nur eben nicht aus dem Rhein. François hat die Analyse gemacht und jede Menge Begleitstoffe gefunden. Harnsäure, synthetische organische Substanzen, Salze, Fette. Ein paar Ölspuren und Faulschlamm. Dazu noch Bakterien und einen ganzen Cocktail an medizinischen Substanzen.«
»Und, äh … das ist was genau?«
»Abwasser. Kanalwasser. Die typischen Beimengungsstoffe in Siedlungsbrauchwasser. Mit anderen Worten: Dieser Mann ist irgendwo in der Kanalisation von einem Krokodil ertränkt worden und danach erst in den Rhein geraten.«
Laurents Gedanken rasten davon. Die alte Horrorgeschichte von dem Krokodilbaby kam ihm in den Sinn, das ins Klo gespült wurde und im Kanalsystem zu einem menschenfressenden Monster heranwuchs. Konnte es sein, dass diese haarsträubende Geschichte tief unter den Straßen von Mainz zur Wirklichkeit geworden war?
*
Tinne hockte an ihrem Schreibtisch und blies Trübsal. Je länger sie ihr Hirn zermarterte, um einen Eingang in das Labyrinth des Vergessens zu finden, umso wolkenhafter wurden ihre Gedanken. Inzwischen konnte sie kaum mehr auseinanderhalten, was sich tatsächlich zugetragen hatte und was sie sich einbildete. Fahrig wühlte sie auf der Tischplatte herum und brachte Unordnung in die Papiere, die dort lagen. Der Tisch besaß eine beachtliche Größe, kein Wunder, es handelte sich ursprünglich um eine alte Wirtshaustafel. Die hatte sie in ihrer Heimat Göttingen erstanden und seither in jede ihrer Wohnungen gestopft, egal wie eng.
»Ich muss doch etwas gemacht haben«, murmelte sie. »Eine ganze Woche lang, was hab ich denn getrieben?« Doch alles, was sie auf dem Tisch fand, waren Uniunterlagen, altbekannte Bücher, Ausdrucke, hingekritzelte Notizen von Seitenzahlen und Quellenangaben. Zumindest über diesen Teil ihres Lebens musste sie sich im Moment keine Sorgen machen – Dick und Doof hatten sie bis auf Weiteres krankgeschrieben.
Mit zusammengekniffenen Augen versuchte sie zum hundertsten Mal, einen Erinnerungszipfel zu erwischen. Der letzte blasse Fetzen war das Telefonat mit Jason, sein englisches R, der leichte Singsang in seiner Intonation. Ein großes Ding für dich als Historikwissenschaftlerin. Und ich meine echt groß.
Ihre Finger spielten mit den Papieren, da rutschte ein längliches Etwas heraus, sie erkannte das CineStar-Logo. Eine Kinokarte, ›Das Geheimnis von Neapel‹ mit Peppe Barra, richtig, den hatte sie im August mit Laurent gesehen. Am Rand stand etwas, sie erkannte ihre Handschrift und versuchte, das Wort zu entziffern.
Barilos? Basilog? Was sollte das bitte schön heißen? Plötzlich regte sich etwas in ihr … ein vager Hauch, fast durchsichtig. Telefon. Telefonieren. Ja, da war etwas. Ein weiterer Fetzen des Gesprächs mit Jason.
Auf eine merkwürdig entrückte Weise sieht sie sich selbst, wie sie am Tisch sitzt, das Handy ans Kinn geklemmt, mit der einen Hand hält sie Mufti auf ihrer Schulter im Gleichgewicht, mit der anderen will sie etwas notieren. Kein Zettel griffbereit, verflixt, sie findet die Kinokarte und versucht, darauf zu schreiben. Der Kater zappelt, die Karte rutscht weg, krampfhaft schiebt Tinne sie hin und her, doch der dünne Karton klebt an ihrem Handballen fest, sie kann kaum leserlich schreiben … das Wort, sie hört Jasons Stimme, es …
Ein Klopfen riss Tinne aus ihrer Konzentration. Der Hauch verblasste, die Erinnerung wurde wieder zu Nebel. Berties Karottenkopf erschien in der Tür, zwei Handbreit darüber Axls langer, dünner Schädel. »Stören wir?«, fragten die beiden wie aus einem Mund. Tinne seufzte und legte die Kinokarte auf ihr Notebook. »Nein, kein bisschen«, log sie. Rasch machte sie ein Handyfoto von dem B-Wort, um es immer parat zu haben. »Was gibt’s?«
Die beiden kamen herein und stellten sich in Positur. Sie kamen Tinne vor wie die Blues Brothers vor der strengen Mutter Oberin im Waisenhaus.
»Und zwar«, Bertie zog eine wichtige Miene, »wir haben nachgedacht, der Axl und ich. Wegen deinem Zustand.«
Tinne fühlte sich zwar nicht nach einem ›Zustand‹, hielt aber die Klappe und ließ die zwei reden.
»Es gibt nämlich bestimmte Mechanismen, mit denen man diese Blockade lösen kann«, fuhr Axl fort. »Damit das Hirn wieder auf die Areale zugreifen kann, die vergessen sind.«
»Aha. Und woher habt ihr euer Fachwissen?«
»Recherchen.« Bertie hob stolz einen Stapel Blätter hoch. »Da gibt’s viel im Netz drüber, und wir haben ein paar Ideen, die dir auf jeden Fall helfen werden.«
Tinne überlegte, wie sie die beiden bremsen konnte, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Die Hilfsbereitschaft ihrer Mitbewohner in allen Ehren, aber sie hatte keine Lust auf Küchenpsychologie aus dem Internet und auf Gedächtnisauffrischungstipps von YouTube.
»Also, danke erst mal, aber wisst ihr …«, fing sie an, doch die beiden winkten synchron ab.
»Du musste gar nichts machen, wir haben das alles durchgeplant«, verkündete Axl. »Alles baut aufeinander auf, und du wirst sehen, im Nu hast du deine Erinnerung wieder. Entspann dich und lass uns nur machen.«
Tinne musste sich bemühen, nicht die Augen zu rollen. Entspannen? Sie hatte die dunkle Vorahnung, dass die Pläne der beiden zu allem Möglichen führen würden, nur nicht zur Entspannung.
»Ach, übrigens«, Bertie zauberte eine Tüte hervor, »ich habe eine Krankenfahrt in die Uniklinik gemacht und bei der Gelegenheit nach deinen Klamotten gefragt. Hatten sie noch. Ist zwar alles ziemlich ruiniert, aber vielleicht willst du sie ja wiederhaben. Axl hat sie sogar gewaschen.«
Das wunderte Tinne nicht, denn Axl war Mister Tausendprozentig im Kommunenhaushalt. Die Dinge des täglichen Bedarfs übernahm er mit größter Selbstverständlichkeit, ein Bündel unfallverschmutzter Wäsche kam einer Kampfansage gleich.
Bertie drückte ihr die Kleider in die Hand, sie bedankte sich artig. Axls innerer Monk hatte sogar dafür gesorgt, dass der Stapel akkurat gefaltet und an den Kanten parallel ausgerichtet war. Tinne spürte einen Stich – tatsächlich, ihre robuste Jeans, treue Begleiterin aller Uni-Exkursionen. Der Fleece, den sie letztes Jahr gemeinsam mit Laurent gekauft hatte. Die Windjacke von Fjällräven, so alt, dass sie wohl noch aus Göttingen stammen musste. Alles aufgerissen oder vom Notarzt zerschnitten, hier und dort mit antiseptischem Mittel bekleckst, das sich sogar dem Waschmittel widersetzt hatte. Wieder glomm die Frage in ihr auf, warum sie im brütend heißen Sommer mit Fleece und Jacke unterwegs gewesen war.
Die Männer verzogen sich, Tinne blieb inmitten der Kleider sitzen. Sie wartete, dass eine Erinnerung kam wie vorhin bei der Kinokarte. Ein durchsichtiger Hauch in ihren Gedanken. Doch nichts passierte, die Klamotten lagen nur zerrissen da und erzählten keine Geschichte. Eher beiläufig tastete Tinne die Taschen der Hose ab – und spürte etwas Knittriges. Behutsam zog sie ein Stück Papier heraus, das fast zwischen ihren Fingern zerfiel. Die Maschinenwäsche hatte dem Material arg zugesetzt. Sie erkannte eine Skizze, eine symmetrische Struktur, hauchfein, fast ausgelöscht.
Was sollte das sein? Ein Grundriss? Das Kreuz symbolisierte wohl eine Kirche. Aber was mochte der schräge Kasten darüber darstellen? Tinne biss die Zähne zusammen. Ausnahmsweise verwünschte sie Axls Ordnungsliebe – hätte der penible Altrocker die Kleider nicht sofort in die Waschmaschine gestopft, hätte sie sicher mehr Details über ihre vergessene Woche erfahren. So blieben ihr nur eine ausgebleichte Skizze und ein mysteriöses Wort auf einer Kinokarte.
Aber immerhin, es gab eine Spur. Tinne war bereit, den Kampf gegen die Amnesie aufzunehmen.
*
Nadja und Nadya hatten Spaß bei der ›Summer Nighz‹-Party. Die Bässe dröhnten aus dem Gewölbe des Brückenkopfes, über ihnen spannten sich die eleganten Bögen der Theodor-Heuss-Brücke, die Dämmerung ließ den Rhein in dunklen Farben glühen. Hammer, die Location!
»Super Tipp von Jakob!«, rief Nadya und bemühte sich, das Wummern der Musik zu übertönen. »Wo ist der überhaupt?«
Nadja schaute sich um. Jakob, der Jungwinzer mit langem Pony und Vollbart, hatte ihnen von den ›Summer Nighz‹ erzählt, die dieses Wochenende am Brückenkopf stattfanden. Weil beide Mädels ihn süß fanden, folgten sie dem Tipp und hofften, ihm hier über den Weg zu laufen.
»Keine Ahnung. Wird schon kommen. Was willst ’n noch?« Sie nahm das leere Glas ihrer Freundin und kannte die Antwort schon, bevor Nadya den Mund aufmachte.
»’N Chardonnay.«
Nadja nickte zufrieden. Bingo. Ihre fast gleichen Vornamen waren nicht die einzige Ähnlichkeit – die beiden jungen Frauen teilten Essens- und Getränkevorlieben, Lieblingsmusik und Männergeschmack. Was andere Freundschaften auf eine harte Probe stellte, schweißte sie umso enger zusammen. Einen Chardonnay wollte Nadja für sich selbst holen. Logo, dass Nadya Lust auf dasselbe Getränk hatte.
Zwischen Stehtischen mit schwatzenden Menschen schlängelte sie sich zum Gebäude. Der gemauerte Brückenkopf ragte vor ihr auf wie eine Festung, ein halbrunder Eingang führte ins Innere. Dort erstreckte sich ein langes Gewölbe mit Barhockern rechts und links. Floorspots beleuchteten die Wände, Gäste drängten sich, die Bässe der Musik spürte man im Bauch. Coole Location, definitiv. Nadja stellte sich an der Bar an und brüllte dem Mann am Ausschank ihre Bestellung entgegen. Mit zwei gefüllten Gläsern ging sie wieder nach draußen. Normalerweise wäre ein altes steinernes Gewölbe eine willkommene Abkühlung gewesen, denn die hochsommerlichen Temperaturen draußen ließen die Kleider am Körper kleben. Doch durch die vielen Menschen hier unten war es stickig und schwül, Nadja freute sich über die frische, wenn auch warme Nachtluft.
»Und, gesehen?«, fragte sie Nadya und stellte die Weingläser auf den Tisch. Ihre Freundin schüttelte bedauernd den Kopf. Kein Jakob auf dem Radar. Nadja nahm einen Schluck und ließ die Musik auf sich wirken. Na gut, wenn der knusprige Winzer schon nicht auftauchen wollte, würden sie die Party einfach so genießen. Die Musik kam jedenfalls gut. Der DJ nannte sich ›SuperNatural‹, die Mädels hatten bei dem Namen die Nasen gerümpft. Inzwischen mussten sie aber zugeben, dass der Mann am Teller etwas konnte und jeder neue Song Spaß machte. Der ›Bella Ciao‹-Remix von El Profesor. Bushido gemeinsam mit Capital Bra. Schade, dass 6ix9ine so ein Aso war, sein ›Fefe‹ hatte was. Die Fanta 4 und Clueso mit ihrem ›Zusammen‹. Nadja musste an das irre komische Video denken, in dem der Produzent den Fantas die Zusammenarbeit mit Clueso schmackhaft machte und Thomas D. und die anderen sich anstellten wie Vollpfosten. Sie schloss die Augen und ließ die Klänge auf sich wirken … Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt …
In diesem Augenblick wurde die Welt dunkel und still. Nadja schaute erschrocken auf. Die Musik war ausgegangen, die Spots leuchteten nicht mehr. Da erhoben sich auch schon die Stimmen der Umstehenden, halb spöttisch, halb entnervt. »Och nee, oder?« – »Was geht, Strom weg?« – »Haha, Rechnung nicht bezahlt.«
Auch Nadya zog ein überraschtes Gesicht. »Hey, was ist das denn? Hat die Stadt ein Problem, weil’s zu laut ist?«
Die Menschen schwatzten und lachten im Licht der schwindenden Dämmerung, Handyblitze zuckten, das unerhörte Ereignis musste sofort im Netz geteilt werden. Nadja lief ein paar Dutzend Meter entlang des Fußwegs in Richtung Hilton, bis sie einen Überblick hatte. Wie vom Donner gerührt blieb sie stehen. Nein, die Stadt hatte kein Problem mit der Party am Brückenkopf, die Stadt hatte ein ganz anderes Problem. Der Bereich jenseits der Brücke, die Rheinstraße, das Hilton-Hotel, die Spielbank – überall herrschte Dunkelheit, nur die Scheinwerfer der Autos schnitten zaghaft durch die unerwartete Schwärze.
Eine halbe Stunde später stand ein T5 der Mainzer Netze auf Höhe der Brücke am Straßenrand. Pylonen und Blinklichter sperrten den Bereich ab, zusätzlich hielten Polizisten Wache und winkten die Neugierigen weiter. Im Hintergrund heulten Sirenen, Feuerwehrleute hatten alle Hände voll zu tun, um Leute aus feststeckenden Aufzügen zu befreien und blockierte Automatiktüren zu öffnen.
Das ›Summer Nighz‹-Partyvolk am Brückenkopf war längst auf und davon, der Inhaber ärgerte sich über die entgangenen Einnahmen und wischte missmutig die Tische blank. Für Nadja und Nadya hatte der Abend inzwischen eine glückliche Wendung genommen: Jungwinzer Jakob war aufgetaucht, sogar mit einem ebenso bärtigen und ebenso hippen Kumpel im Schlepptau. Die vier saßen inzwischen in der Mainzer Altstadt, wo es Licht und gute Musik gab.
Von solch einem Happy End konnten die Männer der Mainzer Netze nur träumen. Sie leuchteten ratlos in einen Schacht, in dem vier armdicke rote Kabel verliefen. Ein Verteilernetz mit 20 Kilovolt, das den gesamten städtischen Bereich nördlich der Brücke mit Strom versorgte. Doch nun waren die Betonröhren, die die Kabel umhüllten, zerborsten und in schrägem Winkel verschoben. Kupferlitzen quollen aus den zerrissenen Leitungen, es roch nach verkohltem Plastik und heißem Metall.
Die Männer hatten keine Erklärung für das, was sie sahen. Der Anblick ließ nur einen einzigen Schluss zu: Eine ungeheure Kraft musste das Betonfundament angehoben und die Kabel durchtrennt haben.
Montag, 10. September 2018
Tinne tappte aus ihrem Zimmer in die Küche. Auf ihrem Nachthemd prangten die Maus, der Elefant und die gelbe Ente, aber sie musste sich vor niemandem genieren. Dank ihrer Krankschreibung konnte sie die Morgenstunden im Bett verdümpeln, während ihre beiden Mitbewohner längst bei der Arbeit waren. Bertie fuhr Taxi, gemeinsam mit seinen Kollegen vom Taxidienst Laurenzi zog er seine Kreise durch Mainz und die umliegenden Dörfer. Axl verdiente seine Brötchen als Metallkünstler. In seiner Werkstatt in Hechtsheim schuf er überlebensgroße Metallmonster mit Zähnen und Klauen. Einige der Skulpturen zierten den Innenhof der WG, die Nachbarschaft in der Bretzenheimer Wilhelmstraße wurde nicht müde, darüber die Köpfe zu schütteln.
Die Wohngemeinschaft, nach ihrer Hausnummer ›Kommune 47‹ genannt, hätte für Tinne eigentlich nur eine Übergangslösung sein sollen. Ihr damaliger Lebensgefährte Olaf hatte sie aus der gemeinsamen Wohnung geworfen, damit seine blutjunge Doktorandin Tinnes Platz einnehmen konnte. Tinne kroch in der erstbesten Bleibe unter, die sie auf dem Wohnungsmarkt fand, um nicht reihum bei ihren Freunden die Besuchercouch blockieren zu müssen. Die WG in Bretzenheim entpuppte sich dann allerdings als Glücksgriff, die beiden Männer hießen die neue Mitbewohnerin herzlich willkommen, und bald schon fühlte sie sich pudelwohl in dem alten, windschiefen Häuschen.
Müde ging sie nach unten zum Zeitungsrohr. Die Nacht war grässlich gewesen, ganz so, als hätten alle Erinnerungen der letzten Woche einen Ausgang gefunden. Doch leider waren sie rechtzeitig zum Morgengrauen wieder im schwarzen Loch verschwunden, Tinnes Gehirn fühlte sich so leer an wie zuvor. Vor lauter Schläfrigkeit brauchte sie ein paar Sekunden, bis sie merkte, dass unter dem Briefkasten ein Schuhkarton lag. Jemand hatte mit Textmarker ›Frau Professor‹ darauf geschrieben und einen Smiley gemalt. Das konnte doch nur von der Brigade sein!
Die Brigade – so nannten sich die Mitarbeiter vom Taxidienst Laurenzi, acht Leute inklusive Dietmar Laurenzi, dem Chef. Die Männer und Frauen arbeiteten nicht nur zusammen, sondern waren auch privat dicke Freunde. Wenn sie etwas unternahmen, ging es hoch her, meist floss dabei der Wein in Strömen. Bertie lud seine Kollegen oft und gerne in die Kommune ein, bei einer dieser Gelegenheiten hatten sie Tinne aufgrund ihres Uni-Jobs den Spitznamen ›Frau Professor‹ verpasst.
Neugierig trug sie das Paket nach oben und machte es auf. Darin lagen eine Packung Arzneitee für Gedächtnis und Konzentration, eine Flasche Rotbäckchen von Rabenhorst, einige Hefte mit Kreuzworträtsel und ein Rubiks Zauberwürfel aus den schrillen 1980ern. Eine Karte steckte darin, die ein kleines Männchen mit riesigem Einstein-Kopf zeigte. Liebe Frau Professor, gute Besserung! Unsere Kiste soll deinem Hirn auf die Sprünge helfen, damit wir bald wieder mit dir (und über dich) lachen können. Darunter hatten alle acht Brigadiere unterschrieben.
Tinne war gerührt und bekam ein Dauergrinsen ins Gesicht. Der Zauberwürfel – mein Gott, wie lange gab es den schon? In der Schule hatte jeder einen gehabt, und bald kannten die Nerds – die man freilich noch nicht so nannte – die Kniffe zum schnellen Lösen. Und Rotbäckchensaft, auch so eine Kindheitserinnerung! Gefühlt gab es ihn schon ewig, sie hatte ihn als kleines Mädchen immer dann bekommen, wenn sie krank im Bett lag. Aber auch nur dann, weil er so viel kostete. Sie nahm sich vor, die Brigade demnächst einzuladen und mit einem anständigen Chili con Carne zu bekochen, dem einzigen Gericht, das sie aus dem Effeff beherrschte.
Die Türklingel riss sie aus ihren Gedanken, gleich darauf klimperte ein Schlüssel im Schloss. Ohne großes Nachdenken wusste sie, dass es nur Laurent sein konnte. Bertie und Axl klingelten nicht, sonst hatte niemand einen Schlüssel. Na gut, das ältliche Vermieterehepaar aus dem Erdgeschoss natürlich, aber die beiden wären wahrscheinlich noch nicht einmal bei einem Atombombenalarm ins Reich ihrer Mieter eingedrungen.
»Morgen, Schlafmütze. Wie geht’s dir?« Laurents Umarmung fühlte sich gut an, sein Duft nach Cool Water umspülte Tinne wie eine weiche Decke.
»Beschissen, danke der Nachfrage«, wisperte sie und kuschelte sich an ihn. »Was machst du hier, gibt’s keine Verbrecher in Mainz, die du fangen musst?«
»Mehr als genug, glaub mir. Heute Vormittag habe ich sogar einen Ortstermin in der Kanalisation, die Gummistiefel liegen schon im Auto. Ich wollte aber noch mal kurz bei dir vorbeigucken, gestern Abend warst du ausgeknipst, als ich aus dem Präsidium gekommen bin.«
»Oh ja, um halb neun sind bei mir die Lichter ausgegangen.« Tinne gähnte und überlegte kurz, ob sie die Hand vor den Mund nehmen sollte. Dafür hätte sie sich allerdings aus Laurents Umarmung freimachen müssen, und dieser Preis erschien ihr für etwas Anstand entschieden zu hoch.
»Hat sich dieser Jason bei dir gemeldet, oder hast du ihn ans Telefon gekriegt?«
»Nö. Noch immer nur Mailbox. Bertie hat mir sogar den Gefallen getan und ist bei ihm daheim vorbeigefahren, er wohnt in Drais. Hat aber keiner aufgemacht.«
»Na, das scheint ja nicht ganz so der superzuverlässige Typ zu sein«, brummte der Kommissar und warf einen gierigen Blick auf die silberglänzende Siebträgermaschine, die in der Kommunenküche wirkte wie ein Ufo von einem fremden Gestirn. »Komm, lass uns noch schnell einen Espresso trinken, dann muss ich los.«
Die Bezzera Galatea gehörte Tinne, Olaf hatte ihr die Maschine seinerzeit in einer Anwandlung von Großzügigkeit geschenkt. Tinne war inzwischen der Überzeugung, dass die Galatea das mit Abstand beste Überbleibsel ihrer Beziehung darstellte. Während sie Bohnen mahlte und das Pulver festdrückte, fragte sie sich grimmig, warum die Amnesie nicht die vier Jahre mit Arschkeks Olaf aus ihrer Erinnerung getilgt hatte anstatt der letzten Woche. Andererseits – waren es nicht auch die schlechten Erfahrungen, die unseren Charakter formten? Ohne die Arschkeksjahre wüsste sie die schöne Zeit mit Laurent vielleicht nicht zu schätzen.