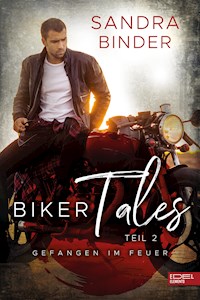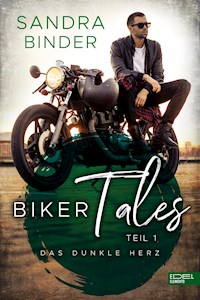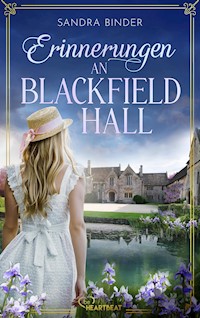5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Du kannst nicht vor deiner dunklen Vergangenheit fliehen …
Der spannende neue Roman für Fans von Ben Aaronovitch
1888 versetzte ein unbekannter Serienmörder das Londoner East End in Angst und Schrecken – heute setzt er sein grausiges Werk fort.
Während der Mord an einer Prostituierten die Polizei vor ein Rätsel stellt, erkennt Privatdetektivin Maxine Atwood in der abscheulichen Tat die Handschrift eines alten Bekannten: Jack the Ripper. Die in die Menschenwelt verbannte Gefallene hofft zunächst auf einen Zufall, doch ›Saucy Jacky‹ meldet sich bald schon persönlich bei seiner einstigen Rivalin: Wie damals schreibt er ihr Briefe, führt sie mit echten Informationen und falschen Hinweisen in die Irre und hetzt die Detektivin kreuz und quer durch ganz London. Maxine verfolgt jede noch so winzige Spur, überprüft alle dämonischen Zweige der Stadt, aber sie scheint ein Phantom zu jagen. Und der Ripper droht, ihr ein zweites Mal zu entkommen ...
Erste Leserstimmen
„der Jack-the-Ripper-Mythos bekommt neues Futter“
„eine herrliche Mischung aus Krimi, Action und Fantasy“
„Maxime ist ein tiefgehender Charakter, den ich im Laufe der Geschichte in mein Herz geschlossen habe“
„Sandra Binder schreibt ihren Roman spannend und abwechslungsreich“
„Jack the Ripper, eine Privatdetektivin nicht von dieser Welt und unser heutiges London – eine perfekte Konstellation“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Ähnliche
Über dieses E-Book
1888 versetzte ein unbekannter Serienmörder das Londoner East End in Angst und Schrecken – heute setzt er sein grausiges Werk fort. Während der Mord an einer Prostituierten die Polizei vor ein Rätsel stellt, erkennt Privatdetektivin Maxine Atwood in der abscheulichen Tat die Handschrift eines alten Bekannten: Jack the Ripper. Die in die Menschenwelt verbannte Gefallene hofft zunächst auf einen Zufall, doch ›Saucy Jacky‹ meldet sich bald schon persönlich bei seiner einstigen Rivalin: Wie damals schreibt er ihr Briefe, führt sie mit echten Informationen und falschen Hinweisen in die Irre und hetzt die Detektivin kreuz und quer durch ganz London. Maxine verfolgt jede noch so winzige Spur, überprüft alle dämonischen Zweige der Stadt, aber sie scheint ein Phantom zu jagen. Und der Ripper droht, ihr ein zweites Mal zu entkommen …
Impressum
Erstausgabe Februar 2020
Copyright © 2023 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96087-642-7 Taschenbuch-ISBN: 978-3-96817-030-5 Hörbuch-ISBN: 978-8-72641-045-7
Covergestaltung: chaela unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © BigAlBaloo und © Good Job Lektorat: Regina Meißner
E-Book-Version 11.01.2023, 13:12:52.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
YouTube
Schatten über Whitechapel
Vorbemerkung
Wer war Jack the Ripper? Seit rund hundertdreißig Jahren ist dieses Rätsel ungelöst und der bekannteste Serienmörder der Geschichte ein Mysterium.
Ripperologen beschäftigen sich bis heute mit den Fällen, rekonstruieren die Ereignisse, wälzen alte Akten und stellen immer wieder neue Theorien auf. Glaubwürdige und weniger glaubwürdige. Aber seien wir ehrlich: Niemand weiß, wer der Whitechapel-Mörder wirklich war. Ja, nicht einmal, wie viele Frauen er tatsächlich getötet hat. Seit über hundertdreißig Jahren wird gerätselt und dabei Wahrheit mit Fiktion vermischt.
Jack the Ripper ist ein Phantom, eine Nebelgestalt, dessen Name nach wie vor Gänsehaut verursacht. Sofort denkt man an die nächtigen, nebelgeschwängerten Straßen Londons, einen Mann – mehr Teufel als Mensch – mit Mantel und Zylinder und einem blitzenden Messer in der Hand. Und von eben jener faszinierenden Gestalt handelt dieser Roman.
Einige der nachfolgend erwähnten Personen, Opfer wie Ermittler, haben wirklich gelebt, manche Vorkommnisse beruhen auf Fakten, doch vieles ist schlichtweg meiner Fantasie entsprungen. Dieses Buch ist kein Tatsachenbericht, es möchte den Leser unterhalten, mitreißen und eine fantasievolle Version des alten Rätsels wiedergeben.
Aber wer weiß, vielleicht hat sich die Geschichte tatsächlich so ereignet, wie uns Privatdetektivin Maxine Atwood gleich erzählen wird …
Ich wünsche eine spannende Lesezeit in London,
Ihre Sandra Binder
Prolog
»Verbannung …« König Edwin zwirbelte sich den langen Kinnbart und blickte auf das Blockhaus neben dem See am Waldesrand.
Die aufgehende Sonne färbte den Himmel rosarot, eine leichte Brise ließ die Blätter in den Bäumen rascheln und Vögel zwitscherten in den Ästen. Eine friedliche Atmosphäre, wie sie am Hofe so niemals zu erleben war. Und ein herber Kontrast zu dem Unfrieden, den sie hierher mitgebracht hatten und der in wenigen Augenblicken losbrechen würde.
Der König seufzte. Seine Zweifel und die Zerrissenheit waren ihm deutlich anzusehen. »Wie kann ich ihr das antun? Meiner ergebensten Dienerin, fähigsten Leibwächterin … und loyalen Freundin?«
»Wir haben keine andere Wahl, mein König, das wisst Ihr.« George legte ihm eine Hand auf den Arm. Heute, in dieser Kutsche am Wegesrand, war er Edwins bester Freund, nicht der Kanzler oder sein wichtigster Ratgeber. Und er musste die Sicht seines Freundes dringend zurechtrücken – zu dessen eigenem Wohl. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn die Wahrheit ans Licht käme. »Mich schmerzt der Gedanke, sie unschuldig zu verurteilen ebenso wie Euch. Doch wir müssen die Gefahr bedenken, mein König. Wir haben es so entschieden, aus vernünftigen Gründen. Ein Zurück ist nicht mehr möglich. Und vergesst nicht, dass es nicht für immer ist.«
Edwins wasserblaue Augen musterten George hilflos. Was er wohl hoffte, in dessen Miene zu finden? Zuversicht? Trost? Etwas, mit dem er seine Entscheidung rechtfertigen konnte? Schließlich seufzte er erneut, wandte sich ab und betrachtete die einfache Behausung, in der Maxine mit ihrer Familie wohnte.
Ihre Lebensweise war so weit von jener des Hofes entfernt, man konnte fast vergessen, dass sie der General der königlichen Armee war. Maxine hatte noch nie Wert auf jeglichen Prunk und Tand gelegt. Sie blieb lieber abgeschieden von allem – mit ihrem Mann, einem Fischer, und ihrer kleinen Tochter, die das Schloss noch nie von innen gesehen hatte. George fand diese Art zu leben nicht sonderlich erstrebenswert, der König hatte ihm gegenüber allerdings des Öfteren betont, dass er beeindruckt davon war, wie Maxine in all der Schlichtheit solch tiefe Zufriedenheit fand.
»Ihr wisst, sie kommt mit wenig aus«, sagte George deshalb. »Es wird ihr nicht schwerfallen, eine Zeitlang in der Menschenwelt zu leben – anders als den meisten von uns. Außerdem ist es nicht für immer.« Er wiederholte sich absichtlich. »Bald schon werden wir Gewissheit erlangen und dann könnt Ihr sie begnadigen.« George hoffte zumindest, dass es so ablaufen würde, denn wenn nicht … Das wollte er sich nicht vorstellen.
Dem König hatte er mehrfach erklärt, es sei eine reine Sicherheitsmaßnahme, Maxine in die Menschenwelt zu verbannen, unwissend wie sie war. Dennoch wirkte Edwin wenig überzeugt und viel zu nachdenklich. Was sollten sie nur tun, wenn er es sich anders überlegte? Der Vorfall ließ sich dann nicht mehr vertuschen und Georges gesamte Familie sowie der König selbst würden vor dem Volk in Ungnade fallen. Alles, was sie sich erarbeitet hatten, wäre in nur einem Wimpernschlag fort. Und das nur weil dieser alte Narr über sein weibisches Gewissen stolperte.
»Wir müssen nun endlich handeln, mein König«, drängte George und wischte sich die schweißnassen Hände an seinem Gehrock ab. »Alles ist vorbereitet. Schickt die Männer ins Haus. Sie werden das Schwert finden, mit dem der Mord verübt wurde. Ich habe es selbst hineingebracht.«
»Dass aus gutgemeinter Saat solch verderbte Blüten wachsen«, murmelte der König. »Nie mehr wird mein Herz ruhen.«
George widerstand dem Drang, die Augen zu verdrehen und zu schnauben. Stattdessen nickte er aufmunternd.
Tief durchatmend hob der König den Arm, streckte die Hand aus dem Fenster der Kutsche und bewegte lediglich die Finger in Richtung Blockhaus. Eine winzige Geste nur, doch mächtig genug, um Menschenleben, Dörfer, ganze Reiche zu zerstören.
Fasziniert beobachtete George, wie sich die Soldaten in Bewegung setzten. Insgeheim hatte er befürchtet, dass sie sich weigerten, ihren General gefangen zu nehmen, und das Unbehagen stand ihnen auch in die Gesichter geschrieben, doch sie folgten loyal dem Befehl ihres Königs. Sechs Mann marschierten auf das Blockhaus zu, wo sie gegen die Tür hämmerten und laut um Einlass geboten.
Wenig später erschien Maxines Ehegatte Charles an der Schwelle und wurde prompt von einem der Soldaten am Arm aus dem Haus gezogen und festgehalten, während drei weitere ins Innere vordrangen. Der Fischer war sichtlich verwirrt, gestikulierte mit den Händen und sagte irgendetwas, das George von seinem geschützten Beobachtungsposten in der Kutsche aus nicht hören konnte.
Anscheinend hatte die Familie noch geschlafen, denn Charles trug lediglich ein Leinenhemd und eine einfache Stoffhose. Außerdem stand ihm das blonde Haar wirr vom Kopf ab.
Plötzlich erklang ein spitzer Schrei. Catherine. Man konnte das Mädchen bereits brüllen hören, bevor es hinauskam. Es klammerte sich weinend an das Hemd seiner Mutter, die, von zwei Soldaten flankiert, abgeführt wurde. Maxine wehrte sich nicht, redete lediglich über die Schulter auf ihre Tochter ein. Vermutlich versicherte sie Catherine, dass alles gut werden würde, dass es ein Missverständnis war, dass sie bald nach Hause zurückkehren würde … Das fremde Schwert, das einer der Soldaten aus dem Haus trug, beäugte sie dabei irritiert.
Ihre Tochter ließ sich nicht beruhigen, im Gegenteil. Ihr Gebrüll war derart grell, dass es George in den Ohren schmerzte. Einer der Soldaten trat zu dem tobenden Kind und riss es von seiner Mutter los, wodurch das Weinen noch schriller wurde. Außerdem fing Catherine an, auf den Mann einzuschlagen, wo immer sie ihn treffen konnte. Die kleinen Hände einer Zwölfjährigen vermochten sicherlich keinen großen Schaden anzurichten, doch der Soldat verlor die Geduld. Entnervt schubste er das Mädchen von sich, sodass es rücklings auf dem Boden landete und aufschrie.
Als Maxine dem Vorfall gewahr wurde, riss sie sich von den Männern los, wirbelte herum und schlug dem Soldaten, der ihre Tochter angegriffen hatte, mitten ins Gesicht. Es ging so schnell, hätte man in diesem Moment geblinzelt, wäre es einem entgangen. Danach brach ein regelrechter Tumult aus. Maxine schlug mit wutverzerrter Miene auf den Soldaten ein, der eine Hand auf die blutende Nase presste und die andere ergebend hob. Mehrmals erwischte sie die anderen Männer, die sie beruhigen wollten, bevor diese es zu dritt schafften, sie zu Boden zu werfen und dort zu fixieren.
Maxine war eine erfahrene Kämpferin und die beste Soldatin des Königs – natürlich war sie kaum zu halten, wenn sie wütend wurde. Sie ließ sich jedoch von Charles besänftigen, der Catherine von hinten umschlang und ihr über das blonde Haar streichelte. Er wiegte das Mädchen, das nach wie vor bitterlich weinte und am gesamten Körper bebte, und redete derweil auf Maxine ein. Ihre Miene wurde allmählich sanfter und schließlich ließ sie sich von ihren eigenen Männern wegschleifen.
Catherine streckte die Hände aus und ihre zarten Fingerchen versuchten, nach der Mutter zu greifen. Maxine schüttelte stumm den Kopf, während ihr glitzernde Tränen übers Gesicht rannen. Der Anblick ließ selbst Georges Herz schmerzen. Zu sehen, wie sie dem Kind die Mutter entrissen, war grausamer als erwartet.
Er sog scharf die Luft ein und wandte sich ab. In diesem Moment spürte er Edwins Blick auf sich und sah zu seinem König auf. Jener wirkte blass und schockiert.
»Was haben wir getan?«, wisperte er.
George räusperte sich, ehe er antwortete. »Es ist die einzige Möglichkeit, um die Ordnung zu wahren.«
»Zwanzig Jahre.« Edwin schloss die Augen und ließ den Kopf hängen. »Sie schreiben das Jahr 1870 in der Menschenwelt. 1890 werde ich Maxine begnadigen, komme, was da wolle.«
»Komme, was da wolle?« George ergriff den Arm des Königs und zwang ihn, ihm in die Augen zu sehen. »Wir brauchen sie dort, vergesst das nicht. Sie ist die Einzige, die der Lage Herr werden kann, wenn – was wohl nie passieren wird – der schlimmste aller Fälle eintritt.«
Der König beugte sich zu ihm und raunte: »Und wenn der schlimmste aller Fälle eintritt und sie der Lage nicht Herr wird?«
George blickte durchs Fenster und beobachtete, wie Maxine in die zweite Kutsche gedrängt wurde. Er wusste nicht, was er darauf antworten sollte.
1. Überraschung!
»Scheiße«, murrte jemand, der sich dem Klang nach unter einem Berg Watte befand. Dem Fluch schlossen sich ein Klirren und ein Poltern an, bevor sich die Stimme erneut erhob: »Was für ein Schweinestall!«
Ich war zu müde, um hochzuschrecken. Oder auch nur die Augen zu öffnen. Ungelenk legte ich eine Hand auf das riesige, pochende Ding, das mein Kopf sein musste und stöhnte leise. Wer immer da gerade durch meine Wohnung stolperte, es war mir gleichgültig. Ich besaß nichts, was es sich zu stehlen lohnte und wenn mir jemand die Kehle aufschlitzen wollte, nur zu, dann hörten wenigstens diese bohrenden Kopfschmerzen auf.
»Max!« Die Stimme erklang nun direkt neben meinem Ohr und ich erkannte die leicht nasale Aussprache. Eine große Hand mit kräftigen Fingern umfasste meinen Oberarm und rüttelte grob an mir. »Muss ich denn erst einen Eimer Wasser holen, Maxine?«
»Das machst du nur ein einziges Mal.« Verdammt, was war mit meiner Kehle los? Dieses Krächzen klang nicht sehr überzeugend. Trotzdem: »Und dann rate ich dir, lauf um dein Leben.«
Vorsichtig öffnete ich die Lider. Nur einen Spalt breit vorerst, das war schmerzhaft genug und trieb mir brennende Tränen in die Augen. Im Zimmer war es so hell, als hätte jemand urplötzlich die Sonne angeknipst. Verfluchtes Tageslicht …
Als ich mich allmählich an die Helligkeit gewöhnt hatte, nahm ich verschwommen ein Paar sehr vertraute, eichenholzfarbene Augen hinter einer eckigen Designerbrille wahr. Sie glotzten mich mit einer Mischung aus Abscheu und Mitleid an.
Der schon wieder! Ein Einbrecher wäre mir lieber gewesen. Der hätte nämlich weder die Vorhänge aufgezogen noch eine Moralpredigt gehalten.
»Was willst du hier, Jonas?« Ich versuchte, mich hochzurappeln, wurde aber von einem heftigen Schwindel gepackt, der mich augenblicklich zurückwarf. Jonas griff mir ungefragt unter die Arme und half mir mit hochgezogenen Brauen in eine aufrechte Position. »Wie bist du überhaupt reingekommen?«
»Während du hier im Alkoholkoma lagst, stand deine Tür sperrangelweit offen«, blaffte er und schob seine Brille auf der Nase zurecht. »Herrgott, Max, ausgerechnet zu dieser Zeit. Musst du immer so verantwortungslos sein?«
Diese Leier wieder …
»Ja, ja«, nuschelte ich, massierte mir die Stirn und schaute mich kurz um.
Erleichtert stellte ich fest, dass ich auf meinem eigenen alten, dunkelbraunen Cordsofa saß. Ich war letzte Nacht folglich zuhause angekommen. Und auch wenn ich es offensichtlich nicht ins Bett geschafft hatte, war ich dieses Mal wenigstens vollständig bekleidet.
Vielleicht gab ich heute Morgen – oder war es Mittag? – ein jämmerliches und etwas zerknautschtes Bild ab, aber Jonas hatte mich bereits in sehr viel prekäreren Situationen vorgefunden. Mein heutiger Zustand war bei genauerer Betrachtung fast schon mustergültig. Wieso also die tiefen Sorgenfalten in seiner sonst so von gesundem Lebensstil und teuren Cremes makelloser Gesichtshaut?
Ein herzhafter Hustenanfall überkam mich, bevor ich nachhaken konnte. Ich angelte die verbeulte Zigarettenschachtel vom Fußboden und kramte zwischen den leeren Flaschen und Snackverpackungen auf dem ramponierten Holztischchen nach einem Feuerzeug.
Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich die Kontrolle über meine zitternden Finger wiedererlangt hatte und mir eine Kippe anstecken konnte. Der erste Zug kratzte ekelhaft in meinem Hals. Doch schon beim Ausatmen entfaltete der blaue Rauch seine beruhigende Wirkung. Seufzend lehnte ich mich in die Kissen zurück.
»Wie ich sehe, läuft dein Plan, dich umzubringen, sehr gut«, konstatierte Jonas, ließ sich neben mir auf der Couch nieder, rümpfte die Nase und musterte mich von oben bis unten. »Du siehst richtig beschissen aus.«
Ich tat es ihm gleich. »Und du siehst wie immer wie ein Steuerprüfer aus.« Ich deutete auf das strenge Ensemble aus Stoffhose, Hemd und Wollpullover. Ganz hervorragend passten seine ordentlich gegelten, hellbraunen Haare dazu. Und die Zeitung, die er sich unter den Arm geklemmt hatte, rundete das steife Outfit letztlich ab. Was die Menschen wohl sagen würden, wenn sie wüssten, dass eine solche Strebertype eines der Wesen war, die sie Dämon nannten?
»Schön, dass wir das geklärt haben. Vielen Dank für deinen Besuch.«
Er blinzelte mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Willst du denn gar nicht darüber reden, was passiert ist? Ich hatte angenommen … na ja, dass es dich wenigstens ein bisschen nachdenklich stimmen würde.« Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Aber wie ich sehe, interessiert dich inzwischen überhaupt nichts mehr.«
Was faselte er da? Ich beäugte meinen ehemaligen Assistenten irritiert. Es war nicht ungewöhnlich, dass er vorbeikam, nach mir sah und Moralpredigten hielt. Es war mir zwar schleierhaft weshalb, aber er tat das schon, seit er vor sechs Monaten in ein anderes Detektivbüro gewechselt hatte. Dieser miese Verräter. Gut, ja, ich konnte ihn drei Monate lang nicht bezahlen – vielleicht waren es auch vier – dennoch war das kein Grund, zu Ian McKenzie, diesem arroganten schottischen Fettsack, zu wechseln, der zu allem Überfluss ein Mensch war.
Jedenfalls sollte es per Gesetz verboten sein, Leuten, für die man nicht mehr arbeitete, auf den Wecker zu fallen. Ständig beschwerte er sich über Gin und Zigaretten, über flüchtige Männerbekanntschaften und ›beabsichtigte Geldknappheit‹ – als würde so etwas existieren – und überhaupt war doch eigentlich alles an mir verachtenswert. Diese Tiraden kannte ich auswendig. Dass er nun jedoch ernsthaft mit mir reden, mir sogar zuhören wollte, war neu. Und überforderte mich in meinem derzeitigen Stadium der zögerlichen Aufwachphase, mehr als man annehmen könnte.
»Was soll ich sagen?«, fragte ich deshalb schulterzuckend. »Ich feiere am Wochenende nun einmal gern. Das ist nicht verboten. Und da kann man schon mal mit einem Kater aufwachen.«
Jonas’ Gesichtsausdruck wurde noch ungläubiger, dann lachte er plötzlich auf und warf die Arme in die Luft. »Du hast es gar nicht mitgekriegt. Das glaube ich jetzt nicht … Du bist so selbstbezogen, versoffen und abgewrackt …«
»Jonas …« Mein Augenrollen beeindruckte ihn nicht.
»… dass du die Schlagzeile der letzten Tage verpasst hast.« Er wedelte mit der Zeitung. »Die Presse, die Polizei, einfach alle reden davon.«
Er knallte die London Times mit der Titelseite nach oben auf meinen Schoß und tippte auf das Foto unter dem reißerisch medienwirksamen Titel ›Prostituierte brutal ermordet, Polizei tappt im Dunkeln‹. Meine Nackenhaare stellten sich augenblicklich auf.
»Was zum Teufel …«, entfuhr es mir und ein Hustenanfall schüttelte mich, weil ich mich vor Schreck am Zigarettenrauch verschluckt hatte. Ungläubig blinzelnd riss ich die Zeitung an mich und betrachtete das Bild genauer.
»42 Jahre alt, einen Meter siebzig groß, sechzig Kilo schwer, schwarzes Haar, graue Augen«, zählte Jonas die Details auf. »Na, kommt dir irgendetwas davon bekannt vor?«
Ich fixierte ihn mit erhobener Braue. Ja, das hätte eine Beschreibung von mir sein können, aber … »Willst du mir etwa sagen, ich sehe aus wie zweiundvierzig?«
Er zuckte unbekümmert mit den Schultern. »Wenn du so weitersäufst …«
Ich verkniff mir einen Kommentar und wandte mich wieder dem Foto der lächelnden Frau – oder vielmehr dem Vorher-Foto des Opfers – zu. Ihr Haar war kürzer als meines und reichte nur bis zu ihren Schlüsselbeinen und ihre Nase war länger, außerdem wirkte ihre Haut teigig und aufgequollen, doch von Weitem hätte man sie durchaus mit mir verwechseln können.
Ich spürte ein merkwürdiges Kribbeln in der Magengegend und versuchte, es mit einem kräftigen Zug an der Zigarette zu unterdrücken.
»Und jetzt?« Ich warf die Zeitung verächtlich auf den Couchtisch zu all dem anderen Müll. »Das ist nicht mehr als ein Zufall. Eine Menge Leute sehen so aus.«
Jonas presste die Lippen aufeinander und nickte wie ein Lehrer, der gerade festgestellt hatte, wie einfältig sein Schüler wirklich war. »Gibt es auch eine Menge Leute, die den gleichen Namen tragen wie du?«, fragte er, schnappte sich die Zeitung, fuhr mit dem Zeigefinger an die richtige Stelle und las vor: »Wie ein Sprecher des Metropolitan Police Service gestern verlauten ließ, handelt es sich dabei um die sterblichen Überreste von Maxine Atwood. Die zweifache Mutter und Witwe war eine ortsbekannte Prostituierte und bei der Polizei bereits aufgrund von Diebstahl, Trunkenheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses aktenkundig.«
Okay, zugegeben, das war ein merkwürdiger Zufall. Allerdings gab es sicherlich einige Leute, die einen 08/15-Namen wie meinen trugen. Ich ließ mir meine Verwunderung nicht anmerken und versuchte mich stattdessen an einem Grinsen. »Oh, ich bin gar nicht einzigartig? Das macht mich wirklich traurig.«
»Ihre aufs brutalste verstümmelte Leiche wurde am Samstagmorgen in ihrem eigenen Bett in dem von ihr und ihrer kleinen Tochter bewohnten Ein-Zimmer-Appartement in der Brushfield Street von einem Nachbarn entdeckt«, las Jonas weiter, erst dann ließ er die Zeitung mit erschütterter Miene sinken.
»Brushfield Street? Das ist in Whitechapel …«, murmelte ich, bevor ich mich bremsen konnte.
»Kann sein. Worauf willst du hinaus?«, wollte Jonas wissen.
Wieder spürte ich dieses Ziehen. Irgendetwas tief in meinem Inneren brüllte schmerzerfüllt auf und eine sorgfältig weggesperrte Erinnerung rüttelte an ihren Gitterstäben. Aber das war unmöglich. Dieser Mord konnte nichts mit den Geschehnissen von damals zu tun haben. Es war so lange her …
Nein. Ich massierte die schmerzende Stelle, unter der mein Herz gegen die Rippen hämmerte, und ließ die Zigarette in eine halbleere Bierflasche fallen, wo sie zischend erlosch. Diese Erinnerung durfte nicht rauskommen. Sie und all die überflüssigen Gefühle, die mit ihr verbunden waren, mussten umgehend dorthin zurück, wo sie hingehörten: in den finstersten, ginüberfluteten Teil meines Gedächtnisses.
Ich bemerkte, wie stark meine Finger zitterten, als ich nach der Ginflasche griff, weshalb ich nicht den Umweg über ein Glas nahm, sondern mir die klare Flüssigkeit direkt in die Kehle schüttete. Der Alkohol breitete sich angenehm warm in meine Glieder aus, beruhigte mich allerdings wenig.
Jonas’ vorwurfsvollen Blick auf die Flasche ignorierte ich geflissentlich. Normalerweise trank ich morgens ja auch nicht, kein Grund, ein Drama daraus zu machen.
»Ich will auf nichts hinaus«, antwortete ich. »Nur ein Zufall.«
»Du denkst doch an etwas Bestimmtes, Max?« Seine intelligenten Augen waren durchdringend auf mich gerichtet. Jonas suchte in meiner Miene nach Antworten, würde aber wie immer keine finden. »Wieso kommt es mir so vor, als wollte jemand deine Aufmerksamkeit erregen oder dir drohen?« Angst mischte sich unter die Neugier, als ihm eine dritte Möglichkeit einfiel: »Hat dich der Mörder mit dieser Frau verwechselt? Will dich vielleicht einer umlegen?«
»Miss dem Ganzen keine überzogene Bedeutung bei, es ist nur ein …«
»Dein Gesicht ist leichenblass. Gib es zu, du glaubst selbst nicht an einen Zufall.« Er drückte mir freundschaftlich den Arm. »Bitte sag es mir, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ich kann dir helfen.«
Ich schaute ihm einen Herzschlag lang abwägend ins Gesicht. War heute der Tag, an dem ich ihm alles erzählen würde?
Ich war nie das gewesen, was man gemeinhin als ›gute Freundin‹ bezeichnete. Nicht einmal, wenn man das ›gut‹ durch ein ›gerade noch wert, so genannt zu werden‹ ersetzte. Dennoch hatte ich jemanden, der für mich da war und den ich ›Freund‹ nennen durfte – verrückt … Vor allem, weil sich unsere Freundschaft eher wie ein schlechter Scherz anhörte: Eine abgewrackte Gefallene, die wegen Mordes aus der Oberwelt verbannt worden war und ein moralisch mustergültiger Dämon, der sich seit seiner Flucht aus der Unterwelt als vollwertiger Mensch ansah, vertraten das Gesetz in der Menschenwelt …
Ich zeigte es selten und auch wenn er definitiv eine bessere Freundin verdiente: Ich war froh, dass ich zumindest einem Kerl auf der Welt nicht völlig gleichgültig war. Und genau deshalb musste ich Jonas aus meinem Scheiß heraushalten. Er kümmerte sich schon genug um mich, unnötig, ihn zusätzlich mit meiner Vergangenheit zu belasten. Er würde mir ohnehin bloß helfen wollen und wäre danach frustriert, weil er das nicht konnte. Niemand konnte das. Außerdem hatte ich keine Lust darauf, diesen alten Müll aufzurollen …
Also winkte ich betont unbekümmert ab. »Ich bin blass, weil ich – im Gegensatz zu dir – weiß, wie man feiert.« Grinsend zwinkerte ich ihm zu. »Du solltest dich mal wieder volllaufen und flachlegen lassen, dann würdest du verstehen, wie man einen Tag lang die Nachrichten verpassen kann.«
Er hob die Brauen. »Ich bin verlobt, wie du dich vielleicht erinnerst.«
»Und deshalb darfst du keinen Spaß haben?«
Er klopfte mir mit einem süffisanten Grinsen auf die Schulter. »Die Leiche ist am Samstagmorgen gefunden worden. Heute ist Montag.«
»Ach so.« Ich warf einen Blick aus dem Fenster. Die Sonne, die hoch am Himmel stand, deutete darauf hin, dass es bereits nach Mittag war. Mist. Wenn wir heute tatsächlich Montag hatten, war ich verdammt spät dran …
»Seit dieser Sache versuche ich, dich zu erreichen«, fügte Jonas vorwurfsvoll hinzu. »Seit zwei Tagen, Max! Gehst du überhaupt nicht mehr an dein Handy?«
»Nein, eher selten, Mum. Die meisten Leute, die mich anrufen, sind tierische Nervensägen.« Dabei fielen mir spontan zwei solcher Menschen ein: mein Vermieter und meine einzige Klientin. Stöhnend massierte ich mir die pochenden Schläfen. »Ich sollte mich allmählich an die Arbeit machen.« Um mir beide vom Hals zu halten und gleichzeitig Jonas loszuwerden, fügte ich in Gedanken hinzu.
Er hob die Brauen. »Du hast tatsächlich noch Klienten?«
»Verzieh dich endlich, Jonas.«
Als er mich weiterhin nur kopfschüttelnd beäugte, überlegte ich, ob ich schlichtweg aufstehen und ihn sitzenlassen sollte, aber ich traute meinen Beinen nicht. Wenn sie so wacklig waren wie meine Hände zittrig, würde ich wohl eher davonkriechen müssen. Also entschied ich mich zunächst für ein zweites Frühstück, griff nach der Zigarettenschachtel und steckte mir eine Kippe an. Den Rauch blies ich meinem ehemaligen Assistenten provozierend ins Gesicht. Es wirkte.
»Dir ist einfach nicht zu helfen.« Er erhob sich und machte zwei Schritte auf die Tür zu, bevor er erneut stehenblieb, sich umdrehte und vage um sich zeigte. »Du hattest doch mal eine Putzfrau. Wo ist die abgeblieben?«
Eigentlich war Darlene meine Mitbewohnerin gewesen – als ob ich mir das Appartement und dann noch eine Putzfrau leisten könnte! Sie kam über eine Agentur zu mir, kümmerte sich eine Weile um unsere Behausung, die gleichzeitig mein Büro war, hatte aber bald schon die Nase voll davon. Und da die Agentur niemand Neues schickte, hatte sie dort wohl keine besonders gute Bewertung für mich hinterlassen … Das musste Jonas jedoch nicht wissen.
Ich schaute mich in dem Dreckloch, das mein Vermieter als ›Wohnung‹ bezeichnete, kurz um. Es gab Behausungen, in denen mehr Abfall auf dem Fußboden als im Mülleimer liegen musste – das gehörte in derartigen Preislagen nun einmal zum guten Ton. Davon abgesehen wurde heutzutage alles doppelt und dreifach verpackt, sodass ein ordentlicher Haufen Müll gar nicht zu vermeiden war.
»Keine Ahnung«, antwortete ich schulterzuckend. »Vielleicht hat sie im Lotto gewonnen und lebt jetzt in einem Stelzenbungalow auf Borneo.«
»Vielleicht wurde sie von einer Mülllawine begraben und verwest hier irgendwo. Würde den Geruch erklären«, murmelte Jonas.
»Bist du jetzt endlich fertig mit deinen Vorträgen und kümmerst dich um deinen eigenen Kram?« Ich funkelte ihn zornig an. »Du arbeitest nicht mehr hier. Wieso kommst du also immer wieder her?«
»Das weiß ich allerdings auch nicht.« Er drehte sich um und marschierte zum Ausgang. »Schließ ab jetzt gefälligst deine verdammte Tür ab.«
»Vergiss dein Revolverblatt nicht.« Ich griff nach der Zeitung, um sie ihm nachzuwerfen, blieb jedoch an dem Foto meiner Doppelgängerin hängen.
Maxine Atwood – sie hatte das Alter, den Beruf, den Background und wohnte in der Gegend … So gern ich wollte, ich konnte es nicht ignorieren. Ein eisiger Schauer glitt über meinen Rücken und ich zuckte ungewöhnlich schreckhaft zusammen, als die Tür hinter Jonas ins Schloss fiel.
Erneut griff ich nach der Ginflasche, im Versuch die aufkommenden Gefühle zu betäuben und die uralte Erinnerung zurückzudrängen. Hundertdreißig Jahre waren inzwischen vergangen. Es musste ein bizarrer Zufall sein. Oder ein Trittbrettfahrer.
»Reiß dich zusammen«, fauchte ich mich selbst an. »Stell dich nicht an wie ein kleines, ängstliches Schulmädchen!«
Ich pfefferte die Zeitung abfällig in eine Ecke, angelte die Fernbedienung vom Couchtisch und schaltete den Fernseher an, um mich abzulenken.
»Die Frau wurde am Samstagmorgen in ihrem Appartement tot aufgefunden«, berichtete der Nachrichtensprecher, ein junger Mann mit krummer Nase und schütterem Haar. »Aufgrund der entstellenden Verletzungen im Gesicht geht die Polizei davon aus, dass sich der Mörder und sein Opfer gekannt haben …«
Brummend schaltete ich die Glotze ab, warf die Fernbedienung zur Zeitung in die Ecke und ließ die Zigarette in die zum Aschenbecher umfunktionierte Bierflasche fallen. Dann machte ich mich schwankend auf ins Badezimmer. Die Arbeit rief und zum ersten Mal seit langem war das etwas Gutes. Sie würde mich auf andere Gedanken bringen.
Der Wind fegte scharf durch die Straße und wirbelte die vertrockneten Blätter eines Baums am Wegesrand auf. Fröstelnd zupfte ich am Kragen meines Trenchcoats. Herbst in London. Das war nicht anders als Frühling, Sommer oder Winter in London. Wenn es nicht stürmte, schneite es. Wenn es nicht schneite, dann regnete es. Und wenn es nicht regnete, zog Nebel auf.
Immerhin war stets das richtige Wetter für Trenchcoat und Hut, was glücklicherweise auch wieder en vogue war. Nicht, dass ich ein Faible für Mode gehabt hätte, dieses Outfit war nur schon seit über fünfzig Jahren meine Berufskleidung – in dieser Hinsicht war ich altmodisch. Und wie eine Detektivin auszusehen war doch sehr viel unauffälliger, wenn es plötzlich jeder tat.
Meine Finger zitterten, als ich in meinem Kaffee rührte. Ich konnte nicht genau sagen, ob es vom Alkoholentzug oder von der Grübelei kam. Dieser Mord verursachte eine innere Unruhe in mir, wie ich sie lange nicht gespürt hatte, weshalb ich mit aller Kraft versuchte, nicht daran zu denken.
Stattdessen konzentrierte ich mich auf das unbequeme Stahlgestell des Stuhls, auf dem ich saß, den ungenießbaren Kaffee, an dem ich seit einer halben Stunde nippte und die Menschen, die mit gestressten Mienen vorbei an dem kleinen Café, vor dem ich saß, über den Bürgersteig hasteten.
Einige von ihnen waren ganz unterhaltsam. Zum Beispiel dieser Kerl mit der Lederjacke und dem Rattengesicht. Schon als ich ihn um die Ecke biegen sah, wusste ich, was er vorhatte. Gut zu wissen, dass mein Instinkt noch funktionierte, auch wenn ich ihn so gut wie nie gebrauchte. Wie ich nicht anders erwartet hatte, rempelte er eine ältere Frau an und zog das Portemonnaie aus ihrer Handtasche, während er sich wortreich bei ihr entschuldigte. Die Dame nickte lächelnd und zockelte unbeschwert weiter.
Ich schaute dem Kerl nach, bis er um die nächste Ecke gebogen war, wo er vermutlich ein neues Opfer im nachmittäglichen Gewimmel der Shoppingverrückten fand, dann warf ich mal wieder einen Blick auf das hässliche Bürogebäude gegenüber. Schließlich saß ich wegen meiner Zielperson hier. Alles andere war nicht mein Business.
Früher wäre ich aufgesprungen und dem Rattengesicht in bester Superheldenmanier nachgelaufen, um das Portemonnaie zurückzuholen und der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Nun ja, die Zeiten änderten sich. Ich war eben nicht mehr die heroische Soldatin wie einst in der Oberwelt, sondern lediglich eine Versagerin, die versuchte, irgendwie in diesem stinkenden Dungepfuhl zu leben, bis mein Körper endlich gegen den Gin aufgab. Und was konnte ich mir schon von solcherlei Aktionen kaufen? Bei der alten Dame wäre nicht mehr drin als ein feuchter Händedruck und ein halbgares Dankeschön. Und dafür hätte ich meinen Posten, für den ich bezahlt wurde, verlassen sollen? Eine unsinnige Rechnung.
Ich nippte noch einmal an dem bitteren Kaffee, verzog das Gesicht und kramte daraufhin mein Smartphone aus der Jackentasche. Welch wunderbare neue Technik – für Fotos von meiner Zielperson musste ich keine Kamera mehr mit mir herumschleppen. Zumal die Ehefrau dieses Idioten den Unterschied ohnehin nicht erkennen würde. Sie merkte schließlich ebenfalls nicht, dass ich sie gehörig über den Tisch zog.
Es brach nun bereits die dritte Woche an, in der ich dem Fettwanst nach Feierabend auflauerte und in den Pub folgte. Es war immer dasselbe: Punkt siebzehn Uhr verließ er den hässlichen grauen Betonklotz von Bürogebäude, schlenderte in den Pub zwei Straßen weiter, genehmigte sich dort vier Pints und wankte daraufhin nach Hause. Ich machte jeden Tag exakt fünf Schnappschüsse – drei auf dem Weg und zwei im Pub. Ich blieb schon gar nicht mehr, bis er sich auf den Nachhauseweg machte, denn es war offensichtlich, dass dieser grässliche Fladen von einem Mann keine Affäre hatte. Ich fragte mich ernsthaft, wie seine Frau auf die absurde Idee kam, eine andere wäre blind und taub genug, sich von ihm besteigen zu lassen.
Wie auch immer, es war mir gleichgültig. Sie hatte mich aus diesem eifersüchtigen Grund engagiert und ich beschwerte mich nicht, denn immerhin konnte ich täglich vier Stunden Arbeit auf die Rechnung setzen. Damit wurden alle Parteien glücklich.
Der Kerl, der sich an das Tischchen nebenan gesetzt hatte, raschelte mit seiner Zeitung. Das Geräusch fuhr regelrecht in all meine Nervenenden, sodass ich mich schmerzerfüllt wand und das Gesicht verzog. Augenblicklich erschien das Foto meiner Doppelgängerin vor meinem inneren Auge und mein Herz begann, schneller zu schlagen.
Anscheinend konnte ich noch so oft versuchen, die Geschichte auszublenden, sie ließ sich nicht vertreiben. So ein Mist. Demnach blieb mir nichts anderes übrig, als in den Angriff überzugehen. Ich würde mich davon überzeugen müssen, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hatte. Ich würde für mich selbst klarstellen müssen, dass meine tödliche Unfähigkeit, die nicht nur Menschenleben gekostet, sondern meine gesamte Zukunft zerstört hatte, nichts weiter als eine ferne Erinnerung war. Ich konnte sie getrost in die dunklen Ecken meines Verstandes zurückdrängen und sie musste nie wieder herauskommen. Vorher ließen mich die Gedanken wohl nicht mehr los.
Seufzend rief ich die Kontakte in meinem Handy auf und scrollte mich zu Brians Nummer durch. Brian Hutchins war Detective Chief Superintendent, mein wichtigster Kontaktmann bei der Metropolitan Police und er stellte keine Fragen. Zumindest so lange wie ich … nun, nennen wir es ›freundlich‹, so lange wie ich freundlich zu ihm war.
Ich fragte mich oft, wieso er sich derart von mir um den Finger wickeln ließ, aber er würde mir bei einem unserer Dates garantiert gern mehr über den Fall erzählen. Und über die andere Maxine Atwood – Mutter und Prostituierte, Alkoholikerin und verlorene Seele …
Mich fröstelte. Ich hatte sehr viel mehr Gemeinsamkeiten mit dem Opfer, als ich zunächst angenommen hatte. Sehr viel mehr, als mir lieb war.
Ich atmete tief durch, als ich Brians Nummer anwählte und zuckte regelrecht zusammen, als er nach drei Mal Klingeln ranging. Was war nur los mit mir? Ich verhielt mich wie ein ängstliches Kind – das musste sofort aufhören.
»Hallo, schöne Frau«, raunte Brian und verfiel in eine übertrieben kehlige Tonlage. »Endlich rufst du zurück.«
Er hatte ebenfalls versucht, mich zu erreichen? Auch seine Versuche waren an mir vorbeigegangen. »Hattest du Sehnsucht nach mir?«
»Jede Nacht«, erwiderte er.
Ich gebe zu, ich konnte diesen Kerl gut leiden. Es war angenehm, Zeit mit ihm zu verbringen. Er war zuvorkommend, lustig und ein weitaus weniger selbstbezogener Liebhaber als die meisten anderen Männer, die ich traf.
»Aber das war dieses Mal nicht der Grund. Sondern Maxine Atwood, das Mordopfer von Samstagmorgen.«
Wenn das kein Zufall war. »Ihretwegen rufe ich an – ich würde gern den Bericht des Rechtsmediziners lesen.«
Brian zögerte. Er zierte sich, wie immer, wenn ich ihn um solcherlei Dinge bat. Aber wir wussten beide, dass er früher oder später einknicken würde. »Das ist nichts für schwache Mägen, Süße.«
Ich rollte mit den Augen. Für den harten Inspector spielte ich oft das hilfsbedürftige Mädchen, weil er irgendwie darauf stand, aber ich hasste es, wenn er mich Süße nannte. Ich war eine zweihunderteinundzwanzigjährige Soldatin aus einer anderen Welt, Himmelherrgott, und dieser Mensch nahm mich einfach nicht für voll.
Ob es das war, was ihn dazu brachte, mir immer wieder so freigiebig Ermittlungsdetails zu verraten? Er glaubte, dass ich Detektivin geworden war, weil ich mich nach ein bisschen Action in meinem trüben Langweilerleben sehnte, und wollte mich deshalb mit seinem spannenden Polizistendasein beeindrucken. Nun ja, wenn es mir half, um an Informationen zu kommen, sollte er das ruhig denken.
»Sag es mir lieber gleich: Hat diese Sache irgendetwas mit dir zu tun?« Seine Stimme nahm den strengen Klang eines Polizisten an. »Ich meine, der gleiche Name, das ähnliche Äußere … Hast du dir Feinde gemacht? Du kannst mit mir reden, Max.«
»Garantiert nicht. Der Name ist purer Zufall, hat mich aber selbst neugierig gemacht. Und du weißt, ich unterstütze die Polizei immer gern bei ihren Ermittlungen.«
»Aha … Nun ja, dafür sind wir natürlich dankbar, aber es geht hier um Mord und …«
Er zögerte erneut und ich konnte es ihm nicht einmal verdenken. Ich war vielleicht eine gute Detektivin gewesen, irgendwann, vor ungefähr hundert Jahren. Heute konnte ich an manchen Tagen nicht einmal meine eigenen Schuhe finden, geschweige denn einen Mörder.
»Ich werde mich nicht einmischen, ich möchte nur ein wenig mehr über die Frau mit meinem Namen erfahren. Du weißt, du kannst mir vertrauen.«
»Das ist keine gute Idee, Süße. Die Sache ist echt übel.«
»Komm schon, Brian«, bettelte ich mit meiner verführerischsten Mädchen-Stimme. »Ich wäre dir wirklich dankbar. Und damit meine ich äußerst und langanhaltend dankbar. Wie lange habe ich eigentlich nicht mehr für dich gekocht?«
Die Antwort lautete: noch nie. Aber wir beide wussten, was der Code bedeutete.
Er sog scharf die Luft ein. »Ich sehe, was ich tun kann. Aber denk nicht mal daran, auf eigene Faust zu ermitteln, Maxine. Wir haben alles im Griff, verstanden? Wir sind die Polizei.«
»Geht klar. Danke, Süßer.« Ich grinste, bis ich bemerkte, wie meine Zielperson gegenüber von mir das Bürogebäude verließ. »Scheiße, ich muss auflegen.«
Ich beendete das Gespräch, schoss einige Fotos von dem untersetzten Kerl mit Schnauzer und folgte meiner Zielperson schließlich in einigem Abstand in den Pub. Das Ecklokal war sehr viel größer, als es von außen den Anschein machte, und die Einrichtung bestand fast ausschließlich aus dunklem Holz und buntem Glas – man fühlte sich beinahe wie in einer Kirche. An der Theke bestellte ich einen Gin Tonic und setzte mich damit in die hinterste Ecke des Raumes, von wo aus ich den Kerl beobachten und zwei weitere Bilder schießen konnte. Damit war die Arbeit für heute erledigt. Zufrieden nippte ich an meinem Drink.
***
Ungefähr eine Stunde und zwei Gin Tonic später beobachtete ich den Kerl immer noch. Keine Ahnung wieso. Er saß ganz friedlich da und presste sich ein Pint nach dem anderen rein. Der Typ schien ein noch größeres Problem zu haben als ich. Wie es aussah, waren sein Leben und seine Ehe nur im Suff zu ertragen. Aber ich würde mich hüten, meine Meinung kundzutun. Das war schließlich nicht meine Angelegenheit. Ich war Detektivin, keine Eheberaterin, wurde für Fotos bezahlt, nicht für meine Meinung. Und die Zeit, in der mir die Leute nicht gleichgültig gewesen waren, war längst vorbei.
Nach der Verbannung aus meiner Heimat hatte es eine Phase gegeben, da wollte ich den Menschen ernsthaft helfen. Nicht nur aus Nächstenliebe, sondern weil ich darin meine einzige Chance gesehen hatte, nach Hause und zu meiner Familie zurückzukommen. Es wäre meine Strafe und meine Chance, hatte König Edwin gesagt. Wenn ich meine Verfehlung wiedergutmachte, indem ich die Menschen beschützte, ihre Welt von Unheil befreite, dann würde er mich begnadigen.
Und das alles wegen einer Tat, die ich nicht begangen hatte … Dennoch fügte ich mich meinem Schicksal, wollte das Elend in der Menschenwelt aufhalten, aber sie waren nicht mehr zu retten. Genauso wenig wie ich selbst.
Ich hatte versagt, damals, als dieses Monster London terrorisiert hatte. Ich konnte den Menschen nicht helfen. Ich konnte ja nicht einmal mir selbst helfen.
Ich trank eben mein Glas leer, da kündigte mein Handy eine neue E-Mail an. Sie war von Brian. Mit klopfendem Herzen nahm ich das Gerät vom Tisch und las die Nachricht.
Max, ich warne dich, diese Sache ist nichts für schwache Nerven ...
Er schickte mir den Bericht wohl aus dem einfachen Grund, dass dieser mich abschreckte, mich davon abhielt, der Sache weiter nachzugehen, und ich somit der Metropolitan Police nicht mit meinen eigenen Ermittlungen in die Quere kam. Allerdings hatte ich gar nicht vor, in einem Mordfall zu ermitteln. Schließlich hatte ich weder die Möglichkeiten eines Polizeibeamten noch wurde ich dafür bezahlt. Ich wollte lediglich Gewissheit …
Ich tippte auf den ersten der beiden Anhänge, es war ein Auszug des Tatortberichts, und begann zu lesen:
Der Leichnam liegt nackt in der Mitte des Bettes, der linke Arm nah am Körper, Unterarm über dem Unterleib, der rechte Arm leicht abgespreizt und ausgestreckt, Finger verkrampft, Beine gespreizt.
Die gesamte Oberfläche des Unterleibs und der Schenkel wurden entfernt sowie die inneren Organe der Bauchhöhle entnommen. Die Brüste wurden entfernt, die Arme durch mehrere gezackte Wunden verstümmelt und das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten. Das Gewebe des Halses wurde bis auf den Knochen rundherum komplett abgetrennt.
Die inneren Organe sind im Raum verteilt: Gebärmutter, Nieren und eine Brust unter dem Kopf, die andere Brust neben dem rechten Fuß, die Leber zwischen den Füßen, die Gedärme auf der rechten und die Milz auf der linken Seite des Körpers, die vom Unterleib und von den Schenkeln entfernten Hautlappen auf einem Tisch.
Der Bettbezug ist in der rechten Ecke mit Blut durchtränkt und auf dem Boden darunter befindet sich eine Blutlache. Die Wand auf der rechten Seite des Bettes, in einer Linie über dem Hals, ist mit einigen Spritzern verschmiert.
Ich legte das Handy mit dem Display nach unten auf den Tisch, schluckte und atmete tief durch, um die aufkommende Übelkeit zu vertreiben. Das Bild, das sich durch diese nüchternen Worte in meinem Kopf geformt hatte, war ein Gemälde des Grauens. Und schlimmer noch: Es befreite eine längst verdrängte Erinnerung, platzierte das Opfer auf einem alten Holzbett, gab ihm blondes, blutverkrustetes Haar …
Ich schüttelte den Kopf, verscheuchte die Gedanken und atmete noch einmal durch, ehe ich die zweite angehängte Datei öffnete. Dabei handelte es sich um die Untersuchung des Gerichtsmediziners.
Das Gesicht weist zahlreiche, tiefe Einschnitte auf. Nase, Wangen, Augenbrauen und Ohren wurden teilweise entfernt. Der Hals wurde bis auf die Rückenwirbel durchtrennt, die Hauteinschnitte an der Vorderseite zeigen ausgeprägte Ekchymose, die Luftröhre ist am unteren Teil des Kehlkopfes eingeschnitten.
Beide Brüste wurden durch kreisförmige Schnitte entfernt. Die Brust- und Bauchwand wurde zwischen vierter, fünfter und sechster Rippe durchtrennt, wodurch der Inhalt des Brustkorbes sichtbar ist. Beim Öffnen desselben stellte sich heraus, dass ein Teil der Lunge zerstört und weggerissen, der Herzbeutel unterhalb geöffnet ist und das Herz fehlt.
Ich konnte nicht weiterlesen. Ich sprang auf, stürzte zu den Toilettenräumen, warf mich vor einem der Klos auf die Knie und würgte. Ich hatte heute nicht viel mehr als eine Handvoll Chips, Kaffee und Gin zu mir genommen, es kam mir also nur saure, brennende Flüssigkeit hoch. Mein Magen krampfte derart, dass ich das Gefühl hatte, er versuchte, sich aus meinem Körper zu winden. Außerdem brach kalter Schweiß auf meiner Stirn aus. Und zu allem Überfluss fühlte ich mich urplötzlich stocknüchtern.
Als nichts mehr hochkommen wollte, ließ ich mich auf die kalten Fliesen sinken, lehnte mich an die Trennwand und konzentrierte mich aufs Atmen. Ich schnaufte, als hätte ich einen Marathon hinter mir. Fühlte mich auch ein wenig so.
Ich besaß keinen schwachen Magen. In meinem langen Dasein hatte ich schon viel erlebt und viel gesehen, vor allem in meiner Zeit als Soldatin.
Die Menschen nannten die Welt, aus der ich stammte und verbannt wurde, Himmel oder Oberwelt. In der festen Überzeugung, dort gäbe es einen Kerl namens Gott und es herrschte ewiger Frieden. Das konnte ich nicht bestätigen. Vielleicht hatten wir manches mit diesen sogenannten Engeln gemeinsam, aber vor allem waren wir unserem Herrscher gegenüber loyal. Auch in meiner Welt gab es mehrere Könige und demnach Kriege. Schlachten, die weitaus grausamer und blutiger waren als diejenigen, die ich seit hundert Jahren in der Menschenwelt beobachtete. Im Grunde sah ich schon mein ganzes Leben lang dabei zu, wie sich Leute die Köpfe einschlugen und zu was sie anderen gegenüber fähig waren. Es waren nicht das verstümmelte Opfer oder die Tat an sich, die mir den Magen umdrehten – es war die Tatsache, dass ich die Vorgehensweise des Täters wiedererkannte.
1888 war schon einmal eine Frau auf die gleiche Weise aufgefunden worden. Ihr Name war Mary Jane Kelly. Sie war das letzte Opfer eines Monsters, das ›Jack the Ripper‹ genannt wurde. Diesem Mistkerl hatte ich es zu verdanken, dass ich nie wieder nach Hause zurückdurfte, geschweige denn meinen Frieden finden würde. Ich hatte kein anderes Wesen jemals derart gehasst wie ihn.
Ich atmete tief ein, tief aus, und versuchte, die Erinnerung fortzuschieben. Wie so oft, wenn ich mit dem Ripper konfrontiert wurde. Das Perverse an der Sache war, dass die Menschen heute noch von ihm fasziniert waren. Er war ein Mysterium, ein Geist – und ihren Leben so fern, wie es nur irgendjemand sein konnte. Ich würde mich nicht wundern, wenn sich ein beliebiger Idiot diesen Geisteskranken zum Vorbild genommen hätte.
Oder konnte es sein …? Nein! Der echte Ripper war nicht wiedergekehrt. Wo sollte er denn die vergangenen einhundertdreißig Jahre gesteckt haben? Es musste ein Trittbrettfahrer sein. Kein Mensch wurde so alt und kein Gefallener oder Dämon konnte sich so lange vor mir verstecken. Dafür hatte ich zu gute Quellen.
Schwankend hievte ich mich hoch, dann torkelte ich zurück zu meinem Platz, um mein Handy einzusammeln, und verließ schließlich den Pub in Richtung meiner Wohnung.
***
Bereits an der Haustür hörte ich Bonds zornige Stimme und das Geräusch seiner hämmernden Fäuste an meiner Wohnungstür. Anders als der Name vermuten ließ, war Ralph Bond kein schnittiger, gutaussehender Agent im Anzug, sondern vielmehr ein übergewichtiger Mann im schmuddeligen Mantel, der sich vielleicht einmal im Monat rasierte. Was etwas merkwürdig war, wenn man bedachte, wie viele Gebäude er in der Gegend um die U-Bahn-Station Angel in Islington besaß.
Als ich eingezogen war, hatte ich es fast schon poetisch gefunden, hier zu leben. Als Gefallene aus einer Welt, in der die Menschen geflügelte Wesen namens Engel vermuteten … Allerdings spielte die Wohnlage keine Rolle, wenn man nicht mehr fähig war, die Miete rechtzeitig zu bezahlen. Ob man nun ein Engel war oder nicht.
»Ich weiß, dass du da drin bist, Maxine!« Bonds Stimme schallte vom zweiten Stockwerk herab. »Mach die Tür auf!«
Ich hatte definitiv keine Lust, da jetzt hochzugehen.
»Am Freitag hab ich deine Miete, ist das klar? Sonst breche ich die Tür auf und befördere deinen knochigen Arsch höchstpersönlich hier raus, kapiert? Und nimm endlich dieses stinkende Ding von deiner Matte!«
Stinkendes Ding? Mir schwante Böses, allerdings war es zunächst an der Zeit, mich unsichtbar zu machen. Langsam ging ich aus der Tür und huschte auf die andere Straßenseite, wo ich mich an einen Zeitungskiosk stellte, die Mütze in die Stirn zog und so tat, als studierte ich die Cover der Zeitschriften, während ich die Haustür beobachtete.
Es dauerte nicht lange, da stürmte Bond aus der Tür. Ich könnte schwören, er hatte Schaum vorm Mund und seine Augen glühten rot. Allerdings waren der Vermieter und sein Vorhaben, mich zu erwürgen, momentan meine geringste Sorge.
In weiser Voraussicht hatte ich auf dem Heimweg eine Flasche Gin erstanden, in der festen Absicht, den heutigen Tag aus meinem Gedächtnis zu tilgen. Und morgen, wenn ich verkatert erwachte, war das alles nicht passiert. Ich wollte es nicht noch einmal erleben, konnte es einfach nicht.
Mein Blick glitt zu den Zeitungen. Auf drei von fünf Titelseiten stach mir das Foto meiner Namensschwester ins Auge und ließ einen eisigen Schauder über meinen Rücken fahren. Keuchend wandte ich mich ab und marschierte zu dem großen, wenig englisch anmutenden Betonklotz hinüber, in dem ich lebte. Den Briefkasten ließ ich Briefkasten sein, für gewöhnlich erhielt ich ohnehin keine erfreulichen Nachrichten, und stapfte die Treppe in den zweiten Stock hinauf.
Je näher ich kam, desto deutlicher roch ich ›das stinkende Ding‹. Es war ein Geruch, den ich nicht sofort einordnen konnte, der mir aber grauenhaft bekannt vorkam. Unwillkürlich stellten sich die Härchen an meinen Armen auf.
Ich konnte nichts dagegen tun, meine Beine bewegten sich von selbst, obwohl ich mich am liebsten umgedreht und aus dem Staub gemacht hätte. Und nie mehr wiedergekommen wäre. Wie ferngesteuert ging ich zu meiner Wohnungstür und bückte mich zu dem Päckchen aus grauem Papier, das fein säuberlich mit brauner Paketschnur umwickelt war. Ich wollte es eben hochheben, da sah ich es: Ein Wort in ordentlich geschwungener Handschrift befand sich in der oberen rechten Ecke des Pakets. Ich fror vor meiner Wohnungstür förmlich ein.
Die Handschrift erkannte ich nicht, das hatte ich nie, denn sie war verstellt gewesen. Doch stets hatte dieses eine Wort in der oberen rechten Ecke jedes Pakets, jedes Briefs, jeder Postkarte gestanden.
Überraschung!
Alles in mir wurde kalt und taub. Ich wusste nicht, wie lange ich das Päckchen anstarrte, bis ich es endlich in die Hände nehmen und damit in die Wohnung gehen konnte.
Ich wusste, was sich darin befand. Da konnte ich noch so sehr hoffen, dass ich mich irrte.
2. Spiel mit mir
Ich stellte das Päckchen und die Ginflasche nebeneinander auf den Couchtisch und beäugte beides im Wechsel. Dann beschloss ich, mir ein Glas zu holen.
Ich bewegte mich wie im Nebel, kurzzeitig überlegte ich sogar, ob ich bloß träumte und wie ich mich dazu bringen könnte, aufzuwachen. Ohne recht mitbekommen zu haben, dass ich zum Küchenschrank gegangen war, setzte ich mich auf die Couch, füllte das Wasserglas mit Gin und trank einen kräftigen Schluck. Dann nahm ich meine Schiebermütze ab, streifte den Trenchcoat über meine Schultern und legte beides über die Sofalehne.
Das Päckchen ließ ich dabei keinen Moment aus den Augen. Die Anwesenheit dieses Dings war unangenehm, fast unheimlich. Ich konnte den Blick nicht davon abwenden, als würde es zubeißen, wenn ich wegsah. Wer weiß, vielleicht täte es das sogar.
Überraschung!
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die ordentliche, geschwungene Handschrift gehörte einer Frau. Vor allem nach den Punkten über dem Ü zu urteilen, die aussahen wie kleine Kringel.
Überraschung!
Das wirklich Überraschende daran war, dass es mich nicht sonderlich überraschte. Es gab keinerlei plausible Gründe für das, was hier geschah, und doch hatte ich das Gefühl, es hatte so kommen müssen. Verrückt …
Ich trank einen weiteren Schluck Gin, atmete tief durch und griff schließlich nach der Schnur. Vorsichtig löste ich den Knoten und wickelte das Paket auf. Ein bestialischer Gestank stach mir in die Nase und ätzte sich in meine Lungen. Metallisch und beißend zugleich – Blut und Alkohol. Eine Kombination, die mir schon damals den Magen umgedreht hatte.
Ich zog das Papier auseinander, blickte ins Innere des Päckchens und war wieder nicht sonderlich überrascht. Angeekelt, aber nicht überrascht. In einer durchsichtigen Plastikbox mit Luftlöchern lag ein blutiges, fleischiges Etwas, das seinem Geruch nach in Alkohol eingelegt gewesen war. Ich musste nicht Sherlock Holmes heißen, um darauf zu kommen, dass dies das Herz war, das im Leichnam der anderen Maxine Atwood fehlte.
Er hatte es aus ihrem Torso gerissen, eingelegt, verpackt und schließlich an mich geschickt. Und ich wusste auch wieso.
Ich spülte die Übelkeit mit einem großen Schluck Gin hinunter, dann nahm ich den Brief aus dem Paket und schob das Herz aus meinem Blickfeld. Ich hasste seine Geschenke. Aber mehr noch hasste ich seine Briefe. Mich fröstelte bei dem Gedanken, die widerlichen Ausgeburten seines kranken Hirns lesen zu müssen.
Das Schreiben war in derselben ordentlichen Handschrift verfasst wie das Wort Überraschung und die Adresse. Die ausladenden Lettern des 19. Jahrhunderts gehörten der Vergangenheit an, dennoch fühlte ich mich in frühere Zeiten versetzt. Denn am Inhalt, an seinen Worten, hatte sich rein gar nichts verändert.
Meine liebe Spielkameradin,
verzeih mir die lange Zeit des Schweigens. Glaub mir, dies war nicht meine Absicht, geschweige denn mein freier Wille.
Zur Wiedergutmachung, auch dafür, dass ich Dir das letzte nicht wie geplant schicken konnte, übersende ich Dir das beiliegende Herz. Es ist nicht dasselbe, ich weiß, ich bin deshalb untröstlich, aber ich hoffe, Du erkennst es als angemessene Entschädigung für meinen unhöflichen Abschied an. Mein erstes Geschenk an Dich, der Paukenschlag, mit dem ich mich zurückgemeldet habe, hat Dich leider erst spät erreicht, wie ich erfuhr. Hat es Dir denn nicht gefallen, liebste Maxine? Es hat eine Weile gedauert und ich habe keine Mühen gescheut, bis ich jemanden fand, der Deinen Namen trägt.
Ich schnaubte. »Und willst du jetzt einen Orden dafür, oder was? Widerlicher Bastard …«
Nun, ich hoffe, es war eine gelungene Überraschung. Es musste etwas Großartiges sein, nachdem unser Spiel derart rüde unterbrochen worden war. Ich gestehe, ich war sehr wütend damals, Maxine. Denn Du hast geschummelt. Du und Mary, ihr habt die Regeln verletzt. Das war so nicht vereinbart, Maxine, das weißt Du. Unser schönes Spiel, es war ruiniert! Ihr habt Saucy Jacky verspottet und damit Angry Jack erweckt. Deshalb konnte ich nicht anders, Maxine, ich musste es tun. Ihr seid slbst Schud. Valetz die Regel nich, das wießt Du dch!
Ich runzelte die Stirn. Die Schrift veränderte sich an dieser Stelle, wurde ausladender, krakeliger, und einige Buchstaben endeten mit dicken Tintenflecken. Außerdem hatte er sich in seiner Hast verschrieben. Nach dieser Passage wurde alles wieder ordentlich, als hätte er sich nur für einen schwachen Moment seiner Wut hingegeben.
Aber jetzt bin ich ja zurück. Es wird Dich freuen zu hören, dass ich mich bester Gesundheit erfreue, besser denn je, um ehrlich zu sein, und dass ich bereit bin. Ich habe einige wundervolle Partien für uns vorbereitet, liebste Maxine. Lange habe ich auf den Tag gewartet, an dem wir unser Spiel fortsetzen können …
Aber ach, was musste ich erfahren, als ich nach Dir sah? Verzeih mir die Ausdrucksweise, doch Du scheinst lediglich ein Abklatsch, eine Karikatur der Frau zu sein, die ich einmal kannte. Ist es die Trauer über den Verlust eines ebenbürtigen Gegenspielers? Darüber, den Sinn Deines hiesigen Daseins verloren zu haben? Es tut mir leid, dass Du derart leiden musstest, meine alte Freundin. Glaub mir, ich verstehe, und wäre es andersherum, es hätte ebenso mich treffen können.
Da Du noch nicht bereit bist, gebe ich Dir ein wenig Zeit, um in Deine alte Form zurückzufinden. Was wäre dieses Spiel sonst unfair! Und kein bisschen amüsant. Trödle jedoch nicht. Du weißt, ich kann es nicht leiden, zu warten.
Endlich wieder vereint.
Hochachtungsvoll, Dein Jack (the Ripper)
P.S.: Ist es nicht unterhaltsam, zu sehen, wie überfordert und planlos die Polizei ist? Wie gut, dass sich manche Dinge niemals ändern.
P.P.S.: Zur Sicherheit schlitze ich trotzdem nur Abschaum und Nutten auf. Dafür interessiert sich die Met nicht genug und wir haben unsere Ruhe, meine liebe Spielkameradin.
P.P.P.S.: Also los, spiel mit mir!
Ich legte den Brief auf den Tisch, lehnte mich in die Sofakissen zurück und starrte gegen die Wand. Am liebsten hätte ich geschrien, getobt, die Wohnung verwüstet, und innerlich tat ich das auch, doch tatsächlich konnte ich mich nicht bewegen.
Es bestand kein Zweifel daran, dass er es war. Niemand könnte seine Worte, sein gestelztes, abartig fröhliches und im nächsten Moment irrsinnig zorniges Gehabe derart perfekt imitieren. Mich fröstelte. Meine Finger fühlten sich plötzlich an wie eingefroren und ich hatte das Gefühl, ein eiskalter Wind fegte durch mein Appartement. Er brachte die Erinnerung an andere Briefe mit sich, die ich längst vergessen geglaubt, vergessen gehofft hatte.
Er hatte mich immer als seine Spielkameradin und die Morde als unser Spiel bezeichnet. Bis heute weiß ich nicht, wieso sich dieser kranke Perverse ausgerechnet mich ausgesucht hatte. Aber die viel wichtigere Frage war im Moment: Wie war es möglich, dass Jack the Ripper, das Original von 1888, urplötzlich hier und heute erschien? Wo hatte er hundertdreißig Jahre lang gesteckt? Unabsichtlich und gegen seinen Willen, wie er schrieb …
Bisher war ich felsenfest davon ausgegangen, dass der Ripper ein Mensch gewesen war. Zum einen, weil er, Großkotz in Person, der er war, nie etwas anderes angedeutet hatte. Stets erhob er sich über alle und jeden, wieso hatte er dann nie erwähnt, dass er ein Wesen aus einer anderen Welt war? Immerhin waren Dämonen und Gefallene stärker und weniger verwundbar als Menschen. Außerdem besaß mancher Dämon besondere Gaben – wie beispielsweise meine Informantin Kali, die andere Wesen identifizieren und kilometerweit lokalisieren konnte. Wieso hatte er das für sich behalten?
Zum anderen wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ein Dämon oder ein Gefallener mit einem Messer durch die Gegend zog und mordete. Dämonen waren, anders als die landläufige Meinung besagte, friedliche Wesen, Flüchtlinge, die in der Menschenwelt Schutz und Anonymität suchten. Aus meiner Heimat kamen dagegen zwar lediglich Verbrecher in diese Welt, doch jeder Gefallene konnte mit hundertprozentiger Genauigkeit feststellen, wo sich ein anderer seiner Art gerade aufhielt, und wenn das auf der anderen Seite der Welt war. Ich hätte ihn gespürt. So wie ich die Handvoll Gefallene spürte, die sich an verschiedenen Zipfeln der Erde befanden. Bisher war ich nie einem von ihnen begegnet.
Nachdem die Mordserie des Rippers abrupt endete, hatte ich angenommen, er wäre gestorben. Ich stellte mir nur zu gern vor, wie dieses miese Schwein vor einen Zug gestolpert oder von einem Ochsengespann niedergetrampelt worden war. Verdammt, jetzt hatte ich die Gewissheit, dass er nach wie vor putzmunter durch die Gegend spazierte. Aber warum diese lange Pause? Er liebte sein ›Spiel‹. Er hätte es nie aufgegeben, wenn es nicht unbedingt nötig gewesen wäre.
Ich schluckte. Meine Kehle war staubtrocken. Endlich schaffte ich es, mich zu bewegen, zumindest bis zu meinem Glas Gin. Trotz des flauen Magens schüttete ich die Hälfte des Inhalts in mich hinein, flutete die Erinnerungen, die an meinem Bewusstsein zupften.
Ich legte eine Hand auf mein heftig klopfendes Herz, presste die Augen zusammen und flehte denjenigen an, den die Menschen Gott nannten und der gerüchteweise in meiner Welt leben sollte, er möge diesen Wahnsinn in einen Traum verwandeln. Und mich schnellstmöglich aufwachen lassen. Natürlich hatte sich rein gar nichts geändert, als ich die Lider wieder öffnete.
Frustriert stöhnend schaute ich mich in meinem Wohnzimmer Schrägstrich Büro um und fragte mich, was ich jetzt tun sollte. Der Raum kam mir mit einem Mal sehr viel chaotischer und unaufgeräumter vor als jemals zuvor. Vielleicht lag das aber auch nur daran, dass es in meinem Kopf momentan genauso aussah. Irgendwo in meinem gedankenüberfluteten Hirn lag die Antwort vergraben, wie ich jetzt vorgehen musste. Aber wie sollte ich da rankommen? Zumal ich Jahrzehnte damit zugebracht hatte, Erinnerungen zu verscharren und ersäufen, und sich mein Gedächtnis aus Gewohnheit wehrte, irgendetwas davon rauszulassen.
Fest stand, dass ich die Sache weder ignorieren noch in Gin ertränken konnte – dadurch löste sich der Ripper nicht in Luft auf. Er mordete weiter und er erwartete, dass ich ihn jagte. Ich musste ihn jagen, sonst würde er sauer werden. Und niemand, am allerwenigsten ich, wollte, dass er wieder sauer wurde.
Er war unberechenbar und – wie ich nur ungern zugab – ziemlich gerissen, unglaublich schnell und mir stets einen Schritt voraus. Außerdem war der Kerl ein Phantom, geradezu unsichtbar. Und trotz aller neuen Technik und Ausrüstung hatte ich wenig Hoffnung, dass ihn die Polizei dieses Mal erwischen würde. Zumal er mit mir spielen wollte. Und er würde dafür sorgen, dass es unser Spiel blieb.
Ich nippte ein letztes Mal an meinem Drink, dann schüttete ich den kläglichen Rest zurück in die Flasche und schraubte den Deckel darauf. Er wollte mir Zeit geben, um zu meiner alten Form zurückzufinden? Dann sollte er lieber ein weiteres Jahr untertauchen. Oder besser zwei.
Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich zuletzt einen kühlen Kopf gehabt und einen schwierigen Fall gelöst hatte. Musste irgendwann in den Dreißigern gewesen sein. Da gab es eine Phase, in der ich mich zusammenreißen und mit meinem Schicksal abfinden wollte, aber sie hielt nicht lange an. Ohne eine reelle Chance, nach Hause und zu meiner Familie zurückzukehren, ergab in dieser Welt einfach nichts genügend Sinn, um dafür lange nüchtern bleiben zu wollen. Daher war aus mir das geworden, was der Ripper so charmant als einen Abklatsch der Frau, die ich einmal gewesen war, bezeichnete. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken, dass ich ihm in dieser Sache zustimmen musste.
Ich hatte kaum etwas mit der Person gemein, die ich gewesen war, als ich 1888 auf den Ripper traf. Ich war erst achtzehn Jahre in der Menschenwelt, hatte noch Hoffnung mich hier beweisen zu können und begnadigt zu werden. Damals war ich eine hervorragend trainierte und ausdauernde Soldatin gewesen, mit messerscharfem Verstand und einem unbeugsamen Willen – eine lebende Waffe. Heute hockte ich mit trübem Geist auf der Couch in meiner versifften Wohnung, schaute mit ginverhangenem Blick auf die Vergangenheit und bekam meine zitternden Finger nicht unter Kontrolle. Ich hatte nicht einmal den Hauch einer Idee, was ich jetzt tun sollte. Daher stellte ich mir zunächst eine gedankliche To-do-Liste zusammen:
1. Nüchtern werden.
2. Alte Akten studieren.
3. Meine Kontakte abklappern.
4. Den Ripper fangen.
Punkt eins war nicht unbedingt schnell in die Tat umzusetzen, außerdem bereitete er mir Kopfzerbrechen. Denn jedes Mal, wenn ich zu nüchtern wurde, kam die heftige Furcht vor den Erinnerungen zurück. Ich wusste, ich brauchte den überfluteten Teil meines Gedächtnisses, um Punkt vier abzuhaken, doch alles in mir wehrte sich dagegen. Daher beschloss ich, mit Punkt zwei zu beginnen.
Ich erhob mich langsam von der Couch und wankte zu meinem Schreibtisch hinüber. Mit einem Stöhnen zog ich ihn von der Wand weg und bückte mich daraufhin zu der Heizrohrverkleidung, unter der, wie ich genau wusste, kein Heizrohr verlief. Sie war vielmehr ein unauffälliges Versteck für Wertsachen, belastende Beweise oder – in meinem Fall – unliebsame Erinnerungen. Ein Ruck, die Holzverkleidung löste sich und Dokumente kamen zum Vorschein.
Zuerst hatte ich meine Aufzeichnungen zum Ripper-Fall verbrennen wollen, doch ich hatte es nicht über mich gebracht. Eine Vorahnung? Konnte sein.