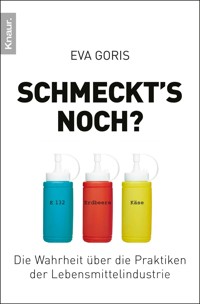
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hauptsache billig! – Nach diesem Motto packen immer mehr Kunden industriell gefertigte und verarbeitete Nahrungsmittel in ihren Einkaufswagen. Mit alarmierenden Folgen für die Gesundheit. Wie bringt man wieder Qualität auf den Tisch? Eine Anleitung zum nachhaltigen Umdenken. Schmeckt's noch? von Eva Goris: wissenswerte Verbraucherinformationen und -tipps im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Eva Goris
Schmeckt's noch?
Die Wahrheit über die Praktikender Lebensmittelindustrie
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Für Peter und Harald [...]
Einleitung
Sind wir alle essgestört?
Essen aus dem Labor
Was Hänschen nicht isst …
Wie macht man Omas warme Suppe?
Wie wächst Sauerkraut?
Von glücklichen Schweinen und armen Säuen
Fabrikschweine
Kuscheln verboten
Das schweinereichste Land Europas
Billig ist teuer bezahlt
Mit Antibiotika spielt man nicht
Deutschland, einig Schweineland
Wohin mit dem Mist?
Blass, weich und wässrig
Nur wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin
Alte Haustierrassen sterben aus
Wollschweine & Co.
Unglückliche Hühner und das Gelbe vom Ei
Eierlegen im Akkord
Verbraucher wollen keine Käfigeier – und essen sie doch
Geflügelzucht: ein Leben für den Grill
Relikte aus längst vergangener Zeit
Wenn Vögel Grippe kriegen
Die Spur der Hähnchen
Der Sündenfall Apfel oder Die Vertreibung aus dem Obst- und Gemüseparadies
Äpfel im Koma
Als Treffpunkt für Liebende nicht geeignet
Äpfel mit dem Geschmack von Zartbitterschokolade
Alter Apfeladel
Gesunde Früchtchen
Dramatische Abnahme von Mineralstoffen und Spurenelementen
Massenware mit Giftspuren
Alles und zu jeder Zeit
Alte Nutz- und Kulturpflanzen werden verdrängt
Ungeahnte Kartoffelvielfalt
Von Mairübe bis Blondköpfchen: vergessene Kulturpflanzen
Tomaten auf der Intensivstation
Plastikplanen-Land ernährt Europa
Da haben wir den Salat!
Einheimisches Wintergemüse
Bio erobert den Supermarkt
Käse – ein Laib ohne Seele
Käsenation Deutschland
Regionale Käsespezialitäten
Am Anfang steht die Turbokuh
Von Ur-Kühen und einer Genrettungsaktion
Milch ist nicht gleich Milch
Was einen guten Käse ausmacht
Fabrikkäse – ohne Zusatzstoffe nicht denkbar
Die Milchmacher
Joghurt & Co.: Hauptsache leicht, luftig und low fat
Joghurt, der gar keiner ist
Geschmack und Konsistenz aus dem Labor
Omas Joghurt
Fische in Seenot
Ausrottung der Meere
Vom Fisch zum Stäbchen
Die Fischplünderer
Mast im Meer
Ein Computerprogramm legt die Lachsfarbe fest
Welcher Fisch darf ins Einkaufsnetz?
Wie frisch ist Fisch?
Krabben, Krebse & Co.
Vergessene Fische
Alte Fischrezepte
Unser kläglich Brot
In der Tütenbäckerei
Der unberechenbare Sauerteig
Für Brot gibt es kein Reinheitsgebot
Aufs Korn gekommen
Wie erkennt man gutes Brot?
Angeschmiert: Ist Butter böse, Margarine gut und Öl ein Dickmacher?
Ist die gute Butter böse?
Margarine: Sparbutter mit schlechtem Ruf
Einsatz als Cholesterinsenker
Pflanzenöle: gut geölt oder angeschmiert?
Wie Fette wirken
Kalt gepresst und heiß geliebt
Fix und fertig
Chilled Food – Mundgerechte Verführung
Wozu noch kochen?
Was machen all die »E« im Essen?
Das Spargelsüppchen schmeckt nach Dimethylsulfid
Gibt es ein Leben ohne künstliche Aromastoffe?
Schockgefrostet und eingedost – Vitamine und die Kunst der Konservierung
Auf schnellstem Weg in den Turbofrost
Vor der Erfindung der Kälte
Haltbar mit Salz und Zucker
Von Mäusen und Menschen
Weltmacht dank Dosenfutter
Rettet die Dose!
Essen als Medizin?
Kekse gegen Depressionen, Brot gegen Hitzewallungen
Japan und die USA: Massenexperimente mit Functional Food
Medi-Food von der Wiege bis zum Schaukelstuhl
Risiken und Nebenwirkungen der Apotheke auf dem Teller
Tablette oder Tomate?
Genmanipulierte Nahrung ist allgegenwärtig
Original statt Fälschung oder Wie wir wieder gesund essen können
Die fettlöslichen Vitamine
Die wasserlöslichen Vitamine
Die Mineralstoffe
Wie wirken Antioxidantien?
Von A wie Apfel bis Z wie Zitrusfrüchte: Die gesunden Klassiker
Trockenfrüchte
Nüsse
Gemüse
Wann hat Gemüse Saison?
Salat
Pilze
Kräuter und Gewürze
Dank
Anhang
Rezepte
Kalte Schweinelende
Adressen und Ansprechpartner
Direktvermarkter
Verbraucherzentralen
Literaturhinweise
Für Peter und Harald und C.-P. Hutter
Einleitung
Ein Freund von mir, er ist Franzose, hat einmal gesagt: »Das Essverhalten von euch Deutschen werde ich nie verstehen! Ihr fahrt zur Tankstelle und kauft das teuerste Öl für den Motor eures Autos, aber beim Kauf von Olivenöl für den Salat spart ihr jeden Cent …!«
Warum sind wir so sparsam, wenn es ums Essen geht? Wir parken den Wagen für zwei Euro vor dem Supermarkt und regen uns an der Fleischtheke über den Preis für das Schnitzel auf. Es heißt: Der Mensch ist, was er isst. Warum speisen wir uns dann selbst so billig ab? Wir essen das Fleisch gequälter Tiere aus der Massentierhaltung, weil es billiger ist als das Fleisch von »glücklichen« Tieren. Wenn das Schnitzel über den Tellerrand ragt, freuen wir uns diebisch, die Qualität des Fleisches ist uns eher egal, Hauptsache viel! Und das, obwohl wir oft die Hälfte übriglassen und dem Gastwirt beim Abräumen hocherfreut entgegenstöhnen: »Ich habe es nicht geschafft.« Als wäre das ein Kompliment an die Küche! Wenn wir das Geld, das wir für all die weggeworfenen Reste mitbezahlt haben, in gute Bio-Lebensmittel investiert hätten, wären wir besser ernährt. Die Deutschen haben im Vergleich zu anderen europäischen Nationen eine schlechte Ess-Klasse. Unsere Wertschätzung für Lebensmittel ist generell gering.
Sind wir alle essgestört?
Wir leben im Angebotsschlaraffenland und pendeln zwischen Völlerei und Diätenwahn hin und her. Auf der Strecke bleiben der Genuss und die Lust am Essen. Genuss wird mit übervollen Tellern, fetten Süßspeisen und viel Fleisch gleichgesetzt. Der Figur wegen wird die Völlerei jedoch als »Sünde« gebrandmarkt, und so plagt uns, schon während wir essen, das schlechte Gewissen. Wer abnehmen will, hat es in unserer von Überfluss geprägten Gesellschaft schwer, denn Nahrung ist allgegenwärtig. Und da alle schlank sein wollen, achten besonders weibliche Konsumenten beim Kauf von Lebensmitteln vor allem auf die Kalorien. Doch wo unser Essen herkommt, wie es produziert wird und ob es für den Körper wirklich ein Lebensmittel – also ein Mittel zum Leben – ist, kann kaum noch jemand mit Sicherheit sagen. Wie auch? Es steht ja nicht neben den Nährwertangaben im Kleingedruckten.
Dabei liegt es auf der Hand: Ohne Massenmast und industrielles Töten, Billigimporte und Quantität statt Qualität sind die Niedrigstpreise im Handel nicht haltbar. Aber ist Geiz wirklich so geil? Erst wenn verwesendes Gammelfleisch umverpackt wird und in Folie eingeschweißt wieder im Supermarkt auftaucht, werden wir für eine Verbrauchersekunde lang wieder wach.
Wie weit der Irrsinn gehen kann, zeigte die BSE-Krise. In einer Welt, in der 800 Millionen Menschen hungern, brannten bei uns in Europa wie im Mittelalter wieder die Scheiterhaufen. In den Feuern wurde das Fleisch von Millionen Rindern vernichtet, die nur im Verdacht standen, den Wahnsinn im Gehirn zu haben. Was als Rinderwahnsinn durch die Medien geisterte, war in Wahrheit die Folge von Futter-Wahnsinn: Die Futtermittelindustrie hatte Grasfresser zu Kannibalen gemacht, die die Überreste ihrer Artgenossen in Form von Futterpellets als Kraftnahrung vorgesetzt bekamen. Über das Futter wurden Schlachtabfälle und damit die Erreger von BSE verfüttert, die dann das Gehirn von Fleischessern durchlöcherten. Doch dieses Experiment zur Abfallentsorgung ist gehörig schiefgegangen.
Rinderwahnsinn, Schweinepest, Vogelgrippe: Die Liste der Lebensmittelskandale ist lang. Krebsgifte in Olivenöl, Antibiotika in Schnitzeln und Pestizide in Erdbeeren: Massenproduktion hat ihren Preis, deshalb muss der Mensch eine ganze Menge verdauen!
Essen aus dem Labor
Auf der anderen Seite betreibt die Lebensmittelindustrie einen enormen wissenschaftlichen Aufwand, um die Satten in der Wohlstandsgesellschaft immer satter zu machen. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war die Auswahl an Lebensmitteln größer. Ludwig XIV., seines Zeichens Sonnenkönig von Frankreich, würde staunen angesichts der Fülle. Was wusste er schon von Kiwis aus Neuseeland, Bananen aus Costa Rica und Papaya aus Brasilien, die heute jeder Sozialhilfeempfänger kaufen kann? Rund 200 000 unterschiedliche Artikel stehen in den Regalen der Supermärkte, und etwa 600 neue Kreationen kommen Woche für Woche hinzu. Alte müssen dafür ihren Platz räumen.
Um die Verbraucherakzeptanz im Vorfeld der Markteinführung abzuklopfen, ist ein ganzes Heer an »Vorkostern« beschäftigt. In Sensoriklabors finden Blindtests statt, um Testessern auf den Zahn zu fühlen. Was nach einer gewissen Karenzzeit vor dem Kunden nicht bestehen kann, fliegt wieder aus dem Regal. Um ein Produkt möglichst perfekt zu plazieren, setzt die Industrie auch auf die Popularität anderer Werbeträger. Da gibt es dann die Harry-Potter-Torte, Fußballfrikadellen oder für die reisefreudigen Esser Ethnofood, das an den Urlaub erinnern soll. Und im Maggi-Kochstudio laufen Kurse unter dem Motto »Viva Italia« und »Candle-Light-Dinner«. Sattwerden ist längst Nebensache.
Um Backmischungen ohne Backen (das gibt es wirklich, der Kuchen muss nicht in den Ofen!) und andere Bequemlichkeiten zu erfinden, ist neben der Fleißarbeit der Forscher vor allem Hightech gefragt. Es gibt Nudeldesigner, die durch eine veränderte Oberflächenstruktur die Garzeit verkürzen. Verfahrenstechniker machen den Schaum auf Fabrik-Cappuccino noch schaumiger, die Kräcker noch knuspriger und den Joghurt noch cremiger. Flavoristen führen uns mit Aromen an der Nase herum und zaubern im Labor eine Geschmackswelt nach Bedarf: fruchtig-frisch, tropisch-süß oder rauchig-zart. Unsere Geschmacksrezeptoren, unsere Sinne und Gelüste sind längst zum Spielball der Industrie geworden, die die Befriedigung gleich parat hat: aufreißen, aufwärmen, aufessen! Werbefilmer bringen uns emotional auf die Alm, lassen Omis Kuchen backen und Opas Sahnebonbons verteilen und gaukeln uns mit Null-Informationen wie »vom Lande« eine bäuerliche Produktion vor. Ja, wo soll die Milch denn sonst herkommen? Aus dem Bankenviertel in Frankfurt?
Doch das Misstrauen gegen die Industrie ist gewachsen. Da helfen auch über 70 000 Gütesiegel (!) nicht weiter. Die Masse hat die erwünschte Wirkung erschlagen, die Verbraucher sind »siegelmüde«. Das Forschungsprojekt »Trust in Food« kam zu folgendem Ergebnis: Nur 1 Prozent der Befragten traut der Industrie über den Weg, 4 Prozent glauben, was die Supermärkte versprechen. Immer wieder zeigen Umfragen ähnliche Ergebnisse, trotzdem ändert sich am Kaufverhalten wenig. Wie geht das zusammen? Eine Flutwelle von Ernährungsinformationen donnert über unsere Köpfe hinweg, doch die meisten Menschen wissen erschreckend wenig über den Zusammenhang von Lebensmittelproduktion und unserem Essen. In Baden-Württemberg zum Beispiel glauben 20 Prozent der Abiturienten, dass das Steak als Zellkultur in der Genfabrik wächst. Das Wissen über die Produktion und Zubereitung von Lebensmitteln schwindet. Viele Menschen mögen nicht einmal mehr rohes Fleisch anfassen, 85 Prozent können keinen klassischen Braten zubereiten.
Was Hänschen nicht isst …
Dabei werden die Satten auf der Welt immer dicker. Die WHO geht davon aus, dass global gesehen eine Milliarde Menschen zu dick sind, 300 Millionen gelten gar als fettsüchtig! In Deutschland ist bei der Einschulung bereits jedes vierte Mädchen und jeder dritte Junge zu dick. Schon die Kleinen leiden unter Skelettschäden, Diabetes und Kreislaufproblemen. Mit den Kilos steigen die Kosten der Krankenkassen. Die dicken Kinder von heute sind die Patienten von morgen, die dem Gesundheitssystem schwer auf der Tasche liegen.
Was Hänschen nicht isst, isst Hans nimmermehr – diese Regel gilt heute mehr denn je! Deshalb ist »Essen« als Schulfach neben Mathematik und Englisch in der Diskussion. Es gibt viel Engagement rund ums essende Kind, doch irgendwie scheint der Funke nicht zu zünden. Aktionen wie »5 am Tag« oder »Optimix«, die für fünf Obst- und Gemüseportionen und die optimale Zusammensetzung der Mahlzeiten werben, erreichen nur wenige Verbraucher. Sind wir womöglich beratungsresistent oder lassen wir uns wider besseres Wissen immer wieder verführen? Deutschlands oberste Verbraucherschützerin, Professorin Edda Müller, ihres Zeichens Vorstand des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, beklagt irreführende Werbung auf Produkten, die als besonders kindgerechte Lebensmittel gelten. Statt »viel Milch und Vitamine« hätten diese Waren den Zusatz »viel Zucker und Fett« verdient.
Zu Recht fordert Claus-Peter Hutter, Präsident der Umweltstiftung Euronatur und Initiator der Aktion Gourmets for Nature die Einführung des Fachs Ernährungserziehung in den Schulen: »Kinder müssen lernen, wie Steckrüben, Rote Beete und Schwarzwurzeln schmecken und dass sie gleich auf dem Acker wachsen.« Aber gute Ernährung hat auch etwas mit einer intakten Umwelt zu tun, und die hängt auch mit der Herkunft der Lebensmittel zusammen. Weitgereistes »Essen auf Rädern« jedoch schadet wegen des Kohlendioxidausstoßes beim Transport der Atmosphäre. »Heranwachsende müssen das schon in der Schule lernen«, sagt Hutter, »sonst werden sie zu verfetteten Ernährungs- und Umweltanalphabeten.«
Das Schlankheitsversprechen ist zwar Trumpf im Kühlregal, doch auch die abgespeckten Variationen der Lebensmittel bringen nicht die Lösung: Seit es »Light«-Produkte gibt, hat sich die Zahl der Dicken in den USA um ein Drittel erhöht. Einige Lebensmittel werden deshalb jenseits des Atlantiks bereits mit Tabak und Alkohol auf eine Gefahrenstufe gestellt. Big Mäc und Pommes als Droge für die Dicken? Die Schadensersatzklage einer amerikanischen Mutter in Millionenhöhe wurde von einem Gericht in den USA zwar abgewiesen, aber so ganz vom Tisch ist die Diskussion, ob Fabrik- und Fastfood die wahren Fettmacher sind, nicht.
Wie macht man Omas warme Suppe?
Warum essen wir so verrückt? Ist die Industrie schuld, die uns in Zeiten der Übersättigung immer mehr Appetit macht? Dabei bleiben wir doch oft vor vollen Tellern hungrig zurück. Aber warum? Vielleicht bleiben Grundbedürfnisse unerfüllt? Vermisst der Körper Omas warme Suppe? Die Sehnsucht nach der guten alten Essenszeit ist trotz Wellness- und Fitnessfood spürbar. Retro-Mahlzeiten wie Königsberger Klopse, Pichelsteiner-Eintopf und Reibekuchen tauchen als Fertiggerichte wieder in den Regalen auf. Es riecht ein bisschen wie damals bei Muttern, wenn die vorgefertigte Mahlzeit aus der Mikrowelle kommt. Aber es schmeckt anders: Fertiggerichte sind eben doch Einheitseintopf. Dabei will auch das Kind in uns gefüttert werden. So sehen es jedenfalls die Psychologen: Eine warme Suppe ist wie eine warme Decke. Doch wie hat Mama die warme Suppe gemacht? Wer weiß heute noch, wie man Marmelade einkocht, Brot selber bäckt, Kartoffeln richtig lagert, Sauerkraut stampft oder Bohnen auf Fäden zieht, damit sie an der Luft trocknen können? Die Kunst des Konservierens ist schon fast verlorengegangen, und nun droht die »Generation Backmischung« auch das traditionelle Kochen zu verlernen. Tüte aufreißen, Inhalt mit Wasser anrühren – fertig! Ist doch ganz einfach, oder?
Wenn wir wieder schmecken wollen wie damals, sind viele Menschen heute auf die Industrie angewiesen. Die klassische Hausmannskost verschwindet mit der klassischen Hausfrau aus Deutschlands Küchen. Der Menschentyp Hausfrau und der Sonntagsbraten sind beide vom Aussterben bedroht. In deutschen Küchen lernt der Nachwuchs allenfalls, die Mikrowelle zu bedienen. Heute wachsen schon in der zweiten Generation Kinder heran, die nicht kochen können, weil sich bereits ihre Eltern durch den Tag gesnackt haben.
»Und die Industrie hat schon vorgekocht«, beklagt Otto Geisel, Vorsitzender von Slow Food Deutschland und Inhaber des Hotels Victoria in Bad Mergentheim. Immer mehr Fähigkeiten gehen dadurch verloren, bald weiß niemand mehr, wann welche Obst- oder Gemüsesorte wächst und wie man sie zubereitet. Otto Geisel engagiert sich deshalb ganz besonders für »die kleinen Genießer, die Essen und Schmecken wirklich erst lernen müssen«. In Schulkantinen bereiten »Slow-Food-Köche« frisch geerntete Lebensmittel aus der Region zu. »Das Essen ist obendrein preiswert – und wir blicken nur in zufriedene Kindergesichter, die an gedeckten Tischen sitzen. Sie lieben es …!«
Wie wächst Sauerkraut?
Die Entfremdung von unseren Lebensmitteln ist erschreckend weit fortgeschritten. Wie wird eine Kuh gemolken? Wie macht man Joghurt und Käse? »Wie wächst Sauerkraut?« Diese Frage wurde Besuchern der Grünen Woche in Berlin von einem Fernsehteam gestellt. Nicht einer der befragten Besucher wusste die Antwort. Sauerkraut? Hilflos zeichnete eine Frau komische Fäden auf eine Tafel: »So wächst Sauerkraut!« Die Fäden wuchsen senkrecht aus dem Acker. Da bleibt einem das Lachen im Halse stecken.
Wer schlachtet sein Huhn heute noch selbst, bevor er es isst? Dass der Hamburger zwischen dem Brötchen einmal etwas mit einem Rind zu tun hatte, wissen die meisten Kinder nicht. Diese Distanz zum »Lebensmittel Tier« macht Tierfabriken und die unhaltbaren Zustände darin erst möglich. Durch die industrielle Lebensmittelproduktion ist uns auch das Mitleid für unsere Mitgeschöpfe abhanden gekommen.
Wenn ein Mensch 70 Jahre alt geworden ist, hat er statistisch über 100 000 Mahlzeiten verzehrt und sechs Jahre seines Lebens mit Essen zugebracht. Dieser Mensch hat dabei 30 Tonnen Nahrung verdaut, er hat sieben Rinder gegessen, 40 Schweine, zwei Kälber und über 600 Hühner. Obendrein hat er weit über 10 000 Eier verspeist und den Inhalt von 100 Säcken Kartoffeln, 80 Säcken Zucker und Mehl sowie 1000 Kilogramm Käse gefuttert. Was machen all diese Lebensmittel mit uns? Unser Vertrauen in die Nahrung, die wir kaufen, ist gering, und trotzdem futtern wir vor allem billig.
War es früher vielleicht besser bestellt ums Essen? Die »gute alte Zeit« hatte auch ihre Nachteile: Lebensmittel mussten nach der Ernte lange gelagert werden und hatten beim Überwintern hohe Vitamin- und Nährstoffverluste. Schädlinge fraßen die Vorräte weg, und wer nicht richtig konserviert, getrocknet oder geräuchert hatte, konnte sich mit Schimmelpilzen und üblen Bakterien schwere Vergiftungen zuziehen. Man war in größerem Maße als heute, wo wir Lebensmittel aus der ganzen Welt beziehen, von Naturereignissen abhängig, Hagel, Stürme oder Dürre konnten ganze Ernten zunichte machen. Dann drohten Hunger und Tod. Die ständige Verfügbarkeit von Lebensmitteln in hoher Qualität und in großen Mengen, obendrein günstig und für jedermann erschwinglich, war noch vor wenigen Jahrzehnten kaum vorstellbar. Pralinen, einst ein süßes Privileg der Aristokratie bei Hofe, gibt es heute für 99 Cent bei Aldi. Die Käse- und Wursttheken quellen über, und am Obst- und Gemüsestand liegt die Ernte der ganzen Welt: Trauben aus Südafrika, Paprika aus Spanien, Äpfel aus China.
Und unsere einheimischen Lebensmittel? Die drohen auf der Strecke zu bleiben. Verdrängt von billiger produzierter, auf eine schöne Schale und längere Haltbarkeit getrimmter Massenware, deren Produktion ganz und gar den Anforderungen der Lebensmittelindustrie unterworfen ist und der jede Abweichung von der Norm ausgetrieben wird. Wir haben uns von diesem schönen Schein nun schon so lange blenden lassen, dass wir uns kaum noch an den Geschmack der Äpfel aus unserer Kindheit erinnern und fast vergessen haben, wie viele Sorten Birnen es damals noch gab oder wie gesund und frisch der Salat vom Wochenmarkt war und wie gehaltvoll das Fleisch, als es noch nicht aus der Hochleistungsmast stammte.
Ohne den Supermarkt an der Ecke wären die meisten von uns heute kaum überlebensfähig. Das Leben ohne unsere perfekt funktionierende Lebensmittelindustrie mit Importen aus aller Welt ist undenkbar geworden. Das hat allerdings den Nachteil, dass wir abhängiger geworden sind und damit anfälliger für die Nachteile und Gefahren der modernen Essenswelt, in der ein Lebensmittelskandal leicht epidemische Ausmaße annimmt. Deshalb: Bevor Sie sich billig abspeisen lassen, schauen Sie doch mal über den Tellerrand.
Von glücklichen Schweinen und armen Säuen
Glücksschweine« stecken die Nase am liebsten in die Erde. Stets auf der Suche nach etwas Fressbarem, schnüffeln sie mit ihrem hochentwickelten, empfindlichen Riechorgan nach Wurzeln und Früchten, Gräsern und Insekten. Sie lieben Klee und Nüsse, knabbern Käfer und allerlei Samen. So futtern sich die Allesfresser richtig fett, und wenn man sie lässt, werden die robusten, widerstandsfähigen Tiere bis zu 15 Jahre alt.
Früher brauchte die Bäuerin keine Tonne für biologische Abfälle in der Küche, denn im Schweinestall wartete die hauseigene Fressmaschine, die Kartoffel- und Gemüseschalen sowie Essensreste »recycelte« und in wertvollen Dünger verwandelte. Alles, was in der Küche nicht weiterverarbeitet werden konnte, verschwand im Bauch der Schweine. Gut und gerne 400 Kilogramm bringt so ein ausgewachsenes Hausschwein auf die Waage.
Ausgewogene Ernährung macht müde. Nach dem Fressen wird im Leben glücklicher Schweine erst mal ausgiebig geruht. Schweine sind saubere Tiere, die vom Menschen zu Unrecht in die Dreckecke gestellt wurden. Suhlen gehört zur Körperhygiene, um Parasiten gleich im Schlamm zu ersticken. Wie gut das tut, wissen auch wir Menschen, wenn wir in Kurkliniken in Schlammbädern untertauchen. Aber nicht nur in dieser Hinsicht, auch anatomisch gesehen sind Schweine dem Menschen ähnlich. Außerdem sind sie sehr intelligent. Wie Hunde hören sie auf ihren Namen, sind gelehrig und zu komplizierten Dressurleistungen fähig.
Die Paarhufer haben viel Sinn fürs Familienleben. Wenn glückliche Schweine Kinder kriegen, wird den ganzen Tag über liebevoll mit dem Nachwuchs gekuschelt und geschmust. Schweinemütter säugen drei Monate lang ihre Ferkel und verhätscheln die Kleinen zärtlich. Auf der Wiese wird Wegrennen gespielt, Raufen und Muttersau-Ärgern. Wenn Ferkel schlafen, drücken sie sich ganz eng an den Körper der wohligwarmen Schweinemama und grunzen vor Zufriedenheit. Sie fühlen sich sauwohl im Schweineparadies.
Werden kleine Ferkelchen von der Muttersau getrennt, leiden sie unter großen Trennungsschmerzen. Oft geht die Trauer der Tierkinder so weit, dass die Schweinchen ihre Nahrung erbrechen oder gar nicht mehr fressen wollen. Sie haben Durchfall und quieken vor Sehnsucht laut und ausdauernd nach der Mutter.
Fabrikschweine
In den gigantischen Schweinemastanlagen zur Produktion von billigem Industriefleisch wird auf Trennungsschmerz keine Rücksicht genommen. Obendrein werden den Ferkeln gleich an den ersten Tagen nach der Geburt körperliche Schmerzen zugefügt. Ohne Betäubung werden die Tiere kastriert, man kneift ihnen die Eckzähne ab und schneidet das Ringelschwänzchen ab. Die Zähne und das Schwänzchen müssen weg, damit sich die Schweine später in der qualvollen Enge der Tierfabriken nicht verletzen. Das Schwänzchen würde von den anderen Schweinen abgebissen, denn Aggressionen und Kannibalismus sind in der Massentierhaltung als Folge von Platzmangel nicht selten. Immer wieder kommt es vor, dass Schweine sich in den Tierfabriken und auf dem Transport zum Schlachthof aus Panik gegenseitig anfressen.
Die Hoden sind ohnehin überflüssig, denn Eberfleisch ist Geschmackssache, und der deutsche Verbraucher isst lieber das Fleisch von Börgen. Das sind die kleinen Kastraten, die als Tierkinder im Alter von sechs Monaten geschlachtet werden. Von wegen »fettes Schwein«: Die Kastraten bringen nur zwischen 90 und 120 Kilogramm auf die Waage, bevor man ihnen das Bolzenschussgerät aufsetzt oder sie in die Gaskammer schickt. Spanferkelchen, die schon drei Wochen nach der Geburt unters Messer kommen, gibt es bereits ab zwölf Kilogramm Schlachtgewicht.
Da Fabrikschweine kein Liebesleben haben, brauchen sie auch keine Hoden. Die Kastration von Ferkeln wird bis zum siebten Lebenstag durchgeführt, als »schmerzlos« bezeichnet und ohne Betäubung vollzogen. Dass der Kastrationsschnitt und das Herausdrehen der Hoden jedoch zu anhaltendem Leiden führt, kann man leicht am Verhalten der Tierkinder beobachten, die es eine ganze Weile nach dem Eingriff vermeiden, sich hinzulegen. Außerdem schreien sie laut und anhaltend, wenn sie kastriert werden. Sie mögen sich danach nicht bewegen. Ihre Beinchen zittern, einige Ferkel erbrechen sich vor Schmerz.
Der Samen für die Produktion von kleinen Schweinchen für die Tierfabrik stammt von einem sogenannten Spitzenvererber. Das ist ein hochgezüchteter Eber, dessen Samen in einer Besamungsstation von einem Besamungsexperten (ein Mensch!) »abgesamt«, also aufgefangen wird. Der Vorgang ist extrem unromantisch: Der Eber bespringt eine Art Holzgestell, an dessen Ausgang der Samen von dem Besamungsexperten in einem Reagenzglas aufgefangen wird. Dieser Samen wird dann untersucht, bevor man ihn der Zuchtsau verabreicht.
Kuscheln verboten
Die Sau selbst ist eine Gebärmaschine. Sie ist pro Wurf 115 Tage lang trächtig, dann kommen vier bis zwölf Fabrikferkelchen zur Welt. Die Zuchtsau muss etwa 20 Ferkel im Jahr werfen, sonst hängt sie vorzeitig im Schlachthof am Haken. Nach knapp drei Jahren ist der Körper des Mutterschweins total ausgepowert. Dann wartet der Schlachter auf die arme Sau.
Die Fabriksau kann sich natürlich nicht richtig um den Nachwuchs kümmern. Sie liegt eingepfercht in einem Kastenstand, der von Insidern »eiserne Jungfrau« genannt wird. Mit ihren drei Zentnern Körpergewicht ist die säugende Sau in diesen Käfig gesperrt, der sich fast wie ein Korsett um sie herumlegt und das Tier fixiert. Die arme Sau kann nur liegen oder stehen; laufen und andere Bewegungen sind in dem Käfigknast mit seinen Ausmaßen von 80 mal 200 Zentimetern völlig ausgeschlossen. Schweine sind aber keine Faultiere, sie haben einen natürlichen Bewegungsdrang und leiden in der Enge wie ein Marathonläufer, den man in die Gästetoilette sperrt. Der Mangel an Bewegung führt zu gesundheitlichen Problemen. Viele Zuchtsauen leiden unter Entzündungen am Gesäuge und an der Gebärmutter.
Nestbau und das typische Pflegeverhalten sind der Muttersau unmöglich. Würden Schweine draußen leben, würden sie wie ihre wilden Verwandten Äste, Blätter und Moose sammeln, um für die Ferkel ein Nest zu bauen und es wie ein Kinderbettchen auszupolstern. Dort liegen die Kleinen dann geschützt und werden von Mama zärtlich und liebevoll gepflegt. In Tierfabriken ist Kuscheln verboten.
Schweine sind längst aus dem Schnüffelparadies zwischen Klee und Käfern vertrieben. Nur wenige Glücksschweine leben heute noch artgerecht auf Ökohöfen. Während auf der einen Seite die Massentierhaltung explodiert, musste auf der anderen Seite von Tierschützern ein Zuchtfonds gegründet werden, mit dem artgerechte Tierhalter unterstützt werden, die die Sau rauslassen. Artgerechte Tierhaltung erfordert viel private Förderung und Initiative.
Das schweinereichste Land Europas
»Tiere dürfen nicht länger einer industriellen Logik unterworfen werden – wir müssen sie wieder wie Mitgeschöpfe behandeln.« Der Mann, der das sagt, ist gelernter Metzgermeister und hat mit Massentierhaltung Millionen gemacht. Karl Ludwig Schweisfurth war lange Jahre Chef des Wurstgiganten Herta. Die Techniken zum industriellen Töten von Tieren hat er auf den Schlachthöfen in Chicago gelernt und in den sechziger Jahren mit nach Deutschland gebracht. Später waren ihm Massenschlachtungen am Fließband zuwider. Schon in den frühen Achtzigern verkaufte er die Wurstfabrik und gründete ein Bio-Imperium mit einer Stiftung, die seinen Namen trägt, und einem Musterhof für Biofleisch, der als Symbol für seinen Traum steht, »dass Lebensmittel ökologisch und regional hergestellt werden«. Die Herrmannsdorfer Landwerkstätten sind Lieferanten für hervorragendes Biofleisch.
Deutschland ist das schweinereichste Land Europas, rund 48 Millionen Schweine werden Jahr für Jahr hier geschlachtet. Industriell produzierende Tierfabriken sind Standard und immer weiter auf dem Vormarsch: 100 000 Schweine in einem einzigen Fleischerzeugungsbetrieb sind bald keine Seltenheit mehr. Der Platz pro Tier beträgt nicht einmal einen Quadratmeter. Das sind großindustrielle Maßstäbe! So produziert man Autos, Computer, Fernseher – und leider auch Lebewesen. Kein Wunder: Der Marktanteil von Ökoschweinefleisch liegt bei unter 2 Prozent.
Die moderne Fließbandproduktion von Schweinefleisch erspart den industriellen Haltern jede Menge Arbeitskräfte – und auch Stroh. Aus Fabrikställen ist Stroh verbannt, denn damit entfällt das arbeitsintensive Ausmisten. Wie Ballettänzer müssen die Paarhufer ihr ganzes erbärmliches Schweineleben lang auf Spaltenböden balancieren. »Spaltenböden« nennt man eine Art Betonfußboden mit Schlitzen, durch die Kot und Urin gleich abfließen. Darunter verlaufen Güllekanäle, die die tierischen Exkremente auffangen. Die Schweine stehen quasi auf ihren eigenen Ausscheidungen in einer Duftwolke aus Ammoniak. Das ist für die empfindlichen Nasen der Tiere die reinste Quälerei. Doch das arme Schwein leidet nicht nur unter dem Gestank. Schmerzhafte Gelenkveränderungen wie Arthrose und Arthritis, Herzerkrankungen und Lungenentzündungen führen immer wieder zu Verlusten in der Schweinezucht.
Die Qual dauert allerdings kein ausgewachsenes Schweineleben von 15 Jahren, denn das würde ja keine Sau aushalten. Außerdem rentiert sich ein langes Leben der Tiere für die Schweinebarone nicht. Allein die Futterkosten würden jeden Profit zunichte machen.
Billig ist teuer bezahlt
Der Verbraucher findet Geiz geil und gibt für Nahrungsmittel etwa 12 Prozent seines Einkommens aus. 1950 waren es noch 40 Prozent. Viele andere Waren, deren Preise ebenso gestiegen sind wie die Einkommen, lassen wir uns etwas kosten, ausgerechnet am Essen jedoch wird gespart. Für das Lebensmittel Fleisch zahlt der Kunde an der Ladentheke heute weniger als vor 50 Jahren. Das führt dazu, dass der Parkplatz in der Innenstadt oft teurer ist als ein Schweinekotelett, das bereits für 4,75 Euro pro Kilo zu haben ist.
Den Preis dafür zahlt das Tier mit einem erbärmlichen Dasein, und der Verbraucher wird mit Gammelfleisch, Schweinepest, illegal eingesetzten Hormonen als Masthilfe und diversen anderen Fleischskandalen bestraft. Außerdem hat der Kunde das Billigfleisch, das er im Sonderangebot ersteht, vorher längst über die gesetzlichen Abzüge von seinem Gehalt bezahlt, denn schließlich werden die Subventionen für die Landwirtschaft – meist auf dem Umweg über die EU – mit Steuergeldern finanziert. Da geht es nicht um Peanuts, sondern um Milliarden, die ganz lieb als »Subventionsbeihilfe« bezeichnet werden. Für die Landwirte gibt es jede Menge Prämien wie die Ackerprämie, Stallbauinvestitionen und Subventionen für EU-Kühllager. Deutschland finanziert insgesamt 33 Prozent der gesamten EU-Gelder, und so zahlt der deutsche Steuerzahler für die Agrarsünden in anderen Ländern gleich mit.
Noch teurer kommt es uns zu stehen, dass die Nutztiere aus den Tierfabriken Lebewesen mit Körpern wie Hochleistungsmaschinen sind, und so anfällig wie der Motor eines Formel-1-Rennwagens für technische Probleme ist, so anfällig sind die überzüchteten Körper der Tiere für Krankheiten. Die Erzeuger haben den Marktdruck im Rücken, ihnen geht es nur um eines: in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Aufwand und möglichst geringen Kosten möglichst viel Fleisch zu produzieren. Das heißt für die armen Schweine: wenig bewegen und fressen, fressen, fressen, um schnell viel Körpermasse anzusetzen.
Mit Antibiotika spielt man nicht
Computergesteuerte Futterautomaten geben den Takt vor, in dem Schweine rasant schlachtreif gemästet werden. Gut die Hälfte des Futters wird – wie Soja – aus Ländern importiert, in denen die Menschen wenig zu essen haben. Bis 2006 wurden Antibiotika als »Leistungsförderer« gleich mit dem Futter verabreicht. Die antibiotische Masthilfe bewirkte eine bessere Nährstoffverwertung – auf gut deutsch: Die Schweine setzten schneller Muskelmasse an. Praktischerweise hemmten die Medikamente ganz nebenbei auch das Wachstum schädlicher Mikroorganismen im Darm. So konnte man die »Masse Tier« im Stall einigermaßen gesund halten.
Doch dass man mit Antibiotika nicht spielen soll, zeigte sich spätestens Ende der neunziger Jahre, als es zu Problemen in der Humanmedizin kam, weil Antibiotika, die wirksamsten Waffen der Ärzte, plötzlich stumpf geworden waren. Obwohl die Ursachen dafür durchaus bekannt waren, wurde der Schwarze Peter zumindest sprachlich den Patienten zugeschoben: Patienten, die auf Antibiotika nicht mehr ansprechen, heißen in der Fachsprache ironischerweise »Therapieversager«.
Vier der sogenannten Leistungsförderer (Spiramycin, Tylosinphosphat, Virginiamycin und Zink-Bacitracin), die als Zusatzstoffe bei der Tierernährung verwendet wurden, mussten deshalb schon vor der Jahrtausendwende europaweit verboten werden. Da sich in der Tiermedizin eingesetzte Antibiotika im Aufbau unwesentlich von den Antibiotika in der Humanmedizin unterscheiden, war es zu Resistenzen gekommen, das heißt, man hat sich widerstandsfähige Bakterien an den Hals gezüchtet, gegen die die Humanmedizin zunehmend hilflos ist. Zum Beispiel gibt es mehr und mehr Resistenzen gegenüber Fluorchinolonen: 40 Prozent der Campylobacterkeime und Salmonellen sind mittlerweile gegen diese Gruppe von Antibiotika resistent, die Keime sind also trotz Medikamenteneinsatz überlebensfähig. Beim Menschen wurden diese Antibiotika, die in der Geflügelzucht eine große Rolle spielen, lange erfolgreich gegen Harnwegsinfekte und Atemwegserkrankungen eingesetzt.
Mittlerweile dürfen Antibiotika zwar nicht mehr als Masthilfe, sondern nur noch zur Behandlung von Krankheiten in den Ställen eingesetzt werden. Aber 80 Prozent aller Antibiotika sind von dem Verbot nicht betroffen, denn sie werden den Tieren jetzt zu Therapiezwecken verabreicht. Die Rede ist nicht von ein, zwei Pillen und ein wenig Pülverchen, sondern von mehreren hundert Tonnen Antibiotika, die den Tieren Jahr für Jahr verabreicht werden, denn die sensiblen, bei natürlicher Haltung äußerst robusten Schweine reagieren auf die Qualen in den Tierfabriken häufig mit Krankheiten.
Es gibt eine vorgeschriebene Wartezeit bis zur Schlachtung, damit der tierische Organismus genug Zeit hat, das Medikament abzubauen. So werden Rückstände im Fleisch vermieden. Doch was passiert im Darm der Tiere? In der Gülle, die als Dünger auf die Felder gebracht wird, finden sich die Medikamente wieder und gelangen über frisch geerntetes Gemüse auf den Tisch der Verbraucher. Tetracyclin zum Beispiel können Tiere im Körper nicht ganz verstoffwechseln – es landet mit der Gülle auf den Feldern und später im Gemüse. Selbst Vegetarier sind daher heute nicht mehr sicher vor den Auswirkungen der großindustriellen Tierzucht: Was auf Gülleflächen wächst, kann mit Antibiotika belastet sein. Wissenschaftler haben auf Versuchsfeldern Rückstände von Chlortetracyclin in Feldsalat und sogar in reifem Korn von Winterweizen gefunden. Mit der Gülle landen obendrein Keime, Rückstände aus Zusatzstoffen und Reinigungsmitteln aus dem Stall direkt auf dem Acker.
Ist von Medikamenten in der Massentierhaltung die Rede, zeigen alle Schweinebarone mit Unschuldsmiene sofort auf die »schwarzen Schafe« und reden von »kriminellen Machenschaften«, gegen die niemand gefeit sei. Doch selbst der ganz legale Einsatz von Medikamenten, damit die Tiere den eigenen Tod auf der Schlachtbank noch erleben, reicht nicht immer aus. Die Schweinepest beispielsweise macht seit Jahren immer wieder Schlagzeilen. Bei Massentötungen werden dann ganze Bestände, unter Umständen ein paar hunderttausend Schweine, ausgerottet, ihr Fleisch wird vernichtet, weil sich sonst in den Tierfbriken schnell Krankheiten ausbreiten können. Bei so vielen Tieren auf so engem Raum ist die Gefahr für epidemieartige Ausbrüche groß, denn ein Schwein steckt in der Enge unweigerlich das andere an.
So grassieren Pest und Wahnsinn in den industriellen Tierfabriken. Auch wegen des Rinderwahnsinns (BSE) wurden viele Millionen gesunde Tiere »gekeult« und auf dem Scheiterhaufen verbrannt – alles mit dem Geld der Steuerzahler. Aber auch die gefürchtete Vogelgrippe wurde in den Megaställen ausgebrütet, denn hinter deren Türen wird nicht nur Fleisch produziert, hier gedeihen auch widerstandsfähige Keime und Bakterien, die mit jedem Umschlag der »Ware Tier« weiterverbreitet werden.
Deutschland, einig Schweineland
Wenn das Fabrikschwein die Mast überlebt, wird es auf Tiertransporter verladen und viele Kilometer über die Autobahn Richtung Schlachthof gekarrt. In Schweinejahren gemessen, sind nur Tierkinder auf der Ladefläche zusammengepfercht, die nach einem kurzen Leben von 180 Tagen vom Fließband der Tierfabriken rollen. Sie haben Todesangst.
Offiziell bleibt rund 1 Prozent auf der Strecke – das heißt, sie verenden schon vor der Ankunft im Schlachthaus auf der Ladefläche. Das sind pro Jahr rund eine halbe Million Tiere. Damit die stressempfindlichen Schweine die Fahrt zum Schlachthof überleben, werden ihnen vorher manchmal vorsorglich Betablocker und Beruhigungsmittel verabreicht. Psychopharmaka erleichtern den Weg zur Schlachtbank ungemein – da geht das Schwein irgendwie entspannter in den Tod …
All die Qualen, die die Fabrikschweine auf ihrem kurzen Lebensweg vom Stall bis zur Schlachtbank erdulden müssen, werden von Tierschützern, aber auch von Verhaltensforschern und kritischen Wissenschaftlern mit Folter verglichen. Tierschützer reden seit langem vom »Krieg gegen die Tiere«, wenn es um Massentierhaltung geht.
Und in Zukunft? Deutschland wird ein »einig Schweineland« mit historischen Dimensionen werden. In puncto Massentierhaltung ist der Osten unaufhaltsam auf dem Vormarsch: Sachsen-Anhalt und Brandenburg ziehen mit dem Weser-Ems-Gebiet in Niedersachsen gleich, wenn es um die Zahl der Schweinehaltungsplätze geht.
Überall in der Republik boomen die Fleischfabriken. Die Schweinebestände werden in den nächsten Jahren einen historischen Höchststand erreichen, so der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Deutschland wird mit Megaställen von 80 000 bis 100 000 Mastplätzen, die mit staatlichen Beihilfen aus Steuergeldern gefördert werden, zum Schweineland Nummer eins in Europa.
Gibt es dann wenigstens mehr Arbeitsplätze in der Landwirtschaft? Fehlanzeige. Die Zahl der Schweinehalter hat sich in den letzten Jahren mehr als halbiert, die Zahl der Schweine pro Betrieb dagegen im Durchschnitt verdoppelt, wie die Umweltstiftung Euronatur ermittelt hat. Der Staat fördert ein Mehr an Schweinen und den Abbau von Arbeitsplätzen.
Das gilt generell in der Landwirtschaft: Die Zahl der bäuerlichen Betriebe hat sich in den letzten 50 Jahren von 2,2 Millionen auf knapp 400 000 Betriebe verringert. Die letzten zehn Jahre waren in puncto Höfesterben besonders krass: Anfang der neunziger Jahre gab es noch 650 000 Bauernhöfe, heute sind es ein Drittel weniger, und ein Ende des Höfesterbens ist längst noch nicht abzusehen. Dabei werden nicht nur Existenzen vernichtet, sondern auch Kulturlandschaften zerstört. Pendler ziehen aufs Land, weil sie nach Feierabend eine bäuerliche Idylle suchen, die es in weiten Landstrichen längst nicht mehr gibt.
Etwa 20 000 Landwirte leben in Deutschland von der Schweinehaltung. Viele von ihnen werden in Zukunft den Giganten weichen müssen – »Bauernopfer« im wahren Sinn des Wortes. In den Tierfabriken gibt es keine Bauern mehr, sondern nur noch Hilfsarbeiter oder Spezialisten, und die heißen »Jungsauenvermehrer«, »Ferkelerzeuger«, »Aufzüchter« und »Mäster«.
Aber noch von einer anderen Seite geraten kleine Betriebe in Deutschland unter immer größeren Druck, denn zugleich rollen international agierende Fleischkonzerne den Markt auf. Die Amerikaner sind auf dem Vormarsch und bereiten den Boden in Polen. Der größte US-Schweinefleischproduzent Smithfield will polnisches Schwein für Produktionskosten von 90 Cent pro Kilogramm vom Band laufen lassen. Dabei sind die Kosten mit 1,30 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht schon heute so niedrig, dass Schweinehalter mit einigen hundert Tieren nicht überlebensfähig sind.
Die industrielle Tötung der Tiere wird von wenigen Großkonzernen durchgeführt, die mit Beteiligungsgesellschaften, Tochterunternehmen und Warenvertriebs-GmbHs Unternehmensstrukturen aufweisen wie Stahlhersteller, Pharma- oder Autokonzerne. Ein Gigant wie Westfleisch hatte laut Geschäftsbericht 2005 über 4,3 Millionen Schweine geschlachtet, zerlegt und abgesetzt. Längst gibt es in der Branche Unternehmenszusammenschlüsse und Fusionen, die von der Europäischen Kommission genehmigt werden müssen. Am Ende der Kette stehen Monopolisten.
Wohin mit dem Mist?
Parallel zu Größenwahn und Kostendruck sinken die Umweltstandards rund um die Massentierhaltung. Das jedenfalls beklagt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in einer Anfang 2006 veröffentlichten Studie zur Massentierhaltung, die erschreckende Aussichten auf die Zukunft enthält. Denn all die vielen Schweine, Rinder, Hühner und Puten im Land »müssen mal«. Dabei kommen gewaltige Mengen hinten raus: Alle Schweine in Deutschland produzieren 90 Millionen Kubikmeter Gülle im Jahr. Gemeinsam mit den 13 Millionen Rindern und den 110 Millionen Vögeln in der Geflügelindustrie fallen so Jahr für Jahr 360 Millionen Kubikmeter Gülle an.
Reinhild Benning ist Agrarexpertin beim BUND und hat errechnet, dass die ganze »Scheiße« 145 000 Schwimmbecken füllen würde. Jedes einzelne Becken wäre 50 Meter lang, 20 Meter breit und 2,50 Meter tief!
Wohin also mit den Exkrementen? Ab auf die Felder, heißt die naheliegende Lösung. Es gibt bereits »Abnahmeverträge für Gülle«, und trotzdem gelingt es nicht, die Menschen im Umfeld von Mastanlagen vor belasteten Böden und Nitrat im Grundwasser zu schützen. Die massive Überdüngung der Böden mit den Exkrementen aus der Massentierhaltung führt unweigerlich zu einem Stickstoffüberschuss auf dem Acker und zu den gefürchteten Nitratbelastungen. Kurz gesagt: Der Verbraucher hat den Mist hinterher auf dem Teller und im Wasserglas. Und die Kosten für die Reinigung von Grundwasser und Böden darf er sowieso mit seinen Steuergeldern bezahlen.
Menschen, die im direkten Umfeld einer Agrar-Industrieanlage wohnen, klagen häufig über Atemwegserkrankungen und Allergien, die durch sogenannte Bioaerosole aus der Intensivhaltung ausgelöst werden können. Kinder sind besonders anfällig. Unter »Bioaerosolen« versteht man Stallkeime, Pilze und Stäube, die eine Art Asthma hervorrufen können. Von gesunder Landluft kann in der Nähe von Großanlagen nicht mehr die Rede sein. 552 000 Tonnen übelriechender Ammoniakemissionen entstehen jedes Jahr in der Landwirtschaft.
Was sich später auf den Schlachthöfen abspielt, dafür stehen Begriffe wie »Treibgatter«, »Entbluten«, »Ausweiden« und »Abflammen«. Auch beim industriellen Töten gibt es allerlei Entsorgungsengpässe. Für die Millionen Liter Blut, die in Schlachthäusern fließen und aufgefangen und vernichtet werden müssen, gibt es strategische Entsorgungspläne. In den glückseligen Vor-BSE-Zeiten wurde das Tierblut einfach zu Blutmehl getrocknet und als Eiweißkonzentrat an die Futtermittelindustrie verkauft, die das Blutmehl wiederum dem Tierfutter beigemischt hat. Das ist heute verboten. Das Schlachthofblut wird getrocknet und anschließend verbrannt. Allein für die Entsorgung von Blut zahlte ein Konzern wie Westfleisch im BSE-Jahr 2001 laut Geschäftsbericht über 1,5 Millionen Euro.
Bevor im November 2000 das erste BSE-Rind in Deutschland gefunden wurde, wanderten Schlachtabfälle einfach ins Futter. Die Tiere »entsorgten« praktisch die Kadaver ihrer Artgenossen durch Auffressen. Heute dürfen auch Knochen nicht mehr zu Knochenmehl verarbeitet und dann in den Mästereien wieder verfüttert werden.
Die sensiblen Schweine mit ihren feinen Nasen riechen den Tod ihrer Artgenossen schon, bevor sie den Schlachthof erreichen. Dass die Tiere leiden, kann der Fleischesser hinterher schmecken. In Todesangst werden die Muskeln der Tiere mit dem Stresshormon Adrenalin überschwemmt – das Fleisch bekommt den typischen, unangenehm strengen »Schweinegeruch«, der jedem Gourmet den Appetit verdirbt.
Blass, weich und wässrig
Nach all den Qualen schmeckt dem Verbraucher das Billigfleisch am Ende oft nicht. Zu fad sei es, klagt er. Und es schrumpfe in der Pfanne. Dafür gibt es in der Fleischerbranche einen Fachbegriff: Man redet von »PSE-Fleisch«. Die drei Buchstaben kommen aus dem Englischen und stehen für »pale« (blass), »soft« (weich) und »exudative« (wässrig). Was die Werbung als »ein Stück Lebenskraft« verkauft, verliert beim Garen oder Braten viel Wasser und spritzt dabei die Küche voll. Das ist typisch für Fleisch aus Massentierhaltung, das mit Kraftfutter zu möglichst schnellem Muskelwachstum angeregt wird und dabei Wasser einlagert. Beim Einkauf erkennt man Fabrikfleisch schon an der blassrosa Farbe. Es ist nahezu fettfrei und schwimmt oft schon in der Auslage an der Fleischtheke im eigenen Saft. Doch am Markt ist man erfinderisch. Weil das Fleisch nicht schmeckt, hat die Gewürzindustrie eigens Kotelett- und Schnitzelwürze erfunden, die den Geschmack etwas aufpeppen soll.
Gutes Schweinefleisch braucht nicht viel Würze. Es ist langsam gewachsen, hat eine kräftige, hellrote Farbe und ist marmoriert, das heißt, feine Fettäderchen durchziehen die Muskelfasern. Beim Schwein ist Fett im Muskelfleisch kein Manko, sondern ein Qualitätsmerkmal. Das Fleisch ist saftiger und viel zarter als das Fleisch der mageren Kastraten, die aus der Massentierhaltung in die Supermärkte kommen. Intramuskuläres Fett von langsam gewachsenen Schweinen ist nicht nur Träger all der wunderbaren Aroma- und Geschmacksstoffe, die gutes Schweinefleisch zum Genuss machen, sondern auch wichtig für die Fülle an Vitaminen, die in tierischen Lebensmitteln vorhanden ist: Fleisch von glücklichen Schweinen schmeckt nicht nur besser, es ist auch gesünder.
Da kann das Massenschwein nicht mithalten, denn die Marmorierung ist abhängig vom sogenannten Ausmästungsgrad der Tiere. Fleisch von Jungtieren kann noch keine Marmorierung haben, denn der Muskel hatte keine Zeit, langsam zu wachsen und Fett anzusetzen. Kalorienmäßig schlägt dieser Fettanteil übrigens kaum zu Buche. 100 Gramm Schweineschnitzel haben etwa 200 Kilokalorien, ein Kotelett gut 150 kcal. Fürs Übergewicht ist da schon eher die fette Soße verantwortlich.





























