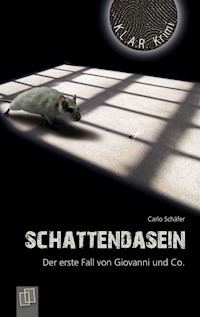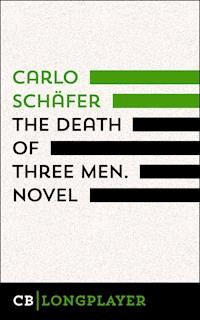13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Erzählband versammelt Carlo Schäfers Prosatexte, allesamt Meisterwerke literarischer (Hoch-)Komik. Der subtil gewobene Miniaturenroman »Der Tod dreier Männer“, angesiedelt in zutiefst verbrecherischen Gegenden der menschlichen Seele; der brillante Kurz-Krimi »Kinder und Wölfe«; die fiese Erzählung »Kurpfalz is Himmel« – und die perfekt komponierte lange Novelle »Dr. Katz, der vermutlich schwärzeste Text der deutschen Literatur. Der allmähliche Zerfall des Schullehrers Katz, der auf die Gleichgültig der Welt mit womöglich noch größerer Indolenz reagiert ist verzweifelt, melancholisch, gnadenlos und konsequent bis zum bitteren Ende. Und dabei rasend komisch, das exakte Gegenstück von „lustig“. Carlo Schäfer schreibt da weiter, wo Nikolai Gogol, Franz Kafka und Daniil Charms aufgehört haben: Über das Groteske und Irre der Welt – präzise, genau, wahnwitzig, komisch und hammerhart. So leise radikal, so konsequent verzweifelt-heiter-giftig, so kompromisslos subversiv ist unsere Welt in der deutschsprachigen Literatur seit ewigen Zeiten nicht mehr in eine ästhetisch brillante Form gebracht worden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch
Carlo Schäfer war ein begnadeter Satiriker und Polemiker, die Highlights dieser Facette seines Werkes finden Sie in dem bei CulturBooks erschienenen Band »Das Bimmel ist ein hochloder Diffel. Aus den ›Carlos‹-Kolumnen«. Carlo Schäfer war auch ein nicht minder begnadeter Erzähler. Deswegen versammelt »Schmutz, Katz & Co.« vier Erzähltexte – den Roman »Der Tod dreier Männer«, zum ersten Mal die lange Novelle »Dr. Katz« sowie die beiden Erzählungen »Kinder und Wölfe« und »Kurpfalz is Himmel«.
Die Themen, die es letztendlich unmöglich machen, den Satiriker vom Erzähler zu trennen, sind die gleichen. Carlo Schäfer befand sich im permanenten Nahkampf mit dem ganz gewöhnlichen Wahnsinn des Alltags. Lediglich die Stimmungslage variiert. Der »Katz« etwa ist vermutlich der schwärzeste Text der deutschen Literatur, ohne ein einziges Element des klassischen Noirs bemühen zu müssen: der allmähliche Zerfall des Schullehrers Katz, der auf die Gleichgültigkeit der Welt mit womöglich noch größerer Indolenz reagiert. Verzweifelt, melancholisch, gnadenlos und konsequent bis zum bitteren Ende. Und gleichzeitig rasend komisch, das radikale Gegenstück von lustig.
Diese spezielle, radikale Schäfer-Komik verbindet alle vier Texte, sie ist im besten Jean Paul’schen Sinn »weltzernichtend«. Die Texte tun weh, weil sie ganz genau dahin schauen, wo wir sonst gern vor lauter Peinlichkeit unsere Scheuklappen anlegen.
»Carlo Schäfer schreibt da weiter, wo Nikolai Gogol, Franz Kafka und Daniil Charms aufgehört haben: über das Groteske und Irre der Welt – präzise, genau, wahnwitzig, komisch und hammerhart.« Thomas Wörtche
Über den Autor
Carlo Schäfer
Schmutz, Katz und Co.
Das erzählerische Werk
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2016
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, info@culturbooks.de
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: September 2016
ISBN 978-3-95988-059-6
Inhaltsverzeichnis
Für Dorit Liebevoll, geduldig, humorvoll, melancholisch, klug – und natürlich schön. Der Schuhtick – was soll’s!
Vorwort: Anarchie & Komik
In seiner Persona als Carlos hat sich Carlo Schäfer in Hunderten von Kolumnen für das CulturMag seit 2009 mit dem galoppierenden Irrsinn angelegt, der uns umgibt. Mit Dummheit, Ignoranz, Indolenz, Ideologie, Prätention, Widerlichkeit, Dogmen, Denkfaulheit, moralischer, politischer und ästhetischer Verkommenheit. Unter all dem hat er gelitten wie ein Hund, aber er hat sich nie ergeben. Carlo hat zurückgeschlagen, für uns alle.
Carlo konnte pöbeln und wüten, wenn es der Gegenstand seines Zorns erforderte, und er konnte mit seiner virtuosen Sprachmimikry alle Phrasen, Floskeln und vermeintlichen Konsense vernichten, bis ihr Schwachsinn deutlich zu Tage trat. Er hat die Apathie, den kaltherzigen Zynismus und die Unmenschlichkeit, die sich dahinter verbergen, bloßgelegt und sichtbar gemacht, gerade da, wo’s wirklich wehtut. Das war durchweg nicht nett und versöhnlich, sondern böse und vor allem unglaublich witzig, hatte Geist und Esprit. Carlo machte keine Gefangenen, aber nicht aus der Position des Überlegenen, sondern mitten aus dem Nahkampf heraus.
Das alles gilt, wenn auch anders gelagert, für seine Prosaarbeiten. Carlo Schäfer war ein begnadeter Satiriker und Polemiker, aber er war auch ein nicht minder begnadeter Erzähler.
Wie schon der Kollege François Rabelais und vielleicht noch der Kollege Daniil Charms – in diese Linie von Literatur gehört Carlo Schäfer auch mit seinen Romanen und Erzählungen, und das kann man nicht über viele deutsche Schriftsteller der Gegenwart sagen – wehrt sich Carlo Schäfer mit der so ziemlich schärfsten ästhetischen und erkenntnistheoretischen Waffe, die es gibt: mit Komik.
Die hier versammelten Texte - die erstmals veröffentlichte, perfekt komponierte lange Novelle »Dr. Katz«; der subtil gewobene Miniaturenroman »Der Tod dreier Männer«, angesiedelt in zutiefst verbrecherischen Gegenden der menschlichen Seele; der brillante Kurzkrimi »Kinder und Wölfe« und die fiese Erzählung »Kurpfalz is Himmel« - sind Meisterwerke literarischer (Hoch-)Komik. Tragische und komische, groteske und deswegen extrem realistische Texte.
Die Themen, die es letztendlich unmöglich machen, den Satiriker vom Erzähler zu trennen, sind die gleichen: Carlo Schäfer befand sich immer im Handgemenge mit dem ganz gewöhnlichen Wahnsinn des Alltags. Lediglich die Stimmungslagen variieren: Der »Katz« etwa ist vermutlich der schwärzeste Text der deutschen Literatur, ohne ein einziges Stereotyp des klassischen Noirs bemühen zu müssen: Der allmähliche Zerfall des Schullehrers Katz, der auf die Gleichgültigkeit der Welt mit womöglich noch größerer Indolenz reagiert. Verzweifelt, melancholisch, gnadenlos und konsequent bis zum bitteren Ende. Und gleichzeitig rasend komisch, das radikale Gegenstück von lustig.
Diese spezielle, radikale Schäfer-Komik verbindet alle vier Texte, sie ist im besten Jean Paul’schen Sinn »weltzernichtend«. Die Texte tun weh, weil sie ganz genau dahin schauen, wo wir sonst gern vor lauter Peinlichkeit unsere Scheuklappen anlegen.
So leise radikal, so konsequent verzweifelt-heiter-giftig, so kompromisslos subversiv ist unsere Welt in der deutschsprachigen Literatur seit ewigen Zeiten nicht mehr in eine ästhetisch brillante Form gebracht worden.
Lehrer Dr. Katz
Und Hiob sprach: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach: Ein Knabe kam zur Welt!
I.
»Heute ist Dienstag«, sagt Stemm, »das ist Ihnen doch klar, Katz?«
»Aber gestern war doch frei! Es ist Montag!«, ruft Dr. Katz heiter.
»Es war nicht frei«, entgegnet der Schulleiter grimmig, »Sie waren nicht da. Unentschuldigt.«
Katz fühlt sich kurz ganz leicht – wie ein Mäuslein. »Ich war krank, ja, natürlich, und das Telefon war kaputt …«
Stemm nickt sarkastisch. »Aber ja doch. Ich bin jetzt nur eben mal so freundlich, Sie daran zu erinnern, dass heute die neue Schulrätin kommt.«
»Zu wem?«, fragt Katz hilflos, noch damit beschäftigt, den gestrigen Tag zu rekonstruieren – er erinnert sich an nichts.
»Zu Ihnen!«, bellt Stemm und lässt den Doktor stehen.
Wer ist dieser Mann? Und wo sind wir überhaupt? Die erste Frage ist schwer zu beantworten, ja, ihrer Beantwortung gilt unsere Mühe auf den folgenden Seiten. Die zweite Frage ist leicht: Der Ort heißt »Waldheim«.
Waldheim liegt nicht im lieblichen Süden der Republik und irgendwie trotzdem nicht im Norden. Der Ort ist weder grenznah noch zentral gelegen. Er hat nichts Besonderes, noch nicht einmal etwas besonders Hässliches. Viel normal Hässliches, das schon.
Die Menschen dort? Jahrhunderte voll Bedeutungslosigkeit und Langeweile machen einen Schlag nicht gerade besser. Der Waldheimer Mensch mag es nicht, wenn es zu wirr zugeht, er mag aber schon eine kollektive Enthemmung von Zeit zu Zeit. (Hier ist das jährliche Spießbratenfest hervorzuheben.)
Der Waldheimer ist, sagen wir es hart, selten der Hellsten einer, und die Waldheimerin tut es ihm gleich, beide sind miteinander verheiratet und machen Kinder. Die gehen in die Schule, in den »Gesamtschulverbund 2000«.
Ja, es passt nicht ins Bild, ist aber dennoch wahr: Ausgerechnet hier wurde vor vielen Jahren ein schier unglaublich ambitionierter pädagogischer Versuch gestartet und dann mit der damals noch futuristischen Namensgebung auch gleich schon lächerlich gemacht. War es die Morgenröte der Aufbruchsstimmung der frühen Regierung Brandt, die unbemerkt auch das sachliche Waldheim erfasste, Jahre im Voraus? Oder war es beinharter Zufall, Chaosfraktal, kartografisches Misslingen?
War eine Trinkwette im Ministerium der Ausgangspunkt?
Jeder Lehrer unterrichtet hier alles: den Bauerntölpel bis hin zur blitzgescheiten Advokatentochter, das hochbegabte Prinzesschen des Totengräbers und den dummen Bastard des Priesters. Einer der Lehrer ist Dr. Katz.
Noch immer veratmet das Haus einen Hauch fast studentischen Idealismus. Vielfach eingesogen und wieder ausgeblasen, mit Pestbrodem und Winden des Leibes vermengt, ist daraus das Allerschlimmste geworden: hohles Pathos, übler Schwulst.
Und Dr. Friedrich Katz, so unglücklich und gebeutelt, ja schlicht fertig er auch ist: Schwulst und Pathos halten ihn dann doch erstaunlich lange bei der Stange.
Er wurde einen Tag vor dem Heiligen Abend 1948 in der Bismarckstraße 12 in Waldheim, Ortsteil Grindberg, geboren. Er kam zu früh und mit dem Steiß voran, riss seiner Mutter bei der plötzlichen und rabiaten Niederkunft schier das Innerste entzwei, aber er war zunächst wohlauf.
Das Land lag in Trümmern, vor dem Berner Fußballtriumph und Wiedererwachen der deutschen Lebenslust lag die ganze Vorschulzeit des Knaben, das Datum garantierte darüber hinaus katastrophal terminierte Kindergeburtstage, die folgerichtig nie begangen wurden.
Alles das hätte schon für ein schweres Leben genügt, aber da waren ja die Eltern: Gabriele Katz, eine geborene Stach, die Mutter: Ein alter und langsam anwachsender Familienirrsinn vergiftete das Weib. So soll schon Diebold Stach, ein Urgroßonkel der Mutter Katz, im vorherigen Jahrhundert einen französischen Wanderarbeiter mit der Hacke erschlagen haben. Hans Stach, Fritzens Großvater, verließ zehn Jahre nur zur Notdurft sein Bett und durchweinte viele Nächte. Schließlich starb Gabrieles Bruder Gottwin nach Jahren der heftigsten Trunksucht 1933 von eigener Hand. Ihr Leid war da weniger offenbar, jedoch zur Kindsformung geradezu disqualifizierend: lähmende Angst vor eigentlich allem.
Ständig sah die Mutter Katz ihren kleinen Friedrich schrecklichsten Gefahren ausgesetzt, ständig war sie von Visionen des Untergangs gepeinigt, wenn der Sohn etwas Neues begann. Fritz sollte nicht rennen, springen, tollen, klettern, weil er sonst zerbräche, oben am Hals, bestenfalls gelähmt überlebte, vermutlich aber gar nicht. Er sollte natürlich auch nicht schwimmen lernen, ja was brauchte er denn schwimmen zu können, wenn er einfach lebenslang jedes Gewässer, das größer als ein Waschzuber war, »wie jeder vernünftige Mensch« bitte schön meiden würde?
Er sollte an trüben Tagen nicht hinaus, um nicht von den Tuberkeln gefressen zu werden, er sollte an Sonnentagen nicht in den Himmel schauen, da er sonst erblinde. (Am besten vermied man auch diese Gefahr, indem man zu Hause blieb.) Fritz sollte noch nicht einmal auf dem Bauch schlafen, da dies zur Erstickung führe. Tat er eins davon doch, gab es Kopfnüsse oder Tränen oder beides.
Demgegenüber war der alte Friedrich von stark fordernder Natur. (Ja, Friedrich Katzens Vater hieß ebenfalls Friedrich. Was lag da näher, als den Knaben zur Unterscheidung Fritz zu rufen? Vielleicht die einzige nachvollziehbare Entscheidung der alten Katzens.) Die Nichtkarriere als Haarwasservertreter, die dies verursacht habende Dummheit (er nannte sie »Pech«), sollte dem Vater, seiner Meinung nach, durch einen Siegfried-Sohn vergolten werden.
Ihm also ging die Raubauzigkeit seines Knaben, solche er für notwendig auf dem Wege zur Männlichkeit hielt, niemals weit genug. Ununterbrochen marterte er Fritz mit maskulinem Zeug. Er hieß den Ungeschickten Zweige suchen und hilfsderen Speere schnitzen, woraufhin die Mutter mit dem Kleinen prophylaktisch den Arzt aufsuchte, weil sie befürchtete, er sei Bluter, und die kleinste Schramme könne ihn umbringen. Großzügig und unerbeten deckte der Vater den Knaben mit Baukastenserien der Firma Märklin ein, wobei das einzige nennenswerte Modell, das Fritz hinbekam, ein Miniatur-Hau-den-Lukas war, und auch da hatte der Alte noch ungeduldig angetrieben, schließlich enttäuscht mitgeholfen. Im Nebenzimmer heulte während der gesamten Bastelei gut hörbar Gabriele, denn sie stellte sich die schrecklichen Folgen vor, die einträten, wenn man eine dieser kleinen Schrauben verschluckte.
Völlig elend: Beugte sich der Vater noch dem phobischen Erziehungsansatz seiner Frau, was das Schwimmen und Radeln betraf, so war er in Bezug auf – ausgerechnet – das Ringen nach Wettkampfregeln fest entschlossen, Fritz zu stählen.
Ringen im Unterschied zum Boxen entstellte nicht, Ringen brachte im Gegensatz zum Fußball keinen Kontakt mit ungezogenen Kindern mit sich, denn Ringen war klassisch, das hörte man ja: griechisch-römisch! Bitte schön.
Fritz war noch keine sechs, als er mit seinem Vater die Sporthalle betrat, wo Katz senior ihn zu regelmäßigem, hartem Training anmelden wollte. Ein vierschrötiger Übungsleiter musterte den kleinen, bereits etwas schmerbäuchigen Knaben und meinte, in drei bis vier Jahren könne man es versuchen, aber er zweifle, wenn er ihn so sehe. Vielleicht sei Gymnastik besser: »Willst du denn ringen, Bub?«
»Ja«, antwortete Fritz eifrig, »ja, denn es wird mich stark machen! Aber es ist auch gefährlich, und davor habe ich Angst. Ich möchte deswegen nur im Stehen ringen. Nicht fallen, nur das nicht! Sonst breche ich mir was! Im Stehen aber will ich tapfer ringen.«
Der alte Friedrich Katz ertrug den Blick des Sportlers keine Minute und verließ mit seinem Sohn rasch die Halle. Unter der Humboldtbrücke schlug er sein Kind. Zu Hause noch einmal.
Neben diesen absurd zuwiderlaufenden Ansprüchen der Alten an ihren Sohn gab es wenig Nennenswertes in Fritzens früher Kindheit.
Beispiele, wenn nicht gar eine Aufzählung der seltenen Unternehmungen:
– Einmal und nur einmal suchte die Familie im verzweifelten Imitat der Gemeinsamkeit einen Zirkus auf. Gabriele fiel hier natürlich von einer Ohnmacht in die nächste, Vater Friedrich geriet darüber in Harnisch, zugleich und zusätzlich erbitterte ihn die erzieherische Nutzlosigkeit und mithin verweichlichende Wirkung dieses Nachmittags.
Fritz aber war wie benommen von der Pracht der Schau. Lachend winkte er den Clowns, atemlos versprach er sich allem Guten, kämen nur die kühnen Trapezartisten ordentlich zurück, wohlig schauderten ihn die Löwen und Tiger, fröhlich und unbegabt tappte er den Takt der schrägen Kapelle.
Dann ging es ab nach Hause. Ins Bett, Licht aus.
– Einmal und wieder wirklich nur einmal gingen die Katzens ins Kino. Ein italienischer Kinderfilm, in dem recht melodramatisch eine Jungenfreundschaft im Nachkriegs- milano inszeniert wurde: Der allmähliche Aufbau totalen Vertrauens zwischen zwei glutäuigen Buben, der Bruch desselben durch den bis dahin eigentlich edler angelegten der zwei Hanswurste, tränenreiche Versöhnung, Schluss. Der erwachsene Fritz Katz hätte den Film geliebt (Schwulst, Pathos), der Knabe begriff nichts, da »Freundschaft« für ihn ein Abstraktum darstellte, etwas war, von dem er wusste, dass es existierte, das er aber mit keinerlei Semantik ausstatten konnte. Er war ratlos, die Mutter sicher, sie und die ihren hätten sich in der abgestandenen Luft etwas eingefangen, der Vater außer sich, denn er interpretierte die Handlung als versteckten Aufruf zur gleichgeschlechtlichen Liebe.
– Überhaupt nicht zu begreifen ist dann ein Freibadbesuch Anfang der Fünfziger. Er fällt so aus jedem Rahmen der Erinnerung, dass Fritz Katz heute mitunter denkt, er habe überhaupt nicht stattgefunden, argwöhnt, er habe das Ganze nur geträumt: Wie sie da zu dritt schwitzend auf der Wiese hockten, zu verklemmt, auch nur Badekleidung anzulegen! Besaßen sie denn überhaupt welche, angesichts der totalen Ablehnung des Wassersports durch die Mutter? Vielleicht hatten sich die Alten widerwillig dem Kinderarzt Dobschütz gebeugt, der Fritz nahe einer Rachitis sah und aushäusiges Sonnenanbeten anmahnte?
Jedenfalls passierte an diesem Tag, man möchte es der Mutter fast gönnen, tatsächlich ein kleines Unglück. Eine Biene stach Fritz in den Zeh, als er gerade mal gewagt hatte, wenigstens einen Schuh auszuziehen. Er weinte, die Mutter schrie, der Vater ging wortlos davon, seine beiden jammernd hinterher, die Leute lachten, Kinder zeigten auf Fritz, der sei es, der sei der, mit dem keiner spielen wolle.
– Schließlich der ganz besondere Tag, eine Reise – nun ja, fast eine: Der kleine Katz behauchte voller Freude die kalten Scheiben des Zugabteils und fingerte linkisch Blumen ins Beschlagene. Familie! Er hatte immer gedacht, das seien nur sie drei – und nun fuhren sie zu Verwandten, sogar nach Heilbronn, wo das berühmte Schloss stand. Fritz irrte an dieser Stelle, verwechselte Heilbronn mit Heidelberg, aber mit seinem ursprünglich, numerisch bescheidenen Familienbegriff war er so falsch nicht gelegen: Seine Mutter war früh Vollwaise geworden, der Weg des Gottwin Stach wurde schon erwähnt, Friedrich hatte ebenfalls alle verloren außer seinem älteren Bruder: Bert. Die Katzbrüder verabscheuten sich freilich zutiefst.
Dies nicht ahnend, malte Fritz glücklich eine neue Blume aufs Fenster, wimmernd ertrug er die Kopfnuss des Vaters und den Tadel, er möge kein Mädchenzeug machen.
Die Unternehmung endete bereits im Vorgarten eines düsteren Siedlungshauses in Heilbronn-Neckarsulm. Kaum hatte Fritz fröhlich seiner neuen Verwandtschaft zugewinkt, kaum hatte er einen Blick auf seine überirdisch schöne Cousine geworfen und den Namen »Laura« in seine Seele genommen, da wurde es laut.
»Mehr hat es nicht gegeben, unser Elternhaus war kein Palast.«
»Du betrügst mich doch!«
»So ist es recht, ich erledige den Papierkram und werde dann auch noch verdächtigt! Hier nimm dein Geld, es ist abgezählt.« Onkel Bert musterte Fritz: »Euer Sohn ist schmutzig«, sagte er. »Bei deiner Haarwasservertreterei kommst du doch vielleicht wenigstens billiger an Seife!«
Friedrich Katz wandte sich um. »Wir gehen.«
Fritz verstand nicht, was geschah, auch nicht, warum er am Abend kalt baden musste, aber später im Bett genoss er immerhin ein wenig den eigenen Wohlgeruch und die Erinnerung an Laura.
Wir müssen es nicht begründen, dass der dickliche Fritz in der Schule – vorsichtig formuliert – mehr als ein Problem hatte.
Im körperlichen Spiel täppisch, in seinem intellektuellen Vermögen spürbar limitiert, saß er in der letzten Bank und unterwarf sich seinen Lehrerinnen. Aber auch diese, obwohl sie ihn vordergründig für sein Wohlverhalten lobten, waren von dem schwammigen, devoten Knaben insgeheim leicht abgestoßen.
Am späten Vormittag nach den Lektionen liebte es Fritz dann, eine von der Mutter dick bestrichene Butterbrezel in der häuslichen Küche zu schmausen. Dazu erzählte er, was er alles einmal erleben wollte, wenn es nur einmal so weit wäre, etwas zu erleben.
Die fröhlichen Stimmen der kickenden Nachbarsjungen schallten aus dem Hinterhof, die Mutter schloss das Fenster.
Ja, er war nun Schüler, nein, er hatte keine Schultüte gehabt – dafür gab es noch nicht einmal einen Grund, die Eltern hatten sie einfach vergessen.
Durch einen Tränenschleier verfolgte Fritz daher die Einschulungsfeier. Aber was war das? Ein großer prächtiger Kasten wurde auf die Bühne geschoben, ein kleiner Vorhang ging auf, und der Kasper und der Seppl erschienen. Von denen hatte er doch schon einmal gehört!
Fritz verfiel augenblicklich dem ihm bis dato unbekannten Handpuppenspiel. Und da die Eltern wenigstens diesmal ein wenig Reue verspürten, ihren Bub so karg durch die Welt zu schicken, kauften sie ihm zu Weihnachten ein kleines Puppentheater.
Es folgte die glücklichste Zeit in Fritzens Leben: In großen, spontan ersonnenen Epen traten neben den tradierten Figuren der Großmutter, des Krokodils und des Kasperles zahllose Ungeheuer auf, die er durchaus erfindungsreich mit einfachen Socken repräsentierte, die er in der Art der Klappmaulfigur einsetzte. (Stets siegte die Großmutter.)
»Lieber Gott, ich danke dir für meine Eltern«, waren nicht selten seine letzten Worte des Tages, geflüstert in die Dunkelheit und Stille seiner Kammer, »und für das Kasperletheater. Amen.«
In einer Hinsicht unterschieden sich Fritzens Dramen von sonstigen kindlichen Rollenspielen allerdings beträchtlich: Je weiter er in die Beherrschung des Alphabets vordrang – es ging keineswegs flott, aber es ging so eben – desto absonderlicher wurden die Namen der Sockencharaktere: »Schoppenhauer«, »Nizsche«, »Jünger«, »Gööte«. Dieses verdankte sich Fritzens unverständigem Stöbern in der wahllosen, unbenutzten elterlichen Bibliothek. Genauer gesagt der zwölfbändigen Remittentenkollektion: DIE DEUTSCHEN MEISTERWERKE. (Das war die Bibliothek.)
Diese scheinintellektuelle Namensplünderei war den Alten plötzlich recht, ja, die Mutter stellte geduldig die Bände wieder an ihren Platz, wenn er sie auf dem Teppich verstreut hatte, denn sah man da nicht eine eventuelle Genialität aufkeimen?
Natürlich nicht, aber er hatte Freude daran.
Unverändert pflegte auch noch der Drittklässler diese Passion, täglich stundenlang beschäftigte er sich mit seinem Theater.
Mit was oder wem auch sonst.
Einmal immerhin fragte er in der großen Pause Rudolf Stemm (ja, den späteren Chef): »Willst du mich nicht einmal besuchen?«
Rudolf schaute an Fritz vorbei und kratzte sich an der Lederhose. »Ich muss Hausaufgaben machen. Ich muss üben.«
Fritz lachte: »Aber Rudolf, heute ist Samstag! Wir müssen nichts lernen.«
»Ich schon«, entgegnete Rudolf. Er konnte den einsamen Kameraden auch weiter nicht ansehen. »Was sollten wir gemeinsam tun? Du kannst nicht Fußball spielen!«
»Das stimmt«, pflichtete Fritz bei. »Oder ich weiß es eigentlich nicht, es ist mir zu gefährlich, das ist es.«
Rudolf nickte: »Das ist es. Genau. Ich muss jetzt gehen. Die Suppe wird kalt. Wenn sie kalt ist, krieg ich den Riemen.«
»Wir können aber schon etwas spielen«, barmte Fritz. »Ich habe ein Kasperletheater!«
Rudolf rannte weg.
Fritz überlegte, was wohl da hinter ihm Interessantes sein mochte, wo der Rudolf immer hingeschaut hatte. Er drehte sich um. Eine Mauer, Ziegel, rotbraun.
»Lieber Gott, ich danke dir für meine Eltern und für das Kasperletheater. Amen.«
Sie nahmen es ihm weg. Eines Tages, in einem Moment seltener Einmütigkeit. Mit der Genialität war es nichts, das sah man an den Zensuren. Und die Mutter hatte beim Frisör gelesen, zu große Fantasie mache bisweilen krank. Vater Katz war fast zeitgleich – nach immerhin zwei Jahren – zu seinem Standardverdacht gelangt: Eine Junge, der mit Puppen spielt, der wird am Ende ein Puppenjunge.
Nächte durchweinte der Knabe da, gleich seinem Ahnen, nächtelang drang sein Gewimmer durch die muffigen Räume der dunklen Wohnung und löste bei seinen Eltern durchaus Beklommenheit aus. Nicht etwa, weil sie ihr Büblein so leiden ließen, vielmehr reute es sie, das offensichtlich schädliche Treiben nicht früher unterbunden zu haben.
In einer dieser Nächte, ein schwüler Maimond verwirrte ohnehin die Seelen und hinderte am Schlaf, besannen sich Friedrich und Gabriele darauf, es doch noch einmal mit einem Geschwisterchen für Fritz zu versuchen.
Ein aberwitziger Zeitpunkt für eine Lebensentscheidung, ein Punkt im Zeitkontinuum, als habe ein Kerbtier mal eben dahindefäkiert – aber was soll es, man macht halt so vor sich hin, Friedrich hatte noch nicht einmal Lust, obwohl die Mutter ausnahmsweise die furchtbaren Ängste, die ihr seine Penetrationen verursachten, für sich behielt.
Während ihr Gatte tierhaft und unglücklich in sie drang, erfüllte sie der Alb eines blutigen Fleischklumpens, der ihr statt eines Menschen als Leibesfrucht erwüchse. Immer größer wurde das schreckliche Bild, und fast dankbar war das geplagte Weib dafür, denn dieses Grauen maskierte ihr den tiefen rhythmischen Schmerz in den Lenden.
Die Zeugung misslang, worüber das Paar nie sprach. Es war halt wieder etwas fehlgeschlagen, und so war es eben.
Und apropos Fehlschlag: Katz kam in die vierte Klasse.
Eine der ersten Hausaufgaben war es, einen sachlichen Bericht über die dahingegangenen Sommerferien abzufassen. Fritz legte sich ins Zeug. »Jetzt gilt es!«, hatte der Vater gesagt und die Mutter mehr oder weniger das Gleiche. Also vertrugen sich seine Eltern doch! Er war froh und zeigte am nächsten Morgen voller Eifer auf.
Die verdiente Lehrerin Helga Wuttig, neu in Katzens Klasse, war ein wenig überrascht: »Was ist denn Kind? Fritz heißt du, nicht wahr.«
»Friedrich Katz«, korrigierte sie der Knabe unter albernem Gekicher. »Aber man darf mich Fritz nennen.«
»Soso«, die Lehrerin verkniff sich einen Tadel. »Und was ist nun so wichtig?«
»Ich möchte meinen Aufsatz vorlesen!«
Seine Mitschüler waren schon manches gewohnt, es lachten nicht einmal viele. Die neue Lehrerin musste freilich ein wenig um Fassung ringen.
»Wir haben gerade Rechnen!«
»Ich weiß«, Fritz nickte, dienerte. »Aber darf ich meinen Aufsatz vorlesen?«
Nachdem sich dieser Dialog fast wortwörtlich auch in der Mal- und in der Singstunde wiederholt hatte, wurde sein Flehen erhört.
»Jetzt haben wir Deutsch«, sagte Wuttig mit kalter Stimme. »Also Fritz, liest du uns deinen Urlaubsbericht vor?«
»Gerne!«, rief der kleine Katz. Und schon dieses schrille »Gerne!« verleitete einige Kameraden zu halblautem, verächtlichem Imitat.
Fritz, davon nicht berührt, berichtete von einer Reise nach Salzburg, die er mit seinen Eltern in den letzten großen Ferien unternommen habe. Die war natürlich erfunden. Die Lüge wäre aber vielleicht nicht einmal aufgefallen, denn die Katzens waren wie immer kaum unterwegs, also quasi unsichtbar gewesen, nur packte Fritz dann doch zu viele Phantasmen in sein Werk. Längst war ihm ein unlösbarer Selbstanspruch eingewoben, der sich der tödlichen Gegensätzlichkeit seines Elternhauses verdankte. Hier erfüllte ihn die ganze Welt ob ihrer Bedrohlichkeit mit Angst, sah er sich genötigt, größte Vorsicht walten zu lassen, da glaubte er, als Junge dem schlichtesten Alltag aber auch ständig etwas Abenteuerliches und Sensationelles abgewinnen zu müssen – und leider drängte es ihn in seinem Text, hiervon zu zeugen.
Also war sein Salzburg von karibisch anmutenden Seuchen bedroht, derer man sich nur erwehren konnte, indem man sich die Zähne mit Cognac putzte (er hatte dieses Motiv aus einem Zeitungsbericht über das Leben der Weißen in Belgisch-Kongo – unwissend sprach er das Wort auch noch »Kocknack« aus). Andererseits wollte der feiste Bub aber im »Salzburger Wald« dann einem Bären begegnet sein, den er mithilfe einer selbst gefertigten Steinschleuder vertrieben habe. Unter dem anschwellenden Stöhnen seiner angewiderten Klasse las er – ausnahmsweise wirklich tapfer – weiter: Ein abendlicher Besuch in der Oper, die Zauberflöte, die wunderschön gewesen sei, freilich so laut, dass man in der Pause, um Hörschäden vorzubeugen, gehen musste. Ein tropfender Wasserhahn in der Hotelsuite (erneut quälend seine Buchstabentreue beim Verlesen des Wortes), den sein Papa und er mit dem mitgebrachten Werkzeugkasten reparierten.
So ging es weiter, und es ging nicht gut.
Schließlich kam er zum Ende seines langen Lügenwerks:
»… und nachdem wir nun so viel Schönes gesehen hatten und alles ohne Krankheit überstanden hatten, fuhren wir wieder nach Hause. Papa verladete das Gepäck in unseren Mercedes. Mama und ich saßen in einem hübschen Café und aßen Bratwürstchen. Dann gingen wir noch im Meer schwimmen, dann fuhren wir zurück über den Bremerpass. Es dauerte sehr lange, bis wir durch Italien durch waren und endlich in Basel wieder in Deutschland waren. In Italien muss man die Fenster geschlossen haben, weil es gibt dort noch manchmal die Pest. Mama hatte einen Sonnenhut auf, der war wunderschön. Und auf der Rückfahrt sangen wir Lieder. Und zu Hause ladete ich meine Freunde ein.«
Bleierner Hass erfüllte gleich einem giftigen Gas den Raum. Kinder sind ja keineswegs gnädig, Schulkinder noch weniger. Es wäre nun Sache der Lehrerin Wuttig gewesen, mit erzieherischem Takt rasch von Fritz und seinem Werk abzulenken, aber in uneingestandener Abneigung gegen den devoten Hinterbänkler forderte sie sogar Redebeiträge von ihren Schülern, als ob es sich um einen normalen Aufsatz gehandelt hätte, der eine wohlmeinende Aussprache verlangte.
Und nun, zwangsenthemmt, ließen es die Kameraden hoch hergehen:
»Der lügt, der Fritz!«
»Die haben gar keinen Mercedes!«
»Salzburg liegt, glaub ich, an keinem Meer! Und Italien ist auch nicht dazwischen, da ist nichts dazwischen!«
»Der war gar nicht dort, die haben gar kein Geld.«
»Was soll das mit dem Hut?«
»Das mit dem Bär ist bestimmt auch gelogen.«
»Erst sagt er, dass es in der Oper da so irgendwie wunderschön gewesen sein soll, und dann gehen die wieder.«
»Also mein Papa hat eine Firma, und wir sind wirklich manchmal in Hotelen, und wenn da etwas kaputt ist, dann repariert das das Hotel und man nicht.«
»Ich mein, das ist ein Quatsch mit der Pest in Italien …«
»Ich finde, es ist egal, ob die im Auto singen, weil, das ist irgendwie doch gar nicht interessant.«
»Bremerpass?«
»Im Café isst man Kuchen und keine Bratwürstchen …«
»Man sagt nicht ›ladete‹, man sagt ›lud‹.«
»Der schreibt, dass er seine Freunde eingeladen hat. Aber der hat gar keine Freunde …«
Es war eine Hinrichtung, und Lehrerin Wuttig ließ sie grimmig geschehen.
Fritz saß regungslos da, zunächst in gespielter Souveränität, die allmählich Entsetzen Platz machte.
Erst als der arrogante Joseph Edler von Bazner, der sich soeben schon mit seinen Hotelkenntnissen hervorgetan hatte, ohnehin viel von sich und den seinen hielt, unbotmäßig zu hetzen begann: »Der alte Katz war nämlich schon genau so einer, mit dem war mein Vater auf dem Gymnasium, der ist geflogen, das ist eine Bagage!«, raffte sich die Lehrerin auf, dem Ganzen Einhalt zu gebieten, noch immer nicht um Fritzens willen als vielmehr aus Abneigung der dynastisch Sozialdemokratischen gegen den Adel:
»Schluss jetzt! Jetzt ist es gut. Joseph, beherrsche dich … So redet man nicht über Klassenkameraden und ihre Familien!«
Die späte Hilfe erreichte Fritz nicht mehr. »Ich wollte doch nur, wollte doch nur, wollte doch nur fleißig sein, es gut machen, weil nämlich …«, stammelte es in seinem brausenden Kopf. Und er merkte, dass er sich nur in dieses Rauschen zurückziehen musste, um weg zu sein. Aber weg, wo war das? Und wo war dann die Mama?
Helga Wuttig brauchte Stunden, um sich von der erbärmlichen Szene zu erholen, und im Laufe dieser Zeit schämte sie sich immer mehr, den Kleinen derartig ins Messer gestürzt zu haben.
So bat sie ihn, nach der letzten, der Religionsstunde noch ein wenig zu bleiben. Ergeben nickte er da, kaum hörte er Joseph zum Rudolf Stemm wispern, nun bekomme der Katz nochmals Senge. Sollte es doch geschehen, es war ja anscheinend nur gerecht.
Als alle gegangen waren, griff die Lehrerin in ihre Schublade, und der Knabe war sich sicher, sie brächte nun ein Beil, mindestens ein Schlagholz zum Vorschein. Damals wurde ohnehin noch getatzt, er aber würde getötet. Jedoch: Es war eine Tafel guter Schokolade, von der Pädagogin in diesen mühsamen Aufbaujahren selbstlos für besondere Gelegenheiten im Klassenzimmer aufbewahrt. Mit der winkend, setzte sie sich nun mütterlich lächelnd zu ihm in die letzte Bank.
Wogen der Dankbarkeit und des Selbstmitleids durchfluteten den Kleinen, und leise weinend nahm er die fast wortlos offerierte Tafel entgegen. Seinerseits wortlos bot er der mächtigen Frau, die so nach Belieben die Schwärze und das Licht sein konnte, ein Rippchen an, und sie nahm es, hielt es für Versöhnung. Dabei war es Unterwerfung unter ein fürderes Lebensprinzip des Friedrich Katz Junior: Freude und Schmerz in steter notwendiger Umarmung zu sehen, eins nicht ohne perverses Mitempfinden des anderen zu fühlen. Und infolge davon und dieser erlebten Macht, dieser über allem stehenden Macht, erwuchs ihm noch etwas: der brennende Wunsch, Lehrer zu werden.
Vom ersten Aufkeimen des Berufswunsches war es natürlich noch ein weiter Weg bis zur Verbeamtung.
Da waren die Macht und die Güte in eins gesetzt, da war die Lehrerin Wuttig, aber da waren eben auch die strengen Eltern, die ihre ganz eigenen Pläne hatten und zunehmend mit ihm darüber sprachen, einzeln, wenn der andere gerade nicht da war. Und ach, er liebte doch seine Eltern und wollte ihnen wohlgefällig sein. Nur – es ging nicht, es ging wirklich nicht!
Vaters Zukunftspläne passten überhaupt nicht zu allem vorher: Zwar sollte der Sohn heldisch sein, ein Wildfang und Lausebub, und da enttäuschte er den Alten ja schon ein ums andere Mal, später aber hatte er nach Friedrichs festem Willen gänzlich solid zu sein. Und immerhin, der Vater ließ ihm ja die Wahl: Rechtsanwalt oder Notar.
Die Mutter, bei all ihrer Angst, eigentlich die personifizierte Angst seiend, trieb es noch toller.
Wenn er nur erst einmal gesund groß geworden wäre, Gott gebe, dass dieses nahezu Unmögliche gelingen möge, sollte er nach ihrem Willen zur Armee. Jawohl, zur Armee! Tatsächlich. In den Krieg, am besten in den Krieg!
Gabriele wunderte sich ja selbst – aber ein Soldat in schmucker Uniform, der rührte etwas in ihr an, für das sie keine Worte hatte. Wäre sie weniger verschreckt im Leben gestanden, dann hätte sie sich einem General geschenkt, jedem General, zwei Generälen zugleich, zwei strengen Generälen mit Hundepeitschen am liebsten. Das hätte sie freilich nicht einmal unter Hypnose oder Folter gestanden.
Fritz verstand nichts mehr, nichts mehr, gar nichts: Das bisherige Erziehungsparadox der Alten hatte ihn doch schon verdreht und gewürgt, und nun stand es auch noch auf dem Kopf!
Und ihn grauste ohnehin vor all diesen Entwürfen: Was ein Notar oder Rechtsanwalt tat, war ihm nicht ganz klar, dass es aber viel mit Lesen und Schreiben zu tun hatte, das glaubte er zu wissen. Wie sollte er, der er nicht einmal begriff, wann das Gänsefüßchen oben, wann unten hingehörte, das denn ein Leben lang schaffen? Denn ein Leben, das sah er doch an seinen Eltern, war eine harte, lange und zähe Angelegenheit.
Aber stattdessen in den Krieg? Zur Armee? Das war gefährlich. Gefährlich! Er wollte die Mutter nicht traurig machen, nicht indem er in der Schlacht fiel, nicht indem er gar nicht in die Schlacht zog. Es ging nicht, nichts ging.
Konnte man bei der Armee Notar sein? War das weniger tödlich? Lag hierin ein Entrinnen?
»Vater, gibt es bei der Armee Notare?«
»Nein.«
»Rechtsanwälte?«
»Nein.«
»Oh.«
»Was soll das, hör auf zu weinen!«
»Ja, Vater.«
Fritz versuchte wochenlang an nichts zu denken, aber das ließ ihn sich nur noch schwindliger fühlen und verbesserte nebenbei keineswegs seine Zensuren. Schwankend ging er Ende der vierten Klasse in die Prüfungen für den Eintritt ins Gymnasium.
Man begann mit dem Diktat. Durch eisernes häusliches Üben mit seinen gemeinsam auf ihn einschreienden Eltern hatte sich leider eine Menge Ballast angehäuft, sodass Regeln wie: »Nach l, n, r, das merke ja, steht nie tz und nie ck« – »Wer nämlich mit ›h‹ schreibt, ist dämlich«, und wie die öden Merksätze alle heißen mochten, die letzte Geläufigkeit im Schreiben ausgetrieben hatten. Er konnte dem Prüfungstext kaum folgen, gerade ein falsches »tz« in »Herzlichkeit« verhalf schließlich zur glatten Sechs.
Bevor die bekannt gegeben wurde, kam es dann auch noch im mathematischen Teil der Abschlussexerzitien zur Katastrophe. Fritz knobelte heftig an einer Textaufgabe herum: Sechs Arbeiter brauchen sechs Tage, um das Haus zu bauen, wie lange brauchen neun? Neun Tage, das lag nahe und konnte doch nicht sein! Wieso brauchen mehr Männer länger?
Möglicherweise weil es auf den ohnehin gefährlichen Baustellen häufiger zu Unfällen kam, wenn man sich gegenseitig im Weg stand? Aber wie ließ sich das berechnen, Gefahr war doch etwas Unberechenbares! Und überhaupt, es dauerte doch viel länger, ein Haus zu bauen! Vater wollte eins, seit Fritz denken konnte, und es stand immer noch nicht! Waren sie anders als andere? Manchmal dachte er das.
Waren sie krank?
Ja, sie waren krank, das musste es sein! Deshalb weinte die Mutter, war der Vater so mürrisch und deshalb spielte niemand mit ihm, die anderen hatten Angst, dass sie sich ansteckten.
Dann aber musste es eine schwere Krankheit sein.
In seiner Furcht und Verwirrung entging Fritz sein Harndrang, und er erfuhr erst, dann aber ziemlich laut, vom Aufsicht führenden Konrektor Wendt, in einer »schändlichen Lache« zu sitzen.
Danach erfuhr es die ganze Schule, alsbald das ganze Viertel.
Fritz wurde wegen erwiesener geistiger und seelischer Begrenztheit vom Besuch der Mittel-, gar der Oberschule ausgeschlossen. Es ging dabei unter, dass sein Versagen in gewisser Weise ein glückliches war – er hatte dermaßen schlecht abgeschnitten, dass er die vierte Klasse sogar wiederholen musste, was ihm ja durchaus Chancen eröffnen konnte. Aber so weit dachten die Katzens nicht, gar nichts dachten sie, wütend waren sie. Die häuslichen Folgen waren einfach nur katastrophal. Der Vater sprach so gut wie nichts mehr mit ihm, bei der Gelegenheit dann auch gleich nichts mehr mit der Mutter, das Weib war ja schuld mit ihrer Furchtsamkeit.
Die Mutter ihrerseits war überzeugt, der Vater mit seinen grobschlächtigen Ansprüchen habe den Verstand des Kindes auf dem Gewissen. Ja, das zivile Männliche war ihr nun endgültig verleidet, und auch der kleine Fritz war eben männlichen Sexes. Kaum ein Wort mehr drang also auch über ihre Lippen, abgesehen von knappen, kalten Alltagsanweisungen. Die symbiotischen Butterbrezeln wurden abgeschafft, und Fritz erhielt ein Jahr Hausarrest, eine lächerliche Maßnahme, da ihn ohnehin nur der Schulweg ins Freie führte, und den musste er ja weiterhin gehen.
Es war eben einmal mehr absurd: Das Kind sahen sie beide als missraten an, die erträumten Laufbahnen waren abgehakt. Ihr lebenslanges Bestreben, gesellschaftlichem Maß zu genügen, verbot es, den Ehrgeiz wirklich fahren zu lassen und den Jungen beispielsweise davonzujagen oder verhungern zu lassen.
Nein, nach außen hin wurde tapfer aufrechterhalten, dass Fritz nach Kräften gefördert würde. In ihrer seelischen Umnachtung spielte es für die Alten keine Rolle mehr, dass es außen niemanden gab, den die Progressionen im Hause Katz interessiert hätten, ja, dass es eigentlich gar kein außen gab.
Aber lassen wir das für den Moment, kehren wir aus der Düsternis zurück. Er ist doch groß geworden, Lehrer, ein ehrbarer Beruf! Unser Ausgangspunkt – jener Dienstag im 21. Jahrhundert in der Woche ohne Montag! Ja, kehren wir dahin zurück, es ist Herbst, das ist nicht gerade Sommer, aber auch nicht Winter. Herbst, den kennt Katz, letztes Jahr war auch Herbst und davor schon oft. Aber er bekommt Besuch, das kennt er weder privat allzu gut, noch ist es ihm beruflich oft passiert. Ja, jetzt fällt es ihm wieder ein. Eine neue Schulrätin würde ihn besuchen, sogar der Name kehrt zurück: Euler. An einem Dienstag. Diesem.
Der Montag ist und bleibt weg. Er muss sich setzen. Im Bestreben sich zu erinnern, fällt ihm etwas anderes wieder ein.
Vielleicht kommt sie wegen dieser Sache mit Jessicas Mutter? Katz fängt an zu schwitzen und zu zittern. Alles ist wieder da, das ganze schreckliche Erlebnis, wo er es doch so schön, er denkt wirklich das Wort »schön«, vergessen hatte.
Da Dr. Fritz Katz auch schon vor Jahren von seinen studierten Fächern gerade noch so viel verstanden hat wie von allen anderen denkbaren außer, sagen wir, Kambodschanisch, ihn sein Chef Rudolf Stemm aber mit Arbeit versorgen musste, hatte der Direktor vor zwei Jahren einen gewagten Versuch unternommen. Katz sollte »probehalber« den Sport in einer fast ausschließlich von Spätaussiedlern besuchten neunten Klasse des Förderschulzweigs übernehmen.
Zwar gab es im Vorfeld der Besetzung Einwände dergestalt, dass rechtliche Folgen drohten, falls Katz irgendein Polnisches gegen die Wand rennen ließe, aber der bei der betreffenden Sitzung fast nur physisch anwesende Doktor selbst zerstreute diese Bedenken, indem er eine Fortbildung erfand, die ihn »ganz legal« in den Stand setzte, auch Sport zu »geben«. Das entsprechende Diplom liefere er »bald« nach. Zu Hause hatte ihn seine Lüge gewundert, denn Sport interessierte ihn nicht. Was war in ihn gefahren? Irgendwie hatte er sich geehrt gefühlt, zumindest wahrgenommen. Aus ähnlichen Gründen kaufen Senioren bei einschlägigen Veranstaltungen Heizdecken für jedes Zimmer.
Es ging dann noch am besten, wenn der Doktor jedes Mal Abwerfen spielen ließ, wozu die limitierten Kinder gern den Medizinball verwendeten, was ihm wiederum erst auffiel, als sich ein tauber Russe die Nase brach. Stemm zog Katz aus dem Fach ab.
Jedenfalls war der Doktor in jener kurzen Zeit fast am meisten an der grenzdebilen Jessica Brahms verzweifelt, die sich mitunter schon beim Betreten der Halle einnässte. Das war selbst ihm zu viel, das tat man nicht, das war doch ihm sogar nur einmal passiert!
Daher entschloss er sich, die Mutter … Nein, noch nicht!
II.
Halten wir noch inne. Wenn man Katzens Biografie in ihrer ganzen Dürftigkeit begreifen will, ist es zu früh, jetzt schon den Besuch der Rätin in jener Woche ohne Montag, gar die von Katz kurzzeitig fälschlicherweise angenommene Ursache vorzustellen. Es handelt sich um eine allzu widerliche und korrupte Aktivität des Doktors, deren Offenlegung uns abhielte, uns weiter mit ihm zu befassen.
Die Rätin kommt im Herbst. Setzen wir früher an. Sechs Monate vor der Rätin geht Katz zur Schule, natürlich, wohin sonst. Die Woche beginnt. Und sie hat einen Montag. Heute.
Es wird eine sehr schlimme Woche werden, aber die letzte ihrer Art. Denn in dieser Woche geschieht immerhin etwas Erfreuliches, was leider Katzens Vernichtung beschleunigt. Vielleicht begreifen wir ihn besser, wenn wir damit beginnen?
Leidlich mutig betritt Katz soeben den Gesamtschulverbund 2000. Er hat ein leichtes Stechen hinter der Stirn, da er auch an diesem Wochenende vom Wein nicht lassen konnte. Dennoch versucht er, sich morgendlichen Elan einzubilden. Schließlich hat es am Freitag mit der 8b des Hauptschulzweigs, seiner Klasse, gar nicht schlecht hingehauen. Und vielleicht waren ja die vielen Gespräche, die er mit den Kindern … (Diese waren in Wirklichkeit halluzinierte Selbstgespräche am Küchentisch.)
»Guten Morgen, Dr. Katz!«, ruft ihm ein Mädchen zu.
So etwas erlebt Katz ganz selten und erfreut sagt er: »Guten Morgen! Ich würde dich gerne mit Namen anreden«, fährt er übereifrig fort, »aber bei so vielen Schülern, Entschuldigung, Schülerinnen und Schülern … weil nämlich …«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: