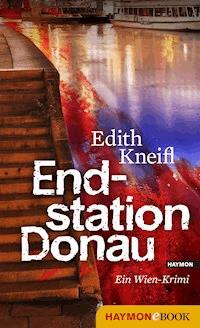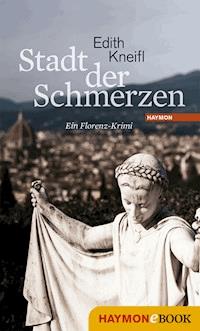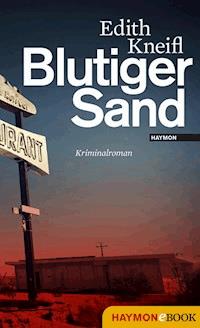Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Katharina Kafka & Orlando-Krimis
- Sprache: Deutsch
DER TOD, DAS MUSS EIN WIENER SEIN. Ein Großstadtkrimi der besonderen Art vor dem Hintergrund des Wiener "Grätzels" Margareten: Eine junge Frau wird grausam getötet, eine Serbin kommt bei einer mysteriösen Gasexplosion ums Leben, eine dritte, die eigentlich keine Frau ist, entgeht dem Tod nur knapp. DANN SCHLÄGT DER SERIENKILLER NOCH EIN WEITERES MAL ZU … Die rothaarige Romni Katharina Kafka, Kellnerin in einem Margaretner Café, verfolgt die Morde in ihrem Stadtviertel mehr mit Neugier als mit Schrecken. Doch als der geheimnisvolle Täter dann auch sie ins Visier zu nehmen scheint, nimmt sie selbst die Fährte auf. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem exaltierten Transvestiten Orlando, verfolgt sie die Spuren des Täters quer durch Margareten. Immer enger wird der Kreis der Verdächtigen, die eines mit Sicherheit nicht sind: die üblichen. Vor dem lebendigen Hintergrund des Wiener Grätzels Margareten legt Edith Kneifl einen Großstadtkrimi der besonderen Art vor: Ein spannender Psychothriller, garniert mit dem liebevoll ausgeschmückten Flair des Viertels rund um das Schlossquadrat und gewürzt mit einer guten Prise schwarzem Wiener Humor. WEITERE KRIMIS MIT DEM ERMITTLERDUO KATHARINA KAFKA UND ORLANDO: "Endstation Donau" "Blutiger Sand" "Stadt der Schmerzen"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edith Kneifl
Schön tot
Ein Wien-Krimi
Die Handlung des Kriminalromans ist gänzlich frei erfunden, wenn auch manche Personen und Schauplätze der Realität entnommen sind. Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang bei den Geschäftsleuten und Wirten des fünften Wiener Gemeindebezirks für interessante und informative Gespräche.
Mein besonderer Dank gilt Dr. Stefan Gergely, der den Impuls zu diesem Roman gegeben und mit vielen Ideen zum Inhalt beigetragen hat.
© 2009
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7438-4
Umschlag- und Buchgestaltung:
Kurt Höretzeder, Büro für Grafische Gestaltung, Scheffau/Tirol
Coverfoto: Stefan Gergely
Diesen Wien-Krimi erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
1. Akt
1
Sonnenaufgang in Wien-Margareten. Eine Stadt, die niemals schläft, mag eine treffende Beschreibung von New York sein, gilt aber sicher nicht für Wien.
Es war kurz vor sechs Uhr früh, als ich durch die menschenleeren Gassen des fünften Bezirks wankte. Auf der Schönbrunner Straße war kaum Verkehr. Geschäfte und Lokale hatten geschlossen. Vor der Kirche, in der einst Franz Schubert aufgebahrt gewesen war, schlief ein Sandler seinen Rausch aus.
Als ich die Pilgramgasse hinaufspazierte, tauchte die Statue der Heiligen Margarete im Morgengrauen auf. Mitleidig schaute die Schöne auf den Drachen herab.
Ich hatte für Märtyrerinnen prinzipiell viel übrig. Grund für Margaretes Martyrium schien jedoch weniger ihr Glaube als ihre Schönheit gewesen zu sein: Die unschuldige Schäferin war vor 1700 Jahren in Kleinasien von einem Stadtpräfekten begehrt worden. Als sie ihn zurückwies, ließ er sie im Gefängnis mit eisernen Kämmen und Fackeln foltern. Doch ihre Wunden heilten immer wieder. Daraufhin verwandelte er sich in einen riesigen Drachen und versuchte, sie zu verschlingen. Das Kreuzzeichen, das sie schlug, rettete sie. Auf dem Weg zur Hinrichtung betete die Arme für ihren Verfolger, wurde aber dennoch enthauptet.
Plötzlich bildete ich mir ein, dass selbst die Margariten, die als Markenzeichen des Viertels über den Fahrbahnen hingen, ihre Köpfchen hängen ließen. Ich hatte eindeutig zu viel getrunken.
Der Himmel über Wien verfärbte sich orangerot, brachte die Dächer der Stadt zum Glühen. Schüchterne Strahlen drangen durch die Häuserzeilen auf die Straße.
Nach der durchwachten Nacht fielen mir beim Gehen die Augen zu. Trotz Frühlingsbeginn waren die Temperaturen auf fünf Grad gesunken. Die Kälte fuhr mir in alle Knochen. Meine Lederjacke war nicht gefüttert und meine Jeans waren zerrissen.
Den Primeln und Narzissen auf den begrünten Verkehrsinseln schien der erneute Kälteeinbruch weniger auszumachen als mir. Dirigiert von unsichtbarer Hand, begrüßte lautes Vogelgeschrei den kühlen Morgen. Ein Schwarm großer schwarzer Raben flog über das sogenannte Schlossquadrat beim Margaretenplatz. Sie bekränzten es mit einer Art Heiligenschein. Vorboten eines Unglücks?
Mein Aberglaube hielt sich in Grenzen.
Kaum waren die Vögel außer Sichtweite, herrschte wieder unheimliche Stille. Dann ließ mich ein lauter Schrei zusammenzucken.
Mir fiel ein, dass in der Nähe eine alte Frau wohnte, die öfters mitten in der Nacht aufschrie. Wahrscheinlich litt sie unter Albträumen.
Seit ich vor ein paar Wochen einen Job im Café Cuadro, einem der Lokale im Schlossquadrat, angenommen hatte, ging ich kaum einmal vor den frühen Morgenstunden zu Bett, obwohl wir meistens pünktlich um Mitternacht Schluss machten. Doch ich genehmigte mir nach der Arbeit gern den einen oder anderen Absacker im nahe gelegenen Motto.
Dieses Lokal in der Schönbrunner Straße war ein Ort, an dem man sich rasch näherkam. Es dominierte dunkles Lila, die übermalten Babypuppen an der Decke und die barocken Stühle passten aber meiner Meinung nach eher als Kulisse in einen Fantasy-Film als in eine coole Bar. Die Musik war jedoch wirklich geil. Außerdem war das Motto ein Paradies für voyeuristisch veranlagte Menschen wie mich. Barflies, Künstler, Sternchen und echte Stars – zu später Stunde trafen sich dort Nachtschwärmer jeder Couleur. Alle hatten nur eines gemeinsam: Sie verstanden es, sich zu inszenieren.
Ausnahmsweise hatte ich heute Nacht mal einen Mann abgeschleppt. Mein One-Night-Stand war die schlaflose Nacht leider nicht wert gewesen. In seinem Atelier im Hinterhof eines typischen Wiener Vorstadthäuschens war es ziemlich ungemütlich gewesen. Wir hatten es halb angezogen und im Stehen getan. Eine schnelle Nummer mit kalten Lippen, kalten Händen und kalten Herzen. Es würde kein zweites Mal mehr geben. Dass ich nicht beziehungsfähig bin, hatte mir ein Psychotherapeut schon vor Jahren schwarz auf weiß bestätigt. Und alles, was sich wiederholte, roch gefährlich nach sich anbahnender Beziehung, nach Besitzansprüchen, Eifersucht und kleinkarierten Machtspielchen.
Nach dem Tod meiner Eltern, ich war damals Anfang zwanzig, hatte ich in Houston, Texas, ein Kriseninterventionszentrum aufgesucht. Mein Psychotherapeut dort behauptete, ich würde mich schlicht und einfach weigern, erwachsen zu werden, wollte an dem Punkt in meiner Entwicklung Halt machen, an dem mir meine Eltern grausam entrissen worden waren. Und ich würde deshalb so gern die passive Beobachterin spielen und mir dabei das Leben der anderen ausmalen, weil es mich davon abhalten würde, mein eigenes Leben zu leben. Wahrscheinlich hatte er Recht. Seit dem gewaltsamen Tod meiner Eltern vermied ich es tatsächlich, Verantwortung zu übernehmen, mich ernsthaft auf etwas einzulassen, sesshaft zu werden, wie man so schön sagt. Insofern wurde ich den Vorurteilen, die die meisten Menschen gegenüber meinen Roma-Vorfahren mütterlicherseits hatten, gerecht.
Immerhin hatte ich mich auf ein Geschichtsstudium eingelassen und war nun also eine arbeitslose Magistra der Geisteswissenschaften. Eigentlich hatte ich vorgehabt, bis zu meinem Vierziger den Doktor zu schaffen. Doch das würde sich nicht mehr ausgehen. Ich wurde in zwei Monaten vierzig und hatte bisher kein spannendes Thema für meine Dissertation gefunden.
Als ich vor dem Schlossquadrat stand, hatte ich plötzlich eine Art Geistesblitz. Vielleicht sollte ich über meinen neuen Arbeitsplatz forschen? Früher stand dort das Schloss Margareten. Nach einem fürchterlichen Brand im Jahre 1768 waren von dem Schloss nur ein paar Steinquader übrig. Zu Maria Theresias Zeiten war die Vorstadt spärlich besiedelt gewesen. Neben dem Schloss waren ein paar Bauernkaten gestanden. Weingärten, Maulbeerbäume und Safranwiesen hatten das Bild geprägt. Um von den kostspieligen Seidenimporten aus China unabhängig zu werden, hatte die clevere Kaiserin Maulbeerbäume pflanzen lassen. Im 18. Jahrhundert hatten sich Textilmanufakturen angesiedelt. All die prächtigen höfischen Gewänder waren in dieser Gegend produziert worden. Auch Ziegeleien und sogar eine Brauerei hatten sich hier niedergelassen, und Margareten hatte sich zu einem Arbeiterbezirk entwickelt.
Je länger ich darüber nachdachte, desto überzeugter wurde ich, dass dieser Bezirk oder zumindest das Grätzl um den Margaretenplatz, das heute fast großstädtisches Flair ausstrahlte, durchaus ein interessantes Dissertationsthema abgeben würde. Aber vielleicht war das auch nur eine besoffene Idee.
Ich musste dringend aufs Klo. Da ich nicht gut irgendwo am Straßenrand hinpinkeln konnte, überlegte ich, auf die Toilette des Cuadro zu gehen. Den Schlüssel für die Tore im Schlossquadrat hatte ich dabei. Die Lokale in diesem Häusergeviert waren durch Innenhöfe und Durchgänge miteinander verbunden. Man brauchte also nicht einmal auf die Straße hinauszugehen, um von einem Lokal ins andere zu gelangen.
Den Schlüssel für den Durchgang hatte mir der Eigentümer nach dem Probemonat zukommen lassen. Bisher hatte ich meinen Chef noch nie persönlich zu Gesicht bekommen. Als ich im Jänner im Cuadro anfing, hatte er sich in Bali aufgehalten. Er war erst seit Kurzem wieder zurück. Meine Kollegen hatten mir natürlich einiges über ihn erzählt. So richtig schlau war ich bisher trotzdem nicht aus ihm geworden. Wahrscheinlich bezeichnete man ihn nicht umsonst als den „Schlossherrn“, den „heimlichen Bezirksvorsteher“ oder sogar als den „Kaiser von Margareten“. Immerhin hatte er das ganze Viertel aufgewertet, indem er seine Häuser von einem Architekten sehr behutsam sanieren hatte lassen.
Ein lauter Knall riss mich aus meinen Gedanken. Eine riesige Stichflamme erleuchtete den Himmel über der Stadt. Das Feuer vermischte sich mit dem Morgenrot, tauchte die Umgebung in einen rotgoldenen Glanz.
Ich wurde von einer Hitzewelle erfasst. Begann zu rennen, rannte auf die Margaretenstraße, achtete nicht auf den Verkehr. Erst das Quietschen der Reifen brachte mich zur Besinnung. Entsetzt bemerkte ich, dass ein Wagen knappe zehn Zentimeter vor mir zum Stehen gekommen war.
Eine elegant gekleidete Dame mit modischer roter Brille stieg aus dem großen anthrazitfarbenen Skoda. Sie war kreidebleich im Gesicht.
Bevor sie womöglich hysterisch herumzuschreien begann, sagte ich scharf: „Hier ist Tempo 50, Madame.“
Sie schien nicht daran zu denken, mich anzuschnauzen, starrte nur gemeinsam mit mir entsetzt auf das in Flammen stehende Haus am Margaretenplatz.
„Der erste Stock ist plötzlich in die Luft geflogen. Ich glaube, das war eine Gasexplosion“, sagte ich.
„Oh Gott“, stöhnte sie und schlug die Hand vor den Mund.
„Wir müssen sofort die Feuerwehr anrufen.“ Ich nahm mein Handy aus der Jackentasche. Vor lauter Aufregung wählte ich die Nummer der Rettung.
Ein paar Minuten später traf die Feuerwehr ein.
Die Frau an meiner Seite wollte hinüber zu dem brennenden Haus laufen. Ich packte sie am Ärmel ihres Nerzmantels.
„Sind Sie verrückt? Sie können dort jetzt nicht einfach hineinspazieren.“
„Aber vielleicht ist mein Mann …“, schluchzte sie.
Ich legte den Arm um ihre Schultern und fragte leise: „Wohnen Sie dort?“
Sie schüttelte den Kopf. „Nein. Mein Mann …, Ex-Mann, hat seine Ordination im ersten Stock.“
„Um diese Zeit wird er wohl nicht in der Ordination sein“, versuchte ich sie zu beruhigen.
Inzwischen war auch die Polizei eingetroffen. Sie sperrte den Platz vor dem Haus ab. Die weinende Frau und ich befanden uns innerhalb der Absperrung. Niemand schien von uns Notiz zu nehmen.
Panische Schreie. Hysterisches Kreischen. Einige Hausbewohner trafen bereits Anstalten, aus den Fenstern im dritten und vierten Stock zu springen, und mussten von den Einsatzkräften zurückgehalten werden. Fasziniert sah ich dabei zu, wie sich die Feuerwehrmänner bemühten, den Brand in den Griff zu kriegen. Zum Glück gelang es ihnen bald zu verhindern, dass das Feuer auf die oberen Stockwerke übergriff.
Durch die heftige Explosion waren einige Fenster im Erdgeschoß und im ersten Stock samt Rahmen sowie Mauerteile aus den Wänden gerissen und auf die Straße geschleudert worden. Auch Mobiliar war aus den Fenstern geflogen. Einzelne Trümmer waren aufs Trottoir gekracht. Das Prasseln der Glasscherben auf dem Pflaster wurde durch das Ächzen und Stöhnen der Holzbalken, die von den Flammen umzüngelt wurden, übertönt.
„Mein Mann …“, seufzte die ältere Dame verzweifelt. Da mir keine tröstenden Worte einfielen, drückte ich sie ein bisschen fester an mich.
Dunkelblaue Rauchwolken verfärbten den Himmel. Ölige Ascheflocken rieselten wie schwarzer Schnee auf uns nieder, blieben in unseren Haaren kleben. Der Geruch von Rauch und verbranntem Kunststoff verstopfte meine Nase.
Als die letzten Flammen endlich zuckend und zischend verebbten, erhaschte ich einen Blick durch die zerborstenen Fenster in die ausgebrannten Räume.
Einige Feuerwehrmänner wagten sich in das völlig verwüstete Erdgeschoß. Nach einer Weile kamen zwei der Männer mit einer Bahre, auf der sich die Überreste eines verbrannten Opfers befanden, wieder heraus. Instinktiv wandte ich mich ab.
Die Frau im Nerz riss sich von mir los und stürzte sich auf die Männer mit der Bahre. Zögernd folgte ich ihr.
Beim Anblick der halb verkohlten Leiche drehte sich mir der Magen um.
Ich verfluchte meine Neugier, brachte es aber nicht fertig, den Schauplatz dieses schrecklichen Unfalls zu verlassen, ohne zu wissen, was genau passiert war. Wie gebannt starrte ich auf die am Trottoir aufgepinselten Margariten, bis auch sie endlich zu weinen begannen. Ich bildete mir ein, dass sich ihre Tränen mit schwarzem Blut vermischten.
Vergiss deine Visionen, Kafka, sagte ich mir und riss mich zusammen. Hielt nun wieder nach der älteren Dame Ausschau. Einer der Polizeibeamten erklärte ihr gerade, dass es sich offensichtlich um eine Gasexplosion handle und dass das Todesopfer eine Frau sei.
Die Tote wurde in einem Rettungswagen weggebracht.
Die Polizei nahm unsere persönlichen Daten auf und ließ uns dann gehen.
„Soll ich Sie nach Hause begleiten?“, fragte ich die Frau, die nun wieder nahe bei mir stand.
„Nein, danke. Aber wenn Sie meinen Wagen parken würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich fürchte, dazu bin ich jetzt nicht mehr fähig.“ Sie klang wieder halbwegs gefasst, obwohl ihre Stimme nach wie vor zitterte.
Ich nahm die Schlüssel und stellte ihren Skoda Octavia in die nächste Parklücke. Auf der Ablage zwischen Fahrer- und Beifahrersitz entdeckte ich ein Ausweisetui. Neugierig warf ich, bevor ich ausstieg, einen Blick auf die Fahrzeugpapiere. Sie waren auf Angela Bischof, geboren am 24. Oktober 1950, ausgestellt.
Der Name kam mir bekannt vor.
2
Um elf Uhr vormittags wachte ich auf. Mit geschlossenen Lidern blieb ich noch ein, zwei Minuten liegen. Sogleich sah ich die Flammenhölle vor mir. Am liebsten wäre ich wieder eingeschlafen. Der penetrante Weckruf meines Handys ließ es nicht zu.
Ich ging in die Küche und machte mir einen Kaffee. Im Mund hatte ich nach wie vor den bitteren Rauchgeschmack, und meine Lungen fühlten sich an, als hätte ich drei Päckchen Smart geraucht.
Ich liebte meine Küche, hatte sie doch Österreichs berühmteste Architektin Margarete Schütte-Lihotzky entworfen. Leider hatte ich sie nie persönlich kennengelernt.
Durchs Küchenfenster warf ich einen Blick auf die Franzensgasse hinunter. Die wenigen Leute, die unterwegs waren, drückten sich, eingepackt in dicke Daunenjacken, an den Hausmauern entlang. Der Himmel war zugezogen. Die morgendlichen Sonnenstrahlen hatten sich wieder verabschiedet. Ein kalter Wind pfiff durch die Ritzen meiner Terrassentür.
Was für ein hässlicher Montagmorgen, dachte ich. Zum Glück musste ich erst um sechzehn Uhr im Cuadro anfangen. Abenddienste waren mir lieber als Tagdienste.
Ich zündete mir eine Zigarette an. Mein Hustenanfall klang verdächtig nach einer Lungenkranken im Endstadium. Ich dämpfte die Zigarette sofort wieder aus und füllte erneut meine altmodische italienische Espressomaschine mit gemahlenem Kaffee. Seit ich mich an unsere Eigenmarke Cafe do Cuadro gewöhnt hatte, schmeckte mir kein anderer Kaffee mehr. Die milden aromatischen Hochland-Bohnen wurden eigens für die Lokale im Schlossquadrat geröstet. Ich musste demnächst mal fragen, ob ich nicht ein halbes Kilo zum Supersonderpreis mit nach Hause nehmen durfte.
Meine Haare stanken nach Rauch. Selbst an meinem Körper schien Asche zu kleben. Als ich heimgekommen war, hatte ich mich gleich ins Bett gelegt und war sofort in Tiefschlaf gefallen.
Ich ging unter die Dusche. Ließ den heißen Strahl auf mich niederprasseln. Sah zu, wie er all den Ruß und die Asche von meinen Haaren und meiner Haut schwemmte.
Missmutig betrachtete ich meinen nackten Körper. Meine Figur wurde zunehmend weicher, weiblicher. Ich steckte eindeutig in einem falschen Körper. Angeblich sah ich nicht übel aus, rothaarig, grüne, leicht schräg stehende Augen, eine ziemlich dunkle braune Haut, üppige Brüste und lange schlanke Beine. Das rote Haar und die grünen Augen hatte ich von meinem Vater geerbt. Die Figur leider von meiner Mutter. Noch war ich schlank. Aber ich befürchtete, meine Hüften und mein Busen würden in ein paar Jahren ebenso ausladend werden wie ihre es waren. Schon als kleines Mädchen wäre ich lieber ein Bub gewesen. Im Laufe der Jahre hatte ich mich zwar mit meinem Geschlecht so halbwegs angefreundet, aber im Grunde wäre ich auch heute lieber ein Mann gewesen. So dünn und drahtig wie mein Vater es war, der die Marathonstrecke lief, bevor Marathonläufe zu schicken Events wurden.
Meine Brüste bestanden längst keinen Bleistifttest mehr. Und bei gutem Licht entdeckte ich seit Kurzem die ersten Spuren von Cellulite auf meinen Oberschenkeln.
Es war an der Zeit, wieder mit dem Training zu beginnen. Meine Kondition war nicht die beste. Das hatte ich, als ich vor der Explosion geflüchtet war, deutlich zu spüren bekommen. Mein Hometrainer stand im Vorzimmer. Diente mir als Kleiderablage. Ich war zu faul, ihn abzuräumen. Machte mir stattdessen eine Eierspeise von drei Eiern. Brot hatte ich keines zuhause. Nach dieser Cholesterin-Bombe war mir erst recht schlecht.
Obwohl ich mir vor dem Schlafengehen geschworen hatte, mit der Raucherei aufzuhören, zündete ich mir noch eine an. Ein Kaffee ohne Zigarette schmeckte wie ein Wiener Schnitzel ohne Panier.
Dann schaltete ich meinen PC ein, surfte ein bisschen im Internet und verfolgte die Kommentare zu den ORF-Nachrichten über die Gasexplosion in Margareten. Anonym bleiben wollende einsame Herzen spielten Detektiv:
„Das ist sicher die Russenmafia gewesen. Die mischen gasförmigen Sprengstoff dazu und sprengen damit unsere Häuser in die Luft.“
„Möglicherweise eine Eifersuchtstat? Kommt leider vor. Und ist auch keine Spezialität von Migranten. Wahnsinnige gibt es überall.“
„Ob man den Schuldigen finden wird? Vielleicht hat sich der Schlauch ja auch von selbst gelöst? Aber sollte es einen Täter geben, welche Strafe wird angemessen sein? Die Todesstrafe?“
Andere Kommentare waren weniger komisch: „Wahrscheinlich war es wieder einer aus der linksradikalen Szene. So ist es ja immer, wenn eine Bombe hochgeht, ein Strommasten gesprengt wird oder ein Haus in die Luft fliegt.“
„Die Kriminalität von Ausländern ist um ein Mehrfaches höher als die von Einheimischen. Diese Tatsache bestreiten nur die sogenannten Gutmenschen. Islamistische Attentäter mitten unter uns!“
Ich schaltete den Computer aus. Ein Blick auf die Uhr. Kurz vor zwei. Die Mitarbeiter dürfen einmal am Tag kostenlos in jedem der Lokale des Schlossquadrats essen. Ich beschloss, heute ausnahmsweise auf meinen geliebten Burger im Café Cuadro zu verzichten und mir ein toskanisches Cordon bleu beim benachbarten Silberwirt zu genehmigen. Mein Magen verlangte nach etwas Deftigem. Die Eierspeise hatte ich schon wieder vergessen.
Als ich den Margaretenplatz überquerte, warf ich einen Blick auf das ausgebrannte Haus. Das Parterre und der erste Stock waren völlig zerstört. Ein Dutzend Kolkraben tummelte sich auf der Brandruine, delektierte sich an verkohlten Überresten. Hoffentlich stammten sie nicht von einem Menschen. Plötzlich hatte ich wieder ein ganz flaues Gefühl im Bauch. Angeekelt wandte ich mich ab.
Beim Silberwirt waren alle Tische besetzt. Mein Kellnerkollege Markus deckte für mich den kleinen Tisch gegenüber der Schank. Ich saß genau unter einer Vitrine mit „Les Misérables“, einer Plastik von Eva Schaerer, einer Studentin des berühmten österreichischen Bildhauers Alfred Hrdlicka. Nach dieser schlaflosen Nacht fühlte ich mich ähnlich wie die gequält dreinschauenden kleinen schwarzen Figuren.
Ohne dass ich ihn darum gebeten hatte, brachte mir Markus mein Lieblingsbier. Das Margaretner Bier stammte aus der mährischen Stadt Iglau. Es schmeckte viel vollmundiger als viele der hiesigen Biere.
„Geht auf Kosten des Chefs“, sagte er. „Der Stefan Gergely ist gerade rüber ins Hofstöckl gegangen, als du reingekommen bist. Er hat gemeint, du könntest heute sicher ein Bierchen vertragen.“
„Warum spendiert mir der Gergely ein Bier? Der weiß doch gar nicht, wer ich bin“, sagte ich verwundert.
„Er ist eben ein großzügiger Mensch. Und er kennt alle seine Angestellten, selbst wenn sie ihm noch nicht vorgestellt wurden“, sagte Markus mit einem verschmitzten Lächeln.
„Ist im Hofstöckl heute wieder was los?“, fragte ich.
„Ja, ein Parteigrande feiert seinen Abschied aus der Politik. Ganz exklusiv, im kleinen Kreis. Aber es sind alle da, nicht nur unser Stammtisch ist komplett vertreten, auch Bezirksvorsteher Wimmer und der Bürgermeister. Wir haben eine Hochrippe vom Angusrind, also ein leicht blutiges Festmahl für sie vorbereitet.“
Ich wusste, dass im Hofstöckl, einem ebenerdigen Anbau im Innenhof, die Hausmeisterwohnung untergebracht gewesen war. Gergely hatte es Anfang der 90er zu einer Edelbrand-Bar umbauen lassen. Heute war es eher ein verschwiegenes Hinterzimmer für erlesene Festivitäten.
Mit Politikern hatte ich nicht viel am Hut. In den Lokalen des Schlossquadrats verkehrten nicht nur prominente SPÖler, sondern auch ÖVPler und sogar Grüne. Ich behandelte diese Leute, wenn sie im Cuadro auftauchten, gleich wie alle anderen Gäste. Den Bezirksvorsteher von Margareten konnte ich jedoch gut leiden. Ich kannte ihn nicht persönlich, hatte nur mit ihm telefoniert, als mein Großvater einen Schlaganfall hatte. Kurt Wimmer verhalf ihm sofort zu einem Platz auf der Bettenstation im Haus Margareten, obwohl mein Großvater kein Parteimitglied war. Das rechnete ich ihm bis heute groß an.
Meinem Opa schien es im Seniorenheim in der Arbeitergasse zu gefallen. Er konnte zwar nicht mehr sprechen, wirkte aber immer recht fidel, wenn ich ihn besuchte. Vielleicht sollte ich mich zeitgerecht um einen Platz dort bemühen? Denn wenn ich so weitermachte, würde ich bald selbst pensionsreif sein.
„Mir ist heute nach einem herzhaften toskanischen Cordon bleu“, sagte ich zu Markus.
Er war ein bisschen älter als die meisten anderen meiner Kollegen und der ruhende Pol in diesem Tollhaus. Das war mit ein Grund, warum ich mich so gut mit ihm verstand.
Markus erzählte mir, dass am späten Vormittag ein Polizeibeamter beim Silberwirt reingeschneit und sich angeblich bei Stefan – er meinte Gergely – nach mir erkundigt hatte. Von den fünfundvierzig Angestellten im Schlossquadrat waren anscheinend alle mit dem Chef per Du. Nur ich nicht.
Kaum hatte ich fertig gegessen, kam Küchenchef Rudi Kirschenhofer vorbei, der in allen vier Lokalen des Schlossquadrats das Regiment führte, und fragte mich: „Möchtest vielleicht eine Williamsbirne, damit du den Brandgeschmack aus der Kehle kriegst?“
Ich schüttelte den Kopf. Anscheinend hatte es sich bereits herumgesprochen, dass ich in der Früh Zeugin der Gasexplosion gewesen war. Margareten war eben wirklich ein Dorf.
„Nach dem Cordon geht’s mir eindeutig besser“, sagte ich grinsend und strich über meinen Bauch. „Am liebsten würde ich den Rest des Nachmittags hier verbringen. Bei diesem Sauwetter finde ich es im Silberwirt immer am gemütlichsten.“
Das Lokal hatte schon über zweihundert Jahre auf dem Buckel, hatte sich aber bestens gehalten. Verglichen mit vielen anderen Wiener Beisln wirkte der Silberwirt geradezu frisch und jugendlich. Früher war es ein typisches Arbeiterwirtshaus gewesen. Als Mitte der 90er-Jahre das große Beislsterben in Wien einsetzte, beschloss Stefan Gergely zu retten, was sich noch retten ließ. Er kaufte das alte, heruntergekommene Wirtshaus und ließ es sanft renovieren. Eigentlich hatte er damit die Beisl-Renaissance in Wien eingeleitet.
Das alte Lokal hatte von seinem früheren Charme nichts eingebüßt, entsprach aber nun den heutigen Vorstellungen von Hygiene und Sauberkeit. Die Tische und die Budel waren aus dickem Ahornholz und genauso original wie die Hängelampe über dem Stammtisch. Auch in dem wunderschönen schattigen Gastgarten hatte sich nicht viel geändert. Nur die Markise war neu und erlaubte es den Gästen, auch bei leichtem Regen im Freien zu sitzen. Die hervorragende Wiener Küche und die gepflegten Weine lockten nicht mehr nur Arbeiter und Geschäftsleute an, sondern auch Künstler und Studenten. Am Sonntag gab’s den traditionellen Schweinsbraten frisch aus dem Rohr. Und auf der Speisekarte fand man sowohl den typischen Zwiebelrostbraten als auch die traditionellen Erdäpfeldatschi und überbackene Schinkenfleckerl.
3
Ich ging schon etwas früher als nötig hinüber ins Cuadro. Der Durchgang vom Gastgarten des Silberwirts auf die Margaretenstraße entwickelte sich mittlerweile langsam zu einem kleinen Skulpturenpark. Der Chef hatte ein Herz für bildende Künstler, deren Kunstwerke er dann in seinem Schlossquadrat präsentierte.
Wie immer war ich in Versuchung, dem im Durchgang aufgestellten „blinden Musiker“, einer mannsgroßen Statue aus Pappelholz von Jan Schneider, einem anderen Hrdlicka-Schüler, ein paar Cent zu geben.
Genauso erging es mir jedes Mal, wenn ich bei der U-Bahn-Station Pilgrambrücke eine bettelnde Romni mit einem Kleinkind sah. Ihr Anblick löste bei mir das Gefühl von Beklemmung und gleichzeitig Schuldbewusstsein aus. Einerseits empfand ich Mitgefühl, andererseits ohnmächtige Wut. Ich schaffte es nie, an diesen Frauen vorbeizugehen, ohne etwas zu geben. Natürlich wusste ich, dass ein Großteil des erbettelten Geldes bei kriminellen Organisationen landen würde. Aber ich wusste auch über die Situation der Roma in der Slowakei und in anderen osteuropäischen Ländern Bescheid: ein Leben im Müll am Rande der Großstädte oder in Elendssiedlungen am Land, ohne Kanalisation und elektrischen Strom. In den heruntergekommenen Stadt-Ghettos überlebte man höchstwahrscheinlich leichter. Die Lebenserwartung der Roma war sowieso extrem niedrig, betrug im Durchschnitt etwa fünfzig Jahre. Meine Mutter war eine Romni gewesen, und sie war nicht einmal fünfzig geworden.
Das Cuadro erinnerte mich vom Styling und Ambiente her an mein Lieblingscafé in New York in der Prince Street. Wahrscheinlich hatte ich mich auch deshalb hier um einen Job beworben.
Die Gasexplosion in nächster Nachbarschaft war heute, sowohl vor als auch hinter der Theke, Thema Nummer eins. Inzwischen war allgemein bekannt, dass die Gasleitung in dem alten Haus manipuliert worden war. Bei dem Todesopfer handelte es sich um eine junge Frau aus dem Kosovo, die frühmorgens die Praxis von Doktor Bischof geputzt hatte. Als sie sich eine Zigarette angezündet hatte, war das Haus in die Luft geflogen.
Meine Kollegen hielten sich mit Spekulationen zurück. Viele von ihnen kamen aus den Nachbarländern und bedauerten die junge Serbin.
Zurzeit arbeiteten Angehörige aus zwölf verschiedenen Nationen in den Lokalen des Schlossquadrats. Die früheren Bemühungen der Wiener Stadträtin Renate Brauner um eine bessere Integration der Immigranten waren also nicht überall gescheitert. Zumindest bei uns funktionierte die Zusammenarbeit zwischen Polen, Tschechen, Kroaten, Italienern und Österreichern so halbwegs. Der Gergely war angeblich selbst ein richtiges k.u.k.-Kind. Seine Vorfahren waren Sudetendeutsche, Ungarn, Galizier und Italiener gewesen. Vielleicht hatte er auch deswegen kaum Probleme mit seinem internationalen Personal?
Wenigstens die Einwanderer verstehen sich untereinander, dachte ich grinsend, als mir meine Kollegin Diana, die aus Polen stammte, die Hemingway-Minze für einen Mojito reichte. Wir verwendeten für den Mojito ausschließlich drei Jahre alten kubanischen Rum und die Hemingway-Minze aus unserem hauseigenen Kräutergarten. Auch so ein Spleen von unserem Gastrofürsten. Er ließ in den Innenhöfen nicht nur verschiedene Minze-Arten, sondern auch jede Menge andere Kräuter züchten. Im Sommer roch es hier orientalischer als am Naschmarkt.
Obwohl meine Großmutter eine richtige Kräuterhexe gewesen war und ihr Wissen an meine Mutter und mich weitergegeben hatte, hielt ich mich lieber raus, was den Kräuteranbau betraf. Ich konnte es nicht leiden, wenn man mich wegen meiner Herkunft für eine Autorität auf solch unwissenschaftlichen Gebieten hielt. Esoterik und alles, was ihr nahe kam, war mir zutiefst zuwider. Aber laut unseren Gästen schmeckte der Mojito halt am besten mit dieser speziellen Minze-Art.
Zur Happy Hour von 17 bis 19 Uhr herrschte im Cuadro oft Hochbetrieb. Kein Wunder, „verschenkten“ wir praktisch alle Cocktails um sechzig Prozent des normalen Preises. Auch die viereckigen Burger waren sehr gefragt. Die kleine Küche im Cuadro war zur Theke hin offen. Die Gäste konnten dem Koch – er hieß Manfred und arbeitete schon seit zehn Jahren im Cuadro – bei der Zubereitung der Hamburger zusehen. Er geriet gerade ins Schwitzen, obwohl er ziemlich dünn war. Geschickt jonglierte er mit den warmen Weckerln, die frisch aus der hauseigenen Backstube kamen.
„Harte Nacht gehabt, Kafka?“, fragte mich Jürgen Geyer, unser Service-Chef, der gemeinsam mit dem Küchenchef Geschäftsführer der Lokale im Schlossquadrat war.
Nicht nur er, auch meine männlichen Kollegen nannten mich alle beim Nachnamen, was ich durchaus passend fand, waren sie doch alle jünger als ich. Außerdem war ich stolz auf meinen Namen.
„Kann man wohl sagen.“
„Willst einen Chili Burger, extra scharf, so wie für den Chef?“, fragte mich Manfred.
„Nein danke, ich hab schon gegessen.“ Warum waren bloß heute alle so nett zu mir? Nur weil ich Zeugin einer Gasexplosion gewesen war?
„Ein Seidl?“, fragte mich Diana.
„Nein danke. Aber hast du ein Make-up dabei? Ich glaube, ich sollte meine Augenringe abdecken. Ich sehe aus wie eine Schleiereule.“
„Du sagst es.“ Diana verschwand hinter der Theke und reichte mir ein kleines Fläschchen.
„Du bist ein Schatz, hast was gut bei mir“, sagte ich und verschwand auf die Toilette, die sich im Durchgang, genau gegenüber dem Lokal, befand. Als ich im Spiegel mein zerknittertes, rot geflecktes Gesicht erblickte, schwor ich mir, einen Monat lang keinen Tropfen Alkohol anzurühren.
Ich erinnerte mich an das Einstellungsgespräch, das Jürgen Geyer seinerzeit mit mir geführt hatte. Obwohl das Team im Cuadro deutlich jünger war als ich, nahm er mich, weil ich, wie er meinte, um mindestens zehn Jahre jünger aussehen würde. Hoffentlich hatte er mich heute nicht genauer angesehen. Denn ich fühlte mich um zehn Jahre älter. Meine Augen waren voll kleiner geplatzter Äderchen. Meine ohnehin nicht gerade unauffällige Nase leuchtete wie eine rote Ampel. Ich verbrauchte das halbe Fläschchen Make-up, um wieder halbwegs zivilisiert zu wirken.
Als ich die Damentoilette verließ, blinzelte ich Che Guevara, dessen Konterfei nebenan an der Eingangstür der Herrentoilette hing, zu und murmelte: „Hasta la vista, compañero.“
Kaum war ich zurück im Café, verging mir das Grinsen. Alle Tische und selbst die lange Theke waren voll besetzt. Die meist jungen Leute bestürmten uns mit ihren Bestellungen. Ich kam nicht mehr dazu, meinen Kollegen ausführlich von der Gasexplosion im Haus schräg gegenüber zu berichten.
Plötzlich setzte sich Frau Bischof auf einen Barhocker an der Theke.
„Ich verkehre normalerweise nicht hier“, sagte sie. Legte ihre rote Brille ab und musterte die jungen Gäste an den Tischen mit arrogantem Blick. „Wohin man auch schaut, Schwule, nichts als Schwule und Lesbenff Was ist bloß aus dem guten alten Margareten geworden.“
„Ein Schwulenbezirk?“
Sie überhörte meinen zynischen Unterton.
„Sie sagen es! Dieses ganze Multi-Kulti-Getue führt doch zu nichts.“
Sie sah mich wieder um Zustimmung heischend an. Ich reagierte nicht mehr.
„Diese Moslems können mir genauso gestohlen bleiben“, meckerte sie weiter.
„Was darf ich Ihnen bringen?“, fragte ich betont höflich.
„Ein Achtel Weiß.“
„Ich wollte mich eigentlich nur noch mal bei Ihnen bedanken“, sagte sie, als ich ihr das Glas Wein reichte. Es war nicht ihr erstes Achtel. Ich roch ihre Fahne.
Dankesbezeugungen waren mir schwer unangenehm. Da ich nicht recht wusste, worüber ich mit ihr reden sollte, fragte ich: „Sie bevorzugen wahrscheinlich den Silberwirt, oder?“