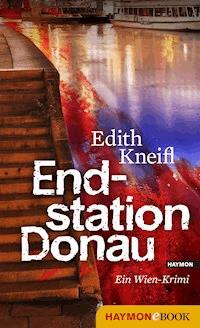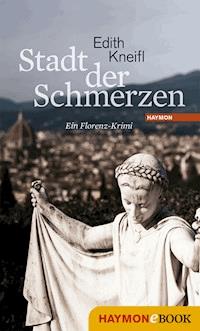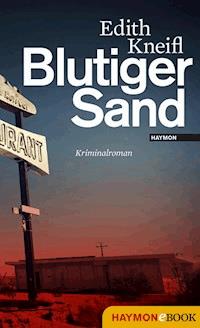Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwanzig Jahre lang saß Enrico im Gefängnis - unschuldig, wie er meint. Jetzt wurde er entlassen, und er kehrt zurück in die Stadt seiner Kindheit und Jugend - in die Stadt Triest, wo er seine große Liebe fand - Gina. Doch für Gina war Enrico nicht der einzige Liebhaber, auch dessen Freunde Giorgio, Livio und Michele erfreuten sich ihrer Gunst. Einer von ihnen hat sie vor zwanzig Jahren in einem schäbigen kleinen Hotel umgebracht, und Enrico ist fest entschlossen, nach seiner Entlassung herauszufinden, wer es war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HAYMON
Das Buch
Zwanzig Jahre lang saß Enrico im Gefängnis – unschuldig, wie er meint. Jetzt wurde er entlassen, und er kehrt zurück in die Stadt seiner Kindheit und Jugend – in die Stadt Triest, wo er seine große Liebe fand – Gina. Doch für Gina war Enrico nicht der einzige Liebhaber, auch dessen Freunde Giorgio, Livio und Michele erfreuten sich ihrer Gunst. Einer von ihnen hat sie vor zwanzig Jahren in einem schäbigen kleinen Hotel umgebracht, und Enrico ist fest entschlossen, nach seiner Entlassung herauszufinden, wer es war.
Die Autorin
Edith Kneifl (geb. 1954 in Wels/Oberösterreich) verbrachte einige Jahre in Griechenland und den USA und lebt heute als Psychoanalytikerin und Schriftstellerin in Wien. Sie wurde gleich für ihren ersten Roman Zwischen zwei Nächten (1991) mit dem ›Glauser‹ ausgezeichnet. Es folgten In der Stille des Tages (1993), Triestiner Morgen (1996), Ende der Vorstellung (1997), Allein in der Nacht (1999).
Edith Kneifl
Triestiner Morgen
Roman
HAYMON
© 2013HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Originalausgabe: DIANA München 2000
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7497-1
Umschlag: hœretzeder grafische gestaltung, Scheffau/Tirol
Für Rainer
»Triest hat einen spröden
Charme. Nach Laune
gleicht’s einem ungeschliffenen, hungrigen Lausbuben,
der blaue Augen hat und viel zu plumpe Hände,
um eine Blume zu verschenken;
einer Liebe
mit Eifersucht.«
UMBERTO SABA:Triest in ›Triest und eine Frau‹
Allerheiligen 1994
Neonröhren tauchen das Bahnhofscafé in ein kaltes, unfreundliches Licht. Eine alte Frau wischt den Steinboden auf, nähert sich den Tischen und bückt sich nach einem Zigarettenstummel, der ihr zu schade zum Wegwerfen scheint. Die Theke wird von Männern in blauer Arbeitskleidung belagert. Mit einem Gläschen Grappa begießen sie das Ende ihrer Nachtschicht. Derbe Witze und lautes Gelächter beleben das Lokal.
Die Frau hinter der Kasse lacht nicht mit. Sie schaut den Barkeeper, der ihr eine Tasse Kaffee reicht, vorwurfsvoll an.
»Hast du wieder zuviel Zucker hineingetan?«
»Zwei Löffel, hast du letztes Mal gesagt.«
»Der Arzt hat gemeint, ein Löffel muß genügen«, murmelt sie und leert die Tasse in einem Zug.
»Noch einen?«
Sie schleckt mit der Zungenspitze den Schaum von ihren Lippen und nickt.
Enrico wartet geduldig, bis Kassiererin und Barkeeper ihre Unterhaltung beendet haben. Beide würdigen ihn keines Blickes.
»Ein Glas Terrano, bitte.«
Nun sieht sie doch kurz zu ihm auf, und was sie sieht, scheint ihr zu gefallen. Sein altmodischer, grauer Mantel ist aus gutem Stoff, sein weißes Hemd sauber, und seine schwarzen, rissigen Schuhe sind auf Hochglanz poliert. Nur der verhärmte Zug um seinen Mund mißfällt ihr.
Sie wird gleich eine Spur freundlicher, schenkt ihm sogar ein Lächeln, als sie ihm den Bon in die Hand drückt.
Seit einer Ewigkeit lächelt mich zum ersten Mal wieder eine Frau an – eine häßliche, fette Frau mit verfaulten, schwarzen Zähnen, denkt Enrico, bedankt sich aber höflich und begibt sich zur Theke. Er stellt seinen kleinen, braunen Koffer auf den Boden und reicht dem Barkeeper den Bon.
Das Zischen der Espressomaschine übertönt die Stimmen der Männer. Plötzlich verlangen alle nach Kaffee, auch diejenigen, die gerade erst einen Grappa bestellt haben. Mit ein paar geschickten Handgriffen erfüllt der Barkeeper die Wünsche seiner morgendlichen Stammgäste, wischt die Theke ab, stellt leere Flaschen in eine Kiste, rührt geschlagene Milch in den Kaffee und schenkt dem Fremden ein Glas Wein ein.
Versonnen betrachtet Enrico die rubinrote Flüssigkeit. Erinnerungen an manch geleerte Flasche tauchen auf. Er zündet sich eine Zigarette an und scheint jeden Zug zu genießen. Als er sie bis zur Hälfte geraucht hat, wirft er den brennenden Stummel auf den Boden, tritt ihn sorgfältig aus, nimmt eine andere Zigarette aus dem Päckchen, reißt den Filter ab und zerbröselt den Tabak zwischen seinen Fingern.
Das Bahnhofscafé wurde erst vor kurzem renoviert. Nicht nur die Stahlrohrtische und die schwarzen Stühle sehen neu aus, über dem ganzen Lokal liegt ein Hauch von Frische: Sonnige Gelbtöne, dezentes Hellgrau und zartes Lindgrün. Der Bereich, in dem man sitzen kann, ist durch Grünpflanzen vom Stehbuffet getrennt. Die Theken aus schwarzem Marmor und hellbraunem Holz harmonieren mit dem grauen Boden. Den grünen Balken über der Theke hält Enrico allerdings für überflüssig. Auch das Licht ist ihm zu grell, schmerzt seine Augen, die nicht mehr an Helligkeit gewöhnt sind.
Als eine blonde Frau im Pelz das Bahnhofscafé betritt, drehen sich die Köpfe aller Männer wie auf Kommando zur Tür. Vereinzelt ertönen sogar anerkennende Pfiffe. Selbst der Barkeeper vergißt kurzfristig auf seinen professionell gelangweilten Gesichtsausdruck und mustert sie ungeniert.
Sie scheint weder die Pfiffe noch das unverschämte Grinsen der Männer wahrzunehmen, geht zur Theke, stellt ihren kleinen, dunklen Koffer neben Enricos Koffer und begibt sich zur Kasse.
Der Barkeeper läßt sie nicht aus den Augen. Als er ihr den Kaffee reicht, berührt er ihre Hand. »Kandisin?«
Ein kaum merkliches Kopfschütteln. Sie trinkt ihren Espresso schwarz, ohne Zucker.
»Schreckliches Wetter heute.«
Ihre müden Augen streifen Gesicht und Körper des jungen Mannes. Er riecht förmlich nach billigem Vergnügen. In dieser Preiskategorie sind sie alle gleich einfallslos und langweilig, denkt sie und schenkt jetzt auch dem Mann neben ihr einen flüchtigen Blick.
Enrico schaut nicht einmal auf.
Belustigt runzelt sie die Stirn, nimmt ein silbernes Zigarettenetui aus ihrer Handtasche, steckt sich eine Zigarette in den Mund und überlegt, ob sie ihn um Feuer bitten soll. Bevor sie sich noch dazu entschließen kann, leuchtet das Feuerzeug des Barkeepers unter ihrer Nase auf.
Sie bedankt sich, schiebt ihm die leere Tasse hin und geht zu einem Tisch neben der Theke. Ihren Koffer läßt sie stehen.
Der Barkeeper starrt auf ihre Beine. Er weiß es zu schätzen, wenn Frauen Nylonstrümpfe und hochhackige Schuhe tragen. Mädchen in seinem Alter bevorzugen Strumpfhosen und bequemes, flaches Schuhzeug.
Die Schöne stellt Fototasche und Handtasche auf den Stuhl neben sich, zieht ihren Pelzmantel aus und legt ihn über die beiden Taschen. Vergeblich versucht sie dann, die Aufmerksamkeit der Kellnerin auf sich zu lenken. Die ältere, ziemlich verhärmt aussehende Frau übersieht ihre erhobene Hand und bedient später gekommene Gäste. Der junge Mann hinter der Theke hat ihr Winken jedoch registriert und zwinkert ihr verständnisvoll zu.
Sie schaut gelangweilt durch ihn hindurch, schlüpft aus ihren Pumps und massiert ihre Füße. Auch den Mann, der gerade hereinkommt, scheint sie nicht zu bemerken.
Er begrüßt die Kassiererin mit einem Kuß auf die Wange und nickt auch der Alten, die unermüdlich den Boden aufwischt, freundlich zu.
Nur wenige Tische sind besetzt, doch er steuert geradewegs auf den Tisch der schönen Fremden zu.
»Ist hier noch frei?« Er wartet ihre Antwort nicht ab, setzt sich einfach auf den leeren Stuhl ihr gegenüber.
Überrascht blickt sie auf.
»Darf ich meinen Mantel zu Ihren Sachen legen?«
Sie nickt verwirrt und schaut ihm zu, wie er seinen Regenmantel sorgfältig zusammenfaltet und auf ihren Nerz legt.
Aus der Nähe sieht er wie ein gewöhnlicher Landstreicher aus. Nicht nur seine Kleidung dürfte schon bessere Tage gesehen haben. Seine rötliche Gesichtshaut verrät den geübten Trinker, sein weißer Stoppelbart ist mindestens drei Tage alt und sein Haar schulterlang. Doch seine strahlend blauen Augen und sein jungenhaftes Lächeln wirken sehr einnehmend.
Sie kramt in ihrer Handtasche, leert den Inhalt der Tasche auf den Tisch, zerknüllt ein leeres Zigarettenpäckchen, mehrere Zettel und Fahrkarten und räumt die Tasche wieder ein.
Die Arbeiter sind zusehends schweigsamer geworden. Die ersten brechen auf und verabschieden sich von ihren Kollegen mit einem freundlichen »Ciao«.
Über den Lautsprecher werden Zugverspätungen bekanntgegeben, zuerst in Italienisch, dann in Slowenisch und zuletzt in deutscher Sprache.
Enrico blättert in seinem Notizbuch, klappt das Buch wieder zu und geht hinaus. Sein halbleeres Weinglas läßt er auf der Theke zurück.
Die Telefonzelle neben dem Zeitungskiosk ist besetzt. Ein Betrunkener bemüht sich vergeblich, eine Münze in den Schlitz zu stecken.
Der heftige Wind hat die Bahnsteige leergefegt. Kein Intercity, kein Regionalzug, nur ein paar Güterwaggons, die auf ihre Lokomotive warten. Einige Touristen, gut verpackt in warmen Wintermänteln, schlendern unter dem Vordach auf und ab.
Am Ende der Gleise steht ein Polizist, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Er wirkt wie angefroren.
Zwei Gepäckträger veranstalten mit ihren leeren Wagen ein Wettrennen auf den Bahnsteigen. Das Geräusch der klappernden Räder läßt Enrico zusammenfahren. Er reißt die Tür der Telefonzelle auf, zerrt den Betrunkenen, der im Stehen eingeschlafen scheint, heraus und wählt.
Erst nach mehrmaligem Klingeln hebt jemand ab. Die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung klingt brüchig und verschlafen, und doch erkennt er sie sofort.
»Das darf doch nicht wahr sein, unmöglich! Du bist es wirklich?«
Die unverhohlene Überraschung entlockt Enrico nicht das kleinste Lächeln. Er bittet den Freund, so schnell wie möglich hinunter in die Stadt zu kommen. Der gute Giorgio scheint jedoch keine besonders große Lust zu haben, ihn wiederzusehen. Er erfindet alle möglichen und unmöglichen Ausreden, um dieses Treffen hinauszuschieben, wenn nicht gar zu vermeiden.
Ruhig, aber bestimmt erklärt ihm Enrico, warum es sein muß, dieses Wiedersehen nach so vielen Jahren. Schließlich gibt Giorgio nach, so wie er seinem Freund und früheren Arbeitskollegen immer nachgegeben hat, und willigt ein, ihn in einer Stunde vor ihrem ehemaligen Bürogebäude zu treffen.
Enrico schlendert zurück in das fast leere Bahnhofscafé. Keiner nimmt von ihm Notiz. Die Kassiererin ist in einen Liebesroman vertieft, der Barkeeper wäscht die Gläser ab. Sein halbleeres Weinglas ist wohl auch darunter.
Er bestellt noch einen Terrano und schenkt dem Pärchen am Tisch neben der Theke einen gelangweilten Blick. Der Mann kommt ihm bekannt vor. Zwar kann er sich keine Namen merken und hat auch mit Zahlen Schwierigkeiten, aber ein Gesicht, das er einmal gesehen hat, vergißt er nicht. Enrico beobachtet ihn eine Weile, dann wendet er sich verärgert ab. Paranoid – dieser Trottel von Psychiater hat doch recht gehabt. Ich kenne Tausende Gesichter in Triest, warum sollte mir nicht eines dieser Gesichter zufällig im Bahnhofscafé begegnen?
Die Kellnerin nähert sich jetzt unaufgefordert dem Tisch der Blonden. »Was darf’s denn sein?«
»Kaum taucht ein Mann auf ...«, murmelt die gut gekleidete Dame.
»Wie bitte?«
Sie wiederholt nicht, was sie soeben gesagt hat.
Ihr Tischnachbar bestellt ein Bier.
»Und für mich einen Espresso.«
Die Kellnerin ringt sich ein schiefes Lächeln ab. »Darf’s etwas zum Kaffee sein, ein Brioche vielleicht?«
»Nein danke, ich kann jetzt beim besten Willen nichts essen.«
Über den Lautsprecher werden erneut Zugverspätungen bekanntgegeben.
»Hat Ihr Zug auch Verspätung?«
»Hatte. Deswegen habe ich den Cibalia-Express nach Zagreb verpaßt. Jetzt muß ich bis zum Abend die Zeit irgendwie totschlagen.«
»Wer weiß, ob der Nachtzug bei diesem Wetter überhaupt fahren wird. Angeblich sind die dort unten eingeschneit. Es sieht aus, als würde es auch hier gleich zu schneien beginnen. Schöne Stimmung draußen, wie vor einem Sturm.«
»Schön nennen Sie das? Ich finde es grauenhaft. In dieser Gegend sind solche Schneemassen doch eher ungewöhnlich. Außerdem haben wir erst November.«
»Sie sind nicht aus Triest?«
Sie gibt ihm keine Antwort.
»Aber Sie sind Italienerin?«
»Nicht alle, die Italienisch sprechen, sind auch Italiener.«
»Stimmt. Sie sind ein slawischer Typ, aber Sie könnten natürlich genausogut Deutsche sein. – Verraten Sie mir Ihren Namen?«
»Wozu? Was bedeuten schon Namen?«
»Sie sind Deutsche? Oder Österreicherin?«
Lachend sagt sie: »Geben Sie es auf.«
»Im Norden soll es angeblich noch viel ärger sein. Alle Züge, die aus Österreich kommen, haben gewaltige Verspätung.«
»Warten Sie auch auf Ihren Zug?«
»Nein, ich fahre nicht weg.«
»Sie holen nur jemanden ab?«
»Nein.«
Die Kellnerin bringt Bier und Kaffee.
»Bitte schön, mein Herr!«
Sie schweigen beide. Die Frau macht nicht den Eindruck, als sei sie an der Fortsetzung des Gespräches interessiert. Sie starrt ununterbrochen zur Tür.
Durch die lange Fensterfront sieht man die überdachten Bahnsteige. Vor dem Café versammelt sich eine Gruppe junger Burschen. Unausgeschlafene Gesichter pressen sich gegen die schmutzigen Fensterscheiben. Als die Stimme aus dem Lautsprecher die Zugverspätungen wiederholt, hängen sich die Burschen ihre Rucksäcke um und gehen hinein.
Der Barkeeper schickt sie zuerst an die Kasse und nimmt dann der Reihe nach ihre Bestellungen auf. Gelangweilt wiederholt er: »Kaffee, Mineralwasser, Orangensaft ...«
»Würden Sie so freundlich sein und einen Moment auf mein Gepäck achtgeben, mein Koffer steht drüben an der Theke«, bittet die Blonde ihren Tischnachbarn.
»Selbstverständlich.«
Ihre Bewegungen sind fahrig, sie stößt sich an der Tischkante. Sein Bierglas schwankt gefährlich. Zerstreut entschuldigt sie sich, legt sich ihren Mantel über die Schultern, klemmt ihre Handtasche unter den Arm und geht auf die Toilette. Wieder zieht sie die Blicke vieler männlichen Gäste auf sich.
Enrico reiht sich in die lange Schlange vor der Kasse ein, kauft eine Flasche Refosco, bezahlt, ohne zu protestieren, einen weit überhöhten Preis und verläßt das Lokal.
Vor dem Bahnhofsgebäude stellt er seinen Koffer ab und betrachtet versonnen die Häuserzeile auf der anderen Straßenseite, die graugelben Fassaden, die rot blinkende STOCK Reklame, die Bar und das Restaurant unten im Haus ... Er überquert die Straße.
›KOSIC‹ steht nach wie vor über dem Eingang des kleinen Ladens, gleich ums Eck.
Enrico späht durch die blitzsaubere Fensterscheibe. Computer, Telefonanlagen, Faxgeräte, Kopierer ... Enttäuscht spaziert er den Viale Miramare entlang zurück zum Bahnhofsvorplatz.
Die ›Piazza della Liberta‹ ist wie ausgestorben. Er vermißt die vielen molligen Frauen in den bunten Pluderhosen und die Männer in den altmodischen, schwarzen Anzügen, die früher tagelang um den Bahnhof herum campierten und auf riesigen Kisten und fest verschnürten Schachteln schliefen, in denen sich ihre wertvolle Beute befand: Bluejeans, Turnschuhe, Zigaretten, Kosmetika, Putzmittel, Femsehapparate und bunte Plastikgewehre, die hier, zum Leidwesen der Kinder, weiterverscherbelt wurden.
Ein Wochenende in Triest bedeutete für die meisten von ihnen zwei Tage Fahrt und zwei Nächte im Bus – ein Hotel konnten sie sich nicht leisten. An manchen Samstagen verwandelten dreihundert Busse oder sogar mehr die Stadt in eine einzige Verkehrshölle. Bis auf den letzten Zentimeter nützten sie alle verfügbaren Parkplätze aus. Enrico und seine Freunde machten sich manchmal die Mühe, nur die Busse, die rund um den Bahnhof standen, zu zählen.
Aber was vor zwanzig Jahren einem maghrebinischen Basar glich, ist heute ein totes Viertel. Der Wind wirbelt Packpapier, Blechdosen und Plastikbecher über die Straße. Die Geschäfte sind geschlossen, die Rolläden an den knallrot und giftgrün gestrichenen Buden heruntergelassen, die Leuchtschriften erloschen.
Das Geschäft mit dem ›blauen Gold‹, wie man die Bluejeans damals nannte, dürfte versickert sein. Die endlosen Menschenschlangen vor den Läden, die Stühle, die mitten auf dem Gehsteig standen, damit die Kunden in Ruhe Schuhe probieren konnten, die unverständlichen Laute der fremdländischen Händler, nichts als Erinnerungen.
Nur rund um das Denkmal der schönen Kaiserin Sissi breitet sich nach wie vor Konsumtristesse aus. Immer noch scheinen einige Slowenen zu glauben, hier Jeans, Elektrogeräte und Autozubehör billiger zu bekommen. Selbst heute am Feiertag haben einige Händler ihre zum Teil wahrscheinlich gestohlene Ware auf dem feuchten Rasen ausgebreitet. Doch die vielen Kinder, die in diesem Park früher mit ihren Spritzpistolen Krieg spielten, sind inzwischen erwachsen geworden und haben mit echten Waffen geschossen. Vielleicht sind sie längst tot, denkt Enrico.
Ohne die ärmlich gekleideten Gestalten, die frierend unter den kahlen Laubbäumen Schutz suchen, noch weiter zu beachten, verläßt er die kleine Parkanlage gegenüber dem Bahnhof.
Ein dünnes Hemd bedeckt meine Blöße, Arme, Beine und Hintern sind nackt. Mein Fleisch ist von vollkommener Schönheit, weich und warm, von Sonne durchflutet. Die Haut glatt und von unschuldigem Weiß, wie die Haut eines Kindes.
Enrico sitzt regungslos am Rand des Bettes, die Schultern gebeugt, die Arme auf den Schenkeln ruhend. Die dünnen, farblosen Lippen krampfhaft zusammengepreßt, starrt er auf den golden schimmernden Teppich. Die Morgensonne taucht das Schlafzimmer in ein verführerisches Licht. Geblendet schließt er die Augen.
Die Nacht war lang und stürmisch, wie schon so viele Nächte vorher. Gewöhnlich verschlafe ich die Vormittage. Enrico muß spätestens um sieben Uhr dreißig aufstehen, nur an den Wochenenden kann er ausschlafen.
Ich weiß, wie sehr er es liebt, beim Aufwachen meine feuchte Wärme neben sich zu spüren. Schlaftrunken schmiegt er sich an meinen weichen Körper und versucht eine zärtliche Umarmung. Unsanft stoße ich ihn weg. Ich schätze die Liebe am frühen Morgen nicht.
Die Augustsonne brennt mit voller Kraft in den kleinen Raum. Drückende Schwüle lastet über dem Zimmer, vermischt sich mit Schweißgeruch und abgestandenem Zigarettenrauch. Bestimmt träumt er von einem anderen Erwachen. Unter freiem Himmel, in kalter und klarer Gebirgsluft vielleicht? Es mangelt ihm nicht an Phantasie. Doch ich will nicht mit ihm in den Karst fahren. Ich bin eine sehr urbane Frau und halte nicht viel von Wald- und Wiesenromantik.
Resigniert betrachtet Enrico sein zerknittertes Hemd, das er gestern nacht ordentlich über eine Stuhllehne gelegt hat. Nun stellt er sich wieder vor, wie ich seine Hemden waschen und bügeln werde.
Ich kann mich nicht in der Rolle seiner lieben, kleinen Frau sehen, obwohl er mir unsere gemeinsame Zukunft immer wieder in den schönsten Farben ausmalt. Er langweilt mich stundenlang mit diesen trostlosen Zukunftsplänen: Ein kleines, trautes Heim, stilles Glück zu zweit ...
Gestern abend in der Bar lachte ich ihn aus, als er von Hochzeit sprach. Livio und Giorgio lachten mit mir. Aber mein lieber Enrico blieb ernst, verzog keine Miene, murmelte nur etwas von Ehe-Phobie. Mit sanftem Druck würde er mich eines Tages heilen, kündigte er seinen Freunden an. Mir verging das Lachen.
Ich liebe die Männer, viele Männer. Ein Mann hat mir noch nie gereicht. Mag sein, daß ich auch nur aus Langeweile mit ihnen ins Bett gehe. Vielleicht mache ich es aber auch aus Wut. Aus jener unbestimmten Wut auf das Leben, das mir bisher etwas schuldig geblieben ist. Aber so genau will ich es gar nicht wissen.
Enrico möchte mich trotzdem heiraten und viele kleine Kinderchen mit mir haben. Allein bei dieser Vorstellung bekomme ich Magenkrämpfe.
Er dreht sich zu mir um. Ich schließe schnell die Augen.
Zärtlich streicht er über meine Hüften, gibt mir einen zarten Schlag auf den Hintern und läßt seine Hand an meinen Schenkeln entlanggleiten.
Er schüttelt sich, als wäre ihm kalt. Wenn er sich neben mir ausstreckte, könnte er sich an meinem Fleisch wärmen. Aber er bewegt sich nicht, bleibt zitternd auf dem Bett sitzen, das von demselben Blau ist wie der Himmel.
Seine kalten Lippen nähern sich meinem Körper. Er küßt meine rosigen Backen, küßt sie gierig.
Ich rühre mich nicht. Gleich wird er mich wecken und sich über mich hermachen, mir dieses kurze, besinnungslose Vergnügen, diese endlosen Sekunden der Ekstase aufzwingen. Mit einem kurzen Blick überzeuge ich mich, daß er dazu fähig wäre – jederzeit bereit, einstweilen noch, solange er jung und kräftig ist.
Auch wenn ich ihn nicht leidenschaftlich begehre, so biete ich mich ihm, selbst jetzt im Halbschlaf, noch an. Und trotzdem werde ich ihn wieder mit einem anderen Mann betrügen. Dieser Gedanke beruhigt mich. Ist die Liebe nicht ein einziger Betrug? Vor allem ein Selbstbetrug?
Enrico steht auf, zieht das zerknitterte Hemd und die nicht mehr ganz saubere Hose an, stopft das Hemd in die Hose, streift meinen Körper mit einem letzten, wehmütigen Blick und verläßt das Zimmer.
Er verzichtet darauf, sich einen Kaffee zu kochen, befürchtet, das Geräusch der Espressomaschine könnte mich wecken. Im Bahnhofscafé gegenüber schmeckt der Espresso nicht schlecht. Auch ich trinke dort fast jeden Morgen meinen Milchkaffee.
Das Kritzeln eines gespitzten Bleistifts auf Papier. Er hinterläßt mir eine Nachricht, unterzeichnet bestimmt wieder mit einem Herzchen, dann verläßt er, beinahe geräuschlos, die Wohnung.
31. Oktober 1994
Langsam schließt sich das schwere Eisentor hinter ihm. Zwanzig Jahre und dreizehn Tage unschuldig hinter Gittern. Enrico wurde einen Tag früher aus der Haft entlassen. Sonn- und feiertags entlassen sie niemanden. An diesen Tagen sind die Büros der Gefängnisverwaltung unterbesetzt. Es herrscht akuter Personalmangel.
Enrico war ein ›Frack‹, ein Lebenslanger. Lebenslange verbrachten im Durchschnitt zwanzig bis zweiundzwanzig Jahre hinter Gefängnismauern, ehe ein Vollzugsgericht bei ordentlicher Haftführung ihrem Entlassungsantrag folgte.
Er mußte fast die volle Zeit absitzen. Alle seine Ansuchen um Begnadigung wurden abgelehnt. Er hatte vor Jahren zwei Mithäftlinge krankenhausreif geschlagen.
Zögernd dreht er sich noch einmal um. Die staatliche Strafanstalt thront wie eine mittelalterliche Burg, umgeben von Olivenhainen und braunen Feldern, auf dem sanften Hügel von San Stefano.
Die riesige Beton- und Stahlkonstruktion ist drei Stockwerke hoch, die Zellen liegen in einer langen Reihe nebeneinander auf den Galerien. Kantinen und Duschen befinden sich im Erdgeschoß. Die Werkstätten und die Büros der Gefängnisverwaltung sind in einem Nebengebäude untergebracht.
San Stefano gilt als das modernste und sicherste Gefängnis des Landes. Enrico wurde Ende 1976, kurz nach der Eröffnung dieses Renommierbaus, hierher verlegt. Die ersten beiden Jahre seiner Gefangenschaft verbrachte er in einem feuchten Loch in der Nähe von Triest.
Seine Zelle in dem Triestiner Gefängnis hatte kein Fenster. Er konnte nur auf den Korridor hinaussehen und zu den Zellen gegenüber. Damals war er noch froh gewesen, nicht isoliert zu sein. Er hatte interessante Leute um sich, eine bunte Gesellschaft von Dieben, Zuhältern und Betrügern.
Gleich zu Anfang, als er erst ein paar Wochen hinter Gittern saß, kam ein Brief von seinem Freund Michele. Die meisten Zeilen waren mit schwarzen Balken bedeckt. Wahrscheinlich hatte der Junge wirres Zeug geschrieben. Enrico hob den Brief dennoch auf, beantwortete ihn sogar ein gutes Jahr später.
Bald nach seiner Einlieferung begann er einen Fluchtplan zu entwickeln. Eineinhalb Jahre lang arbeitete er mit großer Akribie an seinem Plan. Er schlug die Zeit damit tot. Nach eineinhalb Jahren wurde ihm klar, daß er sich diesen Plan aus dem Kopf schlagen mußte. Allein würde er es niemals schaffen, und seinen ständig wechselnden Zellengenossen wollte er sich nicht anvertrauen. Aber es gab noch eine andere Fluchtmöglichkeit, mit der er sich nun in seinen Träumen beschäftigte. Die Gefängniswärter hatten zwar alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, Spiegel, Gürtel, Krawatten und Schuhbänder verboten, aber sein Plan war viel einfacher.
Die Stromversorgung in den Zellen war zeitlich begrenzt. Normalerweise wurde Punkt zehn Uhr abends das Licht ausgeschaltet. Danach kontrollierten die Wächter kaum mehr die Zellen. Er brauchte nur sein Bettlaken in dünne Streifen zu zerreißen, zwei, drei Streifen naß zu machen und zu einem festen Seil drehen und sich, wenn alle schliefen, auf die Bank zu stellen, das Seil am Fenstergitter befestigen, die Schlinge um den Hals zu legen und runterzuspringen.
»Die Stimmen der anderen Häftlinge verschmelzen zu einem unverständlichen Gemurmel, in meinen Ohren dröhnt ein lautes, eintöniges Surren. Und ich fühle, wie mich die Sehkraft verläßt. Die Zellenwände neigen sich, rücken immer näher, die Decke senkt sich ...«, schrieb er damals in seiner Verzweiflung an seinen Freund Michele. Er schrieb im Stehen, das Blatt Papier an die Wand gedrückt, da ihm keine bequemere Stellung möglich war, wenn er sich nicht auf den verdreckten Boden setzen wollte.
Den Häftlingen war es verboten, tagsüber das Bett zu benützen – eine reine Schikane. Sie waren zu fünft, eingeschlossen in einem Raum von höchstens zwölf Quadratmetern, zwei Stockbetten, eine schmale Bank ohne Rückenlehne, auf der ein kleiner Mann hockte und nachts auch schlief, weil es für ihn kein Bett gab. Die anderen streiften mit verschwitzten und zum Teil zerrissenen Kleidern wie blinde Fliegen im Raum umher, einige gingen barfuß. An einer Seite des Raumes befand sich eine Toilette, ohne Tür oder sonst eine Abtrennung, die Tag und Nacht Gestank verbreitete. Enrico hatte manchmal das Gefühl, in einer Kloake zu hausen.
Als einer seiner Zellengenossen aus der Strafanstalt entlassen wurde, bat ihn Enrico, seinen Vater aufzusuchen und ihm Bescheid zu geben, wie es um den Alten stehe. Der verrückte Säufer schickte ihm tatsächlich eine Nachricht. »Dein Vater liegt im Sterben«, stand auf dem Zettel, den ihm ein Wärter in die Hand drückte.
In seiner Verzweiflung schrieb Enrico, ohne sich vorher mit seinem Anwalt zu besprechen, einen Haftentlassungsantrag. Er schrieb, sein Vater sei pflegebedürftig, hätte nur mehr ein paar Wochen zu leben, er schrieb sich die Seele aus dem Leib und bekam nie eine Antwort. Sein Vater starb, und er erfuhr erst nach dem Begräbnis von seinem Tod. Damals las er gerade ›Zeno Cosini‹ und er beschloß, ebenfalls das Rauchen aufzugeben. An dem Tag, als der Anwalt ihn vom Tod seines Vaters unterrichtete, schrieb er zum ersten Mal in sein kleines, schwarzes Notizbuch: »1. Juli 1976. Drei Uhr nachmittags. Vater gestorben. LZ (= Letzte Zigarette).«
Kurze Zeit später wurde er nach San Stefano verlegt.
Die Zellen in San Stefano unterschieden sich nicht voneinander. Sie waren alle sechs Quadratmeter groß und spärlich möbliert: Pritsche, Tisch, Stuhl und Waschbecken. Die kleinen Zellenfenster waren vergittert und zusätzlich noch mit einem Maschendraht versehen. Die Häftlinge konnten nur nach draußen sehen, wenn sie auf einen Stuhl stiegen. Was sie sahen, war ein betonierter, schmutziggrauer Platz, auf dem im Sommer Fußball gespielt wurde.
Der einzige Baum stand ausgerechnet vor Enricos Fenster. Eine armselige, kleine Birke, die schon früh im Herbst ihre spärlichen Blätter verlor. Durch das vergitterte Zellenfenster fielen bizarre Schatten von den Zweigen herein. Manchmal stieg er auf seinen Stuhl und beobachtete den leeren Gefängnishof.
Die Gefängnismauer bestand aus groben Betonziegeln. Tauben nisteten in den Höhlen zwischen den Ziegelsteinen. Das große, rostige Eisentor quietschte laut in den Angeln und scheuchte die Tauben auf, sooft es geöffnet wurde. An windstillen Tagen konnte Enrico das Quietschen bis in seine Zelle hören.