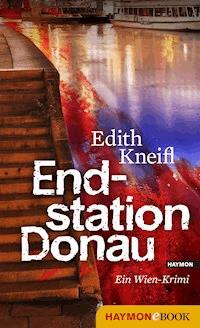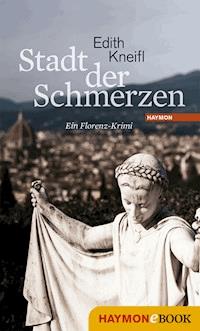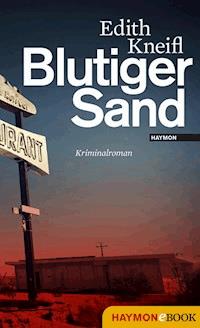Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein von der eigenen Vergangenheit geplagter Psychoanalytiker und ein trinkfester Expolizist treffen sich in einer Wiener Bar … Ein Witz? Nein: der Beginn einer Mörderjagd, die in die Untiefen der Wiener Seele führt. Das Es, das Ich und der Über-Vater Ist es ironisch, wenn man als Psychoanalytiker selbst an einem ungelösten Vaterkomplex leidet? Schon ein bisschen, aber das nützt Artur Lang – eigentlich verhinderter Barpianist – nun auch nichts. Denn der Vater ist tot und Artur zurück in Wien. Zuflucht vor seinen Patient*innen findet er bei seiner 85-jährigen Nachbarin, die überzeugt ist, dass gegen alles ein Kraut gewachsen ist und dem Zivildiener Jonas, der sie mit ebendiesem versorgt. Wölfe in der Stadt Als seine Patientin plötzlich stirbt, gerät Artur in Verdacht, daran nicht unschuldig sein. Hat er sie tatsächlich missbraucht, oder sprach ihre krankhafte Lügensucht aus ihr, als sie diesen Vorwurf in die Welt setzte? Ein Einbruch in Langs Praxis wirft weitere Fragen auf: Welche Rolle spielt sein alter Schulkollege Oswald - High Society Arzt mit locker sitzendem Rezeptblock - bei all dem und was hat es mit den Wölfen auf sich, von denen Artur meint, sie plötzlich in der Stadt zu sehen? Zusammen mit einer Barbekanntschaft mit kriminalistischem Hintergrund nimmt Psychoanalytiker Artur Nachforschungen auf. Leg dich auf die Couch und hol tief Luft Als ausgebildete Psychoanalytikerin begleitet uns Edith Kneifl in die Wiener Seele und bringt Licht in deren dunkle, verborgene und auch beunruhigende Ecken. Zusammen mit Artur versumpfen wir in gemütlichen Absteigen, lachen laut auf, wo es in der guten Gesellschaft verpönt ist, und halten die Luft an, wenn sich die Ereignisse überschlagen. Was auch nicht zu kurz kommt: Liebesgeschichten, Intrigen, Skandale, kurzum: alles, was man an dunklen Herbstabenden braucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Die Aufgabe des Therapeuten ist aber die nämliche wie die des Untersuchungsrichters; wir sollen das verborgene Psychische aufdecken und haben zu diesem Zwecke eine Reihe von Detektivkünsten erfunden, von denen uns also jetzt die Herren Juristen einige nachahmen werden.“
Dr. Sigmund Freud
TEIL I
November
Er war ihr gefolgt. Nicht zum ersten Mal. Seit Tagen behielt er sie im Auge. Als das automatische Gartentor aufging, wartete er exakt fünfundzwanzig Sekunden. Dann stieg er aus seinem Wagen und huschte durch das sich langsam schließende Tor.
Sie war bereits in die Garage gefahren.
Ohne Scheinwerferlicht war es stockdunkel. Kein Mond, keine Sterne. Zwischen den Ästen der hohen Nadelbäume drang nur vage die schwache Außenbeleuchtung des Hauses hindurch. Die Dunkelheit ringsum wurde durch den schwachen Lichtschein betont.
Er riskierte es, die Taschenlampenfunktion seines Telefons einzuschalten, um nicht über die Baumwurzeln, die aus dem Kiesweg ragten, zu stolpern, bis er so nahe am Haus war, dass er sie nicht mehr brauchte.
Es nieselte. Die Feuchtigkeit kroch unter seinen dünnen Trenchcoat. Er fröstelte. Die Aussicht, bei diesem nasskalten Wetter einige Stunden auf seinem Beobachtungsposten im Freien ausharren zu müssen, missfiel ihm. Wieder einmal verfluchte er seinen Job.
Er sehnte sich nach einer Zigarette, wagte es aber nicht, sich eine anzuzünden. Wenn sie bereits im Haus war, könnte sie bei der Finsternis durch ein Fenster die kleine Flamme sehen.
Zitternd trat er von einem Bein aufs andere.
Der Regen war stärker geworden. Er hatte dieses Sauwetter gründlich satt.
Sie musste längst drinnen sein.
Als endlich das Licht im Erdgeschoss anging, entspannte er sich ein bisschen. Die Rollos waren nicht heruntergelassen. Wenigstens würde er eine gute Sicht haben.
Er ging ein paar Schritte, um sich aufzuwärmen. Unter einer Trauerweide holte er ein Zigarettenpäckchen aus seiner Manteltasche, stellte den Kragen hoch, hielt ihn schützend vor das Feuerzeug und zündete sich eine an.
Gierig machte er einen tiefen Lungenzug. Die dunkel gekleidete Gestalt, die sich ihm von hinten näherte, bemerkte er nicht.
Plötzlich vernahm er ein leises Rascheln.
Erschrocken drehte er sich um und blickte in den Lauf einer Flinte.
Das metallische Klicken war nicht zu überhören.
Die Überraschung in seinen Augen wich blankem Entsetzen. Ein kaum hörbarer Schrei entkam seinem Mund, als die Schrotladung sein Gesicht und seinen Schädel zerfetzte.
Heftige Böen machten der kleinen Maschine schwer zu schaffen. Ich klammerte mich an die Lehnen meines Sitzes, schloss die Augen und malte mir den Aufprall des Fliegers neben der Landebahn und die darauffolgende Explosion aus.
Der Wiener Flughafen war vergrößert worden. Durch nicht enden wollende Gänge gelangte ich zum Ausgang.
Der persische Taxifahrer schien mich für einen Touristen zu halten.
Ich war nach wie vor sehr nervös. Um mich abzulenken, plauderte ich mit ihm über das verheerende Novemberwetter.
Er versuchte, mich zu beruhigen.
„Angeblich wird es nur noch morgen kalt und stürmisch sein, danach soll es wärmer werden. Sie hätten lieber im Frühjahr kommen sollen. Im Frühling ist Wien am schönsten.“
Dann wechselte der alte Mann das Thema, erzählte mir von seiner Flucht vor dem brutalen Schah-Regime im Jahre 1974.
Ich besitze die Fähigkeit, gut zuhören zu können. Und aufmerksame Zuhörer sind eben ideale Opfer für Leute, die sich ihr persönliches Elend von der Seele reden wollen.
Als wir uns der Stadt näherten und der Verkehr dichter wurde, begann er sich über die Unfreundlichkeit der Wiener zu beklagen. Automatisch pflichtete ich ihm bei.
Mich überfiel eine gewisse Schwere. Ich fühlte mich erdrückt und niedergeschlagen angesichts der zahlreichen Neubauten und Kräne, die vor uns in den dunklen Himmel ragten.
„Rund um den neuen Hauptbahnhof wird viel gebaut“, informierte mich mein Fahrer und versicherte mir, dass die Wohnungen hier ein Vermögen kosteten und daher nur für die Slim-Fit-Generation erschwinglich wären.
Erst als wir die Prinz-Eugen-Straße hinunterfuhren und die Statue des Rotarmisten am Schwarzenbergplatz in Sicht kam, erkannte ich die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen war, wieder.
Kolossale Gebäude aus weißem Stein mit riesigen Portalen und goldenen Türbeschlägen, imposante Stiegenaufgänge, protzige Denkmäler, Najadenbrunnen und neoklassizistische Paläste. Was für eine schwülstige Architektur! Ich bildete mir ein, helle Knabenstimmen zu hören, und sah vor meinen Augen weiße Pferde im Dreivierteltakt tanzen.
Ich war fünfundzwanzig Jahre lang weg gewesen, und von dem neuen Hauptbahnhof abgesehen, schien sich nicht viel verändert zu haben, obwohl sich alles anders anfühlte.
* * *
Um sechs Uhr früh erwachte ich in einem Hotelzimmer. Das Licht der Straßenbeleuchtung sickerte durch die Vorhänge. Durch das gekippte Fenster drang Verkehrslärm von der stark befahrenen Landesgerichtsstraße.
Ich hatte Kopfschmerzen. Der Schmerz meldete sich zuerst hinter meiner rechten Augenhöhle. Er verstärkte sich, strahlte bald über die ganze Stirn aus. Ich massierte mir sanft die Schläfen. Es half nichts. Das monotone Pochen ließ nicht nach. Vielleicht lag es an den beiden Beruhigungstabletten, die ich vor dem Flug genommen hatte?
Meine Flugangst war allerdings nicht der Grund, warum ich meine Heimatstadt über zwanzig Jahre lang nicht besucht hatte. Von Berlin aus hätte ich genauso gut mit dem Auto oder mit der Bahn öfter nach Wien fahren können.
Mein Zimmer hatte zwei große französische Fenster. Eines ging nach vorn auf die vierspurige Straße hinaus. Ich schob den Vorhang ein Stück beiseite und sah hinunter.
Menschenleere Straßen. Im Schein der Lampen malten sich die Kanten der Gehsteige deutlich von der Fahrbahn ab. Die Schatten der Hausdächer zitterten auf dem nassen Asphalt. Immer wieder blitzten Lichtstrahlen vorbeirasender Autos zwischen den Blättern der Bäume auf.
Ich ging zum anderen Fenster, schaute auf eine schmale düstere Gasse.
Hier waren die Männer der MA 48 bereits bei der Arbeit. Wortlos und ohne überflüssige Bewegungen entsorgten sie den Abfall der Stadt.
Der Parkettboden meines Zimmers war glattpoliert und erinnerte mich an die Böden in der Wohnung meiner Eltern.
Auf einmal schlug mir mein Puls bis zum Hals. Ich bekam kaum mehr Luft. Typische Vorzeichen einer Panikattacke.
Ich holte den Beutel für Erbrochenes, den ich im Flieger sicherheitshalber an mich genommen hatte, und atmete hinein. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sogleich fühlte ich mich besser.
Meine Muskeln entspannten sich, mein Brustkorb weitete sich. Ich schnäuzte mich in eine Serviette und öffnete beide Fenster.
Erleichtert sog ich die frische Luft ein und beschloss, auf das Hotelfrühstück zu verzichten. Unterwegs würde ich sicherlich irgendwo einen Kaffee bekommen. Appetit hatte ich ohnehin keinen.
Ich spazierte zum Parlament und dann den Ring entlang. Vor dem Palais, in dem ich meine Kindheit und Jugend verbracht hatte, verschnaufte ich kurz.
Die Wohnung hatte meinen Großeltern mütterlicherseits gehört. Mein Großvater war ein berühmter Arzt und überzeugter Nazi gewesen. Er hatte meinem Vater, also seinem Schwiegersohn, lange nach dem Krieg beruflich alle Wege geebnet.
Rasch ging ich weiter bis zur Oper. Der Anblick des altehrwürdigen Gebäudes, in dem ich mir als Student stundenlang die Beine in den Bauch gestanden hatte, rührte mich an. Meine Augen wurden feucht, als ich mich an die grandiose Tosca erinnerte, die ich als Achtzehnjähriger hier gehört hatte. Tja, Oper ist eben Gefühl pur!
Dieser Anfall von Sentimentalität ging vorüber, als ich die neuen Hotels und die Ringstraßengalerien erblickte. Anscheinend war die Wiener Innenstadt, die früher einem Freilichtmuseum geähnelt hatte, richtig elegant geworden. Die mondänen neuen Häuser passten perfekt zu dem alten imperialen Prunk.
Der äußere Schein war in Wien schon zu Zeiten der Monarchie sehr wichtig gewesen. Glänzende Fassaden, hinter denen sich das übliche psychische Elend verbarg. Was das betraf, kannte ich mich aus. Schließlich war ich in einer riesengroßen Altbauwohnung in einem der weniger grandiosen Ringstraßenpalais aufgewachsen.
Als ich das Hotel Imperial erreichte, beschloss ich, doch zu frühstücken. Mein Kreislauf spielte verrückt. Vielleicht war es keine so gute Idee gewesen, mich nüchtern auf den Weg zu machen?
War im Imperial eine Krawatte erforderlich? Ich war noch nie in diesem berühmten Hotel. Und ich trug prinzipiell keine Krawatten. Der schwarze Anzug, der graue Trenchcoat und der neue dunkelgraue Hut mit dem schwarzen Seidenband, den ich mir in einem Duty-Free-Shop am Berliner Flughafen besorgt hatte, mussten genügen.
Nach einem Blick auf die jungen, sehr sportlich gekleideten Gäste, die an der Rezeption herumalberten, entkam mir ein Lächeln. Offensichtlich hatten sich auch in Wien die Zeiten geändert.
Im Café entschied ich mich für einen Tisch beim Fenster und amüsierte mich über die neugierigen und neidischen Blicke der ersten Passanten, die geschäftig vorbeieilten. Fast fühlte ich mich wohl, als ich meinen Großen Braunen trank und ein Ei im Glas löffelte. Für eine Weile vergaß ich sogar den wahren Grund für meinen Wienbesuch.
Auf dem Ring staute sich mittlerweile der Verkehr. Viele Busse mit ausländischen Kennzeichen. Wien schien sich als Reiseziel großer Beliebtheit zu erfreuen.
Als ich das Hotel Imperial verließ, nieselte es. Ich war froh über meinen neuen Hut und den wasserabweisenden Trenchcoat und verzichtete darauf, ein Taxi zu nehmen. Nicht aus Sparsamkeit. Geld interessierte mich nicht besonders. Aber ich wollte wieder ein Gefühl für meine Heimatstadt bekommen, wofür sich eine Taxifahrt nicht besonders eignete.
Am liebsten wäre ich zu Fuß zum Zentralfriedhof gegangen.
Es war weit bis zu dieser Stadt der Toten, in der mehr Menschen ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten, als heute in Wien lebten. Außerdem war der Weg entlang des Rennwegs und der Simmeringer Hauptstraße nicht sehr verlockend, wenn ich mich richtig erinnerte. Daher fuhr ich mit der Straßenbahn bis zum zweiten Tor des Zentralfriedhofs.
* * *
In der schönen Jugendstilkirche hatte der Trauergottesdienst für meinen verstorbenen Vater bereits begonnen. Mein Herr Papa schien sehr beliebt gewesen zu sein. Die Friedhofskirche war überfüllt. Ich wunderte mich, dass so viele Menschen zum Begräbnis eines längst pensionierten Primarius gekommen waren. Wie hatte es seine zweite Frau bloß geschafft, den Alten hier und nicht in einer der Aufbahrungshallen verabschieden zu lassen?
Ich entdeckte sie nicht gleich, obwohl sie ganz vorne stand. Ein Witwenschleier bedeckte ihr Haar und ihr Gesicht. Aus der Ferne wirkte sie klein und sehr zart, fast schon zerbrechlich. War das tatsächlich die ehemals wohlgerundete, hübsche Frau Doktor Nadine Lang?
Unwillkürlich entkam mir ein Lächeln. Wir trugen den gleichen Nachnamen. Nicht ich hatte ihn ihr gegeben, sondern mein Vater.
Ich hörte nicht richtig zu, während diverse Honoratioren der Stadt meinen verstorbenen Vater, den Herrn Primar und Klinikvorstand, lobpriesen und seine Verdienste als Orthopäde hervorhoben.
Mein Vater hatte Macht ausgestrahlt. Macht wirkt nicht nur auf Frauen anziehend. Dennoch flogen vor allem die Frauen auf ihn, schwärmten von seiner einnehmenden Art, seinem umwerfenden Charme, hielten ihn für eine faszinierende Persönlichkeit.
Als Kind war er mir nie besonders großartig erschienen. Er mochte seine Qualitäten gehabt haben, für mich war er der strenge, furchterregende Vater gewesen, den ich aus tiefster Seele gehasst hatte. Eine ungesunde Vater-Sohn-Beziehung nannte man das. Ich wusste Bescheid, hatte genug Freud gelesen.
Ich musste an die vielen Nächte denken, in denen ich aus lauter Angst vor ihm beinahe ins Bett gemacht hatte. Seine brutalen Überfälle kamen oft unvorhergesehen. Wenn er abends spät heimkam, damals arbeitete er als Oberarzt in einem Spital, reagierte er nicht selten all seine aufgestauten Aggressionen an mir ab.
Aus heutiger Sicht war das nicht das Schlimmste. Wesentlich schlimmer als die körperlichen Übergriffe empfand ich den Psychoterror, den er über zwanzig Jahre lang auf mich ausgeübt hatte. Er stellte sehr hohe, ja unerfüllbare Ansprüche an mich, war ein Kontrollfreak und Tyrann. Jahrzehntelang ließ er meine Mutter und mich nach seiner Pfeife tanzen. Bis ich eines Tages die attraktive Nadine kennenlernte.
* * *
Der Priester beendete die Zeremonie. Die Trauergemeinde folgte den mit Arztkitteln bekleideten Sargträgern hinaus auf den Vorplatz. Der Sarg wurde in einem Leichenwagen verstaut. Nadine stieg in einen zweiten bereitstehenden Wagen. In ihren High Heels hätte sie den weiten Weg bis zu Vaters Grab nicht zu Fuß geschafft.
Ich reihte mich in den mittleren Reihen des Trauerzuges ein, kannte weder die Leute links noch rechts von mir. Sie unterhielten sich leise miteinander. Ich bekam mit, dass es um den Leichenschmaus ging, der, angeblich auf Wunsch des Verstorbenen, bei einem berühmten Heurigen in Grinzing stattfand und zu dem nur die Crème de la Crème der Stadt eingeladen war. Ich hatte nicht vor, am Totenessen teilzunehmen. Oder sollte ich aus reiner Bosheit dort erscheinen?
Während des langen Marsches dachte ich daran, wie ich Nadine kennengelernt hatte. Wir studierten beide Medizin und saßen in einer Vorlesung zufällig nebeneinander. Es war Liebe auf den ersten Blick. Zumindest meinerseits. Bald schon stellte ich sie meinen Eltern vor. Und das war der Anfang vom Ende.
Ein Jahr danach starb meine Mutter an einer Überdosis Schlaftabletten. Unfall oder Selbstmord? Diese Frage wurde nie geklärt. Ich hatte nicht gewusst, dass sie depressiv gewesen war, wie man danach spekulierte. Eine offizielle Diagnose hatte es nie gegeben. Als Ärztegattin weigerte sie sich, andere Ärzte zu konsultieren.
Noch bevor meine Mutter von uns ging, hatte ich meinen Vater überredet, Nadine einen Turnusplatz in seinem Krankenhaus zu verschaffen. Es wunderte mich, dass er meine Bitte so bereitwillig erfüllte. Von dem Verhältnis meines Vaters mit meiner Freundin hatte ich keine Ahnung. Auch als meine Mutter starb, ahnte ich noch nichts. Ich hielt ihren Tod damals für einen Unfall, da sie ständig Schlaftabletten geschluckt hatte. Mittlerweile war ich mir sicher, dass sie vom Verhältnis meines Vaters mit Nadine gewusst und deshalb den Freitod gewählt hatte. Bis heute gab ich ihm die Schuld an ihrem Tod.
Als ich dieses Arschloch, kurz nachdem meine Mutter gestorben war, dabei überraschte, wie er es am Küchentisch in unserer Wohnung mit Nadine trieb, rastete ich aus. Nur innerlich. Anstatt mit einem scharfen Fleischmesser auf die beiden loszugehen, ergriff ich die Flucht, fuhr mit dem Nachtzug nach Berlin.
In meinem Koffer befanden sich, außer ein paar persönlichen Sachen, der Schmuck meiner Mutter und zwei kleine Zeichnungen von Egon Schiele, die mein Nazi-Großvater kurz nach dem Krieg billigst erstanden hatte.
Eigentlich hatte ich vorgehabt, zu Beginn des darauffolgenden Semesters nach Wien zurückzukehren, doch ich blieb in Berlin.
Die Berliner Luft war in den späten 1990er Jahren nicht mehr von Verbrüderungs- und Freiheitsgeschrei erfüllt. Die große Depression machte sich breit. Berlin löste Wien als Hauptstadt der Melancholie ab. Dennoch genoss ich dort von Anfang an meine Anonymität.
Ich schrieb meinem Vater einen kurzen Brief. Verlangte mein Erbe. Mir standen nach dem Tod meiner Mutter zwei Drittel ihres Vermögens zu. Er antwortete nicht, schaltete einen Anwalt ein. Schließlich musste er nachgeben. Sobald das Geld auf meinem Konto eingelangt war, teilte ich ihm mit, dass ich wünschte, fortan von ihm in Frieden gelassen zu werden.
Anfangs hielt er sich nicht daran, hetzte mir sogar einen Privatdetektiv auf den Hals. Irgendwann gab er auf. Und irgendwann beendete ich meine Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Neurologie in Berlin. Dank des Erbes meiner Mutter.
Bereits während des Studiums stürzte ich mich in diverse psychotherapeutische Ausbildungen. Ich ertrug keine Autoritäten mehr, plante eine Praxis aufzumachen, mein eigener Herr zu werden. Jahrelang war ich mit mir und meinem Vaterkomplex beschäftigt, versuchte es mit Psychodrama und Katathymem Bilderleben, landete immer wieder bei meiner Kindheit.
Im Zuge meiner Ausbildungen begann ich dann mit einer Lehranalyse und experimentierte gleichzeitig mit Kokain, LSD und Magic Mushrooms. Meine Lehranalyse dauerte eine kleine Ewigkeit und kostete mich ein Vermögen. Meinem Analytiker bin ich bis heute treu ergeben. Bis zu meinem Umzug nach Wien war ich bei ihm in Supervision. Drogenexperimente hingegen interessierten mich schon lange nicht mehr.
Meine Panikattacken wurden im Laufe der Jahre seltener und hörten schließlich ganz auf. Andere Ängste und Phobien sind geblieben, wie eben Flugangst und Höhenangst. Wenn alles zu viel wurde und die Sehnsucht nach Ruhe im Kopf sehr groß war, schluckte ich gelegentlich noch ein Xanor, ein Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine. Mittlerweile konnte ich das Haus aber ohne eine Pille in meiner Hosentasche verlassen, was früher nicht möglich gewesen war.
Als Psychoanalytiker war ich in Berlin ziemlich begehrt. Ich hatte den Wien-Bonus. Analytiker aus Wien sind in Deutschland sehr gefragt, egal, ob sie Freudianer sind oder nicht. Die Arbeit schien damals eine Art Rettungsring für mich zu sein, denn meine wenigen Beziehungen waren alle gescheitert. Was mir blieb, war die Arbeit.
* * *
Die Sonne verabschiedete sich. Schneidender Wind kam auf. Eiskalter Regen prasselte auf die Trauergäste nieder, die dem Sarg folgten. Einige Leute machten sich aus dem Staub.
Ich nahm mir vor, bis zum bitteren Ende auszuharren. Selbst mein damaliger Lehranalytiker hatte mir indirekt empfohlen, der Konfrontation mit der einzigen Liebe meines Lebens nicht auszuweichen.
Ich hielt mich abseits, suchte mir einen Weg zwischen den Gräbern. Im Schutz der hohen Bäume entfernte ich mich etwas von dem Trauerzug.
Eichhörnchen huschten an mir vorbei. Ich blieb kurz stehen, sah zu, wie eines der niedlichen Tierchen eine Nuss in einem Astloch versteckte. Ob es die Nuss wiederfinden wird? Ich hatte mal gelesen, dass Eichhörnchen zu einfältig waren, um sich die Verstecke für ihre Vorräte zu merken.
Keine dreißig Meter vor mir tauchte plötzlich ein großer Hund auf. Sein Fell hob sich kaum vom grauen Himmel ab. War es nicht strengstens verboten, Hunde auf Friedhöfe mitzunehmen? Hunde sind gefräßiger als Ratten, was menschliche Überreste betrifft.
Ich wollte weitergehen. Irgendetwas hielt mich zurück.
Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete ich das große Tier, das wie eine Friedhofsstatue auf einem aufgeschütteten Erdhügel stand.
Gänsehaut überzog meinen Körper, als ich merkte, dass es sich nicht um einen Hund handelte.
Sehe ich statt weißer Mäuse graue Wölfe? Ich hatte nichts getrunken und war auch nicht anderweitig benebelt. Obwohl ich Wölfe bisher nur im Zoo oder im Fernsehen gesehen hatte, war ich mir sicher, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handeln musste.
Er starrte mich unverwandt an.
Nach ein paar Schrecksekunden, in denen ich wie angewurzelt dagestanden war, drehte ich mich um und entfernte mich betont langsam. Er würde mich schon nicht anfallen, am Friedhof gab es schließlich genug Aas.
Bald erreichte ich das hintere Ende des Trauerzugs. Erst jetzt sah ich mich noch einmal nach dem Wolf um. Er war verschwunden.
Sollte ich jemanden ansprechen und ihm von dieser surrealen Begegnung erzählen? Man würde mich für verrückt halten. Wölfe im Wienerwald – das hätte ich mir noch einreden lassen. Aber Wölfe in der Stadt? Völlig absurd! Hatten mich meine Augen doch getäuscht?
Als ich endlich an der ausgehobenen Grube angelangt war, verdrängte ich das unheimliche Erlebnis und stellte mich so hin, dass ich Nadine im Auge behalten konnte. Sie hatte mich noch nicht erblickt.
Meine ehemalige große Liebe hatte ihren Gesichtsschleier abgenommen.
Trotz Hilfe plastischer Chirurgie wirkte sie alt und verhärmt. Ihre aufgespritzten Lippen waren bestimmt zu keinem Lächeln mehr fähig. Ihr schulterlanges blondiertes Haar wirkte schütter. Sie war so dünn, dass man sie von hinten für einen unterentwickelten Teenie halten konnte, obwohl sie gleich alt war wie ich, also demnächst fünfzig wurde.
Nadine hatte auf eine große Karriere als Ärztin gehofft. Nach ihrer Heirat durfte sie meinem Vater in seiner Privatpraxis eine Zeit lang assistieren. Die Informationen über sie stammten hauptsächlich von meinem Jugendfreund Oswald. Nach meiner Flucht aus Wien hatten wir losen Kontakt miteinander gehalten.
Nadine gab die Zusammenarbeit mit meinem Vater bald auf und konzentrierte sich fortan auf ihre Rolle als Gattin des berühmten Herrn Primar. Ich verfolgte ihre gesellschaftlichen Aktivitäten, vor allem ihre Auftritte bei Charity-Events, manchmal im Internet.
Vom Tod meines Vaters hatte ich ebenfalls im Internet erfahren. Am Tag danach rief mich allerdings sein Anwalt an. Merkwürdigerweise hinterließ der Alte kein Testament. Sein Anwalt teilte mir mit, dass ich der Haupterbe war und Nadine sich mit dem Pflichtteil begnügen musste. Ich war zwar nicht scharf auf sein Vermögen, wollte es aber keinesfalls ihr überlassen.
* * *
Der Pfarrer machte nicht viel Aufhebens. „Gott sei seiner armen Seele gnädig“, nuschelte er. Hatte mein Vater an Gott geglaubt? Wohl eher nicht. Aber ich wusste es nicht. Ich wusste wenig über den Mann, der mich gezeugt hatte. In Gedanken starrte ich in seine dunklen, leeren Augenhöhlen, die einst eisblau waren und mir tödliche Angst eingejagt hatten.
Verzweiflung ergriff von mir Besitz, wie ich so dastand im Regen und mir seine Verwesung ausmalte, seinen blanken Totenschädel, seinen von Würmern angefressenen Körper …
Ich befürchtete, den Rest des Tages nicht ohne Xanor zu überstehen, atmete ein paar Mal tief durch, war aber nach wie vor völlig durcheinander, musste an den Tod und die Liebe zugleich denken.
Mir wurde bewusst, wie traurig mein eigenes Leben bisher verlaufen war. Ein Leben voller Unzufriedenheit, unterdrückter Wut und verrückter Rachepläne. Ich hatte ohne Liebe gelebt. Frauen hatten in meinem Leben keine große Rolle gespielt. Einige kurze Beziehungen, keine hielt länger als zwei Jahre, ein paar One-Night-Stands. Selbst in dieser Hinsicht schien ich das genaue Gegenteil meines virilen Vaters zu sein. Auch wenn mich meine Arbeit immer wieder über mein enttäuschendes Liebesleben hinweggerettet hatte, ging ich nie in ihr auf. Solange mein Vater gelebt hatte, war ich das Gefühl, nicht mein eigenes Leben leben zu können, selbst wenn mehr als sechshundert Kilometer zwischen uns lagen, nicht losgeworden. Einer von uns beiden hatte weichen müssen. Die Frage, wer, war nun entschieden.
Ein schneidender Wind kam auf. Rasch lockerten die Totengräber die Riemen, die unter dem Sarg hindurchliefen, und die schwere Kiste verschwand in dem dunklen Erdloch.
„Er möge in Frieden ruhen“, ertönte die Stimme des Pfarrers.
Das dumpfe Hämmern in meinem Kopf ließ nach. Auf einmal konnte ich wieder normal atmen. Weder spürte ich eine besondere Traurigkeit, die ich angesichts meines armseligen Daseins fühlen hätte müssen, noch verbitterte mich die Erinnerung an meine Kindheit, noch bereute ich all die Jahre, die ich vergeudet hatte. Alle Niederlagen erschienen mir jetzt, wo der Sarg im Grab verschwunden war, plötzlich nichtig und klein.
Solange mein Vater gelebt hatte, war in dieser Stadt kein Platz für mich gewesen. Nun war meine Zeit gekommen.
Die Trauernden warfen dem Toten Erde oder Blumen nach und kondolierten der Witwe, die knapp neben dem Grab stand.
Steif, mit unbewegter Miene und mit der großen dunklen Sonnenbrille auf der Nase, nahm Nadine die Beileidwünsche entgegen.
Ihr Anblick verursachte mir nach wie vor leichtes Unbehagen. Ich beobachtete sie aus ein paar Metern Entfernung.
Ich liebte sie nicht mehr, hasste sie nicht mehr, wusste jedoch nicht, wie ich mich ihr gegenüber verhalten sollte.
Zögernd streckte ich ihr meine Hand entgegen, als ich an der Reihe war.
Sie zuckte zusammen, ergriff meine Hand nicht, nahm aber ihre schwarze Sonnenbrille ab und starrte mich an, als wäre ich ein Außerirdischer.
Ihr Mund öffnete und schloss sich. Kleine Zuckungen liefen über ihr offensichtlich geliftetes Gesicht und den vergleichsweise faltigen Hals, der ihr tatsächliches Alter verriet.
Als sie einen Schritt zurückwich, geriet sie auf dem nassen Boden ins Rutschen. Hektisch ruderte sie mit den Armen, fand aber ihr Gleichgewicht nicht wieder und stürzte in die Grube. Mit einem lauten Krach landete sie auf dem hölzernen Sarg. Ihr dumpfer Schrei scheuchte die Kolkraben in den kahlen Bäumen auf. Ihr Gekreische übertönte die aufgeregten Stimmen der Trauergäste.
Während ich überlegte, ob ich hinunterklettern sollte, um Erste Hilfe zu leisten, zerrten die Totengräber Nadine bereits aus der Grube.
Sie stieg zwar nicht aus dem Grab wie Phönix aus der Asche, aber an ihr schien alles heil geblieben zu sein. Das schwarze Kostüm war verdreckt und ihre Strümpfe zerrissen. Doch sie war anscheinend mit ein paar blauen Flecken davongekommen.
Ihr empörter Gesichtsausdruck brachte mich zum Lachen.
Schluss mit all den Ängsten, Depressionen und Selbstzweifeln! In Zukunft werde ich weder einen Psychoanalytiker noch Xanor brauchen.
Lauthals lachend und begleitet vom Geschrei der Todesvögel, verließ ich die Grabstätte meines Vaters. Hunderte Augenpaare sahen mir empört nach.
Es störte mich nicht.
TEIL II
März
1.
Nachdem mein Vater unter der Erde war, gab es für mich keinen Grund mehr, nach Berlin zurückzukehren. Ich beschloss, die Erbschaft anzutreten, meine Wohnung und meine psychoanalytische Praxis in Berlin aufzugeben und fortan in Wien zu leben. Konkrete Pläne hatte ich noch keine, aber es fühlte sich richtig an, meine Heimatstadt zurückzuerobern.
In Berlin war ich nie glücklich gewesen. Wobei, was heißt Glück? Ich verwendete diesen unbestimmten Begriff normalerweise nicht.
Die Stadt war zu groß, zu chaotisch, zu protzig und zu heruntergekommen zugleich. Die deutsche Regierung war 1999 von Bonn nach Berlin gezogen und mit ihr zogen viele mit.
Der Kontrast zwischen Arm und Reich war in Berlin deutlicher sichtbar als in Wien. Die Gegensätze zwischen West und Ost irritierten mich. Vor allem stieß ich mich an der Überheblichkeit der Wessis gegenüber den Ossis. Allerdings ging mir auch die ständige Jammerei der Deutschen aus den neuen Bundesländern auf die Nerven. Alle blieben für sich in ihrem Teil von Berlin, obwohl die Mauer längst gefallen war. Ich überlegte damals kurz, mir im ehemaligen Osten der Stadt Arbeit zu suchen. Meine Bekannten rieten mir davon ab.
Anfangs wohnte ich in einer Wohngemeinschaft. Bevor die Mieten unerschwinglich wurden, fand ich eine relativ günstige Altbauwohnung für mich allein in Kreuzberg.
In der psychiatrischen Klinik, in der ich arbeitete, hatte ich häufig mit Süchtigen zu tun. Junkies und Alkoholkranke gaben sich bei uns die Türklinke in die Hand.
In Österreich herrschten um die Jahrtausendwende ebenfalls traurige Zeiten. Ein konservativer Wahlverlierer wurde mit Hilfe einer Rechtsaußenpartei Bundeskanzler. Im Ausland wurde Österreich geächtet. Ich schämte mich für meine Landsleute.
Als ich im November nach Wien zurückkehrte, hatte sich politisch seit meiner Flucht nicht viel verändert. Ich beschloss, mich nicht mehr um Politik zu kümmern. Ich hatte andere Sorgen.
Die Erbschaftsgeschichte war rasch erledigt. Allerdings fiel es mir schwer, mich in Wien wieder einzugewöhnen. Berlin war mir zu groß gewesen, Wien zu klein. Manchmal dachte ich daran, mich irgendwo im Süden niederzulassen, denn am wohlsten fühlte ich mich in Ländern, in denen ich die Sprache der Menschen nicht verstand.
Ich war ein vermögender Mann. Mein Vater hatte bei seiner zweiten Eheschließung auf Gütertrennung bestanden. Sowohl die riesige Altbauwohnung im Ringstraßenpalais am Opernring als auch das Haus an der Alten Donau hatten meiner Mutter gehört und waren wegen eines ungünstigen Testaments zunächst an meinen Vater gefallen. Jetzt ging beides in meinen Besitz über.
Der Rest von Vaters Vermögen wurde zwischen Nadine und mir aufgeteilt. Ich bekam zwei Drittel. Nadine musste sich mit einem Drittel zufriedengeben. Aber mit ihrer Witwenrente und der Ärztekammerpension hatte sie ein gutes Auskommen. Im Grunde konnte sie sich nicht beklagen.
Ich gab ihr Zeit bis zum nächsten Sommer, um sich eine neue Bleibe zu suchen. Bis dahin konnte sie im Haus an der Alten Donau kostenlos wohnen bleiben. Sie musste nur die Instandhaltungs- und Betriebskosten bezahlen.
Laut meinem Freund Oswald fand Nadine, dass sie sehr schlecht weggekommen war. Angeblich hatte mein Vater ihr versichert, dass er mich enterben würde. Bestimmt hatte er das auch vorgehabt. So wie ich ihn einschätzte, dachte er aber mit siebenundsiebzig noch nicht ans Sterben und daher auch nicht an ein Testament.
Oswald hatte versucht, zwischen Nadine und mir zu vermitteln. Aber all seine Fähigkeiten als selbsternannter Mediator fruchteten nicht. Das Verhältnis zwischen meiner Ex-Verlobten und mir blieb, trotz der Gleichgültigkeit, die sich bei mir am Begräbnis eingestellt hatte, vor allem bei persönlichen Aufeinandertreffen angespannt.
Oswald war seit der Kindheit mein bester Freund. Er war ebenfalls beim Begräbnis meines Vaters. Ich hatte ihn nicht bemerkt. Er mich sehr wohl.
Als ich nach dem Eklat am Grab den Zentralfriedhof verließ, lief er mir nach. Vor dem Tor holte er mich ein. Oswald war immer schon der Sportlichere von uns beiden gewesen.
Mein Freund stammte aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Bis heute genierte er sich für seine Herkunft. Sein Vater war Eigentümer eines kleinen Lebensmittelladens in der Nibelungenstraße. Die Mutter arbeitete im Geschäft mit. Nachdem sie Konkurs anmelden mussten, suchte sie sich einen Job als Kassiererin in einem Supermarkt. Abends putzte sie Büros, um ihren alkoholkranken Mann und ihren Sohn durchzubringen.
Oswalds Vater war ebenso gewalttätig wie meiner. In dieser Hinsicht waren mein Freund und ich Leidensgenossen. Herr Pabst prügelte nicht nur seinen Sohn halbtot, sondern auch seine Ehefrau. Kein Wunder, dass Oswald gerne in die Schule ging und Klassenbester war.
Später studierten wir gemeinsam Medizin. Im Gegensatz zu mir war Oswald sehr ehrgeizig. Bis zu meiner Flucht nach Deutschland wohnten wir sogar gemeinsam in einer WG. Oswald besuchte mich anfangs ein paar Mal in Berlin. Mit den Jahren wurde der Kontakt loser und in letzter Zeit telefonierten wir nur mehr zu Weihnachten und anlässlich unserer Geburtstage. Da wir beide keine großen Mail-Schreiber waren, hörten wir nicht oft voneinander.
Oswald war als Student ebenfalls in Nadine verliebt gewesen. Ich erinnere mich bis heute mit Schaudern an unseren missglückten Dreier. Als Nadine mit ihm herumzumachen begann, lief ich davon. Angeblich war nichts passiert, beteuerten beide am nächsten Tag.
Kurz danach verlobte ich mich mit Nadine. Mein Freund erwies sich als guter Verlierer. Er tröstete sich bald mit einer anderen Kommilitonin.
Ich musste grinsen, als ich an all die Frauen dachte, die Oswald früher abgeschleppt hatte. Mein Freund war ein richtiger Womanizer gewesen. Keine hatte seinem jungenhaften Lächeln und seinen schönen dunklen Augen widerstehen können.
Er sah heute noch gut aus. Sein braunes Haar war zwar grau geworden, doch sein bubenhaftes Gesicht hatte sich kaum verändert. Er war einige Zentimeter größer als ich, gut gebaut und wirkte sehr fit und durchtrainiert.
Meine Gedanken kehrten zurück zu den letzten Tagen vor meiner Abreise nach Berlin.
Das Bild von Nadine, wie sie mit weit gespreizten Beinen am Küchentisch lag und sich von meinem Vater vögeln ließ, sehe ich bis heute deutlich vor meinem geistigen Auge. Ihr gelangweilter Gesichtsausdruck, dann der erschrockene Blick, als sie mich an der Türschwelle bemerkte … Zwei Tage später fuhr ich, wie gesagt, mit dem Nachtzug nach Berlin.
Gleich nach dem Ende meiner Facharztausbildung an der Charité stürzte ich in ein tiefes schwarzes Loch. Meine damalige Freundin verließ mich, weil mit mir offenbar nichts anzufangen war. Ich tat mir selbst unheimlich leid. Einsam und verlassen in einer Stadt, die ich nicht besonders mochte, tröstete ich mich mit Alkohol, Drogen und schlechter Gesellschaft. Anstatt mir einen Job zu suchen, verbrachte ich die Abende in den angesagten Bars von Kreuzberg, warf das Geld mit beiden Händen raus, haute mir die Nächte um die Ohren und schlief bis in den Nachmittag hinein.
Eines Nachts baute ich mit dem Auto eines Freundes einen Unfall und landete mit einer Gehirnerschütterung und zwei gebrochenen Rippen in der Notaufnahme eines Krankenhauses.
Die resolute Ärztin, die mich behandelte, empfand Mitleid mit mir. Nach meiner Entlassung aus dem Spital und einem eindringlichen Gespräch verhalf sie mir zu einem Job als Psychiater in einem kleineren Krankenhaus.
In dieser Zeit hatte ich mich, wie gesagt, auf verschiedene Therapieausbildungen eingelassen, die mich dann zur Psychoanalyse führten.
Oswald schien sich über meine Rückkehr im November des vorigen Jahres sehr zu freuen. Letzte Weihnachten, die ich mit ihm gemeinsam in einem Hotel in der Steiermark verbracht hatte, redete er mir gut zu, mich in Wien als Psychiater und Psychoanalytiker niederzulassen.
Ich hätte nicht gleich arbeiten müssen, doch ich hatte irgendwie Lust, im Land, in dem die Neurosen blühen, zu praktizieren.
Mitte Jänner eröffnete ich die Praxis. Anfang März war mein Terminkalender voll. Die meisten Patienten hatte mir Oswald überwiesen. Ich arbeitete höchstens fünf Stunden pro Tag. Da ich kein Morgenmensch war, begann ich immer erst am späteren Vormittag.
Oswald war Allgemeinmediziner und betrieb eine florierende Wahlarztpraxis in Hietzing. Er bemühte sich gar nicht erst um einen Kassenvertrag, da seine betuchten Patienten und Patientinnen ohnehin lieber bar bezahlten. Vor einigen Jahren hatte er sich auf Lifestyle-Medizin spezialisiert, bot seither Ernährungsumstellungen und Diätberatung an sowie dauerhafte Haarentfernung oder intravenöse Laserbehandlung bei Schmerzen, Allergien und anderen Beschwerden. Er empfahl die Lasertherapie auch bei Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen, was mich dann doch wunderte.
Vor Kurzem hatte er mir stolz erzählt, dass er seine Patienten auch mit Hypnose behandelte. Soviel ich wusste, hatte er weder das Diplom, das Ärzte berechtigt, psychotherapeutisch zu arbeiten, noch eine Hypnosetherapieausbildung. Für die zwanzigminütigen Sitzungen verlangte er ein Vermögen. Mich störte, dass er sich ständig über sich und seine reichen Patienten lustig machte. Er nahm diesen Psychokram, wie er es nannte, nicht ernst.
* * *
Mein Vater hatte mir ein Medizinstudium nicht zugetraut und mir geraten, Musiklehrer zu werden. Dafür reiche meine Intelligenz gerade aus, hatte er wörtlich gesagt.
Als ich mich doch für Medizin entschied, ermutigte er mich nie, sondern prüfte mich beim Abendessen ab, stellte mir im ersten Semester Fragen, die wahrscheinlich nicht einmal seine Oberärzte beantworten hätten können.
Es störte ihn, dass ich mich nicht für sein Fach, die Orthopädie, interessierte. Ich war bereits damals fasziniert von der Psyche des Menschen. Während fast alle berühmten Sportler des Landes, von der Skifahrerin bis zum Fußballer, bei ihm unter dem Messer lagen und er auch an anderen Berühmtheiten herumschnipselte, lag ich auf meinem Bett und verschlang die Werke von Sigmund Freud.
Das große Praxisschild aus Messing am Eingang des Ringstraßenpalais tauschte ich aus. Jetzt hing ein kleineres dort, auf dem stand schlicht und einfach: „Dr. Arthur Lang, Psychoanalytiker und Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Termine gegen Voranmeldung“ und daneben meine Telefonnummer.
Ich arbeitete vorwiegend als Psychoanalytiker. Meine Analysepatienten lagen drei- bis viermal in der Woche bei mir auf der Couch. Patienten, die nur psychiatrische Hilfe suchten, empfing ich meistens nach den Analysestunden im Halbstundentakt.
Meine Ordination, in der mein Vater bis zu seinem Tod praktiziert hatte, besaß neben einem eigenen Eingang auch einen Zugang zur danebenliegenden Wohnung, in die ich ebenfalls im Jänner eingezogen war.
Der kleinere Raum der Ordination, die meine Eltern damals als Wohnung erworben und umgebaut hatten, diente als Wartezimmer. Hinter einer verglasten Front befand sich das Reich der Sprechstundenhilfe. Im Bad gab es eine behindertengerechte Toilette und ein Waschbecken für die Patienten. Die Dusche hatte mein Vater herausreißen lassen. Die Küche war mit Bücherschränken vollgeräumt. Außer einer Kaffeemaschine, einem Wasserkocher und einem Kühlschrank erinnerte nichts mehr an die ehemalige Nutzung dieses Raumes.
2.
„Ich bin eine Mörderin.“
Ihre schrille Stimme ließ mich aufschrecken.
Ich war eingenickt. Meine Ordination war überheizt, mein Ohrensessel am Kopfende der Couch sehr bequem.
Vielleicht sollte ich mir einen unbequemeren Stuhl zulegen? In letzter Zeit nickte ich öfters ein, vor allem in den psychoanalytischen Sitzungen am frühen Abend, wenn es draußen dämmerte und die Straßenbeleuchtung auf der Ringstraße meinen Behandlungsraum in ein anheimelndes Licht tauchte.
Ich reagierte nicht, fürchtete, meine Stimme könnte verraten, dass ich ein Schläfchen gehalten hatte. Was hatte ich verpasst? Worüber hatte sie gesprochen, als ich kurz weggetreten war?
Anna Maria war eine schwer neurotische Frau Anfang vierzig. Der Ursprung ihrer seelischen Qualen dürfte, wie so oft, in der Kindheit liegen. In Fällen wie ihrem lag die Vermutung nahe, dass sie einem traumatisierenden Sexualerlebnis ausgesetzt gewesen war. Bisher war aber nichts dergleichen zur Sprache gekommen. Auch schwere Vernachlässigung konnte eine Rolle gespielt haben.
Immer wieder fragte ich mich, was ihr tatsächlich widerfahren sein mochte. Manchmal ertappte ich mich dabei, in Frage zu stellen, ob sie überhaupt ein furchtbares Trauma erlebt hatte. Vielleicht waren es doch recht gewöhnliche Ereignisse, die durch ihre außergewöhnliche Empfindsamkeit verstärkt worden waren.
Als sie aufgeregt weitersprach, hörte ich aufmerksam zu.
„Wir sind ausnahmsweise mit der U-Bahn gefahren. Mein Mann meinte, wir wären so schneller als mit einem Taxi. Um diese Zeit sind vor allem die Ausfahrtsstraßen von Wien verstopft. Eugens Wagen war in der Werkstatt … Ich sage nur U4! Gestank nach Schweiß und billigem Aftershave, primitive heruntergekommene Gestalten, kreischende Kleinkinder. Es herrschte ein fürchterliches Gedränge. Montagabend. Sie verstehen?“
Ich verstand nichts, hoffte, sie würde bald auf den Punkt kommen.
„Er hat mich aus der Galerie abgeholt. Wir mussten zu einem Abendessen mit Freunden.“
„Wer hat Sie abgeholt?“
„Hören Sie mir nicht zu?“, kreischte sie. „Mein Mann natürlich! Von wem reden wir die ganze Zeit?“
Ich war an ihre Stimmungswechsel gewöhnt, dennoch überraschte mich ihr aggressiver Ton.
„Möchten Sie nicht wissen, wie ich ihn umgebracht habe?“
Ich unterließ es lieber, sie zu fragen, ob sie von ihrem Mann sprach, stattdessen sagte ich: „Sie glauben einen Menschen umgebracht zu haben?“
„Nein, ich glaube es nicht. Ich weiß, dass ich ihn getötet habe. Er hat den Tod verdient.“
Es erschien mir angebrachter, zu schweigen und sie weiter toben zu lassen.
„Wir sind am Ende des Bahnsteigs gestanden. Die Meute hinter uns hat zu drängeln begonnen, als die Ankunft der U4 über den Lautsprecher angekündigt wurde. Wir waren ganz vorne. Plötzlich habe ich ein monströses, hartes Ding an meinem … Sie wissen schon … gespürt.“ Sie schluchzte heftig.
„Und dieser Schlappschwanz von Eugen hat keinen Finger gerührt. Ich war so wütend und enttäuscht von diesem Arsch.“
Mir fiel auf, dass sie es meistens vermied, ihre eigenen Sexualorgane zu benennen, gleichzeitig aber zu einer sexualisierten Ausdrucksweise neigte.
„Und dann ging alles sehr schnell. Die Lichter der einfahrenden U-Bahn haben mich geblendet. Ich habe einen Schritt zurück gemacht, bin dann knapp neben statt vor ihm gestanden.“
Oh mein Gott! Sie wird doch nicht ihren Mann vor die U-Bahn …?
„Ich habe ihm einen kräftigen Stoß versetzt. Der Typ ist ins Taumeln geraten und auf die Geleise gestürzt. Der einfahrende Zug war nicht schnell, trotzdem hat der Fahrer nicht mehr bremsen können. Von dem Schwein hat man nur mehr die abgetrennten Beine gesehen. Sein Kopf ist wahrscheinlich zwischen den Gleisen gelegen und sein Körper zermalmt worden. Der Mann hat weiße Socken zu schwarzen Schuhen getragen. Stellen Sie sich das vor! Als die ersten Leute zu schreien begonnen haben, bin ich in ihr Geschrei mit eingefallen und habe mich durch die Menge Richtung Ausgang gezwängt. Eugen ist hinter mir her gelaufen. Er dürfte nicht mitgekriegt haben, was ich getan habe, denn er hat kein Wort darüber verloren, als wir endlich in einem Taxi gesessen sind.“
Ich verdrehte die Augen, hielt ihre Geschichte für eine ihrer Rachefantasien.
„Sein Körper war zerstückelt und überall war Blut“, flüsterte sie aufgeregt.
„Verzeihung, was haben Sie gesagt? Ihre letzten Worte habe ich nicht verstanden.“
„Sie verstehen nie etwas. Sie glauben mir nicht, denken, ich habe diese Geschichte erfunden. Kaufen Sie sich eine Zeitung!“
Wütend sprang sie auf. Die Le-Corbusier-Liege drohte zu kippen. Ehe ich Stift und Block zur Seite legen konnte, baute sie sich mit hochrotem Gesicht, die Hände in ihre breiten Hüften gestemmt, vor mir auf und funkelte mich zornig an.
„Wenn Sie mir nicht vertrauen, ist der ganze Zirkus hier sinnlos.“
Sie knallte hundertfünfzig Euro auf meinen Schreibtisch und verließ grußlos, zehn Minuten vor dem Ende ihrer Sitzung, die Ordination. Die vorbereitete Quittung ließ sie auf meinem Schreibtisch liegen.
„Auf Wiedersehen, Frau Mayerbach“, rief ich ihr nach.
Meine Patientin war mit einem deutschen Adeligen verheiratet und legte großen Wert auf das Wörtchen „von“. In Österreich waren die Adelstitel 1919 abgeschafft worden. Ich dachte nicht im Traum daran, das kleine „von“ zu benützen.
Kaum war die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen, griff ich nach meinem Handy, schaltete es ein und informierte mich über die aktuellen Neuigkeiten im Internet.
Es hatte tatsächlich einen Zwischenfall in der U-Bahn gegeben. Angeblich war der Betrieb der U4 wegen eines technischen Gebrechens eine Weile eingestellt gewesen.
Ich vermutete, dass sich jemand vor die U-Bahn geworfen hatte, und fragte mich nicht zum ersten Mal, warum die Wiener Verkehrsbetriebe Suizide nicht öffentlich bekanntgaben.
Um keine Nachahmungstäter zu animieren, du Dummkopf, sagte die Stimme meines Vaters.
Ich ignorierte sie.
Entweder hatte meine Patientin diesen Selbstmord mitangesehen oder davon gehört oder gelesen und ihn nun für ihre Fantasiegeschichte verwendet.
Sie litt unter Mythomanie oder auch Pseudologia phantastica, dem zwanghaften Erzählen von unwahren Geschichten, meist über sich selbst oder über etwas, das sie angeblich erlebt hatte. Um Beachtung und Anerkennung zu erreichen, war ihr jedes Mittel recht.
Anna Maria war eine zwanghafte Lügnerin, schien ihre Lügen selbst manchmal zu glauben und schmückte sie aus, wenn sie meine Zweifel spürte. Sie war nicht wahnhaft, im Grunde wusste sie, dass sie scheinbar grundlos die Unwahrheit sagte.
Vor ein paar Jahren hatte ich in Berlin einen Patienten behandelt, der unter dem Münchhausen-Syndrom litt. Er verbreitete ständig Lügen über seinen angeblich schlechten gesundheitlichen Zustand, um beachtet zu werden.
Anna Maria war ein anderes Kaliber. Obwohl sie unter Schlafstörungen litt und ständig Beruhigungsmittel schluckte, klagte sie fast nie über irgendwelche Beschwerden, sondern erzählte mir die abenteuerlichsten und verrücktesten Geschichten.
Ich erinnerte mich an eine andere Verfolgungsstory, die sie mir gleich zu Beginn ihrer Analyse aufgetischt hatte. Damals hatte sie behauptet, ihr Mann hätte ihr einen Privatdetektiv auf den Hals gehetzt.
Sie fühlte sich tagelang von einem dunklen Wagen verfolgt. Und eines Abends, als sie in die Garage fuhr, sah sie eine Gestalt, die sich auf ihrem Grundstück herumtrieb. Da diese Person plötzlich wieder verschwand, vermutete sie selbst, sich alles nur eingebildet zu haben.
Dieser Meinung war damals auch ich.
Sigmund Freud hätte seine helle Freude an dieser Patientin gehabt.
Sie litt unter einer histrionisch-narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Mein Freund Oswald, bei dem Frau Mayerbach wegen ihrer Schlafprobleme früher in Behandlung war, diagnostizierte sie mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Diesen Begriff fand ich zu verwaschen.
Oswald warnte mich vor ihr, riet mir, sie weiterzuschicken. Ich hörte nicht auf ihn.
Wie sich später herausgestellt hatte, war ich von Anna Maria Mayerbach selbst auserwählt worden. Sie war ebenfalls beim Begräbnis meines Vaters. Mein peinlicher Auftritt damals hatte ihr imponiert, wie sie mir später gestand. Also verdankte ich diese Patientin im Grunde meinem Vater. Sie hatte ihn gekannt, hatte ihn wegen ihrer Knieschmerzen mehrmals aufgesucht.
Da Frau Mayerbach nicht den Anspruch erhob, meine Honorare mit der Krankenkasse zu verrechnen, blieb es mir erspart, eine eindeutige Diagnose stellen zu müssen.
Ihr bühnenreifer Abgang beschäftigte mich nicht lange. Ich machte mir nur ein paar Notizen.
Anna Maria war ein gutes Beispiel dafür, dass die Vergangenheit unser Verhalten bestimmt. Auch wenn mir noch unklar war, welche konkreten Traumata ihrer Störung zugrunde lagen, wusste ich inzwischen ein bisschen über ihre schwierige Kindheit Bescheid. Als Pubertierende litt sie unter Anorexie und war deswegen bei einem Psychiater in Behandlung. In dieser Zeit begann sie auch, sich selbst zu verletzen. In den letzten Sitzungen gewann ich den Eindruck, dass wir ihren Medikamentenmissbrauch – sie nahm meines Wissens vor allem Beruhigungsmittel – langsam in den Griff bekamen. Auch ihre Alkoholexzesse waren seltener geworden.
Nach der Sitzung kochte ich mir einen Kaffee und stellte Nachforschungen über den U-Bahn-Zwischenfall im Internet an. Auch wenn mir bewusst war, dass Anna Marias Fantasie grenzenlos war, konnte ich ein vermeintliches Mordgeständnis nicht auf die leichte Schulter nehmen und hielt Nachforschungen für gerechtfertigt.
Auf orf.at und in einigen Zeitungen fand ich kurze Notizen über einen Unfall in der U-Bahn-Station Karlsplatz. In einem Chatroom gab es den ersten Hinweis auf Selbstmord. Die üblichen Wichtigtuer tauschten ihr Halbwissen aus. Einer deutete sogar an, dass es Mord war. Obwohl ich dieses Getratsche nicht ernst nahm, verunsicherte es mich. Hatte Anna Maria die Wahrheit gesagt? Stieß sie den Mann, der sie belästigt hatte, tatsächlich vor die U-Bahn?
Mein Handy klingelte.
Caroline Čećnik, meine alte Nachbarin. Ich hatte sie gebeten, nicht einfach bei mir anzuläuten, sondern mich vorher anzurufen. Anfangs war sie öfters während einer Therapiesitzung vor meiner Tür gestanden. Diskretion war ein Fremdwort für sie. Mit so einer Nachbarin war es schwierig, ein zurückgezogenes Leben zu führen.
„Schön, dass du heute so früh Schluss gemacht hast. Magst nicht auf einen Sprung rüberkommen? Ich habe gerade Nachschub gekriegt.“
Ich musste mir ein Lachen verkneifen.
Caroline war ein hoffnungsloser Fall. Diese exzentrische alte Dame war ständig zugekifft.
Um ihr Alter machte sie ein großes Geheimnis. Ich schätzte sie auf mindestens achtzig, wenn nicht älter. Sie litt unter Polyneuropathie und schwerer Arthritis, verweigerte aber Schmerzmittel und behauptete, dass ihr nur Marihuana Linderung verschaffte.
Caroline war Schauspielerin. Ihr letztes Engagement lag eine Weile zurück. Irgendwann hatte sie mal erwähnt, dass sie zuletzt vor fünfzehn Jahren auf einer Bühne gestanden war. Im Gegensatz zu anderen alten Leuten sprach sie selten über ihre Vergangenheit. Sie schien mehr an der Gegenwart interessiert, diskutierte gerne über Gott und die Welt und war bestens informiert, da sie viel fernsah und sowohl eine Tageszeitung als auch eine wöchentlich erscheinende Stadtzeitung abonniert hatte. Trotz ihres nicht unbeachtlichen Konsums von Marihuana schien sie alles unter Kontrolle zu haben.
Meine Nachbarin war auch dem Alkohol nicht abgeneigt. Klein und zart, wie sie war, vertrug sie nicht viel. Ein, zwei Likörchen am Nachmittag und ein, zwei Gläschen Rotwein abends. Betrunken hatte ich sie noch nie erlebt.
Als ich vor nunmehr vier Monaten in die Wohnung meiner Eltern zurückgekehrt war, hatte sie mich freudig willkommen geheißen. Während ich eine sehr vage Erinnerung an die Nachbarin meiner Eltern hatte, konnte sie sich gut an mich erinnern.
Sie hatte nach ihrer Scheidung von einem berühmten Theaterregisseur die dritte Wohnung im zweiten Stock gekauft. Ich war damals vierzehn oder fünfzehn gewesen. Mit neunzehn war ich ausgezogen, hatte mit meinem Freund Oswald und mit Axel, einem Medizinstudenten, den wir beim Inskribieren kennengelernt hatten, eine Männer-WG gegründet.
Caroline hatte sich mit meiner Mutter gut verstanden. Meinen Vater hatte sie nicht ausstehen können. Vielleicht mochte ich sie auch deshalb?
Sie schimpfte aber nur selten über ihn, da sie abergläubisch war. Toten durfte man nichts Schlechtes nachsagen. Außerdem glaubte sie, dass er keines natürlichen Todes gestorben war. Anfangs hatte sie Nadine verdächtigt, ihn ermordet zu haben. Seit ich ihr erzählt hatte, dass ich der Haupterbe meines Vaters war, sprach sie nicht mehr davon.
Die alte Schauspielerin war nicht sehr mobil, verließ kaum das Haus, spazierte sogar in ihrer Wohnung mit dem Rollator herum. Obwohl sie von einer sozialen Organisation gut versorgt wurde – sie bekam Essen auf Rädern und täglich schaute ein Zivildiener bei ihr vorbei und wenn sie krank war auch eine Pflegerin –, erledigte ich manchmal Besorgungen für sie oder brachte sie zu einem Arzt.
Sie revanchierte sich mit Gras. Ja, Caroline war meine Dealerin.
Nach dem Tod meines Vaters hatte auch ich wieder zu kiffen begonnen. Allerdings rauchte ich nur abends, wenn ich nicht einschlafen konnte, einen Joint.
Von wem Caroline den Stoff bezog, hatte sie mir bisher nicht verraten. Ich verdächtigte einen der Zivildiener. Bis Ende Februar war ich im Stiegenhaus oft einem großen, schlaksigen Jungen mit roten Haaren begegnet. Er hatte meistens sehr mürrisch dreingesehen und mich kaum eines Blickes gewürdigt. Caroline hatte ihn mir einmal mit den Worten „das ist mein Zivi Jonas“ vorgestellt. Seit Kurzem kam ein anderer Bursche. Er war kleiner, ein bisschen rundlich und grüßte immer freundlich. Den mürrischen Typ sah ich nach wie vor manchmal im Stiegenhaus. Ich war mir fast sicher, dass er meine Nachbarin mit Marihuana versorgte.
An den Wochenenden lud ich Caroline öfters zum Essen ein. Ich kochte gerne, wenn ich Zeit hatte.
Obwohl ich einen Schlüssel für ihre Wohnung besaß, läutete ich bei ihr an.
Im nächsten Augenblick vernahm ich leises Scharren. Romeo, Carolines verwöhnter Kater, kündigte mich an.
Ich mochte keine Katzen, musste aber zugeben, dass Romeo gut auf sie aufpasste. Der kleine Zerberus miaute laut oder machte sich durch Kratzen bemerkbar, wenn sich jemand vor ihrer Tür befand. Die Klingel überhörte sie meistens, weil sie ständig Kopfhörer aufhatte. Sie war nicht schwerhörig, obwohl sie behauptete, mit Kopfhörern Musik hören zu müssen, um mich nicht zu stören.
Ihre Wohnung bestand aus zwei großen Zimmern, Bad, Küche und einem Klopfbalkon. Die Einrichtung war gewöhnungsbedürftig, ein seltsames Gemisch eines langen Lebens. Auffällig war, dass keine Erinnerungsstücke an ihre Zeit als Schauspielerin herumlagen. Nicht einmal Fotos, Kritiken oder Theaterplakate. Als ich sie eines Abends fragte, warum sie diese wichtige Zeit in ihrem Leben so negiere, tippte sie sich an die Stirn und meinte: „Das ist alles hier drin. Woran ich mich nicht mehr erinnere, war eben nicht so wichtig für mich, selbst wenn es mir einst wichtig erschienen ist. In meinem Alter muss man sich von Ballast befreien. Die Vergangenheit ist Ballast. Und an die Zukunft will man nicht denken. Ich lebe im Jetzt.“
3.
Als mir die zierliche alte Frau öffnete, stellte ich bestürzt fest, dass sie krank aussah. Ihr Gesicht war kreidebleich. Um die Augen hatte sie dunkle Ringe.
„Geht’s dir nicht gut?“