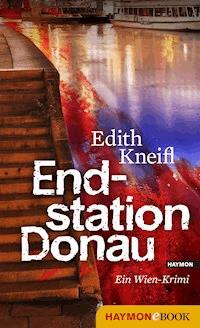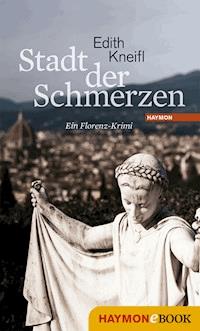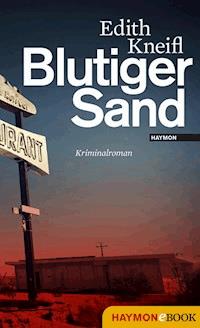Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
MORD IM VORSTADTKINO - KRIMISPANNUNG MIT ORIGINAL WIENER SCHMÄH! KINOBESITZERIN AUF MÖRDERJAGD In einem schäbigen Wiener Vorstadtkino wird die Leiche eines alten Mannes gefunden. Schon der dritte Tote in einem Monat - wieder ein älterer Mann und wieder mit durchgeschnittener Kehle. Weil die Polizei nicht weiterkommt, geht die Kinobesitzerin Hermine selbst auf Mörderjagd. Sie trifft einige Besucher der Spätvorstellung im Café und stellt einen Kreis der Verdächtigen auf, vom Taxifahrer Schurli bis zu den betagten Kinogeherinnen Ella und Klara. Immer tiefer wird Hermine in Intrigen verwickelt, die mindestens so düster, grotesk und bedrohlich sind wie die Filme, die sie in ihrem Kino zeigt. EIN RAFFINIERTER PSYCHO-KRIMI MIT ABGRÜNDIGEM WIENER HUMOR Edith Kneifl spielt in ihrem Roman vergnügt mit Bezügen zu bekannten Kriminalfilmen. So schafft es die "Grande Dame des österreichischen Kriminalromans" (Die Presse), eine psychologisch raffinierte Story mit abgründigem Wiener Humor zu verbinden. DAS BUCH ZUM KULTFILM VON WOLFGANG MURNBERGER Die Verfilmung des Romans von Wolfgang Murnberger, dem Regisseur der beliebten Brenner-Filme mit Josef Hader, wurde prompt mit einer Romy ausgezeichnet. "Abgründig und eigentümlich wie die Wiener Seele selbst - hier liegen Komik und Grauen nah beieinander!" "Hier kriegt man das urtypische Wiener-Vorstadt-Flair, präsentiert in einer spannenden Krimihandlung. Das ist besser als jeder TV-Film am Abend!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edith Kneifl
Taxi für eine Leiche
Ein Wien-Krimi
Edith Kneifl
Taxi für eine Leiche
Es ist besser, etwas Böses zu tun, als gar nichts zu tun, denn das Böse impliziert immerhin zwischenmenschliche Kommunikation.
John Cale
Der Mörder hielt den aufgeklappten Taschenfeitl wie einen Dolch in der erhobenen Hand. Er stieß seinem Opfer die kleine scharfe Klinge in die rechte Seite des Halses. Ein schneller sauberer Schnitt. Das Blut schoss mit solcher Macht heraus, dass kleine Fleischfetzen bis an die Wand spritzten …
1
Schritte. Schwere Schritte. Ein kühler Luftzug. Ein dumpfer Knall. Ein schwacher Lichtschein. Eine zerbeulte Cola-Dose.
Sie steckte die Dose in den Mistsack, bückte sich, hob Kaugummipapier und Popcornbecher auf.
Zwei Beine, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe. Ihre Finger berührten weiches warmes Fleisch. Sie roch an ihren Fingern. Frisches Blut.
Sie schrie.
Das grelle Licht ihrer Taschenlampe tastete schonungslos über die fahlen eingefallenen Züge eines Mannes. Sein Mund stand offen. Seine Augen waren weit aufgerissen.
»Scheiße«, schimpfte sie leise, als fürchtete sie, der Tote könnte sie hören.
Zum Glück hatte es wieder einen alten Mann erwischt. Nach jeder Vorstellung hatte sie Angst, ein junges Gesicht unter den Sitzen zu entdecken.
Sie wusste, dass sie nichts anrühren sollte. Es war schon ein Fehler gewesen, die Finger auf die offene Wunde in seinem Hals zu legen. Der Strahl ihrer Lampe richtete sich auf den zusammengekrümmten Körper unter den hochgeklappten Sitzen.
Erst jetzt bemerkte sie, dass dem Alten nicht nur die Kehle durchgeschnitten, sondern auch Brust und Bauch aufgeschlitzt worden waren. Blut, nichts als Blut. Auch rund um sein Hosentürl breitete sich ein großer dunkler Fleck aus.
Erschüttert wandte sie sich ab und wankte leicht benommen zurück ins Foyer.
Im Spiegel gegenüber der Kasse erblickte sie das Gesicht einer alten Frau. Die Wangen grau wie ihr zerrauftes Haar, die Lippen farblos, Angst und Entsetzen in ihren Augen.
Sie strich sich das Haar aus der Stirn. Ihre Finger waren blutbeschmiert.
Angeekelt stürzte sie aufs Klo, drehte den Wasserhahn auf und hielt die Hände unter den eiskalten Strahl.
Neben dem Waschbecken lag ein Stück Kernseife am Boden. Sie hob die Seife auf, schrubbte ihre Hände, bis sie sich röteten, wusch sich auch das Gesicht und kontrollierte ihre Kleidung. Keine Blutflecken.
Vielleicht ist die Glühbirne im Klo zu schwach? Im Foyer musterte sie sich noch einmal gründlich im großen Spiegel.
Ihr graute vor morgen früh. Milena war auf Besuch bei Verwandten in Kroatien. Der Kinobesitzerin würde also nichts anderes übrig bleiben, als in ihrem Kino selbst Putzfrau zu spielen.
Das Haus hatte ihrer Mutter gehört. Um die notwendigsten Renovierungsarbeiten bezahlen zu können, hatte sie ihre letzte, eiserne Reserve geplündert. »Das Kapitalsparbuch darfst du nicht anrühren, das ist deine Altersversorgung«, klangen ihr die letzten Worte ihrer Frau Mama noch in den Ohren.
Ihre Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung lag im ersten Stock. Bad und Küche waren durch einen geblümten Plastikvorhang voneinander getrennt. Die Toilette hatte sie bis vor kurzem mit einer Studentin geteilt, die in der Zimmer-Küche-Wohnung nebenan hauste. Nachdem die junge Frau ihr Studium beendet hatte, schaute sie sich nach einer besseren Bleibe um. Hermine K. hatte erst gar nicht versucht, neue Mieter für die desolaten Räume zu finden, sondern benützte sie als Lager für ihre Filmutensilien und für das Gerümpel ihrer Mutter. Der zweite Stock des Hauses war unbewohnbar, diente ihr schon länger als Rumpelkammer.
Obwohl die alte Frau Karpfinger vor zwanzig Jahren sanft entschlummert war, bewahrte die Kinobesitzerin bis heute alle ihre Sachen auf. Sie brachte es einfach nicht übers Herz, sich von den wurmstichigen Möbeln und der mottenzerfressenen Garderobe ihrer Frau Mama zu trennen.
In der unbewohnten Ein-Zimmer-Wohnung sah es aus wie in einem Gruselkabinett. Zwischen einem lebensgroßen Humphrey Bogart aus Pappmaché und einer ramponierten Marilyn Monroe – eine Schaufensterpuppe bekleidet mit einem weißen Fetzen –, stapelten sich Kartons voller Zeitungsausschnitte, Autogrammfotos und vergilbter Ansichtskarten, Hüte in allen Farben und Größen, verstaubte Filmrollen und kaputte Beleuchtungslampen. Bei jedem Schritt stolperte man über ein Sammelsurium von leeren Zigarrendosen, Bonbonschachteln, Bierdeckeln und Schwedenbombenkartons. Jedes Mal, wenn Hermine K. nicht wusste, womit sie die nächste Gasrechnung bezahlen sollte, nahm sie sich vor, die Wohnung zu entrümpeln und erneut zu vermieten.
Die karpfinger-lichtspiele nahmen das ganze Parterre eines alten zweistöckigen Hauses ein. In der Linzer Straße gab es noch eine ganze Reihe dieser typischen Wiener Vorstadthäuser. In den letzten Jahren hatte allerdings so manch schmuckes kleines Häuschen einem mehrstöckigen Neubau weichen müssen.
Hermine K. hatte sich bisher erfolgreich gegen den Abbruch ihres Hauses gewehrt. Obwohl ihre finanzielle Situation von Jahr zu Jahr trister wurde, hatte sie durchaus lukrative Angebote ausgeschlagen.
Der Kinosaal fasste hundert Leute. Hermine K. war überglücklich, wenn sie in einer Vorstellung fünfzig zahlende Besucher hatte. Das kam jedoch nur alle heiligen Zeiten einmal vor. Von Jahr zu Jahr ging es finanziell bergab. Die Einnahmen deckten oft nicht einmal die laufenden Betriebskosten.
Mord hin, Mord her, ich muss mich jetzt um die Abrechnung kümmern, sagte sich die Kinobesitzerin. Die Steuerfahnder jagten ihr mehr Angst ein als die Kriminalpolizei.
Sie setzte sich hinter die Kasse und trug die dürftigen Einnahmen ordentlich in ein großes schwarzes Buch ein. Akuter Besucherschwund. Fünfzehn zahlende Besucher in der Samstagabendvorstellung. Wenn das so weitergeht, kann ich nicht einmal die nächste Stromrechnung bezahlen.
Auch ihren Freunden schien die triste Lage bewusst zu sein. Jean Gabin blickte ernst und traurig auf sie herab. Robert Mitchum runzelte leicht verärgert die schöne Stirn. Edward G. Robinson und James Cagney dagegen hatten nur ein hintergründiges Grinsen für sie übrig.
Die alten Filmplakate, mit denen sie den kleinen Kassenraum austapeziert hatte, waren vergilbt und völlig zerschlissen. Hermine K. konnte sich jedoch nicht dazu entschließen, ihre Lieblinge gegen Robert de Niro, Al Pacino oder gar gegen Schimanski auszutauschen.
Nach einem letzten verzweifelten Blick auf ihr Kassabuch beschloss sie, dem »Café Nachtlberger« noch einen kurzen Besuch abzustatten. Trotz der winterlichen Temperaturen sehnte sie sich nach einem kühlen Blonden. Im karpfinger-kino herrschte striktes Alkoholverbot. Sie hielt sich auch selbst daran. Im Eiskasten hinter der Kasse kugelten nur Coca-Cola-Dosen und Limonadeflaschen herum. Sogar Almdudler und Frucade führte sie seit einiger Zeit.
Für den Toten konnte sie sowieso nichts mehr tun. Sie wollte sich bis morgen überlegen, ob sie die Polizei verständigen oder ihn einfach verschwinden lassen sollte. Die Kriminalpolizei hatte nach den letzten beiden Morden die Presse angelockt. Und die Zeitungsleute hatten eine Menge ungustiöser Artikel über ihr Kino verbrochen. Sie war stinksauer auf diese »Schmierfinke«.
Sorgfältig sperrte sie die kleine Handkasse ab, steckte den Schlüssel in ihre Rocktasche und schob die Stahlkassette in die oberste Schublade ihres Schreibtisches. Dann kletterte sie die Wendeltreppe hinauf in den Vorführraum und vergewisserte sich, dass Karl alle Lampen ausgeschaltet hatte. Der alte Operateur war ziemlich vergesslich geworden. Sie befürchtete, eines Tages abzubrennen. Vielleicht wäre das gar nicht die schlechteste Lösung? Gegen Brand bin ich wenigstens versichert, dachte sie.
Der Schalter für das Notlicht befand sich gleich neben der Saaltür. Froh, den Kinosaal nicht noch einmal betreten zu müssen, drehte sie auch das Licht im Foyer ab. Tote fürchten sich nicht in der Dunkelheit. Sie schlüpfte in ihren schäbigen Pelzmantel, setzte den neuen Hut auf und verließ das Kino.
Als sie die Glastür zusperrte, fiel ihr ein, dass sie auch die Seitenausgänge kontrollieren sollte.
2
Der Himmel über Wien war schwarz. Der Mond versteckte sich hinter den Wolken. Es hatte zu nieseln begonnen.
Feuchtkalter Novembernebel umhüllte die baufälligen Häuser in der Nachbarschaft.
Hermine K. zog ihren Hut tiefer ins Gesicht, stellte den Kragen ihres Mantels hoch und vergrub die Hände in den Taschen. »So ein Sauwetter«, schimpfte sie leise und rempelte unabsichtlich einen Mann an, der die Plakate und Fotos in den Schaukästen ihres Lichtspieltheaters studierte.
»Entschuldigung.«
Er rührte sich nicht.
Sie schenkte ihm einen zweiten Blick und erkannte ihn. Ein Besucher der Spätvorstellung. Der junge Mann war ihr nicht nur wegen seiner exorbitanten Größe aufgefallen, sondern auch, weil er fast den gleichen Hut trug wie sie. Hermine K. lächelte ihn freundlich an.
Versunken in den Anblick von Jack Nicholson, der gerade Jessica Lange über den Küchentisch legte, reagierte er nicht auf ihr Lächeln.
Die Schaukästen befanden sich neben dem vorderen Seitenausgang. Sie zögerte einen Moment, rüttelte dann doch an der Tür, hinter der, keine paar Meter entfernt, der Tote lag. Erleichtert, weil die morsche Holztür nicht nachgab, überquerte sie die Straße.
Schritte folgten ihr. Laut und selbstsicher hallten sie auf dem Kopfsteinpflaster wider. Ihre Finger in der rechten Manteltasche umklammerten den schweren Schlüsselbund. Ängstlich drehte sie sich um. Der Fremde ging knapp hinter ihr.
Die Straßenbeleuchtung war ausgefallen. Seit gestern Abend lag dieser Teil der Linzer Straße völlig im Dunkeln. Die Koloniamänner hatten sich auch schon eine Woche lang nicht blicken lassen. Vor der »Pizzeria Rudolfo«, schräg gegenüber dem Kino, türmten sich die Mistsäcke. Im Rinnstein schwamm, was in den Plastiksäcken keinen Platz mehr fand. Bald würden sich die Ratten darüber hermachen. Ihr ekelte vor Ratten.
Plötzlich hörte sie keine Schritte mehr. Trotzdem war sie froh, als sie die vermummte Gestalt vor dem Maronistand erblickte.
Herr Bronislav schaufelte gerade glosende Holzkohlenstücke in einen schwarzen Kübel und bedeckte den Kohleofen mit einem Blechdeckel. Seine schwieligen Hände waren blaugefroren, und seine große Nase leuchtete wie ein Stopplicht über dem karierten Wollschal.
»Schluss für heute?«, fragte Hermine K.
Der serbische Maronibrater blickte auf, zog den Schal ein Stück herunter. Ein Lächeln verschönerte seine von unzähligen Narben entstellten Züge. »Guten Abend, Frau Karpfinger«, begrüßte er sie freundlich. »Möchten Sie ein paar Maroni? Ich schenke sie Ihnen, leider sind sie nicht mehr sehr warm.«
Er griff nach einem braunen Papiersack.
»Ich brauchen kein Sackerl. Sie mir geben nur zwei, drei Stück.«
Sie befreite eine lauwarme Maroni von ihrer Schale, stopfte sie in den Mund und murmelte: »Beruhigt die Leber.«
Während Herr Bronislav Klauscek, den alle der Einfachheit halber Branko nannten, den Rollladen an seinem Stand herunterließ, fragte sie ihn mit vollem Mund, ob er jemanden um ihr Kino schleichen gesehen hätte.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe niemanden gesehen. Aber ich habe, ehrlich gesagt, nicht geschaut.«
»Geschäft gehen gut heute?«
»Leider nicht. Es ist zu kalt. Kein Mensch traut sich bei dieser Glätte auf die Straße.«
»Du sehen Kino von hier?«
Herr Bronislav nickte. »Ich habe wirklich nichts gesehen. – Ist wieder etwas passiert?«, fragte er besorgt.
Anstatt ihm zu antworten, stopfte sie die letzte Maroni in den Mund und verabschiedete sich: »Bis morgen, Branko, und danke für die Vorspeis.«
Keine zwei Leute kamen auf diesem schmalen Streifen, der sich Gehsteig nannte, aneinander vorbei. Sie schlängelte sich zwischen parkenden Fahrzeugen durch, drückte sich an den Hausmauern entlang und ging eine enge Gasse hinauf zur Hütteldorfer Straße.
Trostlos sah es aus in den Seitengassen des vierzehnten Wiener Gemeindebezirks: Tiefe Schlaglöcher, große Pfützen, leere Gassenlokale, eingeschlagene Fensterscheiben, dunkle Hauseingänge, stockfinstere Hinterhöfe, leerstehende Fabrikgebäude, eine ehemalige Brauerei, ein aufgelassenes Stripteaselokal – die Fotos von nackten, nicht mehr ganz taufrischen Mädchen hingen noch immer in den Auslagen. In der Ferne die Lichter des neuen Gemeindebaus. Die Wohnungen waren erst vor drei Jahren, vom Herrn Bürgermeister höchstpersönlich, an die Mieter übergeben worden, die großteils fünf, sechs Jahre oder sogar länger darauf gewartet hatten. In den Dachgeschosswohnungen machte sich angeblich bereits Schimmel breit. Wie in meinem Kino, dachte Hermine K. und konnte sich eine gewisse Schadenfreude nicht verkneifen. Jung verheiratet, hatten sie und ihr Mann sich jahrelang vergeblich um eine Gemeindewohnung bemüht.
Um die Vorstadt kümmerten sich die Politiker nur vor den Wahlen. Die restliche Zeit mussten die Leute hier selbst schauen, wie sie zurechtkamen. Nicht einmal die U-Bahn fuhr bis hierher. Ab dem Gürtel musste man mit dem langsamen 52er oder mit dem nicht viel schnelleren 49er vorliebnehmen. Selbst die Konsumfiliale war vor einigen Jahren zugesperrt worden. Nur ein Greißler hatte überlebt. Die alte Frau Hinterberger machte ihren Laden jedoch nur mehr auf, wenn sie wollte, oder besser gesagt, wenn ihr krankes Herz und ihre müden Beine es erlaubten. Ihre Extrawurst war meistens graugrün, die Äpfel waren verschrumpelt, und in ihrem Mehl tummelten sich die Motten.
Hermine K. erledigte ihre Einkäufe immer Samstag vormittags in einem Supermarkt, drei Straßenbahnstationen stadteinwärts. Bei der Greißlerin kaufte sie seit Jahren nur mehr Bier und die Milch für ihren Frühstückskaffee.
Ein Wagen näherte sich mit achtzig Sachen. Ihre schwarze Schnürlsamthose und ihr Pelzmantel bekamen ein paar Spritzer ab. Sie hatte den Nerz, ein Erbstück ihrer Mutter, vor Jahren, als Mini modern war, kürzen lassen. Seit die Rocklänge wieder unters Knie gerutscht war, vor allem für Damen ihres Alters, kam sie sich richtig armselig damit vor, so als hätte das Geld nicht gereicht.
Verärgert versuchte sie mit einem Papiertaschentuch den Dreck von Hose und Mantel zu entfernen.
»Um diese Zeit sind nur mehr lauter Arschlöcher unterwegs«, sagte eine junge Stricherin, die unter dem Vordach eines Wäschemodengeschäftes auf und ab stiefelte. Hermine K. gab ihr Recht.
»Tun S’ nicht lang herumreiben, das macht alles nur schlimmer. Geben S’ die Sachen lieber in die Putzerei.« Die Schöne der Nacht schien, trotz ihres jugendlichen Alters, bereits gewisse Erfahrungen mit rücksichtslosen Autofahrern gemacht zu haben.
3
Sissis Würstelstand war noch geöffnet. An dieser Stelle hatte früher einmal ein hübsches kleines Barockhaus gestanden. Hermine K. hatte damals, als der Abbruch bereits eine beschlossene Sache war, gegen diesen barbarischen Akt protestiert. Sie war sogar einer Bürgerinitiative beigetreten und hatte in ihrem Kino jede Menge Unterschriften gesammelt. Trotz Unterstützung der »Grünen« hatten sie keine Chance gehabt. Der Besitzer, wohnhaft in der schönen Schweiz, war froh gewesen, dieses Sandlerparadies endlich loszuwerden.
Seit zwei Jahren gähnte hier nun eine Baugrube. Die Gerüchteküche prophezeite einen Supermarkt oder ein Bürogebäude – ein Parkhaus würde es wohl werden. Inzwischen entwickelte sich Sissis »Würstelhex« zu einer wahren Goldgrube. Ihr Würstelstand war der einzige im Umkreis von einem Kilometer.
Die Kinobesitzerin konnte die fesche Sissi nicht ausstehen. Sie mochte keine schlanken dunkelhaarigen Frauen, vermisste an ihnen die Gutmütigkeit und Großzügigkeit, die Frauen ihres eigenen Kalibers auszeichneten. Für ordinäre Frankfurter verlangte »dieses geldgierige Luder« einen Dreißiger und für eine Extraportion Senf noch einmal fünf Schilling. Das Brot brachte man sich am besten selbst mit. Sissis Scheiben waren meist einige Tage alt und dünn wie Löschpapier. »Guten Abend, Frau Karpfinger.« Ein süßes falsches Lächeln, ein böser Blick. Die Antipathie war gegenseitig, auch Sissi konnte »diese präpotente Kinobesitzerin«, wie sie Hermine K. anderen Stammgästen gegenüber zu nennen pflegte, nicht ausstehen. »Was darf’s denn sein?«
»Eine Heiße, und tun Sie mir dieses Mal ein bisschen mehr Senf drauf.« Hermine K. war nicht gewillt, fünf Schilling extra hinzulegen.
»Aber freilich, Frau Nachbarin. Süß oder scharf?«
»Einen Süßen, wie immer.«
»Darf’s vielleicht auch ein Pfefferoni sein?«
»Ja, von mir aus, geben Sie mir auch noch einen Rachenputzer.«
»Ist wieder spät geworden heute Abend?«
»Auch nicht später als sonst.«
»Es ist schon gleich halb!«
»Ja und?«
»Normalerweise machen Sie doch um zehn Schluss …«
»Allzu viel dürfte bei Ihnen nicht gerade los sein, sonst bliebe Ihnen wohl kaum Zeit, mich zu bespitzeln.«
»Seien Sie nicht gleich so angerührt, Frau Karpfinger, ich hab’s ja nicht bös gemeint. Aber Sie haben schon Recht, das Geschäft geht schlecht. Unsere Leute hocken abends alle vorm Fernseher. Außer den Nutten und den Tschuschen kommt keiner mehr nach acht. Auf die Jugos könnt ich gern verzichten. Warum müssen die gleich immer zu viert oder zu fünft anrücken? Jedes Mal denke ich, meine letzte Stunde hat geschlagen. Die gehen mir bestimmt eines Tages an die Kassa.«
»Passiert ist Ihnen, bisher jedenfalls, nichts.«
»Nein, aber sie sind wirklich zum Fürchten. Allein wie die schon ausschauen …
»Wie Verbrecher, ich weiß«, unterbrach sie Hermine K. »Jung sind sie halt und ein bisserl ausgeflippt. – Mein Gott, wir waren doch auch einmal jung.«
»Ihr Wort in Gottes Ohr!«
In den abbruchreifen Häusern wohnten fast nur mehr kroatische, serbische oder türkische Gastarbeiter. Manche Familien lebten schon seit Jahren hier und hatten hinter den Häusern kleine Gärten angelegt. In den Sommermonaten kauften die Österreicherinnen bei ihnen Erdbeeren und frischen Salat zu Spottpreisen. Den Rest des Jahres schimpften sie über »dieses Zigeunerpack«.
Ein Betrunkener wankte auf den Würstelstand zu und bestellte stammelnd: »Eine Eitrige mit Buck…ckel und zwei Hül…Hülsen.«
»Ein kleines Momenterl. – Hier, bitte schön, Ihr Burenhäutel mit extra viel Süßem.«
Die Kinobesitzerin aß schnell und gierig. Sie hatte seit der Früh keinen Bissen zu sich genommen.
Sissi reichte dem Betrunkenen eine fette Käsekrainer mit einem Scherzel und zwei Dosen Bier und bestand darauf, dass er sofort bezahlte.
Er zog einen zerknitterten Hunderter aus seiner Hosentasche und murmelte: »Stimmt so.«
Sogleich wurde Sissi eine Spur freundlicher und fragte ihn, ob sie ihm die Dosen aufmachen solle.
»Nein danke, Madame, das schaff ich schon alleine.«
Sie wandte sich wieder dem Bildschirm ihres kleinen Fernsehapparats zu. »An sich mag ich den Fendrich, ein fescher Bursch, aber mit der Zeit werden seine Schmäh auch immer schwächer.«
»Reinhard Fendrich, jetzt um halb elf?«, fragte Hermine K. verwundert.
»Video!«
»Ach so.«
»Hab um viertel acht keine Zeit gehabt, mir die Show anzuschauen.«
»Herzbla…blatt«, lallte der Betrunkene.
»Ja genau. Ist meine Lieblingssendung, obwohl er immer nur junge hübsche Pupperl bringt. Dabei gibt es gerade unter unsereins jede Menge einsame Herzen, nicht wahr, Frau Karpfinger?«
Angewidert zog Hermine K. die Augenbrauen hoch, schluckte den letzten Bissen Burenwurst hinunter, wischte sich mit der rauen Papierserviette den Mund ab und sagte: »Wenn einer in unserem Alter einsam ist, dann ist er selber schuld.«
Die junge Prostituierte verließ ihren Platz unter dem Vordach des Wäschemodengeschäftes und näherte sich der hellbeleuchteten »Würstelhex«.
Bei Licht sieht sie wesentlich älter aus, dachte die Kinobesitzerin. Außerdem hat sie den schweren schleppenden Gang einer alten Frau.
»Soll ich dir für einen Fünfziger einen blasen?«, fragte die Kleine den Betrunkenen.
Er grinste sie nur blöde an.
Sissi und Hermine K. schenkten einander einen pikierten Blick.
»Möchten Sie einen Schluck Bier? Die Wurst so trocken runterwürgen, das könnt ich nicht«, wechselte Sissi das Thema.
»Mein Bier trinke ich im ‚Nachtlberger‘.«
»Beim Schorschi, gell?«
Hermine K. hätte ihr am liebsten eine runtergehauen, zückte aber statt dessen ihr Portemonnaie und legte genau vierunddreißigfünfzig neben ihren mit Senf beschmierten Pappendeckelteller. »Auf Wiederschaun.«
»Auf Wiedersehen, Frau Karpfinger, und lassen Sie sich das Bierchen beim Schorschi gut schmecken.«
»Danke, das werde ich«, konterte die Kinobesitzerin. Diese alte Schlampe hat es auf meinen Schorschi abgesehen. Aber mit solchen Bohnenstangen hat er nicht viel am Hut. Er hat es gern etwas fester, hat gern was in der Hand, der gute alte Schorsch, dachte sie beruhigt.
4
Bierdunst strömte Hermine K. entgegen. Gelächter und lautes Stimmengewirr dröhnten bis hinaus auf die Straße.
Das »Nachtlberger« war das einzige Lokal weit und breit, das nach Mitternacht geöffnet hatte. Offizielle Sperrstunde war um zwei. Allzu oft wurde es aber drei oder gar vier, bis der Oberkellner Schorsch, gemeinsam mit seinen letzten Gästen, das Café verließ.
Die Kinobesitzerin schob den schweren dunkelgrünen Vorhang hinter der Eingangstür beiseite und betrat das Lokal mit einem freundlichen »Guten Abend allerseits«.
»Hallo, Mimi«, grölte ein betrunkener Stammgast, mit dem sie nicht einmal per Du war.
»Servus, Mimi-Maus«, begrüßte Schorschi sie. Sein drittes Gebiss leuchtete wie eine Zahnpastareklame. »Ein Bierchen?«
»Ja, ein Seidel.«
»Warum bestellst nicht gleich ein Krügerl? Auf die Dauer kommen dich die ewigen Seidel ganz schön teuer.«
»Möcht wissen, was dich das angeht. – Mir schmeckt’s eben im Seidel besser.«
»Tschuldigen Sie schon, Frau Karpfinger, ich hab’s ja nur gut gemeint.«
»Ja, ja, ich weiß, du meinst es immer nur gut mit mir. Aber sag, was ist denn mit deinen Stimmbandeln passiert? Du hörst dich an, als hättest ein Reibeisen verschluckt.«
Er räusperte sich lautstark und krächzte: »Halsweh hab ich.«
»Hast wieder geraucht wie ein Schlot, gib es wenigstens zu.«
»Nein, ehrlich nicht. Ich hab eine Angina pectoris.«
»Du weißt ja nicht einmal, was das ist«, sagte Hermine K. lachend und zog ihren Pelzmantel aus.
Das »Nachtlberger« war im Winter immer überheizt. Die kleinen Kohleöfen spuckten die Wärme aus wie kalorische Kraftwerke.
»Du kannst mir den Buckel runterrutschen!« Schorschi drehte sich um und zapfte für seine Freundin besonders langsam ein kleines Bier. Zärtlich strich er mit einer Holzspachtel den Schaum weg und füllte das Glas bis zum obersten Rand. »Bitte sehr, Ihr Seidel, Madame.«
»Bist heute auch nicht gerade der Schnellste.«
Er hustete demonstrativ. »Ich möcht dich einmal hinter der Theke erleben, wenn alle auf einmal einen Durst kriegen. Man könnt fast glauben, je mehr sie saufen, desto durstiger werden s’.«
Sie stürzte ihr Bier in zwei Zügen hinunter. »Noch eins, Schorschi.«
»Du bist eine Alkoholikerin, du willst es nur nicht wahrhaben.«
»Verschon mich mit deiner Moralpredigt. Gib mir lieber was zu trinken. Ich hab einen Durst.«
Er schüttelte den Kopf, beeilte sich aber, ihr ein zweites Bier hinzustellen. »Warum musst du immer so viel saufen, Mimi? Ich kapier das nicht. Du bist doch eine attraktive Frau, eine Frau in den besten Jahren …«
Hermine K. hatte sich tatsächlich gut gehalten. Zwar wirkte sie auf den ersten Blick wie eine etwas füllig gewordene Hausfrau, aber ihre dreiundfünfzig Jahre sah man ihr trotzdem nicht an. Nur ihre Beine waren etwas aus der Fasson geraten, deshalb trug sie auch jahrein, jahraus lange Hosen und bequemes Schuhzeug – flache dunkle Halbschuhe mit Einlagen. Ihre zarte, fast faltenlose Haut mit den vielen Sommersprossen und ihre kleine lustige Stupsnase ließen sie jedoch um mindestens zehn Jahre jünger aussehen. Ihr dichtes graues Haar war kinnlang. Stirnfransen verdeckten ihre spärlichen hellblonden Brauen. Sie dachte nicht im Traum daran, ihre ursprünglich rotblonde Haarfarbe wieder aufzufrischen, war heilfroh, den lästigen Spitznamen »Karotte« endlich los zu sein.
Obwohl sie sich über das Kompliment ihres alten Freundes insgeheim freute, sagte sie: »Hör mit dem Gesäusel auf, Schorschiboy. Geh doch rüber zu deiner Sissi, die hört sich dein Süßholzgeraspel bestimmt liebend gerne an. Ich hab gerade ein Würstel bei ihr verdrückt, und sie hat mir die ganze Zeit wieder nur von dir vorgeschwärmt.«
»Lass mich mit dieser alten Pritschen in Frieden. Du weißt, dass ich sie nicht ausstehen kann. Wenn ich ihr auf der Straße begegne, wechsle ich die Seite.« Etwas leiser fuhr er fort: »Aber ich mach mir wirklich ernsthaft Sorgen um dich, Mimi. Kein Tag ohne Alkohol, du bist eine Spiegeltrinkerin. Du hast jeden Abend deine sechs, sieben Bierchen, das ist einfach zu viel für eine Frau.«
»Die ‚Frau‘ habe ich überhört, du Chauvi! Aber vielleicht kannst du Supergscheiterl mir verraten, womit ich meinen Ärger sonst hinunterspülen soll? Von eurem gepantschten Wein krieg ich Kopfweh und vom Mineral Läuse im Bauch.«
»Was hast denn für einen Ärger? Schon wieder eine Leich?«
»Sehr witzig!« Sie beugte sich über die Theke und flüsterte: »Ich hab wirklich wieder eine …«
»Jessasmarandjosef! Schmäh ohne?«
»Um Himmels willen schrei nicht so! Willst, dass gleich das ganze Lokal auf Mörderjagd geht, so unter dem Motto: Eine Stadt sucht einen Mörder? Eine Leiche pro Woche, wenn das so weitergeht, werde ich mein Kino bald zusperren müssen. Schon nach dem ersten Mord sind die Hälfte der Leute ausgeblieben.«
»Ach deswegen bist so grantig. – Du kannst ihnen nicht verübeln, dass sie wegbleiben. Wer setzt sich schon freiwillig in ein hiniges Vorstadtkino, wo ein Wahnsinniger einen nach dem anderen abkragelt?«
Ihr war bewusst, dass er Recht hatte. Die karpfinger-lichtspiele befanden sich in einem katastrophalen Zustand, sie schrien geradezu nach Generalsanierung. Hermine K. hatte nicht nur berechtigte Angst vor der Baupolizei, sondern befürchtete auch, dass die alte Bude eines schönen Tages einfach über ihr zusammenkrachen würde.
Das Dach war undicht. Nächsten Sommer würde sie den Freiluftlichtspielen im Augarten ernsthafte Konkurrenz machen und ebenfalls Open-Air-Vorstellungen unter dem Motto »Kino unter den Sternen« anbieten. Im Winter konnte man auf dem Dachboden Schlittschuh laufen. Und hübscher schwarzer Schimmel zierte nicht nur die Wände in ihrem Bad, sondern machte sich auch im Kinosaal breit.
Die Eingangstür war mit ordinären Graffiti geschmückt und aus karpfinger-lichtspiele waren karpf’n’’’-lichtspiele geworden. »I« und »GER« hatten sich längst verabschiedet, leuchteten einfach nicht mehr. Die vergilbten Plakate und die uralten Fotografien in den Schaukästen besaßen zwar einen gewissen nostalgischen Charme, lockten aber gewiss keine neuen Besucher an. Doch Hermine K. hatte keine Zeit, sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern.
5
Aus den Boxen über der Theke dröhnte in unerträglicher Lautstärke »Junge, komm bald wieder«.
»Würdest du bitte dieses Gejeier ausmachen«, sagte Hermine K. gereizt. »Ich kann den Freddy nicht mehr hören, auch wenn er ein echter Wiener ist.«
»Nur seine Mutter war Wienerin«, korrigierte Schorschi sie.
»Ja, ja, ich weiß, ich kenne seine Biografie auswendig. Früher bin ich auf ihn gestanden. Aber stell ihn jetzt bitte ab, ich ertrag solchen Schmus nicht mehr. Von mir aus soll der Junge endlich untergehen …«
»Dem Wurli den Saft abdrehen? Nein, das kann ich nicht machen. Da würden sich die anderen Gäste sauber beschweren.«
»Geht’s nicht wenigstens ein bisschen leiser? Meine armen Nerven …«
»Kein Wunder, wenn in deinem Kino schon wieder einer abgekratzt ist. Ich hab gar kein Blaulicht gesehen und keine Sirenen gehört.«
»Da hat es auch weder was zu sehen noch zu hören gegeben. Mein Bedarf an Polizei ist gedeckt. Hast du gewusst, dass sie mir seit neustens in jede Vorstellung einen Wappler in Zivil reinsetzen? Der von heut Abend hat nicht einmal zahlt, und seine Begleiterin wollt er auch umsonst reinschmuggeln …«
»Über den hast du dich schon letzte Woche beschwert, gell?«
»Dieser Schauer hat den Mord natürlich auch nicht verhindert, scheint nichts mitgekriegt zu haben, obwohl sich das Drama direkt vor seinen Augen abgespielt haben muss. Wahrscheinlich liegt er längst zu Hause in seinem Bett und sieht sich den Kojak an.«
»Ist das der mit dem Schlecker?«
»Bravo, Schorschi! Du schaust dir also doch hin und wieder Kultursendungen an.«
»Und was ist mit deiner Leich passiert?«
»Nichts. Was soll ihr schon passiert sein. – Ich hab den Laden einfach dichtgemacht. Morgen früh werde ich dann weitersehen.«
»Bist deppert, Mimi? Du kannst doch den Toten nicht über die Nacht in deinem Kino liegen lassen.«
»Wieso nicht? Tote schlafen fest.«
»Du bist echt leiwand.«
»Dem Alten kann es doch wurscht sein, wann er für tot erklärt wird.«
»Dem Alten schon, aber ob’s den Bullen wurscht sein wird …?«
»Tote haben es nicht eilig, der läuft mir nicht davon.«
»Du rufst jetzt sofort die Kripo an! – Brauchst einen Schilling?«
»Morgen, Schorschi, morgen. Jetzt möchte ich erst einmal in Ruhe mein Bier trinken.«
»Du spinnst wirklich! Wenn sie dir draufkommen, landest selber im Häfen.«
»Ich werde die Kieberer gleich in der Früh verständigen, werd halt sagen, dass ich die Leiche erst beim Putzen entdeckt hab, alles genau so wie beim ersten Mal.«
»Du bist einfach nicht mehr zu retten!« Schorschi tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Stirn.
»Ich darf gar nicht an diese fürchterliche Schweinerei denken …« Angeekelt verzog sie das Gesicht und schüttelte sich. »Im Saal hat’s furchtbar nach Schweiß und Urin gestunken. Wahrscheinlich hat er sich angemacht vor Angst. Und das Blut muss wieder weggespritzt sein …, genau wie bei den anderen beiden. Nicht einmal zugedeckt habe ich den armen Kerl, hab ihn einfach so liegengelassen mit der durchgeschnittenen Kehle und dem aufgeschlitzten Bauch. Ich hab mich nicht getraut, genauer hinzuschauen. Bestimmt hängen ihm die Gedärme raus.«
»Pfui Teufel!«
»Das kannst du laut sagen. Ich schwör dir, der Francis Ford Coppola hätte dieses Blutbad auch nicht besser hingekriegt.«
»Aber dein Palma schon, oder?«
»Meinst du den Brian de Palma oder den Robert Palmer? Ist eh wurscht, keiner von beiden hätte das geschafft. Wenn du willst, kannst du dich selbst davon überzeugen. Wir können ja nach der Sperrstund noch einmal gemeinsam rüberschauen.«
Der Oberkellner schien nicht sehr begeistert von dieser Idee. Er kehrte ihr den Rücken zu und leerte ein paar Aschenbecher aus.
»Dass ein alter Mensch noch so viel Blut in den Adern hat! Wie soll ich den Boden bloß je wieder sauberbekommen? Drei solche Riesenflecken und alle drei in den vorderen Reihen. Kein Mensch wird sich mehr dort vorne hinsetzen wollen. Auch der Sessel ist blutdurchtränkt – echt scheußlich, sag ich dir.«
»Wen hat’s denn dieses Mal erwischt?«, fragte Schorschi neugierig.
»Kenn ihn nicht, hab das Gesicht vorher nie gesehen.«
»Hast ihn also nicht identifizieren können.«
Sie starrte missmutig in ihr Bierglas und fluchte leise: »Verdammter Mist! Ich muss wirklich noch mal rüber. Kommst du mit?«
»Spinnst? Ich kann jetzt unmöglich weg, wir haben Hochbetrieb – das siehst doch.«
»Ich hab nicht einmal geschaut, ob seine Brieftasche noch da ist. Vielleicht hat er irgendeinen Ausweis bei sich …«
»Na, sag einmal, das weiß doch jedes Kind, dass man bei einem Toten zuerst nach der Brieftaschen schaut.«
»Ich hab ein Hirn wie ein Nudelsieb«, übte sie sich in Selbstkritik.
Ausnahmsweise widersprach er ihr nicht.
Am Tisch gegenüber der Theke saßen vier Männer und spielten Karten. Ohne ihr Spiel zu unterbrechen, riefen sie nach dem Kellner: »Schorschi, schläfst du heut?«, schrie der eine.
»Wo bleibt mein Gspritzter?«, rief der andere.
»Ich hab ein Krügerl bestellt, aber bracht hast mir ein pickertes Cola. Sind wir in einem Kasperltheater?«, empörte sich der dritte.
Der vierte schwieg und machte den nächsten Stich.
»Nur nicht hudeln«, rief Schorschi. »Bin schon unterwegs, meine Herren. – Den Wurschtel kann keiner derschlagen«, sagte er lachend zu Hermine K.
»Heut Abend geht’s hier wieder zu wie in einem Irrenhaus«, meckerte sie.