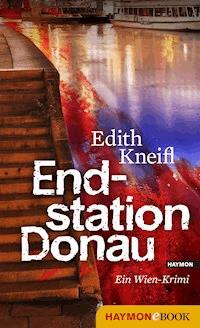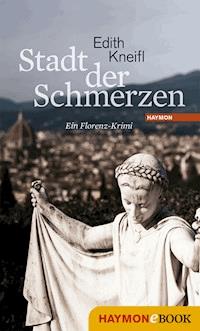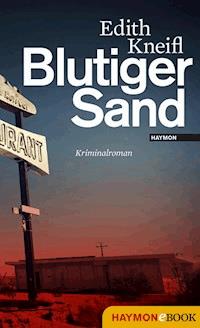Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Wien-Krimis
- Sprache: Deutsch
TOD DES WIENER DOMBAUMEISTERS IN DER SILVESTERNACHT Wien zur Jahrhundertwende: Mitten in der rauschenden Silvesternacht des Jahres 1899 stürzt der Wiener Dombaumeister vom Nordturm des Stephansdoms. Unter den Augenzeugen: Gustav von Karoly. Der fesche Privatdetektiv macht sich sofort auf die Suche nach möglichen Hintergründen. Hatten etwa die Freimaurer ihre Hände mit im Spiel? CHARMANTER PRIVATDETEKTIV TRIFFT AUF RESOLUTE ERZIEHERIN - PRICKELND! Die Ermittlungen führen Gustav schließlich in ein Heim für "gefallene Mädchen". So wurden junge Frauen bezeichnet, die ihre Jungfräulichkeit verloren, ohne verheiratet zu sein. Als eine der schwangeren Heiminsassinnen tot im Donaukanal gefunden wird, verfolgen Gustav und die junge Erzieherin Clara Bernhard gemeinsam eine Spur, die sie in die schaurigen Katakomben unter dem Stephansdoms führt. DAS DEKADENTE WIEN DER JAHRHUNDERTWENDE ALS PERFEKTE KRIMIKULISSE Ausgelassene Ballnächte, amüsante Liebeleien, dekadenter Adel, aber auch Armut und aufkommender Antisemitismus: Edith Kneifl erweckt das Wien des Fin de Siècle zum Leben. Mit Spannung, Gefühl und einer Prise Humor entführt sie die Leser in eine untergehende Welt: Mit offenen Augen tanzt die Kaiserstadt ins Verderben - die perfekte Krimikulisse! LESERSTIMMEN: "Das Flair im Wien der Jahrhundertwende ist bei der Lektüre förmlich zu spüren!" "Zur Abwechslung mal ein richtig sympathischer Frauenheld, dieser Gustav von Karoly. Und der Alltag in der Sisi-Zeit interessiert mich sowieso immer. Dass es auch noch gehörig spannend zugeht in dem Krimi, ist fast schon eine Draufgabe!" ********************************************************* Edith Kneifls WIEN-KRIMIS RUND UM DIE JAHRHUNDERTWENDE: - Der Tod fährt Riesenrad - Die Tote von Schönbrunn - Totentanz im Stephansdom *********************************************************
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Edith Kneifl
Totentanz im Stephansdom
Ein historischer Wien-Krimi
Edith Kneifl
Totentanz im Stephansdom
Für Rosmarie
I
Neunundneunzig Stufen. Er hörte auf zu zählen, schleppte seine hundertzwanzig Kilo weiter die steile Treppe hinauf. Was für eine verrückte Idee, sich in der Silvesternacht auf dem Nordturm des Stephansdoms zu treffen. Es war nicht seine Idee gewesen. Der Mann, mit dem er verabredet war, hatte vorgeschlagen, sich von dort oben aus gemeinsam das Feuerwerk anzusehen. Da es verboten war, den Turm in der Nacht zu besteigen, hatte er ihn gebeten, niemandem von ihrem Vorhaben zu erzählen. Seine Worte hatten versöhnlich geklungen. Erleichtert hatte der Dicke die seltsame Einladung angenommen. Ihr fürchterlicher Streit letztens hatte ihm Alpträume beschert. Es war nicht besonders klug von ihm gewesen, sich diesen Mann zum Feind zu machen. Schließlich war er auf ihn angewiesen.
Auf der Aussichtsplattform angelangt, atmete er erst ein paarmal tief durch, bevor er sich eine Zigarre ansteckte.
Fünfzehn Minuten vor zwölf. Beim Schlag der Halbpummerin ließ er vor Schreck seine brennende Zigarre fallen und hielt sich die Ohren zu.
Als der Glockenschlag ausgeklungen war, holte er die Champagnerflasche aus der Tasche seines schwarzen Capes. Gläser hatte er keine mitgebracht. Er hoffte, der andere würde daran denken.
Die Aussicht war fantastisch. Der Mond tauchte die schneebedeckten Dächer des Häusermeers in einen silbernen Glanz. Tausende Sterne funkelten am Firmament. Und die Gas- und Petroleumlichter hinter den Fenstern verströmten ein warmes goldenes Licht.
Er hielt sich für einen Romantiker. Tatsächlich vermisste er in diesem Moment die zärtlichen Hände eines Mädchens. Der Mann, auf den er wartete, hatte ihm versprochen, dass er seine Geliebte heute noch sehen würde. Vielleicht brachte er sie sogar mit auf den Turm?
Plötzlich vernahm er Schritte. Schwere Schritte. Sie kamen näher.
Kurz vor Mitternacht. Ein Mann, dessen Gesicht unter einer Kapuze verborgen war, trat zu ihm hinaus auf die schmale Plattform.
»Na endlich.« Der Dicke machte sich sogleich daran, die Champagnerflasche zu entkorken.
Die verhüllte Gestalt, die dem Kapuzenmann gefolgt war, hatte er nicht bemerkt.
Der erste Schlag traf ihn im Nacken. Er schrie auf vor Schmerz. Der zweite Schlag erwischte ihn an seiner linken Schläfe, streckte ihn zu Boden. Er warf einen letzten Blick auf die flimmernden Sterne am Himmel. Kurz darauf verlor er das Bewusstsein. Als sein Körper auf dem Kopfsteinpflaster vor dem Fiakerstandplatz beim Dom aufprallte, spürte er längst nichts mehr.
1
1. Jänner 1900. Die Pummerin läutete ein neues Jahrhundert ein.
Die Schläge der großen Glocke im Wiener Stephansdom übertönten die lauten Stimmen und die Walzerklänge, die aus den offen stehenden Fenstern der umliegenden Häuser drangen.
»Prosit Neujahr! Ein gutes neues Jahr! Es lebe das 20. Jahrhundert!« Aus den dunklen Gassen und Straßen strömten jubelnde Menschen auf den Stephansplatz.
Gustav von Karoly und sein Freund, Polizei-Oberkommissär Rudi Kasper, bahnten sich den Weg durch die von Pferden und Automobilen verstopfte Kärntnerstraße. Sie trugen beide Frack und darüber Wintermäntel, obwohl es eine relativ warme Silvesternacht war. Die Temperaturen lagen um die null Grad. Das Straßenpflaster in den weniger belebten Seitengassen war angezuckert. Es musste geschneit haben, während sie im Kursalon das Tanzbein geschwungen hatten.
Die beiden Männer gingen schweigend nebeneinander her. Ihre Laune war nicht die beste. Gustav litt unter Liebeskummer, Rudi unter allgemeinem Weltschmerz.
Der Silvesterball in den prunkvollen Räumen des Kursalons im Wiener Stadtpark hatte Rudi angeödet. Gustav, der nicht nur wegen seiner Tanzkünste bei der Damenwelt sehr begehrt war, wäre normalerweise sicher länger geblieben. Sein Freund hatte jedoch darauf bestanden, sich unter das einfache Volk am Stephansplatz zu mischen und dort den Eintritt ins 20. Jahrhundert zu feiern.
»Pass auf mit deinem blöden Spazierstock! Seit wann brauchst du überhaupt einen Stock? Bist du neuerdings gehbehindert? Oder ist das ein Symbol deines gesellschaftlichen Aufstiegs? Nur, weil du irgendwann einmal einen Grafentitel erben wirst, musst du nicht jetzt schon wie eine dieser erlauchten Herrschaften herumlaufen«, schimpfte Rudi.
»Pardon! War keine Absicht.«
»Mein Schienbein wird morgen garantiert blau sein.«
»Übertreib nicht so! Den Stock habe ich mir zu Weihnachten, als ich mir den Knöchel verstaucht hab, von meinem Vater ausgeborgt. Es ist ein ganz besonderes Exemplar. Schau mal.« Gustav hob den Stock und zeigte seinem Freund den vergoldeten Knauf – einen Zähne fletschenden Löwen.
Rudi, der für solche Extravaganzen nichts übrig hatte, schüttelte unwirsch den Kopf.
Der Himmel über Wien erstrahlte in allen Farben. Im Prater waren die Feuerwerker zugange. Mit glänzenden Augen betrachtete Gustav die glitzernden Sternchen und Rosetten. Sein längst verstorbener Großvater, Albert von Karoly, hatte ihn 1873 zur Eröffnung der Weltausstellung in den Prater mitgenommen. Gustav war damals neun Jahre alt gewesen. Seither liebte er Feuerwerke.
»Statt was zum Fressen kriegen die Wiener ein Spektakel serviert«, sagte Rudi. »Daran wird sich auch im 20. Jahrhundert nichts ändern.«
»Du bist und bleibst ein alter Griesgram.«
»Und du bist und bleibst ein unverbesserlicher Illusionist.«
»Spürst du denn nicht diese grandiose Aufbruchsstimmung, die in der Luft liegt? Hörst du nicht, wie die Leute singen und lachen?«
»Vor allem diejenigen, die uns für die Jahrhundertwende den Weltuntergang prophezeit haben.«
»Ich rede nicht von den paar Spinnern.«
»Von wegen ‚paar Spinner‘. Hast du keine Zeitungen gelesen? Selbst in den halbwegs seriösen Blättern war von Meteoriten die Rede, die unsere gesamte Zivilisation zerstören, und sogar von apokalyptischen Reitern, die Feuerstürme entfachen und jede Art von Leben auf der Erde auslöschen werden …«
»Reine Hysterie! Obwohl, gegen so einen kleinen Feuersturm hätte ich momentan nichts einzuwenden. Mir ist kalt«, jammerte Gustav.
»Weil du so dünn bist. Dünne frieren schneller. Ihnen fehlt eben die Speckschicht.« Neben dem groß gewachsenen, schlanken Gustav wirkte der Polizei-Oberkommissär fast klein und stämmig. Dabei war er nur zehn Zentimeter kleiner als sein Freund und brachte ungefähr das gleiche Gewicht auf die Waage. Bei ihm verteilten sich die Kilos anders. Er hatte breite Schultern, muskulöse Arme und eher kurze Beine.
Schnellen Schrittes gingen sie weiter. Kaum war der letzte Schlag der Pummerin verklungen, erreichten sie den großen Platz vor dem Dom, auf dem sich eine riesige Menschenmenge versammelt hatte.
Plötzlich vernahmen sie laute Schreie.
Beim Fiakerstandplatz, links vom Haupteingang des Doms, war ein Tumult ausgebrochen.
Gustav kämpfte sich zwischen den scheuenden Pferden und aufgeregten Leuten nach vorne durch.
Im Lichtschein einer Gaslaterne erblickte er ein großes Kleiderbündel auf dem Pflaster unter dem Nordturm.
»Rudi, komm her«, schrie er, »hier liegt jemand!«
Der Körper wirkte konturlos. Die Person lag auf dem Bauch. Die Füße waren unter dem Saum eines schwarzen Capes verborgen. Auf der linken Seite ragte eine bleiche, verstümmelt aussehende Hand hervor.
»Womöglich ist er hingefallen und von der hysterischen Menge oder gar von den Rössern zu Tode getrampelt worden«, sagte Gustav. Es klang mehr wie eine Frage.
Rudi drehte den Kopf des Toten zur Seite.
Von dem Gesicht war nicht mehr viel übrig.
Erschüttert wollte Gustav sich abwenden. Da erblickte er einen großen dunklen Fleck auf dem zerschmetterten Schädel. Er beugte sich über den Leichnam und ehe Rudi ihn davon abhalten konnte, berührte er den Toten.
»Das ist Blut. Warum hat er nur am Kopf geblutet? Sieh mal, sein Körper weist keine Blutspuren auf. Ist das nicht merkwürdig?«
»Wahrscheinlich hat es dem armen Mann beim Aufprall das Herz zerrissen. Bestimmt wird der Gerichtsmediziner einen Haufen innere Verletzungen feststellen«, antwortete Rudi.
»Oh mein Gott, das ist ja unser Großmeister, der Dombaumeister Rauensteiner!«, rief Gustav.
»Der Herr Dombaumeister ein Freimaurer? Interessant! Ist die Freimaurerei bei uns nicht strengstens verboten? Wenn der Vatikan das wüsste …«
»Da Teifi, da Teifi!«, schrie plötzlich jemand.
Ein behinderter Mann mit einem monströsen Kopf auf dem kurzen Hals und einem von Pockennarben entstellten Gesicht humpelte auf Gustav und Rudi, die nun beide neben dem Toten knieten, zu.
»Er hat ihn runter…ge…schmissen«, stotterte er.
»Wer hat ihn wo hinuntergeworfen?«, fragte Gustav.
Der Mann deutete auf den Nordturm. »Da Teifi … vo… vom Him… Himmel …« Er bekreuzigte sich dreimal.
»Wie ist Ihr Name?«
»Co…si…mo. Ich … ich bin der Glöck… Glöck…ner.«
»Ist der Mann kopfüber hinuntergestürzt?«, fragte Rudi.
Die Antwort des Glöckners ging in einem ohrenbetäubenden Geräusch von Hufen unter. Vier schwarz lackierte Fuhrwerke steuerten in höllischem Tempo auf den Stephansdom zu. Die Menschenmenge stob auseinander. Eines der Fuhrwerke war ein fensterloser Leichenwagen. Aus den anderen sprangen uniformierte Männer. Irgendjemand schien die Polizei verständigt zu haben.
Ein korpulenter Herr mit einem imposanten, an beiden Enden nach oben gezwirbelten Schnurrbart stieg gemächlich aus einer der eleganten Kutschen. Die Menge machte ihm sofort Platz. Zwei Uniformierte geleiteten ihn zu dem Toten.
Obwohl Polizei-Oberkommissär Rudi Kasper nicht im Dienst war, fühlte er sich übergangen. »Verdammter Wichtigtuer«, schimpfte er.
Der Lichtblitz einer Fotokamera verschreckte die Pferde. Nervöses Wiehern, laute Rufe der Kutscher, durcheinanderschreiende Passanten. Panik drohte auszubrechen. Gustav sah sich nach einem möglichen Fluchtweg um.
Der Polizeifotograf schien von der ganzen Aufregung nichts mitzubekommen. Seelenruhig bat er den stellvertretenden Polizeidirektor Hoffinger, dem die sicherheits- und gerichtspolitische Abteilung unterstand, für eine weitere Aufnahme stillzustehen.
Hofrat Hoffinger warf sich in Pose und blickte stolz in die Linse der großen Kamera.
Rudi wartete die langwierige Prozedur nicht ab, sondern schnappte sich den Glöckner und bemühte sich, ihm einen vernünftigen Satz zu entlocken.
Der arme Kerl murmelte unentwegt: »Da Teifi, da Teifi …«
»Der Tote ist der Dombaumeister Rauensteiner«, sagte Gustav zum Vizepolizeidirektor, als dieser sich zu ihnen gesellte.
Der Beamte musterte Gustavs schlanke Gestalt und seinen gut geschnittenen Mantel mit dem Zobelkragen.
Gustav erwiderte seinen Blick mit hochgezogenen Brauen. Daraufhin hielt ihn der Vizepolizeidirektor eines Handschlags für würdig.
»Lassen Sie den Platz sofort räumen«, herrschte Hofrat Hoffinger den Polizeiagenten Bröselmeier an, der neben ihm in Habt-Acht-Stellung stand. »Und halten Sie diesen Dummkopf da fest.« Er deutete auf den Glöckner.
»Soll ich ihn arretieren?«, fragte Polizeiagent Bröselmeier beflissen. »Arretieren ist immer gut.«
»Erst wenn ich es Ihnen befehle. – Die sterbliche Hülle des Mannes muss entfernt werden, bevor die Leute darüber hinwegtrampeln«, wandte sich Hoffinger an Polizei-Oberkommissär Rudi Kasper.
»Er ist eindeutig vom Nordturm gestürzt oder gestürzt worden. Wir sollten die Leiche besser hier liegen lassen und abwarten, was der Gerichtsmediziner sagt. Ich nehme an, er wird jeden Moment eintreffen.«
»Meinetwegen«, murmelte der Hofrat.
»Keiner fasst den Toten an, bevor ihn der Gerichtsmediziner nicht untersucht hat«, sagte Rudi laut und deutlich. »Es genügt vollkommen, wenn wir den Platz hier unterm Turm absperren.«
Die Uniformierten, die in Begleitung des hohen Herrn erschienen waren, sahen sich unschlüssig an, rührten sich aber nicht von der Stelle.
»Worauf warten Sie?«, schnauzte der Vizepolizeidirektor sie an.
»Noch ein Foto bitte, Herr Polizeidirektor«, bat der Fotograf. »Vor dem Haupttor vielleicht? Dort hätten wir mehr Licht. Möchten der Herr Polizei-Oberkommissär auch aufs Bild?«
»Alter Schleimer«, fauchte Rudi leise.
»Du kennst den Fotografen?«, fragte Gustav.
»Ja, er ist ein einfacher Polizeiagent. Seit er sich diesen modernen Fotoapparat zugelegt hat, spielt er sich auf, als wäre er ein großer Künstler.«
Der Fotograf eilte mit seinem Ungetüm zum Haupttor. Hofrat Hoffinger stapfte hinter ihm her. Rudi und Gustav blieb nichts anderes übrig, als ihnen zu folgen.
Gustav schaute hinauf zur Pummerin, die gerade das neue Jahrhundert eingeläutet hatte.
Eine steinerne, sich im Uhrzeigersinn drehende Wendeltreppe mit dreihundertdreiundvierzig Stufen führte auf den Südturm. Dieser freistehende Turm, der eigentliche Steffl, war das höchste Gebäude der Reichshaupt- und Residenzstadt. Gustav war mit seinem Großvater einmal oben gewesen, hatte sogar die Türmerstube und das Uhrenstüberl besichtigen dürfen.
Nachdenklich schweiften seine Blicke zurück zu dem unfertigen zweiten Turm des Doms. Unwillkürlich fiel ihm die Sage vom Puchsbaum ein, der einen Bund mit dem Teufel geschlossen hatte, um den Nordturm fertigstellen zu können.
Im 15. Jahrhundert verliebte sich der damalige Dombaumeister Hans Puchsbaum in ein hübsches Fräulein namens Maria. Auch sie fand bald Gefallen an dem geschickten Mann. Als er es wagte, um ihre Hand anzuhalten, stellte ihm der Vater seiner zukünftigen Braut eine unerfüllbare Bedingung: Nur wenn er den Nordturm innerhalb eines Jahres vollenden könne und dieser dann ebenso hoch wie der Südturm sei, würde er ihm seine Tochter zur Frau geben. In seiner Verzweiflung bat der Baumeister den Teufel um Hilfe. Der Teufel macht aber bekanntlich nie etwas umsonst. Er versprach, den Turm fristgerecht fertigzustellen, wenn Hans Puchsbaum in dem einen Jahr weder den Namen Gottes noch den der Jungfrau Maria oder den eines Heiligen aussprechen würde. Wenn er es täte, würde er seine Seele holen.
Da der Baumeister die junge Frau aufrichtig liebte, willigte er ein. Der Turm wuchs rasant. Puchsbaum machte sich jedoch bittere Vorwürfe, weil er diesen Pakt mit den dunklen Mächten eingegangen war. Als er eines Tages hoch oben auf dem Gerüst herumkletterte, sah er unten am Domplatz Maria. Puchsbaum rief ihren Namen. Im selben Moment stand der Teufel hinter ihm und schleuderte ihn unter höhnischem Gelächter in die Tiefe. Sein Körper zerschmetterte direkt vor Marias Augen. Die Bauarbeiten am Turm gingen daraufhin sehr schleppend voran und wurden 1511 eingestellt. Und so blieb der Nordturm bis heute unvollendet.
Dombaumeister Rauensteiner war ebenfalls vom Nordturm gefallen oder vielmehr hinuntergestürzt worden.
Was zum Teufel hatte der Rauensteiner mitten in der Nacht dort oben zu suchen gehabt, fragte sich Gustav.
Nach der umständlichen Prozedur des Fotografierens ließ sich der Vizepolizeidirektor dazu herab, den Glöckner höchstpersönlich zu befragen.
Cosimo behauptete stammelnd, der Rauensteiner sei, so wie der Puchsbaum, mit dem Teufel im Bunde gewesen und beim Erklingen des ersten Schlages der dicken Glocke vom Satan höchstpersönlich hinuntergestoßen worden.
Polizeiagent Bröselmeier versetzte ihm jedes Mal eine Ohrfeige, wenn er ins Stottern geriet. Schließlich brachte Cosimo keinen zusammenhängenden Satz mehr heraus.
Hofrat Hoffinger verlor die Geduld mit ihm und ließ ihn abführen.
»Ich nehme nicht an, dass dieser Krüppel ihn hinuntergestoßen hat. Aber er war nun mal verantwortlich für die Glocke im Nordturm. Er hätte niemanden hinauflassen dürfen. Die Halbpummerin schlägt, soviel ich weiß, jede Viertelstunde. Der enorme Druck, der durch das Bewegen der schweren Glocke entsteht, wird den Dombaumeister zu Fall gebracht haben«, sagte Hoffinger zu Rudi Kasper.
Gustav, der neben den beiden stand und alles mithörte, konnte der Theorie des Herrn Vizepolizeidirektors absolut nichts abgewinnen.
»Es wird sich herausstellen, ob es sich um Fahrlässigkeit gehandelt hat. Man muss dieses Individuum auf jeden Fall zuerst einmal anständig verhören.« Mit diesen Worten verabschiedete sich der Hofrat von seinem Oberkommissär. Er nickte auch Gustav gnädig zu und stieg in eine der schwarzen Kutschen.
Mit stolzgeschwellter Brust kehrt er nun zurück zu seiner Silvesterfeier und wird die fadisierten hohen Herrschaften mit dieser schauerlichen Geschichte beglücken, dachte Gustav. Er wunderte sich, dass sein bester Freund diesem Idioten nicht widersprochen hatte. Rudi war kein Feigling, im Gegenteil, er hatte sich schon öfters mit seinem Vorgesetzten angelegt. Irgendetwas stimmte momentan nicht mit ihm. Er war in letzter Zeit ständig gereizt, ja richtiggehend streitsüchtig. Warum hatte er sich in diesem Fall nicht mehr exponiert? Warum hatte er dem Hoffinger die übereilte Verhaftung durchgehen lassen?
Als er sich mit Rudi vom Tatort entfernte, fiel ihm allerdings etwas anderes ein. »Warum warst du vorhin so überrascht, als ich erwähnte, dass der Dombaumeister dem Freimaurerbund angehörte? Die Dombauhütten waren bereits im Mittelalter Sitz der Steinmetzbruderschaften. Die Steinmetze waren intelligente und kosmopolitische Leute …«
»Jaja, ist schon gut. Aber was hat das bitte schön mit diesem toten Baumeister zu tun?«, unterbrach Rudi ihn.
»Das wollte ich dir gerade erklären. Die Dombaumeister bildeten von jeher den harten Kern der Freimaurer. Nachdem mich mein Vater und einer seiner Freunde, dessen Namen er mir nicht verraten wollte, als Anwärter für den Freimaurerbund vorgeschlagen hatten, musste ich in mehreren Aufnahmegesprächen ranghöheren Brüdern meine Beweggründe darlegen und ihre Fragen beantworten. Ich wurde sozusagen auf Herz und Nieren geprüft. Mein erstes Gespräch hatte ich mit dem Rauensteiner. Er war kein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich befürchtete sogar, er würde gegen mich stimmen. Denn er hat mich mehrmals wegen nichts und wieder nichts richtiggehend angebrüllt. Mein Vater meinte jedoch, er sei nur ein großer Brummbär, der nicht beißen würde.«
»Trotzdem muss er sich Feinde gemacht haben.«
»Neider, ja, aber richtige Feinde?«
»Er hat es weit gebracht, war ein mächtiger Mann. Vielleicht hat er seine Macht missbraucht?«
»Da wäre er nicht der Erste …« Gustav runzelte die Stirn.
»Oder er hat noch mächtigere Leute ernsthaft vergrämt. Hör dich doch mal in deinem Geheimbund um.«
»Meine Brüder bespitzeln? Nein, mein Lieber, das kannst du nicht von mir verlangen.«
2
Gustav hatte am Neujahrsmorgen keinen Katzenjammer. Er hatte in der Silvesternacht kaum etwas getrunken. Beim Anblick seiner Tante Vera, die sich angeregt mit ihrer Patentochter Dorothea und deren Verlobten Doktor Carl Jank unterhielt, bekam er jedoch sogleich Kopfschmerzen.
Der Schweizer Seelenarzt war eine imposante Erscheinung, groß gewachsen und kräftig gebaut. Gustav, der über eine eher schwächliche Konstitution verfügte, konnte diesen vor Gesundheit nur so strotzenden blonden Hünen nicht ausstehen. Dorothea hingegen schien ihren Verlobten zu vergöttern. Sie hing buchstäblich an seinen Lippen. Zumindest kam Gustav das so vor.
Was war bloß aus der kleinen fröhlichen Dorothea geworden? Wie herzlich hatte sie als Kind immer über seine Späße gelacht! Gustav hatte öfters auf sie aufgepasst, wenn seine Tante und Dorotheas Mutter Valerie in anregende Gespräche vertieft waren und die Kleine darüber vernachlässigt hatten. Dorotheas Mutter war Veras beste Freundin gewesen und vor einigen Jahren in der k.k. Irrenanstalt auf dem Michelbeuerngrund zu Tode gekommen. Die Behandlung mit eiskalten Wassergüssen mitten im Winter hatte sie nicht überlebt. Sie starb an einer Lungenentzündung. Vera sprach von Mord.
Valerie war keineswegs verrückt gewesen. Sie hatte es nur gewagt, die Ärmsten der Armen kostenlos medizinisch zu behandeln, ohne studiert zu haben. Den Frauen war damals in der gesamten k.u.k. Monarchie der Zugang zu den Universitäten verwehrt gewesen. Deshalb war Dorothea auch in die Schweiz gegangen. Die Universität Zürich hatte als erste Hochschule Europas Frauen zum Medizinstudium zugelassen.
Der selbstbewusste Schweizer Psychiater war um einiges älter als Dorothea und unerhört erfolgreich.
»Sie sehen gar nicht gut aus, mein Freund«, sagte er zu Gustav.
Ich bin nicht dein Freund, hätte dieser ihn am liebsten angeschnauzt. Er schwieg um des lieben Friedens willen und hörte seiner Tante zu, die von dem grandiosen Silvesterkonzert im Musikverein schwärmte, das sie gemeinsam mit dem glücklichen Paar besucht hatte.
»Nachher haben wir mit dem Champagner, den Doktor Jank aus Zürich mitgebracht hat, auf das neue Jahrhundert angestoßen. Mein Gott, wie lange habe ich keinen so guten Champagner mehr getrunken!«
Die Verlobten waren in einem Ringstraßenhotel abgestiegen – in getrennten Zimmern natürlich. Davon hatte sich Gustav gestern überzeugt, als er Dorothea einen kurzen Besuch abstattete. Er hatte es sogar gewagt, sie zu fragen, was sie an diesem Psychiater finden würde.
»Es ist ganz einfach, Frauen mögen Männer, die an ihnen interessiert sind, und Carl interessiert sich nun einmal sehr für mich und meine Arbeit«, hatte Dorothea gesagt.
Gustav bereute es längst, Silvester nicht zu Hause geblieben zu sein. Auf dem Ball hatte er sich im Grunde ebenso gelangweilt wie Rudi, und den Anblick des toten Dombaumeisters hätte er sich auch lieber erspart.
Das neue Jahrhundert beginnt ja großartig, dachte er, als er seinen Kaffee schlürfte und missmutig der regen Unterhaltung am Tisch folgte. Er fragte sich, was das größere Übel war, der Tod des Großmeisters der Österreichischen Freimaurer oder der Anblick der beiden Turteltauben beim Frühstück.
Seit die Karolys das dritte Zimmer in ihrer Wohnung an fremde Leute vermieteten, hatten sie kein Esszimmer mehr und mussten die gemeinsamen Mahlzeiten in der geräumigen Küche einnehmen. Für gewöhnlich machte sich Gustav nichts daraus. Vor diesem wohlhabenden Schweizer genierte er sich für ihre beengten Verhältnisse.
Zum Glück war der momentane Untermieter, ein Student der Rechtswissenschaften, über Weihnachten nach Hause zu seinen Eltern ins Salzkammergut gefahren. Dorothea hatte ihren Verlobten über die katastrophalen finanziellen Umstände der Familie Karoly aber bestimmt nicht im Unklaren gelassen.
Sie war mit ihrem Carl am dreißigsten Dezember nach Wien gekommen, um die Jahrhundertwende hier zu feiern und um ihren Verlobten ihrer geliebten Patentante vorzustellen.
Vera von Karoly schien sehr angetan von dem Arzt zu sein, was Gustav maßlos ärgerte. Seine kluge Tante hatte normalerweise für Männer nicht viel übrig. Sie war eine radikale Frauenrechtlerin. Wie konnte sie nur so freundlich zu diesem präpotenten Schweizer sein?
Gustav warf der alten Josefa, die Vera und ihm den Haushalt führte, einen verzweifelten Blick zu. Seine Verbündete schien jedoch ebenfalls von dem Angeber fasziniert zu sein. »Möchten S’ noch ein Stückerl von der Malakofftorte, Herr Doktor?«, fragte sie und lächelte bei diesen Worten verschämt.
Josefa lächelte so gut wie nie. Gustav schimpfte sie in Gedanken eine Verräterin. Am liebsten hätte er augenblicklich den Tisch verlassen.
»Nein, vielen Dank. Ich bringe beim besten Willen nichts mehr hinunter.« Carl klopfte sich auf seinen nicht übersehbaren Bauchansatz.
Der Herr Doktor wird bald fett werden, dachte Gustav mit einer gewissen Genugtuung und griff nach der verschmähten Malakoff. Er konnte essen, so viel er wollte, er würde nie dick werden. Er hatte die Figur seines Vaters geerbt, der mit sechzig Jahren rank und schlank war wie ein Jüngling.
Alle außer Gustav schienen bester Laune zu sein. Um die Stimmung zu trüben, erzählte er von dem Todessturz des Dombaumeisters. »Auf den ersten Blick sieht es nach einem Selbstmord aus. Höchstwahrscheinlich handelt es sich aber um Mord.«
Sogleich unterbrach Carl ihn: »Sagt Ihnen das Ihre Spürnase? Der Dombaumeister war sicher nicht der Einzige, der sich zu Silvester umgebracht hat. Ich habe mich mit dem Phänomen der Massenhysterie näher beschäftigt. Solche Zeitenwenden lösen Untergangsfantasien bei empfindsamen Menschen aus …«
Wagt er es etwa gar, sich über mich lustig zu machen?, fragte sich Gustav und unterbrach den Herrn Doktor rasch: »Mein Freund, Polizei-Oberkommissär Rudi Kasper, schließt ein Kapitalverbrechen nicht aus. Und der stellvertretende Polizeidirektor hat bereits jemanden wegen fahrlässiger Tötung verhaften lassen. Leider den Falschen.« Gustav schaute Dorothea zum ersten Mal an diesem Morgen in die Augen.
»Ist das dieser Trottel? Wie heißt er noch mal?«, fragte sie. Vor einem Jahr hatte sie den Herrn Vizepolizeidirektor nicht gerade von seiner besten Seite kennengelernt. Damals hatte der Frauenmörder von Schönbrunn die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Dorothea hatte ihn mit Gustavs Hilfe überführt. Doch der Hofrat hatte den Täter auf Weisung von ganz oben bald wieder laufen lassen.
»Hoffinger«, sagte Gustav. »Der wird’s noch zum obersten Polizeidirektor bringen, wenn er sich weiterhin so bei den Mächtigen einschleimt.«
»Ich kenne diese schauerliche Geschichte, Liebes.« Carl tätschelte Dorotheas Hand. »Lass Karoly weiterreden. Es handelt sich ja offensichtlich um einen neuen Fall für ihn.«
Wenn schon, dann ‚von Karoly‘ bitte, hätte Gustav ihn gerne angefaucht. Da Dorothea allerdings so eine Bemerkung sicherlich nicht goutiert hätte – sie war eine überzeugte Republikanerin –, unterließ er es, den Herrn Doktor zu korrigieren.
»Fahren Sie fort mit Ihrer spannenden Geschichte.« Carl lehnte sich auf der unbequemen Küchenbank mit vor dem Bauch verschränkten Händen zurück.
Tu nicht so gönnerhaft, dachte Gustav, begann aber nun der kleinen Runde ausführlich zu schildern, was er in der vergangenen Nacht erlebt hatte.
Weder der Doktor noch die Frauen unterbrachen ihn ein weiteres Mal. Als er geendet hatte, fragte Carl mit kaum verborgenem Grinsen: »Sie sind Freimaurer?«
In Gustavs Ohren klang diese Frage fast abfällig.
»Er hat kurz vor Weihnachten das Aufnahmeritual hinter sich gebracht, ist also erst Lehrling«, antwortete Vera an seiner Stelle.
Gustav warf ihr einen bösen Blick zu. Seine Tante hielt nichts von Männerbünden. Als er sich von seinem Vater, Graf Batheny, dazu überreden hatte lassen, den Freimaurern beizutreten, war sie entsetzt gewesen.
»Von diesen geheimnisumwitterten Aufnahmeritualen müssen Sie mir unbedingt berichten«, forderte Carl ihn auf. »Ich beschäftige mich in meinen Forschungsarbeiten mit Riten und Ritualen. Vor allem in der Adoleszenz suchen junge Menschen oft Halt oder, besser gesagt, eine Ersatzfamilie …«
»Josefa, bring mir bitte ein weißes Hemd!«, unterbrach Gustav ihn und erhob sich. »Bitte entschuldigen Sie mich, ich muss zu einer Besprechung mit Polizei-Oberkommissär Kasper.«
Dieser Mensch hält mich für vollkommen verblödet, ärgerte sich Gustav, glaubt, mich ungestraft vor Dorothea runtermachen, mich als pubertierenden Jüngling hinstellen zu können!
Er hatte keine Verabredung mit Rudi. Aber er wollte lieber ein bisschen spazieren gehen oder einen zweiten starken Mocca im Café Schwarzenberg trinken, als sich weitere überhebliche Bemerkungen dieses Schweizer Seelenarztes anzuhören.
3
Gustav verließ die k.k. Hofstallungen durch das Seitentor an der Mariahilfer Straße und schlug den Weg Richtung Margareten ein. Er hoffte, Rudi am Neujahrstag zu Hause anzutreffen.
In den Morgenstunden hatte es heftig geschneit. Jetzt um die Mittagszeit herrschten Plusgrade. Schluss war mit der weißen Pracht. Am ersten Tag des neuen Jahrhunderts versank die Reichshaupt- und Residenzstadt in einer bräunlichen Brühe. Nur in den stillen dunklen Seitengässchen Margaretens, in die kaum ein Sonnenstrahl drang, war ein bisschen Schnee liegen geblieben.
Rudi wohnte mit seinem Vater in einer ärmlichen Zweizimmerwohnung über dem Wirtshaus der Familie Kasper in der Schlossgasse. Das Gasthaus »Zum schwarzen Elephanten« war ein beliebter Treffpunkt trinkfester Gesellen.
Gustav vernahm Gelächter und laute Stimmen, als er sich der Wirtschaft näherte. Er warf einen Blick durch die schmutzige Fensterscheibe.
Die Gaststube wurde von flackernden Gaslampen erhellt. Der alte Kasper stocherte in der roten Glut im Kohleofen und fachte das Feuerchen wieder an. Dichte Rauchschwaden umgaben die fröhlichen Zecher wie ein gespenstischer Schleier. Es roch nach Krautsalat und Schweinsbraten. Gustav hasste Kraut, vor allem hasste er den Geruch von Kraut.
Da er sich sicher war, dass sein Freund den Zechkumpanen seines Vaters nicht Gesellschaft leistete, eilte er die steile Stiege hinauf in den ersten Stock.
Im Stiegenhaus belästigte der Gestank von Kohl und Bier seine empfindliche Nase. Wie hält es Rudi hier bloß aus, fragte er sich nicht zum ersten Mal. Der Herr k.k. Polizei-Oberkommissär verdiente genug, um sich eine ordentliche Wohnung leisten zu können. Außerdem stritt er sich ohnehin andauernd mit seinem ewig betrunkenen Vater.
Am Gang vor der Wohnungstür lag allerlei Gerümpel: ein zweibeiniger Stuhl, eine verdreckte Armeedecke und ein großer Topf voller Küchenabfälle, die ebenfalls einen fürchterlichen Gestank verbreiteten. Hinter der vergitterten Fensterscheibe war ein schwacher Lichtschein zu sehen.
Gustav klopfte an.
»Wer ist da?« Rudis Tonfall war nicht gerade einladend.
»Na wer schon? Ich bin’s! Mach bitte auf.«
Rudi öffnete, bekleidet in Hemd, Socken und Sockenhaltern. Angesichts der Bartbinde, die hinter seinen Ohren befestigt war, konnte sich Gustav das Lachen beim besten Willen nicht verkneifen.
»Dein Schnauzer bleibt auch ohne dieses Ungetüm in Form. Sieh dir meinen an. Ich verwende nie diese lästigen Binden«, sagte er.
»Nicht jeder hat so viel Ähnlichkeit mit einem Primaten wie du«, erwiderte Rudi, dessen Haarwuchs zu wünschen übrig ließ. Er hatte dünnes, rötlich-blondes Kopfhaar und seine Stirnecken waren bereits kahl. Gustav hingegen war mit einer dichten schwarzen Haarpracht gesegnet, nicht nur am Haupt, sondern auch über der Oberlippe und am Körper.
»Zieh dich an, Herr Oberkommissär. Die Sonne scheint. Wir sollten einen Neujahrs-Spaziergang machen. Ich muss mit dir reden.«
»Nimm dir einen Kaffee. Die Kanne steht am Ofen. Ich bin gleich fertig.«
Angeekelt betrachtete Gustav die schmutzigen Kaffeehäferl auf dem Regal über dem Herd. »Den Kaffee trinken wir im Schwarzenberg.«
Er legte die Bücher, die sich auf dem einzigen Stuhl in der Küche stapelten, auf den Boden und setzte sich. Während sich Rudi fertig ankleidete, betrachtete Gustav neugierig die Buchumschläge: »Der Verbrecher«, »Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte«.
»Was liest du denn da? Cesare Lombroso? Ist das nicht einer dieser italienischen Rassisten?«
»Nein, er ist Darwinist und Jude. Er hat eine neue wissenschaftliche Richtung in der Kriminologie begründet, eine kriminalanthropologische. Hochinteressant, das sag ich dir. Vor allem das Buch über die verbrecherischen Weiber.«
»Du bist und bleibst ein Frauenfeind, lieber Freund.«
»Sagtest du Frauenfreund? Ja, das bin ich. Hast du nicht Lust, den Beginn des neuen Jahrhunderts mit zwei lieben Mädeln zu feiern? Habe ich dir von der feschen Gretel erzählt? Sie hat eine nicht minder fesche Freundin …«
»Lass mich mit deinen Weibergeschichten in Frieden. Es klappt sowieso nie, wie du weißt. Ich kann einfach nicht mit käuflichen Frauen.«
»Ich rede nicht von Prostituierten. Meine Gretel ist Weißnäherin und ihre Freundin arbeitet in einem Hutgeschäft auf der Mariahilfer Straße. Sie sind beide nicht fad, sondern richtige Frohnaturen. Wir könnten sie auf eine Jause einladen und nachher mit ihnen in ein Kabarett gehen. Ich komme für alles auf, wenn du blank sein solltest.«
»Es geht nicht ums Geld. Ich steh nun mal nicht auf diese Art von Frauenzimmern. Das solltest du mittlerweile begriffen haben.«
»Ach ja, der Herr Graf kriegt nur Lust bei Frau von und zu. Adelige habe ich nicht zu bieten. Da musst du dich an deinen Herrn Papa und deine Halbschwester halten.«
»Ich kann gleich wieder gehen.«
»Sei nicht immer so schnell beleidigt. Ich wollte dir ja nur zu ein bisserl Spaß verhelfen. Hast es momentan nicht leicht mit Dorothea und ihrem Verlobten, oder?«
»Er ist ein Parvenü. Ich verstehe nicht, wie sie sich in so einen eitlen Gecken verlieben konnte. Sie hat nur Augen für ihn.«
»Frauen können ungemein selbstsüchtig sein. Vor allem, wenn sie verliebt sind. Nichts hat dann mehr für sie Bedeutung, außer dem geliebten Mann.«
»Genau.«
»Wie sagte der von dir verehrte Doktor Freud? ‚Was will das Weib?‘«
»Das hat er, glaube ich, so nicht gesagt. Egal. Frauen sind eben auch für ihn unbekannte Wesen.«
»Und deswegen lasse ich mich erst gar nicht auf sie und ihre Spielchen ein, sondern amüsiere mich lieber mit den berechenbaren Mädeln, die wissen, was sie kriegen, und trotzdem bereit sind, ein paar nette Stunden mit mir zu verbringen.«
»Und danach gibst du ihnen einen ordentlichen Schmattes. Was ist denn das anderes als Prostitution?«
»Seit wann bist du so ein Moralapostel?«
»Ich würde dieses Thema gern beenden. Lass uns ins Kaffeehaus gehen. Ich möchte mit dir über den neuen Mordfall reden.«
»Ich bin nicht im Dienst«, sagte Rudi. »Außerdem hat mir der Hoffinger den Fall entzogen. Er will sich höchstpersönlich darum kümmern. Weder die Kirche noch deine Freimaurer haben mit einem Selbstmord viel Freude. Du wirst sehen, der Todessturz wird als Unfall ad acta gelegt werden. Oder sie machen den Glöckner dafür verantwortlich. Das würde ich ihnen aber nicht raten! – Was hatte der Rauensteiner überhaupt um Mitternacht auf dem Nordturm zu suchen? Kein Mensch begibt sich dort freiwillig hinauf, wenn die Halbpummerin die Viertelstunde verkündet und er noch dazu weiß, dass die Pummerin im Südturm gleich zu schlagen beginnen wird. Der Lärm muss mörderisch gewesen sein.«
»Dasselbe habe ich mich auch schon gefragt.«
»War der Feuerbeobachter nicht in der Türmerstube? Soviel ich weiß, ist diese Stube immer besetzt. Gerade in der Silvesternacht sollte man meinen, dass erhöhte Brandgefahr in der Stadt besteht …«
»Eine sehr berechtigte Frage.«
»Wir werden das alles heute nicht klären können. Am Neujahrstag schläft jeder vernünftige Mensch seinen Rausch aus. Wo, meintest du, sollen wir beide das neue Jahrhundert begießen?«
»Gehen wir zuerst ins Schwarzenberg.«
Als sie an der Sirkecke angelangt waren, setzte leichter Schneefall ein.
Keiner hatte mit diesem erneuten Wetterumschwung gerechnet. Vormittags war noch strahlender Sonnenschein gewesen. Gegen eins hatte sich der Himmel über der Stadt verdüstert und seither schneite es pausenlos. Wien war normalerweise eine hektische und laute Stadt, der Schnee aber dämpfte alle Geräusche. Es war unheimlich still um diese frühe Nachmittagsstunde.
Im Café Schwarzenberg wurden die beiden Herren sehr herzlich empfangen. Während sie mit dem Chef de Service und dem Zahlkellner Neujahrswünsche austauschten, machte ein Hilfskellner Gustavs Tisch, links vom Eingang, frei.
Das Schwarzenberg war sozusagen Gustavs Büro. Als Privatdetektiv inserierte er regelmäßig in diversen Tageszeitungen und gab als seine Postadresse das elegante Ringstraßencafé an.
Der Piccolo brachte ihm auch sogleich seine Post.
Gustav warf einen flüchtigen Blick auf die Absender der beiden Briefe und steckte sie ungelesen ein. Er hatte auf der mit tabakbraunem Leder überzogenen Sitzbank Platz genommen. Von hier aus überblickte er das ganze Lokal. Rudi saß links neben ihm in einem bequemen ledernen Clubsessel.
Die Luft war von Rauch geschwängert. Die Kerzen in den prächtigen Lüstern an der mit kleinen weißen Kacheln gefliesten Decke spendeten weiches Licht.
Rudi bestellte einen Großen Schwarzen, Gustav einen Einspänner.
»Kommt sofort, Herr Graf«, sagte der Ober beflissen.
Rudi wandte sich grinsend ab.
»Die Kellner haben es alle mit den Titeln. Wenn sie wüssten, wer du bist, würden sie dich garantiert als Herr Polizeidirektor begrüßen.«
»Das würde ich mir verbitten.«
»Ach was. Die wissen eh, dass ich kein echter Graf bin, sonst würden sie mich mit Euer Erlaucht anreden.«
»Trotzdem, die meinen es hier besonders gut mit dir.« Rudi deutete auf die üppige Schlagobershaube, die Gustavs großen Mocca zierte.
»Bin eben Stammgast.«
Gustav berichtete seinem Freund dann von Carls abfälligen Bemerkungen über seine Mitgliedschaft bei den Freimaurern. »Er zeigte außerdem eine völlig unangemessene Neugier, was das Aufnahmeritual betrifft.«
»Was hast du von einem Eidgenossen anderes erwartet?«, fragte Rudi.
»Eigentlich darf ich nicht darüber reden.«
»Worüber?«
»Über das Aufnahmeritual.«
»Findest du diese Geheimnistuerei nicht ein bisschen albern?«
»Ja … nein, es muss so sein. Wie du weißt, hat meine Aufnahme in die Loge Sokrates im Tempel in Pressburg stattgefunden. Mein Vater und ich sind einen Tag früher angereist, damit sich der Aufenthalt mit der langen Fahrt auch auszahlt. Am Vorabend haben wir eine fantastische Vorstellung von Pique Dame im Pressburger Stadttheater besucht. Eindeutig die schönste Oper von Tschaikowski. Einfach großartig! Ich sage dir, die Pressburger können mit uns Wienern durchaus mithalten. Der Hermann, gesungen von einem russischen Tenor, hervorragend. Auch die Pique Dame, die alte Gräfin, sang hinreißend und die Lisa war einfach bezaubernd. Wir sind übrigens im Hotel National abgestiegen. Und im Café Savoy im Erdgeschoss des Hotels hat mir mein Vater an jenem Abend, bevor wir in die Oper gingen, versprochen, mich demnächst als seinen leiblichen Sohn anzuerkennen und mir den Grafentitel zu vererben …«
»Das hast du mir alles bereits erzählt.« Rudi gähnte gelangweilt.