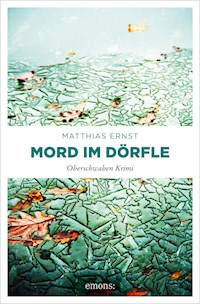2,99 €
Mehr erfahren.
Nachdem die Kriminalkommissarin Inge Vill schwer traumatisiert eine Auszeit nehmen musste, kehrt sie nun zurück ins Kommissariat der schwäbischen Kleinstadt Feigenbach. Dort wird in einem brutalen Mordfall ermittelt: Ein Heilpraktiker wurde in einem Fass mit Rapsöl ertränkt. Der Mann hatte sich zeitlebens einige Feinde gemacht – durch windige Geschäfte ebenso wie durch fragwürdige Behandlungsmethoden, die ein Kind beinahe das Leben gekostet hätten. Der Vater des Mädchens ist nun der Hauptverdächtige, doch Inge Vill glaubt nicht an diese einfache Lösung. Gleichzeitig sprengt ein Verrückter Radarfallen in die Luft. Als bei einer Explosion ein Beamter ums Leben kommt, ist Inge Vill die Einzige, die einen Zusammenhang sieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der AutorMatthias Ernst wurde 1980 in Ulm/Donau geboren. Bereits in seiner Jugend begeisterte er sich für Literatur und verfasste Romane und Kurzgeschichten. Nach dem Studium der Psychologie begann er eine Weiterbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten und arbeitete in mehreren Akut- und Rehakliniken in Süddeutschland. In seinem ersten Kriminalroman Die Spur des Jägers verbindet er seine beiden größten Leidenschaften miteinander, das Schreiben und die Psychotherapie. Matthias Ernst lebt und arbeitet in Oberschwaben.
Das BuchNachdem die Kriminalkommissarin Inge Vill schwer traumatisiert eine Auszeit nehmen musste, kehrt sie nun zurück ins Kommissariat der schwäbischen Kleinstadt Feigenbach. Dort wird in einem brutalen Mordfall ermittelt: Ein Heilpraktiker wurde in einem Fass mit Rapsöl ertränkt. Der Mann hatte sich zeitlebens einige Feinde gemacht – durch windige Geschäfte ebenso wie durch fragwürdige Behandlungsmethoden, die ein Kind beinahe das Leben gekostet hätten. Der Vater des Mädchens ist nun der Hauptverdächtige, doch Inge Vill glaubt nicht an diese einfache Lösung. Gleichzeitig sprengt ein Verrückter Radarfallen in die Luft. Als bei einer Explosion ein Beamter ums Leben kommt, ist Inge Vill die Einzige, die einen Zusammenhang sieht.
Matthias Ernst
Schwabenmord
Kriminalroman
Midnight by Ullsteinmidnight.ullstein.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Originalausgabe bei Midnight. Midnight ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Januar 2016 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016 Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © Susanne Marx ISBN 978-3-95819-054-2 Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Montag, 1. Juli 201307.00 Uhr
Ich fuhr durch die Toskana. Der Himmel über den grünen Hügeln war wolkenlos und stahlblau. In meinem roten Alfa jagte ich über die kleinen Sträßchen und kurvte durch die engen Gassen der uralten Städte und Dörfer. Ein herrliches Gefühl der Freiheit durchströmte mich. Ich erfreute mich an der farbenprächtigen Landschaft und an der warmen, würzigen Luft, die durch die offenen Fenster des Wagens hereinfloss und mich umfing wie eine wohlige Wolke.
Eine Kleinigkeit allerdings trübte meine Hochstimmung: Im Radio spielten sie einen Song, den ich nicht leiden konnte. Eine Klebstoffstimme besang irgendwelche himmlischen Klunker. Die Sängerin nölte so penetrant auf einem einzigen Ton herum, dass es mir in den Ohren wehtat. Ich versuchte, den Sender zu wechseln, doch irgendwie musste ich dabei auf den falschen Regler gekommen sein, denn der Song wurde noch lauter. Genervt drückte ich alle Knöpfe an der Bedienkonsole des Radios, aber die Lautstärke des Liedes nahm stetig zu. In meiner wachsenden Verzweiflung schlug ich auf das Radio ein, und plötzlich krachte und schepperte es.
Erschrocken riss ich die Augen auf und blickte mich um. Erste Sonnenstrahlen zwängten sich vorsichtig durch die Ritzen eines Rollladens. Irritiert stellte ich fest, dass ich keineswegs mit meinem Alfa durch die Toskana fuhr, sondern in meinem Bett im Schlafzimmer meiner Feigenbacher Wohnung lag. Der italienische Traum war leider zu Ende, doch die Sängerin leierte ihr Kaugummiliedchen weiter herunter. Die Nachttischlampe lag auf dem Boden. Offenbar hatte ich sie umgestoßen in meinem vergeblichen Versuch, das Autoradio zum Schweigen zu bringen. Ich unterdrückte den Impuls, den Wecker auszuschalten, mich auf den Bauch zu legen und mir einfach wieder die Decke über den Kopf zu ziehen.
Auf der dunkelroten Digitalanzeige leuchteten die Ziffern 07:00. Die Uhr ging offenbar leicht vor, denn die Nachrichten hatten noch nicht begonnen. Erfreulicherweise hatte die Kaugummifrau ihr Diamantenliedchen inzwischen beendet, und ein hassenswert gut aufgelegter Moderator kündigte die »besten News zwischen Alb und Alpen« an.
Während ich mir noch überlegte, ob ich in Zukunft nicht lieber auf den Radiowecker verzichten und mir ein altmodisches Gerät mit einer simplen Glocke anschaffen sollte, gongte es und eine seriöse Stimme verkündete, dass es nun sieben Uhr und heute der 1. Juli 2013 sei.
Die erste Meldung drehte sich um den kroatischen Beitritt zur EU. Prima, dann würde ich bei der Einreise nach Istrien nicht mehr ewig im Stau stehen müssen, sollte ich jemals wieder dorthin in Urlaub fahren wollen. Zuletzt war ich mit Bernd dort gewesen. Bernd. Oje, kein gutes Thema.
Während ich viel Mühe darauf verwandte, die Gedanken an meinen Exfreund aus meinem Kopf zu verjagen, kam der Nachrichtensprecher zunächst auf die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Litauen zu sprechen, danach auf die Waldbrände in Arizona, bei denen wohl neunzehn Feuerwehrleute ums Leben gekommen waren, und schließlich auf das unvermeidliche Fußballthema. Ein Jahr vor der WM in Brasilien hatte die brasilianische Nationalmannschaft den Confederations Cup gegen Spanien gewonnen und wurde nun als haushoher Favorit auf den Gewinn der WM im eigenen Land gehandelt.
Dann folgten die Lokalnachrichten:
»Feigenbach. Am vergangenen Samstag wurde das Feigenbacher Stadtbergfest von Herrn Oberbürgermeister Fettmilch offiziell eröffnet. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit einem neuen Besucherrekord. Neben dem Rummel und den Festzelten auf dem Stadtberg stehen zahlreiche Veranstaltungen wie etwa die historische Modenschau am morgigen Dienstag oder der Kinderumzug am Freitagvormittag auf dem Programm.«
Mist! Das Stadtbergfest hätte ich beinahe vergessen gehabt. Das kleine, zweitägige Festchen, das es in meiner Kindheit einmal gewesen war, war in den letzten Jahren zu einem gigantischen, kollektiven Besäufnis mutiert. Ich notierte auf meiner inneren To-do-Liste, mich so weit wie möglich von dem ganzen Rummel fernzuhalten, und konzentrierte mich wieder auf die Stimme des Nachrichtensprechers.
»Bachlangen. Im Fall des am vergangenen Donnerstag ermordeten Heilpraktikers Jürgen S. gibt es offenbar weiterhin keine heiße Spur. Ein Sprecher der Kriminalpolizei teilte gestern auf Anfrage unseres Senders mit, dass man zwar in mehrere Richtungen ermittle, bislang allerdings noch keinen dringend Tatverdächtigen festsetzen habe können. Jürgen S. war am späten Donnerstagabend tot in seiner Praxis aufgefunden worden. Unbestätigten Angaben zufolge war er in einem mit Rapsöl gefüllten Fass ertränkt worden. Dies ist insofern pikant, als S. laut seiner Homepage einer der führenden Fachleute für die Heilwirkung des Rapsöls war.«
Mit einem Mal war ich hellwach. Ich schnalzte mit der Zunge. Nun hatte ich endlich eine grobe Ahnung davon, was mich in der Polizeidienststelle erwarten würde. Nach einem Jahr Zwangspause sollte ich heute meine Wiedereingliederungsphase beginnen. Und die Ermittlungen im Fall des ermordeten Heilpraktikers würden ein perfekter Neuanfang werden. Ich würde beweisen können, was in mir steckte. Und ich würde Rudi Heckenberger, den Feigenbacher Polizeichef, davon überzeugen können, mir wieder die Leitung des Dezernats für Verbrechen gegen Leib und Leben anzuvertrauen, die ich bis zu der Sache vor einem Jahr innegehabt hatte. Schließlich war ich sein bestes Pferd im Stall, zumindest hatte er in den wenigen E-Mail-Kontakten, die wir in der Zeit meiner Krankschreibung gehabt hatten, nie aufgehört, mir genau das zu versichern.
Der Nachrichtensprecher fuhr fort:
»Heute Nacht wurde im Feigenbacher Ortsteil Unterfeigenbach eine stationäre Radarfalle von Unbekannten in die Luft gesprengt. Dabei wurde ein Anwohner durch umherfliegende Trümmerteile verletzt. Es handelt sich schon um den zweiten Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche. Bereits am vergangenen Freitag war in Buchlangen eine Geschwindigkeitsmessanlage durch massive Gewalteinwirkung zerstört worden. Die Polizei prüft den Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen. Und nun das Wetter.«
Ich zuckte innerlich zusammen. In Unterfeigenbach war ich auch einmal geblitzt worden. Hundertzehn Euro und ein Punkt. Mann, hatte ich mich damals geärgert! Und nun hatte irgendein militanter Radarfallenhasser das Teil zerstört. Na super! Auch das würde bei unserem Dezernat landen. Dummerweise hatte es einen Verletzten gegeben, es war also nicht nur einfach eine schwere Sachbeschädigung, sondern eine Körperverletzung. Ich bedauerte im Geiste das arme Schwein, das sich mit diesem langweiligen Fall würde befassen müssen. Wahrscheinlich traf es meinen Kollegen Markus; der war mit seiner peniblen Ader und seinem Faible für Aktenarbeit genau der Richtige, wenn es galt, Hunderte von Verkehrssündern auf ihre Vorliebe zu Knallkörpern hin abzuklopfen.
Ich wälzte mich aus dem Bett und ging unter die Dusche. Während ich das herrlich warme Wasser über meine Haare und meinen Körper laufen ließ, malte ich mir aus, wie mein erster Tag wohl ablaufen würde. Gut, ganz sicher würde er kurz werden. Mein Wiedereingliederungsplan sah für die ersten beiden Wochen nur vier Arbeitsstunden pro Tag vor. Aber wenigstens fanden die wichtigen Besprechungen alle vormittags statt. So würde ich kein relevantes Detail der Ermittlungen verpassen. Die zeitraubenden Befragungen und die Arbeit im Feld würden dann jedoch größtenteils meine Kollegen übernehmen müssen.
Ich trocknete mich ab, föhnte mir die Haare, zog mich an und ging in die Küche, um mir einen Kaffee zu kochen. Dann holte ich die Tageszeitung aus dem Briefkasten und suchte im Regionalteil nach Berichten über den Mordfall. Bei den Todesanzeigen wurde ich fündig. Ein ziemlich mickriger Nachruf mit den Worten »In stillem Gedenken an unseren geschätzten Kollegen. Naturheilverein Feigenbach« war alles, was ich finden konnte. Gut, das würde morgen ganz anders aussehen, wenn die Lokalredaktion ihre Berichterstattung über die Mordermittlungen so richtig in Gang gebracht hatte.
Nachdem ich meinen Kaffee getrunken hatte, schnappte ich meine Handtasche, schob mein Smartphone und meinen Geldbeutel hinein und verließ meine Wohnung. Ich schloss meinen Alfa auf, und als ich auf den Ledersitzen Platz nahm, hatte ich mit einem Mal ein gutes Gefühl, ja beinahe eine Art Vorfreude auf das Kommende. Ein Jahr lang war ich ausgeknockt gewesen. Doch nun würde ich endlich wieder durchstarten. Ich schob die Mix-CD, die meine kleine Schwester mir zum Geburtstag geschenkt hatte, in den Player und startete den Wagen. Das Röhren meines Alfas vermischte sich mit dem Dröhnen eines uralten AC/DC-Songs, und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht gab ich Gas.
08.00 Uhr
Ich nahm die Abzweigung von der Bundesstraße möglicherweise ein wenig zu rasant, sodass ich mit quietschenden Reifen in den Hof der Dienststelle einbog. Ein Kollege von der Schutzpolizei beäugte mich misstrauisch, doch als er mich hinter dem Steuer meines Alfas erkannte, hob er die Hand zu einem freundlichen Gruß. Ich nickte ihm lächelnd zu und stellte mein Auto auf einem freien Parkplatz ab.
Dann stieg ich aus und ging mit pochendem Herzen auf das Hauptgebäude der Feigenbacher Polizeidienststelle zu. Im Glaskasten saß der ewig notgeile Toni. Bei dem Gedanken daran, wie er sich bei der Weihnachtsfeier vor zwei Jahren sturzbetrunken an alles herangemacht hatte, was nicht schnell genug den Raum hatte verlassen können, musste ich unwillkürlich grinsen. Und das löste mit einem Mal einen kleinen Teil der ungeheuren Anspannung, die schon seit Tagen von mir Besitz ergriffen hatte.
Ich nickte Toni zu und wollte flugs an ihm vorübereilen, doch seine erstaunlich hohe Stimme hielt mich zurück.
»Sie sollet glei zum Chef komme, Frau Vill.«
Die Erwähnung von Rudi Heckenberger trieb meinen Puls sofort wieder in die Höhe.
»Ruhig Blut, Inge«, versuchte ich mich innerlich wieder runterzubringen, so wie ich es von Frau Schwiers, meiner Therapeutin während der psychosomatischen Reha, gelernt hatte. »Rudi wird mit dir nur die Formalitäten klären. Wie die Eingliederung abläuft und so weiter. Sei doch froh, dass er dich zuerst zu sich ruft. Schau, er wirft dich nicht gleich ins kalte Wasser, er kümmert sich um dich.«
Mein inneres Wiegenlied zeigte Wirkung. Ich atmete tief durch und schlug den Weg zu Heckenbergers Büro ein. Als ich vor der Türe zu seinem Vorzimmer stand, wiederholte ich kurz mein »Inge, das schafft du«-Mantra, dann klopfte ich und trat ein.
Eleonore Wiesenbräu, Rudis Sekretärin, musterte mich ausgiebig. Ihre eigentlich recht kleinen grünen Äuglein wurden durch die riesigen Gläser ihrer Siebzigerjahrebrille grotesk vergrößert, und ich fühlte mich kurz in einen uralten Science-Fiction-Film versetzt, in dem ein unfreiwillig komisch aussehendes Monster vom Mars eine Gruppe gefangener Erdlinge mit seinem Röntgenblick nach versteckten Waffen abscannt.
»Guten Morgen, Frau Wiesenbräu«, rief ich fröhlich.
»Guten Morgen Frau Vill«, erwiderte sie mit gewohnt sauertöpfischer Miene. »Sieht man Sie auch mal wieder.«
Ich lächelte sie freundlich an, während mir einige sehr, sehr unfreundliche Gedanken durch den Kopf gingen.
»Schön, dass Sie sich trotz meiner langen Abwesenheit noch an mich erinnern können«, war die einzige kleine Spitze, die ich mir zugestand. »Mir wurde gesagt, dass ich mich bei Herrn Heckenberger melden sollte?«
»Gehen Sie rein, er erwartet Sie«, brummte Eleonore die Schreckliche.
Ich ließ die alte Giftkröte an ihrem Sumpf, den sie Schreibtisch nannte, zurück und ging auf die ledergepolsterte Tür von Rudis Büro zu. Als ich gerade zu einem Klopfen ansetzen wollte, wurde die Tür plötzlich schwungvoll aufgerissen. Erschrocken blickte ich in das zorngerötete Gesicht meines Chefs.
Auch er war offensichtlich überrascht, dass jemand auf seiner Türschwelle stand. Meine Anwesenheit schien ihn zudem aus dem Konzept gebracht zu haben, denn er starrte mich einige Augenblicke lang verwirrt an, ehe er seinen Charakterkopf einmal kräftig schüttelte, mir die Hand hinstreckte und »Guten Morgen, Frau Vill, schön, Sie zu sehen, gehen Sie doch schon mal in mein Büro« sagte.
Ich gab ihm die Hand und trat ein. Rudi ging ins Vorzimmer und schloss die Tür hinter sich. Trotz der Dämpfung durch das Leder hörte ich, wie er mit einem Mal laut wurde. Ich konnte die Worte zwar nicht verstehen, doch es klang so, als ob er gerade dabei wäre, seine Chefsekretärin zusammenzustauchen. Eine kurze Woge der Genugtuung durchflutete mich, wurde jedoch rasch von einem leisen Gefühl des Mitleids abgelöst. Von Rudi in Senkel gestellt zu werden war etwas, das ich nur meinen allerschlimmsten Feinden gegönnt hätte.
Heckenberger kehrte mit hochrotem Kopf zurück. Er deutete auf den vor seinem Schreibtisch stehenden Besucherstuhl, und ich nahm Platz, während Rudi sich in seinen Chefsessel fallen ließ.
Er betrachtete mich einen Moment lang schweigend, während seine angespannte Miene zunehmend weicher und seine Gesichtsfarbe zunehmend heller wurde. Schließlich sagte er:
»Schön, dass Sie wieder da sind, Frau Vill!«
Ich nickte und erwiderte:
»Das wurde jetzt auch langsam Zeit.«
Er öffnete eine Schublade seines Schreibtischs und holte zwei Gegenstände heraus, die er vor mir auf der Arbeitsfläche ablegte. Es handelte sich um meinen Dienstausweis und um meine Pistole. Ich griff zunächst nach dem Ausweis und steckte ihn in die Innentasche meiner Jacke. Dann nahm ich die Waffe in die Hand. Es fühlte sich ungewohnt und auch etwas unwirklich an, wieder eine Pistole in der Hand zu halten. Nach einigen Sekunden schob ich die Waffe in das Halfter unter meiner linken Achselhöhle.
Rudi lächelte mir freundlich zu.
»Fühlen Sie sich fit für den Dienst?«, fragte er.
»Ja«, entgegnete ich, ohne zu zögern, und fügte, auf den Mord an dem Heilpraktiker anspielend, hinzu: »Es gibt ja wohl auch einiges zu tun.«
Auf Rudis Stirn zeichneten sich die Umrisse der Querfalten ab, deren Tiefe neben der Röte der Gesichtsfarbe meines Chefs der beste Indikator für den Grad seiner Anspannung war. Irgendetwas schien ihm Kopfzerbrechen zu bereiten.
»Ja«, sagte er schließlich. »Darüber müssen wir sprechen. Über Ihre Tätigkeiten während der Wiedereingliederung, meine ich.«
Ich schluckte. Welche »Tätigkeiten« er wohl meinte?
»Nun«, erwiderte ich, »so wie ich das verstehe, ist die Wiedereingliederungsphase mit einer verkürzten Arbeitszeit verbunden. Das bedeutet, dass ich wahrscheinlich erst einmal schwerpunktmäßig in der Dienststelle arbeiten werde.«
Rudi nickte.
»Wir ermitteln aktuell in zwei Fällen. Von dem Mord an Jürgen Schwärzler, dem Heilpraktiker, der in seinem eigenen Rapsöl ertränkt wurde, werden Sie schon gehört haben.«
Ohne meine Antwort abzuwarten, fuhr er fort:
»Und dann ist da noch die Sache von gestern Abend.«
»Die Radarfalle«, murmelte ich.
Er blickte mich erstaunt an.
»Kam heute Morgen in den Lokalnachrichten im Radio«, erklärte ich.
Rudi seufzte.
»Dass Ihr Dezernat sich mit so einem Mist überhaupt befassen muss! Haben sie die genauen Umstände auch im Radio gebracht?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Gut«, erwiderte Rudi. »Dann lassen Sie sich bitte von Herrn Hübner diesbezüglich briefen.«
Eine eiskalte Hand legte sich um meine Kehle.
»Wie? Ich verstehe nicht«, stammelte ich.
»Nun, ich möchte, dass Sie zusammen mit Herrn Hübner dieser Sachbeschädigung mit Körperverletzung nachgehen.«
Ich schluckte schwer.
»Und was ist mit dem Mord?«, fragte ich, ohne die Enttäuschung darüber zu verbergen, dass mir eine Ermittlung zugeteilt wurde, die selbst Rudi als »Mist« bezeichnete.
»Sie werden natürlich bei den Lagebesprechungen anwesend sein. Aber die Ermittlung wird Herr Steinle leiten. Und Frau Schmittgal und Herr Kleinert sind ebenfalls schon gut in den Fall eingearbeitet.«
Ich kämpfte mit den Tränen. Ein widerliches Gefühl stieg in mir hoch, ein Gefühl, das ein Kind empfinden musste, wenn es im Sportunterricht bei der Mannschaftswahl übrig bleibt und vom Lehrer notgedrungen dem schwächeren Team zugeordnet wird.
Rudi schien meine Enttäuschung zu spüren, denn seine Stimme nahm mit einem Mal einen besänftigenden Ton an:
»Frau Vill, ich schätze Ihre Fachkompetenz sehr, und deshalb möchte ich Sie auch an den Ermittlungen beteiligen. Aber offiziell sind Sie immer noch im Krankenstand, vergessen Sie das bitte nicht. Verantwortung dürfen Sie erst wieder tragen, wenn Sie die Wiedereingliederung beendet haben.«
»Und das bedeutet …«, sagte ich zaghaft, doch Rudi war noch so sehr in Fahrt, dass er meinen Satz beendete:
»… dass Herr Hübner die Ermittlungen bei dieser Radarfallengeschichte leitet. Seien Sie bitte vernünftig, Frau Vill. Sie werden sehen, dass die Zeit rasch vorübergehen wird. Und ich möchte Ihnen auch die Gelegenheit geben, sich langsam wieder bei uns einzugewöhnen.«
Er blickte mich treuherzig an, und ich schaffte es, meine Enttäuschung so weit niederzukämpfen, dass ich wenigstens ein Nicken zustande brachte.
»Gut«, erwiderte Rudi. »Dann müssen wir nur noch die Sache mit den Büros besprechen.«
Mir schwante Übles.
»Wir konnten Ihr Büro leider nicht ein Jahr lang ungenutzt lassen. Das Dezernat III hat Zuwachs bekommen, und wir mussten einen neuen Kollegen dort einquartieren. POM Mayer vom Dezernat IV wird allerdings Ende des Monats pensioniert, dann bekommen Sie sein Büro.«
»Und wo werde ich …?«, setzte ich an, doch Rudi fuhr einfach fort:
»Sie werden sich das Büro mit Herrn Hübner teilen. Das ist auch für die Zusammenarbeit im Radarfallenfall am praktischsten.«
Die Faust um meine Kehle, die ihren eisigen Griff zwischenzeitlich ein wenig gelockert hatte, drückte nun wieder fester zu. Ich wollte etwas erwidern, doch schaffte ich es nicht. Ich nickte nur. Rudi steckte mir seine Hand entgegen, die ich geistesabwesend schüttelte. Danach musste ich wohl das Büro verlassen und Eleonore die Schreckliche passiert haben, denn als ich wieder voll zur Besinnung kam, fand ich mich auf dem Gang wieder.
So ein Mist! Ich war nicht nur zu einer besseren Praktikantin degradiert worden, nun musste ich mich auch noch einen Monat lang irgendwo in Markus’ winziges Büro quetschen. Ich zitterte am ganzen Körper, und die Tränen schossen mir wieder in die Augen. Ich blickte mich rasch um und überprüfte, ob jemand in der Nähe war, der diesen unkontrollierbaren Gefühlsausbruch beobachten könnte. Zum Glück war ich allein. Ich atmete tief aus, wie ich es in der Klinik gelernt hatte, und langsam, ganz langsam begannen meine Gedanken, sich zu beruhigen, sodass ich mich schließlich durch ein dreimaliges »Inge, das schaffst du« wieder einigermaßen ins Lot bringen konnte.
Puh! Wieder einmal war mir vor Augen geführt worden, wie wacklig meine Psyche noch war, wie leicht ich mich erschüttern ließ. War es vielleicht doch ganz gut, dass Rudi mich erst einmal mit Samthandschuhen anfasste, auch wenn alles in mir sich dagegen zu wehren schien? Ich atmete ein letztes Mal ganz tief aus, dann machte ich mich auf den Weg zu meinem neuen Teilzeitbüro.
08:30 Uhr
Eine dunkle Wolke hatte sich zwischenzeitlich vor die leise Euphorie geschoben, die ich heute Morgen beim Aufbruch zur Dienststelle empfunden hatte. Auf wackligen Beinen begab mich zu dem kleinen Büro, in dem ich zusammen mit Markus die nächsten vier Wochen zusammengepfercht sein würde. Vor der Tür angekommen, zögerte ich kurz. Ein verführerischer Gedanke hatte sich in mein Bewusstsein geschoben. Vielleicht sollte ich mich einfach noch vier weitere Wochen krankschreiben lassen? Dann hätte ich ein eigenes Büro, und dieser dämliche Radarfallenfall wäre sicher auch schon gelöst.
Doch dann rief ich mir ins Gedächtnis, was Frau Schwiers mir über Vermeidungsverhalten gesagt hatte:
»Vermeiden schafft eine kurzfristige Erleichterung, erhöht aber die Hürde für den nächsten Versuch.«
Klar, warum sollte es denn in vier Wochen einfacher werden mit dem Wiedereinstieg, vor allem, wenn ich die erste Wiedereingliederung gleich nach wenigen Stunden aufgegeben hatte? Nein, ein Abbruch war keine Option, so verlockend der Gedanke daran sich auch anfühlte. Seufzend hob ich meine Hand, klopfte an die Türe und trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten.
Das Zimmerchen war noch kleiner, als ich es in Erinnerung gehabt hatte. Das lag vor allem daran, dass ein weiterer Schreibtisch mitsamt Telefon, PC und Bürostuhl neben die mit Aktenbergen vollgestellte Arbeitsfläche meines Messie-Kollegen gestellt worden war.
Als ich eintrat, erhob Markus sich und kam freudestrahlend auf mich zu. Ich streckte ihm die Hand hin, doch er umarmte mich und drückte mich fest an sich. Ich war vollkommen perplex. Was war denn nur in Markus gefahren? Körperkontakt war doch noch nie seine große Leidenschaft gewesen.
»Schön, dass du wieder da bist, Inge«, sagte er, als er mich wieder losgelassen hatte und einen Schritt zurückgetreten war. Er musterte mich neugierig.
»Ich bin auch froh, wieder hier zu sein«, erwiderte ich notgedrungen, obwohl mir gerade eher zum Heulen zumute war.
»Wie geht es dir?«, fragte Markus. Noch eine Überraschung.
»Na ja, es geht schon«, gab ich zögernd zurück. »Ich hoffe mal, dass ich gut in die Arbeit finde, dann ist das letzte Stück Normalität auch wiederhergestellt.«
Markus nickte.
»Mir hat es gutgetan, nach dem Vorfall baldmöglichst wieder in den Job zurückzukehren. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich eh nur zu Hause auf meinem Sofa gesessen und hätte darüber nachgegrübelt, was ich damals falsch gemacht habe.«
»Du hast nichts falsch gemacht«, murmelte ich, während die Bilder von jenem furchtbaren Tag jäh mein Bewusstsein überfluteten.
»Das weiß ich inzwischen auch«, erwiderte er lächelnd.
Ich blickte ihn fragend an. Markus hatte sich ganz eindeutig verändert. Er war offener geworden, hielt sogar den Blickkontakt. Und er schien die Sache deutlich besser weggesteckt zu haben als ich, obwohl er, rein objektiv gesehen, schlimmere Verletzungen davongetragen hatte. Im Vergleich dazu erschienen mir meine Panikattacken beinahe lächerlich.
»Dir scheint es recht gut zu gehen«, sagte ich vorsichtig, in dem Gefühl, mich auf dünnes Eis zu wagen.
Er nickte.
»Es geht mir sogar besser als davor. Manchmal sind Krisen eben auch Chancen.«
Ich verzog das Gesicht. Dieses »Krisen gleich Chance«-Gelaber hatte ich in der Reha an jeder Ecke zu hören bekommen. Doch mir war es stets wie der pure Hohn vorgekommen, konnte ich doch rein gar nichts Positives an meiner Situation erkennen.
»Aber lass uns das Philosophieren für später aufschieben, Inge. Wir haben viel zu tun«, sagte er und deutete auf seinen Schreibtisch. Das war dann wieder der alte Markus, und ich war mehr als froh, dieses Befindlichkeitsgespräch nicht weiterführen zu müssen.
»Der Radarfallenfall?«, fragte ich und zwängte mich dabei hinter die kleine Tischplatte, auf der mein PC stand.
»Sozusagen«, entgegnete Markus.
»Was ist geschehen?«, fragte ich.
»Nun, es handelt sich erst einmal um zwei Fälle von Sachbeschädigung. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein stationäres Gerät zur Geschwindigkeitsmessung in der Ortsdurchfahrt von Buchlangen zerstört. Der Täter muss zunächst die beiden Scheiben mit grober Gewalt eingeschlagen haben. Danach füllte er einen Brandbeschleuniger, wahrscheinlich handelsübliches Rasenmäherbenzin, in die so entstandenen Löcher ein, entzündete das Gemisch mit einem Streichholz und zerstörte dadurch die Messeinheit und die Kamera.«
»Gab es Zeugen?«, fragte ich.
»Warst du schon einmal in Buchlangen?«
Ich nickte und verstand sofort, was er meinte. Buchlangen war ein verschlafenes Kaff, das aus einem Dutzend Häusern bestand, die sich an der Bundesstraße aufreihten wie Kühe auf dem Weg von der Weide in den Stall. Das einzig bemerkenswerte an dem Ort war, dass die Straße von Feigenbach nach Bronnen hier etwa zwei Kilometer lang schnurgerade verlief und als Raserstrecke gefürchtet war. In Buchlangen war deswegen vor einiger Zeit eine stationäre Radarfalle installiert worden, um dem Tempolimit von fünfzig Kilometern pro Stunde Nachdruck zu verschaffen.
»Was ist mit den Daten?«, fragte ich.
Auf Markus’ Gesicht erschien ein verschmitztes Lächeln.
»Nun, in diesem Fall hat es sich gelohnt, dass der Landkreis etwa achtzigtausend Euro in das modernste Messsystem auf dem Markt investiert hat. Die Datenübermittlung an den zentralen Server im Landratsamt erfolgt verschlüsselt über das Mobilfunknetz. Falls der Täter eine Messung vernichten wollte, ist ihm das nicht geglückt.«
Das war schon einmal sehr gut.
»Und die zweite Radarfalle?«, fragte ich weiter.
»Nun, da scheint der Täter im Vergleich zum ersten Mal aufgerüstet zu haben. Es handelt sich um die stationäre Messanlage in Unterfeigenbach.«
»Was heißt aufgerüstet?«
»Nun«, erwiderte Markus, »die KT ist sich noch nicht ganz sicher, um welche Art von Sprengstoff es sich handelte. Jedenfalls explodierte die Anlage gegen 23 Uhr mit großer Wucht. Der Sprengsatz wurde aller Wahrscheinlichkeit nach ferngezündet. Offenbar hatte der Täter die Wirkung deutlich unterschätzt. Die Messanlage wurde so vollkommen zerstört, dass sich Bruchstücke in einem Radius von bis zu einhundert Metern verteilten. Die Kameraeinheit durchschlug das Schlafzimmerfenster in einem etwa vierzig Meter entfernten Haus und verletzte einen der Bewohner. Deshalb ermitteln wir und nicht die Kollegen vom Dezernat IV.«
Ich atmete langsam aus. Das war krass.
»Und die Daten?«, fragte ich.
Erneut erschien das verschmitzte Lächeln auf seinem Gesicht.
»Es handelt sich um das gleiche Modell wie in Buchlangen.«
Nun musste auch ich lächeln. Möglicherweise würde sich dieser Fall sehr, sehr schnell aufklären lassen.
»Gut, dann lass uns doch einmal über die Staatsanwaltschaft die Freigabe der Datensätze der beiden Messstationen durch das Landratsamt beantragen.«
Markus’ Lächeln wurde breiter.
»Schon geschehen, Inge. Ich habe eben Staatsanwalt Fink angerufen. Er kümmert sich darum.«
Bei der Erwähnung des Staatsanwalts zuckte ich leicht zusammen. Ich hatte ihn seit der Sache damals nicht mehr wiedergesehen, aber nun würde ich notgedrungen erneut mit ihm zu tun haben, und ich wusste noch nicht, wie ich das finden sollte.
»Prima, dann müssen wir nur noch nach Namen suchen, die auf beiden Listen auftauchen, und schon haben wir unsere dringend Tatverdächtigen«, entgegnete ich.
Markus nickte, und in seinen Augen lag ein unternehmungslustiger Glanz. Das war genau nach seinem Geschmack. Ermittlungsarbeit im Büro und lange Listen, die es durchzuackern galt.
»Na, Inge, das dürfte doch ein guter Wiedereinstieg werden, oder?«, fragte er.
Ich musste lächeln. Wie recht er doch hatte. Wenn wir den Täter rasch ermitteln konnten, würde ich sicher auch eine größere Rolle im aktuellen Mordfall spielen dürfen. Und das war es, was ich mehr als alles andere wollte.
»So«, sagte Markus und riss mich aus meinen Gedanken. »Jetzt müssen wir aber zur Lagebesprechung. Ich bin schon gespannt, was die anderen zu unseren Ermittlungserfolgen sagen werden.«
09.00 Uhr
Als ich mich im Schlepptau von Markus dem Besprechungsraum näherte, schlotterten mir dann aber doch ein wenig die Knie. Zum letzten Mal war ich dort in jener grauenhaften Nacht gewesen, als der Fall der Feigenbacher Senfmorde vollkommen aus dem Ruder gelaufen war.
Ein Jahr war seitdem vergangen. Wie sie mich wohl empfangen würden? Nach dem Tod von Heiner Fendt, dem früheren Leiter des Dezernats II, hatte nun Raimund, mein dienstältester Kollege, diesen Posten übernommen. Als ich vor etwa drei Monaten davon erfahren hatte, war das ein ziemlicher Schock gewesen. Insgeheim hatte ich die Hoffnung nie aufgegeben, dass ich nach meiner Rückkehr gleich wieder als zumindest stellvertretende oder im besten Fall sogar permanente Dezernatsleiterin einsteigen könnte. Aber das war nun leider zu einer nicht eingetretenen Alternativrealität geworden. Hätte, hätte, Fahrradkette.
Sie erwarteten mich bereits im Besprechungsraum. Raimund, Larissa und Ralf standen vor der Fallanalysewand, und als ich der Reihe nach in ihre Gesichter schaute, überflutete mich eine Welle der Erleichterung und der Freude. Kein abschätziger Blick, keine gerunzelte Stirn, kein zusammengekniffener Mund. Raimund hielt einen Blumenstrauß in der Hand, er lächelte mir freundlich zu. Ralf, sparsam wie immer in seinen zwischenmenschlichen Kontakten, schenkte mir ein schelmisches Zwinkern. Und Larissa konnte offenbar nicht mehr an sich halten, stürzte auf mich zu und umarmte mich. Dann trat sie einen Schritt zurück, strahlte mich an und sagte:
»Schön, dass du wieder da bist!«
Ich spürte, wie sich zwei Tränchen in meinen Augenwinkeln zu sammeln begannen, schluckte und erwiderte:
»Das finde ich auch!«
Raimund trat auf mich zu, umarmte mich ebenfalls kurz und sagte:
»Wollen wir gleich anfangen, oder magst du lieber Fragen beantworten und erzählen, was du im vergangenen Jahr alles durchgemacht hast?«
Ich musste lachen, und gleichzeitig war ich gerührt. Raimund hatte offenbar ziemlich genau geahnt, wie meine grellfarbigen Befürchtungen ausgesehen hatten.
»Lass uns anfangen«, entgegnete ich.
Wir nahmen Platz. Und mit einem Mal waren alle Zweifel und alle Unsicherheiten dahin. Ich war angekommen und brannte darauf, in die Ermittlungen einzusteigen.
»Gut, wir haben zwei Fälle, die wir besprechen müssen«, begann Raimund. »Fangen wir vielleicht mit den Radarfallen an.«
Er nickte Markus auffordernd zu. Dieser erhob sich, räusperte sich mehrfach und wollte gerade damit beginnen, die bisherigen Erkenntnisse zusammenzufassen, als sich die Tür des Besprechungsraumes knarzend öffnete.
Alle Blicke wandten sich dem Eintretenden zu. Es war Fink, der Staatsanwalt. Ich spürte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte. Finks Miene war düster. Er grüßte mit einem kurzen Nicken und setzte sich auf den freien Stuhl neben Ralf, ohne mich eines Blickes gewürdigt zu haben.
Markus räusperte sich noch einmal und begann, die Anschläge auf die beiden Radarfallen zu schildern. Er schloss mit unserem Vorhaben, die glücklicherweise erhaltenen Daten nach Doppelungen zu untersuchen.
»Gute Idee«, warf Ralf ein, und auch Raimund nickte zustimmend.
»Meinem Antrag auf Freigabe der Daten ist bereits entsprochen worden«, sagte Fink und schob mir ein Blatt Papier zu. »Sie können sich also gleich an die Arbeit machen. So ein Schreibtischjob ist doch optimal für eine Wiedereingliederung.«
Ich starrte ihn fassungslos an, doch er wandte den Blick von mir ab. Warum hatte er mir den Beschluss gegeben? Woher wusste er, dass ich schwerpunktmäßig an dem Fall arbeiten würde? Und was sollte der Kommentar über meine Wiedereingliederung?
Offenbar war nicht nur ich irritiert über den Staatsanwalt, denn Larissa warf ihm einen wütenden Blick zu, und auch an Ralfs Schläfen begannen einige Äderchen verräterisch anzuschwellen. Er wollte wohl gerade ansetzen, Fink etwas wahrscheinlich sehr Unfreundliches zu erwidern, als ihn ein scharfer Blick von Raimund traf. Ralf schwieg, versuchte sich jedoch in der Kunst des Tötens mit den Augen.
»Das ging schnell. Danke, Herr Staatsanwalt«, sagte Raimund.
Fink nickte.
»Und nun wenden wir uns dem Mordfall Schwärzler zu«, fuhr er fort. »Frau Schmittgal wird die bisherigen Ergebnisse der Ermittlungen zusammenfassen.«
Er nickte Larissa freundlich zu, und sie erhob sich. Ihre Wangen waren gerötet, und an dem leichten Zittern des Blätterstapels, den sie in der Hand hielt, ließ sich ihre Aufregung gut ablesen. Ein wenig wirkte sie ihrer inzwischen beträchtlichen Berufserfahrung zum Trotz immer noch wie eine Schülerin, die vor versammelter Klasse ein Referat halten muss.
»Am vergangenen Donnerstagabend um 23.45 Uhr meldete sich Anneliese Müller, eine Patientin von Herrn Jürgen Schwärzler, über die 112 bei der Notrufzentrale und teilte mit, dass sie den Heilpraktiker leblos in seinem Arbeitszimmer in seinem Haus in Buchlangen, Dorfstraße 1, vorgefunden habe. Sie habe etwa eine Stunde zuvor mit ihm telefoniert und einen Notfalltermin aufgrund eines akuten Migräneschubs vereinbart. Der Notarzt war um 00.04 Uhr vor Ort, er konnte nur noch Herrn Schwärzlers Tod feststellen. Dieser war gewaltsam herbeigeführt worden. Der oder die Täter hatten Herrn Schwärzlers Kopf in eine mit Rapsöl gefüllte Wanne gedrückt. Der Tod trat laut rechtsmedizinischer Untersuchung durch Aspiration des Öls ein.«
Larissa blätterte kurz um, dann fuhr sie fort:
»Frau Müller gab an, dass ihr Mann sie um 23.40 Uhr vor Herrn Schwärzlers Praxis abgesetzt habe. Zuvor sei sie aufgrund der Migräne in ihrem Bett gewesen. Ich habe das Alibi überprüft, der Ehemann bestätigt diese Angaben. Der geschätzte Todeszeitpunkt liegt unter Berücksichtigung des Telefonates zwischen Herrn Schwärzler und Frau Müller und den Berechnungen der Forensik zwischen 22.45 und 23.30 Uhr, sodass die Patientin als potenzielle Täterin ausscheidet.«
»Wie lässt sich der Todeszeitpunkt so exakt schätzen?«, warf Fink ein.
»Der Notarzt hat umsichtigerweise gleich eine Messung der Körpertemperatur vorgenommen, anhand derer Dr. Hensler die Tatzeit sehr genau abschätzen konnte«, entgegnete Larissa souverän, ohne sich von Finks unfreundlichem Gesichtsausdruck abschrecken zu lassen.
»Im Arbeitszimmer des Opfers fanden sich keine Hinweise auf einen größeren Kampf. Und auch die Haustür weist keine Einbruchsspuren auf. Wir gehen daher davon aus, dass Herr Schwärzler den Täter nicht als Bedrohung empfand und ihn selbst in seine Wohnung ließ. Auf dem Teppich vor dem Schreibtisch fanden wir einen etwa zehn mal fünfzehn Zentimeter großen Blutfleck, ein paar Meter entfernt davon einen Gummihammer. Eine Platzwunde am Hinterkopf des Opfers deutet darauf hin, dass Herr Schwärzler vom Täter hinterrücks mit dem Hammer niedergeschlagen wurde, was möglicherweise zu einer Bewusstlosigkeit führte. Der Täter befüllte dann die Wanne mit insgesamt vierzehn Litern Rapsöl und fesselte Herrn Schwärzler die Hände mit Kabelbindern. Danach muss ihm der Täter den Kopf in die Flüssigkeit gedrückt haben, bis Herr Schwärzler schließlich ertrank.«
»Vierzehn Liter Rapsöl?«, fragte ich entgeistert. »Wie hat er die denn in Schwärzlers Wohnung geschafft?«
»Nun«, erwiderte Fink, »Vielleicht hatten Sie ja noch keine Gelegenheit, sich über Herrn Schwärzler zu informieren. Dieser bestritt einen großen Teil seines Lebensunterhaltes mit dem Verkauf von Rapsöl, dessen positive Wirkung auf die Gesundheit er in seiner Tätigkeit als Heilpraktiker massiv propagierte. Er hatte wahrscheinlich einen großen Vorrat in seiner Wohnung, aus dem der Täter sich bedienen konnte.«
Ich hätte Fink in diesem Augenblick am liebsten eine massiv zentriert. Was sollte das nun wieder? Und in welchem Ton er mir das hingeworfen hatte. »Massiv propagierte.« Hatte er etwa ein Fremdwörterlexikon gefrühstückt? An Arroganz war das jedenfalls kaum mehr zu überbieten. Mein Geysir begann sich zu regen, und das war so früh am Tag gar nicht gut.
»Wir haben zwei leere Kanister mit einem Fassungsvermögen von jeweils sieben Litern neben der Plastikwanne gefunden«, erklärte Larissa.
»Haben wir Fingerabdrücke?«, fragte Ralf.
»Hunderte, leider«, antwortete Larissa. »Die KT hat überall im Haus Fingerabdrücke gefunden, vor allem im Arbeitszimmer. Da war auch reger Kundenverkehr.«
»Wer könnte ein Motiv für den Mord haben?«, fragte Raimund, und Larissas Miene hellte sich deutlich auf.
»Nun«, erwiderte sie, »natürlich haben wir zuerst sein familiäres Umfeld überprüft. Schwärzler lebte seit einigen Monaten getrennt von seiner Frau. Diese hat jedoch ein Alibi, sie war zur Zeit des Mordes mit einer Freundin im Kino. Schwärzlers Eltern sind bereits seit Längerem verstorben, zu seiner in NRW lebenden Schwester besteht wohl seit Jahren kein Kontakt mehr.«
»Das klingt ja nicht gerade nach einer heißen Spur«, brummte Ralf.
Larissa nickte.
»Wenn man sich mit Schwärzler näher beschäftigt, finden sich jedoch zahlreiche Anknüpfungspunkte für mögliche Motive. Was ich bislang zu Herrn Schwärzler recherchieren konnte, lässt vermuten, dass er – um es positiv auszudrücken – stark polarisierte. Er hatte offenbar viele Anhänger, die sich insbesondere auf seiner Website euphorisch über seine Rapsöltherapie, aber auch über andere Steckenpferde von ihm, wie etwa die Kritik an der Schulmedizin, äußern.«
In meinem Kopf rastete eine Querverbindung ein.
»Gab es da nicht vor ein paar Jahren einen Skandal?«, fragte ich. »Wenn ich mich recht entsinne, hatte Schwärzler den Eltern eines kranken Kindes von einer Behandlung im Krankenhaus abgeraten, woraufhin das Kind schwere Schäden davontrug. Ging das nicht sogar vor Gericht?«
Larissa lächelte mir triumphierend zu.
»Genau. Schwärzler war in diesem Zusammenhang zu einer Geldstrafe wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden. Konkret ging es um ein damals neun Jahre altes Mädchen, bei dem er Anzeichen für eine Hirnhautentzündung übersehen hatte und das deshalb heute behindert ist.«
Ich schluckte. Das war hart.
»Nun, dann sollten wir die Eltern dieses Mädchens vielleicht einmal vorladen«, sagte Fink.
»Ich kümmere mich darum«, schlug Larissa vor, und Raimund nickte zustimmend.
»Welche Motive könnte es noch geben?«, fragte er in die Runde.
»Geld«, schlug ich vor.
Larissa nickte wieder eifrig.
»Das könnte tatsächlich ein Motiv sein. Herr Schwärzler verkaufte sein ,Spezielles Rapsöl‹ für neunundzwanzig Euro die Viertelliterflasche.«
»Neunundzwanzig?«, rief Ralf. »Im Discounter kostet eine Flasche vielleicht zwei Euro.«
»Eben«, entgegnete Larissa. »Die Gewinnspanne dürfte beträchtlich gewesen sein, selbst wenn es sich um Öl aus Bioproduktion handelte.«
»Dann sollten wir seine Zulieferer, aber auch mögliche Konkurrenten überprüfen«, merkte Markus an. In seinen Augen lag ein »Bitte, bitte, lasst mich das machen«-Ausdruck, den Raimund jedoch geflissentlich überging.
»Kümmerst du dich darum, Ralf?«
Er nickte, und Markus blickte widmete sich sichtlich enttäuscht seinen Fingernägeln.
»Gut, dann gehen wir wieder an die Arbeit«, sagte Raimund und erhob sich.
Wir taten es ihm nach und verließen den Besprechungsraum. Ich wollte mich gerade auf den Weg zu meinem Büro machen, als mich jemand am Ellenbogen zog. Ich blickte mich um und sah Fink hinter mir stehen.
»Sind Sie sich sicher, dass Sie alldem hier schon wieder gewachsen sind?«, fragte er. Dann nickte er mir zu und ging rasch davon. Ich blieb mit offenem Mund zurück. Das war derart unverschämt gewesen, dass mir die Worte fehlten.
09.30 Uhr
Ich rauchte vor Wut, als ich in mein Büro zurückkehrte. Vom Staatsanwalt blöd angemacht zu werden und dann noch dabei zuschauen zu müssen, wie Larissa und Ralf mit den interessanten Ermittlungsaufträgen abzogen, während ich eingezwängt hinter einem viel zu kleinen Schreibtisch Computerausdrucke durchgehen würde – so hatte ich mir meinen ersten Tag wahrlich nicht vorgestellt.
Markus schien meine schlechte Laune zu spüren, denn er folgte mir zaghaft und vorsichtig.
»Wollen wir den Tatort besichtigen?«, fragte er leise.
»Welchen Tatort?«, gab ich unwirsch zurück.
»Den … nun … in Unterfeigenbach. Die zweite Radarfalle«, stammelte er.
Ich starrte auf den schwarzen PC-Bildschirm auf meinem Schreibtisch. Eigentlich war das gar keine schlechte Idee. Besser, als bis zwölf Uhr hier rumzugammeln. Wer konnte schon sagen, wann die Daten vom Landratsamt eintreffen würden. Und ein wenig frische Luft würde mir sicher auch guttun.
»Einverstanden«, sagte ich und versuchte dabei, ein wenig versöhnlicher zu klingen. Ich schnappte mir meine Tasche und ging mit Markus hinaus auf den Parkplatz. Ich fragte gar nicht, mit welchem Auto wir fahren sollten, sondern öffnete einfach den Alfa mit der Fernbedienung und nahm auf der Fahrerseite Platz. Markus folgte mir wortlos.
Als ich den Motor startete, sprang das Radio an, und AC/DC dröhnten in voller Lautstärke aus den Boxen. Markus fuhr erschrocken zusammen, als Bon Scott sich durch »Highway to Hell« kreischte. Er warf mir einen verstörten Blick zu, woraufhin ich die Musik ein wenig leiser drehte. Dann setzte ich den Wagen auf die Straße und bog in Richtung Stadtzentrum ab. Wir fuhren schweigend dahin, und das war mir auch ganz recht so. In meinem Kopf tobten nach wie vor wilde, wütende Gedanken, und da ich wusste, dass ich mich nur schwer würde beherrschen können, wollte ich meinen Frust nicht an Markus auslassen.
Als wir kurz vor dem Stadtzentrum in die Umgehungsstraße einbogen, die nach Unterfeigenbach führte, traf mich mit einem Mal die Erkenntnis, dass ich ein derart starkes Gefühl der Wut schon lange nicht mehr empfunden hatte. Zuletzt war ich eher bedrückt gewesen, hatte viel darüber nachgegrübelt, was ich alles falsch gemacht hatte, und wenig Lust gehabt, mich zu irgendeiner Unternehmung aufzuraffen. Die Wut, die nun in mir kochte, empfand ich dagegen beinahe als belebend. Vielleicht sollte ich mich häufiger einmal so richtig aufregen?
Wir fuhren über den kleinen Hügel, der den Ortsteil Unterfeigenbach von der Kernstadt trennte. Als wir das Ortsschild passierten, klappte mir beinahe die Kinnlade herunter angesichts der Verwüstungen, die das Sprengen der Radarfalle an den Häusern in der Hauptstraße hinterlassen hatte. Etwa fünfzig Meter vor uns ragte ein einzelner, etwa zwei Meter hoher Stahlpfeiler auf, dessen oberes Ende zerfetzt und verrußt war wie ein explodiertes Kanonenrohr. Von der Messanlage, die einmal auf dem Pfosten montiert gewesen war, war nichts mehr zu sehen.
Dafür hatten die Grundstücke in der unmittelbaren Umgebung der Explosion einiges abbekommen. An einem guten Dutzend Häuser waren Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Teilweise war auch der Putz beschädigt worden. Scharfkantige Metallteile hatten sich hineingebohrt und an den Fassaden Muster hinterlassen, die ich bisher nur auf Bildern aus Bürgerkriegsgebieten gesehen hatte. Ein Zaun neben der Radarfalle war schwarz und verkohlt, offenbar hatte er Feuer gefangen.
Ich stellte den Wagen an den Straßenrand, und wir stiegen aus. Die Straße selbst und die Gehwege waren bereits geräumt worden. Die KTler hatten offenbar auch schon die Bruchstücke der Messanlage eingesammelt, denn außer einigen Kreidespuren auf der Hauptstraße und mehreren durchnummerierten Schildern in Vorgärten waren keine Metallteile mehr zu erkennen.
»Wo wohnt der Verletzte?«, fragte ich.
Markus deutete auf ein Haus auf der anderen Straßenseite und sagte:
»Es handelt sich um einen fünfundvierzigjährigen, verheirateten Mann namens Udo Mohr. Aktuell befindet er sich wohl noch im Krankenhaus.«
»Wollen wir seine Frau befragen, oder ist das schon geschehen?«, fragte ich.
Markus schüttelte den Kopf.
»Sie ist im Krankenwagen mit in die Klinik gefahren, ehe die Kollegen mit ihr sprechen konnten.«
Ich trat auf die Tür des Hauses zu. Das große Panoramafenster im Erdgeschoss, hinter dem sich wahrscheinlich das Wohnzimmer befand, war durch einen glücklichen Zufall von der Explosion verschont worden. Dafür waren im Obergeschoss die Scheiben aller drei Fenster gesprungen.
Ich klingelte. Nichts geschah, kein Geräusch war zu vernehmen.
»Wahrscheinlich ist sie noch immer im Krankenhaus bei ihrem Mann«, bemerkte Markus zaghaft.
Ich klingelte noch einmal. Wieder keine Reaktion. Ich seufzte.
»Und es gibt keine Zeugen?«, fragte ich.
Markus schüttelte den Kopf.
»In Unterfeigenbach sind um 23 Uhr die Bürgersteige schon längst hochgeklappt.«
Ein Gefühl der Verlorenheit brach sich Bahn in mein Bewusstsein. Da waren wir nun an einem bereits aufgeräumten Tatort ohne relevante Spuren und ohne Zeugen.
»Lass uns noch einmal Klingeln putzen«, sagte ich aus dem Impuls heraus, wenigstens irgendetwas Sinnvolles zu tun. Markus zuckte mit den Achseln, und so begannen wir, der Reihe nach an jeder Haustür zu klingeln und die mal mehr, mal weniger freundlichen Anwohner danach zu befragen, was sie kurz vor oder kurz nach dem Vorfall um 23 Uhr am Vorabend gehört oder gesehen haben mochten.
Danach war ich noch frustrierter. Keiner der vierzehn Männer und Frauen, die wir befragt hatten, hatte mehr von der Explosion mitbekommen als den gewaltigen Knall und das Chaos danach. Und niemand waren irgendwelche verdächtigen Personen aufgefallen, die in den Tagen zuvor die Radarfalle möglicherweise ausgekundschaftet haben könnten.
Seufzend ließ ich mich in den Fahrersitz zurücksinken und schloss die Tür meines Alfas. Markus setzte sich neben mich.
»Und nun?«, fragte er mutlos.
»Lass uns ins Krankenhaus fahren und der Vollständigkeit halber diesen Herrn Mohr befragen«, erwiderte ich und startete den Motor.
11.00 Uhr
Im Feigenbacher Klinikum herrschte reger Betrieb. Vor dem Haupteingang hatte sich ein recht umfangreicher Pulk von rauchenden Bademantelträgern versammelt. Ein Mann, den ich auf etwa siebzig Jahre schätzte, saß auf seinem Rollator. In seinem Arm steckte eine Infusionsnadel, und den entsprechenden Beutel führte er an einem Metallständer mit sich. Gierig zog er an seiner Zigarette, und als er meinen erschütterten Blick bemerkte, konterte er ihn grimmig. Ich wandte mich ab und klopfte mir virtuell auf die Schulter, um mich dafür zu loben, dass ich es inzwischen doch wieder geschafft hatte, dieses Laster abzulegen.
Vor dem Kiosk in der Eingangshalle hatte sich eine beachtliche Schlange gebildet, und überall wuselten Ärztinnen, Krankenpfleger, Angehörige und Patienten umher wie in einem Ameisenbau, auf den der Stiefel eines unaufmerksamen Wanderers getreten war. Ich ging zum Empfang, zeigte dem kahlköpfigen und ziemlich dicken Mann hinter der Scheibe meinen Dienstausweis und fragte nach Udo Mohr.
Der Pförtner wählte eine Nummer, wechselte ein paar Worte mit der Sprechmuschel, ehe er sich wieder mir zuwandte.
»Zimmer 113, erster Stock.«
Ich dankte ihm und wandte mich dem Treppenhaus zu. Markus folgte mir die für ein Krankenhaus dieser Größe erstaunlich enge Treppe hinauf in den ersten Stock. Auf der Glastür, die auf die Station führte, stand in roten Klebebuchstaben: »Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie«.
Ich spürte, wie mein Mund trocken wurde, während meine Kehle sich gleichzeitig verengte. Auf dieser Station war ich nach der Sache damals behandelt worden. Ich war nur kurz da gewesen und konnte mich auch nur verschwommen an den Aufenthalt zurückerinnern. Doch mein Körper schien ziemlich genau zu wissen, unter welchen Umständen ich zuletzt hier gewesen war. Ich wandte mich Markus zu. Sein Mund war schmal geworden, und er sog wiederholt seine Oberlippe hinter die Schneidezähne. Er hatte noch viel unschönere Erinnerungen an diesen Ort, an dem er vor einem Jahr notoperiert worden war.
»Alles okay?«, fragte ich.
Er nickte langsam.
»Lass uns reingehen!«
Ich atmete tief durch, öffnete die Tür und trat auf einen weiß getünchten Stationsflur. Auch hier war einiges los. Am anderen Ende des Ganges verschwand eine Traube weiß gekleideter Menschen gerade in einem Zimmer.
»Visite«, murmelte Markus.
Ich erspähte eine Krankenschwester, die gerade damit beschäftigt war, einen Wagen mit Handtüchern zu bestücken. Meinen Ausweis zückend, trat ich auf die junge Frau zu und fragte nach Zimmer 113.
»Sie wollet zu Herrn Mohr?«, fragte sie.
Ich nickte.
»Der ischt grad vor zwei Stunde aufgwacht«, erklärte sie. »Sei Frau ischt bei ihm.«
»War die OP schwierig?«, fragte Markus.
»Dr Bruch war wohl schon kompliziert. Aber des ischt ja heut kein Problem mehr«, erwiderte die Krankenschwester lächelnd.
Ich dankte ihr, und wir folgten der Richtung ihres ausgestreckten Armes, bis wir Zimmer 113 erreicht hatten. Nachdem ich an die Türe geklopft hatte, traten wir ein. Es war ein in Anbetracht der Umgebung recht freundlich eingerichtetes Zweibettzimmer. Das Bett an der Tür war leer. Die Laken waren jedoch zerwühlt. Offenbar war der zweite Patient gerade unterwegs. Ein Mann mittleren Alters lag in dem anderen Krankenhausbett vor dem Fenster, das den Blick auf den Park auf der Rückseite des Gebäudes freigab. Die Haut unter dem dichten schwarzen Vollbart des Mannes war kreidebleich, seine Augen geschlossen. Neben ihm saß eine kleine, blonde Frau auf einem Stuhl. Sie hielt seine Hand. Ihre Augen waren gerötet und von dunklen Ringen umrahmt.
»Frau Mohr?«, fragte ich.
Sie musterte mich misstrauisch, nickte dann aber.
»Inge Vill, Kriminalpolizei. Und das ist mein Kollege Herr Hübner.«
Ich deutete auf Markus.
»Wir ermitteln im Fall der Körperverletzung durch die Radarfalle.«
Nun schlug auch der Mann die Augen auf.
»Finden Sie das Schwein, das das getan hat«, zischte er, und seine Miene verkrampfte sich zu einer gequälten Grimasse.
Seine Frau drückte seine Hand und wischte ihm mit einem Tuch kleine Schweißperlen von der Stirn.
»Haben Sie starke Schmerzen?«, fragte ich, peinlich berührt davon, etwas so Offensichtliches anzusprechen.
Er atmete tief durch, dann antwortete er:
»Die Wirkung der Narkose lässt gerade nach. Ich werde gleich die Schwester rufen, damit sie mir etwas bringt.«
Er drückte auf den roten Knopf einer Klingelschnur, die vom Galgen seines Bettes herabhing.
»Mein Mann wurde drei Stunden lang operiert. Er hat sechs Schrauben in seinem Bein«, sagte Frau Mohr schluchzend und fügte nach einer kleinen Pause hinzu: »Wer macht so etwas?«
»Das wollen wir herausfinden«, erwiderte ich.
Ich wandte mich Herrn Mohr zu:
»Wie haben Sie denn die Explosion erlebt?«
Er schloss kurz die Augen, und auf seiner Stirn bildeten sich erneut kleine Schweißtröpfchen, die seine Frau umgehend abwischte.
»Ich …«, begann er zögernd, »ich habe geschlafen. Wir sind so gegen zehn ins Bett gegangen, nach dem ›Tatort‹.«
»Haben Sie irgendetwas Verdächtiges gesehen oder gehört, ehe Sie schlafen gegangen sind?«, fragte Markus.
Er schüttelte den Kopf.
»Ich habe nicht mehr aus dem Fenster geschaut und bin auch sehr rasch eingeschlafen.«
»Wodurch sind Sie aufgewacht?«, fragte ich.
Wieder bildeten sich kleine Schweißtropfen auf seiner Stirn, wieder wischte Frau Mohr sie sofort weg.
»Es war ein dumpfer Schlag gegen mein Bein«, murmelte er. »Und dann …«
In seinen Augenwinkeln sammelten sich Tränen.
»Dann kam der Schmerz.«
Er schloss die Augen, und dicke Tropfen rannen seine Wangen hinab, um schließlich im dichten schwarzen Gestrüpp seines Vollbartes zu versickern.
»Sie haben also den Explosionsknall gar nicht gehört?«, fragte ich erstaunt.
Er schüttelte den Kopf. Ich wandte mich seiner Frau zu.
»Und Sie?«
»Ich habe einen sehr tiefen Schlaf«, erwiderte sie leise. »Wach geworden bin ich, als mein Mann laut geschrien hat. Es war so schrecklich.«
Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen und begann hemmungslos zu weinen.
Ich tauschte einen resignierten Blick mit Markus. Unser Besuch im Krankenhaus war wohl vergebens gewesen, wenn man einmal davon absah, dass Herr Mohr sich später nicht darüber beklagen konnte, dass er nicht in die Ermittlungen einbezogen worden sei.
»Haben Sie nach der Explosion etwas Verdächtiges auf der Straße gehört oder gesehen? Vielleicht jemanden, der sich rasch entfernt hat?«, fragte Markus in dem vergeblichen Versuch, an weitere Informationen zu gelangen.
Frau Mohr hob den Kopf wieder und starrte uns fassungslos an.
»Glauben Sie im Ernst, ich hätte noch einen Gedanken darauf verschwendet, was sich draußen abspielte?«, rief sie und vergrub erneut das Gesicht in den Händen.
Markus wollte etwas erwidern, doch ich winkte ihm zu, es sein zu lassen. Die beiden standen eindeutig noch zu sehr unter dem unmittelbaren Eindruck der Erlebnisse, als dass wir sie weiterhin mit aus ihrer Sicht belanglosen Fragen hätten traktieren können.
Wir verabschiedeten uns und wandten uns zum Gehen. Ich hatte schon den Türgriff in der Hand, als sich mir doch noch eine Frage aufdrängte. Ich wandte mich um und fragte:
»Warum waren denn die Rollläden nicht geschlossen?«
Herr Mohr drehte seinen bleichen Kopf in meine Richtung und antwortete mit müder Stimme:
»Wir lassen uns im Sommer gerne von der Sonne wecken. Den Rollladen lassen wir eigentlich nur im Winter herab. Um Heizkosten zu sparen.«
Ich nickte und verabschiedete mich noch einmal. Ich wollte gerade wieder nach der Klinke greifen, als sich die Türe einen Spaltbreit öffnete. Ein alter Mann zwängte sich mühsam durch die Öffnung. Eine Hand ruhte auf einem Rollator, die andere schob einen Metallständer mit einem Infusionsbeutel. Es war der Raucher vom Eingangsbereich, und er starrte mich feindselig an, als er mich erkannte.
»So stehet Se doch it rom und gucket blöd aus der Wäsch. Helfet Se mir halt, Hergottnomal!«, krächzte er.
Markus griff sofort nach der Türe, die bereits wieder am Zufallen war, und vergrößerte die Öffnung. Nachdem ich mich gefasst hatte, nahm ich den Infusionsständer und schob ihn neben dem alten Mann her, der nun mit beiden Händen am Rollator die letzten Schritte bis zu seinem Bett deutlich rascher zurücklegte. Er zog eine widerliche Wolke aus abgestandenem Zigarettenrauch und eine unzweifelhafte Alkoholfahne hinter sich her, und ich war froh, als ich endlich den Ständer neben dem Bett abgestellt und mich ein drittes Mal verabschiedet hatte.
Markus wartete draußen.
»Der hat Nerven«, flüsterte er mir zu.
Ich verdrehte die Augen. Mein Magen knurrte vernehmlich.
»Lass uns was essen gehen«, schlug ich vor.
Markus schaute auf seine Uhr. Es war halb zwölf. Kurz befürchtete ich, er könnte vielleicht zu einer Moralpredigt ansetzen und mir vorhalten, dass ich noch eine halbe Stunde arbeiten müsse, aber wenn er das vorgehabt haben sollte, dann schluckte er seine Worte gekonnt herunter. Doch selbst wenn er etwas gesagt hätte – es war mir gleichgültig. Ich hatte für heute erst einmal genug gearbeitet.
11:30 Uhr
Wir verließen das Krankenhaus durch den Haupteingang und gingen zu dem Parkhaus mit den schrägen Stellflächen, bei denen sich das Aussteigen manchmal so anfühlte, als stünde man auf den Planken eines schwankenden Schiffes. Ich lenkte meinen Alfa in rasantem Tempo die drei Ebenen hinunter bis zur Schranke, und nachdem ich diese hinter mir gelassen hatte, bog ich nach rechts in Richtung Altstadt ab.
»Hast du schon eine Plakette gekauft?«, fragte Markus, als wir in den großen Parkplatz hinter der Stadtmauer einbogen.
Ich verzog das Gesicht. An das bescheuerte Stadtbergfest hatte ich ja gar nicht mehr gedacht. Zehn Tage Ausnahmezustand in Feigenbach. Die gesamte Innenstadt war zur Partyzone erklärt worden, und das Festkomitee erhob an den Zugängen einen Obolus von vier Euro. Dafür bekam man dann eine kleine Plakette, die jedes Jahr wieder neu gestaltet wurde.
»Nein«, erwiderte ich. »Ich habe einen Dienstausweis, das muss reichen.«
Ich konnte spüren, wie der Ordnungsfanatiker in Markus zusammenzuckte. Dass jemand die Stadt ohne Plakette betrat, widersprach so ziemlich allem, was ihm heilig war.
Ich stellte den Wagen ab, und wir gingen auf das mittelalterliche Stadttor zu. Im Schatten des Torbogens war ein Tisch aufgestellt worden, an dem drei Mitglieder des Festkomitees den Obolus von vier Euro einforderten. Einer der drei war Hansjörg Maurer. Mit ihm war ich in die Grundschule gegangen. Er erkannte mich gleich. Breit grinsend rief er:
»Na, Inge, hascht du schon deine Plakette?«
Ich zückte meinen Dienstausweis, sagte: »Ja, seit neun Jahren«, und ging, ohne meine Schritte zu verlangsamen, durch das Tor. Beinahe hätte ich erwartet, dass mir Hansjörg etwas nachrufen würde, doch stattdessen hörte ich nur die Stimme meines Kollegen:
»Schauen Sie, Herr Maurer, ich habe meine Plakette schon am Freitagabend gekauft.«
Schleimer.
Markus holte mich nach wenigen Schritten ein.
»Das war aber nicht nett«, zischte er mir zu.
Ja, da hatte er recht. Nett war das nicht gewesen. Aber nett wollte ich in diesem Augenblick auch gar nicht sein. Eine seltsame Gefühlsmischung brodelte in meinem Innern wie ein Chili con Carne kurz vor dem Anbrennen. Meine Wut auf Fink und seine dämlichen Kommentare war zwar inzwischen ein wenig abgekühlt. Dafür hatte sich die Frustration über unsere mageren Ermittlungsfortschritte in meiner Magengrube breitgemacht. Doch auch ein anderes Gefühl regte sich dort, ein Gefühl, das ich nach wie vor am liebsten in den hintersten Winkel meines Seins verbannt hätte.
Heute Morgen auf der Dienststelle und auch vorhin im Krankenhaus hatte ich die Angst in mir aufsteigen gespürt, als sich die altbekannte, eiserne Faust um meine Kehle gelegt hatte. Nun war sie wieder da, lauerte darauf zuzuschlagen wie ein Gepard, der sich durch das Unterholz der Serengeti an eine arglose Herde von Gnus heranpirscht. Ich hatte die Stadt das letzte Jahr über gemieden, so gut es ging. Schon der Gedanke an Ansammlungen von mehr als drei Menschen, die ich nicht kannte, trieb mir Schweißtropfen auf die Stirn. Das Stadtbergfest fiel diesbezüglich nun in die Kategorie »furchtbar große Horrorshow«.
Doch an diesem Montagmittag war alles ruhig. Die Tribünen auf dem Marktplatz, wo morgen die mittelalterliche Modenschau stattfinden und am Freitag der Kinderumzug enden sollte, waren nur spärlich mit Leuten besetzt, die mit Eistüten oder Leberkäswecken in der Hand in der Sonne saßen und ihre Mittagspause genossen. Ich atmete tief durch und steuerte auf den türkischen Imbiss neben der Stadtpfarrkirche zu.
Der vertraute Duft nach gebratenem Fleisch, Zwiebeln und saurer Joghurtsauce stieg mir in die Nase und beruhigte mich ein wenig. Ich bestellte einen Döner mit Käse, Markus die vegetarische Variante. Kurz darauf machten wir uns, mit zwei ziemlich warmen Alupäckchen bewaffnet, auf die Suche nach einem Sitzplatz.
»Setzen wir uns doch auf die Tribüne«, schlug Markus vor.
Ich wollte schon ablehnen. Nachdem ich die Innenstadt beinahe ein Jahr lang gemieden hatte, wollte ich mich jetzt nicht unbedingt an einem so exponierten Punkt wie der Tribüne niederlassen, sichtbar für jedermann. Aber Markus war schon unterwegs, und so beschloss ich, mir einen Ruck zu geben.
Die Holzbänke der obersten Sitzreihe, in der wir es uns schließlich bequem machten, waren herrlich warm. Die Sonne schien freundlich, aber nicht zu kräftig, und als schließlich der Geschmack des ersten Bissens in meinem Mund explodierte, entspannte ich mich ein wenig.
Wir saßen eine Weile lang schweigend und kauend da, bis Markus schließlich das Wort ergriff:
»Was hältst du von der Radarfallensache?«
Ich schluckte hinunter, was ich gerade im Mund hatte, und antwortete wahrheitsgemäß:
»Hm, ich bin mir noch unsicher. Der erste Anschlag riecht nach gewöhnlichem Vandalismus, aber der zweite …«
Markus nickte.
»Das war nicht nur eine Stufe härter«, ergänzte er.
Warum hatte der Täter die zweite Radarfalle mit einer solchen Gewalt in die Luft sprengen müssen, dass es gleich einen Verletzten gab? Dieser Gedanke wollte mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gehen, seitdem ich die Verwüstungen in der Unterfeigenbacher Hauptstraße gesehen hatte.
»Mir kommt es so vor, als ob der Attentäter nicht so ganz wüsste, was er macht«, fügte Markus in nachdenklichem Ton hinzu. »Der zweite Anschlag war viel riskanter als der erste.«
Ich wollte ihm recht geben, doch mein Bauchgefühl meldete sich. War der Täter beim zweiten Mal tatsächlich ein höheres Risiko eingegangen war als beim ersten Mal?
Ich schüttelte den Kopf.
»Nein, das glaube ich nicht.«
Markus schaute mich aufmerksam an, als ich fortfuhr:
»Der erste Anschlag muss mehr Zeit in Anspruch genommen haben und auch deutlich lauter gewesen sein«, erklärte ich.
Seine Stirn legte sich in Falten, doch dann nickte er eifrig.
»Stimmt, beim ersten Mal musste er die Scheiben einschlagen und das Benzin hineingießen. Beim zweiten Mal reichte es, die Sprengladung anzubringen und sie dann zu zünden, eventuell sogar per Fernsteuerung. Der Täter wird effizienter«, erwiderte er.
»Wir müssen mehr über die Art des verwendeten Sprengstoffs erfahren«, murmelte ich.
»Ich werde mich heute Nachmittag mit der KT in Verbindung setzen«, entgegnete Markus.
Ich spürte einen Stich in meiner Magengrube. Markus würde jetzt wieder arbeiten gehen. Und ich? Ich würde nach Hause fahren und die Zeit bis morgen irgendwie totschlagen.
»Mach das«, entgegnete ich knapp.
Wir schwiegen wieder und aßen die Reste unseres Döners. Währenddessen beschäftigten sich meine Gedanken seltsamerweise mit dem zweiten Fall, dem Fall, der mir – wie ich es empfand – vorenthalten wurde, dem Fall des ermordeten Heilpraktikers. Welches Motiv konnte ein Täter haben, der sein Opfer in Rapsöl ertränkte? Es gab sicher effektivere Tötungsarten. Aber um Effektivität war es dem Mörder sicher nicht gegangen, viel mehr dagegen um die Symbolkraft seiner Tat.
»Warum Rapsöl?«, murmelte ich leise vor mich hin, die Frage eher an mich als an Markus richtend.
Er zuckte mit den Schultern und erwiderte:
»Nicht unser Fall.«
Ich verzog das Gesicht.
»Na ja, immerhin werden wir bei den Besprechungen nach unserer Meinung gefragt«, gab ich ein wenig zu scharf zurück.
»Ja, du hast ja recht, Inge.«
Markus seufzte und knüllte die Papierserviette in die Alufolie, die er dann feinsäuberlich zu einem kleinen Quadrat zusammenfaltete.
»Wer könnte den Heilpraktiker umgebracht haben? Und warum?«, fragte ich.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.