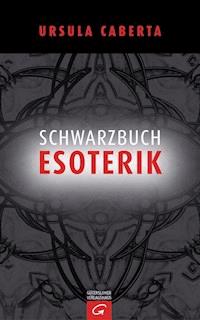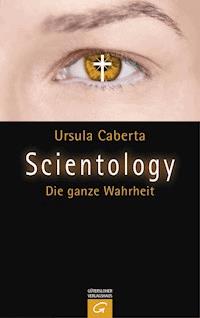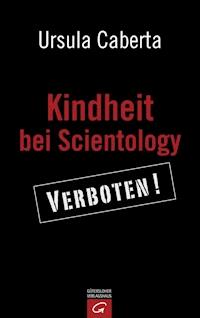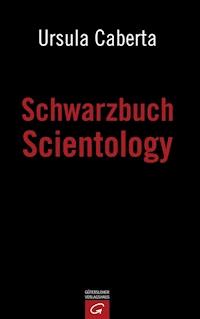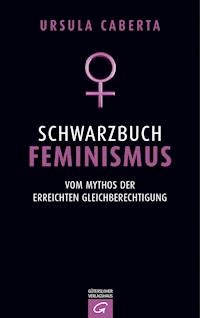
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mogelpackung Feminismus? Was haben Alice & Co. wirklich erreicht?
Leben wir heute in einer Gesellschaft, in der Mann und Frau gleichberechtigt sind? Ganz klar: Nein! Wir haben zwar eine Kanzlerin, Frauen erhalten selbstverständlich eine Berufsausbildung, stellen die Mehrzahl der Studierenden. Aber in den Führungsetagen der Wirtschaft sind sie kaum zu finden, verdienen bei gleicher Qualifikation weniger als ihre männlichen Kollegen und haben schwer an der Doppelbelastung durch Familie und Beruf zu tragen. Ursula Caberta unterzieht die Erfolge von Alice Schwarzer & Co. einer kritischen Analyse – mit entlarvendem Ergebnis. Mit scharfer Feder zeichnet sie ein schonungsloses Bild der aktuellen Situation von Frauen in unserer postmodernen Gesellschaft. Herausfordernd fragt sie: Wo bitte bleibt die »moderne« Feministin?
- Auf der vergeblichen Suche nach den Erfolgen des Feminismus
- Gescheiterte Heldinnen – eine schonungslose Analyse der Frauenbewegung
- Die große Illusion der Gleichberechtigung – bissig entlarvt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der Alltag in der Bundesrepublik Deutschland findet für die große Mehrheit der Menschen höchstwahrscheinlich in dem Bewusstsein statt, dass wir in einem Land leben, in dem die weibliche Bevölkerung im Gegensatz zu vielen anderen Ländern dieser Welt einen besonders hohen Status hat. Im Grundgesetz ist verankert, dass es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen geben darf. In der öffentlichen Diskussion findet dieses gesellschaftlich relevante Thema kaum noch statt. Jedenfalls nicht mit dem Tenor, es müsse sich für die Frauen etwas ändern oder die Situation der Frauen in Deutschland sei noch ein Problem. Die Konsequenz daraus ist, dass auch der Begriff Feminismus nicht die Schlagzeilen beherrscht.
Und doch: Hin und wieder schleicht sich die »Frauendebatte« in die Berichterstattung ein. So wurde zum Beispiel 2006 in der Wochenzeitschrift Die Zeit in einem Dossier die Forderung erhoben: »Wir brauchen einen neuen Feminismus!«1 Und im Folgejahr widmete Der Spiegel dem Thema sogar eine Titelgeschichte: Feminismus: Das wahre Geschlecht.2
Obgleich es nicht die großen Headline-Geschichten sind, die Diskussion ist seit einiger Zeit wieder zart entfacht. Es wird von einer neuen Feminismusdebatte gesprochen und geschrieben. Selbst in den politisch konservativen Ecken dieser Republik ist das Wort mit dem großen F kein Tabu mehr.
Nicht ganz unschuldig an der flauen Diskussionsbrise ist die deutsche Dauerfeministin Alice Schwarzer. Diese stellte im Jahr 2007 fest, dass die Bewegung des Feminismus in Deutschland an Boden gewonnen habe: Für Alice Schwarzer sind Ursula von der Leyen und Angela Merkel Belege dafür, dass der Feminismus inzwischen dort angekommen ist, wo er auch hingehört: in der Mitte der Gesellschaft.3
Mit dieser die »Frauen-« oder »Feminismusdebatte« sehr einschränkenden Aussage hat sie scheinbar immerhin einige wache Geister auf den Plan gerufen. Denn wenn die Ikone der Gleichberechtigungsfragen solche Aussagen von sich gibt, ist es vielleicht an der Zeit, die aktuelle Situation der Frauen doch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Wenn nach Frau Schwarzer eine Regierungschefin und eine Ministerin – die anderen Ministerinnen im Kabinett Merkel scheinen den Feminismusbegriff nicht zu rechtfertigen – die Merkmale für aktiven Feminismus im Zentrum der Gesellschaft bedeuten, haben wir ja in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit grundlegende feministische Lebensformen. Endlich leben die Frauen in Deutschland unter der Schirmherr- oder besser -frauschaft und erleben gleichberechtigte Zeiten. Unsere lieben Freundinnen, die Engländerinnen, dürfen diese sogar schon länger genießen. Schließlich war in Großbritannien mit Margret Thatcher bereits von 1979 bis 1990 eine Frau Premierministerin – glückliches feministisches Großbritannien. Endlich, endlich ist – nach der Definition von Alice Schwarzer – mit Kanzlerin Merkel nun auch Deutschland ein feministisches Frauenwunderland geworden.
Eine fragwürdige Position, doch dazu später mehr.
Irritationen treten auch dadurch auf, dass eine neue Debatte angesprochen wird. Ein neuer Feminismus soll diskutiert werden. Doch was soll eigentlich der Unterschied, die große Neuerung sein? Blickt man in die Vergangenheit der Frauendiskussion, keimt eher der gegenteilige Verdacht auf: Vieles, was schon einmal fest etabliert war in der Diskussion um die Frauen in der Gesellschaft, scheint vergessen worden zu sein. Vieles, was in früheren Zeiten mühsam differenziert wurde, wird plötzlich wieder zusammengeworfen. Also wird es wohl Zeit, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, die alten Kämpfe in Erinnerung zu rufen und den Neuinterpreten der Frauenfrage (Frauen und Männern) nicht die Chance zu geben, die Frauen erneut gegeneinander auszuspielen.
Neu ist an der Debatte so gut wie gar nichts. Vielmehr finden sich einige Dauerbrenner wieder im Einsatz wie beispielsweise die Quote! Frauen per Quote an die Spitzen der Macht in Politik, Wirtschaft und Medien – so die Forderung. Wie immer bei dieser Diskussion findet die Reflexion, wie denn die Frauen in Deutschland davon profitieren, wenn Frauen nur aus Prozentsatz-Gründen hohe Positionen einnehmen, nicht statt. Frau Merkel ist doch wohl ohne Quote Kanzlerin geworden, aber gut, dazu kommen wir noch.
Da liest man, dass die Generalsekretärin der SPD – Frau Nahles – davon ausgeht, dass sie dieses Amt niemals erreicht hätte, wenn es in der SPD nicht seit einiger Zeit eine Quotenregelung gäbe. Abgesehen davon, dass es nicht die Funktion von Frau Nahles war, die Frau Schwarzer dazu bewogen hat, den Feminismus in Deutschland auszurufen, ist auch sonst nicht wirklich erkennbar, dass sich durch die Tätigkeit von Frau Nahles in herausgehobener Stellung etwas für die Frauen verändert hätte. Also: Auch die Frauenpolitik wirft Fragen auf.
Genereller Tenor ist jedoch, dass für die Frauen ja so unglaublich viel erreicht wurde. So viel, dass inzwischen – und das schon seit längerer Zeit – sogar schon erste arme Männer nach Gleichberechtigung rufen. Männer, die sich diskriminiert und von Frauen ausgebootet fühlen und daher fordern, dass endlich wieder etwas für ihre Artgenossen getan werden müsse. Ja, die Männer haben es zunehmend schwer heutzutage: Sie entfernen sich die Körperhaare, um (angeblich) attraktiver zu sein. Sie streben Idealmaße an. Und passend zum Waschbrettbauch wird für das perfekte Erscheinungsbild auch schon einmal das Hinterteil geliftet – wegen des angeblich für Frauen so attraktiven Knackpos. Die so genannten Schönheitschirurgen verzeichnen stetig mehr Zulauf von Männern, die sich ihre Falten wegspritzen lassen. Was für die Frauen die Brustvergrößerung oder -verkleinerung ist, ist beim Mann die Penisverlängerung. Sexuelle Merkmale des Körpers per Operation verbessern zu lassen, gerät ohne Frage bei den Männern immer mehr in Mode. Parallel dazu ist ein weiteres Merkmal des Körperwahns in der Männerwelt angekommen: die Gefahr von Magersucht. Applaus also für die Erfolge der Frauenbewegung. Die von Gegnern der Frauenemanzipation beschworene Gefahr der Gleichmacherei der Geschlechter hat im Hinblick auf den Schönheitswahn eine gewisse Bestätigung gefunden.
Das vergangene erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts ist in einer Diskussion angekommen, die die alten Auseinandersetzungen wiederbelebt. Allerdings werden die geforderten Rechte nur für bestimmte Frauen angestrebt. Die Mehrheit der Frauen kann zusehen, wo sie bleibt … Am besten wohl da, wo der Staat und vor allem die Kirche in alter patriarchalischer Tradition sie schon immer am besten untergebracht sahen: am Herd, beschäftigt mit Kindererziehung, dankbar betend für ihre Existenz. Ausdruck dieser Entwicklung ist unter anderem die inzwischen in Deutschland quasi zum Leitsatz erhobene Redewendung »Hinter einem erfolgreichen Mann steht immer eine starke Frau«. Stark dürfen, nein, müssen sie sein, zum Wohle des Mannes, der Familie und der Gesellschaft. Ohne Frage bewegt sich für die überwiegende Mehrheit der Frauen das Rad der Geschichte zurück. Leider sind sie daran nicht selten sogar selbst beteiligt – weil sie entweder nicht erkennen oder das Wissen ignorieren, was ihr Handeln für andere Frauen bedeutet. Weil sie sich aufgrund ihres politischen oder beruflichen Erfolges als emanzipierte Wesen empfinden. Oder weil sie anderen Frauen schaden. Die Männer können sich einstweilen gelassen zurücklehnen, denn Alice Schwarzer hat es ihnen leicht gemacht, sich aus der Verantwortung zu stehlen, wenn wieder einmal Kritik an der gesellschaftlichen Entwicklung auftaucht. Ein kleines Zitat der Feministin per se und sie sind aus dem Schneider.
Die so genannte neue Diskussion dreht sich um die alten Fragen: Wann und für was sind Frauen in der Gesellschaft einsetzbar und in welcher Rolle? Die ökonomische Komponente spielt dabei gleichermaßen wie in den letzten Jahrhunderten eine entscheidende Rolle. Ebenso die Frage: Welche Frauen profitieren von welcher ökonomischen Situation? Sind die Möglichkeiten für alle Frauen inzwischen gleich? Die Antwort ist eindeutig »Nein«.
Es wird Zeit für einen Aufbruch im neuen Jahrhundert! Zwar brauchen wir keinen neuen Feminismus, aber die klaren Forderungen nach Gleichstellung beider Geschlechter sowie nach gleichen Möglichkeiten für alle Frauen müssen wiederbelebt werden.
Feminismus – mehr als nur ein Wort
»Ich glaube fast, um sich zu emanzipieren, braucht man Wut, vielleicht auch ein wenig Hass.«
Margarete Mitscherlich
Wenn wir von Feminismus sprechen, worüber reden wir dann eigentlich genau? Unbestreitbar ist die Erkenntnis, dass Feminismus etwas mit Frauen zu tun hat. Schließlich leitet sich das Wort vom lateinischen Wortstamm femina (Frau) ab. Dann aber wird es schon schwierig. Die Definitionen sind je nach Sichtweise des Betrachters oder der Betrachterin unterschiedlich und bisweilen unklar. Vermengt wird der Begriff gerne mit anderen Auffassungen und Vorgängen, die allerdings nicht immer die Wortwahl Feminismus rechtfertigen. So zum Beispiel das in der jüngeren Zeit in der politischen »Frauendiskussion« häufig auftauchende Wort der »Gender«-Politik. Spätestens hier kann man/frau sich vom Feminismus verabschieden. Doch dazu später.
Feminismus – was ist das denn nun? Eine bestimmte Richtung der Frauenbewegung, die um die Gleichberechtigung der Frauen in der Gesellschaft ringt, oder – schon etwas radikaler – eine Ideologie, die danach strebt, die gesellschaftliche Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen zu verändern? Oder eine politische Richtung, die in der Gesellschaft die weibliche Vorherrschaft einführen will und damit der Männerherrschaft den Kampf ansagt: Nieder mit dem Patriarchat!
Auch die Frauen waren und sind sich bis heute nicht einig, welche dieser Bestrebungen tatsächlich die Zielsetzung des Feminismus sein soll. Unbestritten ist, dass die Diskussionen um feministische Ansätze – wie radikal oder soft auch immer – sich auf grundsätzliche Veränderungen in einer Gesellschaft beziehen. Die Grundidee hierzu geht auf Charles Fourier zurück, der bereits im 18. Jahrhundert den sozialen Fortschritt in einer Gesellschaft mit dem Begriff Feminismus und damit mit den Frauen verbunden hat. Der französische (Sozial-)Philosoph tat der Welt kund, dass eine soziale Freiheit dann erfolge, wenn Fortschritte in der Befreiung der Frau zu verzeichnen seien. Herr Fourier lebte von 1772–1837 – ein Kind der französischen Revolution also – und gilt als früher Sozialist. Nicht nur, weil er von der Befreiung der Frau als Ansatz für gesellschaftliche Veränderungen schrieb, sondern weil er eine grundsätzliche Position gegen Unterdrückung vertrat und schon damals formulierte, dass Menschen für ihre persönliche Freiheit einstehen sollten. Auch die sexuelle Freiheit war bei ihm Thema, da er diese als Bedingung für eine generelle soziale Gleichstellung betrachtete. Ihm hat die Welt es zu verdanken, dass bis heute die Befreiung der Frau in einer Gesellschaft als fortschrittliches Bestreben angesehen wird. Wann immer es darzustellen gilt, dass die notwendigen Änderungen in einer Gesellschaft mit der Stellung der Frau korrelieren, werden die Erkenntnisse des Herrn Fourier herangezogen. Er hatte den revolutionären Zeitgeist verinnerlicht und weiterverbreitet.
Die französische Nationalversammlung hatte am 26. August 1789 die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte proklamiert. Diese beginnt mit dem Satz: »Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander gleich.« Den Frauen brachte diese Klausel jedoch zunächst keine Vorteile, da die Kategorie Mensch erst einmal nur für das männliche Wesen galt, folglich also nur diesen die Menschen-und Bürgerrechte zugesprochen wurden. Als entscheidende Kraft für eine Reformierung dieser Ideologie und damit stellvertretend für viele Revolutionärinnen der damaligen Zeit wird zu Recht die Philosophin und Schriftstellerin Olympe de Gouges genannt. Sie hat im Jahr 1791 mit ihrer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin dafür gesorgt, dass das Wort Mensch zukünftig nicht mehr mit dem Wort Mann gleichgesetzt wurde. Ihrer radikalen Forderung nach völliger Gleichstellung der Geschlechter haben Frauen es zu verdanken, dass sie seither als etwas Menschliches angesehen werden. Ihre Begründung war so einfach wie klar: »Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen; sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Tribüne zu besteigen.«4
Aus dieser Zeit stammen auch andere bis heute wirkende Grundlagen zur Diskussion über Frauen und Männer und deren Verhalten zueinander. So hat etwa die Beschäftigung mit einem der grundlegenden Bedürfnisse der Menschen – weiblich wie männlich –, der Sexualität, in der damaligen Zeit grundsätzliche Reformen erfahren. Insbesondere für Herrn Fourier galt Sexualität als notwendiger Akt zur Entstehung von Harmonie. Da die Revolution im damaligen Frankreich zu den einflussreichsten Zeiten der europäischen Geschichte gehört und dazu natürlich die Schriften von Fourier, kann es nicht verwundern, dass auch in den bewegten Zeiten der 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts auf seine Thesen zurückgegriffen wurde. Inwiefern das allerdings zum Wohle der Frau und zu deren Selbstbestimmung, auch der sexuellen, geführt hat, ist sehr fragwürdig.
Wie bei allen Ideologien kann sich jeder etwas herauspicken, und dies muss nicht immer im Sinne des Erfinders sein. So gibt es natürlich auch kriminelle Auswüchse basierend auf der so genannten sexuellen Revolution. Hier ein erstes kleines Beispiel: Dem Gründer der Aktionsanalytischen Organisation (AAO), Otto Muehl, der u. a. wegen Unzucht mit Minderjährigen Anfang der 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts in Österreich zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde, wird zugeschrieben, dass er sich zur Begründung seiner strafwürdigen sexuellen Aktivitäten auch auf Charles Fourier und seine Schriften bezogen haben soll.
Unbestreitbar hat Fourier jedoch eine Entwicklung mit eingeleitet, die bis heute nicht beendet ist. Fourier ist der Vater des Begriffs Feminismus. Er beschäftigte sich intensiv mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau. In seinem Werk Aus der Neuen Liebeswelt schrieb er etwa 1820: »Die Harmonie entsteht nicht, wenn wir die Dummheit begehen, die Frauen auf Küche und Kochtopf zu beschränken. Die Natur hat beide Geschlechter gleichermaßen mit der Fähigkeit zu Wissenschaft und Kunst ausgestattet.«
Für so klare Worte zur gesellschaftlichen Gleichstellung der Frau wäre man/frau heute manchmal dankbar.
Da der Feminismusbegriff dank Herrn Fourier und den revolutionären Frauen in der sozialistischen ideologischen Ecke zu verorten ist und sich daraus diverse Forderungen zur Änderung der gesellschaftlichen Situation (mal etwas sozialistischer, mal etwas sozialdemokratischer) entwickelt haben, verwundert es nicht, dass sich die Hüter der angeblich von Gott gewollten Ordnung bis heute kritisch mit dem Feminismus – und was sie darunter verstehen – auseinandersetzen. Die Kritik ist mal schärfer, mal weniger zugespitzt. In jedem Fall wird den Feministinnen pauschal etwas Antichristliches unterstellt, aber auch ein paar Unterschiede sind bei den beiden großen christlichen Konfessionen erkennbar: »Die (evangelische, d. Verf.) Kirche war nie ein Ort der Emanzipation. Das Thema Frauenordination war auf dem Kirchentag erst ein Thema, als es schon längst durchgesetzt war in den Landeskirchen.«5
Diese Aussage stammt von der im Jahr 2009 amtierenden Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentages, Ellen Ueberschär. Und es geht weiter: Auf die Frage der taz: »Gleichberechtigung in der Kirche ist nur noch eine Frage der Zeit?«, antwortet die Generalsekretärin: »Wir stehen kurz davor. Trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt eine gewisse Stagnation. (…) Die älteren Feministinnen stoßen an eine Grenze, sie haben ganz viel erreicht, finden aber keine Nachfolgerinnen. Die Generation der Dreißigjährigen, die interessiert der Kampf der Siebzigerjahre nicht mehr, die empfinden die feministische Theologie als Karrierehemmnis, auch in der Kirche.«6
Feministische Theologie – was darunter zu verstehen ist, kann man/frau bei den Evangelischen Frauen in Deutschland e. V. nachlesen: »Feministische Theologie ist eine kontextuelle Theologie, sie bezieht also gesellschaftliche, soziale, politische und zeitgeschichtliche Gegebenheiten in ihre Sichtweisen ein. Sie ist im Sinne der Frauenemanzipation eine parteiische Theologie und entstand aus der Kritik an der Dominanz männlicher Gottesbilder im gesellschaftlichreligiösen Bewusstsein, das weiblich geprägte Gottesbilder verdrängt und auf patriarchalischen Gesellschaftsverhältnissen beruht.«7
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
1. Auflage, 2012
Copyright © 2012 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlagmotiv: © Silberblatt – Fotolia.com
eISBN 978-3-641-08320-5
www.gtvh.de
www.randomhouse.de
Leseprobe
Die Zeit, 24.08.2006, Nr. 35.
Der Spiegel, 24.07.2007. Nr. 30/2007.
Elisabeth Klaus: Antifeminismus und Elitefeminismus – Eine Intervention, S. 180.
Jutta Menschik (Hrsg.): Grundlagentexte zur Emanzipation der Frau, 1977, S. 13.
taz, 03.06.2011.
Ebd.
www.evangelischefrauen-deutschland.de.