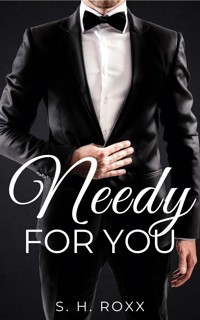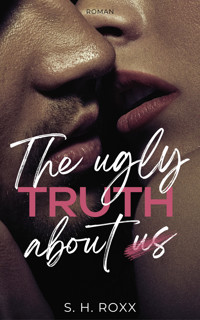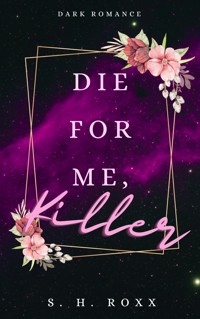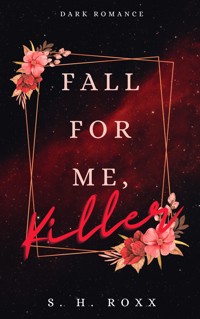3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Florence: Ich habe einen Fehler gemacht. Einen verdammt schwerwiegenden. Schon als mir der Mann mit den kältesten Augen der Welt vor meinem Wohnhaus begegnete, schrillten in meinem Kopf laute Alarmsirenen. Und doch wollte ich wissen, ob ich mir durch seine dunkle Aura und die zugleich wunderschönen und steinharten Gesichtszüge bloß einbildete, dass das Shirt unter seinem teuren Kaschmirmantel blutdurchtränkt war. Nun habe ich meine Antwort. Doch genau das ist das Problem. Rick: Ich sah sie an mir vorbeilaufen, war vollkommen eingenommen von ihrer unschuldigen Schönheit, doch wusste instinktiv, die Kleine bedeutet Ärger. Für einen kurzen Moment vergaß ich sogar meinen eigenen Namen, so verdammt heftig traf mich ihr gieriger und zugleich verängstigter Blick. Und dann stand sie dort. An einem Ort, den ich niemals zweimal besuche. Einem Ort, den ich schleunigst verlasse und zu dem ich unter keinen Umständen zurückkehre. Einem Tatort, für dessen grausamen Anblick ich alleine verantwortlich bin. Mein Instinkt war vollkommen richtig – die Kleine bedeutet Ärger. Wäre sie bloß nicht so verdammt neugierig gewesen. Denn auch diese wunderschönen, stahlgrauen Augen können sie nicht vor dem Schicksal bewahren, das ihr nun droht. Vor dem Schicksal, über das ich entscheide.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
see me. thrill me. touch me. kill me.
Dark Romance
s. h. roxx
See Me. Thrill Me. Touch Me. Kill Me.
Dark Romance Roman
Copyright: Alle Rechte sind der Autorin vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verbreitung des Textes oder Ausschnitten des Textes ist ohne die schriftliche Genehmigung der Autorin untersagt.
© S. H. Roxx, 1. Auflage 2018, Österreich
2. Auflage (überarbeitete Neuauflage) 2025, Österreich
Coverdesign: © S. H. Roxx unter der Verwendung von canva.com
Bildquelle: depositphotos.com
Sämtliche Personen und Handlungen dieser Geschichte sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit real existierenden oder verstorbenen Personen, Orten oder Ereignissen ist rein zufällig.
Kontakt: www.shroxx.com
Impressumsanschrift siehe Buchende
inhalt
Triggerwarnung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Danksagung
Buchempfehlung
triggerwarnung
Der vorliegende Roman ist rein fiktional. Er dient zur Unterhaltung und soll dir ein paar hoffentlich sehr nette Lesestunden bescheren – und keinesfalls moralische Maßstäbe setzen.
Denk bitte daran, dass es sich hierbei um eine Dark Romance handelt. Manche Szenen könnten dich triggern oder verstören.
Ich distanziere mich von den Handlungen und Aussagen meiner Protagonisten. Das erwähne ich einfach, weil ich glaube, dass ich das in diesem Fall sollte.
Falls du auf kitschige Liebesschnulzen stehst, bist du hier leider falsch. Falls du dir jedoch eine düstere Romanze mit einem Bad Hero wünschst, der trotzdem gewiss kein guter Kerl ist, und eine gute Portion schwarzen Humor magst, bist du hier genau richtig.
Mein Bad Guy dieser Story ist wirklich bad, also überlege dir gut, ob du bereit für ihn bist.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen.
XOXO,
Roxxi
kapiteleins
Florence
»Ja, Mom.« Ich rolle mit den Augen und stelle den Anruf auf Lautsprecher. Genervt lege ich das Handy vor mir auf dem Boden ab und setze mich vor den Ganzkörperspiegel in meinem Schlafzimmer. »Ich beschwere mich gar nicht, es ist nur –«
»Das ist dein dritter Job in diesem Jahr«, unterbricht sie mich mit quengelnder Stimme. »Wenn du den auch hinschmeißt, bin ich wirklich enttäuscht, Florence. Nie ist etwas gut genug für dich.«
Ich fange an, meine schwarzen Haare in der Mitte in zwei Hälften zu teilen. »Der letzte Job in dem Dreckscafé, in dem mich mein Boss sexuell belästigt hat und ich die Woche zehn Überstunden machen musste, war nun wirklich kein Traumjob«, erinnere ich sie seufzend. Mit der Haarklammer befestige ich den linken, abgetrennten Teil meiner Haare und fange anschließend an, den rechten Teil vom Haaransatz an zu flechten. »Vergiss es. Was ich sagen wollte, ist –«
»Er wollte nur mit dir etwas Essen gehen, Florence«, sagt sie so, als wäre sie selbst dabei gewesen, woraufhin ich innehalte und mir selbst im Spiegel einen ungläubigen Blick zuwerfe. »Natürlich weiß ich, dass die Art, wie er dich dazu bringen wollte, nicht die Art eines Gentlemans war, allerdings hast du womöglich wie so oft etwas überreagiert.«
Überreagiert. Die Frau sollte Komikerin werden.
»Mom.« Ich hole tief Luft und bekämpfe den Drang, das Handy so lange gegen den Spiegel zu schlagen, bis sie mich nie wieder auf dem Ding erreichen kann. »Er hat mich nach einem Date gefragt, als er mir eine Hand auf die Brust gelegt und seinen Schwanz an meinem Arsch gerieben hat.« Ein kalter Schauer läuft mir bei der Erinnerung über den Rücken. »Warum reden wir überhaupt darüber? Was ich die ganze Zeit versuche zu sagen, ist –«
»Bitte sprich nicht so, als wärst du eines dieser Ghettomädchen.«
Ghettomädchen. Ihr Lieblingswort, seit ich in eine kleine Wohnung in einem leicht heruntergekommenen Viertel in Washington D.C. gezogen bin. »Vielleicht hat er nur auf deine vulgäre Art reagiert.« Vulgäre Art. »Du sendest bei einigen Männern eben die falschen Signale, Liebes. Dieses Rauchen, deine primitive Kleidung, die Obszönitäten …« Primitive Kleidung.Obszönitäten. Beinahe breche ich in hysterisches Gelächter aus. Beinahe.
Ihre Seitenhiebe ignorierend, da ich sie schon auswendig kenne, flechte ich nun den zweiten Teil meiner Haare. »Entschuldigung, Mutter. Ich korrigiere: Er hat mit seinem erigierten Glied absichtlich meinen Hintern berührt.« Als sie theatralisch seufzt, murmele ich: »Wie auch immer. Ich habe nicht vor, meinen Job in dem Bistro zu kündigen. Ich habe mich lediglich für die kommende Woche krankgemeldet.«
»Nicht?«, schießt es mit erfreulicher Stimme aus ihr hervor.
Ich wickele das Haargummi nun auch um den zweiten Zopf meiner brustlangen Haare und schnappe mir das Handy vom Boden, um aufzustehen. »Nein, Mom. Das versuche ich dir ja die ganze Zeit mitzuteilen.« Wenn du mal die Klappe halten würdest.
»Oh, Liebes, da bin ich froh. Wenn du schon nicht aufs College gehen willst, solltest du wenigstens anständig arbeiten. Diese Schreiberei führt doch zu nichts.«
Wie jedes Mal, wenn sie das sagt, werde ich unwillkürlich wütend.
Meine Mom hat noch nie verstanden, weshalb ich mich gegen das College und für eine eigene Wohnung und Vollzeitjob entschieden habe, aber am Schlimmsten findet sie die Vorstellung, dass ich mal vom Schreiben leben möchte.
Schon früh habe ich begonnen, mir eigene Geschichten auszudenken und sie zu Papier zu bringen. Ich habe über Themen recherchiert, die mich interessierten, und Texte oder Artikel darüber verfasst. Das einzige Fach, das mich am College wirklich angesprochen hätte, ist Journalismus – doch die Vorstellung, eines Tages als rastlose Reporterin um die Welt zu reisen oder unter immensem Druck für eine kleine Zeitschrift fremdbestimmte Artikel herunterzutippen, passt ganz und gar nicht zu meinem Bild von der Zukunft.
Also habe ich – sehr zum Entsetzen meiner Mutter – vor über zwei Jahren, direkt nach der High School, beschlossen, mir einen Job zu suchen, der mir genug einbringt, um in eine eigene Wohnung ziehen und selbstständig leben zu können. Nebenbei wollte ich weiterhin an meinem Traum festhalten: dem Schreiben. Ich bin noch nicht bereit, ihm den Laufpass zu geben, nur weil ich bisher keinen Verlag von meinem Manuskript überzeugen konnte.
Für meine Mom ist das natürlich nichts als pure Zeitverschwendung. In ihren Augen liegt der Grund für die Absagen ganz klar an meinem fehlenden Talent – und nicht etwa an der schieren Masse an Manuskripten, die tagtäglich bei den großen US-Verlage eingehen.
»Wenn du das sagst«, zische ich und wandere gleichzeitig in die Küche, um mir einen Eiskaffee aus dem Kühlschrank zu holen. Zwar ist es schon zehn Uhr abends, allerdings hat Koffein noch nie geschadet, um meine Nerven zu beruhigen. Koffein und eine Zigarette. »Wir hören uns, Mom.«
»Liebes, du bist wirklich nicht kritikfähig«, nörgelt sie. »Ich meine es ja nur gut. Stell dir vor, ich würde dich bei deinem unrealistischen Traum unterstützen und dir dabei zusehen, wie du untergehst. Das wäre schrecklich. Schrecklicher als zu wissen, dass du in einer Ein-Zimmer-Wohnung in diesem Ghettoviertel wohnst.«
»Ich lebe doch nicht im Ghetto!«, fahre ich sie allmählich stocksauer an. Unsere wöchentlichen Unterhaltungen verlaufen wirklich immer in dieselbe nervenaufreibende Richtung. »Du solltest froh sein, dass ich von zu Hause ausgezogen bin und auf eigenen Beinen stehe. Immerhin verdiene ich mein eigenes Geld und sorge für mich selbst.«
»Mir wäre lieber gewesen, du wärst aufs College gegangen«, erwidert sie unzufrieden.
Zeit, das Gespräch zu beenden. Ich wandere zur Wohnungstür, schließe auf, betätige die Türklingel und sage: »Oh! Mom, ich muss auflegen. Ich rufe dich wie immer nächsten Sonntag an.«
»Erwartest du so spät noch Besuch?«, fragt sie verwundert.
»Nur vom Pizzalieferanten«, plappere ich eilig. »Also dann, Mom. Bye.«
»Dann vermeide wenigstens die süßen Säfte!«, belehrt sie mich noch rasch, doch ich würge sie bereits ab.
Gott.
So.
Frustrierend.
Der Trick mit der Türklingel funktioniert stets einwandfrei und ich nutze ihn beinahe jeden Sonntag, um unser sinnloses Telefonat beenden zu können. Auch auf das Risiko hin, dass sie denkt, ich ernähre mich vorwiegend von fettiger Pizza – es könnte mir nicht gleichgültiger sein. Es gibt eben keinen besseren Ausweg, um dem Grauen in Form von Mutter-Vorwürfen zu entkommen.
Ich starre den kühlen Eiskaffee in meiner Hand an und entscheide mich für eine Runde um den Block, um eine Zigarette rauchen zu können. Eigentlich rauche ich nicht regelmäßig, es ist eher ein Gelegenheitsding, und in Situationen wie diesen ein kleines Hilfsmittel für mich, um meine Nerven zu beruhigen und runterzukommen.
Also spaziere ich zurück in mein Schlafzimmer, ziehe mir einen schwarzen Hoodie über, stecke mir die Packung Zigaretten samt Feuerzeug in die Bauchtasche und schlüpfe in eine hellblaue Jeans. Im Flur steige ich eilig in meine schwarzen Chucks und schnappe mir den pinken IPod mit den pinken Kopfhörern von der Kommode.
Kaum bin ich aus der Tür heraus, stöpsele ich mir die Stecker in die Ohren und schalte den IPod an. Hotline Bling von Drake ertönt, während ich die Treppe hinunter hüpfe und leise mitsinge. Als ich an der Tür unseres Hausdealers vorbeilaufe, die sich im ersten Stockwerk befindet, verziehe ich wie immer angewidert das Gesicht, da mir der Marihuana-Geruch wie gewohnt die Nasenwände verätzt.
Okay, ich gebe es zu – ich hätte bestimmt eine nettere Gegend oder ein hübscheres Wohngebäude zum Einziehen finden können, oder eines, in dem nicht zu siebzig Prozent asoziale Faultiere oder eben Dealer wohnen, aber wen juckt’s, was meine Nachbarn treiben? Solange sie mich in Ruhe lassen, wie ich das bei ihnen tue, soll es mir recht sein, dass bei dem Dealer täglich mehrere Junkies ein- und ausgehen. Nachdem ich klargestellt habe, keine Drogen zu konsumieren, hat er mich nie wieder angesprochen – Sache geregelt.
Vor der Tür angekommen atme ich die kühle Abendluft ein und ziehe die Zigarettenschachtel hervor. Ich zünde mir eine Zigarette an, während ich gemütlich zu John Legends›All of me‹ die dunkle, verlassene Straße entlang marschiere.
Ich liebe D. C. Selbst meine Wohngegend, die meine Mom nur abschätzig als Ghetto bezeichnet, ist mir mittlerweile ans Herz gewachsen. Ich mag die grauen Plattenbauten mit ihren bröckelnden Fassaden, die breite, ständig befahrene Straße gegenüber, deren Lärm auch nachts noch bis in den zweiten Stock meiner Wohnung dringt, und die wenigen Imbissstände an den Straßenecken, die zwar vergammeltes Essen verkaufen, aber irgendwie dazugehören.
Perfekt ist es hier sicher nicht – aber für eine ausreichend große Wohnung, in der ich allein leben kann und deren Miete noch halbwegs bezahlbar ist, reicht es vollkommen.
Zumindest in meinen Augen.
In Gedanken daran, dass ich morgen nicht wie jeden Montag die Frühschicht in dem Bistro, das einige Straßen entfernt liegt, antreten muss, spaziere ich um die Ecke und ziehe immer wieder an meiner Kippe. Ich werde vermutlich die ganze Woche freimachen, das habe ich mir nach all den Überstunden wirklich mal verdient. Außerdem habe ich dann auch mal wieder Zeit, mich voll und ganz meinem Buch zu widmen, das ich seit einiger Zeit schreibe. Darauf freue ich mich am meisten.
Für Mitte Oktober haben wir hier in Washington noch recht angenehme Temperaturen. Letztes Jahr um diese Zeit sanken die Temperaturen zu dieser späten Abendstunde bis hinab auf fünf Grad, heute genießen wir willkommene elf Grad. Dennoch liebe ich das Gefühl des kühlen Windes, der mir entgegenbläst, wodurch sich meine Nackenhaare einzeln aufstellen.
Mich kurz umsehend, werfe ich den Stummel der Zigarette auf den Asphalt und drücke die Glut unter meinem Schuh aus. Den leer getrunkenen Eiskaffee entsorge ich in einem Mülleimer neben mir. Heute bin ich eine größere Runde spaziert als üblich, so dass ich noch drei Wohnhäuser umrunden muss, um zurück zu meinem zu gelangen.
Das Bedürfnis unterdrückend, noch eine zweite Zigarette zu rauchen, scrolle ich durch die Lieder auf meinem geliebten IPod und lasse Youngblood von Five Seconds Of Summer laufen. Gott, ich könnte das Lied in einer Dauerschleife hören.
Gedankenvertieft steuere ich gegen Ende des Liedes auf mein Wohngebäude zu, das in der Mitte mehrerer Plattenbauten liegt. Kurz überlege ich, ein paar Straßen weiter zu spazieren, bis ich bei dem Wohnbau meines besten Freundes Seth ankomme, verwerfe den Gedanken jedoch, da er, im Gegensatz zu mir, morgen Früh aufstehen und zur Arbeit muss. Mittlerweile ist es 22:30 Uhr und meine Besuche bei ihm dauern selten kürzer als zwei Stunden an.
Die graue, mit Graffiti verschönerte Haustür meines Gebäudes steht wie immer offen. Ich ziehe mir die Kopfhörer aus den Ohren und rolle sie um meinen IPod. Ich bin nur noch wenige Meter von der Haustür entfernt, da verlässt ein groß gewachsener Mann das Gebäude und steuert direkt auf mich zu.
Plötzlich kann ich nur noch schwer atmen. Seine schwarzen Augen fixieren die meinen und es fühlt sich an, als bliebe die Welt um uns herum stehen. Wie in Zeitlupe läuft er auf mich zu, dabei bin ich mir sicher, dass ich nicht sein Ziel bin, sondern er nur an mir vorbeimarschieren möchte.
Da ist irgendetwas an der Art, wie er sich bewegt, irgendetwas an der Intensität seines Blickes und der Schwärze seiner kalten Augen, das mich frösteln lässt. Die Temperaturen sinken um einige Grade, während ich leicht zitternd einen Schritt nach dem anderen vorwärts mache.
Je näher ich ihm komme, desto spürbarer wird die dunkle Aura, die ihn umgibt. Mein Hirn wird ganz benebelt und ich fasse nur schwer klare Gedanken, warum, weiß ich nicht. Unter normalen Umständen wäre er mir aufgrund seiner unübersehbaren Attraktivität aufgefallen, der Breite seiner Schultern und dem teuren Kaschmirmantel, der absolut nicht zu ihm passt. Er wirkt verkleidet und diese Tatsache lässt das Unbehagen in mir steigen.
Wer ist er? Ich habe ihn hier in dieser Gegend mit absoluter Sicherheit noch nie gesehen. Schon gar nicht in meinem Haus.
Als er viel zu nah an mir vorbeiläuft, steift er meine Schulter mit seinem Arm, woraufhin ich Gänsehaut am gesamten Körper bekomme. Die unangenehme Art von Gänsehaut.
Unsere Blicke treffen sich, als ich aus einem drängenden Impuls heraus den Kopf nach ihm umdrehe, und ich versteife mich augenblicklich, während mein Herz beginnt wie verrückt zu rasen. In seinem Blick liegen Kälte und Verdorbenheit, aber auch etwas anderes. Interesse? Neugier?
Seine Gesichtszüge sind gleichermaßen hart wie wunderschön. Er trägt eine schwarze, dünne Baumwollmütze, die an seinem Hinterkopf locker hinabhängt und einen Kontrast zu seinem knielangen schwarzen Mantel darstellt, den er offen trägt. Ein dichter, aber nicht wirklich langer Bart ziert seine Wangen, das Kinn und den Bereich zwischen Oberlippe und Nase, und lässt ihn vermutlich älter wirken als er in Wahrheit ist.
Irgendetwas an ihm lässt alle Alarmsirenen in meinem Kopf schrillen. Verdammt laut schrillen. Und ich glaube nun ultimativ zu wissen, was es ist.
Unter seinem Mantel habe ich etwas gesehen, das ich vermutlich nicht sehen sollte. Vielleicht ist es ein Hirngespinst, vielleicht bloß eine Einbildung – ich weiß es nicht –, aber da waren rote Flecken, die sein weißes Shirt entstellt haben. Vielleicht bloß ein Muster? Ein hässliches rot-weißes Shirt? Womöglich spielt mir mein Unterbewusstsein durch mein Unbehagen bloß einen üblen Streich und lässt mich Dinge sehen, die gar nicht existieren.
Oder auch nicht?
Geh weiter! Schau ihn nicht an!, schreit mir mein Verstand zu, doch ich kann nicht anders und sehe ihm wie gebannt hinterher. Eine derartige Begegnung hatte ich noch nie.
Ich fröstele. Ich habe Gänsehaut. Mein Herz rast. Meine Atmung geht stockend. Mein Hirn schreit: Alarmstufe Rot.
Und dennoch stehe ich wie angewurzelt vor der Haustür und versuche zu verstehen, was hier gerade vorgefallen ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Was stimmt bloß nicht mit mir, Herrgott?
Schwer schluckend betrete ich das Gebäude und marschiere wie paralysiert die Treppe hinauf. Ich fühle mich so verdammt unwohl, fühle mich verfolgt und sehe diese schwarzen, kalten Augen immer noch vor mir. Mit meinen plötzlich feuchten Händen stecke ich den IPod ein und kralle ich mich anschließend in den Stoff meines Hoodies. Ich laufe verkrampft vorwärts.
Im ersten Stock fällt mit sofort die offene Wohnungstür auf. Es ist die Wohnung des Dealers, die sich direkt unter meiner befindet. Die schmutzige Wohnungstür steht einen Spalt weit offen, was noch nie vorkam, und die Totenstille ist beunruhigend.
Der einzig logische Grund dafür, dass die Tür offensteht, wäre der, dass der Dealer ein paar Junkies zu Besuch hat – doch dann wäre es laut. Zumindest wären Stimmen oder Geflüster zu hören, aber das ist nicht der Fall.
Wieder stellen sich meine Nackenhaare auf, so als würde mein Körper Gefahr wittern, und wieder schaffe ich es nicht, den Blick abzuwenden, diesmal von der Wohnungstür. Tief in mir drin weiß ich, dass ich mich umdrehen und die Treppe hinaufsteigen sollte, jedoch hält mich meine Neugier zurück und die Angst macht meine Beine wie gelähmt.
Verdammt, geh weiter. Geh ja nicht in diese Wohnung. Tu es nicht, Florence.
Im nächsten Augenblick stehe ich unmittelbar vor der Tür und lausche. Stille. Meine zitternde Hand wandert in Zeitlupentempo zum Türknauf, dann schiebe ich ihn langsam von mir, so dass sich die Tür einen Spalt weit mehr öffnet.
»Hallo?«, wage ich, zu flüstern, doch niemand antwortet.
Das unangenehme Ziehen in meinem Magen erinnert mich daran, dass ich eigentlich mit keiner Antwort gerechnet habe. Irgendetwas stimmt hier nicht und ich könnte schwören, dass es mit dem mysteriösen Mann von gerade eben zu tun hat.
»Ist jemand da?«, frage ich, diesmal ein wenig lauter. Meine Stimme zittert.
Bevor ich mich davon abhalten kann, öffne ich die Tür komplett und trete ein. Der gewohnte Marihuana-Geruch dringt mir umgehend in die Nase, benebelt mein schon benommenes Hirn noch mehr, und lässt mich angewidert das Gesicht verziehen. Ich mache ein paar unsichere Schritte vorwärts, blinzele durch die Dunkelheit hindurch und taste an der Wand nach einem Lichtschalter.
Ein riesiger Fehler.
Das, was mir das plötzlich grelle Licht präsentiert, ist nichts, was ich jemals wieder vergessen könnte.
Angst. Ich verspüre Todesangst. Panik. Unbändige Scheißpanik kriecht mir die Wirbelsäule hinauf und schnürt mir den Hals zu.
Blut, da ist überall Blut.
Ich wusste es. Es war fucking Blut, das der Mann unter seinem Mantel zu verstecken versucht hat!
Wie in Trance mache ich zwei Schritte rückwärts, ohne den Blick von den leeren Augen des schwarzen Dealers zu nehmen. Sie starren in die Luft, jegliches Leben darin ist erloschen. Sein Körper ist durch Messerstiche und tiefe Schnittwunden entstellt, so als hätte es jemandem irrsinnigen Spaß bereitet, ihn aufzuschlitzen. Aus seinem verdrehten, am Boden liegenden Körper quillt dunkelrotes Blut und der metallene Geruch übersteigt nun sogar den Marihuana-Geruch in der Wohnung.
Dass der Mann tot ist, weiß ich, ohne ihn angefasst und nach seinem Puls gefühlt zu haben. Niemand mit so vielen Einstichen und Wunden hätte überlebt. Außerdem ist auf dem schmutzigen Parkettboden überall Blut, so verdammt viel Blut …
Ich glaube, spucken zu müssen, und halte mir eine Hand vor den Mund.
Ich sollte weglaufen, schreien, die Cops rufen, aber ich schaffe es nicht. Stattdessen würge ich und breche meinen Eiskaffee und den Rest meines Mageninhalts auf den Boden im Flur. Ich würge, immer und immer wieder, und stütze mich mit einer zittrigen Hand an dem klebrigen Schuhschrank neben mir ab, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Als mir klar wird, dass ich mich gerade alleine an einem grausamen Tatort befinde, dessen Anblick sich unwiderruflich in mein Hirn gebrannt hat, und ich dem Täter vor wenigen Minuten so nah war, dass ich jetzt noch seine Berührung an meiner Schulter spüren kann, erhebe ich mich ruckartig und wische mir mit dem Handrücken über den Mund.
Ich muss hier weg. Sofort!
Fest entschlossen, die Cops zu rufen, alle Nachbarn zu wecken und den Mann bis ins kleinste Detail zu beschreiben, damit sie ihn vielleicht heute noch fassen können, laufe ich rückwärts aus der Wohnung und atme mit offenem Mund ein und aus. Ich krame panisch nach dem Schlüssel in meinem Hoodie und dem Handy in meiner Potasche.
Ich erstarre, als ich es spüre.
Ihn spüre.
Millimeter dicht hinter mir.
Ich kann seinen heißen Atem auf meinem vom Angstschweiß feuchten Nacken spüren, und fröstele wieder, weil die Temperaturen erneut um mindestens zehn Grad sinken.
Dieser Mann – der Mörder – steht hinter mir und sagt kein Wort. Seine Präsenz ist so verdammt stark spürbar, ebenso wie die dunkle Aura, die ihn umgibt. Mein Herz droht, zu versagen. Meine rechte Hand umklammert meinen Wohnungsschlüssel, der immer noch in der Bauchtasche meines Hoodies liegt, und meine linke Hand befindet sich auf der linken Hosentasche meiner Jeans und rührt sich keinen Millimeter weit.
Mein Hirn läuft auf Hochtouren, während ich meine Möglichkeiten abwäge. Ich könnte wieder in die Wohnung hineinlaufen und darauf hoffen, dass ein Schlüssel im Schloss steckt, um mich einzusperren, bis die Cops da sind. Doch jemand, der es schafft, einen Menschen abzuschlachten, wird wohl auch dazu in der Lage sein, eine beschissene Holztür aufzubrechen.
Ich könnte einfach schreien und darauf hoffen, dass mir ein Nachbar zu Hilfe eilt. Aber was, wenn ich ihn dadurch auch in Gefahr bringe? Was, wenn dieser Mann ihn auch tötet?Ich könnte, ich könnte …
»Bleib ruhig.« Die überaus tiefe, leicht heisere Stimme verschlägt mir den Atem. Mein Kopf wird leer, als sich eine große Männerhand von hinten auf meinen Mund legt, und wieder bin ich wie gelähmt, so dass ich mich keinen Zentimeter weit bewegen kann. »Atme nur.«
Atmen. Atmen. Atmen. Atmen. Atmen. Atmen.
Der Killer presst seinen Körper stärker an den meinen und entfernt meine linke Hand von meiner Hosentasche. Anschließend hält er mich am Ellenbogen fest, während seine andere Hand weiterhin meinen Mund bedeckt.
»Das hättest du nicht tun sollen«, sagt er leise. Oh scheiße. Allein der Klang seiner unterkühlten, rauen Stimme lässt die Alarmsirenen in meinem Kopf in einer Dauerschleife schrillen. »Mädchen wie du sollten so etwas nicht sehen.«
»Bitte«, presse ich gedämpft durch seine Handfläche hervor. »Ich … ich …« Ich glaube, eine Panikattacke zu erleiden.
»Nicht reden«, knurrt er, so dass ich wieder die Luft anhalte und mit geschlossenen Augen anfange, innerlich ein Gebet aufzusprechen. Ich will nicht sterben. »Was mache ich jetzt bloß mit dir, Black Beauty?«
Black Beauty. Oh mein Gott. Nein. Dieser Mann darf keinen Gefallen an mir finden – Gott weiß, auf welche perversen Gedanken ihn das bringt.
Ach du Scheiße. Jetzt erst wird mir klar, was mir nun droht. Er wird mich töten und meinen Körper neben den des Dealers werfen, wenn er fertig damit ist, mich zu zerstückeln oder aufzuschlitzen. Er könnte mich auch mitnehmen und vergewaltigen, mich umbringen und irgendwo anders entsorgen. Er kann mich nicht gehen lassen, denn ich weiß zu viel. Ich habe zu viel gesehen.
Ich bin so gut wie tot.
Meine Panik übernimmt die Oberhand und lässt mich handeln, bevor ich darüber nachdenken kann.
Ich umklammere krampfhaft den Schlüssel mit meinen Fingern, ziehe die Hand ruckartig aus der Hoodietasche heraus und ramme sie hinter mich. Ich versuche, ihn am Hals zu treffen, oder wenigstens im Gesicht, um ihn kurzzeitig außer Gefecht zu setzen und fliehen zu können, doch er ist so verdammt schnell, dass er meine Faust mit dem spitzen Schlüssel schon abfängt, ehe sie überhaupt in der Nähe seines Körpers landen konnte.
Im nächsten Moment werde ich hart gegen die Wand neben der Wohnungstür gestoßen, an den Haaren gepackt, dann wird mein Kopf brutal zur Seite gerissen, so dass ich ihm nun in die Augen sehen muss. Ich gebe einen erschrockenen Schrei von mir, der umgehend von seiner starken Hand abgefangen wird.
Seine, wie ich nun sehe, tiefbraunen Augen durchbohren die meinen. Ich kann darin keinerlei Emotionen entdecken.
»Das war ein Fehler.«
kapitelzwei
Rick
Verdammter Mist.
Noch ehe ich mich von der Begegnung mit der schwarzhaarigen Schönheit erholen kann, muss ich mich nun darum kümmern, sie loszuwerden. Das passt mir so wenig in den Kram wie ein verschissenes Unwetter, wenn ich joggen bin.
Ich muss logisch denken. Die Kleine hat die Leiche und das Blut an meinem Shirt gesehen. Ich sah es an ihren geweiteten Augen, noch bevor sie überhaupt realisierte, was sie da eigentlich entdeckt hat. Sie war ebenso von meinem Anblick fasziniert wie ich von ihrem, nur dass sich in ihren stahlgrauen Augen noch etwas anderes als Neugier widerspiegelte. Angst. Unbehagen. Sie hat gute Instinkte. Ihr Körper reagiert auf Gefahr.
Als ich das schäbige Wohngebäude verließ, traf mich augenblicklich ihr forschender Blick. Sie ließ ihn kurz an mir hinabgleiten, ehe sie sich in meinen Augen verlor. Mein Schwanz zuckte beim Anblick ihrer geflochtenen Zöpfe, dem lockeren Hoodie und der verdammt engen Jeans, in der ihre schlanke Beine stecken. Es war, als sehe ich der Unschuld in Person in die Augen.
Noch nie hat mich der Anblick einer Frau so dermaßen umgehauen. Oder sollte ich eher sagen, der eines Mädchens? Sie scheint zu meinem Leidwesen noch verdammt jung zu sein. Vielleicht Anfang zwanzig.
Womöglich ist es genau das. Sie ist frisch und jung. Die mit Abstand verlockendste Sünde auf diesem kranken Planeten. Ihre glitzernden, so verflucht grauen Augen versprechen Unschuld und Unterwürfigkeit. Ihr voller, wahnsinnig sinnlicher Mund verspricht dreckige Erlösung. Ihre blasse, makellose Haut verspricht Reinheit.
Fuck.
Und doch muss ich sie loswerden. Ich kann nicht riskieren, dass mir jemand in die Quere kommt, egal, wer diese Person sein mag. Egal, wie unschuldig oder rein sie ist, und egal, ob es sich dabei um eine Frau handelt. Um ein Mädchen.
Scheiße aber auch, so war das nicht geplant.
Schritte poltern im Untergeschoss und ich handele impulsiv.
»Verhalte dich ruhig«, befehle ich ihr, während ich sie in die Leichenwohnung hineindränge und die Tür lautlos hinter uns schließe. Ich halte ihr weiterhin den Mund zu, packe sie mit einer Hand an der Taille, die noch schmaler zu sein scheint als unter dem dicken Hoodie vermutet, und drücke sie grob mit dem Gesicht vorwärts gegen die Tür. Sie atmet so verdammt hektisch, dass ich befürchte, sie könnte einen Anfall erleiden. Vielleicht hyperventiliert sie auch nur.
»Gib einen Mucks von dir und endest in weniger als einer Minute wie er.« Ich nicke in Richtung des Dealers, der Dank mir mausetot in seiner eigenen Blutlache ein paar Meter hinter uns auf dem Boden liegt.
Sie folgt der Bewegung. Weder nickt sie noch schreit sie – wenigstens etwas. In Gedanken an meinen nächsten Schritt und wie beschissen diese Situation ist, kralle ich mich mit der Hand an ihrer Taille fest, woraufhin sie scharf die Luft einzieht. Ich lockere den Griff minimal, um ihr keine Rippen zu brechen, und werde kurzzeitig von ihrem blumigen Duft abgelenkt. Beinahe zerquetsche ich sie mit meinem Körper, so stark presse ich mich von hinten an sie, doch ich tue es nicht mal absichtlich oder weil es nötig ist. Es ist, als würde mich ihr Körper magnetisch anziehen.
Mein Schwarz wird hart.
Als ich höre, dass die Störenfriede außer Reichweite sind und die Totenstille von vorhin wieder einkehrt, wirbele ich die Kleine herum, donnere sie mit dem Rücken gegen die Tür und halte sie zwischen meinen, neben ihrem Kopf an der Wand abgestützten, Armen gefangen.
Mein Blick wandert von ihren glasigen Augen hinab zu ihrer schmalen Nase, den einladend vollen Lippen, bis hin zu ihrem spitzen Kinn. Er gleitet tiefer zu ihrem weiblichen Hals, an dem eine Ader unkontrolliert zuckt, und verliert sich beim Anblick ihrer jungen, weichen Haut. Zu gerne würde ich sie anfassen, aber das hat momentan keine Priorität.
»Bitte«, flüstert sie mit flehender Stimme, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ihr Blick wandert ebenfalls über jeden Zentimeter meines Gesichts, bis er an meinen Lippen hängenbleibt. »Ich w-w-werde niemandem sagen, dass –«
»Sei still«, knurre ich, um nachzudenken. Das Zittern in ihrer hohen Stimme trägt nicht gerade dazu bei, meinen schmerzhaft steifen Schwanz zu beruhigen. »Kein Wort mehr.«
Wir sind uns so verdammt nah, dass unser Atem das Gesicht des anderen streift. Ich muss mich mit dem Kopf weit hinunterbeugen, um auf Augenhöhe mit ihr sein zu können, da die Kleine ihrem Namen alle Ehre macht. Sie ist mindestens zwanzig Zentimeter kürzer als ich.
»Ich schwöre, ich sage kein Wort, ich –«
»Hörst du nicht?«, presse ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ich lege ihr eine Hand um den Hals und drücke zu, woraufhin sie erschrocken nach Luft schnappt. »Halt verdammt noch mal den Mund, Mädchen.«
Sie nickt. Als sie gar nicht mehr aufhört zu nicken, zwinge ich mich, den Griff zu lockern, lasse die Hand aber wo sie ist. Nicht nur, weil ihre Haut zu spüren beruhigend auf meine Nerven wirkt, sondern auch, weil ihr diese Geste symbolisieren soll, wie weit ich gehen würde, um sie zum Schweigen zu bringen.
Als sie endlich aufhört zu nicken und zu röcheln, senkt sie den Kopf – soweit es meine Hand zulässt – und atmet tief ein und aus. Kurz bin ich irritiert, weil es aussieht, als würde sie Atemübungen machen.
Dann fasse ich in Windeseile einen Entschluss. Sie gehen zu lassen kommt ohnehin nicht in Frage, und sie hier umzubringen ist eigentlich nicht mein Plan. Ich muss sie wohl oder übel mitnehmen und später entscheiden, wie, was und wo ich es mit ihr anstelle.
Am liebsten würde ich meine Wut laut hinausschreien und diese Bruchbude auseinandernehmen.
Ich packe grob ihr Kinn und drücke es nach oben, um ihr in die Augen sehen zu können. »Ich sage dir jetzt, wie es läuft. Wenn du nicht wie der Drecksdealer enden willst, wirst du brav sein und tun, was ich dir sage. Wenn du auch nur irgendeinen Mucks von dir gibst oder versuchst, mich auszutricksen, schwöre ich dir, dass ich kurzen Prozess mit dir mache. Es ist mir scheißegal, wie flehentlich du mich ansiehst oder wie verführerisch du mit den langen Wimpern klimperst. Für mich gibt es absolut keinen Unterschied zwischen dir und ihm. Haben wir uns verstanden?«
Das stimmt zwar so nicht, aber das muss sie ja nicht wissen. Je mehr Angst sie vor mir hat, desto besser. Wobei ich nicht glaube, dass sie noch mehr Todesangst verspüren könnte, als sie es ohnehin bereits tut. Immerhin liegt der Beweis für mein tödliches Kaliber vor ihren Augen auf dem Parkettboden. Schwimmend in seinem Blut.
Sie nickt wieder zögerlich, also fahre ich fort: »Wir verlassen jetzt dieses Gebäude. Du wirst mir brav deine Hand geben, dich von mir in den Kofferraum meines Wagens legen lassen und die Fahrt über keinen Ton von dir geben. So weit, so klar?«
Ihre grauen Augen werden riesig, als sie versteht, dass ich vorhabe, sie mitzunehmen. Ihr Atem geht noch schneller und sie blinzelt mehrmals unkontrolliert, während ich sie mit meinem finsteren Blick niederstarre. Irgendwann schluckt sie schwer, was mich unwillkürlich auf falsche Gedanken bringt, und nickt wieder.
»Braves Mädchen.« Ich packe sie an der Hand, zwinge ihre Finger auseinander und quetsche meine dazwischen. Eilig schiele ich durch den Türspion und ziehe sie mit einem Ruck von der Tür, als ich feststelle, außer Gefahr zu sein. »Geh vor und lass meine Hand unter keinen Umständen los.«
»Ok«, kommt stockend zurück, so als zwinge sie sich, das Wort auszuspucken. Sie öffnet die Tür, setzt einen Fuß vor den anderen und zieht mich, so wie ich es mir erwarte, an der Hand mit sich.
Kaum entfernen wir uns zwei Meter von der Tür, wirft sie mir einen über alle Maße panischen Blick über die Schulter zu und bleibt auf der ersten Stufe der Treppe stehen.
»Bitte nicht! Ich will nicht sterben! Ich –«
»Du sollst, verfickt nochmal, den Mund halten!«, fahre ich sie scharf an und packe sie mit der freien Hand im Gesicht. Ihre Hand schwitzt und zittert in meiner, ihr Gesicht ist leichenblass. »Hörst du? Keinen Ton, keinen Mucks, nur atmen.«
Ohne ein weiteres Wort läuft sie die Treppe hinunter. Ihre Beine sind weich wie Wackelpudding, so dass sie bei jeder zweiten Stufe beinahe fällt, doch ich bin sofort da, um sie aufzufangen, was sie sichtlich nervös macht. Den Scheißmantel ziehe ich zu, damit nicht noch jemand entdeckt, was sich darunter befindet, und reiße anschließend die Haustür auf, als wir sie erreichen.
Mein SUV parkt nur zwei Straßen entfernt, also lege ich einen Gang zu, um endlich von hier verschwinden zu können, bevor mich noch irgendjemand hier sieht. Zwar würde niemand annehmen, dass ich es war, der den Dealer um die Ecke gebracht hat, aber man kann nie vorsichtig genug sein. Bei der Kleinen war ich mir jedoch absolut sicher, dass sie Ärger machen und die Wohnung betreten würde. Eins und eins zusammenzählen ist danach nicht sonderlich schwer gewesen.
Das Blut an meinem Shirt, die Leiche, das eilige Verlassen des Gebäudes … So eine Scheiße. Mein Instinkt hat mich noch nie getäuscht, Gott sei Dank habe ich ihm nachgegeben und bin ihr gefolgt.
Ich habe noch drei weitere Namen auf meiner Liste, bis ich aus D.C. verschwinden und endlich mit dieser Scheiße hier abschließen kann. Wenn sie mich danach schnappen, soll es so sein, allerdings darf das nicht passieren, bevor ich jeden auf meiner Liste ausgeloschen habe.
Nicht umsonst war ich peinlich genau beim Verwischen meiner Spuren an den letzten sechs Tatorten, die ich verlassen habe. Da der Dealer genug andere Feinde hat und Junkies bei ihm ein und ausgegangen sind, werden die Cops sowieso davon ausgehen, dass es jemand aus diesem Milieu war, der ihn umgelegt hat. Ein unzufriedener Kunde, ein Rivale, ein Lieferant – es gibt etliche potenzielle Täter.
Ihre schwarz lackierten Nägel bohren sich scharf in meinen Handrücken, als sie merkt, dass ich einen Wagen ins Visier nehme. Vermutlich wird ihr erst in diesem Moment wirklich klar, was ihr bevorsteht – welches Schicksal ihr gerade mit brutaler Klarheit entgegenschlägt. Ich kann es ihr nicht verdenken, dass sie wie gelähmt wirkt.
Im Gegenteil: Angesichts der Umstände schlägt sie sich erstaunlich gut. Abgesehen von dem kleinen Brechanfall in der Wohnung – aber das ist nur verständlich, wenn man zum ersten Mal im Leben eine solche Menge Blut sieht. Oder eben eine Leiche.
Ich öffne den Wagen, sehe mich in alle Richtungen um, und betätige anschließend den Knopf zum Öffnen des Kofferraums. Das Mädchen fängt an, wie wild zu zittern.
»Hände vor den Körper«, verlange ich rau, woraufhin sie mich wieder mit panisch geweiteten Augen ansieht. Fuck, ich habe noch nie dermaßen schöne und ängstliche Augen gesehen. Bisher warfen mir die Frauen andere Blicke zu, wenn ich sie aufforderte, mir ihre Hände zum Fesseln entgegenzustrecken. »Tu, was ich sage. Zögere lieber nicht.«
»Warum?«, flüstert sie so leise, dass ich es kaum höre. Sie wagt es, einen Blick über ihre Schulter zu werfen – vermutlich sucht sie nach Menschen, die es hier zu ihrem Leidwesen und meinem Glück nirgendwo zu entdecken gibt. »Wenn du mich umbringen willst, tu es jetzt. Bitte verschlepp mich nicht in irgendeine Gosse oder eine verlassene Lagerhalle. Tu mir das nicht an.«
Ich bin über ihre Worte überrascht, vielleicht auch ein wenig schockiert. Mutig, die Kleine. Allerdings nervt mich ihr Geplapper und die Zeit läuft mir davon, daher packe ich grob beide ihrer Handgelenke, ziehe Kabelbinder aus dem Rucksack in meinem Kofferraum und fessele ihre Hände damit.
»Rein mit dir.« Ich sehe mich erneut um und atme erleichtert aus, als die Straße immer noch verwaist und dunkel ist. »Verdammt, mach schon!«
Ich glaube, ein leises Schluchzen von ihr zu hören, ignoriere es jedoch, da sie endlich tut, was ich von ihr verlange. Sie hebt erst das eine, dann das andere Bein in den Kofferraum, den Rest erledige ich. Mit einem kleinen Stoß liegt sie mit angewinkelten Beinen auf der großen Fläche und wendet den Blick konsequent von mir ab.
»Kluge Entscheidung.« Ich ziehe noch einen Kabelbinder aus dem Rucksack, fessele ihre Fußknöchel, und schnappe mir anschließend ihr Handy und den Schlüssel, den ich ihr nach ihrem kleinen Angriff wieder zurück in die Hoodietasche gesteckt habe.
Als ich die Zigarettenpackung ertaste, ziehe ich verwundert eine Augenbraue in die Höhe, und schnappe sie mir samt dem Feuerzeug. Auch den IPod stecke ich mir rasch ein und vergewissere mich erneut, dass sie sonst nichts mehr bei sich hat.
Hektisch krame ich in dem Rucksack nach etwas, womit ich ihr den Mund stopfen kann, und gebe mich mit einem meiner Shirts zufrieden. Eingerollt zwänge ich es in ihren kleinen Mund, den sie krampfhaft versucht geschlossen zu halten, und drücke ihren Kopf zur Seite, damit ich es an ihrem Hinterkopf verknoten kann.
Et voila.
Jetzt heißt es nur noch so schnell wie möglich weg von hier, dann kann ich mich weiter mit meiner Geisel beschäftigen.
Schade um das hübsche Mädchen mit den grauen Augen. Ein elftes Opfer stand zwar nicht auf meiner Liste, aber ich wusste immer schon, dass es dazu kommen könnte. Komplikationen und Kollateralschäden sind bei dem, was ich tue, vorherzusehen, ich muss mir bloß mein Ziel vor Augen halten, dann wird alles gut.
Die Kleine muss verschwinden. Eliminiert werden, ohne Spuren zu hinterlassen. Sieben Bastarde auf meiner Liste habe ich schon erledigt, drei weitere warten noch auf ihr Schicksal, von dem sie bisher nichts ahnen.
Das ist das Ziel.
Die zehn Leute, die für den Tod meines Bruders verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen und in die Hölle, in die sie gehören, zu schicken. Danach untertauchen und mein eigenes Leben fortsetzen. Wieder beginnen, es richtig zu leben.
Als ich den Arm nach dem Kofferraumdeckel ausstrecke, um ihn zu schließen, trifft mich ihr wutentbrannter Blick unerwartet. Keine Spur von Angst oder Panik ist in ihren schimmernden Augen mehr zu erkennen, die Gefühle wurden ersetzt durch Hass und Zorn.
Gut so, denke ich mir innerlich. Sei stark.
Kaum habe ich den Kofferraumdeckel geschlossen und verriegelt, frage ich mich, was diese paradoxen Gedanken überhaupt sollen. Sie soll nicht stark sein, denn es bringt ihr absolut nichts. Sie hat keine Ahnung, wozu ich fähig bin, auch wenn sie einen Teil meiner kranken Rachegelüste bereits mit eigenen Augen sehen durfte. Sie weiß nicht, warum ich wofür kämpfe, und das wird sie auch niemals.
Ich setze mich hinter das Steuer und starte den Motor. Bisher hat sie noch keinen Schrei von sich gegeben, zumindest konnte ich keinen hören. Ein gutes Zeichen. Der mickrige, einzig gesunde Teil meines Hirns äußert das Bedürfnis, ihr zu erklären, warum ich das getan habe, aber der Rest meines Hirns hindert ihn gekonnt daran. Sie braucht es nicht zu erfahren, braucht nicht zu wissen, dass ich kein Auftragskiller oder Psychopath bin, obwohl ich doch irgendwie abartig sein muss, um so eine Grausamkeit über die Bühne zu bringen, aber verdammt nochmal egal.