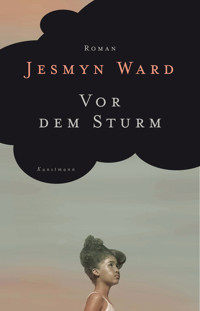17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Jojo und seine kleine Schwester Kayla leben bei ihren Großeltern Mam and Pop an der Golfküste von Mississippi. Leonie, ihre Mutter, kümmert sich kaum um sie. Sie nimmt Drogen und arbeitet in einer Bar. Wenn sie high ist, wird Leonie von Visionen ihres toten Bruders heimgesucht, die sie quälen, aber auch trösten. Mam ist unheilbar an Krebs erkrankt, und der stille und verlässliche Pop versucht, den Haushalt aufrecht zu erhalten und Jojo beizubringen, wie man erwachsen wird. Als der weiße Vater von Leonies Kindern aus dem Gefängnis entlassen wird, packt sie ihre Kinder und eine Freundin ins Auto und fährt zur »Parchment Farm«, dem staatlichen Zuchthaus, um ihn abzuholen. Eine Reise voller Gefahr und Hoffnung. Jesmyn Ward erzählt so berührend wie unsentimental von einer schwarzen Familie in einer von Armut und tief verwurzeltem Rassismus geprägten Gesellschaft. Was bedeuten familiäre Bindungen, wo sind ihre Grenzen? Wie bewahrt man Würde, Liebe und Achtung, wenn man sie nicht erfährt? Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt ist ein großer Roman, getragen von Wards so besonderer melodischer Sprache, ein zärtliches Familienporträt, eine Geschichte von Hoffnungen und Kämpfen, voller Anspielungen auf das Alte Testament und die Odyssee.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Ähnliche
Zum Buch
Ein großer Roman aus dem amerikanischen Süden, ein zärtliches Familienporträt in einer von Armut und Rassismus geprägten Gesellschaft.
Jojo und seine kleine Schwester Kayla leben bei ihren Großeltern Mam and Pop an der Golfküste von Mississippi. Leonie, ihre Mutter, kümmert sich kaum um sie. Sie nimmt Drogen und arbeitet in einer Bar. Wenn sie high ist, wird Leonie von Visionen ihres toten Bruders heimgesucht, die sie quälen, aber auch trösten. Mam ist unheilbar an Krebs erkrankt, und der stille und verlässliche Pop versucht, den Haushalt aufrecht zu erhalten und Jojo beizubringen, wie man erwachsen wird. Als der weiße Vater von Leonies Kindern aus dem Gefängnis entlassen wird, packt sie ihre Kinder und eine Freundin ins Auto und fährt zur "Parchment Farm", dem staatlichen Zuchthaus, um ihn abzuholen. Eine Reise voller Gefahr und Hoffnung.
Jesmyn Ward erzählt so berührend wie unsentimental von einer schwarzen Familie in einer von Armut und tief verwurzeltem Rassismus geprägten Gesellschaft. Was bedeuten familiäre Bindungen, wo sind ihre Grenzen? Wie bewahrt man Würde, Liebe und Achtung, wenn man sie nicht erfährt? „Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt“ ist ein großer Roman, getragen von Wards so besonderer melodischer Sprache, ein zärtliches Familienporträt, eine Geschichte von Hoffnungen und Kämpfen, voller Anspielungen auf das Alte Testament und die Odyssee.
Über die Autorin
Jesmyn Ward, geb. 1977, wuchs in DeLisle, Mississippi, auf. Nach einem Literaturstudium in Michigan war sie Stipendiatin in Stanford und Writer in Residence an der University of Mississippi. Sie lehrt derzeit Englische Literatur an der Tulane University in New Orleans. Bereits ihr erster Roman »Vor dem Sturm« wurde mit dem National Book Award ausgezeichnet, für »Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt« erhielt sie ihn 2017 ein zweites Mal.
Jesmyn Ward
Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt
Roman
Aus dem Englischenvon Ulrike Becker
Verlag Antje Kunstmann
Für meine Mutter, Norine Elizabeth Dedeaux, die mich liebte, noch bevor ich den ersten Atemzug tat. Das lässt sie mich in jeder Sekunde meines Lebens spüren.
Wen suchen wir, wen suchen wir?Equiano suchen wir.Ist er an den Fluss gegangen? Dann soll er wiederkommen.Ist er auf die Felder gegangen? Dann soll er zurückkehren.Equiano suchen wir.
Gesang der Kwa
[Das Gedächtnis] ist etwas Lebendiges – und als solches vergänglich. Doch wenn der Moment kommt, strömt alles Erinnerte zusammen und erwacht zum Leben – Alt und Jung, Vergangenheit und Gegenwart, Lebende und Tote.
Eudora Welty
The Gulf shines, dull as lead. The coast of Texasglints like a metal rim. I have no homeas long as summer bubbling to its headboils for that day when in the Lord God’s namethe coals of fire are heaped upon the headof all whose gospel is the whip and flame,age after age, the uninstructing dead.
Derek Walcott
1. Kapitel
JOJO
ICH STELL MIR GERNE VOR, dass ich weiß, was der Tod ist. Ich stell mir gerne vor, dass er etwas ist, dem ich ins Auge sehen kann. Als Pop zu mir sagt, ich soll ihm helfen, und ich das schwarze Messer seh, das hinter seinem Gürtel steckt, folge ich ihm nach draußen und versuche, den Rücken durchzustrecken und die Schultern so gerade wie einen Kleiderbügel zu halten; so geht Pop. Ich tu so, als wär die Sache ganz normal und langweilig, damit Pop denkt, dass ich mir diese dreizehn Jahre verdient hab, damit er weiß, dass ich bereit bin zu tun, was getan werden muss, Eingeweide von Muskeln zu trennen, Organe aus ihren Höhlen zu schälen. Ich will Pop zeigen, dass ich mit Blut klarkomme. Heute ist mein Geburtstag.
Ich halte die Tür fest, damit sie nich zuknallt, dann lasse ich sie ganz leise einklicken. Mam und Kayla sollen nich aufwachen, wenn keiner von uns im Haus is. Besser, sie schlafen. Besser, meine kleine Schwester Kayla schläft weiter, denn in den Nächten, wenn Leonie arbeiten is, wird sie jede Stunde wach, setzt sich im Bett auf und schreit. Besser, Großmutter Mam schläft weiter, denn die Chemo hat sie ausgetrocknet und ausgezehrt, so wie die Sonne und die Luft es bei den Wassereichen machen. Pop schlängelt sich zwischen den Bäumen durch, aufrecht und schlank und braun wie eine junge Kiefer. Er spuckt auf die trockene rote Erde, und die Baumkronen winken im Wind. Es ist kalt. Dieser Frühling ist stur, an den meisten Tagen lässt er keine Wärme durch. Die Kälte bleibt einfach da, so wie Wasser in einer verstopften Badewanne. Ich hab mein Hoodie auf dem Fußboden in Leonies Zimmer liegen lassen, wo ich schlafe, und mein T-Shirt ist dünn, aber ich reibe mir trotzdem nich die Arme. Wenn ich mich von der Kälte ärgern lasse und dann die Ziege sehe, werd ich ganz bestimmt zusammenzucken oder die Stirn runzeln, wenn Pop ihr die Kehle durchschneidet. Und wie ich Pop kenne, wird er es merken.
»Wir lassen die Kleine lieber schlafen«, sagt Pop.
Pop hat unser Haus selbst gebaut, vorne schmal und lang, dicht an der Straße, damit er den Wald auf dem Rest des Grundstücks stehen lassen konnte. Die Ställe für seine Schweine, Ziegen und Hühner hat er auf kleine Lichtungen zwischen die Bäume gesetzt. Zu den Ziegen müssen wir am Schweinestall vorbei. Die Erde dort ist schwarz und matschig vom Kot, und seit Pop mich, als ich sechs war, mal verprügelt hat, weil ich ohne Schuhe im Schweinegehege rumgelaufen bin, war ich nie wieder barfuß hier draußen. Du kannst dir dabei Würmer holen, hatte Pop gesagt. Später an dem Abend hat er mir Geschichten von sich und seinen Geschwistern erzählt, als sie noch klein waren und immer barfuß gespielt haben, weil jeder nur ein Paar Schuhe besaß, und das war zum in die Kirche gehen. Sie haben alle Würmer gekriegt, und wenn sie aufs Plumpsklo gingen, haben sie sich die Würmer aus dem Po rausgezogen. Ich hab es Pop nicht gesagt, aber das hat besser gewirkt als die Schläge.
Pop wählt die unglückliche Ziege aus, legt ihr den Strick wie eine Schlinge um den Hals und führt sie aus dem Stall. Die anderen blöken und stubsen ihn an, rammen ihm ihre Köpfe in die Kniekehlen und lecken an seiner Hose.
»Heh, weg da!«, sagt Pop und tritt nach ihnen. Ich glaub, die Ziegen verstehn sich; ich seh das an den bockigen Kopfstößen, daran, wie sie sich in Pops Hose verbeißen und am Stoff zerren. Ich glaub, sie wissen, was die lose Schlinge um den Hals der einen bedeutet. Der weiße Bock mit dem dunkelgefleckten Fell tänzelt hin und her, er wehrt sich, als ob er schon ahnt, wo es für ihn hingeht. Pop zieht ihn an den Schweinen vorbei, die zum Zaun gerannt kommen und Pop angrunzen, weil sie Futter wollen, und dann den Weg runter zum Schuppen, der dichter am Haus steht. Zweige klatschen an meine Schultern, kratzen mich und hinterlassen dünne weiße Schrammen auf meinen Armen.
»Wieso hast du hier nicht mehr gerodet, Pop?«
»Zu wenig Platz«, sagt Pop. »Und keiner brauch zu sehn, was ich da hinten hab.«
»Man kann die Tiere doch vorn hören. Von der Straße aus.«
»Und wenn einer versucht, sich herzuschleichen und sich an meine Tiere ranzumachen, dann hör ich ihn durch diese Bäume kommen.«
»Du meinst, die Tiere würden sich klauen lassen?«
»Nein. Ziegen sind garstig, und Schweine sind schlauer, als man denkt. Und gemein. So’n Schwein beißt jeden, von dem es nich gewohnt is, Futter zu kriegen.«
Pop und ich gehen in den Schuppen. Pop bindet den Ziegenbock an einen Pfahl, den er in den Boden gerammt hat, und der Bock blökt ihn an.
»Kennst du irgendwen, der seine Tiere draußen hat?«, sagt Pop. Und Pop hat recht. Keiner in Bois lässt seine Tiere frei rumlaufen, weder auf den Feldern noch vorne vor dem Haus.
Der Bock wirft den Kopf hin und her, stemmt sich nach hinten. Versucht, den Strick abzuschütteln. Pop schwingt ein Bein über das Tier, zwängt es ein und schiebt ihm seinen Arm unters Kinn.
»Big Joseph«, sage ich. Als ich das sage, würde ich am liebsten rausgucken, über meine Schulter auf den hellen grünen Tag draußen, aber ich zwinge mich, den Blick auf Pop zu richten, auf den Bock, dem zum Sterben der Hals gestreckt wird. Pop schnaubt verächtlich. Ich wollte den Namen eigentlich gar nicht aussprechen. Big Joseph ist mein Weißer Opa, Pop mein Schwarzer. Ich wohne seit meiner Geburt bei Pop; meinen Weißen Opa hab ich zwei Mal gesehen. Big Joseph ist rund und groß und sieht ganz anders aus als Pop. Er sieht noch nicht mal so aus wie Michael, mein Vater, der schlank ist und überall Tattoos hat. Die hat er sich als Andenken bei Möchtegern-Künstlern machen lassen, in Bois und draußen auf dem Wasser, als er offshore gearbeitet hat, und im Gefängnis.
»Na also«, sagt Pop.
Pop ringt mit dem Bock wie mit einem Mann, und der Bock knickt ein. Er fällt vorwärts in den Sand und dreht den Kopf zur Seite, sodass er mich anguckt und mit der Wange über die schmutzige Erde und den blutbefleckten Schuppenboden schabt. Er zeigt mir sein sanftes Auge, aber ich gucke trotzdem nich weg, zucke mit keiner Wimper. Pop macht den Schnitt. Der Bock gibt einen überraschten Laut von sich, ein Blöken, das von einem Gurgeln erstickt wird, und dann ist überall Blut und Schlamm. Die Beine des Tiers werden schlapp wie Gummi, und Pop kämpft nicht mehr. Mit einer schnellen Bewegung steht er auf, bindet die Fesseln mit einem Strick zusammen und zieht dann den Tierkörper hoch zu einem Haken, der am Dachsparren hängt. Das Auge: noch feucht. Es schaut mich an, als wäre ich derjenige, der ihm die Kehle aufgeschlitzt hat, als wäre ich derjenige, der ihn ausbluten lässt, bis sein Gesicht ganz rot und blutdurchtränkt ist.
»Könn’ wir?«, fragt Pop. Dann schaut er mich kurz an. Ich nicke. Meine Stirn schlägt Falten, mein Gesicht ist verkrampft. Ich versuche, mich zu entspannen, während Pop an den Beinen entlangschneidet, dem Ziegenbock Hosennähte verpasst, Hemdnähte, Schlitze überall.
»Hier festhalten«, sagt Pop. Er zeigt auf einen Schlitz am Bauch des Tiers, also greife ich mit den Fingern hinein und packe zu. Es ist noch warm, und nass. Bloss nicht abrutschen, ermahne ich mich. Nicht loslassen.
»Jetzt ziehen«, sagt Pop.
Ich ziehe. Die Ziege wird von innen nach außen gekehrt. Schleim und Gestank überall, irgendwas riecht muffig und beißend, wie ein Mann, der tagelang nicht geduscht hat. Das Fell lässt sich abschälen wie eine Bananenschale. Ich staune jedes Mal, wie leicht es abgeht, sobald man nur dran zieht. Pop zieht kräftig auf der anderen Seite, und dann schneidet und reißt er das Fell an den Hufen ab. Ich ziehe die Haut auf meiner Seite über das Tierbein bis zum Fuß, kriege sie aber nicht so gut ab wie Pop, deshalb übernimmt er das Abschneiden und Abreißen.
»Andere Hälfte«, sagt Pop. Ich greife in den Schlitz in der Nähe des Herzens. Dort ist die Ziege sogar noch wärmer, und ich frage mich, ob ihr Herz in der Panik so schnell geschlagen hat, dass die Brust ganz heiß geworden ist, aber dann schaue ich zu Pop, der schon dabei ist, die Haut am Fuß abzutrennen, und merke, dass ich durch das Grübeln langsam geworden bin. Ich will nicht, dass er mein Trödeln für Angst hält oder für Schwäche, so als wär ich nich alt genug, um dem Tod ins Gesicht zu sehen wie ein Mann, also packe ich zu und ziehe mit Wucht. Pop trennt das Fell am Fuß ab, und dann baumelt das Tier von der Decke und besteht nur noch aus rosa Muskeln, die das bisschen Licht, das in den Schuppen fällt, einfangen und im Dunkeln glänzen. Von der Ziege ist nur noch das haarige Gesicht übrig, und irgendwie ist dieser Anblick noch schlimmer als der Moment, bevor Pop ihr die Kehle durchgeschnitten hat.
»Hol den Eimer«, sagt Pop, also hole ich den Metallbottich vom Regal hinten im Schuppen und schiebe ihn unter das Tier. Ich hebe das Fell, das schon anfängt, steif zu werden, auf und stopfe es in den Bottich. Alle vier Stücke.
Pop macht einen Schnitt in der Bauchmitte, die Eingeweide rutschen raus und fallen in den Bottich. Während er weiterschneidet, stinkt es überwältigend, schlimmer als Schweinekot im Gesicht. Es riecht wie tote Tiere, die tief im Wald verwesen und auf die nur dieser Gestank und die kreisenden, hinabstürzenden Bussarde hinweisen. Es stinkt wie platt gefahrene Opossums oder Gürteltiere, die auf dem heißen Asphalt vor sich hin faulen. Nur schlimmer. Dieser Geruch ist noch schlimmer; es ist der Todesgestank von etwas, das bis gerade lebendig war, das noch heiß ist von Blut und Leben. Ich schneide eine Grimasse, würde am liebsten Kaylas Stinkgesicht machen, das sie immer macht, wenn sie sauer oder ungeduldig ist. Für andere sieht es aus, als hätte sie was Ekliges gerochen: Sie kneift ihre grünen Augen zusammen, rümpft die Nase zu einem Pilz, zeigt alle zwölf winzigen Milchzähne. So ein Gesicht möchte ich ziehen, weil ich durch die gekräuselte Nase vielleicht den Geruch wieder rausquetschen oder abmildern könnte, den Todesgestank vielleicht sogar ganz aussperren könnte. Ich weiß, dass es der Magen und die Gedärme sind, aber ich sehe bloß Kaylas Stinkgesicht vor mir und das sanfte Auge des Ziegenbocks, und dann kann ich nicht mehr hinschauen, kann nicht mehr an mich halten, dann bin ich raus durch die Schuppentür und übergebe mich ins Gras. Mein Gesicht brennt heiß, aber meine Arme sind kalt.
Pop kommt mit einem Rippenstück in der Hand aus dem Schuppen. Ich wisch mir den Mund ab und schau ihn an, aber er schaut nicht zu mir, sondern in Richtung Haus und weist mit einem Nicken dorthin.
»Ich glaub, ich hab das Baby weinen hören. Du solltest mal nach den beiden sehen.«
Ich stecke die Hände in die Hosentaschen.
»Brauchst du mich denn nich mehr?«
Pop schüttelt den Kopf.
»Ich komm jetzt klar«, sagt er, aber dann schaut er mich zum ersten Mal richtig an, und sein Blick ist nicht mehr streng. »Geh du schon mal rein.« Und er dreht sich um und geht zurück in den Schuppen.
Pop muss sich verhört haben, denn Kayla ist noch gar nich wach. Sie liegt in ihrer Unterhose und ihrem gelbem T-Shirt auf dem Boden, den Kopf zur Seite gedreht, die Arme ausgebreitet, als ob sie die Luft umarmen will, die Beine gespreizt. Auf ihrem Knie sitzt eine Fliege; ich verjage sie und hoffe, sie hat nicht die ganze Zeit, als ich mit Pop im Schuppen war, auf Kayla draufgesessen. Fliegen fressen Aas. Als ich noch kleiner war, als ich Leonie noch Mama genannt hab, hat sie mir erzählt, dass Fliegen einen vollscheißen, wenn sie auf einem landen. Das war, als es noch mehr Gutes als Schlechtes gab, als Leonie mich auf der Schaukel, die Pop an einem der Pekannussbäume im Vorgarten aufgehängt hatte, angeschubst hat oder neben mir auf dem Sofa saß, mit mir Fernsehen guckte und mir dabei über den Kopf strich. Bevor sie mehr weg war als da. Bevor sie anfing, zerdrückte Tabletten zu schniefen. Bevor die Gemeinheiten, die sie zu mir gesagt hat, sich immer mehr aufgehäuft haben und sich wie Splitt in einem aufgeschürften Knie festgesetzt haben. Damals hab ich Michael noch Pop genannt. Das war, als er bei uns gewohnt hat, bevor er wieder bei Big Joseph eingezogen ist. Bevor die Polizei ihn vor drei Jahren abgeholt hat, kurz vor Kaylas Geburt.
Jedes Mal, wenn Leonie was Gemeines zu mir gesagt hat, hat Mam ihr gesagt, sie soll mich in Ruhe lassen. Ich hab doch nur Spaß gemacht, meinte Leonie dann, lächelte jedes Mal ganz breit und fuhr sich mit der Hand über die Stirn, um ihr kurzes, gesträhntes Haar glattzustreichen. Ich wähle Farben, die meiner Haut schmeicheln, hat sie Mam erklärt. Die dieses Schwarz zur Geltung bringen. Und dann: Michael steht total drauf.
Ich ziehe die Decke hoch, bis über Kaylas Bauch, und leg mich neben sie auf den Fußboden. Ihr kleiner Fuß fühlt sich in meiner Hand warm an. Im Schlaf strampelt sie die Decke wieder ab, greift nach meinem Arm und zieht ihn auf ihren Bauch, sodass ich sie umarme, ehe ich wieder still liege. Ihr Mund geht auf, ich wedele die freche Fliege weg, und Kayla lässt einen kleinen Schnarcher los.
Als ich wieder raus in den Schuppen gehe, hat Pop schon sauber gemacht. Er hat die stinkenden Eingeweide im Wald vergraben, das Fleisch, das wir Monate später essen werden, in Plastik eingepackt und in den kleinen Gefrierschrank in der Ecke gelegt. Er macht die Schuppentür zu, und als wir an den Ställen vorbeigehen, weicht mein Blick ganz von alleine den Ziegen aus, die an den Holzzaun kommen und blöken. Ich weiß, sie fragen nach ihrem Freund, dem, den ich mit getötet habe. Dem, von dem Pop ein paar Stücke bei sich hat: die zarte Leber für Mam, die er nur kurz anbraten wird, gerade so lange, dass Mam das Blut beim Essen nicht übers Kinn läuft, wenn er mich zu ihr reinschickt, um sie damit zu füttern, und für mich die Keulen, die er stundenlang kochen und danach räuchern und grillen wird, um meinen Geburtstag zu feiern. Ein paar der Ziegen wenden sich ab und grasen.
Zwei Böcke schliddern ineinander, dann versetzt einer dem anderen einen Kopfstoß, und sie fangen an zu kämpfen. Als einer weghumpelt und der Sieger, der ein schmutzig-weißes Fell hat, sich über eine kleine graue Ziege hermacht und versucht, sie zu besteigen, ziehe ich meine Hände in die Ärmel. Die Ziege tritt nach dem Bock und blökt. Pop bleibt neben mir stehen und schwenkt das frische Fleisch durch die Luft, um die Fliegen zu verjagen. Der Bock beißt der Ziege ins Ohr, die Ziege macht einen Laut, der wie ein Knurren klingt, und schnappt zurück.
»Ist es immer so?«, frage ich Pop. Ich hab schon gesehen, wie Pferde sich aufbäumen und besteigen, wie brünstige Schweine sich im Schlamm bespringen, gehört, wie wilde Katzen nachts schreien und fauchen, wenn sie Katzenbabys machen.
Pop schüttelt den Kopf und hebt die ausgesuchten Fleischstücke in meine Richtung hoch. Er lächelt halb, der Mundwinkel, der ein paar Zähne entblößt, wird messerscharf, dann ist das Lächeln wieder verschwunden.
»Nein«, sagt er. »Nicht immer. Manchmal ist es auch das hier.«
Die Ziege versetzt dem Bock einen Stoß in den Nacken und schreit. Der Bock schliddert rückwärts. Ich glaube Pop. Wirklich. Ich seh ihn ja mit Mam. Aber ich seh auch Leonie und Michael, so klar und deutlich, als stünden sie hier vor mir, bei ihrem letzten großen Streit, bevor Michael uns verlassen hat und wieder zu Big Joseph gezogen ist, vor drei Jahren, kurz bevor er ins Gefängnis kam: Michael hat damals seine Pullover, seine Camouflage-Hosen und seine Jordans in große schwarze Müllsäcke gestopft und alles nach draußen geschleppt. Ehe er wegging, hat er mich umarmt, und von so nah konnte ich nur seine Augen sehen, die grün waren wie die Kiefern, und die roten Flecken, die auf seinem Gesicht erschienen: an den Wangen, um den Mund herum, an den Nasenflügeln, wo die Adern unter der Haut kleine lila Strahlen waren. Er legte die Arme um mich und tätschelte mir ein, zwei Mal den Rücken, aber seine Berührungen waren so leicht, dass es sich gar nicht wie eine Umarmung anfühlte, obwohl sein Gesicht total angespannt aussah, irgendwie komisch, so als hätte er überall Klebeband unter der Haut. Als würde er gleich anfangen zu weinen. Leonie war schwanger mit Kayla, und sie hatte schon Kaylas Namen ausgesucht und mit Nagellack auf den Autositz geschrieben, der früher mein Autositz gewesen war. Ihr Bauch wurde langsam größer; es sah aus, als hätte sie sich einen Kinder-Basketball unter ihr T-Shirt geschoben. Sie lief hinter Michael her nach draußen auf die Veranda, wo ich stand und immer noch die beiden kleinen Klapse auf meinem Rücken spürte, so sanft wie eine schwache Brise, und Leonie packte Michael von hinten am Kragen, zog ihn zu sich und versetzte ihm einen Schlag an den Kopf, der so laut schallte, dass es nass klang. Er drehte sich um, packte sie am Arm, und dann schrien und keuchten und schubsten und zerrten die beiden sich gegenseitig über die ganze Veranda. Sie waren so dicht zusammen, an Hüften, Brust und Gesicht, dass sie eins waren und sich trippelnd fortbewegten, wie ein Einsiedlerkrebs, der unbeholfen über den Sand hoppelt. Dann schoben sie sich noch dichter aneinander und sagten etwas, aber ihre Worte klangen wie Stöhnen.
»Ich weiß«, sagte Michael.
»Du weißt überhaupt nichts«, sagte Leonie.
»Wieso drängst du mich so?«
»Mach doch, was du willst«, sagte Leonie, und dann weinte sie, und die beiden küssten sich und lösten sich erst voneinander, als Big Joseph in die sandige Auffahrt gefahren kam und anhielt, sodass sein Lieferwagen nicht mehr auf der Straße, sondern gerade so auf dem Hof stand. Er hupte nicht und winkte nicht und gar nichts, er saß einfach nur da und wartete auf Michael. Und dann ließ Leonie Michael stehen, knallte die Tür und war wieder im Haus verschwunden, und Michael schaute nach unten auf seine Füße. Er hatte vergessen, Schuhe anzuziehen, und seine Zehen waren ganz rot. Er holte einmal tief Luft und griff dann nach seinem Gepäck. Dabei kamen die Tattoos auf seinem weißen Rücken in Bewegung: der Drache auf seiner Schulter, die Sense am Oberarm. Ein grimmiger Sensenmann zwischen den Schulterblättern. Mein Name, Joseph, am Nackenansatz, zwischen Umrissen von meinen Babyfüßen.
»Ich komme wieder«, sagte er, sprang kopfschüttelnd von der Veranda, warf sich die Müllsäcke über die Schulter und ging zu dem Lieferwagen, in dem sein Daddy, Big Joseph, der Typ, der nie, kein Mal, laut meinen Namen gesagt hat, wartete. Ein Teil von mir hätte ihn am liebsten ausgepfiffen, als er in der Auffahrt zurücksetzte, aber ein größerer Teil von mir hatte Angst, Michael könnte noch einmal aus dem Wagen springen und mich verprügeln, deshalb ließ ich es bleiben. Damals war mir noch nicht klar, dass Michael manchmal alles mitkriegte und manchmal nichts, dass er mich mal wahrnahm, und dann wieder tage- oder wochenlang nicht. Dass ich in dem Moment keine Rolle spielte. Michael hatte sich nicht mehr umgedreht, nachdem er von der Veranda gesprungen war, hatte noch nicht mal hochgeguckt, nachdem er seine Säcke auf die Ladefläche des Pick-ups geworfen hatte und vorne eingestiegen war. Er schien sich immer noch auf seine nackten roten Füße zu konzentrieren. Pop sagt, ein Mann soll einem anderen Mann in die Augen sehen, also stand ich da und schaute Big Joseph an, während er den Rückwärtsgang einlegte, und Michael, der nur auf seinen Schoß guckte, bis sie von der Auffahrt runter waren und davonfuhren. Dann spuckte ich aus, so wie Pop es macht, sprang von der Veranda und rannte ums Haus rum zu den Tieren, zu ihren geheimen Ställen hinten im Wald.
»Na komm, Junge«, sagt Pop. Als er in Richtung Haus losgeht, folge ich ihm und versuche, die Erinnerung an Leonies und Michaels Streit abzuschütteln, sie in der feuchten, kühlen Luft draußen hängen zu lassen wie einen Nebel. Doch sie verfolgt mich, sogar noch, als ich der warmen, weichen Blutspur folge, die Pop im Sand hinterlässt, einer Spur, die ebenso eindeutig von Liebe zeugt wie die Brotkrumen, die Hänsel im Wald fallen ließ.
Der Geruch der Leber in der heißen Pfanne sitzt schwer in meiner Kehle, trotz des Bacon-Fetts, mit dem Pop sie vorher beträufelt hat. Als Pop sie auf den Teller schiebt, riecht die Leber immer noch, aber die Soße, die er dazu gemacht hat, verläuft um sie herum zu einem kleinen Herz, und ich frage mich, ob das wohl Absicht war. Ich trage den Teller bis an Mams Türschwelle, aber Mam schläft noch, also bringe ich ihn zurück in die Küche, und Pop legt ein Papiertuch drüber, um das Essen warm zu halten, und dann schaue ich zu, wie er das Fleisch und die Gewürze, Knoblauch, Sellerie, Paprikaschoten und Zwiebeln, von denen mir die Augen tränen, schneidet und alles zum Kochen aufsetzt.
Wären Mam und Pop am Tag von Leonies und Michaels Streit zu Hause gewesen, hätten sie die Rauferei gestoppt. Der Junge braucht das nicht mitanzusehen, hätte Pop gesagt. Oder Mam hätte gesagt, Euer Kind soll doch nicht denken, dass man andere Menschen so behandelt. Aber sie waren nicht zu Hause. Ich kann nicht behaupten, dass das oft vorkam. Sie waren nicht da, weil sie erfahren hatten, dass Mam Krebs hatte, und Pop deshalb immer wieder mit ihr zum Arzt fuhr. Soweit ich mich erinnern konnte, war es das erste Mal, dass sie sich darauf verließen, dass Leonie auf mich aufpasste. Nachdem Michael mit Big Joseph weggefahren war, fühlte es sich äußerst seltsam an, Leonie am Tisch gegenüberzusitzen und mir ein Bratkartoffelsandwich zu machen, während sie ins Leere starrte, die Beine übereinanderschlug, mit dem Fuß wippte und Zigarettenrauch zwischen ihren Lippen hervorquellen ließ, bis er ihren Kopf wie einen Schleier umhüllte, obwohl Mam und Pop es nicht leiden konnten, wenn sie im Haus rauchte. Mit ihr allein zu sein. Sie aschte in eine leere Coladose, die sie gerade ausgetrunken hatte, und machte auch die Kippen darin aus, und als ich in mein Sandwich biss, sagte sie: »Das sieht ja eklig aus.«
Nach dem Streit mit Michael hatte sie sich die Tränen abgewischt, aber man konnte noch die getrockneten, glänzenden Spuren in ihrem Gesicht sehen.
»Pop isst das auch immer so.«
»Musst du Pop alles nachmachen?«
Ich schüttelte den Kopf, weil sie das zu erwarten schien. Aber die meisten Sachen, die Pop tat, fand ich richtig gut, zum Beispiel die Art, wie er dastand, wenn er redete, die Art, wie er sein Haar kämmte, aus dem Gesicht raus nach hinten, und es mit Gel glatt strich, sodass er wie einer der Choctaw- oder Muskogee-Indianer aus den Büchern aussah, die wir in der Schule lasen, oder dass er mich im Traktor auf seinem Schoß sitzen und hinten auf unserem Grundstück rumfahren ließ, oder seine Art, schnell und sauber zu essen, und natürlich die Geschichten, die er mir vor dem Einschlafen erzählte. Als ich neun war, machte Pop einfach alles richtig gut.
»Sieht aber ganz so aus.«
Statt zu antworten, schluckte ich kräftig. Die Kartoffelscheiben waren salzig und dick, die Mayonnaise und der Ketchup zu dünn aufgestrichen, deshalb rutschten die Kartoffeln nicht so gut runter.
»Hört sich sogar eklig an«, sagte Leonie. Sie ließ ihre Zigarette in die Coladose fallen und schob die Dose dann über den Tisch zu mir rüber. »Wirf das weg.«
Sie ging aus der Küche ins Wohnzimmer, nahm eins von Michaels Baseball-Caps, das er auf dem Sofa liegen gelassen hatte, und zog es sich tief ins Gesicht.
»Ich komm bald wieder«, sagte sie.
Mit dem Sandwich in der Hand trottete ich hinter ihr her. Die Tür schlug zu, und ich stieß sie wieder auf. Willst du mich etwa ganz alleine hierlassen, wollte ich sie fragen, aber das Sandwich saß mir wie ein Kloß im Hals und unterdrückte die Panik, die wie Blasen aus meinem Bauch aufstieg; ich war noch nie allein zu Hause gewesen.
»Mama und Pop sind bestimmt bald zurück«, sagte sie, bevor sie die Autotür zuschlug. Sie fuhr einen weinroten Chevrolet Malibu, den Pop und Mam ihr zum Highschool-Abschluss gekauft hatten. Leonie fuhr aus der Auffahrt und ließ eine Hand aus dem Fenster baumeln, entweder um sich Luft zuzuwedeln oder um zu winken, schwer zu sagen, und dann war sie weg.
Irgendwie war mir ganz allein in dem zu stillen Haus unheimlich, deshalb setzte ich mich raus auf die Veranda, aber dann hörte ich einen Mann singen, mit einer hohen Stimme, die ganz falsch klang, und er sang immer wieder den gleichen Text. Oh Stag-o-lee, why can’t you be true? Das war Stag, Pops ältester Bruder, mit einem langen Spazierstock in der Hand. Seine Sachen sahen hart und ölig aus, und er schwenkte den Stock wie eine Axt. Immer, wenn ich ihn traf, ergab das, was er sagte, für mich überhaupt keinen Sinn; es war so, als würde er eine fremde Sprache sprechen, obwohl ich wusste, dass es Englisch war: Jeden Tag lief er in Bois Sauvage herum, sang und schwenkte seinen Stock. Er ging genauso aufrecht wie Pop, wirkte genauso stolz wie Pop. Hatte die gleiche Nase wie Pop. Aber alles andere an ihm war ganz anders als bei Pop, eher so, als hätte man Pop wie einen nassen Lappen ausgewrungen und dann in der falschen Form wieder trocknen lassen. Das war Stag. Einmal hab ich Mam gefragt, was mit ihm los war, warum er immer so nach Gürteltier roch, und sie hat die Stirn gerunzelt und gesagt: Er is nicht ganz richtig im Kopf, Jojo. Und dann: Frag Pop lieber nicht danach.
Ich wollte nicht, dass er mich sah, darum sprang ich von der Veranda und rannte hinters Haus in den Wald. Es war tröstlich, die Schweine schnüffeln und die Ziegen rupfen und fressen zu hören, die Hühner picken und scharren zu sehen. Ich fühlte mich nicht mehr so klein und allein. Ich hockte mich ins Gras und schaute den Tieren zu, glaubte fast zu hören, wie sie mit mir redeten, wie sie kommunizierten. Manchmal, wenn ich das fette Schwein mit den schwarzen Matschflecken an der Seite anschaute, grunzte es und schlackerte mit den Ohren, und ich dachte, es will mir sagen: Kratz mich hier, Junge. Wenn die Ziegen mir die Hand leckten und mich mit dem Kopf anstubsten, während sie blökend an meinen Fingern knabberten, hörte ich: Das Salz ist so schön scharf und lecker – noch mehr Salz. Wenn das Pferd, das Pop hält, den Kopf neigte und so lange mit den Hufen scharrte und buckelte, bis seine Flanken wie der feuchte rote Mississippi-Lehm glänzten, verstand ich: Ich könnte über deinen Kopf springen, Junge, und ach, dann würde ich losrennen, würde rennen und rennen und wäre nicht mehr zu sehen. Ich könnte dich zum Zittern bringen. Es erschreckte mich, sie zu verstehen, ihnen zuzuhören. Weil Stag das auch tat; Stag stand manchmal mitten auf der Straße und führte lange Gespräche mit Casper, dem schwarz gescheckten Nachbarshund.
Aber die Tiere nicht zu hören, war unmöglich, denn ich brauchte sie nur anzuschauen, da verstand ich sie schon – es war so, als würde ich einen Satz anschauen und die Wörter verstehen, als würden sie alle auf einmal auf mich einstürmen. Nachdem Leonie weggefahren war, saß ich eine Weile hinten bei den Ställen, hörte den Schweinen und dem Pferd zu und dem Gesang vom alten Stag, der aufbrauste und abflaute wie ein launischer Wind. Ich ging von einem Stall zum anderen, schaute immer wieder zur Sonne hoch, um zu schätzen, wie lange Leonie schon weg war, wie lange Mam und Pop schon weg waren, wie lange es wohl dauern würde, bis sie wiederkamen und ich zurück ins Haus gehen konnte. Ich ging mit hochgerecktem Kopf, lauschte auf das Knirschen von Autoreifen, deshalb sah ich den scharf gezackten Dosendeckel nicht, der vor mir aus der Erde ragte, sah nicht, dass ich im Gehen den Fuß daraufsetzte und instinktiv mein Gewicht verlagerte. Der Deckel sank tief ein. Ich schrie auf, fiel hin, hielt mir das Bein und wusste, dass die Tiere mich in diesem Moment auch verstanden: Lass mich los, großer Zahn! Verschone mich!
Stattdessen brannte und blutete es, ich saß weinend auf der Pferdelichtung, schmeckte Ketchup und etwas Saures hinten in der Kehle und umklammerte meinen Knöchel. Ich traute mich nicht, den Deckel herauszuziehen, und endlich hörte ich, wie eine Autotür zuschlug, dann erst mal nichts mehr, bis Pops Stimme nach mir rief und ich antwortete und er mich auf der Erde sitzen sah, schluchzend und japsend, ohne mich darum zu scheren, dass mein Gesicht ganz nass war. Pop kam zu mir und fasste mein Bein an, so wie er es bei unserem Pferd immer macht, wenn er das Hufeisen prüft. Mit einem kurzen Ruck zog er den Deckel raus, und ich brüllte laut auf. Das war das erste Mal, dass ich dachte, Pop hat was gemacht, was nicht gut war.
Als Leonie an dem Abend nach Hause kam, hat sie kein Wort gesagt. Ich glaub nicht, dass ihr mein Fuß überhaupt aufgefallen ist, bis Pop sie anschrie, Verdammt noch mal, Leonie!, verdammt noch mal, immer wieder. Ich war schläfrig von dem Schmerzmittel, kribbelig von dem Antibiotikum, mein Fuß weiß verbunden, ganz fest umwickelt, und sah bloß zu, während Pop mit der flachen Hand an die Wand schlug, um jede Silbe zu unterstreichen: Leonie! Sie zuckte zusammen, wich einen Schritt vor ihm zurück und sagte dann kleinlaut: Du hast in seinem Alter unten bei den Docks Austern geöffnet, und Mam hat Windeln gewechselt. Und dann: Er is alt genug. Sie sagte: Alles okay, oder, Jojo? Und ich guckte sie an und sagte: Nein, Leonie. Das war was Neues für mich: Ihre Hände, die sie ständig rieb, und die schiefen Zähne in ihrem plappernden Mund anzugucken und in meinem Kopf nicht Mama zu hören, sondern ihren Namen: Leonie. Als ich ihn aussprach, lachte sie; der Laut brach aus ihr hervor, als wäre er mit einem harten Spaten herausgehackt worden. Pop sah aus, als würde er ihr gleich eine runterhauen, aber dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck, und er schnaubte nur, so wie er es macht, wenn eine Saat nicht aufgeht oder eine seiner Säue mehr tote als lebendige Ferkel wirft: enttäuscht. Er setzte sich mit mir auf eins der beiden Sofas im Wohnzimmer. Das war die erste Nacht, in der er Mam allein im Bett schlafen ließ. Ich schlief auf dem Zweisitzer, er auf dem großen Sofa, wo er, nachdem Mam immer kränker wurde, schließlich auch blieb.
Die Ziege riecht beim Kochen wie Rind. Im Topf sieht sie sogar so aus, dunkel und faserig. Pop drückt mit einem Löffel auf das Fleisch, um zu prüfen, wie weich es ist, und legt dann den Deckel schief auf, sodass Dampf herausquillt.
»Pop, erzählst du mir noch mal von dir und Stag?«, frage ich.
»Was denn?«, fragt Pop.
»Parchman«, sage ich. Pop verschränkt die Arme. Beugt sich vor, um am Ziegenfleisch zu riechen.
»Hab ich dir das nich schon alles erzählt?«, fragt er.
Ich zucke die Achseln. Manchmal finde ich, dass ich um Nase und Mund herum Stag ähnlich sehe. Stag und Pop. Ich will hören, wie sie sich unterscheiden. Wie wir uns alle unterscheiden. »Schon, aber ich möchte es trotzdem noch mal hören«, sage ich.
Das macht Pop immer, wenn wir abends allein sind und noch spät im Hof oder im Wald sitzen. Er erzählt mir Geschichten. Wie sie früher Rohrkolben gegessen haben, wenn sein Daddy in den Sümpfen gewesen war und welche geholt hat. Wie seine Mama und ihre Leute Louisianamoos gesammelt und damit ihre Matratzen gestopft haben. Manchmal erzählte er mir die gleiche Geschichte drei oder sogar vier Mal. Wenn er erzählt, gibt mir seine Stimme das Gefühl, als würde er eine Hand nach mir ausstrecken und mir den Rücken kraulen und als könnte ich allem entkommen, was mir sonst das Gefühl gibt, dass ich niemals mit so stolz erhobenem Haupt dastehen werde wie Pop, mir meiner selbst niemals so sicher sein werde wie er. Ich gerate ins Schwitzen und klebe förmlich an meinem Stuhl in der Küche fest, wo es von dem kochenden Ziegenfleisch auf dem Herd so warm geworden ist, dass die Fenster dick beschlagen sind und die Welt auf mich und Pop in diesem Raum zusammengeschrumpft ist.
»Bitte«, sage ich. Pop bearbeitet das Fleisch, das noch in den Topf muss, mit dem Fleischklopfer, damit es weich und zart wird, und räuspert sich. Ich lege die Ellbogen auf den Tisch und höre zu:
Ich und Stag, wir haben den gleichen Papa. Meine anderen Geschwister haben andere Daddys, weil mein Papa jung gestorben ist. Glaub, er war so Anfang vierzig. Ich weiß nich genau wie alt, weil er selbst nich wusste, wie alt er war. Er meinte, seine Maman und sein Daddy sind den Behörden immer aus dem Weg gegangen, ham ihre Fragen nie richtig beantwortet, die Zahl ihrer Kinder falsch angegeben, die Geburten gar nich beim Amt gemeldet. Sie glaubten, die wollten nur bei ihnen rumschnüffeln und sich die Informationen besorgen, um sie unter Kontrolle zu kriegen, um sie einzusperren wie Vieh. Deswegen haben sie das ganze offizielle Zeugs nich mitgemacht, sondern lieber nach den alten Sitten gelebt. Papa hat uns einiges davon beigebracht, bevor er starb: Jagen und Spurensuchen, wie man Tiere hält, ein paar Sachen über Ausgewogenheit und über das Leben. Ich hab gut zugehört. Ich hab immer gut zugehört. Aber Stag hat nie zugehört. Selbst als er noch klein war, rannte Stag nur mit den Hunden rum oder ging zum Badeloch, war viel zu beschäftigt mit sowas, um sich mal hinzusetzen und zuzuhören. Und als er älter wurde, hing er ständig im Juke Joint rum. Papa meinte, er sähe zu gut aus, er würde er sich schnell Ärger einhandeln, weil er so hübsch wie ein Mädchen auf die Welt gekommen war. Weil die Leute hübsche Sachen mögen und ihm alles zu leicht gemacht wurde. Maman machte Schschscht, wenn Papa das sagte, sie meinte, Stag würde nur zu viel fühlen, weiter nichts. Meinte, deswegen fiel es ihm schwer, stillzusitzen und nachzudenken. Ich hab nix gesagt, aber ich fand, sie hatten beide nich recht. Ich glaub, Stag fühlte sich innen drin tot, deswegen konnte er nich stillsitzen und zuhören, deswegen musste er immer auf den höchsten Felsen klettern und kopfüber ins Wasser springen, wenn wir am Fluss baden waren. Deswegen ging Stag, sobald er achtzehn oder neunzehn war, fast jedes verfluchte Wochenende in den Juke Joint und trank, deswegen lief er mit einem Messer in jedem Schuh rum, und noch einem in jedem Ärmel, deswegen verletzte er Leute und kam selbst oft mit Schnittwunden nach Hause – er brauchte das, um sich lebendiger zu fühlen. Und er hätte ewig so weitermachen können, wenn nicht dieser Kerl von der Navy da aufgekreuzt wäre, mit noch ein paar andern Weißen Männern aus dem Norden, die auf Ship Island stationiert waren. Wollte sich wohl’n bisschen mit den Farbigen amüsieren, doch dann traf er an der Theke auf Stag, ein Wort gab das andere, und schließlich zog der Mann Stag eine Flasche über den Schädel, und da hat Stag zugestochen, nich tief genug, um ihn zu töten, aber tief genug, um ihm wehzutun, damit Stag Zeit gewinnen und weglaufen konnte, aber weit is er nich gekommen, weil die Freunde des Weißen sich Stag griffen und ihn zusammenschlugen. Ich war allein zu Haus, als Stag ankam, Maman war ein paar Häuser weiter und kümmerte sich um ihre Schwester, und Papa war draußen auf dem Feld. Als die Weißen Männer Stag holen kamen, fesselten sie uns beide und nahmen uns mit. Ihr zwei werdet jetzt lernen, was Arbeit bedeutet, sagten sie. Was es heißt, nach den Gesetzen von Gott und den Menschen zu leben, sagten sie. Euch Bengel schicken wir nach Parchman.
Ich war fünfzehn. Aber ich war noch nicht mal der Jüngste dort, sagt Pop. Das war Richie.
Kayla wacht plötzlich auf, rollt sich auf den Bauch, stemmt sich hoch und lächelt. Ihr Haar steht wild ab und ist so zerzaust wie die Lianen an den Ästen der Kiefern. Ihre Augen sind grün wie Michaels, und ihre Haarfarbe schwankt irgendwo zwischen Leonies und Michaels, mit einer Spur von Strohblond.
»Jojo?«, sagt sie. Das sagt sie immer, sogar wenn Leonie im Bett neben ihr liegt. Darum kann ich jetzt nicht mehr auf dem Zweisitzer bei Pop im Wohnzimmer schlafen; Kayla hat sich als kleines Baby so dran gewöhnt, dass ich ihr nachts das Fläschchen bringe. Darum schlaf ich neben Leonies Bett auf dem Fußboden, und in den meisten Nächten kommt Kayla irgendwann zu mir runter, weil Leonie meistens weg ist. Kayla hat was Klebriges am Mundwinkel. Ich spucke auf den Saum von meinem T-Shirt und reibe damit über ihre Wange, und sie schüttelt meine Hand ab und krabbelt auf meinen Schoß: Sie ist klein für ihre drei Jahre, und wenn sie sich an mich kuschelt, hängen ihre Füße nicht mal über meine Oberschenkel. Sie riecht nach in der Sonne getrocknetem Heu, warmer Milch und Babypuder.
»Durst?«, frage ich.
»Mhm«, macht sie leise.
Als sie ausgetrunken hat, lässt Kayla ihre Schnabeltasse auf den Boden fallen.
»Singen«, sagt sie.
»Was soll ich denn singen?«, frage ich, obwohl sie mir das nie sagt. Genau wie ich mir zu gerne Pops Geschichten anhöre, hört Kayla mir zu gerne beim Singen zu. »›Die Räder am Bus‹?«, schlage ich vor. Das kenne ich aus dem Head-Start-Programm in der Vorschule: Manchmal sind die Nonnen aus dem Ort zu uns in die Klasse gekommen, mit ihren akustischen Gitarren, die sie wie Jagdgewehre geschultert hatten, und haben uns was vorgespielt. Ich singe das Lied leise, damit Mam nicht aufwacht, und meine Stimme ist holprig und krächzend, aber Kayla schwenkt trotzdem die Arme und marschiert im Zimmer herum. Als Pop den Kochtopf sich selbst überlässt und ins Wohnzimmer kommt, bin ich außer Puste, und meine Arme tun weh. Ich singe gerade »Funkel, funkel, kleiner Stern«, auch ein Hit aus der Vorschule, werfe Kayla dabei in die Luft, fast bis an die hohe Decke, und fange sie wieder auf. Wenn sie ein Kreischkind wäre, würde ich das nicht machen, denn dann würde Mam garantiert aufwachen. Aber während sich jetzt der Duft von in Butter gedünsteten Zwiebeln und Knoblauch, Paprikaschoten und Sellerie im Zimmer ausbreitet, fliegt Kayla mit glänzenden Augen hoch und fällt wieder runter, die Arme ausgebreitet, den Mund zu einem breiten Lächeln verzogen, sodass es so aussieht, als würde sie aus vollem Hals schreien.
»Noch mal«, keucht sie. »Noch mal«, sagt sie jedes Mal ächzend, wenn ich sie auffange, um sie erneut hochzuwerfen.
Pop schüttelt den Kopf, aber ich mache weiter, denn ich sehe an der Art, wie er seine Hände am Geschirrtuch abtrocknet und sich an den hölzernen Türbogen lehnt, den er eigenhändig geschliffen und vernagelt hat, dass er nichts dagegen hat. Er hat die Decke absichtlich so hoch gebaut, gut dreieinhalb Meter, weil Mam ihn darum gebeten hatte. Sie meinte, je mehr Platz zwischen Fußboden und Dach ist, desto kühler ist es im Haus. Er weiß, dass ich Kayla nicht wehtun werde.
»Pop«, sage ich schnaufend, als Kayla mehr auf meiner Brust als in meinen Armen landet. »Erzählst du mir den Rest, bevor du das Fleisch zum Räuchern rausbringst?«
»Das Baby«, sagt Pop.
Ich fange Kayla auf und drehe mich einmal mit ihr im Kreis. Sie schmollt, als ich sie absetze und ein Spielset von Fisher-Price, das früher mir gehört hat, unter dem Sofa hervorziehe. Ich puste den Staub ab und schiebe es ihr hin. Zum Set gehörten eine Ziege und zwei Hühner, und eine der roten Scheunentüren ist kaputt, aber trotzdem geht Kayla in die Hocke und legt sich dann auf den Bauch, um die Plastiktiere hüpfen zu lassen.
»Guck, Jojo!«, sagt Kayla und lässt die Ziege auf und ab springen. »Baa baa«, sagt sie.
»Macht doch nichts«, sage ich. »Sie hört uns gar nich zu.«
Pop setzt sich hinter Kayla auf den Fußboden und lässt die noch heile Scheunentür auf und zu schnappen.
»Die ist ganz klebrig«, sagt er. Dann schaut er nach oben an die raue Decke und bringt seufzend einen Satz hervor, und dann noch einen. Er erzählt mir die Geschichte noch einmal.
Richie, so wurde er genannt. Sein richtiger Name war Richard, und er war gerade mal zwölf Jahre alt. Hatte drei Jahre gekriegt, weil er Essen geklaut hatte: Salzfleisch. Ne Menge Leute waren dort, weil sie Essen geklaut hatten, denn viele waren arm und hungerten, und auch wenn die Weißen unsere Arbeitskraft nicht mehr umsonst kriegten, taten sie alles, um uns nicht einstellen und bezahlen zu müssen. Richie war der kleinste Junge, den ich je in Parchman gesehen habe. Auf der riesigen Farm waren ungefähr zweitausend Männer, verteilt auf mehrere Arbeitscamps. Fast fünfzigtausend Morgen Land, verdammt. Parchman is’ ein Ort, wo einem am Anfang vorgegaukelt wird, dass es gar kein Gefängnis ist, du denkst, wird schon nicht so schlimm werden, weil’s ja keine Mauern gibt. Damals warn es bloß fünfzehn Camps, jedes davon mit Stacheldraht eingezäunt. Keine Ziegel, keine Steinmauern. Wir Insassen wurden Gunmen genannt, weil wir unter Aufsicht der Trusty Shooters, der Vertrauensschützen, arbeiteten, die selbst Insassen waren, die aber vom Direktor Gewehre kriegten, um den Rest von uns zu beaufsichtigen. Diese Trusty Shooters waren die Sorte Männer, die immer als Erste den Mund aufmachen, wenn sie in einen Raum kommen. Männer, die gern die Aufmerksamkeit auf sich ziehn, groß angeben mit den Schlägereien und Messerstechereien und Morden, die sie begangen haben, um an so ’nem Ort nach oben zu kommen, weil sie sich wichtiger fühlen, wenn sie beachtet werden. Die fühl’n sich nur wie echte Männer, wenn sie bei andern Angst sehn.
Als ich zuerst nach Parchman kam, hab ich auf den Feldern gearbeitet, hab gepflanzt und Unkraut gejätet und die Ernte eingebracht. Parchman war sofort als Arbeitsfarm zu erkennen. Du siehst die weiten Felder, auf denen wir gearbeitet haben, siehst, dass man durch den Stacheldraht durchgucken kann, dass man ihn greifen, mit dem Fuß Halt finden, sich mit einer blutenden Hand daran festhalten kann, siehst, dass sie die Bäume zurückschneiden und niedrig halten, sodass das Land bis ans Ende der Welt frei und offen daliegt, und du denkst, Hier kann ich rauskommen, wenn ich es mir nur fest genug vornehme. Ich kann den Sternen nach Süden folgen und den Weg nach Hause finden. Aber du denkst das nur, weil du die Trusty Shooters nicht siehst. Weil du den Sergeant nicht kennst. Nicht weißt, dass der Sergeant aus einer langen Reihe von Männern stammt, die darauf getrimmt wurden, dich wie ein Arbeitspferd zu behandeln, wie einen Jagdhund – und darauf getrimmt zu glauben, er könnte dich dazu bringen, es sogar noch zu mögen. Dass der Sergeant in einer langen Tradition von Aufsehern steht. Du weißt nicht, dass die Trusty Shooters wegen viel schlimmerer Sachen nach Parchman geschickt wurden, als wegen einer Schlägerei in einem Juke Joint. Weißt nicht, dass die Trusty Shooters, die Insassen-Aufseher, dort sind, weil sie Spaß am Töten haben und weil sie auf alle möglichen fiesen Arten gemordet haben, nicht nur andere Männer, sondern auch Frauen und –
Ich und Stag kamen in verschiedene Camps. Stag wurde wegen Körperverletzung verurteilt, ich wegen Beihilfe zur Flucht. Ich hatte auch vorher schon gearbeitet, aber noch nie so hart. Noch nie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf einem Baumwollfeld. Noch nie bei solcher Hitze. Da oben ist sie anders. Die Hitze. Da gibt’s kein Wasser, das im Wind mitfliegt und einen kühlt, deswegen steht dort die Hitze wie im Backofen. Wie in einem feuchten Backofen. Schon bald wurden meine Hände dick, und meine Füße waren ganz verkrustet und blutig, und ich kapierte, wenn ich da draußen auf den Feldern bei der Arbeit war, dann musste ich es schaffen, nicht daran zu denken. Ich durfte nicht an Papa oder Stag oder den Sergeant oder die Trusty Shooters oder die Hunde denken, die am Rand der Felder bellend und mit triefenden Lefzen rumrannten und davon träumten, ihre Zähne in eine Ferse oder einen Nacken zu schlagen. Ich vergaß das alles, ich bückte mich und kam hoch und bückte mich und kam hoch und dachte nur noch an meine Mutter. An ihren langen Hals, ihre ruhigen Hände, ihr Haar, das sie immer nach vorne geflochten hat, um ihren schiefen Haaransatz zu verbergen. Die Gedanken an sie waren wie die Glut eines erloschenen Feuers in einer kalten Nacht: warm und behaglich. Nur so konnte ich meinen Geist von mir selbst losmachen, ihn dort auf diesen Feldern hoch in die Luft fliegen lassen wie einen Drachen. Das musste sein, sonst wär ich im Laufe meiner fünf Jahre in Gefangenschaft irgendwann einfach auf die schmutzige Erde gesunken und gestorben.
Richie hatte nicht annähernd die Zeit. Es ist schwer genug für einen Mann von fünfzehn, aber für einen Jungen? Einen zwölfjährigen Jungen? Richie kam gut einen Monat nach mir dort an. Er marschierte weinend in das Camp, aber er weinte lautlos, ohne zu schluchzen. Die Tränen liefen einfach über sein Gesicht und machten es nass. Er hatte einen großen Kopf, der wie eine Zwiebel geformt war und für seinen Körper viel zu groß aussah: ein Körper, der nur aus Haut und Knochen bestand. Seine Ohren standen gerade vom Kopf ab, wie Blätter von einem Ast, und seine Augen waren sehr groß für sein Gesicht. Er blinzelte nicht. Er war schnell: ging schnell, ohne zu schlurfen, nicht so wie die meisten, wenn sie im Camp ankamen, sondern er hob die Füße, zog die Knie hoch, wie ein Pferd. Sie banden seine Hände los und brachten ihn in die Baracke, zu seiner Pritsche, und er legte sich im Dunkeln neben mich, und ich wusste, dass er immer noch weinte, weil seine schmalen Schultern zwar eingeklappt waren, aber noch bebten, wie die Flügel eines Vogels, der gerade gelandet ist; doch er gab immer noch keinen Laut von sich. Wenn die Nachtwachen vor den Barackentüren eine Pause machen, dann kann einem zwölfjährigen Jungen im Dunkeln alles Mögliche zustoßen, wenn er eine Heulsuse ist.
Als er im Dunkel des nächsten Morgens aufwachte, war sein Gesicht getrocknet. Er folgte mir zu den Latrinen und zum Frühstück und setzte sich neben mich auf die Erde.
»Ganz schön jung für einen Ort wie diesen. Wie alt biste? Acht?«, fragte ich ihn.
Er sah gekränkt aus. Runzelte die Stirn und sperrte den Mund auf.