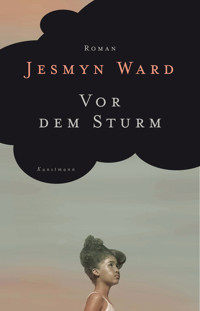20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein so gewaltiger wie zärtlicher Roman, der von den Schrecken der Sklaverei erzählt und von Annis, einer jungen Frau, die in sich die Stärke, Zuversicht und — Widerstandskraft findet, um sich selbst zu befreien. Annis wird in Sklaverei geboren. Als sie noch ein Kind ist, verkauft ihr Vater, der Plantagenbesitzer, ihre Mutter und, ein paar Jahre später, auch sie an die Sklavenhändler. Von den Reisplantagen South Carolinas treiben sie Annis und ihre Mitgefangenen zu den Sklavenmärkten von New Orleans. Aneinander gekettet und der Brutalität ihrer Aufseher sowie den Naturgewalten ausgesetzt, kämpfen sich die Geschundenen Hunderte Kilometer durch ein erbarmungsloses Land. Die »Lady«, die Annis schließlich kauft, ist für ihre Grausamkeit und Willkür gefürchtet. Auf ihrer Zuckerrohrplantage muss Annis fortan schuften und jeder Funke von Widerstand wird hart bestraft. Trost und Hoffnung findet Annis in der Liebe ihrer Mutter, die sie immer noch im Herzen trägt, und in der Erinnerung an die Geschichten, die ihre Mutter ihr von ihrer Großmutter Aza erzählte, einer afrikanischen Kriegerin. Sie handeln von einer Welt jenseits der gnadenlosen Wirklichkeit, einer Welt voller Mythen und Geister; aus ihnen schöpft Annis die Kraft, sich ihren Peinigern zu widersetzen, und den Willen, sich aus der Sklaverei zu befreien. Als sie auf Bastian trifft, der mit einer Gruppe der Sklaverei entkommener Frauen und Männer in der Wildnis Louisianas lebt, nimmt der Gedanke an Flucht immer konkretere Gestalt an und Annis entschließt sich, für ein Leben in Freiheit alles zu riskieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jesmyn Ward
SO GEHN WIRDENN HINAB
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch
von Ulrike Becker
Verlag Antje Kunstmann
Dieses Buch ist für Brandon, der mich gesehen und geliebt hat, sogar in der Zeit, als ich mich selbst weder sehen noch lieben konnte, und für Joshua, der mir als Erster gezeigt hat, dass Liebe eine lebendige Verbindung zu den Toten ist.
»Als sie verkauft wurde, ist ihre Mutter ohnmächtig geworden oder tot umgefallen, sie hat nie erfahren, was genau. Sie wollte zu ihrer Mutter, die drüben auf dem Boden lag, aber der Mann, der sie gekauft hat, ließ sie nicht. Er hat sie einfach mitgenommen. Hat sie abtransportiert wie ein Stück Vieh, muss man wohl sagen … Danach hat sie nie wieder von irgendwem aus ihrer Verwandtschaft gehört.«
»Interview mit Rogers, Will Ann«, aus: Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers’ Project, 1936 bis 1938
There was a ship,the Henrietta Marie,breaking against the furious water,and there were shacklesand the woman on deckher legs open in the hiss of a scream.… and I was there too,unfurling with them all …
– »Shark Bite« aus The World Is Roundvon Nikky Finney
… Dear singing river fullOf my blood, are we as loud under-Water? Is it blood that bindsBrothers? Or is it the MississippiRunning through the fattest veinOf America?
– Auszug aus »Langston’s Blues« ausThe New Testament von Jericho Brown
ERSTES KAPITELMAMAS KÄMPFENDE HÄNDE
Die erste waffe, die ich je hielt, war die Hand meiner Mutter. Damals war ich ein kleines Kind mit weichem Bauch. In jener Nacht weckte mich meine Mutter und führte mich hinaus in die Carolina Woods, tief in den Wald, zwischen die raunenden Bäume, schwarz geworden vom Weggang der Sonne. Die Knochen ihrer Finger: Schwerter in der Scheide, aber das wusste ich da noch nicht. Wir gingen bis zu einer kleinen Lichtung mit einem vom Blitz verbrannten Baum, weit weg von dem weitläufigen, cremefarbenen Haus meines Sires hinter den Reisfeldern. Weg von meinem Sire, der so weiß wie meine Mutter dunkel ist. Weg von dem Mann, der sagt, er besitzt uns, dem Mann, der meine Mutter antreibt, bis sie nur noch ein schwarzer Strich in der düsteren, engen Küche seines Hauses ist, wo sie die meisten wachen Stunden verbringt und Essen für ihn und seine beiden dicklichen, milchbleichen Kinder kocht. Ich war feingliedrig wie ein Vögelchen, mein Kopf berührte die Schulter meiner Mutter. In dieser Nacht vor langer Zeit kniete sich meine Mutter zwischen die Wurzeln des gespaltenen Baums und grub zwei lange, dünne Äste aus: Einer war am Ende angespitzt wie ein Speer, der andere geschlängelt und ungeschickt behauen.
»Da, nimm«, sagte meine Mutter und warf mir den krummen zu. »Den hab ich geschnitzt, als ich klein war.«
Ich verfehlte ihn, und der schartige Stock fiel ratternd auf die Erde. Ich hob ihn auf, umklammerte ihn so fest, dass die rauen Knubbel schmerzhaft drückten, und dann ließ meine Mutter den anderen dunklen Ast herabsausen. Sie hatte mich noch nie geschlagen: weder mit der Hand noch mit einem Stock. Schmerz flammte in meiner Schulter auf, durchzuckte gleich darauf auch die andere.
»Der hier«, knurrte sie leise unter dem Zischen ihrer Waffe, »hat meiner Mama gehört.« Ihr Speer war eine schwarze Peitsche in der Nacht. Ich ging zu Boden. Kroch rückwärts, krabbelte in das Unterholz, das diesen mitternächtlichen Ruinenraum umgab. Meine Mutter lauerte. Während sie mir im Gebüsch nachstellte, sprach sie mit mir, erzählte mir eine Geschichte: »Bleibt unser Geheimnis, das hier. Meins und deins. Kann uns keiner wegnehmen.« Ich wagte kaum zu atmen, duckte mich noch tiefer. Der Wind strich kreisend durch die Bäume.
»Du bist die Enkeltochter einer Kriegerin. Sie war mit dem Fon-König verheiratet, wurde von ihrem Daddy weggeschenkt, weil er so viele Töchter hatte, und er war reich. Der König hielt sich Tausende von Kriegerinnen. Die beschützten ihn, gingen für ihn auf die Jagd, kämpften für ihn.« Sie stocherte in dem Gebüsch über mir herum. »Die Kriegerinnen waren mit dem König verheiratet, aber ihr Ehemann war der Säbel, die Machete ihr Geliebter. Du bist mein Kind, Kind von meiner Mama. Von meiner Mutter, der Kämpferin – Azagueni hieß sie, aber ich hab sie Mama Aza genannt.«
Mama legte ihren Speer hin, stand da mit geöffneten Handflächen. Sie schimmerten silbern. »Komm, Annis. Komm raus, dann bring ich es dir bei.« Langsam kroch ich vorwärts, ihre Hiebe brannten immer noch. »Vergiss deinen Stock nicht«, sagte sie. Ich schob mich ein Stück zurück, ehe ich mich hochrappelte. Draußen blieb ich auf Zehenspitzen stehen, einen Fuß vor dem anderen, bereit, jederzeit wegzulaufen. Darauf gefasst, dass sie mich wieder schlagen würde. »Gut«, sagte sie mit Blick auf meine Füße, mein schwankendes Tänzeln. »Gut.«
Von jener Nacht bis zu dieser bin ich gewachsen. Ich kann jetzt auf den Kopf meiner Mutter hinabschauen, auf ihre dunklen Schultern, so schön und rund wie die Türknäufe, die ich im Haus meines Sires poliere. Meine Mutter hat zwar ein paar graue Haare, aber ihre Finger sind immer noch stark wie Dolche und sie hält sich aufrecht, steht schlank und kerzengerade im fahlen Licht des Vollmonds. Hierher, auf unsere versteckte Lichtung mit dem ausgebrannten Baum in der Mitte, kommen wir nur in den wenigen Nächten im Monat, in denen der Mond so hell scheint, dass wir kein Feuer brauchen. Meine Mutter inspiziert meine Hände, drückt jede einzelne Schwiele, massiert meine Handflächen. Ich bin zwar jetzt größer und breiter als sie, aber ich stehe noch genauso still wie das Kind mit den Zahnlücken von damals, genieße ihre Berührung, öffne mich ihrer Zärtlichkeit.
»Lange Finger hast du.« Meine Mutter klopft auf meine Handfläche, und meine Finger schließen sich schnell. »Heute Nacht übst du mit meinem Stock.«
»Hier«, sagt meine Mutter, als sie die Waffe ausgräbt, die Mama Aza ihr vermacht hat. Ihre geschlossene Hand gleitet über den langen Ast, der geschwärzt und warm vom Fett ihrer Hände ist, und von Mama Azas zuvor. Mama Aza hat Mama beigebracht, wie man damit kämpft, wollte unbedingt dieses Können, das sie von den Schwester-Ehefrauen auf der anderen Seite des großen Ozeans gelernt hatte, weitergeben.
Mama wirft mir die Waffe zu und nimmt ihren Kinderstock: gezackt wie ein Blitz. Ich schwitze, Angst beißt in meinen Achseln. Das Herz klopft mir in den Ohren. Mama lässt ihren Stock zischen, und wir fangen an zu kämpfen: Mit jeder Drehung, jedem Hieb, jedem Stoß wird meine Mutter feuriger, ist kaum wiederzuerkennen: Sie wird zu einer lechzenden, züngelnden Flamme. Es gefällt mir nicht, aber das spielt keine Rolle, denn ich muss parieren, abblocken, zustoßen. Die Welt ist nur noch ein Peitschen und Sirren, und wir wirbeln und drehen uns mit.
Als wir in dieser Nacht in unsere Hütte zurückkommen, die wir uns mit einer anderen Familie teilen, schlafen Nan und ihre zwei älteren Kinder. Die beiden kleinen sind wach, sie können nicht aufhören zu weinen. Unter ihren Decken halten sie einander umklammert, ihr Atem wird von Schluchzern zerhackt, während ihre Mutter und ihre Geschwister schlafen. Nan hat ihre Liebe zu ihren vier Kindern immer umgeleitet, hat sie auf ein Rinnsal gedrosselt, eine gelegentliche Milde in ihren Anweisungen: sei still, schsch, nicht weinen, und der Rest ihrer Zuwendung besteht nur aus Ohrfeigen und Fäusten. Sie will nicht lieben, was sie nicht behalten darf. Meine Mutter streckt einen Arm nach mir aus, wir kuscheln uns ein, und ehe sie einschläft, ergreife ich ihre Hand. Mama ist eine Frau, die ihr weiches Herz verbirgt: eine Frau, die mir mit laubraschelnder Flüsterstimme Geschichten erzählt, eine Frau, die mich wie eine Schwefellaterne durch die Finsternis der Welt geleitet, eine Frau, die mir ein Geschenk macht, wenn sie sich einmal im Monat selbst entblößt, um mir das Kämpfen beizubringen.
am nächsten morgen weckt mich meine Mutter vor Sonnenaufgang; vom Schwitzen in der Nacht riecht sie nach Heu, Magnolien und frischem Wildfleisch. Ich bin erschöpft. Am liebsten möchte ich mich umdrehen, mir unsere Decke über den Kopf ziehen und noch ein bisschen Schlaf schlucken, aber Mama streicht mir mit fester Hand über den Rücken.
»Annis, mein Kind. Wach auf.«
Also ziehe ich mich an und stopfe mir noch die Bluse in den Rock, während wir zum Haus meines Sires gehen. Schlecht gelaunt schlurfe ich hinter meiner Mutter her, die ein Stück vor mir geht, und kämpfe meinen Groll nieder. Mama rennt fast: Sie muss schnell an den Herd, muss das Feuer anzünden und schüren, den Ofen anheizen, um fürs Frühstück zu backen. Ich weiß, dass sie genauso zum Haus befohlen ist wie ich, mit allem, was ich sortieren, abliefern und sauber machen muss, um ihr an diesem Vormittag zu helfen, aber ich bin gereizt und müde – bis meine Mutter anfängt zu hinken, ein leichtes Seitenstechen in ihrem Gang sichtbar wird. Auch sie hat Schmerzen von gestern Nacht. Ich laufe zu ihr, schiebe meine Hand in den Knick ihres Ellbogens und streichle ihren Arm. Schaue hinunter auf die feinen Härchen in ihrem Ohr, auf ihr geflochtenes Haar.
»Mama?«, sage ich.
»Manchmal hab ich Lust auf Süßes«, haucht sie und klopft mit den Fingern an meine Hand. »Du auch?«
»Nah«, sage ich. »Ich mag Salz.«
»Mama Aza hat immer gesagt, Lust auf Süßes ist nicht gut. Ich war dauernd dahinter her, hab so viel süße Beeren gepflückt, dass meine Finger ganz fleckig wurden, rot und blau.« Mama seufzt. »Jetzt gerade kann ich an nichts anderes denken als an Süßes.«
Das Haus meines Sires ist riesig, innen ächzt und knarrt es. Meine Mutter beugt sich über den Herd. Ich sammle Holz und hole Wasser und trage beides nach oben, schaue dabei ins Zimmer der Töchter meines Sires. Sie sind meine Halbschwestern; ich weiß das, seit meine Mutter mir das Kämpfen beibringt, aber immer noch plagen mich jeden Morgen Neid und Abscheu, wenn ich sie bediene. Sie schlafen mit offenen Mündern, ihre Wangen sind rosig, und ihre Augenlider zucken wie Fische im flachen Wasser. Ihr rotes Haar ist wild und zottelig. Sie werden schlafen, bis ihr Vater sie mit einem Klopfen an der Tür weckt, lange nach dem ersten Morgenrot. Ich unterdrücke meine Gefühle und lasse mir nichts anmerken.
Mein Erzeuger sitzt im Morgenmantel am Schreibtisch. In seinem Zimmer riecht es muffig nach kaltem Rauch und altem Schweiß.
»Annis«, sagt er und nickt mir zu.
»Sire«, sage ich.
Ich rechne damit, dass sein Blick wie jeden Morgen über mich hinweggleitet, so wie Wasser über einen glatten Stein fließt. Aber er richtet die Augen direkt auf mich, sein Blick hakt sich fest und folgt mir dann durch das Zimmer, während ich seine Waschschüssel fülle, seine Kleidung einsammle, seinen Nachttopf aufhebe. Er taxiert mich auf dieselbe Art wie seine Pferde, mit einer Aufmerksamkeit, die so prüfend und konzentriert ist wie seine Hand auf einem langen, bemähnten Hals, einem muskulösen Schenkel, einem sattelfesten Rücken. Ich halte meinen Blick gesenkt, und erst auf der Treppe nach unten fällt mir auf, dass meine Hände zittern und sein Geschäft im Topf überschwappt.
Ich versuche, von ihm unbemerkt zu bleiben. Das ist etwas, das ich schon immer beherrscht habe: Ich versiegle meine Lippen und schweige. Während der Tag sich ausdehnt, gehe ich auf Zehenspitzen durch die weiten, halbdunklen Flure seines Hauses. Stelle Eimer und Schüsseln leise hin, setze das Metall langsam kreisend auf dem Boden ab. Ganz still stehe ich vor der Tür des Schulzimmers meiner Schwestern und höre zu, wie ihr Hauslehrer ihnen vorliest. Die Geschichten, die ich höre, sind nicht die Geschichten meiner Mutter: Es ist ein anderer Klang, ein anderer Gesang, der in meine Brust einsinkt und dort vibriert wie eine Messerklinge in lebendigem Fleisch. Die Mädchen, bleiche Schwestern, lesen aus den Texten, die der Lehrer ihnen vorlegt, alte Griechen, die über Tiere und Fleiß schreiben, Wespen und Bienen, und ich höre zu: »Man meint, daß Bienen auch an klirrendem Geräusch Gefallen finden, weswegen es Leute gibt, die sagen, daß sie sie in den Stock versammeln, indem sie mit Scherben und Steinchen klirrende Geräusche erzeugen.« Die Stimme der jüngeren Schwester sinkt zu einem Murmeln ab und hebt sich dann wieder. »Die Arbeiterbienen vertreiben die arbeitsscheuen und nicht sparsamen Bienen. Die Arbeiten sind unter ihnen aufgeteilt, wie zuvor gesagt wurde, und zwar haben die einen Arbeit mit dem Wachs, andere mit dem Honig, wieder andere mit dem Bienenbrot. Und die einen formen Waben, andere tragen Wasser in die Zellen und mischen es mit dem Honig …« Ich stehe auf den Kiefernholzdielen, atme durch und wiederhole die besonders starken Wörter: Wachs, Honig, Bienenbrot, Waben.
»Aristoteles bezeichnet die Anführer des Bienenschwarms als Könige«, sagt der Lehrer, »aber inzwischen hat die Wissenschaft herausgefunden, dass sie weiblich sind: Es sind Königinnen. Im antiken Griechenland wurden die Priester der Artemis ›Bienenkönige‹ genannt. Und ihrem Bruder Apollo sollen die Bienen die Gabe der Prophezeiung verliehen haben.« Der Lehrer lacht sarkastisch. »Das ist gotteslästerlicher Aberglaube. Doch was Aristoteles über die, die arbeiten, und über die Früchte dieser Arbeit sagt, ist fundiert: Lässt der Imker zu viel Honig im Stock, ermuntert er die Bienen zur Faulheit«, erklärt er mit hoher, leiser Stimme, fast so leise wie meine unsicheren Schwestern. Ich weiß, er spricht über Bienen und zugleich nicht über Bienen, die Bienen und die alten Griechen dienen ihm dazu, über uns alle zu reden, die wir die Arbeit machen. Ich weiß, er spricht über meine Mutter, die auf dem Herd in der Küche im Anbau backt und kocht, über Cleo und ihre Tochter Safi und mich, die die Zimmer aufräumen, den Staub aus den Teppichen klopfen und die Fußböden wischen, bis sie wie polierte Eicheln glänzen.
Eilig laufe ich nach unten zu meiner Mutter.
»Hast du wieder gelauscht?«, will sie wissen. Sie kann mich genauso gut lesen wie der Lehrer die Textstellen.
Ich nicke.
»Pass bloß auf«, flüstert sie und haut mit ihrem Kochlöffel gegen einen schwarzen Topf. Die Luft in der Küche steht, es riecht nach Pökelfleisch. »Wenn er das mitkriegt, wird er nicht freundlich reagieren.«
»Ich weiß«, sage ich. Ich möchte ihr noch mehr erzählen. Möchte ihr erzählen, dass ich die Zwillingstöchter meines Sires beneide, um ihre weichen Schultern, ihr helles Haar, das so fein wie Spinnwebseide ist, ihren Unterricht, ihre Bettwäsche, ihre cremefarbenen, hauchdünnen Kleider. Möchte ihr erzählen, dass ich mir beim Lauschen an ihrer Tür etwas nehme, etwas, das keine von ihnen mir freiwillig geben würde. Ich spreche die Worte des Lehrers im Stillen nach und versuche, kein schlechtes Gewissen zu haben, weil meine Mutter die Stirn runzelt und angstvoll mit ihrem Kochlöffel den Topf traktiert. Wachs, Honig, Bienenbrot, Waben. Wie soll ich mich dafür entschuldigen, dass ich mich nach einem Wort sehne, einer Geschichte, irgendetwas Schönem, das mir gehört?
»Tut mir leid, Mama«, sage ich und gehe nach draußen, um noch mehr Holz zu sammeln.
Eine einzelne Biene kurvt durch den Küchengarten: dick, schwarz gestreift, wunderschön. Sanft wie eine Fingerspitze landet sie auf meiner Schulter, und ich frage mich, welche Botschaft sie wohl überbringt und aus welchen Geisterwelten sie stammt. Es sind Königinnen, hat der Lehrer gesagt. Als die Biene auffliegt und in einer wippenden gelben Zucchiniblüte verschwindet, fegt Wind durch die Bäume, und einen Augenblick lang meine ich, in den Ästen ein Echo zu hören: Königinnen.
als ich das bettmeines Sires zurechtmache, sieht er mir vom kalten Kamin aus zu. Normalerweise ist er um diese Zeit unten, nippt an bernsteinfarbenen Drinks und trifft sich mit anderen Plantagenbesitzern: zugeknöpfte Westen, gedämpfte Gespräche, ab und zu wird es laut. Doch heute Abend sitzt er hier oben in einem Polstersessel, ein Stück aus der Mitgift seiner toten Frau. Beim Abendessen hat er über Fieber und eine verstopfte Nase geklagt und meine Mutter um ein Mittel gebeten: ein Gebräu aus Pilzen und Kräutern. Das stelle ich jetzt in einem Keramikbecher vor ihn hin. Er sitzt da mit ausgestreckten Beinen, die Stiefel mit Frühjahrsschlamm verklebt, und hält den Becher mit zwei Fingern. Seine Augen glänzen im Kerzenlicht, und ich schaue auf meine Hände, die glätten, schütteln, falten. Ich zwinge mich, schneller zu machen, damit ich aus diesem Zimmer herauskann, nach draußen in die mondhelle Nacht.
»Du bist größer als deine Mutter«, sagt er. Während die Stimme des Lehrers hoch und belegt ist, ist die von meinem Sire tief und rostig. Unwillkürlich zucke ich zusammen, lasse seine Bettdecke fallen. »Komm her«, sagt er. »Zieh mir die Stiefel aus.«
Das habe ich noch nie gemacht. Ich trete vom Bett zurück, blicke auf meine eigenen ausgetretenen Schuhe, die an den Seiten so abgetragen sind, dass ich meine Zehen sehen kann. Ich kann mich nicht rühren.
»Hast du nicht gehört«, sagt er. Sein rotes Haar funkelt. Es ist keine Frage.
Meine Mutter hat mir erzählt, wie mein Sire sie vergewaltigt hat. Wie er sie vor einem der leeren Schlafzimmer in einem der Flure im ersten Stock des Hauses abgepasst hat. Wie er sie in dieses leere Zimmer gestoßen, sie überwältigt und auf die Fußbodendielen gedrückt hat. Wie er sie auf ihre empfindlichsten Stellen geschlagen hat. Wie er sie dort vergewaltigt hat, und dann noch einmal unten am Fluss, und noch mal und noch mal, bis sie aufhörte zu zählen und mit mir schwanger wurde. Jahre später hat er die weiße Frau mit dem blonden Haar und den dünnen Handgelenken geheiratet, die schließlich bei der Geburt seiner Zwillingstöchter sterben sollte.
Als ich mich jetzt vor ihn hinknie, frage ich mich, ob meine Mutter damals wohl ihr Herz gespürt hat, ob es so schnell schlug wie das eines Kaninchens, das sich in der Dämmerung auf dem Feld vor dem Schatten des Habichts duckt. Ich ziehe an seinen Schnürsenkeln und muss dabei die Hand ausstrecken, denn ich habe mich möglichst weit von ihm entfernt hingekniet. In dieser ungeschickten Position tun meine Arme weh, aber die Senkel lösen sich, und so schnell ich kann ziehe ich ihm die Stiefel aus. Seine Socken riechen nach überreifem Käse. Er hebt einen Arm, scheint die Hand auf meinen Kopf legen, in mein Haar greifen und mich in seinen Schoß ziehen zu wollen, aber ich stehe schnell auf, taumele rückwärts und bin aus der Tür, ehe er auch nur eine Locke berühren kann. Trotzdem sehe ich noch, wie er auf meinen Mund starrt, und auf meine dichte, glänzende Mähne, die sich dem Flechten widersetzt und den gleichen Kupferschimmer wie sein eigenes Haar hat.
Ich werde sie mir abrasieren, jede einzelne Strähne.
der dotter des mondessteht hoch am Himmel, als meine Mutter mich weckt und wir uns aus der Hütte stehlen, weg von Nan und ihren Kindern, die mit den Zähnen knirschen und im Schlaf sprechen. Barfuß gehen wir zu unserer Lichtung, machen so wenig Geräusche wie möglich, treten vorsichtig mit den Fußballen auf blanke, sandige Stellen. Unsere Spuren verwische ich mit einem Zweig, den meine Mutter von einer Kiefer abgebrochen hat. Schon seit ich alt genug bin, um mich zu erinnern, bittet mich meine Mutter, es ihr zu erzählen. Erzähl’s mir, sagt sie oft, wenn dich irgendjemand anfasst. Sie sagt das schon, seit sie mir zum ersten Mal davon erzählt hat, wie mein Sire ihr nachgestellt und sie vergewaltigt hat. Bitte, Annis, sagte sie. Ich will ihr von meinem Sire erzählen, bevor wir kämpfen, aber sie gräbt Speer und Stock so schnell aus und schleudert sie durch die silbrig glänzende Luft, dass ich gerade noch meinen Stab in die Höhe schwingen kann, um ihren abzublocken, und schon wirbeln und schwirren wir, kommen zwischendurch zitternd zum Stopp, ehe wir erneut aufeinander losgehen. Mit jedem Abblocken, jedem Schlag, jedem Stoß zieht sich etwas in meiner Brust zusammen, immer fester und enger, bis es zu brennen anfängt. Wozu das alles, frage ich mich. Wozu das alles, wenn ich es doch nicht anwenden kann?
Der Mond steigt höher, und ich bin erschöpft, die Raserei unseres Kampfes hinterlässt nur noch ein bisschen Groll. Ich stoße in ihre Richtung und versuche zu vergessen.
»Wie hieß Azas Mama?«, frage ich.
Mama pariert mich, und ich durchbreche ihre Abwehr und berühre sie am Bauch.
»Weiß nicht. Hat Mama Aza nicht gesagt. Sie hat nur erzählt, als ihr Vater mit ihr los ist, um sie dem König zur Frau zu geben, ist ihre Mama ihnen gefolgt. Kilometerweit, bis zum Morgen, bis ihr Vater sich wütend umgedreht und ihrer Mutter erklärt hat, es wär für Mama Aza eine Ehre, dem König zu dienen, dass ihr Essen, Kleidung und Respekt sicher wären: als Ehefrau eines Königs. Hat nur erzählt, wie ihre Mama da ihr Gesicht in beide Hände genommen hat, sie auf die Wangen und die Stirn geküsst hat und ihr was zuflüstern wollte, aber vor lauter Weinen konnte sie nicht sprechen.« Mama drückt meinen Ellbogen nach unten. »Mama Aza hat gesagt, als ihr Vater und sie nach Dahomey kamen, wo der König wohnte, da ist die Machete ihre Mama geworden. Der Speer ihr Daddy.«
Mama runzelt die Stirn, ihr Gesicht wird so faltig wie ein Tischtuch.
»Die Kriegerinnen wurden bedient. Aber sie waren auch selbst Dienerinnen. Mussten trainieren und paradieren. Mussten tun, was der König sagte. Und Kriegerinnen durften keine Familie haben, keine Babys kriegen. Das war gegen das Gesetz des Königs.«
Ich halte inne, stecke Mamas Stock in den Sand, der von unseren Füßen festgetreten ist.
»Erzähl mir von meinem Großvater«, sage ich bittend und schaue auf meine Zehen. Unsere Füße haben die gleiche Form. Mama hält inne. Sie hat mir die Geschichte schon oft erzählt, zum ersten Mal als ich noch klein war, bei einer unserer ersten Übungsstunden.
»Mama Aza liebte einen Soldaten, der vor den Burgmauern Wache hielt, und nahm ihn sich als Liebhaber.« Sie runzelt die Stirn. »Der König schickte sie und den Mann, der sie liebte, an die Küste. Sie wurden zu den weißen Männern gebracht, zu dem Wasser, das kein Ende hat. Mama Aza musste durch eine Tür an den Strand gehen, und die Weißen haben sie auf ein Schiff gesteckt.« Meine Mutter erwischt mit ihrem Stock meine Bluse und zieht, ehe sie wieder loslässt. »Sie haben sie geraubt. Hierher verschleppt.« Sie zieht noch mal an meiner Bluse. »Wieso fragst du?«
Ich zucke die Achseln. Ihr zweiter Zeh ist länger als der große. Genau wie bei mir. Schuhe tun uns weh.
»Mama Aza kannte die Macht der Männer schon, bevor sie auf das Schiff kam. Als ihr Daddy sie zum Palast brachte, sagte der König zu ihrem Vater: Ich nehm sie zur Frau, aber sie ist dem Säbel verpflichtet, dem Bogen, der Axt. Mama Aza sagt, sie waren Hunderte, Hunderte Ehefrauen und ein König.«
Mama schwenkt ihren Stab, und ich blocke ihn ab.
»Keine andern Männer durften im Palast wohnen, nur der König«, sagte Mama.
Bestimmt gab es dort auch keine anderen Männer, die genug Macht gehabt hätten, um Mama Aza zu taxieren, sie abzuschätzen, so wie mein Vater mich abgeschätzt hat. Keinen Mann außer dem König: stattlich, reich mit Schmuck behängt, edel gekleidet. Vielleicht war noch sein Tononu da, der Hausherr und Eunuch, der hinter ihm stand.
Ich frage mich, was die Mitglieder des königlichen Haushalts in meiner Großmutter gesehen haben. Ob sie etwas sahen, das von Kraft zeugte, das verriet, dass sie mehr aushalten konnte, als ihr Körperbau vermuten ließ. Wenn meine Mutter mir Mama Azas Geschichten erzählt, sehe ich sie im Geiste vor mir, schlank und rank wie meine Mutter. Aber manchmal denke ich auch, ich könnte mich irren und die Königsfrauen haben in Mama Aza nur ein Mädchen wie mich gesehen: schlaksig, biegsam, mit knochigen Hüften. Vielleicht hatte Mama Aza gelernt, ihre Wildheit so gut zu verbergen, dass alles, was die Frauen und der König sahen, bloß ein dünnes, von einem unsichtbaren Faden aufrecht gehaltenes Mädchen war, das trotzig dastand.
Als der König Mama Aza zur Amazone erklärte, war sie da erleichtert? Froh zu wissen, dass sie nicht schön genug war, um eine seiner echten Ehefrauen zu werden? Dass sie nicht unter ihm zu liegen brauchte, sich ihm nicht hingeben und ihm dann Blut, Babys und Brustmilch liefern musste? War sie froh, dass sie stattdessen lernen sollte, seine anderen Bedürfnisse zu befriedigen, sein Verlangen nach Blut und Beute zu stillen? Ihn im Kampf verteidigen und für ihn Elefanten jagen sollte, mit Messer und Speer? Ihm Bündel liefern sollte, in denen Köpfe statt Babys lagen? Oder bekümmerte es sie, durch ein anderes unsichtbares Band gefesselt zu sein, sich selbst aufgeben zu müssen in diesem Palast voller Frauen, die Leibeigene eines einzigen Mannes waren?
»Ich versteh nicht, warum Mama Aza den Namen ihrer Mutter nicht verraten wollte. Sie hat mir beigebracht, dass die Ahnen kommen, wenn man sie ruft. Dass sie helfen, wenn man in der Not zu ihnen betet«, sagt Mama und schwenkt wieder ihren Stock. Ich blocke nicht rechtzeitig ab. »Vielleicht fand sie, ihre Mama hätte mehr tun sollen, um sie bei sich zu behalten, und hat den Schmerz noch gespürt.« Mama stößt zu, und ich pariere. Die Nacht ist still ohne Menschen, aber laut von den Insekten um uns herum. »Manche glauben, die Gestorbenen kommen zurück, wenn sie auf schlimme Art sterben, so furchtbar, dass die Große Gottheit sich abwendet. Die Fon glaubten, die Geister kommen uns zu Hilfe, wenn wir sie rufen, egal warum und egal wann. Du greifst an«, sagt Mama. Ich schwinge meinen Stab, sie blockt ab, schwingt ihren, und ich wehre ihn gerade noch ab. Mein Atem geht schneller als er sollte. Mama tritt einen Schritt zurück, den Stab in Bereitschaft. »Denk nicht so von mir, hörst du? Ich bin immer für dich da. Auch nach der Zeit hier, in der nächsten. Immer.« Sie kommt nah heran, so nah, dass unsere Knie sich fast berühren, und wischt die Nässe von meinem Gesicht: Es ist halb ein Streicheln, halb ein Schlag. »Also, warum fragst du noch mal nach Mama Azas Geschichte?«
Ich erzähle es meiner Mutter, mit stockender Stimme. Meine Worte überschlagen sich, als die Panik, die ich in dem Zimmer gespürt habe, aus mir herausquillt, und ich muss die Augen schließen, um weitersprechen zu können, um die Geschichte herauszubringen.
»Er hat«, sage ich.
Mama nickt.
»Mich belauert wie ein Jagdhund«, sage ich.
Sie blinzelt.
»Seine Schuhe. Seine Füße.«
Sie wird ruhig, still.
»Nach meinem Kopf gegriffen«, sage ich.
Wenn sie traurig ist, presst meine Mutter ihre Lippen zu einem Strich zusammen und wendet den Kopf ab; ihre Wange ist dann wie ein geschlossener Vorhang. Das hab ich zum ersten Mal gesehen, als ich noch klein genug war, um ganz auf ihren Schoß zu klettern. Ich war beim Rennen hingefallen und hatte mir die ganze Wade aufgeschrammt. Wenn sie wütend ist, verschränkt meine Mutter die Arme vor dem Bauch, so als könnte sie ihren Zorn dort festhalten; das hab ich gesehen, als mein Sire seine Töchter in ihren feinen schwarzen Kleidchen an sich presste, während seine Frau ins Grab hinuntergelassen wurde, und ich wusste, es lag daran, dass er davor die ganze Woche lang vor lauter Trauer jeden Teller, den meine Mutter auf den Tisch stellte, sofort auf den Boden, an die Wand oder an die Decke geworfen hatte. Mama und ich haben damals tagelang auf Knien gelegen und geschrubbt und geschrubbt. Jetzt hält sich meine Mutter wieder den Bauch, der Speer klemmt in ihrem Ellbogen.
»Warum«, frage ich. »Warum machen wir das hier, wenn wir doch nichts damit anfangen können?« Ich lasse meinen Stock fallen.
Meine Mutter schließt die Augen, legt ihren Speer weg und hockt sich hin. Ich hocke mich so neben sie, dass unsere Arme sich berühren.
»Mama Aza hat mir das beigebracht«, sagt Mama und schaut nach oben in den saucenbraunen Himmel, die Arme immer noch fest um den Bauch gewunden. »War so ziemlich das Einzige, was sie mir beibringen konnte. Das hier, und das Sammeln.«
Ich streichle mit einem Finger ihren Arm, all unsere harten Hiebe sind von dieser Lichtung verschwunden.
»Dieses Land, diese Menschen, diese Welt hier«, seufzt Mama, »waren neu für sie. Sie wusste nicht, wie sie sich darin bewegen soll. Kannte die Ordnung nicht. Schon ein paar Monate nach dem Schiff hat sie es herausgefunden. Als sie mich gerade geboren hatte, kam der alte Master in ihre Hütte und hat Anspruch auf mich erhoben. Ich war noch klebrig vom Geburtsblut, und ich hab gebrüllt. Dieses Besitzen von der Geburt bis zum Grab und noch länger, über die Kinder hinaus – diese Welt hat sie einfach überwältigt.«
Ich fasse in die weiche Haut unter Mamas Achsel, eine der wenigen zarten, fleischigen Stellen an ihr.
»Dieser Ort hat ihr Angst eingeflößt«, flüstert Mama. »Als ich älter wurde, dachte ich, ich wüsste Bescheid. Dachte, ich hätte kapiert, wie unrecht das hier ist, aber so war’s nicht.« Mama drückt auf ihren Bauch. »Ich hab’s erst richtig kapiert, als du schreiend aus mir herauskamst.«
An dieser einen Stelle ist die Haut meiner Mama so weich wie ein Schweinemagen, wie helle, plüschige Innereien.
»Mama Azas Kampfkunst weiterzugeben, dir ihre Geschichten zu erzählen – das ist ein Weg, uns an die andere Welt zu erinnern. An ein anderes Leben. Auch keine perfekte Welt, aber so unrecht wie diese war sie nicht.«
Mama drückt meine Finger.
»Wir sollten das nicht vergessen«, sagt sie.
Die Bäume über uns wippen und winken mit ihren Zweigen. Die Baumruine ächzt.
»Weißt du noch, was Mama Aza als Erstes gelernt hat, als sie Königsfrau wurde?«
Ich nicke.
»Rennen«, sage ich.
Mama schnaubt.
»Wenn er wieder so ankommt, rennst du weg«, sagt sie. »Zu wissen, wann man dableiben und wann man weglaufen muss, wann man lieber nicht kämpfen sollte, also, das gehört zum Kämpfen auch dazu. Wann man abwarten, ausharren, beobachten und sich ducken muss, das muss man auch wissen.«
Wir bleiben bis kurz vor der Morgendämmerung auf der Lichtung sitzen, beide so aufgeregt, dass wir uns aneinanderschmiegen, Arm in Arm die Augen schließen und immer wieder kurz einnicken. Schließlich stehen wir auf, vergraben unsere stumpfen Waffen, ich werfe eine letzte Handvoll Sand über das Holz, und der Wind kommt zur Ruhe. Alles ist still, bis an meinem Ohr ein Summen ertönt, ein fedriges Geräusch. Eine pechschwarze Biene schwebt auf dieser Kampflichtung in der vergehenden Nacht auf und ab. Mama und ich gehen zu den Hütten zurück, die Arme fest ineinander verschränkt. Sie stützt sich auf mich, ich halte sie aufrecht.
wir werfen nur einen blick auf die stillen Hütten und gehen direkt zum Haus meines Sires.
»Heute fangen wir früher an«, sagt Mama, während sie das Feuer im Herd anzündet und in das bauchige Innere pustet. »Vielleicht sind wir dann früher fertig«, sagt sie, und ich weiß warum. Sie will schnell vorankommen, damit ich nicht wieder vor meinem Sire niederknien muss.
»Ja, Mama«, sage ich und mache mich ans Wasserholen.
Doch die Stunden dehnen sich trotzdem. Meine bleichen Schwestern verlangen extra Waschwasser. Der Hauslehrer beschwert sich über Staub und verlangt, dass ich die Regale in der zum Schulzimmer umgewandelten Kinderstube putze und poliere. Mein Sire will frische Bettwäsche, sagt, die vom Abend vorher würde wegen seines Fiebers nach Schweiß stinken. Bei Einbruch der Dämmerung bin ich immer noch nicht fertig. Als es für die Familie Zeit zum Schlafengehen wird, schlage ich das Bett meines Sires unwillkürlich schnell und nachlässig auf; die freundliche Cleo und Safi mit den gelben Augen sind schon unten. Als sie gegangen sind, um mir das Bettmachen zu überlassen, hätte ich Safi, die fürsorgliche Safi, die mir immer zu Hilfe kommt, wenn ein Wassereimer zu schwer ist, die immer da ist, um beim Zusammenlegen der Laken mit anzufassen, am liebsten zurückgerufen. Sie hätte kapiert, dass ich Hilfe brauche. Aber meine Stimme hat mir nicht gehorcht. Mein Atem geht rasselnd. Lauf weg, sage ich zu mir selbst. Lauf weg, hat Mama gesagt.
Mein Sire stolpert durch die offene Tür: Er hat sich beeilt, heraufzukommen. Ich stopfe die letzte Ecke des Lakens unter seine Matratze, richte mich auf, balanciere auf den Fußballen. Mache einen Schritt in Richtung Tür. Lauf, hat Mama gesagt, lauf weg. Aber wo soll ich denn hin, sagt eine schwache Stimme. Ich atme ein, dann noch mal; die Luft im Zimmer ist kühl, aber sie brennt in meiner Nase, und ich weiß, ich kann mich nicht mit dem abfinden, was er mir antun will. Ich weiß, ich kann mich nicht so gut beherrschen wie meine Mutter, weiß, dass ich mich wehren, meine Ellbogen wie Hämmer einsetzen werde, meine Beine wie Stöcke, dass ich aus meinen Knien Fäuste machen werde. Ich denke an Mama Aza, wie sie in einer der Hütten hockt, das Baby im Arm, die Nachgeburt noch in ihr drin, und der Vater dieses Mannes, mein Großvater, vor ihr steht, und wie es in ihrem Kopf gedröhnt haben muss: Das hier ist Unrecht, Unrecht, Unrecht. Ich höre es jetzt. Das Wissen gräbt sich in mich ein.
»Annis?« Die Stimme meiner Mutter vom Flur draußen. Sie hat die Zimmertür aufgestoßen und steht im Türrahmen. »Wir sind fertig.« Mit den Armen umschlingt sie ihren Bauch. Sie hat den Kopf gesenkt, aber dann hebt sie ihn, und ich weiß, dass auch Blicke Waffen sind und Augen glitzern können wie kleine Messer, die Sorte, mit denen man Fische ausnimmt. Ich habe noch nie jemanden so an meinem Sire vorbeischauen sehen, wie meine Mutter es jetzt tut, als wäre er ein umherschwirrendes Insekt, das es nicht wert ist, wahrgenommen oder gar weggewedelt zu werden. »Komm«, sagt sie.
Auch bei meinem Sire gibt es bestimmte Anzeichen von Zorn, aber auf die achte ich nicht. Ich drücke mich an ihm vorbei und gehe zu meiner Mutter, zu ihrer Schwerthand, in den langen, düsteren Flur, die knarrenden Stufen hinunter, durch die stille Küche, den raschelnden Garten, hinaus in die lärmende Nacht. Wir gehen an den Hütten vorbei, an den Feldern, hinein in den Wald bis zu unserer Lichtung. Wir entfernen uns so weit vom Haus meines Sires wie wir nur können. Statt unsere Waffen auszugraben, bereiten wir uns ein Bett auf der Erde, die wir mit unseren Füßen weich gestampft haben, und nehmen unsere Arme als Kopfkissen. Meine Mutter schmiegt sich an meinen Rücken, ihr Atem streift zart meinen Nacken.
»Es gibt Kräuter«, sagt Mama. »Morgen such ich welche. Wir sollten sie dahaben.« Sie umfasst meinen Bauch und zieht mich eng an sich. »Er wird nicht aufhören. Nach dem ersten Mal hab ich jedes Mal das hier umklammert«, flüstert Mama. Sie zieht etwas aus ihrem geflochtenen Haar, das wie eine dünne weiße Ahle aussieht.
»Was ist das?«
»Hat Mama Aza gehört. Ein Stück vom Elefantenstoßzahn. Hat sie von einer ihrer Jagden mitgebracht.« Mama legt das Ding in meine Hand, und es fühlt sich glatt und warm an, wie ihre Haut.
»Als ich über den Gedanken weg war, es ihm in den Hals zu rammen, genau hierhin«, sie berührt meinen Nacken direkt unter dem Ohr, wo mein Herzschlag pocht, »hab ich immer dran gedacht, dass noch ganz viel in mir war, was er mir nicht wegnehmen konnte.«
Der Wind rüttelt an den Ästen der Bäume.
»Mama Aza hat gesagt, einen Elefanten zu erlegen ist für Kleine ein guter Weg, zu lernen, wie man Große besiegen kann. Dass man schlau sein muss, listig. Wenn du das nicht bist, überlebst du nicht.« Mama schiebt die Elfenbeinahle wieder in ihr Haar. »Denk immer daran, hörst du. Du brauchst dieses Elfenbein nicht, auch nicht unsere Stöcke. In dieser Welt bist du selbst die Waffe.«
Der Mond bleicht den Himmel aus; als wir einschlafen, ist er schon fast untergegangen.
In der Stunde vor der Morgendämmerung ist die Welt vollkommen still. Ich wache auf, das leise Schnarchen meiner Mutter im Ohr. Ich schiebe meine Hand an ihrem Unterarm entlang bis zu dem Muskel unterhalb der Schulter und drücke, fest genug, um den Widerstand ihres Körpers zu spüren, aber sanft genug, um sie nicht zu wecken. Drehe mich auf den Rücken, um ihr Gesicht zu sehen, ihren offenen Mund, ihre entspannten Wangen. Der Mond ist hinter den Bäumen verschwunden, doch sein Licht durchflutet noch unsere Lichtung: milchiges Glas. In manchen Nächten genieße ich diese Momente ganz für mich allein; was meine Mutter mir beim Kämpfen abverlangt, hole ich mir jetzt zurück. Das Gesicht meiner Mutter ist so entspannt wie das eines Kindes, ihre Glieder sind mir so nah, dass es meine eigenen sein könnten. Ich lege eine Hand auf ihren Hals, spüre das Blut in den Adern, den roten Strom, der sie an mich bindet. So kann ich mich nur bei ihr fühlen.
In der Baumruine über uns surrt und brummt es, und plötzlich ist die Lichtung von einem kratzigen Flüstern erfüllt. Ich kneife die Augen zusammen, schaue in den Himmel und sehe schwarz gepunktete Girlanden, die mit einem Summen aus dem Stamm aufsteigen. Während ich über den Flaum am Arm meiner Mutter streiche, brauche ich noch mehrere Augenblicke, die sich wie Honig in die Länge ziehen, bis ich das dunkle Geschehen, den pfeifenden Gesang entziffert habe: Ein Volk von Bienen hat sich in dem Baum niedergelassen, und jetzt wachen sie auf und schwärmen in der Morgendämmerung aus. Ein bisschen noch, denke ich. Ich werde meine Mutter noch ein bisschen schlafen lassen, sie ein bisschen länger im Traumland gen Himmel fliegen lassen, ehe ich sie wecke und hierher zurückhole.
Noch einen Atemzug, denke ich und spüre den Herzschlag meiner Mutter in ihrem Hals. Einen Atemzug noch.
monate später, als ich am Ende des Wegs, der von den Hütten in die Felder führt, den Georgia-Mann stehen sehe, und neben ihm meinen Sire, der auf mich und meine Mutter zeigt, bohre ich meine Fingernägel in die Handfläche meiner Mutter, um sie aufzuhalten.
»Mama, nein«, sage ich.
»Komm«, sage ich, so wie sie, als sie mich das erste Mal zum Kämpfen geweckt hat.
»Bitte«, sage ich.
Ich drehe mich um zu den Hütten, dem Wald, der weit entfernten Lichtung. Ich ziehe am Arm meiner Mutter, versuche, sie zum Weglaufen zu bewegen, aber sie will nicht. Sie bleibt stehen und packt mich am Kragen. Die Tränen laufen ihr schon übers Gesicht, und sie versucht gar nicht erst, sie wegzuwischen, den Schmerz ihres Kummers zu verbergen. Am Himmel hängen dicke Wolken, die Luft ist schwer vom aufziehenden Regen, und es riecht stark nach Wasser. Meine Mutter hat nur Augen für mich, nichts anderes. Sie streicht mit beiden Händen über ihr Haar, dann über meins, und ich spüre einen scharfen Stich in der Kopfhaut: Die Elfenbeinahle, die an ihren Platz geschoben wird. Dann spüre ich nur noch den Druck ihrer Handflächen an meinen Wangen, auf meinen Ohren, während sie mein Gesicht festhält, damit ich sie ansehe.
»Annis, meine Arese«, sagt sie mit bebender Stimme. »Ich liebe dich. Ich liebe dich, meine Kleine.« Einer der Helfer des Georgia-Manns kommt zu uns und packt meine Mutter an der gleichen weichen Stelle am Arm, an der ich sie so oft angefasst habe. Um uns herum schreiende Menschen; in der Ferne leuchtet ein Sommerblitz. Die Georgia-Männer ergreifen Männer, Frauen und Kinder auf dem Weg zu ihrer Arbeit. Sie sondern diejenigen aus, die verkauft werden sollen. Sind gekommen, um ihre Ware abzuholen und nach New Orleans zu treiben. In mir senkt sich ein schweres Gewicht, ein Strudel, der nach unten zieht, immer tiefer. Bestimmt geht unter uns die Erde auf. Bestimmt wird diese schreckliche Welt mich verschlucken. Ich packe die Handgelenke meiner Mutter, die sehnig wie Korngarben sind, und heule laut.
»Mama«, sage ich.
»Ich werde immer bei dir sein«, sagt meine Mama, und nein, wird sie nicht, denke ich, wird sie nicht, während der am nächsten stehende Georgia-Mann, einer mit dicken Armen und dreckigem Gesicht, sie meinem Griff entreißt. Sie von mir wegzerrt. Mein Sire hat sie für den Markt ausgewählt.
»Nein«, sage ich.
Einen noch, denke ich und entreiße dem Mann meine Mutter mit solcher Kraft, dass sie wie ein Speer auf mich zu schnellt. Er packt sie und zieht erneut, und wir sind drei Menschen von vielen, die sich auf dem Weg ein Gerangel liefern, bis der Georgia-Mann, der neben meinem Sire steht, eine Pistole aus seinem Holster zieht und in die Luft schießt. Die Panik lässt uns erstarren, kann aber weder meine Liebe beschwichtigen noch mein rasendes Bedürfnis, meine Mutter hier zu behalten, hier, hier bei mir. Ich falle in den Staub und umschlinge ihre Beine.
»Mama«, hauche ich in ihre Röcke. Ihre freie Hand findet meinen Kopf.
Einen Atemzug noch, denke ich.
ZWEITES KAPITELIN FESSELN
Ich kann nicht schlafen, seit mein Sire meine Mutter verkauft hat. Cleo übernimmt den Platz meiner Mama in der Küche; der Herd ist jetzt ihr großer eiserner Elefant. Das Putzen und Pflegen des Hauses, das Helfen in der Küche und das Bedienen bei Tisch fallen mir und Safi zu.
Nachdem der Georgia-Mann meine Mama mitgenommen hat, um sie in den Süden, auf die Märkte von New Orleans zu bringen, kann ich nicht mal mehr Safi oder Cleo direkt ins Gesicht schauen. Habe kein Interesse mehr, an der Tür des Schulzimmers meiner Schwestern zu lauschen. Lasse das Wasser in den Eimern überschwappen, putze mit hastigen, oberflächlichen Bewegungen, wasche die Kleidung so flüchtig, dass der Gestank meines Sires und der Dreck meiner Schwestern gar nicht erst rausgeht. Erledige meine ganze Arbeit so schnell, dass ich nie mit dem Mann, der meine Mutter verkauft hat, allein in einem Zimmer bin. Kann noch nicht mal bei Nan und ihren Kindern in der Hütte schlafen. Gehe stattdessen nachts in den Wald, auf unsere Lichtung, zu dem schwarzen, von Bienen verstopften Baum. Ich laufe weg, in jeder Hinsicht.
Obwohl wir Hochsommer haben, sind die Nächte auf der Lichtung kalt. Zwischen den Wurzeln des Baums wickle ich mich in die Decke, die ich mir mit meiner Mutter geteilt habe. Ich liege auf der Seite, die Lippen an meinen Unterarmen, spüre, wie die Kälte vom Nacken meine Wirbelsäule hinunter und über den Po bis zu den Grübchen in meinen Kniekehlen wandert, und weiß, dass mir noch nie so kalt gewesen ist, dass so jetzt mein Leben ist, ohne meine Mutter, die sich an meinen Rücken schmiegt, die Arme um mich schlingt, die Hände auf meinen Bauch legt. Dass es sich so anfühlt, wenn man allein ist. Ohne Geborgenheit zu schlafen bedeutet, wach zu liegen. So viel zu weinen, dass mir die Spucke aus dem Mund läuft und unter meinem Gesicht eine Pfütze bildet. Zu spüren, wie die Bienen, die ich inzwischen als meine Bienen betrachte, nachts herunterkommen, auf meinen Handgelenken oder Füßen landen und sich dann wieder erheben, in ihren Stock zurückkehren. Ich frage mich, welchen bitteren Nektar sie wohl bei mir sammeln. Frage mich, wohin sie meinen Kummer tragen. Frage mich, ob mein Schluchzen für sie ein beruhigendes Rufen ist, und warum sie die einzigen Zeugen meiner Trauer sind. Ohne meine Mutter zu schlafen bedeutet, noch vor dem Morgengrauen zum Haus meines Sires zu gehen, in der Küche in einer Ecke zu sitzen, während Cleo sich mit dem Herd abmüht, und mich nicht darum zu scheren, dass mein Haar stumpf vor Schmutz ist, mein Gesicht schlammverschmiert.
Ein Tag wird zum nächsten. Eine Nacht wird zur nächsten. Die Hitze löst sich aus der Erde, die Blätter werden braun und fallen ab, Sonne und Mond sind nur bleiche Lichter am Himmel. Nirgends ist Wärme. Unsere Waffen grabe ich nicht aus. Unter dem festen Druck des Windes kuschele ich mich auf unserer Lichtung in den Erdboden. Ich schaue durch meinen Sire hindurch, durch meine Schwestern, durch Cleo, durch Safi, und kenne in dieser neuen Welt nichts als Trauer. Ich sehe niemanden, bis ich eines Tages Safi sehe, die sich am Weihnachtsmorgen mit einem nassen Lappen in der Hand vor mich hinkniet und mein Kinn anhebt. Sehe niemanden, bis Safi ihre Hand in meine legt, mich aus meiner Ecke zieht, mich zu den Waschbottichen führt und mich dort aus meinen Kleidern schält.
»Ich bin’s, Annis. Ich bin’s«, sagt Safi, und dann kippt sie mir becherweise Wasser, das sie extra warm gemacht hat, über den Kopf und fängt an, mich abzuschrubben.
»Du bist hier«, sagt Safi, und mein Gesicht bricht auf.
Ich lasse zu, dass sie mich wie ein Kind wäscht. Als sie mir ein Zeichen gibt, mich hinzusetzen, sinke ich vor ihr auf den Boden, und sie kämmt mit ihren Fingern mein Haar durch, entwirrt es Strang für Strang.
»Was ist das?«, fragt sie, als sie die lange Elfenbeinnadel herauszieht. Ich habe sie seit dem Tag, als der Georgia-Mann meine Mutter geholt hat, nicht angefasst.
»Das hat meine Großmutter von der anderen Seite des Ozeans mitgebracht. Sie hat’s meiner Mama gegeben. Meine Mama hat’s mir gegeben.« Ich krümme mich. »Als sie weggeholt wurde.«
Safi legt das Elfenbein auf ihren Oberschenkel, bevor sie meine Haare wäscht, ausspült und einölt. Als sie sich vorbeugt und anfängt, sie eng am Kopf zu flechten, übt sie dabei genauso viel Druck aus wie meine Mutter, dreht mein Haar mit der gleichen Spannung ein wie meine Mama. Safis Beine sind nicht so stark, fühlen sich aber genauso weich an wie Mamas. Ich sage nichts, kann aber die salzigen Tränen, die mir übers Gesicht laufen, nicht stoppen. Als Safi fertig ist, schiebt sie die Elfenbeinnadel zurück an ihren Platz, verbirgt sie unter meinem Haar.
Mir ist warm.
nachdem wir mit der arbeit im hausfertig sind, gehe ich zur Hütte zurück, in einen alten Überwurf gehüllt, den Safi mir umgelegt hat, die Schultern bis zu den Ohren hochgezogen. Ich fröstele wieder, bin leer. Meine Füße sind eiskalt. In der Hütte sitze ich in einer Ecke, während draußen der Wind über die Stämme der Holzwände streicht, hocke ruhelos in der Wärme des kleinen Feuers, im Schimmer von Nans Kindern, die sich gegenseitig Lieder vorsingen. Ich frage mich, wo meine Mutter wohl ist auf der Welt. Frage mich, ob es für sie eine kleine Festtagsleckerei gegeben hat – einen Streifen Gekröse, ein Stückchen Schweinefuß, einen Schluck warme Brühe mit Salzfleisch. Massiere meine Schläfen, versuche, die schmerzenden Fragen wegzukneten.
Als ich aus der Hütte trete, um zur Lichtung zu gehen, steht Safi da, ihr Tuch in der bitterkalten Nachtluft dicht um die Schultern gezogen. Heute ist kein Vollmond; ich habe das Zu- und Abnehmen aus den Augen verloren, spüre nur den immer härter werdenden Frost des Jahres: Tribut an meine Trauer. Auch heute Nacht will ich der Kälte trotzen, auch wenn ich sauber bin, auch wenn die seidig glänzende Erinnerung an die Wärme mir wie eine lästige Katze folgt, denn ein Teil von mir wünscht sich, der Winter möge mich mit seiner frostigen Hand packen, möge alle Hitze und Trauer und Gegenwart aus mir herausquetschen, bis zum letzten Tropfen. Möge nur meine äußere Hülle im Wurzelwerk der Bäume zurücklassen. Ich frage mich, ob ich selbst dann wegfliegen könnte, als Geist, in Richtung Süden. Ob ich meine Mama dort unten finden würde, irgendwo.
»Du wolltest weg?«, fragt Safi und schaut durch die über ihrer Stirn aufgetürmten Haare zu mir hoch. Die Strähnen sind gleichmäßig und fein geflochten, und Safis Augen sind so feucht und dunkel wie die meiner Mutter. Ich blicke dorthin, wo unsere Lichtung ist, und nicke.
»Es ist kalt«, sagt Safi. Sie zieht ihr Tuch fester um sich und runzelt die Stirn. Wenn wir servieren oder Sachen schleppen oder putzen, ist ihr Gesicht immer so ruhig und glatt, dass es seltsam ist, wenn es sich verzieht. »Darf ich heute Nacht bei dir schlafen?«
Protest schäumt in mir auf, blubbert in meiner Kehle. Es ist eng in der Hütte. Nan und ihre Kinder sind laut, selbst im Schlaf. Und was im Stillen, aber deutlich dagegenspricht: Das Bettzeug ist schmutzig von meinen Nächten auf der Lichtung. Es riecht nicht mehr nach meiner Mutter. Aber das sage ich Safi nicht. Ich schaue nach unten auf die Stufe, auf der ich stehe, und ich denke an die Wärme in der Waschküche, an das Gewaschenwerden, die Berührung des heißen Lappens, den Safi geschwungen hat, und kann nicht Nein sagen.
»Er will meine Mama dahaben«, sagt Safi, »im großen Haus.«