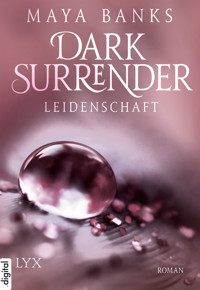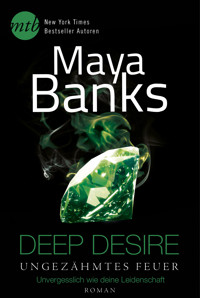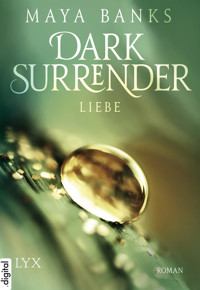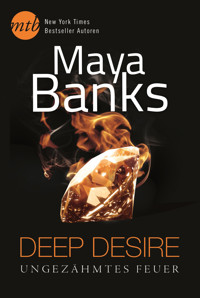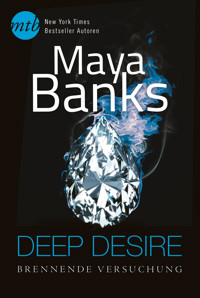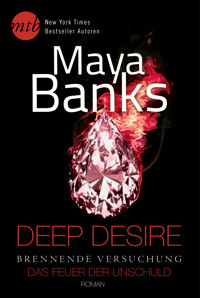9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Slow-Burn-Reihe
- Sprache: Deutsch
Als die Schwester des wohlhabenden Caleb Devereaux entführt wird, wendet er sich in seiner Verzweiflung an die junge Ramie. Sie besitzt eine ungewöhnliche Gabe: Sie kann eine psychische Verbindung zu Entführungsopfern herstellen und sie dadurch aufspüren. Ramie will Caleb unbedingt helfen, denn dieser weckt eine Leidenschaft in ihr, die sie noch nie zuvor für einen Mann empfunden hat. Doch ihre Fähigkeit fordert einen hohen Preis von ihr und bringt sie schon bald selbst in Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Die Autorin
Impressum
MAYA BANKS
SLOW BURN
Dunkle Hingabe
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Firouzeh Akhavan-Zandjani
Zu diesem Buch
Caleb Devereaux und seine Brüder sind verzweifelt. Ihre kleine Schwester wurde entführt, und alle Versuche, ihren Aufenthaltsort zu bestimmen, verlaufen erfolglos. Nach Tagen der Angst weiß Caleb nur noch einen Ausweg: Er wendet sich an Ramie St. Claire, die eine besondere Gabe besitzt: Sie kann eine mentale Verbindung zu vermissten Personen herstellen und sie dadurch aufspüren. Doch ihre Fähigkeit fordert einen hohen Preis: Alle Qualen und Ängste der Opfer empfindet Ramie währenddessen genauso schmerzhaft und intensiv. Obwohl durch ihre Hilfe unzählige Menschenleben gerettet werden konnten, hat jeder Einsatz ein Stück von ihr zerstört. Ramie weiß, dass ein weiterer Fall sie das letzte bisschen Kraft kosten könnte. Aber als Caleb vor ihr steht – attraktiv, mächtig und außer sich vor Sorge –, willigt Ramie ein, ihm zu helfen. Zwischen ihnen entflammt eine heiße Leidenschaft, die sie beide nicht ignorieren können. Und als sich herausstellt, dass ein Unbekannter es auf Ramies Leben abgesehen hat, ist Caleb der Einzige, der zwischen ihr und dem Tod steht …
Für May Chen, weil sie so beharrlich war und mich eine Geschichte schreiben ließ, die ich schon seit Jahren in meinem Kopf herumgetragen hatte.
xoxo …
1
Caleb Devereaux bog aus einer scharfen Biegung der gewundenen Straße auf einen Weg ab, der zu der winzigen Berghütte führte, und fluchte, als er von einem Schlagloch ins nächste holperte. Er brodelte förmlich vor Wut und Ungeduld, doch die erleichterte Freude darüber, Ramie St. Claire nach einer anstrengenden Suche endlich gefunden zu haben, sorgte dafür, dass seine Stimmung nicht völlig im Keller war.
Ramie war die einzige und letzte Hoffnung für seine Schwester Tori.
Caleb hatte seine Suche nach Ramie St. Claire von dem Moment an begonnen, als Tori entführt worden war. Sie war sicherlich niemand, auf den man als Erstes setzte, wenn man auf der Suche nach einem geliebten Menschen war. Ramie war Hellseherin und hatte bei früheren Gelegenheiten beim Aufspüren von Opfern geholfen. Viele mochten ihr vielleicht skeptisch gegenüberstehen, doch Caleb war von Ramies Fähigkeiten überzeugt.
Seine eigene Schwester besaß auch hellseherische Fähigkeiten.
Er und seine Brüder, Beau und Quinn, waren in Bezug auf ihre kleine Schwester immer überängstlich gewesen. Aus gutem Grund. Caleb stand an der Spitze eines Imperiums, daher hatte Sicherheit immer höchste Priorität. Sie hatten immer Angst vor Entführungen gehabt, die begangen wurden, um Lösegeld zu erpressen, aber in ihren schlimmsten Albträumen wären sie nicht auf die Idee gekommen, dass Tori einfach verschwinden und der Gnade eines Wahnsinnigen ausgeliefert sein könnte.
Es hatte keine Lösegeldforderung gegeben … nur ein Video von einer an Händen und Füßen gefesselten Tori und das irre Lachen ihres Entführers, als dieser Caleb sagte, er solle sich von seiner Schwester verabschieden.
Er hoffte nur, dass es noch nicht zu spät war. Himmel, es durfte einfach nicht zu spät für Tori sein.
Es machte ihn rasend vor Wut, dass Ramie St. Claire vor drei Monaten einfach von der Bildfläche verschwunden war. Sie hatte sich einfach in Luft aufgelöst und natürlich auch keine Adresse hinterlassen. Es gab noch nicht einmal Hinweise darauf, dass sie jemals existiert hatte. Wie konnte sie sich einfach aus dem Staub machen, wenn sie so eine unschätzbare Hilfe beim Aufspüren von Entführungsopfern und Vermissten war? Wie selbstsüchtig war es, sich so dringend benötigter Hilfe zu verweigern?
Als er schließlich bei der kleinen Hütte ankam, die nicht so aussah, als würde sie den nächsten Winter überstehen, hatte er sich in seine Wut hineingesteigert.
Er stieg aus und marschierte zu der morschen Tür und hämmerte mit der geballten Faust dagegen. Die Tür wackelte und knackte unter der Gewalt seiner Schläge, doch nur Schweigen antwortete ihm, was seinen Blutdruck in unermessliche Höhen trieb.
»Miss St. Claire!«, brüllte er. »Machen Sie die verdammte Tür auf!«
Er donnerte wieder mit der Faust gegen die Tür und brüllte, dass sie endlich öffnen sollte. Wahrscheinlich sah er genau wie der Verrückte aus, der seine Schwester festhielt, und klang auch so, aber das war ihm mittlerweile egal. Er wusste vor Verzweiflung nicht mehr ein noch aus. Er hatte alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um Ramie endlich aufzuspüren. Und er würde erst wieder gehen, wenn er die Informationen erhalten hatte, deretwegen er gekommen war.
Dann ging die Tür auf, und er wurde vom Anblick einer zierlichen Frau mit argwöhnischen grauen Augen empfangen. Einen Moment lang war er verblüfft und verstummte, als er Ramie St. Claire zum ersten Mal persönlich gegenüberstand.
Die Fotos, die er von ihr gesehen hatte, wurden ihr nicht gerecht. Sie strahlte eine Zartheit aus, als wäre sie dabei, sich von einer Krankheit zu erholen, doch das verbarg ihre Schönheit nicht im Geringsten. Sie wirkte … zerbrechlich. Das, worum er sie bitten wollte, ließ kurz Schuldgefühle in ihm hochkommen, doch er schob sie gleich wieder zur Seite. Wenn es um das Leben seiner Schwester ging, war ihm kein Preis zu hoch.
»Ich kann Ihnen nicht helfen.«
Die leise gesprochenen Worte strichen wie Samt über seine Ohren, was im völligen Widerspruch zu der Wut stand, die ihre Weigerung bei ihm hervorrief. Er hatte seine Bitte noch nicht einmal vorgebracht, und schon erteilte sie ihm eine Abfuhr.
»Sie wissen doch nicht mal, worum ich Sie bitten will«, erklärte er mit so eisiger Stimme, dass die meisten Leute in sich zusammengesackt wären.
»Das ist doch offensichtlich«, erklärte sie erschöpft. Die Müdigkeit zog ihre Augenlider nach unten. »Warum sollten Sie den weiten Weg sonst auf sich nehmen? Ich will nicht einmal wissen, wie Sie mich gefunden haben. Mein Versuch, meine Spuren zu verwischen, muss wirklich erbärmlich gewesen sein, wenn es Ihnen gelungen ist, mich aufzuspüren.«
Caleb runzelte die Stirn. War sie krank gewesen? War sie deshalb von der Bildfläche verschwunden … um sich wieder zu erholen? Doch jetzt, da er sie gefunden hatte, spielte das keine Rolle mehr. Die Gründe, warum sie versucht hatte unterzutauchen, waren ihm egal.
»Warum sollten Sie es einem – bei Ihren Fähigkeiten – so bewusst schwer machen, Sie aufzuspüren?«, fragte er. »Das Leben meiner Schwester steht auf dem Spiel, Miss St. Claire. Ich bitte Sie nicht nur darum, mir zu helfen, sondern werde erst wieder gehen, wenn Sie es getan haben.«
Sie schüttelte heftig den Kopf, und Furcht vertrieb alle Trägheit aus ihrem Blick. »Ich kann nicht.«
In ihren Worten lag ein Anflug von Verzweiflung, die ihm sagte, dass mehr hinter ihrer Weigerung steckte, als auf den ersten Blick ersichtlich war. Irgendetwas stimmte nicht, trotzdem konnte er keine Reue aufbringen, dass er sie zwang einzuwilligen … nicht wenn es dabei um Toris Leben ging.
Er griff in seine Jacke und holte Toris Schal hervor. Der Schal war das Einzige, was er an der Stelle gefunden hatte, wo sie entführt worden sein musste … auf dem Parkplatz eines Supermarktes neben der offenen Tür ihres Wagens. Er hätte sie nie allein hinfahren lassen dürfen. Er hatte sie im Stich gelassen. Er hatte bei ihrem Schutz versagt. Er hatte nicht genügend für ihre Sicherheit gesorgt.
Ramie wich mit einem verzweifelten Schrei auf den Lippen zurück. Er kam sofort hinterher, drückte ihr den Schal in die Hände und hielt sie und den Schal fest, sodass es kein Entkommen gab. Sie stieß ein ersticktes Schluchzen aus und warf ihm einen waidwunden Blick zu, während ihr Gesicht unnatürlich bleich wurde. In ihren Augen war ein kurzes Flackern zu sehen, dann umwölkte sich ihr Blick, Schmerz verzeichnete ihre zarten Züge, und es war zu erkennen, dass sie jeden Moment zusammenbrechen würde.
»Nein«, flüsterte sie. »Nicht noch einmal. Oh Gott, nicht noch einmal. Ich überlebe das nicht.«
Die Beine gaben unter ihr nach, und sie wäre zusammengeklappt, hätte er sie nicht aufgefangen und dafür gesorgt, dass der Schal weiter ihre Hände berührte. Voller Entsetzen sah er mit an, wie Ramie in sich zusammensackte und seinen Armen entglitt, obwohl er sein Bestes tat, sie festzuhalten. Sie lag leblos und schlaff wie eine Gliederpuppe auf dem Boden. Er hockte sich sofort hin, um dafür zu sorgen, dass sie Toris Schal nicht wieder losließ. Aber das schien im Grunde keine Rolle mehr zu spielen. Ramie war längst an einem anderen Ort.
Ihr Blick trübte sich, und ihr Körper begann, sich zuckend zu verkrampfen. Sie nahm eine fötale Haltung ein, und die Hilflosigkeit, die aus dieser instinktiven Schutzreaktion sprach, traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Sie stöhnte leise und fing dann an zu weinen.
»Bitte, tun Sie mir nicht wieder weh. Bitte, ich flehe Sie an. Mehr kann ich nicht mehr ertragen. Wenn Sie mich umbringen wollen, tun Sie’s einfach, aber hören Sie auf, mich zu quälen.«
Eisige Kälte schoss Calebs Rücken hinauf, als er Ramies Stimme hörte, die fast mit der von Tori identisch war. Gütiger Himmel, wurde er etwa durch Ramie Zeuge, was seiner Schwester gerade widerfuhr?
Die Szene, die Ramie wiedergab, war entsetzlich. Nicht nur dass seine Schwester offensichtlich gerade schlimmste Qualen durchlebte, sondern dass Ramie allem Anschein nach mit ihr litt.
Natürlich hatte er Erkundigungen über Ramie St. Claires Fähigkeiten eingeholt, doch es hatte nur wenige Informationen gegeben, die über ihre erstaunliche Erfolgsquote hinausgingen. Nirgendwo war erwähnt worden, wie es ihr gelang, den Opfern zu helfen, oder was es ihr selber antat. Der Himmel stehe ihnen bei. Was hatte er getan?
Ihr Körper zuckte, und Caleb brauchte nur einen Moment, um zu erkennen, was gerade passierte. Es war zu unübersehbar. Übelkeit stieg in ihm hoch, und er musste tief Luft holen, um zu verhindern, dass er sich auf den Boden übergab. Tränen brannten in seinen Augen, während er durch das Fenster von Ramies Bewusstsein hilflos mit ansah, wie seine Schwester vergewaltigt wurde.
Ramies Schluchzen zerriss ihm das Herz, und er zog sie in seine Arme. Ihm fiel nichts anderes ein, als sie sanft zu wiegen. »Tori?« Er wisperte versuchsweise den Namen seiner Schwester, denn er wusste nicht, ob über Ramie eine Verbindung hergestellt worden war. »Kannst du mich hören? Ich bin’s … Caleb. Sag mir, wo du bist, Liebes. Ich werde dich holen. Bitte, halte durch. Gib nicht auf, egal wie schlimm es ist.«
Ramies Kopf flog zur Seite, sofort zeichnete sich der Abdruck einer Hand auf ihrer Wange ab. Caleb war entsetzt und wusste nicht, was er tun sollte, nachdem er eine Linie überschritten hatte, von der es kein Zurück mehr gab. Er versuchte, seine Schuldgefühle zu verdrängen, und sagte sich, dass alles, was ihm half, seine Schwester zurückzuholen, gerechtfertigt war. Aber war es gerechtfertigt, dafür eine unschuldige Frau zu quälen?
Er hatte ihr keine andere Wahl gelassen. Sie hatte Nein zu ihm gesagt, trotzdem hatte er sie gezwungen, ohne zu wissen, welchen Tribut sie dafür würde zahlen müssen. Er hatte keine Ahnung gehabt, wie das Hellsehen bei ihr ablief, doch als er jetzt mit eigenen Augen sah, was es mit ihr machte, tat es ihm in tiefster Seele weh. Kein Wunder, dass sie sich so heftig gesträubt hatte. Kein Wunder, dass sie gesagt hatte, sie könnte es nicht mehr tun.
»Ramie. Ramie!«, sagte er mit etwas mehr Nachdruck. »Kommen Sie zurück zu mir, Ramie. Kommen Sie zurück, sodass Sie mir sagen können, wie ich Tori finden kann.«
Ramies Augen waren geöffnet, doch der Blick war in die Ferne gerichtet, sodass er sah, dass sie gar nicht da war. Der Handabdruck auf ihrem Gesicht hob sich grellrot von ihrer totenbleichen Haut ab. Er sah einen Ausdruck unendlicher Verzweiflung in ihren Augen, sodass er aufs Neue mit den Tränen kämpfen musste.
Plötzlich klappte sie wie ein Taschenmesser zusammen, während ihr Körper zusammenzuckte, als hätte ihn ein heftiger Schlag getroffen. Sie schlang die Arme um ihre Mitte, und er erkannte, dass sie getreten worden war … … oder dass Tori getreten worden war. Es war ein entsetzliches, hilfloses Gefühl zu wissen, dass zwei Frauen gequält wurden … und eine davon seinetwegen.
Dann rollte sie auf die Seite, sodass ihre Wange auf dem kalten Boden lag. Ihr Blick war starr und leer. Sie regte sich überhaupt nicht mehr, und Entsetzen packte ihn. War Tori tot? Gütiger Himmel! War er gerade Zeuge der Ermordung seiner Schwester geworden?
»Ramie! Wachen Sie auf! Gütiger Himmel, bitte, wachen Sie auf. Sagen Sie mir, wie ich Tori finden kann. Sagen Sie mir, dass sie noch lebt!«
Er nahm Ramies leichten Körper hoch und fluchte, weil sie so dünn und zerbrechlich war und auf seinen Armen kaum etwas wog. Er trug sie zum abgenutzten Sofa und legte sie vorsichtig ab, denn er wollte ihr nicht noch mehr Schmerzen zufügen, als sie bereits erlitten hatte.
Er saß auf der Kante, griff nach ihren eisigen Händen und rieb sie, um ihnen etwas Wärme einzuhauchen. Er hatte keine Ahnung, was er machen sollte. Sollte er sie in ein Krankenhaus bringen?
Doch nach einiger Zeit blinzelte sie und schien aus ihrer Trance zu erwachen. Sofort lag wieder ein schmerzerfüllter Ausdruck auf ihren Zügen, und sie begann aufs Neue leise zu weinen, wobei ihm jede Träne tief ins Herz schnitt.
»Ist sie noch am Leben?«, fragte er voller Angst. »Wissen Sie, wie man sie finden kann?«
»Ja«, erwiderte Ramie benommen.
Hoffnung stieg in ihm auf, und er merkte, dass er beinahe ihre Hände zerdrückte.
»Sagen Sie mir, wo«, drängte er.
Flüsternd und unter Schmerzen beschrieb sie ihm den Ort in allen Einzelheiten. Angesichts der Genauigkeit, mit der sie nicht nur den Ort, sondern auch den Entführer beschrieb, krochen ihm Schauer den Rücken hoch. Sie konnte sogar das Autokennzeichen nennen.
Er griff nach seinem Handy und rief seinen Bruder an, um die Informationen, die er von Ramie erhalten hatte, weiterzuleiten. Als das erledigt war, sah er hilflos auf Ramie hinunter. Einerseits erfüllte ihn Dankbarkeit, andererseits auch höchstes Bedauern darüber, was für Qualen er sie ausgesetzt hatte.
»Was muss ich tun, um Ihnen zu helfen?«, fragte er leise.
Lähmende Resignation trübte ihren Blick noch mehr. »Es gibt nichts, was Sie tun könnten«, erklärte sie mit tonloser Stimme. »Gehen Sie einfach.«
»Den Teufel werde ich tun, Sie so einfach in diesem Zustand zurückzulassen!«
Er überlegte, dass er sie mitnehmen könnte. Dann wäre es möglich, ihr die Fürsorge angedeihen zu lassen, die sie offensichtlich benötigte, während Tori das bekam, was für sie vonnöten war.
»Ihre Schwester braucht Sie. Gehen Sie einfach. Mir geht’s bald wieder gut.«
Die Lüge war so offensichtlich, aber mehr Überzeugungskraft schien sie nicht aufbringen zu können. Er war hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, einerseits zu Tori zu eilen und andererseits zu bleiben, um sicherzustellen, dass mit Ramie alles in Ordnung war. Doch wie sollte sie so etwas überhaupt jemals überwinden? Zwei Frauen würden mit dem Schrecklichen, das sie durchgemacht hatten, bis ans Ende ihrer Tage leben müssen … seine kostbare Schwester und die Frau, die er gezwungen hatte, ihm zu helfen, ohne zu wissen, welchen Preis sie dafür zahlen würde.
»Bitte«, flehte sie mit brechender Stimme. »Gehen Sie einfach, und lassen Sie mich in Ruhe. Sie haben bekommen, was Sie wollten. Ich habe Ihnen geholfen … also gehen Sie. Das ist das Mindeste, das Sie für mich tun können.«
Caleb stand auf und fuhr sich aufgewühlt mit der Hand über Kopf und Nacken. »Ich gehe, aber ich werde zurückkommen, Ramie. Ich werde es wiedergutmachen.«
»Das kann man nicht wieder rückgängig machen«, flüsterte sie. »Für das, was passiert ist, gibt es keine Wiedergutmachung. Gehen Sie, und kümmern Sie sich um Ihre Schwester. Sie braucht Sie.«
Sie schloss die Augen, Tränen quollen unter ihren Lidern hervor. Wie konnte er sie zurücklassen? Aber wie konnte er andererseits nicht sofort zu seiner Schwester stürzen, um sie in Sicherheit zu bringen? So hin und her gerissen war er noch nie in seinem Leben gewesen.
»Wenn in Ihnen noch ein Funken Menschlichkeit ist, dann gehen Sie jetzt und erzählen niemandem, wo Sie mich gefunden haben«, erklärte Ramie mit heiserer Stimme. »Bitte, ich flehe Sie an. Gehen Sie! Er hat vor, sie morgen umzubringen. Bei Tagesanbruch. Sie haben also nicht viel Zeit.«
Ihre Worte erwiesen sich als der Anstoß, den er gebraucht hatte, um sich in Bewegung zu setzen. Aber zum Teufel … er würde es wiedergutmachen. Irgendwie.
Eine Woge der Reue durchströmte ihn. Noch schlimmer war die Erkenntnis, dass er nicht behaupten konnte, er würde irgendetwas anders machen, nachdem er jetzt wusste, was ihm vorher nicht klar gewesen war. Er würde wieder genauso handeln, wenn dadurch über Leben und Tod von Tori entschieden wurde. Aber zumindest verstand er jetzt, warum Ramie sich so gewehrt hatte. Wenn er sie jetzt ansah, hielt er sie nicht mehr für egoistisch und grausam. Er erkannte jetzt, dass sie aus reinem Selbstschutz verschwunden war. Er wusste nicht, wie sie so etwas in der Vergangenheit überwunden hatte. Er hoffte bloß inständig, dass sein Handeln nicht den Ausschlag gegeben hatte, dass sie sich endgültig nicht mehr erholen würde.
Caleb schloss die Augen und berührte dann ganz sanft ihre Wange. »Es tut mir so leid. Sie ahnen ja gar nicht, wie sehr. Meine Familie und ich schulden Ihnen mehr, als wir Ihnen jemals zurückzahlen können. Ich werde jetzt erst einmal gehen und hoffe inständig, dass ich nicht zu spät komme. Aber ich werde zurückkehren, Ramie. Verlassen Sie sich darauf. Ich werde es wiedergutmachen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.«
2
Ramie stemmte sich auf dem Sofa hoch, hatte aber nicht einmal die Kraft aufzustehen. Caleb war vor ein paar Minuten gegangen. Zwar hatte er sich ihr nicht vorgestellt, doch sein Name war die ganze Zeit in Tori Devereaux’ Kopf präsent gewesen. Caleb war ihr letzter Bezugspunkt zur Realität, während der Entführer sie immer weiter an den Rand des Wahnsinns brachte.
Sie konnte Mitleid und sogar Verständnis für Calebs Handlungsweise aufbringen, ihm sogar beinahe verzeihen, was er getan hatte. Aber sie würde es niemals vergessen können. Das war das Schlimmste. Die Bilder, die Erinnerung daran, hatten sich für immer in ihrem Gehirn eingebrannt.
Tränen zogen einen schmerzenden Pfad über ihre Wangen. Sie fühlte sich ganz hohl und leer … gar nicht mehr wie ein Mensch. Immer wieder war sie aller Menschlichkeit beraubt worden.
Sie nahm alle Kraft zusammen, kam hoch und zwang sich, Entsetzen und Schmerz standzuhalten, die ihr den Atem nahmen, wie eine Woge, von der man überrollt wird. Denn die Verbindung zu Tori Devereaux war nicht unterbrochen worden, nachdem sie den Schal nicht mehr gehalten hatte. Ramie war sich immer noch allzu deutlich bewusst, was sie gerade durchmachte. Sie könnte eine Stunde oder gar einen ganzen Tag weiter mit ihr verbunden sein. Ramie konnte nur hoffen, dass die Verbindung bald unterbrochen wurde.
Sie musste weglaufen. Sie musste so weit weg wie möglich und dieses Mal dafür sorgen, dass wirklich niemand sie finden konnte … dass er sie nicht finden konnte. Denn wenn es Caleb Devereaux gelungen war, dann würde es auch der Mann schaffen, der sie hartnäckig verfolgte. Sie könnte es nicht ertragen, auch nur noch einmal das durchzumachen, was sie gerade eben erlebt hatte, noch war sie sich sicher, ob sie sich jemals wieder davon erholen würde. Zu viel war zu kurzfristig, zu schnell auf sie eingestürmt. Bis jetzt war sie nicht einmal in der Lage gewesen, die Suche nach dem letzten Opfer zu verarbeiten, und eben war sie gezwungen worden, genau das Gleiche noch einmal zu tun.
Benommen schlurfte sie wie eine alte Frau in das winzige Badezimmer der Hütte. Sie konnte sich nicht einmal dazu aufraffen, Caleb für das zu hassen, was er getan hatte, denn sie wusste, was Verzweiflung war. Sie war ihr immer wieder begegnet. Wer konnte schon sagen, ob sie nicht genau das Gleiche tun würde, wenn das Leben eines geliebten Menschen auf dem Spiel stand?
Doch nein … für sie gab es keine geliebten Menschen. Sie nahm an, dass sie irgendwann auch mal Vater und Mutter gehabt hatte. Irgendwo. Als Schatz war sie ausgesetzt worden und deshalb immer ein Fürsorgefall gewesen. Sie hatte nie echte Bindungen aufgebaut, weil sie von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht worden war.
Die Entdeckung ihrer übersinnlichen Fähigkeit hatte sie ihren Pflegeeltern noch mehr entfremdet. Man hatte sie mit Furcht angesehen, als wäre sie kein menschliches Wesen mit Empfindungen. Ihre Zeit bei der letzten Pflegefamilie, in der man sie untergebracht hatte, war voller Entsetzen und Gewalt zu Ende gegangen.
Seitdem hatte Ramie nur noch allein gelebt. Sie hatte sich nie dazu durchringen können, einem anderen Menschen so weit zu vertrauen, dass sie sich auf ihn einlassen konnte. Es störte sie nicht, immer für sich zu sein. Sie genoss es sogar.
Nur manchmal … trauerte sie um das, was sie niemals gehabt hatte und auch nie haben würde. Ein normales Leben. Freunde und Familie. All die Dinge, die für die meisten Menschen selbstverständlich waren. Ramie würde nie den Fehler machen, das für selbstverständlich zu halten. Wenn ihr jemals die Gnade zuteilwerden sollte, eine Familie oder Freunde zu haben, würde sie jeden einzelnen Tag achten und nichts für normal und selbstverständlich halten. Das ging schon deshalb nicht, weil sie immer wieder Zeuge von Tod und unvorstellbarem Grauen geworden war.
Wo sollte sie jetzt hin? Wo konnte sie sicher sein, dass keiner sie finden würde? Sie wollte einfach verschwinden.
Dieses Mal sollte es für immer sein. Sie konnte nur hoffen, dass es ihr endlich gelingen würde, alle Spuren zu verwischen und sich gut zu verstecken, um sicherzustellen, dass keiner sie fand. Denn wenn der Mann, dessen Sinnen und Trachten darauf ausgerichtet war, sie zu vernichten, sie jemals finden sollte, würde sie sterben. Und ihr Tod würde nicht schnell und schmerzlos sein. Sie würde eines qualvollen Todes sterben und bei jedem Atemzug beten, dass er endlich ihr letzter sein möge.
3
Als sein Flugzeug landete, erfuhr Caleb, dass Tori tatsächlich an dem Ort gefunden worden war, den Ramie beschrieben hatte. Sein Bruder Beau berichtete ihm grimmig von ihrem Zustand, und obwohl Caleb durch Ramie erfahren hatte, was passiert war, empfand er es trotzdem wie einen Fausthieb in den Magen zu wissen, dass seine kleine Schwester so eine schreckliche Behandlung durch ihren Entführer erlitten hatte.
Was ihn jedoch noch mehr in Wut versetzte war, dass man Toris Entführer nicht festgenommen hatte. Sie war allein gewesen, in einem normalen Haus in einem friedlichen, familienfreundlichen Vorort von Houston, als die Polizei das Haus gestürmt und sie angekettet im Badezimmer gefunden hatte.
Sie war wie ein Tier behandelt worden, das nur mit ganz wenig Essen und Wasser am Leben erhalten worden war. Laut Beau hatte sie Gewicht verloren und war dehydriert. Das Schlimmste aber war, dass Beau am Telefon zusammengebrochen war, als er versucht hatte, Toris Zustand zu beschreiben.
Dabei war Beau ein stabiler Mensch. Von den vier Devereaux-Geschwistern war eigentlich er immer der gewesen, der kaum je ins Wanken geriet. Er zeigte nie Gefühle, seine Miene war immer ausdruckslos. Trotzdem war er gerade dann in Tränen ausgebrochen, als er mit Caleb sprach. Ein eindeutiger Hinweis darauf, in was für einem schlimmen Zustand Tori sich befand.
Quinn, Calebs jüngster Bruder, war die ganze Zeit bei Tori geblieben und hatte sie auch ins Krankenhaus gefahren, wo Beau jetzt auf Calebs Ankunft wartete.
Als Caleb Toris Krankenzimmer betrat, wurde er von Beau aufgehalten, der ihm bedeutete, mit nach draußen zu kommen. Caleb schüttelte den Kopf. Er würde nirgends hingehen, ehe er nicht seine Schwester gesehen hatte. Er musste sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass sie am Leben war und ihr nichts mehr passieren konnte … Es war ihm egal, wie schlimm der Anblick sein mochte.
Quinn, der neben Toris Bett stand, schaute mit leiderfülltem Blick auf. Caleb kam leise näher, denn er wollte Toris Schlaf nicht stören.
»Man hat ihr was gegeben, damit sie schlafen kann«, erklärte Quinn leise. »Sie war völlig hysterisch, und wer könnte ihr das verübeln? Ach, Caleb, was hat sie durchmachen müssen!«
Quinn stieß die letzten Worte mit erstickter Stimme hervor, ehe er verstummte und sein feucht schimmernder Blick wieder zu seiner Schwester wanderte.
Caleb betrachtete Tori und bemerkte, wie mitgenommen sie aussah. Unter ihren Augen waren schwarze Ränder, ihr Gesicht war bleich, und sie war viel zu dünn. Ihm stockte der Atem, als er den Handabdruck auf ihrer Wange bemerkte, der genauso aussah wie der, der auf Ramies Gesicht erschienen war, als er sie gezwungen hatte, Toris Schal in die Hand zu nehmen. Wieder empfand er Schuldgefühle.
Tori war hier. Verletzt und völlig erledigt, aber sie war hier, bei ihrer Familie, unter Menschen, die ihr auf jede denkbare Weise zur Seite standen. Ramie dagegen saß allein in ihrer Berghütte und hatte niemanden. Sie hatte das Gleiche wie Tori durchgemacht, doch bei ihr war keiner, der ihr half, wieder zu sich zu finden. Das verstärkte Calebs Entschluss, umgehend zu ihr zurückzukehren, sobald, was Tori anging, alles geregelt war. Was er getan hatte, ließ sich nicht mehr rückgängig machen, aber er konnte auf jeden Fall versuchen, Wiedergutmachung zu leisten. Zumindest konnte er dafür sorgen, dass sich jemand um sie kümmerte und sie nicht allein war.
»Wie zum Teufel hast du es geschafft?«, fragte Beau mit leiser Stimme. »Wie konntest du ihren Aufenthaltsort so schnell und so genau bestimmen, während wir bis jetzt nicht einmal in der Lage waren, eine heiße Spur zu finden?«
»Ramie St. Clare«, erklärte Caleb schlicht.
Quinn war seine Überraschung deutlich anzusehen. Schließlich wusste er durch Caleb, dass sie eigentlich von der Bildfläche verschwunden gewesen war und sich vermutlich weigerte, je wieder irgendjemandem zu helfen. »Du hast sie dazu bekommen zu helfen?«
»Ich hab ihr keine andere Wahl gelassen«, erwiderte Caleb ruhig. »Aber was ich ihr damit angetan habe. Himmel, ich hatte ja keine Ahnung. Ich hab sie aufgespürt, und als sie sich weigerte, mir zu helfen, habe ich ihr einfach Toris Schal in die Hände gedrückt, worauf sie in die Abgründe der Hölle katapultiert wurde.«
Beaus Miene nahm einen grimmigen Ausdruck an, und Wut flammte in seinen Augen auf. »Warum sollte sie überhaupt Nein sagen? Was zum Teufel stimmt mit ihr nicht, dass sie auf die Idee kommt, sich zu weigern, jemandem das Leben zu retten?«
»Es liegt an dem, was es mit ihr macht«, erwiderte Caleb leise. »Ich wusste es nicht. Ich hatte ja keine Ahnung. Woher auch? Für mich ist jedoch schlimmer, dass ich nicht sagen kann, ob ich nicht trotzdem wieder genauso vorgehen würde. Aber zumindest weiß ich jetzt, warum sie Nein gesagt hat.«
Quinn sah ihn verwirrt an. »Ich verstehe dich nicht. Was macht es denn mit ihr? Ich dachte, sie kann einfach die Opfer aufspüren und den Standort benennen, indem sie etwas berührt, das ihnen gehört hat oder bei dem eine Verbindung zum Tatort besteht.«
»Sie spürt sie auf, indem sie gewissermaßen mit ihnen verschmilzt«, erklärte Caleb. »Ich habe sie in diese Lage gebracht … als wäre sie das Opfer. Alles, was Tori durchgemacht hat, musste sie auch über sich ergehen lassen. Ich sah, wie ein Handabdruck, der genau wie der auf Toris Gesicht aussah, auf Ramies Wange erschien. Ramie ist genauso vergewaltigt worden wie Tori.«
Quinn wurde blass, und seine Miene drückte Fassungslosigkeit und Erstaunen aus. Beau zuckte erkennbar zusammen, und die Wut, die eben noch in seinen Augen gestanden hatte, schwand, während er Caleb ansah. Dann schloss er die Augen, und man merkte ihm die Erschöpfung an, als er wieder sprach.
»Verfluchter Mist«, murmelte Beau. »Das ist ja ätzend.«
»Wem sagst du das. Ich komm’ mir wie ein Mistkerl vor, weil ich sie dem ausgesetzt habe, und ich fühle mich wie der letzte Dreck. Denn ich weiß, dass ich es wieder tun würde, wenn es die einzige Möglichkeit wäre, Tori aus den Händen eines Mörders zu retten.«
»Gütiger Himmel, was wirst du tun? Ich meine … wie geht es Ramie jetzt?«, fragte Quinn.
Noch mehr Schuldgefühle kamen in Caleb hoch. Er hatte so schnell zu Tori eilen wollen, dass er bereitwillig getan hatte, worum Ramie ihn bat. Er hatte sie nicht weiter bedrängt und zurückgelassen.
»Ich weiß nicht, wie es ihr geht«, gestand Caleb. »Ich habe sie allein gelassen. Sie hat mich darum gebeten. Und ich hab ohnehin die ganze Zeit nur an Tori gedacht. Aber sobald Tori wieder zu Hause und auf dem Wege der Besserung ist, werde ich zu Ramie zurückfahren und es wiedergutmachen.«
»Wir stehen alle tief in ihrer Schuld«, meinte Beau, und sein Blick glitt zu ihrer schlafenden Schwester.
»Ja, eine Schuld, für die ich einstehen werde«, schwor Caleb. »Was hat der Arzt euch erzählt?«, fragte er und wechselte das unangenehme Thema Ramie St. Claire. »Wie lange wird Tori im Krankenhaus bleiben müssen?«
»Ein paar Tage mindestens«, erwiderte Quinn. »Sie hat mehrere gebrochene Rippen und zahlreiche Prellungen.« Er wand sich, als er weitersprach. »Man muss sichergehen, dass es keine ernsthaften, inneren Verletzungen gibt, außerdem soll sie rehydriert werden, erst dann kommt eventuell ihre Entlassug infrage.«
Die drei Männer erstarrten und gaben keinen Ton mehr von sich, als ein leises Seufzen über Toris Lippen kam. Ihre Stirn legte sich in tiefe Falten, und ihre Miene drückte heftigen Schmerz aus. Sie wand sich ruhelos, und Tränen liefen über ihre Wangen.
Caleb war sofort an ihrer Seite. »Tori, Süße, ich bin’s, Caleb. Du bist in Sicherheit. Beau und Quinn sind auch hier.«
Ihre Augenlider flatterten, doch als sie langsam die Augen öffnete, erfüllten sie qualvoller Schmerz und höchste Verzweiflung. Aber am schlimmsten war die Scham, die ihren Blick umwölkte. Es versetzte Caleb einen Schlag, dass sie sich für etwas schämte, für das sie absolut nichts konnte.
»Caleb«, krächzte sie.
Er legte seine Hand auf ihre Stirn und strich ihr in einer Geste des Trostes das Haar aus dem Gesicht. »Ja, Süße, ich bin’s.«
Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und schluckte. Durch die Medikamente, die man ihr gegeben hatte, war sie immer noch benommen und langsam in ihren Bewegungen.
»Wie hast du mich gefunden?«, wisperte sie. »Ich habe gedacht, dass mich nie jemand finden … dass ich dort sterben würde. Er hat zu mir gesagt, dass ich sterben würde. Er wollte mich umbringen. Allmächtiger, wenn du nicht gekommen wärst … Er wollte mich umbringen, und ich betete, dass er es tun möge.«
Ihre Worte endeten in einem Schluchzen, und Quinn vergrub das Gesicht in den Händen, während Caleb Tori behutsam an sich zog. Beau stand am Fußende des Bettes. Seine Miene war mordlüstern, seine Augen funkelten vor Wut.
»Ich bin zu jemandem gegangen, der wie du ist«, erklärte Caleb leise und ließ dabei unerwähnt, wie – aus gutem Grund – widerwillig Ramie gewesen war, ihm zu helfen. Er würde Tori nie erzählen, dass er Ramie zur Willfährigkeit gezwungen hatte.
Tori runzelte die Stirn und sah verwirrt zu ihm auf. »Jemand, der wie ich ist?«
»Na ja, nicht ganz«, sagte Caleb und schenkte ihr ein Lächeln, das nur für sie bestimmt war. »Schließlich gibt es dich nur einmal. Ich habe Ramie St. Claire aufgesucht. Sie hat schon früher dabei geholfen, vermisste Personen aufzuspüren. Ich gab ihr deinen Schal, und damit war sie in der Lage zu sagen, wo du warst.«
Tori wirkte verblüfft. Ihr Mund stand vor Erstaunen offen, und sie hatte die Augenbrauen verwirrt zusammengezogen. Dann traten Tränen in ihre Augen.
»Wenn sie doch nur früher hätte helfen können«, flüsterte Tori.
Caleb schluckte und mied die Blicke seiner Brüder. Obwohl er ihnen gerade erklärt hatte, was Ramie hatte durchmachen müssen und warum sie sich geweigert hatte zu helfen, verdammten sie sie dafür, dass sie nicht schon früher greifbar gewesen war.
»Ich schulde ihr so viel«, presste Tori hervor. »Ich werde ihr das niemals zurückzahlen können. Kann ich mich zumindest bei ihr bedanken? Wenn alles vorbei ist und ich wieder nach Hause kann?«
Caleb musste schlucken, weil er einen Kloß im Hals hatte, dann wischte er ihr mit dem Daumen eine Träne von der Wange. »Wir können es nur versuchen.«
»Ich habe Angst«, sagte Tori mit brechender Stimme.
Ihre Finger krallten sich in das dünne Laken, mit dem sie bedeckt war, aber Caleb konnte sehen, wie heftig ihre Hände zitterten.
Caleb löste das Laken behutsam aus ihren Fingern und legte dann seine Hand um ihre. »Wovor hast du Angst, Süße?«
Der Griff ihrer Hand wurde fester, und ihre abgebrochenen Nägel bohrten sich in seine Haut. »Dass er zurückkommt, um mich zu holen.«
Ihre Worte hallten unheilvoll durch den kleinen Raum, und die Brüder sahen Caleb an. Ihre Wut – und ihre Angst – waren deutlich zu erkennen. Der Entführer war nicht festgenommen worden. Er war irgendwo da draußen, lief frei herum und suchte wahrscheinlich bereits nach dem nächsten Opfer. Oder würde er hinter Tori her sein, weil sie ihm entkommen war?
»Hör mir zu«, sagte Caleb mit tiefer, ernster Stimme. »Ich weiß, dass du Angst hast. Der Himmel weiß, dass du jedes Recht dazu hast. Aber ich, Beau und Quinn werden dich beschützen. Du wirst unter ständiger Bewachung stehen, bis dieses Arschloch gefunden und festgenommen worden ist. Er wird dafür bezahlen, was er dir angetan hat. Das schwöre ich bei meinem Leben.«
»Ihr könnt meinetwegen nicht euer ganzes Leben und eure Arbeit auf Eis legen«, widersprach Tori.
»Und ob wir das können«, sagte Beau schroff. »Du bist das Allerwichtigste für uns, Tori. Es gibt nichts Wichtigeres.«
»Wir werden diesen Mistkerl nicht in deine Nähe kommen lassen«, erklärte Quinn mit fester Stimme. »Und wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um ihn aufzuspüren und für alle Zeiten hinter Gitter zu bringen.«
Tori wirkte nicht überzeugt, aber sie nickte und schloss, als die Medikamente wieder ihren Tribut forderten, die Augen.
Caleb küsste sie auf die Stirn. »Ruh dich aus, Süße. Wir werden hier sein, wenn du wieder wach wirst. Du musst dich jetzt darauf konzentrieren, dass es dir wieder besser geht, damit wir dich mit nach Hause nehmen können.«
4
Caleb stand in der Tür zu der Hütte, in der er Ramie das letzte Mal gesehen hatte. Ein ärgerlicher Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Die Hütte war leer. Sie wirkte verlassen und sah so aus, als hätte hier nie jemand gewohnt. Ramie hatte noch nicht einmal einen Fingerabdruck hinterlassen. Nichts was darauf hingedeutet hätte, dass sie mal hier gewesen war. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und schloss die Augen, als Frustration ihn erfasste.
Er hatte das Versprechen gehalten, das er Ramie – und sich – gegeben hatte. Er war zurückgekehrt … aber sie war fort.
Er konnte ihr nicht mal einen Vorwurf daraus machen … konnte sie nicht dafür schelten, dass sie die Beine in die Hand genommen hatte und geflüchtet war. Wenn er sie gefunden hatte, würden auch andere dazu in der Lage sein. Und während er sie früher für egoistisch gehalten hatte, verstand er nun genau, warum sie nicht mehr bereit war, sich der Qual auszusetzen, Vermisste aufzuspüren.
Die Frage, die ihn jetzt quälte, war, ob er es dabei bewenden lassen und einfach gehen sollte, so wie sie es sich gewünscht hatte, oder ob er sie erneut aufspüren und wiedergutmachen sollte, was er getan hatte.
Er war nicht die Sorte Mann, die so einfach aufgab. Er hatte sein ganzes Leben mit der hartnäckigen Verfolgung seiner Ziele verbracht.
Er war in eine außerordentlich reiche, alte Familie hineingeboren worden, die über Generationen ein riesiges Vermögen mit Öl angehäuft hatte. In sehr jungen Jahren hatte Caleb bereits die Leitung der Familie übernommen.
Seine Eltern hatten ihren Reichtum offen zur Schau gestellt. Sie waren in der Gesellschaft ein- und ausgegangen und hatten ein Leben in Saus und Braus geführt. Caleb war davon überzeugt, dass zumindest sein Vater in zwielichtige Machenschaften verwickelt gewesen war. Hinsichtlich ihrer beider Tod hatte es Verdachtsmomente gegeben, und die Frage hatte im Raum gestanden, ob es ein Unfall oder Mord gewesen war. Diese Frage war bis zum heutigen Tage nicht beantwortet worden.
Von dem Moment an, als Caleb die Verantwortung für die Familie und das Erbe übernommen hatte, war er ganz systematisch vorgegangen und hatte sie aus dem Scheinwerferlicht geholt. Kontinuierlich hatte er die Präsenz der Familie in der öffentlichen Wahrnehmung verringert und dafür gesorgt, dass keine Informationen mehr nach draußen drangen. Er hatte immer auf höchste Sicherheitsvorkehrungen geachtet und diese sogar noch verschärft, damit das, was Tori passiert war, nie wieder vorkommen konnte … und auch Ramie nicht widerfahren würde, wenn es in seiner Macht stand.
Auf der Suche nach irgendeinem Hinweis, irgendetwas, das ihm die richtige Richtung wies, ließ Caleb den Blick durch die Hütte schweifen. Er wusste bereits die Antwort auf die Frage, die er sich selber gestellt hatte. Er würde sich an Ramies Fersen heften und sie aufspüren … und von da an würde sie das Sagen haben. Was immer sie wollte, was immer sie brauchte, würde ihr zur Verfügung gestellt werden. Wenn es nach Caleb ginge, würde sie bis ans Ende ihres Lebens nie wieder auch nur den kleinen Finger regen müssen. Nichts wäre zu viel oder zu groß im Angesicht der Tatsache, dass sie Tori gerettet und dabei ein großes persönliches Opfer gebracht hatte.
Himmel, sie würde ihm wahrscheinlich einen Tritt verpassen, wenn sie ihn wiedersah. Und er verdiente es wahrscheinlich, auch wenn er das Gefühl hatte, er würde sie auch dann wieder dazu zwingen, ihm zu helfen, obwohl er wusste, was er ihr damit antat. Und das nagte an ihm. Das Wissen, dass er genau das Gleiche noch einmal tun würde, wenn es zum selben Ergebnis führte: Tori am Leben und in Sicherheit.
Er überprüfte, ob sein Handy Empfang hatte, und verzog das Gesicht, als er feststellte, dass dem nicht so war. Er ging zu seinem SUV zurück und fuhr langsam den Berg wieder hinunter. Sobald sein Handy wieder Empfang hatte, wählte er Beaus Nummer und wartete darauf, dass sein Bruder den Anruf entgegennahm.
»Hast du sie gefunden?«, fragte Beau ohne Umschweife.
»Nein«, erwiderte Caleb ruhig. »Wie geht es Tori? Hat es ihr was ausgemacht, dass ich schon so bald wieder weggefahren bin?«
»Das war kein Problem. Quinn und ich sind rund um die Uhr bei ihr. Aber sie schläft furchtbar schlecht und wollte auch keine Medikamente nehmen, bis Quinn Druck gemacht und sie dazu genötigt hat. So kann sie nicht weitermachen. Sie ist völlig am Ende und wird noch zusammenbrechen, wenn sie sich nicht ausruht und wieder gesund wird.«
Caleb schloss die Augen. Verflucht! Er sollte bei seiner Schwester sein. Aber Tori hatte zumindest Beau und Quinn. Wen hatte Ramie? Während seiner langen Suche nach ihr war nie die Rede von einer Familie gewesen … nicht einmal von Freunden oder Bekannten. Sie hatte niemanden.
»Ich möchte so vorgehen, wie wir es besprochen haben«, sagte Caleb. »Ich komme nach Hause, dann werden du und ich alle Sicherheitsvorkehrungen noch einmal von Grund auf durchgehen. Wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe, wird Tori nie wieder das Opfer einer Entführung werden … und wenn wir nachhelfen müssen, ist das eben so.«
»Ich werde hier schon mal anfangen«, sagte Beau. »Ich will nur die Besten anheuern.«
»Einverstanden.«
»Dann lässt du die Sache mit Ramie also auf sich beruhen?«, fragte Beau.
Caleb zögerte, ehe er mit seiner Entscheidung herausrückte. »Nein. Sie wollte in Ruhe gelassen werden, und vielleicht sollte ich mich daran halten. Aber ich kann das nicht. Du hast sie nicht gesehen, Beau. Ich ja. Und sie hat niemanden. Ich muss sie finden und mich davon überzeugen, dass es ihr gut geht. Vorher finde ich keine Ruhe.«
»Das verstehe ich. Wir stehen alle tief in ihrer Schuld, wenn ich also irgendetwas dazu beitragen kann, sie zu finden, will ich es tun.«
»Wir fangen bei der neuen Firma an«, sagte Caleb. »Von dort weiten wir unsere Nachforschungen aus.«
5
Ein Jahr später
Sei immer wachsam.
Das war schon immer ihr Mantra gewesen, aber jetzt war es wichtiger denn je. Angst war ihr ständiger Begleiter. Er hatte sie aufgespürt. Irgendwie war es ihm gelungen, sie aufzuspüren, und er hatte sie zu seinem nächsten Opfer auserkoren.
Er war besessen.
Er war besessen von Ramie … dem einzigen Menschen, der nah dran gewesen war, ihn zur Strecke zu bringen. Aber nah dran war nicht nah genug. Der Mörder war der Festnahme knapp entgangen, aber zumindest hatte Ramie der Polizei den Weg zu dem Ort gewiesen, an dem er sein neuestes Opfer festgehalten hatte.
Er hatte die junge Frau tagelang gefoltert. Endlose Tage voller Schmerz und Qual. Er hatte mit ihr gespielt, ihr den Tod versprochen, um ihn ihr dann doch zu verwehren.
Ehe Ramie von der Bildfläche verschwunden war, hatte er sie angerufen. Er war der Grund dafür, warum sie weggelaufen war. Weil er wusste, wer und was sie war und sie die Verantwortung dafür trug, dass ihm seine Beute wieder abgejagt worden war. Und so war sie nun diejenige, auf die er Jagd machte.
Und er war nahe dran.
Wie bekam er eigentlich jede ihrer Bewegungen mit?
Er spielte mit ihr. Er hielt sie zum Narren … weil er es konnte. Es hatte so schlimme Ausmaße angenommen, dass Ramie nachts aus Angst, er könnte irgendwo lauern, nicht mehr wagte zu schlafen. Sie war ständig unterwegs und blieb nie länger als eine Nacht am selben Ort.
Aber sie konnte spüren, dass er näher denn je war.
Wann würde er das Katz-und-Maus-Spiel satt haben und zur Tat schreiten? Und was würde sie in diesem Fall unternehmen?
Ramie fuhr bei dem am Straßenrand liegenden Hotel vor und stellte ihren kleinen SUV vor der Nummer sechs ab, dem Zimmer, das sie gemietet hatte, ehe sie losgehen wollte, um etwas zu essen, die Gegend zu erkunden und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob alles so war, wie es sein sollte.
Sie verdrängte alle beunruhigenden Gedanken … unterdrückte die Panik, damit sie ihre Umgebung mit geschärften Sinnen wahrnehmen könnte. Mit einem Killer auf den Fersen, der jede ihrer Bewegungen registrierte, musste sie die Ruhe bewahren und besonders hellsichtig sein, um ihrem Verfolger immer einen Schritt voraus zu sein.
Langsam ließ sie ihre Hand über den Türknauf des Hotelzimmers gleiten und achtete dabei darauf, kein Geräusch zu machen oder gar den Schlüssel ins Schloss zu schieben, sodass irgendwer mitbekam, dass sie da war. Sie riss die Hand zurück, als hätte sie sich verbrannt. Die Bosheit, der Hass und das höhnische Lachen ihres Peinigers, die ihr wie eine mächtige Woge entgegenschlugen, hätten ihr beinahe den Boden unter den Füßen weggerissen. Die Beine wollten unter ihr nachgeben, und sie wirbelte verzweifelt herum, um zu fliehen, als die Tür aufsprang und etwas finster Unheilvolles ihr Handgelenk packte und zurückriss, während sie noch versuchte wegzulaufen.
Sie schlug zu, wehrte sich verzweifelt, denn sie wusste, wenn es ihm gelang, sie in den Raum zu zerren, würde sie tot sein – wenn sie Glück hatte. Ihr war klar, dass es weder ein leichter Tod noch ein schneller sein würde. Sie hatte in ihn hineingesehn. Sie wusste, wie er dachte, kannte all die kranken, perversen Fantasien, die er bei seinen Opfern ausgelebt hatte, und ihr Tod würde der schlimmste sein. Sie öffnete den Mund, um zu schreien, doch schon legte sich seine freie Hand schmerzhaft über ihre Lippen.
Sie schlug ihre Zähne in das bitter schmeckende, dreckige Fleisch und wurde belohnt, als er seine Hand wegzog und einen Schmerzensschrei ausstieß.
»Du kleine Schlampe«, knurrte er mit dämonisch klingender, vor Wut zitternder Stimme, die ihr eisige Schauer über den Rücken laufen ließ. »Dafür wirst du büßen.«
Sie drehte sich um und sah dem Bösen zum ersten Mal in Person ins Gesicht, ehe sie ihm ihr Knie in die Lenden rammte. Um sie abzuwehren, schlug er ihr mit dem Handrücken ins Gesicht. Der Schmerz ließ ihre Wange explodieren. Doch sein Griff lockerte sich so weit, dass sie ihm ihr Handgelenk entwinden konnte. Sie nutzte die Atempause, da sie wusste, dass sie keine weitere Chance bekommen würde.
Sie versuchte gar nicht erst, zu ihrem Auto zu gelangen. Er würde sie längst wieder gepackt haben, ehe sie es schaffte einzusteigen und wegzufahren.
Also rannte sie los.
Sie ließ alles, was sie besaß, hinter sich und raste auf die Hauptstraße zu, während ihr schmerzender Körper vor Überanstrengung gequält protestierte.
Sie konnte ihn hinter sich hören, konnte fast seinen Atem in ihrem Nacken spüren. Doch schlimmer war die erdrückende Gegenwart seiner Gedanken in ihrem Bewusstsein, seine Stimme, die bösartige Racheschwüre ausstieß. Sie sah ihren langen, qualvollen Tod in seiner Fantasie, die aber kaum der Wahrhaftigkeit entbehrte, denn seine Erbarmungslosigkeit kannte keine Grenzen. Er würde nicht eher ruhen, bis er sein Ziel erreicht hatte; die Vernichtung ihrer Existenz.
Das gab ihr die dringend benötigte Kraft, schneller zu laufen.
Warmes Blut lief über ihr Kinn und trocknete im Wind, während sie den Abstand zu ihrem Verfolger vergrößerte.
Wo sollte sie hin? Was sollte sie tun? Sie hatte keinen roten Heller mehr, nachdem ihre Handtasche mit dem bisschen Bargeld, das sie noch gehabt hatte, zurückgeblieben war.
Sie schluchzte, als sie ihre letzten Reserven mobilisierte. Sie war am Ende … auch finanziell. Sie hatte nichts mehr. Ihr war klar gewesen, dass sie in der nächsten Stadt einen Aufenthalt würde einlegen und das schreckliche Risiko eingehen müssen, dass er sie schließlich einholte, weil sie irgendwo bleiben musste, um sich einen Job zu suchen und ihre Geldreserven wieder aufzustocken. Damit sie weiter fliehen konnte. Doch damit war sie das Risiko eingegangen, dass genau das eintrat, was ihr jetzt widerfahren war.
Sie war entdeckt worden.
Sie wagte einen kurzen Blick über die Schulter und sah, dass ihr Angreifer aufgegeben hatte. Nein, das war nicht richtig. Er würde nie einfach aufgeben. Er würde nur ein bisschen zurückfallen, sie in einem falschen Gefühl der Sicherheit wiegen und erneut zuschlagen, wenn sie am wenigsten damit rechnete. Er besaß ein unheimliches Talent, sie aufzuspüren, weshalb sie sich allmählich fragte, ob er auch über übernatürliche Fähigkeiten verfügte. Wie konnte es sonst möglich sein, dass er ihre nächsten Schritte vorhersehen konnte? Lebte er etwa seit jenem schrecklichen Tag, da sie über sein letztes Opfer mit ihm in Verbindung getreten war, als ein Schatten in ihrem Kopf? War sie, ohne es zu wollen, eine Verbindung mit der Ausgeburt des Bösen eingegangen? Der Himmel wusste, dass sie nicht in der Lage gewesen war, ihn aus ihren Träumen zu verbannen, nicht einmal bei Tag aus ihren Gedanken. Die einzige Verschnaufpause war ihr gewährt worden, als Caleb Devereaux ihr vor vielen Monaten den Schal seiner Schwester in die Hand gedrückt hatte. Einen kurzen Moment lang hatte sie etwas anderes wahrgenommen als den Mann, der sie verfolgte. Doch damals hatte sie nur eine Hölle gegen eine andere getauscht.
Jener schreckliche Tag auf einem Berg in Colorado hatte geschafft, was keinem anderen gelungen war, er hatte sie gebrochen. Zwar hatte es sie jedes Mal, wenn sie ihre Fähigkeit einsetzte, um Monster aufzuspüren, stark mitgenommen, aber an jenem Tag hatte es keine Wiederkehr mehr gegeben. Vielleicht würde sie sich nie wieder davon erholen. Manche Wunden waren einfach zu tief. Zu viel war auf sie eingestürmt, nachdem sie gerade erst eine Begegnung mit Blut und Tod gehabt hatte. Sie hatte förmlich gespürt, wie etwas in ihrem Innern zerbrach, als sie in Tori Devereaux’ Geist eingedrungen war und all das Schreckliche miterlebt hatte, das die junge Frau gerade erlebte.
Vielleicht war das einfach der letzte Tropfen gewesen. Doch wie auch immer, nachdem Caleb Devereaux sie verlassen hatte, um seine Schwester zu finden und ihr beizustehen, war Ramie nicht mehr dieselbe gewesen. Vielleicht würde sie das auch nie wieder sein.
Wäre der Tod so schlecht? Sie hatte das Gefühl, als würde sie jedes Mal sterben, wenn sie mit dem Geist eines hilflosen Opfers verschmolz. Die meisten Menschen begegneten dem Tod nur ein Mal. Sie hatte ihm immer wieder ins Auge geblickt. Vielleicht würde sie im Tod endlich Frieden finden. Nur dass sie sich weigerte, dem Mann, der sie jagte, diesen Triumph zu gewähren. Er würde durch nichts aufzuhalten sein. In seinem kranken, verdrehten Kopf sah er sich als Gott. Solange all sein Sinnen und Trachten auf sie ausgerichtet war, würden zumindest andere Frauen vor seinen sadistischen Neigungen sicher sein. Das war Grund genug, weiter zu kämpfen.
Grund genug, am Leben zu bleiben.
Sie blieb stehen, weil ihre Beine sich weigerten, nur noch einen weiteren Schritt zu tun. Vor ihr ragte eine Tankstelle auf; um Atem ringend beugte sie sich vor und stützte sich mit beiden Händen an den Knien ab. Tränen brannten in ihren Augen, als ein Gefühl der Ausweglosigkeit sie erfasste. Es spielte keine Rolle, dass sie den Mistkerl nicht gewinnen lassen wollte.
Sie konnte nirgendwo hin. Es gab keinen Ort, an dem sie hätte unterkriechen können. Keinen sicheren Hafen.
Plötzlich erinnerte sie sich wieder an Caleb Devereaux’ Gesicht, und die Worte, die er zum Abschied gesagt hatte, verfolgten sie. Sie erinnerte sich an den Ausdruck des Bedauerns in seinen Augen, als er erkannt hatte, welche Folgen das, zu dem er sie gezwungen hatte, für sie hatte.
Ich werde zurückkehren, Ramie. Verlassen Sie sich darauf. Ich werde es wiedergutmachen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
Vor einem Jahr hatte er ihre Welt in Schutt und Asche gelegt und dafür gesorgt, dass sie seitdem auf der Flucht war. Vielleicht war er jetzt ihre einzige Rettung.