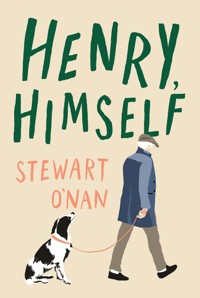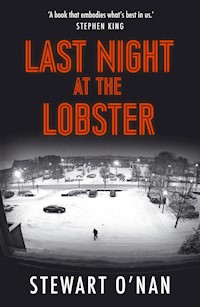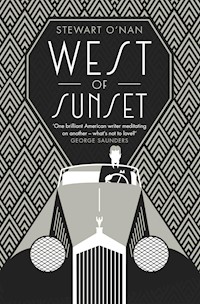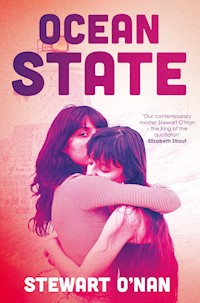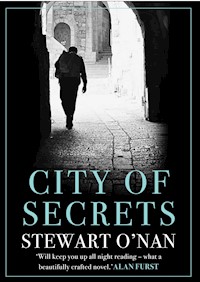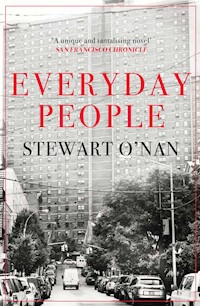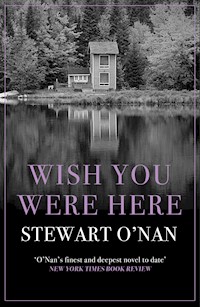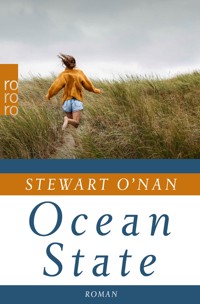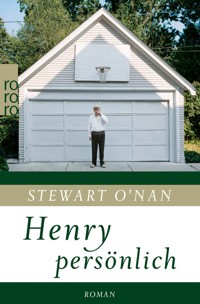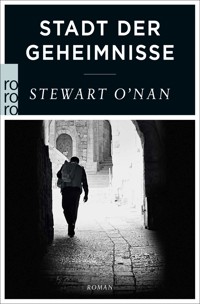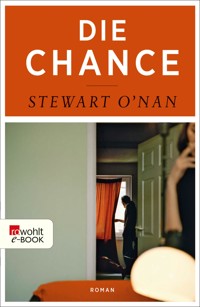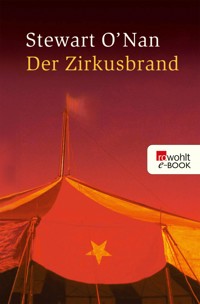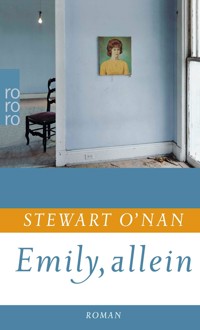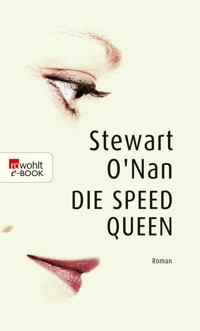9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Strandhaus bei Montauk, Long Island, Sommer 1943. Seit Wochen haben James und Anne Langer keine Nachricht von Rennie, ihrem Ältesten, der im Pazifik gegen die Japaner kämpft. Auch zu Hause wird Krieg geführt, denn James hat nach einer Affäre mit einer Schülerin seine Arbeit als Lehrer verloren, und Anne rächt sich mit einer heimlichen Romanze. Als Rennie schwer verwundet nach Hause kommt, hilflos und seelisch ebenso versehrt wie körperlich, sind James und Anne gezwungen, ihr Leben neu zu ordnen. «Sommer der Züge» ist eine sensible, romantische Geschichte über die Liebe und den vielfältigen Verrat an ihr, über Glücksverheißung und Lebenswirklichkeit, über Schuld und Vergebung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Stewart O'Nan
Sommer der Züge
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Für Trudy
Ach, ich weiß nicht mehr, was richtig ist.
Ilsa, Casablanca
Furcht ist das Einzige, wovor wir uns fürchten müssen.
FDR
1
Sie fuhren in der Nacht, durch die verdunkelte Stadt, die Küste von Long Island entlang. Vom Meer zog Nebel auf, der sich in dicken Schwaden über Buchten und weiße Holzbrücken legte. Die Straßen lagen verlassen im Licht der Sterne, meilenweit war kein Fahrzeug zu sehen. Wie vorgeschrieben, hatte James Abblendvorrichtungen auf die Scheinwerfer des Buick geschraubt. Er befürchtete, man würde sie vielleicht anhalten, Anne würde aufwachen, und Jay müsste sich die Augen zuhalten, weil irgendein Luftschutzwart ihn mit der Taschenlampe anstrahlte. Seit Stunden fragte der Junge jedes Mal, wenn sie langsamer wurden: «Sind wir schon da?», und jetzt ließ James die Sache nicht mehr los.
Sie fuhren weiter, ohne jemandem zu begegnen. Nur Wälder, Marschland und der Mittelstreifen, der unter den Wagen glitt. Er war hier geboren, sein Vater lag im Sterben. Mit seiner Rückkehr ans Meer stellte er die dazwischenliegenden Jahre in Frage; sein Leben kam ihm wie eine große Aufgabe vor, die man plant, aber nie in Angriff nimmt. Rennie lebte noch, doch am anderen Ende der Welt, den Namen seines Schiffes hatten sie aus den Briefen ausgeschnitten. James vermutete ihn im Südpazifik; Anne sagte, das spiele keine Rolle. Sie hatten schon seit Wochen nicht mehr miteinander geschlafen. Auf dem Dach pfiff der Wind um ihr Gepäck. Sind wir schon da? Wann kommen wir an?
Es war der Sommer der Züge. Der Krieg forderte alles, immerzu, wie ein kleines Kind. Seinen Sohn, seine Schüler. Die Tankstellen entlang der Küste waren geschlossen. Er hatte Benzin, weil Annes Vater gestorben war: Dessen Plymouth stand jetzt neben dem verriegelten Haus, das Benzin abgezapft, das Leder der Sitze brüchig von der Sonne. James’ Vater konnte nicht mehr Auto fahren. Sein Gesicht sah aus wie ein Totenschädel. Wenn er redete, blickte er zum Himmel, als wäre hinter einem der Feind im Anflug. In Amagansett waren nachts bei Flut vier Spione mit einem Floß gelandet. Im Mai hatte James’ Schwester angerufen und ihn gebeten zu kommen.
«Das Schuljahr ist erst im Juni zu Ende», hatte er gesagt.
«Dann komm im Juni», hatte Sarah gesagt. Sie war seit dem letzten Schlaganfall bei seinem Vater und kümmerte sich um das Strandhaus, von dem bereits die Farbe abblätterte, und um die morschen Hütten. Sie hatte gesagt, vorher habe sich ihr Vater gut erholt gehabt. Sie hätten auf der Veranda gesessen und das Kreuzworträtsel der Times gelöst. James roch die feuchten Korbstühle, den Gin-Atem ihrer Gäste. Sie habe ihm gerade einen gesuchten Begriff vorgelesen. Dann habe sie gesehen, dass er eingeschlafen war, das sei oft vorgekommen.
«Weißt du, was er gesagt hat, als er wieder aufgewacht ist? ‹S-T-E-N. Britisches Gewehr mit vier Buchstaben.› Und dann konnte er nicht mehr aufstehen. Der Arzt hat gesagt, das sei nicht ungewöhnlich.»
Ihr Vater hatte Sarah nie gemocht, das Ganze war James ein Rätsel. Sie wohnte zwanzig Meilen westlich in Sayville, in einer anderen Zeit. Die drei sprachen nur selten miteinander; ihr Vater war über die hohen Telefonkosten entsetzt.
«Wir hängen jetzt besser auf», hatte James in die Nacht hinaus gesagt und war zu seinem Sessel und dem grellen Licht auf seinem Buch zurückgegangen.
«Noch einer?», fragte Anne. Seit die Kramers ihr Telegramm erhalten hatten, versuchte sie nicht mehr, vor James am Telefon zu sein. Der neue Stern prangte golden in ihrem Fenster, ein Grabmal, ein böses Omen. Bei Rennie würden sie es durch einen Boten erfahren, wie bei einem Prinzen; James und Anne würden auf den Stufen stehen, das Telegramm gemeinsam lesen und in einen bodenlosen Abgrund stürzen. Nein, dachte James, er würde nicht zu Hause sein. Jemand müsste den Kopf zur Tür hereinstecken und ihn aus dem Unterricht holen. Er würde seine Ausführungen über König Philipps Krieg, die Börsenpanik von 1837, die Entstehung der ersten Transkontinentalverbindung unterbrechen. Wie weit der Sommer schon fortgeschritten war, und wie schnell.
«Sarah will, dass wir kommen.»
«Und was hast du gesagt?»
Er hatte keine andere Möglichkeit gesehen, doch als er am Morgen beim Packen des Wagens eine Schnur festgezurrt und sich dabei die Hand aufgeschürft hatte, hatte er geflucht (was auch Anne nach seiner Zusage am liebsten getan hätte, aber die gute, heilige Anne hatte es ihm erspart), war herumgehüpft und hatte sich die wundgeriebene Hand gehalten, hatte sein Pech, seine Unfähigkeit, seine Gutmütigkeit verwünscht. Sie waren gerade erst wegen Annes Vater nach Galesburg gezogen. Es war der dritte Umzug in zwei Jahren.
Keiner der Schicksalsschläge war überraschend gekommen. Annes Vater war gestorben. Rennie hatte – gegen James’ Rat, aber mit seinem zögerlichen Segen – den Kriegsdienst verweigert und war in ein Arbeitslager gebracht worden, zuerst nach New York und dann nach Kalifornien. Vier Monate später war sein Zimmergenosse aus Cornell auf dem Weg nach Nordafrika ums Leben gekommen. Vor Bestürzung hatte sich Rennie freiwillig als Sanitäter gemeldet und war in den Pazifik abkommandiert worden. Dorothy war ihm bis nach San Diego gefolgt. Und jetzt der Schlaganfall von James’ Vater – vielmehr sein letzter, denn er hatte schon mehrere ohne größeren Schaden überstanden. Seit Annes Vater gestorben war – vor ihren Augen, still, nur noch ein Schatten seiner selbst –, war sie verschlossen und resigniert. Sie hatte nicht mehr die Kraft zu kämpfen. Wenn sie zusammen waren, schwiegen sie, waren sie allein, führten sie Selbstgespräche. Jay entzog sich ihrem Einfluss, war verwirrt, vom Alter her kein kleiner Junge mehr, aber auch noch nicht bereit, erwachsen zu werden. Er befand sich in einem Alter, an das James nicht gern zurückdachte, so wie er sich auch nicht vorstellen konnte, ein paar Jahre älter zu sein, all das überstanden zu haben und wieder ein halbwegs glückliches Leben zu führen. Es war genau wie damals in Putney, obwohl er nicht leugnen konnte, dass das sein eigener Fehler gewesen war. Eine Schülerin. Idiotisch. Er hatte so lange für seinen Ausrutscher bezahlt, und doch empfand er noch immer tiefe Scham. Er konnte die ganze Kette der Ereignisse mühelos bis zu der Affäre mit Diane zurückverfolgen. Seine beste Spielerin, sechzehn und schon so groß wie er. Er war verrückt gewesen; nur so ließ sich das erklären.
«Ist es schlimm?», hatte er Sarah in jener Nacht am Telefon gefragt.
«Ja.»
«Kannst du mir Dad geben?»
«Eigentlich nicht.»
«Nein?»
«Ach, Jimmy.»
Sie schlichen den Montauk Highway entlang, durch die Straßen von Küstenstädtchen, in denen die Markisen über Nacht hochgekurbelt und die schrägen Parkplätze verlassen waren. An den Laternenpfählen hingen Körbe mit Geranien, Sand wehte über die Straße. Leute kamen aus der Spätvorstellung, das Kino lag im Dunkeln. Der Nebel machte alles grau und feucht. Hier hatte er seine Kindheit verbracht; er weigerte sich, genau hinzusehen. Sie waren fast da. Center Moriches, Eastport, Quogue mit dem Blick über die Bucht, eine Kette wegen der Verdunkelungsvorschrift verbotener Lichter über dem Wasser. An Land lag ihnen jetzt sein Elternhaus gegenüber, unsichtbar, Meilen entfernt. Er konnte sich nicht an die Winter erinnern; es war nie viel Schnee gefallen. Bis Mitte Juli war es kalt gewesen, über Mittag heiß, und danach fröstelte man unter der Decke. Der Juni war ihm so fern vorgekommen. Jetzt würde er das Haus zum letzten Mal sehen.
Als Kind hatte das Klatschen der Wellen ihn nachts geweckt, und dann hatte er geweint. Seine Mutter war im Morgenrock in seiner Tür stehen geblieben, und im Licht ihrer Kerze hatten die Wände geschwankt. Nach ihrem Tod hatten sie ihre Kleider in einen Karton gepackt und an ihre Schwester in Wisconsin, dem Land der schwarzen Seen, geschickt. Ihre Kommode stand noch im Zimmer seines Vaters, leer und mit Zeitungspapier ausgelegt, das an den Rändern vergilbte und unglaublich billige Waren anpries.
Als er nach dem ersten Schlaganfall seines Vaters vor drei Jahren zum letzten Mal da gewesen war, hatte James ihm sagen wollen, dass er ihn verstehe, aber sie hatten nicht über seine Mutter gesprochen (und würden es auch nie tun). James hatte dem alten, plötzlich so verletzlichen Mann nicht wehtun wollen, denn von seinem heiligen Zorn war nur noch Übellaunigkeit geblieben. James glaubte aufrichtig zu sein, denn obwohl seine Eltern ihn ungerecht behandelt hatten, konnte er nicht aufhören, sie und das Leben, das sie zusammen geführt hatten, zu lieben. Die Jungen waren ins Bett gegangen, und dann auch Anne. Der Schlaganfall hatte noch nicht lange zurückgelegen, und sie hatten bei seinem Vater wachen müssen. Im Schlaf hatte er Bibelstellen vor sich hin geflüstert. Neben dem Bett hatte Sarah ihr Buch auf Armeslänge gehalten und im schummerigen Licht die Augen zusammengekniffen.
«Geh schlafen», hatte sie gesagt.
«Ich kann nicht.»
Er war nach unten in die Speisekammer gegangen, wo sie sich als Kinder zwischen den Kisten und Fässern versteckt hatten, und hatte sich, ein nächtlicher Genießer, im Mondlicht am offenen Fenster ein Glas vom Scotch seines Vaters genehmigt. Als Sarah ihn Stunden später entdeckt hatte, war das Glas noch nicht leer gewesen. Er hatte dran gedacht, es vor ihr zu verstecken.
«Mein Geruchssinn ist noch in Ordnung», hatte sie gesagt. «Mach dir keine Sorgen. Wenn ich noch trinken würde, dann wäre nichts mehr übrig.»
«Das freut mich.»
«Und wie geht’s Anne und dir?»
«Bestens», hatte er gesagt, und als er jetzt daran dachte, konnte er sich nicht mehr erinnern, ob er es wirklich ernst gemeint hatte. Es gab Tage, Zeiten mit Anne, die er wie einen Schatz hütete und sich im Stillen ins Gedächtnis rief, um sich zu vergewissern, dass all das wirklich passiert war. Jetzt faltete sie sogar im Schlaf die Hände. Das lange Kinn ihres Vaters.
Sie passierten die Stadtgrenze von Hampton Bays. Hier war er zu Hause gewesen; die Stadt war ihm so vertraut wie der Junge, der er gewesen war, an den er sich hoffnungsvoll erinnerte, dem er verziehen und gedankt hatte. Anne schlief gegen die Tür gelehnt, das Gesicht ihm zugewandt, als wollte sie sich mit ihm streiten. Jay lag auf ihrem Schoß, halb unter seiner Jacke. In Galesburg hatte Anne ihm nichts von der Sache mit Rennie erzählen wollen, obwohl die ganze Schule davon gewusst hatte. James hatte eines Morgens sein Klassenzimmer aufgeschlossen – den Schlüssel noch in der Hand – und an der Tafel die Karikatur eines Henkers und das Wort VERRÄTER in Riesenlettern entdeckt. Damals waren Jungs aus Galesburg in Bataan gewesen, andere wurden auf See vermisst. Samstags war Jay aus dem Kino nach Hause gekommen und hatte furchtbare Albträume gehabt. Er hatte noch nie ein eigenes Zimmer gehabt, war schluchzend und allein im Dunkeln aufgewacht.
Sie hatten beide darauf gewartet, dass der andere hingehen und ihn wie ein Baby trösten würde; ihr Schlaf war schwer erkämpft. Es war Annes Elternhaus; James hatte sich ständig die Zehen gestoßen. «Ist schon gut, alles in Ordnung», hatte er gesagt, das Licht angeschaltet und Jay schniefend und beschämt daliegen sehen. Der Frühling war ihm lang vorgekommen, beim Frühstück hatte Schweigen geherrscht, und die Nächte waren voller Unruhe. Er hatte sich nicht auf den Unterricht vorbereitet und vor der Tafel unzusammenhängendes Zeug gefaselt, hatte Witzchen gemacht, doch die Jungen in den hinteren Reihen waren unbarmherzig und ungeduldig gewesen. Galesburg war eine Stadt voller Steinbrücken, voller Spinnereien an einem kalten Fluss. Und noch immer musste er an Diane denken, an ihre langen Arme, ihren kräftigen Rücken, obwohl all das – wie auch ihr Haus in Putney – längst der Vergangenheit anzugehören schien. In Galesburg kannte man nur ihre letzte Schmach. Auf dem Gehsteig waren ihm die Frauen aus dem Weg gegangen, hatten hinter ihm ausgespuckt. Anne war dort aufgewachsen; schon mit dreizehn war sie entschlossen gewesen wegzugehen. Im Mai, kurz vor ihrer Abreise, hatte sie plötzlich gesagt, sie habe es nicht ernst gemeint, alle würden so was sagen.
«Dann gefällt es dir jetzt hier?», hatte er gefragt.
«Bleibt mir was anderes übrig?»
«Ich weiß nicht», hatte er unbekümmert gesagt, «was meinst du?»
«Wir kommen zurück. Im Herbst, egal, was passiert.»
Das reichte, es war alles, was er wollte.
«Sag du es ihm», hatte Anne gesagt. «Ich weigere mich.»
Jay hatte keine Freunde mehr, hatte keine neuen Freundschaften geschlossen. Im Winter hatte er in der Stadtbücherei oder in seinem Zimmer gehockt, das früher Anne gehört hatte, wo die Velourstapete über der Fußleiste ganz schmutzig war. Er hatte auf dem Fußboden zwischen seinem Bett und dem Fenster gelesen, von der Diele aus nicht zu sehen; die Vorhänge hatten sich bewegt, wenn er drangestoßen war. Auf den Feldern pickten die Krähen an den Stoppeln vom Vorjahr. Regen in schwarzen Bäumen. Anne schaltete immer eine Lampe für ihn an. Das Haus wurde dunkel, und die Fenster leuchteten auf. Für jedes Buch, das er las, hatte ihm James ein Fünfcentstück gegeben. Er hatte alle Tarzan-Bücher gelesen – Tarzan und der goldene Löwe, Tarzan und die Ameisenmenschen –, in der Bücherei hatte es ein ganzes Regal voll gegeben. Mit dem Geld hatte er Comic-Hefte gekauft, den größten Schund. James hatte in der Schule Schubladen voll davon, nur Muskeln, Schießeisen und Brüste. Er war zu alt als Vater, war schon bei Rennie zu alt gewesen. Er hatte sich zu dem Entschluss durchgerungen, Jay in jenem Jahr in der Schule nicht anzusprechen. Anne hatte gesagt, es sei so schon schwer genug für ihn.
«Ich kann mich an den Strand erinnern», hatte Jay gesagt. Es war nachts gewesen, der Junge hatte nur bei eingeschaltetem Licht schlafen können. «Ganz hinten auf den Felsen steht ein Leuchtturm.»
«Dein Großvater ist sehr krank.»
«Muss Mom sich um ihn kümmern?»
«Wir werden alle ein bisschen helfen. Er braucht das jetzt.» Seine Söhne hatten James’ Mutter nicht gekannt. Sie war in dem Sommer gestorben, als James zehn wurde. Ihr Tod war überlagert vom Schmerz seines Vaters, vom letzten Krieg, von Anne, dem Kommen und Gehen von Gelegenheitsjobs, gemieteten Bungalows und unglaublichen Autos. Dann Putney und Diane. Es kam ihm jetzt so vor, als hätte er sich um Rennie in Jays Alter keine Sorgen gemacht, aber stimmte das wirklich?
Es war der Krieg; im Radio klang es wie ein Hörspiel, das mit knackenden Störgeräuschen aus London übertragen wurde. Anne wollte nicht, dass Jay sich das anhörte. James versuchte, vernünftig mit ihr zu reden, doch sie hatte immer recht, stellte jedes Mal seine Argumente in Frage, wenn er keine richtigen fand. Nachts hörte er sich die neuesten Nachrichten aus dem Pazifik an, beugte sich näher an den Ozongeruch der warmen Röhren, horchte auf das Stampfen des Schiffes, auf dem sich sein Sohn befand. Die Japaner hatten gerade eine der Aleuten-Inseln aufgegeben.
«Was ist es jetzt?», hatte Anne gefragt.
«Immer noch Alaska.»
«Da gibt’s doch nichts, wissen die das denn nicht? Steckt da eigentlich irgendein Sinn dahinter?»
Sie hatte gelesen und Tee getrunken und manchmal unter der Lampe in der Ecke gestrickt. Sie hatte gerade erst damit angefangen, und er wusste nicht, was es werden sollte. Jedes Mal, wenn sie eine Masche fallen ließ, hatte sie geflucht und den Kopf zurückgeworfen, als wollte sie aufschreien. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass Rennie gehen würde, und hatte es ihm nicht verziehen. Mittwochs nach dem Abendessen versammelte James die Familie um sich und schrieb auf, was sie Rennie sagen wollten. Jay schnitt gern die Comics, die Baseballergebnisse und die örtlichen Straftaten aus der Zeitung aus. Wie ein Kolumnist bekam er seinen eigenen Abschnitt, verwendete seinen eigenen Slang. James wusste nie, was er schreiben sollte, und erzählte alle möglichen Klatschgeschichten. Anne fügte nichts hinzu; in der Schule tippte er etwas auf der Schreibmaschine und unterschrieb mit ihrem Namen.
Als ob sie ihn ärgern wollte, schrieb sie jede Woche an Dorothy, formulierte beim Kochen stets ein paar Sätze. Anne hatte Dorothy nie gemocht, obwohl sie für James viel Ähnlichkeit mit dem Mädchen aus Galesburg hatte, das seine Frau einmal gewesen war. Dorothys Familie hatte Rennie gemocht, bis er verhaftet wurde. Seit der Hochzeit sprachen sie nicht mehr mit den Langers, und ihr jüngster Sohn war James auf dem Gang immer ausgewichen. James hatte im Speisesaal gegessen und Jay, genauso allein wie er, ein paar Tische weiter sitzen sehen. Später war er auf dem Heimweg an Jay vorbeigefahren, und obwohl er noch eine Meile zu laufen hatte und weit und breit keine anderen Kinder zu sehen waren, hatte der Junge auf seine Stiefel oder über die verschneiten Felder geblickt, und James war weitergefahren. Er hatte es versprochen.
Zu Hause. Das Arbeitszimmer seines Vaters hatte einen Blick aufs Meer. Es nahm den halben Speicher ein, und die Fensterbank des Giebelfensters lag auf gleicher Höhe mit der Schreibtischplatte. Jahrelang hatte sein Vater, wenn die Gäste ins Bett gegangen und bevor sie aufgewacht waren, bei Kerzenlicht über den Büchern gehockt und seiner Mutter in die Klinik geschrieben, in der sie sich gerade befand. Im Dunkeln hatte James gehört, wie er die Leiter herunter- und dann hinter sich wieder hochgezogen hatte. Sein Vater war nicht auf und ab gegangen, sondern hatte am Schreibtisch gesessen und geschrieben, und um Viertel vor sechs hatte er die Leiter hinuntergelassen, war nach unten geschlichen und hatte Wasser in die Badewanne eingelassen. Sarah hatte er dort oben nicht geduldet. Auf dem Schreibtisch hatte ein Teleskop auf einem Messingständer gestanden. «Was siehst du?», hatte sein Vater ihn gefragt. «Sag mir, was du siehst.»
Die Wellen. Grün, blau, glitzernd, wuchtig. Sein Vater hatte die Hand sanft auf James’ Nacken gelegt und ihn dirigiert. Der riesige Mond war vor ihm aufgetaucht, und darunter hatten sich scharf die Schornsteine eines großen Ozeandampfers abgezeichnet.
«Siehst du ihn?»
«Ja», hatte James gesagt. Sein Vater hatte ihn Staunen und, als Ergänzung dazu, Verantwortung gelehrt; jetzt konnte er nicht mehr deutlich sprechen und musste Sarah bitten, vorbeizukommen und den Brenner anzuzünden.
«Ich bin kein Arzt», hatte Sarah am Telefon gesagt.
«Ich will nicht, dass Jay darunter leidet. Er hat genug durchgemacht.»
«Es ist nie der richtige Augenblick, was?»
Der untere Teil von Hampton Bays lag verlassen da; die Bars waren geöffnet, doch es standen keine Autos davor, und die Bierreklame war verhüllt. In seiner Abwesenheit waren eine Menge Stände für gebratene Muscheln oder Eis aus dem Boden geschossen und wieder eingegangen. Die Straße machte einen Bogen um die Bucht, der Randstreifen war sandig, die Telefonmasten standen schräg. Auf der Weide der McCauffeys stand eine Garage aus Hohlziegeln, tauchte mit ihrem Kalkanstrich plötzlich aus dem Dunkel auf. Er bog auf den Weg, auf dem er immer nach Hause gegangen war und die Kühe des Alten mit Kastanien beworfen hatte. Der Buick schaukelte in den Furchen. Zwergkiefern schrammten an den Kotflügeln entlang und weckten Anne.
«Siehst du da draußen Kühe?», fragte James.
«Was?»
Er hatte es vergessen; die Weide war überwuchert, die McCauffeys nicht mehr da.
Sie überwanden eine Steigung; die Sterne sanken herab, das Meer war ein dunkler Abgrund. Das Haus zeichnete sich schwarz vor dem Mond ab, durch einen Vorhangspalt im Erdgeschoss fiel etwas Licht. Plötzlich tauchte Sarahs Hudson im Scheinwerferlicht auf und dann die Korbschaukelstühle, die nebeneinander auf der Veranda standen.
«Sag bloß, wir sind da», sagte Anne.
Als er anhielt, legte sich eine Staubwolke über den Wagen. Er schaltete alles aus. Anne wartete darauf, dass er ausstieg; Jay war an ihre Brust gesunken und schlief noch immer.
«Da müsste jemand längst im Bett liegen.»
«Mach schon», sagte sie.
Seine Beine waren steif. Es war viel kälter, als er gedacht hatte, und das Meer war lauter. Am Himmel stand nur eine schmale Mondsichel; da das Haus verdunkelt war, konnte er den Weg nicht sehen. Die Haustür öffnete sich, und Sarah erschien. Die Tür schloss sich, und sie wurde unsichtbar. Sie richtete die Taschenlampe auf die Verandastufen, auf ihre Füße und, als sie den Rasen überquerte, auf das nasse Gras.
«James», sagte sie, gab ihm einen Kuss, und er spürte, wie sich die Taschenlampe in seinen Rücken drückte. Sie wurde immer dünner, nahm immer mehr ab. «Dad schläft. Es geht ihm gut.»
«Und was ist mit dir?»
«Nicht einen Tropfen.»
«Ehrlich?», fragte er, als ob es witzig gemeint wäre. Er verließ sich zu sehr auf sie. Es ging nicht mehr darum, wer älter oder jünger war, doch sie behielten es bei.
Alle küssten sich in der Kälte, müde von der Fahrt. Anne trug ihre Handtasche, Jay seine Zigarrenschachtel und Rennies alten Koffer. Sarah führte sie ins Haus, während James sich mit der Schnur abmühte und alles ablud. Über ihm flatterte eine Flagge, die Fallleine schlug gegen den unsichtbaren Mast. Ein Knoten machte ihm Schwierigkeiten, und er hielt inne, stützte die Arme auf den Wagen und blickte zum Haus hinauf. Es wirkte jedes Mal kleiner, doch das war kein großer Trost. Er hatte sich gern von hinten an seine Mutter herangeschlichen. Sie hatte am Herd gestanden, und immer wenn er die Fliesen halb überquert hatte – und aus dem Schutz des Hackklotzes und des Personaltisches getreten war –, hatte sie gesagt, ohne sich von ihrer Arbeit umzudrehen: «Ich seh dich, James», und er hatte den Rückzug angetreten, als ob sie ihn nicht ertappt hätte. Die Gäste hatten auf dem Rasen mit ihren Kindern Krocket gespielt, schon fürs Abendessen umgezogen.
Hinter ihm rollten die Wellen heran und brachen sich am Strand. Oben ging ein Licht an, wurde rasch durch ein Rollo verdunkelt. Im Handschuhfach fand er Rennies altes Pfadfindermesser, schnitt den Knoten auf und nahm die beiden schwersten Taschen vom Wagen. Er schimpfte auf Anne; sie hatte sie absichtlich so vollgestopft, wollte ihn bestrafen, weil er beim Packen nicht geholfen hatte.
Als er eintrat und die Tapete sah, blieb er stehen. Der trübe Spiegel, das Treppengeländer, das in einem eleganten Schnörkel endete. Bei jeder Rückkehr war er wieder sprachlos über sein Schuldgefühl, über die Zärtlichkeit, mit der ihn die Lampen seiner Mutter erfüllten. Im Licht merkte er, dass er innerlich immer noch in Bewegung war. Sie waren oben, er hörte das Wasser laufen. Er stellte die Taschen ab, ging wieder nach draußen, bevor das Haus ihn in Beschlag nehmen konnte, und freute sich über die Dunkelheit.
Als er mit den nächsten Gepäckstücken hereinkam, warteten Anne und Sarah auf ihn. Sarahs blondes Haar war schon mit Grau durchzogen; eine Mischung aus Asche und Teig. Im Licht sah ihr Gesicht verhärmt und ihr Lippenstift zu jugendlich aus.
«Jay liegt im Bett», sagte Anne. «Ich geh nach oben, wenn du nichts dagegen hast.»
«Nein, geh nur. Ich sollte mal nach Dad sehen.»
«Das kann warten», sagte Sarah.
«Mach, was du willst», sagte Anne, «ich lege mich schlafen. Welches Bett willst du?»
«Ist mir egal. Irgendeins.»
Sarah half ihm, das restliche Gepäck hereinzuholen. «Sollte ich fragen?», meinte sie in der Küche.
«Ach, du weißt doch, wie wir sind.»
«Es muss schrecklich sein.»
«Nein», erwiderte James, als ob er alles erklären wollte, aber er war müde und ließ es dabei bewenden. Er merkte, dass er seinen Mantel noch anhatte, und hängte ihn über einen Stuhl. «Mach dir keine Sorgen», sagte er. «Wie geht’s dir?»
«Prima. Ich arbeite bei Grumman, wo auch Terry beschäftigt war. Wir bauen Flugzeuge. Ich hab richtige Muskeln gekriegt. Ich bring dich da unter. Sie stellen ständig Leute ein.»
«Klar.»
«Mein Bus fährt morgen früh um sechs. Wolltest du nicht Dad noch sehen?»
Sie ging voran, als ob sie ihm den Weg zeigen müsste. Die Hintertreppe hinauf, ein getäfelter Tunnel, der von einer einzigen Milchglaslampe beleuchtet wurde. Sie hatte abgenommen, während er dicker geworden war, und er fragte sich, ob sie wieder jemanden hatte. Terry war ihre große Liebe gewesen. James hatte ihn gemocht, obwohl er schon vor zehn Jahren gesehen hatte, dass er die Trinkerei nicht überleben würde. Er wollte Sarah fragen, wie sie all das überstanden hatte und es jetzt fertigbrachte, hier zu sein. Es war ihm nie in den Sinn gekommen, Anne verlieren zu können, nur, sie zu verlassen. Sein Wunschdenken verstellte ihm den Blick auf die Realität: auf die Wohnung seiner Schwester, die verregneten Wochenenden, das Angelgeschäft darunter, das um vier Uhr morgens öffnete. In seinen Tagträumen hatte er sich das helle, luftige Haus ausgemalt, in dem er und Diane wohnen würden, die freundliche Stadt ringsum, das beständige, herrliche Wetter. Ohne sie fühlte er sich lustlos und unzulänglich, konnte sich selbst nicht erklären, was passiert war, und schon gar nicht denen, die er eigentlich lieben müsste. Es war, als hätte sein Herz sogar vor ihm Geheimnisse, und er hatte schreckliche Angst, dass er sich in ein Leben als verwirrter und trauriger alter Mann fügen würde. Sie war ein schönes Mädchen, und er hatte sie geliebt. War es wirklich so einfach? Und wann würde ihn der bloße Gedanke daran nicht mehr schmerzen?
Oben war ihm plötzlich heiß. Die Türen im Flur waren geschlossen, das Fenster am Ende mit einem Vorhang verdunkelt. In der Ferne klatschten die Wellen an den Strand.
«Du musst leise sein», sagte Sarah und legte die Hand wie ein Safeknacker an den Türknauf, doch als sie eintraten, sah er, dass sein Vater wach war und in die Dunkelheit starrte. Er war schon immer distanziert gewesen, die Schlaganfälle hatten sein Schweigen nur verstärkt. Im Zimmer roch es wie in einem Wandschrank, nach Mottenkugeln und Gürtelleder. Ihr Vater lehnte am Kopfteil des Bettes, seine Nachtmütze war ihm halb vom Kopf gerutscht, die eine Gesichtshälfte hing herab. Im Licht vom Flur sah er grau aus. Er hatte die Hände über der Decke gefaltet. Auf dem Nachttisch stand ein Glas Wasser, daneben lag eine Bibel, das verdrehte Seidenbändchen hing herunter, ohne eine Seite zu markieren. James kniete sich hin und berührte seinen Arm.
«Jimmy ist gekommen.» Sein Vater sprach undeutlich, als kaute er an einem großen Bissen. «Dann lieg ich wohl im Sterben.»
«Dad», schimpfte Sarah.
«Was hast du ihm erzählt?»
«Nichts», sagte James. «Sie hat gesagt, dass sich jemand um dich kümmern muss.»
«Ich pinkele ins Bett, Jimmy. Stell dir das vor. Davon sagen sie einem nichts.»
«Ist er nicht wunderbar?», sagte Sarah. «Bist du bereit, dir das den ganzen Sommer lang anzuhören?»
«Deine Schwester hat die Geduld verloren. Ist nicht ihre Schuld.»
«Keine Ursache. Hörst du das? So geht es die ganze Zeit.»
«Dein Bruder ist jetzt hier. Du hast deine Pflicht getan.»
«Warum musst du bloß so sein?», fragte sie plötzlich feindselig und war den Tränen nahe. «Warum kannst du dich nicht einfach bei mir bedanken?»
«Ich bin müde», erwiderte er und schloss die Augen. «Geht. Alle beide.»
James zog seine Hand zurück und stand auf. Alles kam ihm diesmal kleiner und seltsam falsch vor, wie in einem Traum. Wenn er gegen den Türrahmen stieß, würde vielleicht die Wand einstürzen.
«Morgens geht’s ihm etwas besser», sagte Sarah auf der Veranda, «aber nicht viel.»
«Warum lässt du dich von ihm aus der Fassung bringen?»
«Ich weiß, das sollte ich nicht. Gott, dieser Mistkerl. Und du sitzt einfach da und lässt es geschehen. War wohl nicht anders zu erwarten.»
«Warum ich?», fragte James.
«Du meinst wohl, warum nicht du. Immer trifft es mich, ich bin das Mädchen. Immer hat es mich getroffen, und das wird auch so bleiben. Ich sollte mich inzwischen dran gewöhnt haben.»
«Nein», entgegnete er, wusste dann aber nichts mehr zu sagen.
Sie verknotete ihr Kopftuch unter dem Kinn, gab ihm einen Kuss und stieg in den Hudson. Die Scheinwerfer glitten über die Hütten und die Dünen. Er sah zu, wie sie davonfuhr, stand dann in der Dunkelheit und lauschte den Wellen. Über das Wasser drang das vertraute Klirren einer Boje; weit draußen, irgendwo in der Dunkelheit, tutete ein Truppentransporter. Ich seh dich, James, ich seh dich. Hinter ihm knarrte das Haus im Schlaf.
«Wir sind da», sagte er.
Meerblaue Tage. Anne war an den Stundenablauf ihres Vaters, an den unruhigen Zeitplan eines Kranken gewöhnt. Sie wachte um fünf auf und zog sich in der fahlen Dämmerung an, bevor James’ Vater aufstand. Auf der Hintertreppe musste sie den Kopf einziehen und stützte sich beim Hinuntergehen mit einer Hand an der Wand ab. Auf den Stahltischen in der Küche spiegelte sich der aufhellende Himmel. Hier kam die Sonne zuerst hin; in Galesburg war es noch dunkel und ihr Haus eine Zielscheibe.
Mit einem leisen Knall ging der Herd an. Sie schloss die Türen zur Speisekammer, zur Treppe und zur hinteren Diele und wartete darauf, dass der Raum sich erwärmte. Vor Tagesanbruch wirkte das Haus kleiner, da das Grau seine wirkliche Größe verschleierte. Über dem Meer ging die Sonne auf und fiel in langen Strahlen durch die hohen Fenster. Anne blinzelte im hellen Licht, badete in seiner Wärme. Sie glaubte, ein Anrecht auf diese Momente des Alleinseins, auf die beglückende Endlosigkeit zu haben. An manchen Tagen musste sie überhaupt nicht aufwachen, gab nichts von sich preis, war zurückhaltend wie eine Patientin. Mehl, Milchpulver, Margarine.
Im Krankenhaus von Putney hatte sie das Frühstück verteilt, bevor sie nach Hause fuhr, und einmal war ihr von dem erstarrten Eigelb auf ihrem Arm schlecht geworden, und sie hatte sich in den Staub unter dem Autositz übergeben. Damals war sie noch jung gewesen und hatte alle, die sie pflegte, geliebt, verzweifelt über jeden wundgelegenen Patienten und jedes blass daliegende Kind. Die Geständnisse der Sterbenden waren ihr kostbar vorgekommen, als bestätigten sie den Glauben ihres Vaters. Sie hatte jetzt nicht mehr die Geduld, die grenzenlose Hingabe, die sie brauchten. Für den Gott ihres Vaters hatte sie sich nicht interessiert, sie erinnerte sich, wie sie während seiner Predigten mit den lila Seidenbändchen der Gesangbücher gewedelt und Verbinde-die-Punkte gespielt hatte, doch seine Überzeugung hatte sie nie angezweifelt. Montags war er im ganzen Bezirk herumgefahren und hatte sich um die Kranken gekümmert. Er hatte auf der Bettkante gesessen und gesagt: «Ach, Sie haben den Gottesdienst verpasst», und wenn sie wieder gesund waren, fuhren sie sonntags in die Stadt, um ihn zu sehen, über seinen neuesten Witz zu stöhnen und bei den Mitteilungen vor der Predigt darauf zu warten, dass er ihren Namen nannte. Später, nach dem Gottesdienst, hatten sie seine Hände ergriffen. Wie ermüdend musste es für ihn gewesen sein, ihre Wünsche zu ertragen. Die ganzen Jahre, die ganzen Toten. Und was war mit seinen eigenen Wünschen? An jenem letzten Morgen war sie neben seinem Bett auf die Knie gesunken, während er stöhnend dagelegen und ihr gesagt hatte, warum er sich als unwürdig betrachtete. Seine Beichte war unerbittlich und vernichtend gewesen, seine Selbstanklagen widerlich. «Du darfst deiner Mutter keine Vorwürfe machen.» Jetzt dachte sie jeden Morgen, sie würde sich nie davon erholen, obwohl sie wusste, dass es nur eine Frage der Zeit, der Arbeit, des richtigen Lichts war. Sie wollte von dieser Wehmut nicht ablassen. Es war sinnlos und dumm.
Die Bratpfanne war so groß, dass sie alles gleichzeitig zubereiten konnte. James aß gern jeden Tag einen Streifen Speck, während Jay seine ganze Ration auf einmal verputzte und dann bereit war, wieder eine Woche zu warten. Sie aß kaum etwas, sein Vater gar nichts, und so kamen sie aus. Dienstags radelte sie in die Stadt, um ihre Lebensmittelmarken gegen billiges Fleisch einzutauschen. Andere Mütter ließen ihre Töchter anstehen. Anne war die einzige Erwachsene; sie nannten sie Mrs. Langer, obwohl sie ihnen nie ihren Namen genannt hatte. Mürrisch und gelangweilt warteten die Kinder der Fischer, bis der Lebensmittelhändler den Laden aufsperrte, und wenn sein Gesicht in der Tür auftauchte, machten sie einen ohrenbetäubenden Lärm. Sie kauften alle Pferdefleisch, das mager war und nach Wild schmeckte, denn ihre Väter hatten es satt, immer Fisch zu essen. Die Eier kamen von den großen Entenfarmen im Westen und waren preiswert, sogar billig. Der Speck verstieß eindeutig gegen die Vorschriften. Im Gedränge, zwischen all den Waren, hatte sie das Gefühl, dass sie nicht viel brauchte.
«Danke», sagte sie, «auf Wiedersehen», und die Mädchen in der Schlange drehten sich um und sahen ihr nach. Anne fuhr davon und lachte über ihre Rätselhaftigkeit. Sie stellte sich vor, während all der grauen Tage allein hier zu leben, wie eine schwärmerische Romantikerin.
Aber das war sie doch auch, oder? Ein Rätsel, eine Romantikerin, allein. James war den ganzen Tag weg, Jay fing im Marschland Krebse, weil er schreckliche Angst vor seinem Großvater hatte. Auf der Veranda kam und ging Mr. Langer wie der Nebel. Nur die Möwen leisteten ihr Gesellschaft. Sie standen in Scharen auf dem Rasen, verloren Federn und Flaum, und ihr Kot trocknete fest wie verschüttete Farbe. Sein Vater sprach von gebratenen Möwen und einem Eintopf aus Fischköpfen; ihrem Vater hatte Essen nie viel bedeutet. Er hatte sich, übersättigt vom Tag und von seinen Gemeindemitgliedern, an den Tisch gesetzt und kaum etwas gegessen. Sie konnte ihn in Jay wiedererkennen, hatte ihn auch in James wiedererkannt. Beide hatten sie den Traum, alle Menschen zu retten und der Welt nichts schuldig zu bleiben. Ihre Männer. Im Winter hatte sie sich zu sehr verausgabt.
Sein Vater kam als Erster herunter, angezogen für schlechtes Wetter, als würde es bis mittags kühl bleiben. Er trank seinen Tomatensaft immer aus demselben Glas, dem letzten eines ganzen Sets. Sie musste es ihm auf die Veranda hinausbringen. Mit einer Decke über den Knien saß er in einem Korbschaukelstuhl und wartete auf die Zeitung. Jeden Morgen wurde sie von einem dicken Jungen auf einem Fahrrad gebracht, der die sandige Zufahrt über den Kies herunterholperte, dann das Rad am Rand des Grundstücks herumriss und die Zeitung wie ein Wurfgeschoss über das Verandageländer schleuderte, sodass sie über die Dielen hüpfte und kurz vor Mr. Langers Schuhen liegen blieb. Anne kam das wie ein Wunder vor – verwegen und ungestüm –, doch der alte Mann sagte nichts, griff nur nach der Zeitung, schaute dem Jungen nicht einmal nach, der, jetzt wieder ein Normalsterblicher, sein Fahrrad den Hügel hinaufschob. Inzwischen hatte Mr. Langer die Zeitung aufgeschlagen.
Während sein Vater frühstückte, machte sie für James das Lunchpaket fertig. Er hatte seit Putney so viel zugenommen, dass sie ihm nicht beim Essen zuschauen konnte. Alles ließ sich darauf zurückführen; er war so leicht zu durchschauen. Um den Bus zur Fabrik zu erreichen, musste er mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Er durfte nicht sagen, was dort hergestellt wurde, doch sie wussten, dass es sich um Flugzeuge handelte. An dem Abend bevor Rennie abgeholt wurde, hatte James ihm einen Vortrag darüber gehalten, wie sehr er an ihn, an das Land und die Geschichte glaubte, als ob er vor seiner Klasse stünde. Jetzt kam er mit Schmierfett an den Ärmeln und Metallsplittern in den Schuhen nach Hause, nahm nach dem Abendessen sein Fernglas und ging zum Leuchtturm hinaus – der bis auf weiteres abgeschaltet war –, saß bis zur Abenddämmerung unter dem dunklen Reflektor und suchte das Meer nach dem Ansturm der Invasoren ab. Mittwochs schrieb er Briefe an Rennie, die mit den Worten Lieber Sohn begannen.
James hatte sich nicht verändert. Sie musste ihren Glauben wiederfinden; er hatte den seinen nie verloren. Sein Optimismus war ein Spiel, das sie bereits verloren hatte. Es war ungerecht, das kleine Luder hatte nicht ihn, sondern sie zugrunde gerichtet. Anne musste ihm verzeihen. Das Luder, das Miststück. Sechzehn Jahre alt, ihre Liebe jungfräulich und rein, mädchenhaft. Wie konnte sie da mithalten? Er kam nachts zu ihr, gab aber auf, wenn sie ihn abwies. Sie stritten nicht miteinander: Sie wollte streiten, während er um einen Kompromiss, um eine Verständigung rang. Er fragte nicht mehr, was los sei, sondern redete einfach weiter, geduldig, sogar behutsam, als wäre sie wieder krank. Sie musste manchmal weinen, und das verstand er nicht und wollte sie in den Arm nehmen und streicheln. «Rühr mich nicht an!», schrie sie dann oder «Lass mich in Ruhe!», und er wich vor ihr zurück, als ob sie in Flammen stände. Wenn er ihr beim Weinen zusah, verachtete sie ihn am meisten und jagte ihn aus dem Zimmer. Ihr war egal, ob er Angst vor ihr oder um sie hatte. Auch die vergeudeten Tage waren ihr egal.
«Danke», sagte er, wenn sie ihm seine Brotbüchse gab, und fuhr schwankend zwischen den Möwen hindurch. Die Vögel wichen zur Seite, schlossen dann hinter ihm wieder die Reihen. Seine Versuche, den Hügel hinaufzuradeln, machten sie wahnsinnig; als er einmal stürzte, musste sie lachen, bis sie merkte, dass Jay hinter ihr stand.
Sie und Jay aßen am Personaltisch, saßen einander an dem polierten Stahl gegenüber. Sie konnte ihm jetzt nicht erklären, warum sie so distanziert war, nicht einmal, wenn er zuhörte. Obwohl sie James dafür ausschimpfte, konnte auch sie nicht aufhören, Jay mit Rennie zu vergleichen. Oft ertappte sie sich dabei, wie sie ihn liebevoll ansah, wenn er ihr erzählte, was er an diesem Tag vorhatte.
«Ich geh auf die Brücke zum Fischen», sagte er, und sie wollte ihn an sich drücken. So glücklich zu sein, das Fieber des Sommers in sich aufsaugen zu können.
Sie frühstückten, dann radelte er am Strand entlang zum salzigen Marschland, und der Tag lag vor ihr wie das Meer, schimmernd und flach wie eine Tischplatte, der Horizont eine Linie meilenweit draußen, doch scheinbar in Reichweite. Sie spülte das Geschirr, trocknete ab und räumte es weg. Es gab ein vollständiges Service für fünfzehn Personen – Wasserglas, Saftkelch, Salatschüssel, Suppenschalen –, und doch stand immer dasselbe Geschirr oben auf dem Stapel. Auf der Veranda mühte sich Mr. Langer mit der Zeitung ab.
Sie war überrascht, dass sie gern mit ihm zusammensaß. «Scharlatane» nannte er die Leute aus den Schlagzeilen. «Dieser Churchill ist ein Teufelskerl.» Er konnte ohne große Schwierigkeiten rein- und rausgehen, doch manchmal kam er ganz deprimiert aus dem Bad zurück. «Es ist kein Zuckerschlecken», sagte er. «Lass dir von keinem was anderes erzählen.» Wo James sich rechtfertigte, war sein Vater schroff. Meistens aus Frustration, doch manchmal konnte er auch hart zu Jay sein. Die Sonne schien den ganzen Tag; nach dem Mittagessen mussten sie auf andere Stühle umziehen.
«Da kommt der kleine Prinz», sagte Mr. Langer, wenn sie Jay am Strand noch kaum ausmachen konnte. «Zwei Uhr», sagte er und deutete auf das unsichtbare Flugzeug. Sie starrte aufs Meer hinaus. Blau, blau. In der Stadt ertönte die Mittagssirene, wie von einem weit entfernten Schiff. «Absolut pünktlich», sagte er und tippte auf seine Uhr. Dieser andere Ehemann, dieser seltsame Urlaub. Sie strickte etwas für Dorothy, und als sie aufblickte, stellte sie fest, dass er schnarchte und die Sportseite über die Veranda wehte.
«Ich bin nicht müde», sagte er, ohne sich zu verteidigen. Er konnte den Mund nur auf einer Seite öffnen. Es fiel kaum auf.
«Wie fühlst du dich?», fragte sie und beugte sich über ihn. Am Morgen hatte er versucht, sich zu rasieren, und sie konnte sehen, wo er aufgehört hatte.
«Ich bin müde», sagte er.
Auf dem Weg nach oben hielt er sich am Geländer fest, doch er schaffte es. Sie ging eine Stufe hinter ihm, bereit, ihn zu stützen, doch als er in seinem Zimmer war, kam sie sich dumm vor. Ihm ging es nicht so schlecht, bloß ihr. Vor einem Jahr hatte sie mit ihrem Vater gelacht, weil ihm seine Hosen zu weit waren, obwohl sie gewusst hatte, dass sein Dahinwelken das Ende bedeutete.
Sie faltete Mr. Langers Decke zusammen, noch warm von seinem Schoß, und ging auf der Veranda auf und ab. Die Flaumfedern der Möwen wehten herüber und blieben auf dem Rasen hängen; die Vögel schwebten über dem Meer oder schaukelten auf den trägen Wellen. Genau wie Jay würden sie zum Abendessen wieder da sein. Sie wusste nicht, was sie kochen sollte. Sie fing wieder an zu stricken, ging nach ein paar Maschen ins Haus und sah im Kühlschrank nach, doch auch da fiel ihr nichts ein.
Als sie wieder herauskam, wurde sie vom Licht geblendet. Wie sehr sie das Meer einmal geliebt hatte; wie sehr sie es jetzt lieben würde, wenn James, sein Vater und das alte Gespenst seiner Mutter nicht wären. Es war nicht allein ihre Schuld (doch, ganz allein ihre). In den Flitterwochen hatten sie in den Dünen miteinander geschlafen, unschuldig, hingerissen vom Anblick des Nachthimmels. Sand war in sie eingedrungen; sie hatte nichts gesagt, wollte ihm später davon erzählen. Wie ihr Körper geglüht hatte. Danach hatte sie gespürt, wie die Hitze aus ihr herausgeströmt war. Er hatte ihr den Pullover ausgezogen, und es hatte sie gefröstelt. «Was machst du denn da?», hatte sie gefragt, doch auch er hatte sich den Pullover ausgezogen, war aufgestanden und losgerannt, und sie war, ohne zu zögern, hinterhergelaufen, über den festen Sand in die anbrandenden Wellen. Das Wasser schien sie, bis auf einen warmen inneren Kern, ganz taub vor Kälte zu machen. Ihre Haut, so lebendig unter seinen Fingern, war ihr schwer und wie abgestorben vorgekommen. Er war mit eingeschrumpftem Glied aus dem Wasser gekommen, und sie hatte es witzig gefunden, und als sie ihre Kleider gefunden hatten, hatte sie noch einmal mit ihm geschlafen.
«James», hatte sie gesagt.
«Was ist?», hatte er in besorgtem Ton gefragt und reglos in ihr verharrt.
«Guck mal hoch», hatte sie gesagt, und sie hatten eine Weile in den Himmel geblickt. Wann hatte sie ihn zum letzten Mal so begehrt?
Sie ging nach oben, sah nach Mr. Langer und holte ihren blauen Badeanzug aus dem Koffer. Vom Leben im Norden, wo der Winter bis zum Mai dauerte, war sie ganz bleich. Sie konnte hübsch aussehen, brauchte sich nicht vor ihrem Spiegelbild zu scheuen.
In den Dünen suchte sie nach einer Mulde, streckte sich ohne Decke auf dem heißen Sand aus und schloss die Augen. Die Wellen, der Wind, der im Riedgras wisperte. Möwen, Möwen, verschwindet. Nirgends Schatten, die Hitze brannte auf ihrer Haut. Ihr Vater hatte noch im Juni den Kohleofen geheizt. Sie hatte ihn mit Suppe gefüttert, die ihm übers Kinn und auf das Kissen gelaufen war. «Wahrscheinlich wirst du mir nicht verzeihen», hatte er in flehendem Ton gesagt. «Ist schon gut», hatte sie erwidert, und er hatte sich dankbar an ihren Arm geklammert, als ob sie ihn erlöst hätte.
Das Blau zog die Hitze an; unter ihren Brüsten sammelte sich der Schweiß. Sie hätte Limonade machen sollen. Jay konnte die Zeit am Stand der Sonne ablesen. Wie ein Jäger, hatte ihr Vater gesagt, das sei eine Gabe. Sie setzte sich auf. Das Haus leuchtete weiß, die Rollos waren heruntergelassen. Kein Boot war zu sehen, keine Wolke. Genau das brauchte sie, um sich von ihren Depressionen zu befreien – sie selbst, ohne fremde Hilfe.
Sie lehnte sich zurück und ließ die Träger von den Schultern gleiten, zog den Badeanzug bis zur Taille herunter, stützte sich auf die Ellbogen und schob ihn über die Hüfte. Den Badeanzug besaß sie schon seit ihrer Jugend. Verrückt, dass er ihr immer noch passte. Letzten Sommer hatte James eine Bemerkung darüber gemacht. Zeit, sich einen neuen zu kaufen? Jetzt war er ihr zu weit, ihr Bauch geriffelt wie ein Waschbrett, weil sie ihren Vater ins Bett und wieder heraus gehoben, ihm aus der Badewanne geholfen hatte. Sie streckte sich aus, der Sand brannte mit neuer Hitze. Gab ihr die Sonne dieses Gefühl der Stärke? Plötzlich war sie von einer überwältigenden Hoffnung für ihren Vater erfüllt – dass sein Glaube, wennschon nicht wiederhergestellt, in jenen letzten Augenblicken wenigstens nicht völlig zerstört worden war. Dass er den Mut gehabt hatte zu beichten, sie mit seiner Selbstgeißelung zu konfrontieren, bedeutete, dass er sie für stark genug gehalten hatte. Oder lag es daran, wie sie befürchtete, dass sie als Einzige noch übrig geblieben war? Jetzt, allein wie das Einzelkind, als das sie aufgewachsen war, spürte sie ihn in sich, seltsam beherrscht, jenen letzten Teil von ihr, als würde sie – unter der Sonne, in ihrer makellosen Haut – grenzenlos werden. Wenn der Glaube Rennie beschützte, wie konnte sie dann nein sagen? Hier war sie fast imstande zu glauben.
«Deine Mutter hat nie etwas davon gewusst.»
Das schwache Brummen eines Flugzeugs. Sie schlug die Augen auf, doch die Sonne blendete sie so stark, dass sie es erst sehen konnte, als es schon fast über ihr war. Es war laut und flog so tief, dass man die Sterne auf den Tragflächen erkennen konnte. Sie winkte leichtfertig, doch als das Motorengeräusch nicht mehr zu hören war, schämte sie sich und schlang das Handtuch um ihren Körper. Lieber Sohn. Sie hasste James nicht, bloß dieses kleine Luder. Über ihr schrien die kreisenden Möwen. In der Diele war es dunkel, oben im Flur zehn Grad wärmer.
Sein Vater schlief noch immer in Shorts und Socken auf der Bettdecke. Fliegen brummten gegen das Fenster. Ein Rollo streifte sirrend das Fliegenfenster; sie zog es weiter herunter, hielt dann inne, stand da und sah ihn an, seltsam verzerrt im Spiegel der Kommode, die Wand neben ihr voll weißer Rosen. Der blaue Badeanzug. James’ Mutter war seit vierzig Jahren tot. Sie hatte Mr. Langer noch nie von ihr sprechen hören, und James nur, wenn man ihn dazu drängte. Wie ihre eigene Mutter, die sich stets unsichtbar gemacht hatte, und Anne merkte, dass das langsam auch auf sie zutraf. Warum? Sie war doch kein Gespenst.
Jay kam zum Abendessen mit einem Eimer voller Blaubarsche – zähe, hässliche Fische, die Mr. Langer nicht essen wollte.
«Kroppzeug», sagte er und hob einen an den Kiemen hoch. Dazu bestand kein Grund. Mittags hatte er ein Käsesandwich gegessen, und zum Abendessen bekam er einen kleingeschnittenen Hamburger, damit er sich nicht verschluckte.
«Danke», sagte sie zu Jay. «Ich mach uns morgen Fischkroketten zum Mittagessen.»
Er war ein Kind, noch konnte sie ihn zufriedenstellen. Er hievte den Eimer ins Spülbecken und flitzte dann die Hintertreppe hinauf, um sich zu waschen.
«Wo ist mein Hamburger?», fragte Mr. Langer halb im Scherz.
«Reg dich nicht auf», sagte sie und drückte mit dem Pfannenwender den Fleischteig platt.
Sie wartete mit den Spaghetti auf James, doch nachdem sie eine Stunde auf der Veranda gesessen und sich den Sonnenuntergang angesehen hatte, rief sie Jay zum Essen. Mr. Langer bat sie, das Radio einzuschalten. Sie ging mit Jay nach draußen und übte mit James’ altem Baseballhandschuh Fangen mit ihm. Das hatte sie nie gut gekonnt. Jay spielte, als würde er es ihr beibringen. Bei einem Wurf sprang ihr der Ball vom Handschuh und traf sie an der Brust. «Oh», sagte sie und verschränkte die Arme. Sie gab dem Handschuh einen Tritt; Jay sagte, sie bräuchten nicht weiterzuspielen. Es wurde langsam feucht, die Möwen kamen vom Meer herein. Als James endlich auf dem Hügel auftauchte, war ihr der Appetit vergangen.
«Von sieben bis sieben», sagte er kauend. «Sieben Tage in der Woche. Für alles, was vierzig Stunden übersteigt, gibt es das Anderthalbfache und sonntags das Doppelte.»
«Wie’s aussieht, wirst du kaum hier sein.»
«Da hab ich kein Mitspracherecht.»
«Weiß ich», sagte sie und spülte das Geschirr. «Ich fühl mich wahrscheinlich bloß einsam.»
«Ich weiß.»
Draußen spielte Jay Soldat, kletterte auf das Geländer der Veranda und legte seinen Baseballschläger an wie ein Gewehr. Im Wohnzimmer dampfte die Admiral Nimitz über den Pazifik nach Westen. James stand auf, brachte seinen Teller zum Spülbecken und umarmte sie von hinten, während sie die rote Soße abwusch. Sie machte sich los, um das Geschirrtuch zu holen.
«Ich trockne ab», sagte er hoffnungsvoll.
«Hast du Jays Fische gesehen?»
«Schön.» Er nahm ihr das Geschirrtuch ab. «Willst du mir denn gar nicht gratulieren? Schließlich ist das eine gewaltige Lohnerhöhung.»
«Großartig», sagte sie.
«Übertreib’s nicht gleich.»
«Was soll ich denn sonst sagen?»
«Nichts», erwiderte er.
«Hast du es Jay schon erzählt?»
«Ich bin gerade erst nach Hause gekommen.»
«Für mich spielt es keine Rolle», sagte sie. «Ich kümmere mich hier sowieso schon um alles. Er wird dich vermissen.»
James stellte einen Teller auf den Stapel und fischte einen weiteren aus dem Spülbecken. «Ich weiß nicht, warum du so unglücklich bist.»
«Nein?»
Jay tauchte im Fenster auf und erschoss James. Der drückte das Geschirrtuch an die Brust und fiel zu Boden.
«Du machst mir deswegen kein schlechtes Gewissen», sagte sie und ließ ihn dort liegen.
Später, im Dunkeln, kam er zu ihr. Sie hörte sein Bett knarren, seine Füße auf dem Boden. Ihre Bettdecke hob sich und setzte sie der Kälte aus, und er drängte sich an sie.
«Ich kann da drüben nicht schlafen», sagte er.
Sie schlüpfte aus dem Bett, ging um das Fußende herum und legte sich in das andere.
Am nächsten Morgen fuhr sie in die Stadt, um ein paar Pfund Zucker zu kaufen. In der Schlange hinter ihr standen drei oder vier Mädchen mit Verbänden um den Kopf, die stümperhaft angelegt waren. Ein paar Spritzer rote Farbe deuteten auf außergewöhnliche Wunden.
«Entschuldigung», fragte sie eine von ihnen, «habt ihr die angelegt?»
«O nein», antwortete eine andere, die rothaarig war und etwas Teuflisches hatte. «Das war Mrs. Ridley.»
«Ist Mrs. Ridley Krankenschwester?»
Alle lachten.
«Mrs. Ridley ist die Inhaberin von Ridley’s.» Ein paar von ihnen deuteten auf das Billigkaufhaus auf der anderen Straßenseite, über dessen Eingang in vergoldeten Buchstaben RIDLEY stand. «Wir machen eine Übung.»
«Tatsächlich», sagte Anne. «Und was sollt ihr tun?»
«Wir sollen uns mitten auf die Straße legen.»
«Und stöhnen», sagte die Schüchterne. Sie stöhnten gespenstisch, als ob sie im Sterben lägen.
«Wisst ihr, was ihr tun müsst, wenn wirklich was passiert?», fragte Anne.
«Mrs. Ridley holen?»
«Wann findet die Übung statt?»
«Wenn die Sirene losgeht. Dann müssen wir uns hinlegen.»
«Was passiert dann?»
«Die Soldaten kommen mit dem Bus und versorgen uns. Wissen Sie denn gar nichts darüber?»
«Da, wo wir wohnen, gibt es keine Übungen.»
«Oh», sagte das rothaarige Mädchen, «man muss aber Übungen machen. Sonst erwischen einen die Nazis.»
Der Lebensmittelhändler ließ ein weiteres Mädchen herein, und sie rückten alle einen Schritt vor. Als Anne sich umdrehte, um zu fragen, wo die Soldaten herkämen, ertönte die Feuersirene, und ringsum sanken alle zu Boden. Es war Punkt elf. Mr. Langer brauchte sein Mittagessen. Einen Augenblick lang stand sie, die einzige Überlebende, mit ihrer Handtasche da, dann legte sie sich auf den heißen Gehsteig.
Die Sanitäter brauchten ewig. Sie waren schlecht ausgerüstet und redeten zu viel. Derjenige, der sich an ihr zu schaffen machte, ein blonder Junge mit großen Zähnen, war noch jünger als Rennie. Er schwitzte und ließ sich vom Stöhnen der Mädchen ablenken, als hätte er Angst, dass sie wirklich verletzt seien. Sein Name war über der Tasche aufgenäht: Tedder. Als Erstes fühlte er ihr den Puls.
«Wie fühlen Sie sich, Ma’am?», fragte er mit einem Südstaatenakzent.
«Ich stehe unter Schock», sagte Anne. «Ich habe beim Warten eine Menge Blut verloren.»
Er überprüfte ihren Blutdruck und hüllte sie in eine imaginäre Decke. «Wie wär’s mit einem gebrochenen Bein?»
«Offener Bruch, direkt unterm Knie.»
Er gab sich geschlagen. «Das kann ich noch nicht.»
«Es ist ganz einfach», sagte sie. «Sie müssen gar nichts können. Wenn es schlimm ist, machen Sie eine Kompresse drauf, dann stabilisieren Sie den Patienten und bringen ihn in ein Krankenhaus. Ansonsten halten Sie die Wunde sauber, schienen das Bein und transportieren ihn dann ab.»
Er presste die Handballen auf ihr Schienbein, überprüfte noch einmal Puls und Blutdruck. «Sie sind Krankenschwester.»
«War ich mal.»
«Sie werden überleben», prophezeite er; bevor er zu seinem nächsten Opfer rannte, fügte er hinzu: «Ich danke Ihnen.»
«Ich danke Ihnen», sagte sie.
Mittags wurde Entwarnung gegeben. Es war schon nach eins, als sie die Tüte Zucker in ihren Korb legte und nach Hause fuhr. Da sie sich beeilen musste, konnte sie den Blick nicht genießen. Sie mochte diesen Teil des Weges, wo das Meer zwischen den Dünen hervorschaute. Um besser sehen zu können, stellte sie sich auf die Pedale und versuchte dann, die verlorene Zeit wieder aufzuholen, indem sie die letzte halbe Meile rasend schnell fuhr. Als sie den Hügel hinunterrollte, bekam sie zu viel Schwung, schoss über den Kies, das Hinterrad rutschte weg wie auf einer Eisfläche. Sie schielte mit einem Auge auf den Rasenstreifen neben der Veranda, wollte schon abspringen, doch dann grub sich das Vorderrad in eine Furche, sie gewann die Kontrolle zurück, und ihr Gesicht brannte vor Aufregung.
Mr. Langer hatte das Mittagessen zubereitet. Jay saß am Tisch und aß mürrisch sein Käsesandwich.
«Ihr zwei braucht mich gar nicht», sagte sie. «Ihr kommt auch allein zurecht.»
«Du hast gesagt, du würdest Kroketten machen.»
«Hör auf zu jammern», sagte Mr. Langer.
«Tut mir leid, Jay. Ich mache welche zum Abendessen, in Ordnung?»
Er blickte sie kauend an. Im letzten Jahr hatte er diesen leeren Blick zwischen Wut und Enttäuschung perfektioniert. Wenn sie wütend auf ihn war oder, was noch öfter vorkam, ihn zu beschwichtigen versuchte, nahm er Zuflucht zu dieser Leidensmiene, sein Schweigen eine Strafe, sein Blick fest auf einen Punkt hinter ihr gerichtet, als ob er sie herausfordern wollte, ihn zu schlagen. Er war wirklich der Sohn seines Vaters.
«Antworte deiner Mutter», forderte Mr. Langer ihn auf.
«Ja», sagte Jay. «Bitte.»
«Schon gut», sagte sie und versuchte (genau wie James!), die Wogen zu glätten.
Den letzten Bissen noch im Mund, bat Jay, vom Tisch aufstehen zu dürfen, und sie ließ ihn gehen. Mr. Langer ließ die Kruste übrig. Sie brachte ihn auf die Veranda, wusch ab, ging dann nach draußen und legte sich in die Dünen.
Licht, Hitze, die Schatten der Grashalme. Auf ihrem Bauch, am Hals und auf der Stirn bildeten sich Schweißperlen. Die weiße Haut unter ihrem Badeanzug zeichnete sich schärfer ab, und ihre Hüften wurden schmaler, als würde sie in der Sonne schmelzen. Diese wolkenlosen Nachmittage gefielen ihr, und doch durchrieselte sie selbst in den schönsten Momenten ein eisiges Rinnsal aus Zweifeln, wie die Bäche ihrer Kindheit, die noch im Frühling vereist und schwarz gewesen waren, das Bachbett verstopft von den Blättern vom letzten Jahr. Ihr Vater würde für den Rest ihres Lebens tot sein, und auf seinem Grab würde hohes Gras wachsen. Sie konnte sich nicht mehr an seine Stimme erinnern; er sagte ihr bloß Worte, die sie schon gehört hatte: «Die Leute in der Stadt haben es gewusst – zumindest ein paar, da bin ich mir sicher.»
Sie schlug die Augen auf, verbannte ihn aus ihren Gedanken. Die Eintönigkeit ihrer Tage hier. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Schatten, die auf die Veranda fielen. Wenn sie an Rennie dachte, sah sie ihn mit dem Gesicht nach oben in der Brandung liegen, die Brust zerfetzt, jede Welle spülte ihn weiter hinauf, zerrte ihn dann platschend wieder zurück. Es war ein Bild aus Life, jede Woche ein anderer Strand.
Hier gab es nichts. Die Felsen voller Möwen, der gedrungene weiße Leuchtturm, in dem Jay Flugzeug spielte. Er war jetzt dort oben und richtete den schweren Reflektor auf unsichtbare Feinde. Sie winkte ihm auf dem Weg zum Haus, er wandte sich ihr zu, feuerte aber weiter.
Sie war nicht einmal eine Stunde weg gewesen. Der Fisch war verdorben; als sie das Jay später sagte, verfiel er in Schweigen.
«Hör auf damit», sagte sie, und er stapfte aus dem Haus.
Beim Abendessen versuchte sie nett zu sein. Er war höflich. Mr. Langers Hamburger war nicht richtig durchgebraten.
«Dann gib ihn mir, und ich brate ihn so, wie du ihn gern hättest.»
«Ich mag ihn durch», sagte er.
Sie drehte die Flamme ganz hoch, und das Fett spritzte ihr auf die Handgelenke.
«Bitte sehr», sagte sie und knallte ihm den Teller hin. «Tut mir leid. Entschuldige.»
Am schwersten war die Warterei auf James, und wenn er schließlich kam, wollte sie nicht mit ihm reden.
«Und», sagte er, nachdem er ausführlich von seinen Erlebnissen berichtet hatte, «was hast du heute gemacht?»
Der Atem des Sanitäters hatte nach Kaugummi gerochen. Tedder.
«Nichts», erwiderte sie.
Das Radio trieb sie nach oben. Sie strickte, bis es für Jay Zeit war, ins Bett zu gehen, dann brachte sie ihn hinauf und ging noch einmal hinunter, um selbst gute Nacht zu sagen. Nur eine Lampe brannte, in einer Ecke, und auf ihrem Schirm stand ein Biertablett. James und sein Vater saßen jeder auf einer Seite der großen Radiotruhe, als würden sie sie bewachen. Sie saßen immer auf den gleichen Sesseln und unterhielten sich – so kam es Anne vor – mehr mit dem Radio als miteinander. Sie unterhielten sich mit dem Krieg.
Sie wartete lauschend, bis sein Vater als Erster hochkam. Im Dunkeln hörte sie, wie James ihm gute Nacht sagte und dann nach unten stapfte, um auf der Einstellskala nach weiteren Berichten zu suchen. New York natürlich, und dann, südlich davon, Philadelphia. Boston, Portland und einmal, vor einem Sturm, seltsamerweise Cleveland. Das Erdgeschoss war erfüllt von statischem Rauschen, von dem schrillen Pfeifen zwischen den Sendern. Sie versuchte einzuschlafen, bevor er genug davon hatte, wachte Stunden später jedoch von einem lauten Knallen unten auf, stieß ihre Stricksachen auf den Boden, warf die Bettdecke zurück und rief nach unten, er solle ins Bett gehen.
«Hat James es dir schon erzählt?», fragte sein Vater am nächsten Morgen und ließ sich seinen Saft von ihr geben. «Die Marinetruppen sind auf New Georgia.»
Er schien sich zu freuen, und sie ging wieder in die Küche, um James Pfannkuchen zu machen, dachte, ich kann diesen Krieg nicht beenden, konnte ihre eigene Schwäche nicht ertragen. Sie saß schweigend am Personaltisch, als irgendetwas – ein herabstürzender Balken, eine umgekippte Kommode, jemand, der die Treppe herunterfiel – alle im Haus zusammenzucken ließ.
Sie hatte Angst um Jay und rannte zur Vordertreppe.
«Hier», rief Mr. Langer von der Haustür. Er war aufgestanden und hielt seinen Saft und seine Decke in der Hand. «Die Zeitung», sagte er und deutete über das Verandageländer. Sie verstand nicht, was er meinte, lief aber hin.
Unter ihr lag der Zeitungsjunge zusammengekrümmt neben seinem Fahrrad, die Zeitungen waren ringsum im Gras verstreut. Er blutete aus dem Ohr. Als sie die Stufen hinunterlief, hätte sie James fast umgerannt.
Der Junge war bewusstlos. Sein Kopf war nach hinten geknickt, seine Kehle war zu sehen, und noch bevor sie auch nur seine Arme und Beine abtasten konnte, wusste sie – von unzähligen Kindern, die kopfüber in Heuhaufen oder in Baggerseen gesprungen waren –, dass er sich das Genick gebrochen hatte.
Sie fühlte ihm den Puls, der viel stärker war, als sie gedacht hatte, und tastete seine Beine ab. Aus seinen Shorts sickerte Blut. Sein Fahrrad hatte ihm direkt unterhalb der Leiste den Oberschenkel aufgerissen. Sie bedeckte die Wunde mit ihren Händen.
«Ich brauche ein Handtuch», rief sie, und Jay, der aufgewacht war und plötzlich dastand, lief los.
Unter ihr regte sich der Junge.
«James, ich brauch dich hier unten.»
Er sprang im Schlafanzug über das Geländer.
Sie deutete mit dem Kinn auf den Kopf des Jungen. «Wenn er wieder zu sich kommt und anfängt, um sich zu schlagen, musst du ihn festhalten.»
«Hier ist das Handtuch», sagte Jay.
«Gib es deinem Vater.»
Der Junge erwachte aus der Bewusstlosigkeit. Mit dem Genickbruch hatte sie unrecht gehabt (wie sehr sie aus der Übung war, wie sie sich freute, helfen zu können!). Sie drückte das Handtuch auf die Wunde, und er schrie und bäumte sich auf vor Schmerzen.
«Es ist alles in Ordnung!», rief sie laut. «Beruhige dich!»
«Soll ich ihn festhalten?», fragte James.
«Es ist alles in Ordnung. Hörst du?»
Der Junge sank ins Gras zurück und fing an zu schluchzen. Sie warf einen kurzen Blick unter das Handtuch. Die Wunde hörte nicht auf zu bluten.
«Hol den Wagen», sagte sie. «Jay, zieh dich an, du musst mitkommen. Wo liegt das nächste Krankenhaus?»
«In Brookhaven», sagte Mr. Langer.
«Es gibt hier doch irgendwo einen Armeestützpunkt», sagte sie.
«Keine Ahnung.»
Sie fragte James, als er mit dem Wagen vorfuhr.
«In der Nähe von Flanders.»
«Wo ist das?»
Er zog eine Straßenkarte aus dem Handschuhfach und tastete seinen Schlafanzug nach einem Bleistift ab.
«Zeig’s mir einfach.»
James half ihr, den Jungen auf den Rücksitz zu legen. Er hatte eine alte Decke über das Polster gebreitet, was, wie sie wusste, sinnlos war. Jay wartete, hatte Angst, ihn zu berühren.
«Steig hinten ein», sagte sie. «Du musst das Handtuch auf die Wunde drücken, um die Blutung zu stillen. Okay?»
«Okay.»
«Ich kann fahren», sagte James.
«Du musst arbeiten.» Bevor sie losfuhr (daran würde sie sich später erinnern, und es würde ihr ein Rätsel bleiben), küsste sie ihn durchs Fenster.
Sie hatte die Karte neben sich auf dem Sitz liegen und hielt vor jeder Abzweigung, um zu sehen, wo sie war.
«Wie geht’s dir dahinten?», fragte sie Jay. «Keine Angst, wenn er brüllt. Es tut weh, egal, ob du draufdrückst oder nicht.»
Das Benzin würde reichen. Sie brauste so schnell über den leeren Highway, dass sie die Einfahrt fast übersehen hätten, über die sich ein Bogen spannte, wie bei einem Pfadfinderlager. Die unbefestigten Straßen des Stützpunkts waren schlecht beschildert; es wimmelte von Soldaten, zumeist noch halbe Kinder, die wenigen Männer fielen sofort ins Auge. Anne fuhr mit heruntergekurbeltem Fenster; folgte ihren Angaben durch das Gewirr von Zelten zu einer Baracke mit einem roten Kreuz.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: