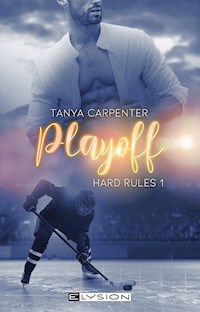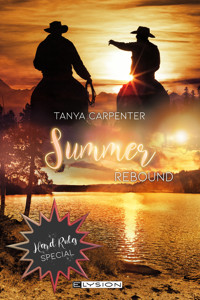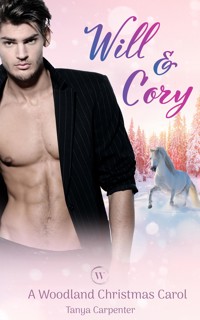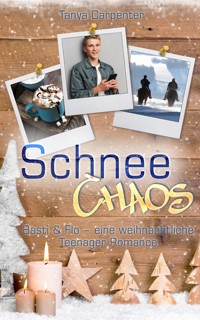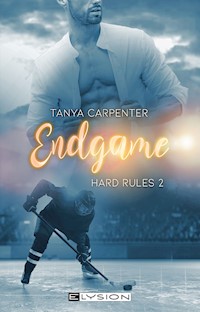9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ashera Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Livia – die Jägerin, und Asgard – der Sucher. Eine Werwölfin und ein Vampir, deren Wege sich durch Zufall kreuzen. Doch gemeinsam scheint es ihnen bestimmt, den jahrhundertelangen Zwist ihrer beider Arten zu beenden, indem sie zu den Ursprüngen zurückkehren und die Wahrheit ans Licht bringen. Dabei schwebt das ungleiche Paar in höchster Lebensgefahr, denn andere Jägerinnen der Lupus Garou sind ihnen auf den Fersen, und auch der Lord von Sacre Nuit hat seine Häscher bereits ausgesandt. Eine einzigartige Liebe, die Raum und Zeit überwindet - ein Schicksal, das mehr als nur zwei Herzen wieder miteinander vereint. Das Bundle beinhaltet beide Teile der Sommermond-Dilogie. "Vampire Moon" (Teil 1) und "Lycanic Moon" (Teil 2) sind auch als eigenständige eBooks erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Table of Contents
Title Page
Impressum
Sommermond 1 - Vampire Moon
Widmung
Prolog
Begegnung
Legenden
Flucht
Reise
Erwartung
Ankunft
Scheitern
Träume
Danksagung
Die Autorin
Sommermond 2 - Lycanic Moon
Widmung
Rückkehr
Trennung
Geheimnisse
Wiedersehen
Konflikte
Erkenntnis
Bedrohung
Hoffnung
Wahrheit
Wagnis
Schicksal
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Tanya Carpenter
Sommermond-Dilogie
Impressum
© by Ashera Verlag 2022
Ashera Verlag GbR
Alisha Bionda & Annika Dick
Hauptstr. 9
55592 Desloch
Covergrafik: iStock (www.istockphoto.com) & Fotolia (www.fotolia.com )
Innengrafiken: Fotolia (www.fotolia.com)
Coverlayout: Atelier Bonzai
Lektorat & Satz: TTT
Originalausgabe.
Alle Rechte vorbehalten
www.ashera-verlag.net
Für Merlin – in Erinnerung
Prolog
Juli 1807, Burg Sacre Nuit, Schottland
Schwüle erfüllte die Räume. Selbst die dicken Mauern der alten Burg vermochten die drückende Hitze, die seit Tagen herrschte, nicht länger auszusperren. Sie kroch durch jede Ritze und in jeden Winkel, legte sich wie eine schwere Last auf die Bewohner und machte sogar das Atmen schwer. Jede Tätigkeit wurde zur schieren Qual, weil jeder Schritt und Handschlag das Gefühl vermittelte, mehrere Zentner bewegen zu müssen.
Asgard rieb sich mit dem Handrücken über die Stirn, damit ihm nicht noch mehr Schweiß in die Augen rann. Sie brannten schon jetzt wie Feuer. Er konnte sie kaum noch offen halten. Das Los aller Sucher, die bei flackernden Kerzen über uralten Dokumenten, Büchern und Schriftrollen saßen, um Wort für Wort zu entziffern, zu übersetzen, und alles Wissen dieser Welt zusammenzutragen. Für ihn – Lord Darwin. Was auch immer Auge und Verstand eines Suchers erreichte, offenbarte sich auch ihm. Dem ältesten Vampir, ihrem Anführer und Herrscher. Bei ihm liefen alle Fäden zusammen, bündelte sich das allumfassende Verständnis dessen, was in der Welt geschah. So war es immer schon gewesen. Die Vampire lenkten die Geschicke der Welt, indem sie deren Augen und Ohren geworden waren und handelten, wo und wie es ihnen nötig erschien. Unbemerkt von den Menschen drehten ihre Lords das Rad des Schicksals nach ihrem Belieben und Willen. Allen voran Lord Darwin.
Asgard wusste, welche Ehre es bedeutete, von Darwin nach Sacre Nuit berufen zu werden, um in der großen Bibliothek Dienst zu verrichten. Doch diese besondere Stellung besaß auch ihre Schattenseiten. Wann immer er dem Herrn der Burg begegnete, brannte sich dessen Blick aus eiskalten blauen Augen in sein Innerstes und legte jedes Gefühl, jeden Gedanken bloß. Unheimlich! Und gefährlich! Auch jetzt überlief ihn ein Schauder. Man sah nur selten eine Regung auf den marmorglatten bleichen Zügen. Wenn der Lord das Wort an jemanden richtete, wirkte allein seine Stimme wie ein Befehl, dem man sich nicht entziehen konnte. Der Lord war nie grausam – jedenfalls nicht gegen seine Untergebenen – aber aus seinen Augen sprach zuweilen der Wahnsinn. Man sagte, er sei früher anders gewesen, doch mit Beginn des Krieges habe sich ein Schatten auf seine Seele gelegt, der nicht mehr weichen wollte und auch die Burg in seinen grausamen Krallen gefangen hielt. Der Tod war nach Sacre Nuit gekommen, im Mantel eines Freundes. Diesen Verrat hatte der Lord nie verwunden. Alles, was man noch von diesen dunklen Tagen wusste, waren vage Legenden, deren Wahrheitsgehalt sich schwer ermessen ließ. Was wirklich geschehen war, wussten nur noch wenige. Vielleicht nicht einmal mehr der Lord selbst, wenn es stimmte, was man sich zu berichten wusste, und der Hass jede Erinnerung an die Zeit vor dem Krieg in ihm ausgelöscht hatte. Selbst seinen Sohn schien er nicht mehr zu kennen. Jedenfalls kümmerte er sich kaum um den Jungen, der seinerseits in eine eigene, entrückte Welt geflüchtet schien.
Die Hitze der vom Wachs genährten Flamme, die vor Asgards Gesicht flackerte, steigerte sich zur Unerträglichkeit. Nur ein wenig frische Luft schnappen, dachte er.
Das Geräusch des Schemels auf dem steinernen Boden ließ die anderen Sucher aufblicken. Asgard machte eine vage Geste der Entschuldigung und taumelte dann mehr, als dass er lief zum offenen Fenster hinüber. Dort hielt er sein Gesicht in den Nachtwind. So sehr er die eisigen Winterstürme hasste, während derer man nicht genug Kleidung tragen und nicht ausreichend Decken über sich breiten konnte, obwohl alle Kamine in der Burg loderten, die Mauern aber dennoch kalt blieben, im Augenblick hätte er alles dafür gegeben, wenn jetzt solch ein Sturm über sie hereingebrochen wäre, um Linderung zu verschaffen.
Er starrte in den Nachthimmel hinauf, der in tiefem Blutrot erstrahlte. Der Mond glühte wie das Gesicht eines Höllendämons. Wolkenfetzen trieben ruhelosen Geistern gleich um ihn her, als buhlten sie um seine Gunst.
Freiheit, dachte Asgard, dort draußen ist Freiheit. Eine, die er nie erlangen würde, denn so wertvoll die Sucher auch für die Lords waren. So gut man sie auch behandelte. Welche Vorzüge man ihnen auch immer gewährte. Sie waren und blieben doch Gefangene. Besonders hier in Sacre Nuit. Ihr Leben und all ihre Gedanken gehörten ihrem Herrn.
Asgard schloss die Augen und gab sich für einen kurzen Moment seiner Sehnsucht hin, einmal allein dort draußen umherstreifen zu dürfen. Die Welt mit seinen geschärften Sinnen auf eigene Faust zu erkunden, das Leben zu fühlen, zu riechen, zu schmecken, zu atmen. Nicht nur aus dem geschriebenen Wort, sondern wirklich und wahrhaftig.
Der Sucher presste seine Wange an das Gestein des Fensterrahmens auf der Suche nach Kühle, doch selbst der Fels, aus dem die Burg erbaut war, schwitzte aus jeder Pore. Der Versuch, Sauerstoff in die Lungen zu bekommen, misslang. Da ihm lediglich schwindlig wurde, je länger er dort stand und auf eine frische Brise hoffte, gab er schließlich auf und fügte sich in sein Schicksal. Irgendwann würde auch dieser Sommer zu Ende gehen. Der Herbst brachte Regen und den sanften Kuss der Nebel, die sich dann im schottischen Tal ausbreiteten und die Burg wie ein Mantel aus Feentau umgaben.
Der Gedanke daran ließ ihn seufzen. Noch sah es nicht danach aus. Es war erst Juli. Der Sommer dauerte an.
Das Buch, das er gerade gelesen hatte, nahm er mit zu dem großen Regal. Darin war nichts von Belang gewesen. Nur Aufzeichnungen längst vergangener Dinge, die sicher schon hundertfach wiedergegeben worden und Lord Darwin längst bekannt waren. Es hieß, der Herr von Sacre Nuit suche nach etwas Bestimmten, auch wenn niemand wusste, was genau es war. Er würde es wissen, wenn es gefunden wurde. Es gab viele Vermutungen. Rache für den begangenen Mord an seiner Tochter, von der heute niemand mehr sprach. Die ultimative Waffe gegen ihre Feinde, die Lykaner. Und einen Weg zur absoluten Macht – als ob diese nicht längst in seinen Händen läge. Doch um diese Dinge durfte sich ein Sucher keine Gedanken machen. Er musste das Wissen finden; die Entscheidung, wie damit zu verfahren war, oblag anderen.
Um den Folianten zurückzustellen, brauchte Asgard die Leiter. Die Stufen knarrten unter seinen Füßen. Er spähte über seine Schulter, doch alle anderen im Raum blieben auf ihre Bücher konzentriert und beachteten ihn nicht.
Er stellte den Einband an seinen Platz zurück. Der Letzte in diesem Segment. Das Nächste war einem anderen Sucher zugeteilt. Jedes Segment wurde im Zyklus eines Mondes neu bestückt. So lange hatte ein Sucher Zeit, die ihm zugeteilten Werke zu lesen, sich das Wissen darin einzuprägen und somit über das kollektive Bewusstsein des Lords alles, was er gefunden hatte, an ihn weiterzugeben.
Schon häufiger war Asgard vor dem Ende eines Zyklus mit seinem Segment fertig geworden. Andere wiederum brauchten länger als eine Mondphase. Die Werke, die sie nicht gelesen hatten, wurden dann einem anderen Sucher im neuen Zyklus zugeteilt. Somit hatte Asgard kein schlechtes Gewissen, wenn er dem vorgriff und in einem anderen Segment weiterarbeitete. Racuul war der Langsamste von ihnen. Asgard entschied, dem jungen Sucher, der erst seit drei Monden auf Sacre Nuit Dienst tat und bereits zweimal für seine Säumnis ermahnt worden war, zu helfen und einige Buchreihen für ihn zu studieren.
Er lehnte die Leiter an das fremde Segment und erklomm die oberste Stufe, da Racuul in der untersten Reihe begonnen hatte. So konnten sie aufeinander zuarbeiten.
Als er das Regal vor sich hatte, überflog er automatisch die Schriftzüge auf den Buchrücken. Wo sollte er beginnen? Er hatte im Laufe der Jahre ein eigenes System entwickelt, bei dem er sich auf seinen Instinkt verließ und die Bücher nicht in der Reihenfolge ihrer Position studierte, sondern so, wie seine innere Stimme es ihm riet.
Asgard schloss die Augen, ließ seine Fingerspitzen über die uralten Werke gleiten und lauschte in sich hinein. Er liebte es, auf sein Gefühl zu hören und dem zu vertrauen. Das hatte ihm bereits mehrmals ein Lob des Lords eingebracht. Wie ernst dieses gemeint war, kümmerte ihn nicht, doch offenbar hatte man Verwendung für die Dinge gefunden, die er in der Bibliothek entdeckt hatte. Die Linien seines Suchermals pulsierten wie von Leben erfüllt, während die Kraft des geschriebenen Wortes zwischen den Seiten hervorströmte und ihn wie eine zärtliche Gefährtin liebkoste. Die Einzige, die ein Sucher je haben durfte. Von dem unscheinbaren Mal zwischen seinen Schulterblättern wanden sich inzwischen unzählige Ranken und Muster über seinen Rücken, und eine einzelne Linie wanderte bereits seinen linken Arm hinab. Er fühlte, wie sie prickelte, eine Verbindung herstellte, zu dem Wissen, das nur darauf wartete, von ihm aufgenommen zu werden. Es war stets ein magischer Akt, so oft er sich auch wiederholte.
Als seine Hand über einen dicken, ledernen Folianten glitt, glaubte er, noch etwas anderes zu spüren. Wie ein Ruf. Eine flüsternde Stimme. Er stockte, ließ seine Finger ein Stück zurückwandern und wieder vor. Erneut hörte er das Wispern, kaum, dass er das derbe Material berührte. Eine vollkommen neue Erfahrung, der Klang hingegen so vertraut. Wie von jemandem, den er sehr gut kannte. Er konnte sich darauf keinen Reim machen. Sucher besaßen keine Familie. Jeder, der das Mal ihrer Gilde bei seiner Geburt trug, musste sofort in eine der Schulen gebracht werden. Dieses Mal, das einer Tätowierung ähnelte, breitete sich im Laufe eines Sucherlebens über den gesamten Körper aus. Es hieß, die Symbole und Linien verrieten dem wissenden Auge, was der Sucher getan und erfahren hatte. Aber Asgard konnte weder sein Mal, noch das eines anderen Suchers lesen. In den ersten Jahren hatte er gehofft, es irgendwann zu erlernen und so vielleicht seine Eltern wiederzufinden. Inzwischen hatte er sich damit abgefunden, dass dies ein Wunschtraum blieb. Es war auch nicht gewollt, dass ein Sucher Gefühle gleich welcher Art empfand, da ihn dies von seiner Arbeit ablenken konnte. Jeder arbeitete stets für sich allein. Freundschaften waren kaum möglich, denn das Einzige, was ihre Gedanken beherrschte und beherrschen durfte, waren Worte, Buchstaben und Schriften.
Dieses Gefühl, das nun von Asgard Besitz ergriff, war ihm daher umso fremder. Verwirrt schüttelte er den Kopf, verharrte einen Moment unschlüssig: Schließlich ergriff er das Buch und zog es hervor. Im selben Augenblick wurde ihm bewusst, dass der lautlose Ruf nicht von diesem Werk ausging. Der Ursprung lag dahinter verborgen. Er hob den Blick von dem ledernen Einband zurück zu der Lücke in der Buchreihe und sah dahinter etwas … schimmern. Nein, das war das falsche Wort. Es war mehr ein Flimmern wie von Hitze. Noch intensiver als es derzeit allerorts der Fall war, wo die Sonne unbarmherzig alles mit ihrem Feuer quälte, sodass ihre Glut selbst in der Nacht unter dem Schatten des Mondes noch nachwirkte.
Der Gedanke an ein Dolmentor schoss Asgard durch den Kopf. Er hatte selbst niemals eines gesehen, doch man erzählte sich, dass sich die Luft an diesen Orten veränderte, wenn ein Tor aktiviert wurde. Dass sich das Bild der Umgebung dann verzerrte, vor den Augen verschwamm. Unwirklich wie ein Bild auf der Wasseroberfläche eines Sees, nachdem man einen Stein hineingeworfen hatte und die Wellen sie in Bewegung versetzten. Genau so war es auch hier.
Asgard legte das Buch beiseite und griff in die Dunkelheit hinter den Büchern. Seine Hand berührte eine Unebenheit, sie lag so weit hinten, dass er sie nur mit den Fingerspitzen erreichen konnte. Er war sich nicht im Klaren gewesen, dass die Buchwand so weit nach hinten reichte. Asgard stand bereits auf der obersten Stufe der Leiter und musste sich dennoch strecken, um etwas, das einem kleinen Knopf ähnelte, erfassen zu können. Er drücke darauf und hörte ein leises Klacken. Sekundenbruchteile später fühlte er weiches, kühles Leder. Der Geruch alten Papiers drang ihm in die Nase. Sein Herz begann vor Aufregung schneller zu schlagen. Was hatte er gefunden? Und warum war es dort verborgen worden? Wieso hatte man es bisher nicht entdeckt, so oft wie die Bücher in diesem Regal schon ausgetauscht worden waren? Alles Fragen, auf die er nur dann eine Antwort finden konnte, wenn er sich seinen Fund genauer besah. Beherzt griff er zu und holte eine dicke Mappe aus hellbraunem Hirschleder hervor. Sie war mit einer silbernen Spange verschlossen, in welche eine Distel und eine Eule eingraviert waren.
Wenn es ein Wappen sein sollte, so war es ihm nicht bekannt.
Nachdenklich fuhr Asgard die Symbole mit dem Zeigefinger nach. Eine Flut von Gedanken und Emotionen durchströmte ihn. Sie kamen und gingen so schnell, dass er sie nicht fassen konnte. Aber er wusste, sie waren da und blieben tief in ihm – darauf wartend, dass er sie eines nach dem anderen ergründete.
Er blickte verstohlen über seine Schulter, weil ihn mit einem Mal das Gefühl überkam, beobachtet zu werden, doch niemand schenkte ihm Beachtung. Also kehrte er an seinen Platz zurück und bemühte sich um den Anschein der Normalität. Wohl wissend, dass ab diesem Moment nichts mehr wie bisher in seinem Leben sein würde. Es war weniger ein Bewusstsein, als vielmehr ein untrüglicher Instinkt. Was er gefunden hatte, war nur für ihn bestimmt. Daran zweifelte er nicht eine Sekunde. Er hatte es finden sollen. Genau dort, genau jetzt. Warum, das verstand er noch nicht, hoffte aber, es in den Zeilen zu erkennen, wenn er begann, sie zu studieren.
Mit einem seltsam flauen Gefühl löste er die Spange und schlug die Mappe auf. Das Papier schien alt, aber dennoch makellos. Die Schrift darauf war fein geschwungen und sauber, beinah ein Kunstwerk. Und die Worte weckten etwas tief in ihm, als reise er durch die Zeit zurück und lausche der Stimme ihres Verfassers.
17. August 1707, Sacre Nuit
Ich habe aufgehört die Tage zu zählen, die ich hier im Kerker von Lord Darwin verbringe, denn wenn ich sie zähle, zähle ich auch die Tage, die mir noch bleiben, ehe er mich am Galgen baumeln lässt. Wenn ich auch weiß, dass ich sterben muss, hänge ich doch an den letzten Stunden meines Lebens zu sehr, um mir beständig vor Augen zu führen, dass sie zerrinnen wie Sand in einem Stundenglas.
Ich begreife noch immer nicht, wie es geschehen konnte. Ein einziger Alptraum. Dabei wirkte alles so richtig. Für sie, für mich, für uns alle. Mit dem Segen ihrer Lords und unserer Fürsten. Und jetzt? Zerbrochen die Liebe, die Hoffnung und vor allem die Allianz, die so vielen Mut gemacht und ihnen den Glauben an eine sorgenfreie Zukunft hätte schenken sollen. Ich fühle mich schuldig, empfinde meine Strafe – so sehr ich sie auch fürchte – dennoch als gerecht, weil ich verantwortlich sein werde für den Tod so vieler Menschen. Und doch wiegen all diese Leben nicht annähernd so viel wie das eine, das durch meine Hände rann.
Ich kann Lord Darwin keinen Vorwurf machen, denn obwohl der Schmerz sein Herz sicherlich in Stücke reißt und nur der Hass auf mich es weiterschlagen lässt, verzichtet er auf jede Grausamkeit und Folter. Sie ist auch nicht vonnöten, denn die schlimmste Qual von allen ist für mich der Moment ihres Todes.
Diese schicksalsschwere Nacht verfolgt mich in meinen Träumen. Es ist alles so unwirklich, kann unmöglich geschehen sein. Der schönste Tag im Leben, ein Bund für die Freiheit, für die Zukunft – alles ertrunken in ihrem Blut.
Die grauen Wände meiner Zelle sagen mir höhnisch, dass es so ist, egal wie sehr ich mir einzureden versuche, dass es nur ein böser Traum sein kann, aus dem ich wieder erwachen werde.
Irgendwann.
Aber nein, ich wache nicht auf. Sie kommt nicht zurück. Alles dahin, verloren – für immer.
Oder doch nicht?
Ich wage es, eine letzte Hoffnung zu hegen, auch wenn hier und jetzt für mich alles zu Ende geht und mir wenig bleibt, was ich noch tun kann, außer meine Gedanken und Gefühle festzuhalten für jenen einen Tag, der kommen mag. Die Worte meines Freundes – des einzig wahren, der mir noch geblieben ist – gehen mir nicht aus dem Kopf. Es muss nicht alles vergeblich sein. Vielleicht ist nur ein Opfer nötig, um doch noch alles zum Guten zu wenden. So will ich auf seinen Rat hören und ihm vertrauen, auch wenn mir nicht in den Sinn will, wer dieses Opfer bringen soll. Das meine wird sicher nichts mehr ändern. Der bewusste Verzicht auf eine Flucht, weil ohne meine geliebte Roga auch mein Leben keinen Sinn mehr macht.
Ich bete, dass ich die richtigen Worte finde und dass, wer immer sie wahrnimmt, sie versteht. Dass er sie verbergen kann vor den Augen des Lords, so wie ich sie verbergen werde. Lange genug überlebt – länger als ich – um das Rad zurückzudrehen.
Ich bange, dass mein letzter Getreuer einen Ort weiß, wo all dies hier sicher ist bis zum richtigen Zeitpunkt. Nah genug, und doch verborgen. Wem, wenn nicht ihm, kann ich diese wichtige Aufgabe anvertrauen? Er wird wissen, was zu tun ist. Er wusste es immer. Darum will ich auch nicht glauben, dass er sich bei unserem Bund geirrt hat. Es hätte Großes daraus entstehen können. Er hätte eine ganze Nation zu retten vermocht. Dass wir scheiterten, hatte andere Gründe. Es lag nicht in unserer Hand; nur den Preis, den müssen wir bezahlen.
Die Vampire leiten das Schicksal der Welt, doch dieses eine Mal ist es auch ihren Händen entrissen worden. Oder doch nicht? Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendwer wollte, dass wir scheitern. Auch wenn sich mir der Grund und der Sinn nicht erschließen.
Nun denn, der Galgen steht. Alles Zaudern hilft nicht. Meine Zeit wird knapp, und wenn ich will, dass das Schicksal eine letzte Chance bekommt – dass wir eine letzte Chance bekommen – sollte ich keine Sekunde mehr verschwenden.
Du, der Du dies hier liest. Ich hoffe, Du bist der Richtige. Denn ich lege das Schicksal ganzer Völker in Deine Hände – und mein eigenes. So lese, was ich zu sagen habe und handle weise. Erkenne die Zeichen, finde die Hinweise, suche die richtigen Verbündeten, sieh den Weg und warte auf den richtigen Moment. Sonst ist alles verloren – und dieses Mal für immer.
Asgards Kehle war trocken geworden. Diese Stimme … sie klang in seinem Herzen nach und weckte etwas in ihm, das ein Sucher nicht besitzen sollte – den Drang zu handeln. Den Mut, etwas auf eigene Faust zu tun. Den Wunsch, das System hinter sich zu lassen, in dem er seit seiner Geburt ein gut funktionierendes Rädchen gewesen war.
Ein Abenteuer wartete auf ihn. Und Asgard wollte es.
Der Schreiber – wer war er? Ein Lykaner? Asgard warf einen erneuten Blick auf das Datum. 1707 – das Jahr, in dem der Krieg begann. Hielt er hier die letzten Worte des Mörders von Lord Darwins Tochter in Händen? Der Gedanke jagte Wellen des Schreckens durch seinen Leib, weckte aber auch seine Wissbegierde. Konnten diese Zeilen das Geheimnis enthüllen? Vielleicht sogar … Erlösung bringen? War es das, wonach sie in Wahrheit suchten?
Verbergen vor den Augen des Lords!
Diese eine Zeile ließ ihn ein weiteres Mal in dieser hitzegeschwängerten Nacht schaudern. Nein, dies war nicht für den Lord bestimmt, ungeachtet dessen, ob er Ahnung davon hatte und danach suchte, oder nicht. Kein Zweifel, hier, in den Hallen von Sacre Nuit, war weder die Zeit noch der Ort, die Seiten in der ledernen Mappe mit der silbernen Spange weiter zu ergründen. Er musste fort von hier. Musste das, was geschützt und bewahrt in dem Leder der Mappe der Zeit getrotzt hatte, vor Lord Darwin in Sicherheit bringen. Dieser durfte weder durch ihn noch mit eigenen Augen je Kenntnis von dem erlangen, was hierin geschrieben stand.
Dieses Bewusstsein loderte so klar und sicher in ihm wie nichts anderes je zuvor. Das Verlangen, ihm zu folgen, war stärker als seine Furcht, entdeckt zu werden. Oder seine Angst vor den Konsequenzen, wenn Lord Darwin bereits in seinen Gedanken las, was er sich anschickte zu tun.
Schnell! Je länger er zögerte, umso mehr wuchs die Gefahr, entdeckt und festgehalten zu werden. Asgard warf sich trotz der Hitze seinen Umhang über, um die Mappe darunter zu verstecken. Danach verließ er eiligen Schrittes die Bibliothek. Er spürte die Blicke der anderen Sucher in seinem Rücken. Sie brannten und jagten ihm zugleich eisige Schauder durch den Leib. Wenn er auch seine eigenen Gedanken verbergen mochte, so würde Lord Darwin vielleicht in den Köpfen der anderen lesen, wie merkwürdig sich einer seiner Sucher benahm. Was sollte er tun, wenn er in den dunklen Gängen dem Lord in die Arme lief? Mit welcher Ausrede wollte er sich rechtfertigen?
Er zitterte, als er an den Treppen vorbeikam, die hinunter in den Kerker führten. Dort waren die Zeilen verfasst worden, die nun durch eine Laune des Schicksals oder aufgrund einer Bestimmung in seine Hände gelangt waren. Das Risiko war nicht zu leugnen, dass auch er dort landen würde, wenn man ihn erwischte.
Bei jedem Bewohner der Burg, der ihm über den Weg lief, fürchtete Asgard, man könne ihm alles vom Gesicht ablesen. Doch die wenigen, denen er begegnete, grüßten ihn nur höflich. Sucher waren geachtet. Mit etwas Glück gereichte ihm dies zum Vorteil. Wenn er erst draußen im Burghof war, konnte er in der Menge untertauchen.
Die Versuchung war groß, dem Licht der Fackeln auszuweichen und sich von Schatten zu Schatten zu schleichen, aber das hätte ihn nur verdächtig gemacht und die Aufmerksamkeit des Lords erst recht auf ihn gezogen.
Asgard hatte den Gedanken an Lord Darwin kaum zu Ende gedacht, als dieser plötzlich wie aus dem Nichts vor ihm stand. Um ein Haar wäre Asgard direkt in ihn hineingelaufen.
Es durchzuckte ihn wie ein Schlag, obwohl Darwin ihn lediglich mit starrem Blick musterte. Der Vampirlord verzog keine Miene. Wusste er bereits von Asgards Entdeckung? Und wenn ja, was würde er tun?
Seine Größe war Ehrfurcht gebietend, jedoch nicht bedrohlich. Er hatte die Hände vor dem Torso gefaltet; die weiten Ärmel seines Mantels verdeckten dies fast. Die glatte Marmorhaut verriet nichts über sein Alter oder gar über das, was in ihm vorging. Während die Gedanken aller anderen Vampire angeblich ein offenes Buch für ihn waren, konnte niemand in die seinen blicken. Ein Umstand, der Asgard die Kehle zuschnürte. Er hörte sein Herz so laut schlagen, dass es von den Wänden widerzuhallen schien.
„Mylord!“, brachte er mühsam hervor. Es klang kratzig und bereits wie eine Lüge.
„Asgard? Nicht wahr?“
Die Stimme des Lords war schneidend wie Stahl.
„Ja, Mylord.“
„Was macht ein Sucher in diesem Bereich der Burg? Zu dieser Stunde? Alle anderen sind in der Bibliothek oder in ihren Kammern, habe ich nicht recht?“
Asgard überlegte fieberhaft, wie er sich herausreden konnte. Dabei durfte er auf keinen Fall den Bereich seiner Gedanken preisgeben, in dem das Wissen um die geheime Mappe ruhte. Dies war umso schwieriger, weil er den Rest seiner Gedanken nicht vor Lord Darwin verbergen durfte, um kein Misstrauen zu erwecken.
„Ich … meine Sektion ist fertig. Ich wollte einige Minuten nach draußen, ehe ich mich zurückziehe“, log er. „Die Hitze … sie ist … kaum zu ertragen.“
Eine Ewigkeit lang blieb der Lord stumm und blickte Asgard weiter nur durchdringend an. Ihm schlug das Herz bis zum Hals. Was, wenn der Lord seine Lüge durchschaute? Was würde er dann tun? Ihn sofort töten? Oder in den Kerker sperren? Es gab zu viele Strafen, die schlimmer waren als der Tod.
Das Leder unter seinem Umhang schien zu glühen wie ein Brandmal. Er durfte nicht daran denken, doch je mehr er den Gedanken zu unterdrücken suchte, umso deutlicher wurde die Präsenz. Eine Last – so verlockend, sie loszuwerden, indem er sie hervorholte und dem Lord übergab. Vor seinem geistigen Auge sah sich Asgard genau das tun, erschrak vor sich selbst und der Möglichkeit, dass Lord Darwin dasselbe Bild gesehen hatte. Es vielleicht sogar in seine Gedanken implizierte, um ihn dazu zu bringen, ihm die Mappe auszuhändigen.
„Die Hitze, ich weiß. Eine der wenigen Dinge, über die auch wir keine Macht haben“, sagte Darwin in diesem Moment und klang erstaunlich verständnisvoll. „Du gehörst zu meinen Besten, Asgard. Ich will, dass du dies weißt. Ich bin über jeden von euch im Bilde und weiß, wer mir mit ganzer Kraft dient. Oder mich zu trügen wagt.“
Die letzten Worte verwandelten das vermeintliche Lob in eine Anklage. Asgard stockte der Atem. Er war überführt.
„Du siehst sehr viel, Sucher Asgard“, sagte Darwin mit einer Stimme, die ihm Eiseskälte über den Rücken jagte. Sollte er gestehen? Oder versuchen, sich herauszureden?
„Das … ist … meine Aufgabe … Mylord“, antwortete er stockend.
„Ich weiß!“ Das heisere Flüstern strich wie ein Windhauch durch die Gänge. Beinah lockend. Sag es mir. Gib es mir. Lord Darwin hob den Blick und starrte über Asgard hinweg in die Schatten hinter ihm, als gäbe es dort eine Antwort zu finden. Eine kalte Stille senkte sich auf sie herab, in der Asgards Herzschlag das Einzige war, das er hörte. Viel zu laut, viel zu schnell.
Als der Lord seine Hand ausstreckte, kam dies der Forderung gleich, ihm die Mappe auszuhändigen. Vielleicht die letzte Chance, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Schon glitten Asgards Finger wie von selbst zu dem weichen Leder, um sie hervorzuholen. Da legte der Lord seine Hand auf Asgards Schulter und zeigte ein Lächeln. Nie zuvor hatte Asgard ihn lächeln sehen.
„Gönn dir eine Atempause, Sucher. Und dann kehre zu deiner Arbeit zurück. Es gilt, keine Zeit zu verlieren.“
Damit ließ er Asgard allein, der kaum wusste, wie ihm geschah. Ungläubig blickte er in die Richtung, in welche der Lord entschwunden war. Sollte ihm tatsächlich so viel Glück beschert sein?
Mit der beständigen Angst im Nacken, doch ohne sich noch einmal umzusehen, eilte er aus der Burg, überquerte den Innenhof in Richtung der Ställe und nahm sich eines der Pferde.
Das Tier spürte seine Nervosität. Hinzu kam, dass Asgard kein geübter Reiter war. Dennoch musste er alles auf eine Karte setzen. Zu Fuß konnte man ihn schnell wieder einholen. Nur mit einem Pferd besaß er eine reelle Chance zu entkommen und einen ausreichenden Abstand zwischen sich und Sacre Nuit zu bringen, ehe Lord Darwin seine Flucht bemerkte. Was dann kam, würde das Schicksal zeigen. Ein Leben in den Schatten, als ewig Gejagter. Bis der Augenblick kam, vom dem der Schreiber sprach … wann immer das sein würde.
Wie von Teufeln gehetzt jagte bald darauf eine dunkle, verhüllte Gestalt auf dem Rücken eines Pferdes durch die Nacht und warf keinen Blick zurück. Hinter Asgard ragten die Zinnen von Sacre Nuit wie Zähne eines gefräßigen Raubtieres in den Himmel, als wollten sie ihn packen, von seinem Ross herunterreißen und verschlingen, damit er sein Vorhaben niemals in die Tat umsetzen konnte. Schwärzer noch als die Nacht, ein unheimlicher Scherenschnitt.
Nichts war mehr wie zuvor und würde es auch nie wieder sein. Das Wissen um die Geheimnisse, die er mit sich fortnahm, konnte sein Todesurteil werden, das war ihm bewusst. Auf jeden Fall war es schon jetzt sein Schicksal geworden. Weil er es gefunden – und weil er die Aufgabe angenommen hatte, die sein Verfasser ihm stellte.
Furcht durchströmte ihn. Furcht davor, dass Lord Darwin, Urvater und Quelle aller Vampire, längst in seinen Gedanken gelesen und die Jagd auf ihn eröffnet hatte. Niemals würde der Lord von Sacre Nuit es dulden, dass sich jemand gegen sein erklärtes Lebensziel auflehnte und danach trachtete, den Krieg zu beenden – oder ihn gar zu verhindern.
Wer wollte es ihm verübeln? Hätte er nicht an Lord Darwins Stelle genauso gehandelt? Anhand der bisher bekannten Tatsachen sicher. Nun wusste er, dass da mehr war. Dass die wahren Hintergründe der Tragödie von einst, die das Leben von Darwins einziger Tochter gefordert hatten, nie ergründet worden waren. Dass das Unglück kein Zufall, aber auch kein schändliches Verbrechen desjenigen gewesen war, der dafür sein Leben hatte geben müssen. Da war ein Geheimnis – ein Rätsel – und dieses musste er ergründen. Er musste einen Weg finden, das Unglück zu verhindern. Er würde es schaffen. Daran glaubte er fest. Es war sein Schicksal. Wenn nicht er, wer dann? Denn dies war seine wahre Aufgabe – die eines Suchers.
Juli 1907, Baltimore
Die Luft flimmerte, rund um das Gemäuer zirpten Insekten in der Hitze der Sommernacht. Ein blutroter Mond verlieh den spärlichen Wolken das Aussehen, lebendig zu sein. Höhnisch versprachen sie Aussicht auf eine willkommene Abkühlung, nachdem die Erde seit Wochen einem regelrechten Glutofen glich. Doch auch sie vermochten bestenfalls wenige Tropfen Regen zu bringen, was die Schwüle noch auf die Spitze treiben würde. Selbst in der Nacht konnte man kaum atmen.
Ein Käuzchen schrie, und hier und da sah Livia Fledermäuse um die Türme huschen. Wie passend. Tief in ihrer Kehle formte sich ein Knurren, doch sie unterdrückte es. Nichts durfte sie verraten. Hier war ein Stützpunkt ihrer Feinde, den die Späher erst vor wenigen Tagen ausfindig gemacht hatten.
Eine Sucher-Schule.
Nun waren sie geschickt worden – die Jägerinnen. Ein ganzes Rudel. Elitekämpferinnen der Lykaner, ausgebildet um erbarmungslos alle Blutsauger niederzumetzeln. Vor allem deren Sucher, die ohne Unterlass nach einem Weg forschten, das Volk der Lykaner endgültig zu vernichten. Sie würden denen zuvorkommen.
Ein dunkles Heulen ertönte – Riva hatte das Kommando in dieser Nacht und gab das Zeichen zum Angriff. Zeitgleich stürmten zwei Dutzend Jägerinnen, bis an die Zähne bewaffnet, aus ihren Verstecken hervor, sprengten die Türen der umgebauten Grafenburg und verteilten sich in Windeseile im Inneren.
Der Duft der Vampire überlagerte alles. Es war leicht, ihm zu den Sälen zu folgen, wo dieser Abschaum sicher voller Schreck in seinem Festmahl gestört verharrte und wartete, was da über ihn hereinbrach.
Livia zog die Smith & Wesson noch während sie sich in einen Seitengang rollte. Instinktiv gab sie zwei Schüsse ab, die den ersten Vampir, der ihren Weg kreuzte, ins Jenseits beförderten. Jahrelanges Training und härtester Drill schulten die Sinne, bis man auch blind immer ins Herz traf. Die zweite Kugel war Verschwendung gewesen und würde sicher eine Rüge nach sich ziehen, doch der Blutrausch begann bei Livia einzusetzen. Wenn er gänzlich erwachte, würde sie genügend Kugeln einsparen, um diese eine zu rechtfertigen. Dann brauchte sie keine Waffen mehr, denn wie alle Jägerinnen wurde sie selbst zur Waffe, wenn der herbe Duft ihre Lungen flutete und in ihren Adern zu pulsieren begann. Vampirblut machte eine Jägerin rasend, denn sie wurden von Kindesbeinen an darauf konditioniert. Mit den Überresten von Vampiren gefüttert, bis sie süchtig nach deren Fleisch und Lebenssaft waren. Manchmal widerte es sie an, wenn die Bilder ihrer eigenen Taten sie heimsuchten. Dann dachte Livia oft, dass sie nicht so war wie die anderen, fühlte sich schwach und ausgestoßen. Aber die Momente vergingen ebenso wie die Träume einer Vergangenheit, von der sie nicht einmal wusste, ob sie je wirklich existiert hatte. Sie war Teil des Rudels, Teil des Systems und eine der besten Jägerinnen. Für Zweifel war da kein Platz. Schon gar nicht, wenn man in den Kreis der Lupus Garou aufgenommen worden war. Diese Ehre gewährte Fürst Cordova nur wenigen. Man musste sie sich verdienen.
Livia schüttelte die hinderlichen Gedanken ab. Dafür war jetzt keine Zeit. Sie jagte über den Flur, registrierte die Vibrationen der sich öffnenden Tür Millisekunden bevor diese aufschwang, warf sich dagegen, sodass der Lehrer dahinter zu Boden fiel, riss sie auf und feuerte einmal. Die weißen Fangzähne blitzen, das Fauchen jedoch erstarb. Seine Hand griff ins Leere, ehe sie kraftlos zu Boden fiel. Livia gönnte ihm nur einen Blick, dann nahm ihr feines Gehör das Wispern der Eleven wahr. Künftige Sucher, die hier ihre Weihen erhielten und bald eine ernst zu nehmende Gefahr darstellen würden, wenn sie diese Nacht überlebten. Ein kaltes Lachen entrang sich ihrer Kehle. Niemand würde überleben.
Mit halblautem, lang gezogenem Heulen signalisierte sie ihren Gefährtinnen in der Nähe, dass hier ein Nest war. So nannten sie die großen Lehrräume, wo ältere Vampire heranwachsende Sucher auf ihre künftigen Aufgaben vorbereiteten.
In der Dunkelheit der Burg leuchteten die Augen der anderen Jägerinnen wie glühende Kohlen. Livia sah das Jagdfieber darin, das auch in ihr immer stärker wütete.
Riva schloss zu ihnen auf. Sie verständigten sich jetzt lautlos. Nur Schatten, Rascheln, eine Anwesenheit, die dem Feind das Blut in den Adern gefrieren ließ, weil er nicht wusste, wann und von wo sie zuschlagen würden, aber bereits ahnte, dass er keine Chance besaß.
Wieder einmal wurde ihr Irrglaube, sich vor den Jägerinnen verbergen zu können, wenn sie nur nicht allzu viel Aufsehen erregten, den Vampiren zum Verhängnis. Wann würden sie endlich lernen, dass es besser war, ihre Ausbildungslager von Häschern bewachen zu lassen. Jenen Kämpfern, die einem Rudel Jägerinnen zumindest ansatzweise gewachsen wären. Dann hätten Livia und ihresgleichen auch mehr Spaß an diesen Aktionen. So war das alles viel zu leicht.
In geschlossener Formation stürmten sie den großen Schulraum, fielen über halbwüchsige Sucher her, die bereits die erste oder sogar zweite Weihe empfangen hatten. Die Gegenwehr blieb verhalten, wer zu fliehen versuchte, wurde mit einer gezielten Kugel niedergestreckt. Die meisten fielen den scharfen Klingen der Messer und den ebenso scharfen Reißzähnen der Jägerinnen zum Opfer, die sich in der beginnenden Transformation aus den Kiefern schoben.
Gleich war es so weit, Livia ließ sich im Lauf auf alle viere fallen und schoss als rotbrauner Isegrim durch die Tür und in den langen Gang hinaus.
Riva hatte ebenfalls Wolfsgestalt angenommen, erreichte die große Flügeltür und blieb witternd davor stehen. Dahinter hörte man Herzen ängstlich schlagen. Der beißende Geruch von Furcht schwängerte die Luft. Livia fletschte die Zähne, wartete darauf, dass sich Riva gegen das letzte Hindernis warf, das Holz zum Bersten brachte und den Weg zu der Beute freimachte.
Mit lautem Geheul, da nun keinerlei Notwendigkeit mehr zur Vorsicht bestand, gab die Leitwölfin das Signal und das Rudel stürmte vorwärts. Splitternd gab das Tor nach, riss halb aus den Angeln unter dem Ansturm ihrer kräftigen Leiber, die mit dem ersten Tropfen vergossenen Blutes kein Halten mehr kannten.
Ältere Eleven, beinah schon bereit, um als Sucher in die großen Bibliotheken der Vampire entsandt zu werden, hatten sich zusammen mit einem Lehrer in die hinterste Ecke des Raumes zurückgezogen, aber das nutzte ihnen nichts. Ein Dutzend Jägerinnen fiel über sie her, packte Arme, Beine und Kehlen. Warmes Blut spritzte Livia ins Gesicht, mit einem gellenden Schrei rissen Muskel und Sehnen, sprang die Schulter aus dem Gelenk. Doch der Vampir musste nicht lange leiden, denn eine andere Wölfin zerrte gerade seine Eingeweide aus dem aufgerissenen Leib.
Überall um sie herum herrschte Schmatzen und Schlingen. Die konditionierte Gier nach dem Fleisch der Vampire schaltete das bewusste Denken vor allem bei den jungen Jägerinnen, die erst kürzlich ihrem Rudel zugeteilt worden waren, gänzlich aus. Die Älteren waren zu kampferprobt und wussten ihren Hunger in Schach zu halten, bis das Nest komplett zerstört war.
Hier entlang, nahm Riva telepathisch Kontakt zu ihr auf und sprang durch das Fenster auf einen Balkon, der direkt zum Nebenzimmer führte. Livia dachte nicht lange nach. Die Schmerzensschreie verstummten langsam, von den Eleven wanden sich nur noch zwei zuckend am Boden, der Lehrer war nicht mehr zu erkennen.
Sie setzte über den Fensterrahmen hinweg, landete sicher draußen, ohne sich an den Glassplittern zu verletzen, und folgte Riva in das nächste Zimmer.
Knurrend und mit gesträubtem Fell baute sie sich vor den Betten auf, spürte wie Blut und Eingeweidereste von ihren Reißzähnen tropften, und suchte mit wildem Blick ihr nächstes Opfer. Doch dann ließ der Anblick sie innehalten.
In diesem Raum waren keine Eleven. An der Wand standen kleine Betten aufgereiht, in denen Säuglinge bis vor wenigen Sekunden noch geschlummert hatten. Mittlerweile waren sie aufgewacht und schrien erbärmlich, strampelten mit den Beinchen und schlugen mit den winzigen Fäusten ins Leere. Am Ende des Raumes stand eine junge Vampirin in einem schlichten Gewand, die sich um die Jüngsten der künftigen Sucher kümmerte, an denen noch nicht mehr als das dunkle Mal darauf hindeutete, dass sie bestimmt waren, diesen Weg zu gehen.
Livia sah das unheilvolle Zeichen auf dem Rücken des Säuglings links von ihr, der sich zur Seite gerollt hatte. Sie wusste tief in ihrem Inneren, dass dieses Geschöpf nicht leben durfte, doch gleichzeitig überrollte sie eine Welle des Mitleids angesichts der Unschuld und Ahnungslosigkeit dieses wimmernden Bündels. Was wusste dieses Wesen schon von dem Krieg, dem es zum Opfer fiel? In seinem Herzen war längst noch kein Platz für den Hass, der sie alle antrieb.
Livia fühlte eine Träne über ihre Wange rinnen. Ihre Schnauze war nur Millimeter von dem Gesicht des Kindes entfernt, das mit einem Mal ganz still dalag und sie aus großen blauen Augen anstarrte. Staunend und unsicher. Der süße Duft aus der Wiege löste keinen Hunger in ihr aus. Sie war sogar versucht, mit ihrer rauen Wolfszunge über die rosige Wange zu lecken, um dem Knaben zu versichern, dass alles gut war und er sich nicht fürchten musste.
Der Schrei der Amme riss Livia aus ihren verwirrenden Gedanken. Sie blickte in ihre Richtung und sah sie mit aufgerissener Kehle zu Boden sinken. Das Blut warf Blasen im Ringen um Luft während ihres letzten Todeskampfes.
Die Leitwölfin hatte sich bereits von ihr abgewandt und beugte sich mit gierig aufgerissenem Rachen über das erste Kinderbettchen.
Riva, nicht!, durchzuckte es Livia, ehe sie nachdenken konnte.
Mit gebleckten Zähnen fuhr ihre Anführerin zu ihr herum und knurrte sie an. In ihren Augen glomm Hass. Das sind Vampire. Künftige Sucher. Je eher man sie tötet, umso besser. Keine Gnade. Auch ein Neugeborenes wird erwachsen, wenn wir das nicht früh genug verhindern.
Riva zögerte nicht länger, sondern riss das Bettchen zu Boden, packte den Säugling und schüttelte ihn so heftig, dass Livia sein Genick brechen hörte. Es überlief sie eiskalt. Sie war eine Jägerin, ausgebildet um zu töten. Doch sie konnte diese hilflosen Geschöpfe nicht umbringen, die nicht einmal begriffen, was mit ihnen geschah. Geschweige denn sich wehren oder zumindest flüchten konnten. Sie wusste, mit einer solchen Schuld könnte sie niemals weiterleben.
Hinter ihr sprangen andere Wölfinnen herein und machten sich über die Babys her. Livia wich langsam rückwärts, bis die Wand sie stoppte. Ihr Herz pumpte heftig, das Blut rauschte ihr in den Ohren und der süße Babyduft, vermischt mit honigwürzigem Blut, ertränkte sie schier. Das Szenario vor ihren Augen lähmte sie.
„Livia!“ Der Gedanke manifestierte sich wie ein Peitschenhieb in ihrem Kopf. Riva wandte sich ihr wieder zu, funkelte sie drohend an. „Ich warne dich, mach keinen Fehler. Ich dulde keine Versager in meinem Team.“
Sie zögerte nur eine Sekunde, blickte von Riva zu den toten Säuglingen und den schlingenden Wölfinnen. Dann traf Livia eine Entscheidung. Blitzschnell drehte sie sich um, sprang aus dem Fenster, stieß sich von der Balkonbrüstung ab und landete zwei Stockwerke tiefer auf dem Rasen. Sie achtete nicht auf den Schmerz in ihren Pfoten, sondern rannte einfach drauflos. Hinter sich hörte sie das Knurren und Heulen, das ihre Verfolgerinnen verriet, und beschleunigte ihre Flucht. Wohin, das wusste sie nicht. Noch weniger, wie es weitergehen sollte. Wer sich einmal gegen das System stellte, hatte sein Leben verwirkt, wurde zum Gejagten. Doch jedes Mal wenn sie an das Neugeborene in Rivas Schnauze dachte, dessen Genick brach, wusste sie, dass sie nie wieder mit den anderen Jägerinnen einen Angriff durchführen konnte. Sie hatte mit dem System gebrochen.
Livia rannte durch die Nacht, den Schrecken des soeben Erlebten noch immer vor Augen. Voller Angst im Herzen, dass die anderen sie doch noch einholten und sie zerfetzen würden. Zu Recht?! Sie hatte sie verraten. Aber wie hätte sie weiterleben sollen, wenn sie anders gehandelt hätte?
Tränen schnürten ihr die Kehle zu, machten das Atmen schwer, bis der Schmerz in ihrer Brust kaum mehr zu ertragen war. Dennoch lief sie weiter. Ihre Pfoten brannten bereits, aber sie wagte nicht anzuhalten. Wenn sie gekonnt hätte, wäre sie bis ans andere Ende der Welt gelaufen. Nur weit weg von diesem Ort, von den Schreien, dem Blut und der Erkenntnis, dass dort kein Feind gestorben war, sondern ein unschuldiges Wesen, das rein gar nichts von diesem Krieg wusste.
Übelkeit stülpte ihr den Magen um, zwang sie zum Anhalten, weil sie sich übergeben musste. Brennende Galle, vermischt mit Vampirfleisch quoll aus ihrem Maul, verätzte ihre Kehle. Es schüttelte sie. Keuchend und mit gesenktem Kopf blieb die Jägerin stehen – nein, nicht Jägerin. Nur noch eine Wölfin. Denn diese Jagd würde nie wieder die ihre sein.
Mit bebenden Flanken verharrte Livia im Dunkeln, lauschte, bangte –, alles blieb still. Schweren Schrittes schleppte sie sich schließlich weiter. Ihre Glieder pulsierten, rebellierten von der ungewohnten Anstrengung einer derart langen Flucht. Sie ignorierte es, zweifelte aber, ob sie erneut davonrennen konnte, wenn doch noch eine ihrer einstigen Gefährtinnen hinter ihr auftauchen würde, was aber nicht geschah.
In der Ferne kamen die Lichter einer Stadt in Sicht, von der sie nicht einmal sagen konnte, welche es war. Als sie geflohen war, hatte sie weder auf eine Richtung geachtet, noch auf die Zeit. Sie musste eine Ewigkeit gelaufen sein. Keine vertrauten Gerüche, nichts, was sie an ihr Zuhause erinnerte. Wenn es denn jemals ein Zuhause gegeben hatte. Empfunden hatte sie es nie, und nun glaubte sie auch zu wissen, warum.
Unter einer Brücke lag umgeben von einem im Wind flatternden Absperrband eine schmutzige Decke, die nach Alkohol und Urin stank. Ein Obdachloser war hier vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Jetzt war niemand mehr hier. Keine Polizei und auch keine ehemaligen Freunde des Toten. Sie war so müde, so erschöpft. Über ihr ratterte eine Straßenbahn, in der Ferne hupten Autos und Motorengeräusche bildeten einen monotonen, einschläfernden Klangteppich. Die Decke war rau, aber besser als nichts. Sich zu wandeln, wagte sie noch nicht. Zu verletzlich wäre sie in menschlicher Gestalt. Noch dazu nackt. Lieber wollte sie bis zur nächsten Nacht warten. Vielleicht warf jemand einem Streuner einen Happen zu, nicht jeder erkannte sofort einen Wolf, schon gar nicht bei der Farbe ihres Felles. Und wer vermutete einen solchen schon nahe einem Stadtzentrum? Sie fasste die Decke behutsam mit den Zähnen, schüttelte den Ekel ab und zerrte sie bis zu den Ausläufern des nahe gelegenen Stadtparks. Müde rollte sie sich schließlich unter einem Oleanderstrauch zusammen, gefangen in Trauer und Einsamkeit.
Das Rudel war Livias Halt gewesen. Die einzige Familie, die sie je gekannt hatte. In dieser Nacht war ihr bewusst geworden, dass dieses Leben nicht ihres war. Dass sie nie so sein würde, wie man es von ihr erwartete. Sie fühlte sich leer. Ohne Ziel, ohne Sinn, ohne Zukunft – und sehr, sehr einsam. Ihre Vergangenheit hatte sie eingeholt. Mit einem tiefen Seufzer schlief sie ein.
Begegnung
Juni 2007, Kanada
Livia blätterte die Zeitung um und studierte die Seite mit den Vermisstenmeldungen. Von Monat zu Monat wurden es mehr. Auch wenn viele dieser Menschen früher oder später wieder auftauchten, meist mit großen Gedächtnislücken oder völliger Amnesie, wuchs die Gesamtzahl der Gesuchten ständig. Livia wusste, woran das lag und es hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. Vor allem, da sie lange Zeit ein Teil davon gewesen war.
Schon damals, als sie sich von dem System abgewandt hatte, bezogen die meisten Lykaner ihr Fleisch aus den Fabriken bestimmter Großkonzerne. Das war üblich, es gehörte zum täglichen Leben.
Die eigenständige Jagd auf Menschen war inzwischen verboten, weil sie zu viel Aufsehen erregte. Ihre Art benötigte aber eine bestimmte Menge menschlichen Fleisches, um ihren Organismus funktionsfähig zu halten. Die Alternative waren Vampire, doch abgesehen von den Schulen der Sucher, kam man an diese noch viel schlechter heran. Zuwenig für das ständig wachsende Volk der Werwölfe.
Die Gefahr, bei der Jagd auf andere Vampire von deren Häschern ausgeschaltet zu werden, war hingegen auf Dauer zu groß. Außerdem hatten sich die meisten Vampirfamilien in höhere Positionen der menschlichen Gesellschaft vorgearbeitet. Unbemerkt bliebe ein solcher Beutezug daher mit Sicherheit nicht, heute noch weniger als in früheren Zeiten. Aber Unauffälligkeit war das A und O, um eine konstante Futterproduktion zu sichern.
Darum wählten sogenannte Fänger gezielt Menschen aus, die schnell in Vergessenheit gerieten oder bei denen die Polizei zu der Vermutung gelangte, dass es sich um einen ungeklärten Selbstmord oder einfach einen ausgerissenen Teenager handelte. Diese Unglücklichen wurden in die Fabriken gebracht, die als Pharmakonzerne oder sogar als Hersteller von Nahrungskonserven getarnt waren. Von dort kehrten sie niemals wieder. Zumindest nicht in einem Stück.
Livia hatte es einmal gewagt, sich auf das Gelände einer solchen „Futterproduktionsanlage“ zu schleichen. Was sie dort gesehen hatte, schockierte sie fast noch mehr als das Massaker an den Vampirbabys, das vor einem Jahrhundert dazu geführt hatte, dass sie dem System ihres Volkes den Rücken kehrte und seither jeden Kontakt zu anderen Lykanern mied.
Wie Schlachtvieh wurden die Menschen getötet und zerlegt. Die einzelnen Organe und Gliedmaßen gab man dann in riesige Becken mit Nährlösungen, die mit einer Mischung aus Hormonen und synthetisch hergestellten Zellteilern angereichert waren. Dadurch wurden aus einem Kilo Menschenfleisch bis zu einhundert Kilo Synthetik-Futter für Lykaner.
Nicht nur die drohende Gefahr der Entdeckung hatte Livia auf schnellstem Wege flüchten lassen, sondern auch das Grauen, das sich ihrer beim Anblick der Fertigungshallen bemächtigt hatte. Sie würde diese Bilder nie wieder loswerden und sicher niemals mehr eine Mahlzeit aus diesen Futterkonserven zu sich nehmen.
Die Vampire hatten ein ähnliches System, weil auch bei ihnen die direkte Jagd inzwischen verboten war. Nur Abtrünnige und Geächtete mussten sich auf diesem Weg – oder durch Diebstahl in Krankenhäusern und Blutbanken – am Leben halten.
Da Vampire aber nur Blut benötigten, ließen sie die Menschen, die sie einfingen und in ihren Konzernen gefangen hielten, nach einer Weile wieder frei, wenn sie ausreichend Blutspenden von ihnen abgezapft und auf die eine oder andere Weise ihr Gedächtnis gelöscht hatten. So erregten sie noch weniger Aufsehen, als die Lykaner.
Livia war schon häufiger Vampiren begegnet, doch sie verbarg ihre Natur vor ihnen, auch wenn sie wusste, dass nur die Häscher eine ernste Gefahr darstellten. Alle anderen kümmerten sich zusehends weniger um die Konkurrenz mit den Lykanern oder den alten Krieg. Das nahm ihresgleichen noch weitaus genauer. Ihr Anführer, Fürst Cordova, schürte den Hass auf die Vampire, indem er die Geschichte ihrer Feindschaft lebendig hielt. Das Unrecht, das ihnen zugefügt worden war. Ihm war es zu verdanken, dass vor dreihundert Jahren nicht alle Lykaner ausgelöscht worden waren. Hätte er nicht mit den Jägerinnen einen ebenbürtigen Gegner für die Häscher-Brigaden geschaffen, würde es heute vielleicht keine Werwölfe mehr geben.
Livia kannte die Geschichte, doch sie hatte sie längst weit in einen dunklen Winkel ihres Gedächtnisses geschoben. Die Welt änderte sich. Und die Vampire von heute trugen keine Schuld mehr an den Ereignissen von einst. Auch nicht an dem noch immer andauernden Wahn ihres obersten Lords, der nach wie vor nicht ruhen wollte, bis der letzte Lykaner vom Antlitz der Erde getilgt war. Was man so hörte, stand er damit inzwischen fast allein, wenn man von seinen direkten Untergebenen absah, deren Heimat auch heute noch die Burg Sacre Nuit war, auf der er wie vor dreihundert Jahren herrschte.
Die Vampire hatten sich gewandelt, viel stärker als Livias Volk. Wenn sie die heutige Jugend der Bluttrinker betrachtete, unterschied sie sich wenig von der der Menschen. Außer, dass sie noch gleichgültiger und arroganter war. Sie glaubten, nichts und niemanden fürchten zu müssen und fühlten sich unbesiegbar. Sie fanden es uncool, sich von Konservenblut zu ernähren und liebten vielmehr den kleinen Trunk, den sie meist noch mit anderen angenehmen Aktivitäten verbanden. In ihrer Naivität gingen sie viel zu sorglos mit ihren Opfern um und vergaßen zuweilen sogar die Gefahr, die allgegenwärtig von den Jägerinnen der Lykaner ausging. Der augenblickliche Vampir-Hype spielte ihnen in die Hände. Doch das sollte nicht Livias Problem sein. Es ging sie nichts an, und sie mied die Nähe von Vampiren so gut es ihr möglich war. Trotz dessen, was man sie gelehrt hatte – über die Vampire, den Beginn des Krieges und die unverzeihlichen Taten ihres höchsten Lords Darwin – konnte sie keinen Hass mehr empfinden. Jeder versuchte zu überleben und was geschehen war, lag Jahrhunderte zurück.
Livia seufzte und überflog die Namen derer, die von der Polizei oder Angehörigen gesucht wurden. Müßig darüber nachzudenken, wer von den hier Genannten in ein paar Wochen wieder auftauchen würde und wer für immer verschwunden blieb. Für Livia waren es sowieso nur Namen ohne Gesichter. Und das war gut so. Andernfalls hätte sie ihr Wissen um die Lykaner-Futter-Fabriken noch weniger ertragen.
Sie hatte sich mittlerweile ein eigenes System angeeignet, um nicht aufzufallen. Von totem Fleisch brauchte man zwar mehr, dafür schaute aber niemand nach, ob eine Leiche im Sarg noch alle Körperteile besaß. Es war leicht, die frischen Gräber abzusuchen, bis man einen Toten fand, der nicht vor der Bestattung mit Formaldehyd oder Ähnlichem präpariert worden war. Die Erde war locker genug, um sich bis zum Sargdeckel hinunterzugraben, der unter ihren Werwolfkrallen schnell nachgab. Später richtete sie alles wieder so her, dass niemandem etwas auffiel.
Manchmal hatte sie auch das Glück, dass ihr auf den Streifzügen mit ihrer Hündin Sachmet Leichenduft in die Nase stieg, wenn jemand aus einem Pflegeheim entlaufen war und im Wald erfror oder ein Obdachloser einen Herzinfarkt erlitt. Die Verletzungen, die sie ihnen zufügte, wurden dann schnell auf wilde Tiere zurückgeschoben, und völlig abwegig war das ja nicht.
Dank ihrer harten Ausbildung war Livia zäh und genügsam. Wie alle Jägerinnen brauchte sie nicht viel. Manchmal nahm sie sich einen kleinen Vorrat mit, um eine Weile nicht auf die Suche nach Nahrung gehen zu müssen. Doch es barg ein Risiko, menschliche Überreste in der Tiefkühltruhe zu lagern.
Ein oder zwei Wochen blieben ihr noch, dann wurde es wieder Zeit, sich auf die Suche zu machen. Im Sommer hasste sie es am meisten, nach Leichen zu graben. Der Verwesungsprozess setzte rasch ein und folterte ihre empfindliche Nase. Außerdem mochte sie die Hitze nicht. Sie erinnerte Livia immer wieder an den einen Moment, auch wenn er bereits fast ein Jahrhundert zurücklag. Doch die Schwüle der Sommernacht hatte sich ebenso fest in ihr Gehirn gebrannt, wie alles andere, was damals geschehen war, als sie zum letzten Mal mit einem Rudel Jägerinnen auf die Jagd gegangen war, um junge Sucher zu eliminieren.
Obwohl die Temperaturen draußen auch jetzt nach Sonnenuntergang noch weit über 25 °C lagen, fühlte sich die Luft im Inneren des Zugabteils frisch an. Klimaanlagen waren der reinste Luxus. Livia fuhr sich über die feuchte Haut in ihrem Ausschnitt und drehte den Kopf mit halb geschlossenen Lidern Richtung Gebläse. Was die anderen Fahrgäste von ihr denken mochten, kümmerte sie nicht. Der kühle Hauch vertrieb die Erinnerung und brachte sie auf andere Gedanken.
Nicht mehr lange, dann erreichten sie ihre Station. Livia freute sich auf Sachmet. Die Hündin war bestimmt schon ungeduldig. Sie spürte, wenn ihre Herrin nach Hause kam, und erwartete sie stets schon an der Tür. Ein Spaziergang würde ihnen beiden gut tun.
Livia streckte sich und überlegte, welchen Weg sie einschlagen sollte. Durch den Park oder lieber hinaus in den Wald. Der Bachlauf wäre sicher erfrischend. Für die Hündin und die Wölfin. Ein Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht.
Mit einem wohligen Seufzer öffnete sie ihre Augen wieder, und da sah sie ihn direkt vor sich. Livias Züge erstarrten, die feinen Härchen in ihrem Nacken stellten sich instinktiv auf, beinah hätte sie das Knurren nicht unterdrücken können. Ein Sucher! Hier? Und allein?
Er blickte sie an. Offenbar fürchtete er sich nicht vor ihr, sondern beobachtete sie bereits eine geraume Weile. Wusste er, was sie war?
Jägerin, hörte sie seine Stimme wie zur Antwort in ihrem Kopf.
Er war sehr jung, so schien es. Hager, mit rot geränderten Augen als habe er viele Tage und Nächte nicht geschlafen. Typisch für einen Sucher, der sein Leben fast ausschließlich über Büchern verbrachte. Sein schwarzes Haar, das er im Nacken zu einem Zopf gebunden hatte, bildete einen starken Kontrast zu seinem bleichen Gesicht, in dem zwei bernsteinfarbene Augen funkelten. Er war unrasiert und die dunklen Ringe ließen ihn wie einen Junkie aussehen. Gute Tarnung unter Menschen. Es ersparte unerwünschten Kontakt.
Eine Weile starrten sie einander nur an, aber keiner von ihnen drohte offen. Sucher gehörten auch nicht zur kämpfenden Elite der Vampire. Dafür hatten sie ihre Häscher. Normalerweise waren immer welche davon in der Nähe, wenn die Sucher von einem Ort zum anderen reisten, und noch nie war Livia einem einzelnen Sucher begegnet.
Sie ließ ihren Blick durch das Abteil wandern und witterte. Nein, da waren keine anderen Bluttrinker. Weder Sucher, noch Häscher. Verwirrt runzelte sie die Stirn, was er mit einem sanften Lächeln quittierte.
Ich bin allein, ließ er sie wissen. Die Stimme in ihrem Kopf klang freundlich und ruhig.
Livia musterte ihn mit einer Mischung aus Skepsis und Neugierde. Allein und wehrlos, dachte sie und nickte langsam, als Zeichen, dass sie das unausgesprochene Friedensangebot akzeptierte.
Schließlich ertönte das Signal für ihre Station. Livia schaute zum Ausgang, griff nach ihrem Rucksack und warf einen letzten Blick auf den Vampir zurück.
Ja, ich bin eine Jägerin, bestätigte sie. Doch hab keine Angst. Ich gehöre nicht mehr zum System. Genau wie du bin ich allein.
Nun war er es, der langsam nickte. Ich weiß. Und ich habe keine Angst vor dir.
Die Art, wie er das transportierte, ließ sie schaudern. Während sie ausstieg, glaubte sie noch, seine Blicke in ihrem Rücken zu spüren, doch sie drehte sich nicht mehr um.
Zu Hause wurde Livia stürmisch von ihrer Hündin Sachmet begrüßt. Die vierjährige Huskydame sprang winselnd und jaulend an ihr hoch, wedelte mit dem Schwanz und leckte Livia die Hände vor Freude.
„Ist ja gut, Süße, ist ja gut. Ich bin wieder zu Hause. Ja, alles in Ordnung, Baby. Das nächste Mal nehme ich dich wieder mit.“
Sachmet war Livias einziger Gefährte. Im Leben einer Kriegerin war kein Platz für innige Freundschaften. Noch weniger für Liebe und Zärtlichkeit. Nur für den Kampf und den Tod. Sie kannte es nicht anders, daran hatte auch ihre Flucht nichts geändert. Man hatte sie nicht gelehrt, zu fühlen und für andere zu sorgen. Im Umgang mit anderen war sie daher befangen und stets auf der Hut. Darum war Livia immer allein geblieben, nachdem sie damals fortgelaufen war. Auch wenn ihre Art nicht für die Einsamkeit geboren war und den Zusammenhalt eines Rudels brauchte, was in der Gemeinschaft der Kriegerinnen gegeben gewesen war. Seit ihrer Flucht hatte sie nie den Mut besessen, sich einen gleichartigen Gefährten zu suchen – oder einen menschlichen. Sie hätte einfach nicht gewusst, wie sie mit einem Menschen umgehen sollte, ohne ihn zu verletzen. Ein Lykaner, der sie womöglich an das System verriet, kam gar nicht infrage. Da war die Gesellschaft eines Hundes ungefährlicher gewesen und vertrieb ebenso die Einsamkeit. Außerdem konnte sie sich auf Sachmet blind verlassen. Es gab keine Geheimnisse zwischen ihnen. Sie musste in ihrer Gegenwart nicht auf der Hut sein, wie es bei einem menschlichen Freund oder auch nur Bekannten der Fall gewesen wäre. Die Hündin war nicht der erste Vierbeiner, den Livia zu sich nahm, doch zweifellos der treueste und klügste bisher.
Normalerweise tat Livia keinen Schritt ohne ihren Schatten, denn Sachmet witterte Jägerinnen, lange bevor Livia ihrer Nähe gewahr wurde. Aber die Zugfahrt und das stundenlange Warten in der Behörde, wo sich Livia die nötigen Bescheinigungen für ihre neuen Papiere abgeholt hatte, wollte sie der Hündin lieber ersparen.
Ein notwendiges Ritual, das sie nun schon zum dritten Mal hinter sich gebracht hatte, damit ihr nicht irgendwann doch jemand vom System auf die Spur kam.
Beim Umzug verloren gegangene Papiere, eine gefälschte Geburtsurkunde, die gekaufte Sozialversicherungsnummer einer Frau, über deren wahren Verbleib sie lieber nichts wissen wollte und viele mitleidheischenden Worte. Bisher funktionierte diese Taktik jedes Mal tadellos. Natürlich hätte sie all ihre Papiere von einem Urkundenfälscher besorgen können, aber dies war ausgesprochen teuer und sie versuchte, neue Identitäten stets so weit wie möglich legal anzunehmen. Echte Ausweise erleichterten einiges und minimierten das Risiko einer Entdeckung, denn überall hatte das System seine Spione. Sie war immer auf der Hut.
„Sieh mal“, meinte sie und hielt Sachmet den Umschlag hin. „Da ist alles drin, was wir brauchen, um neu anzufangen. Morgen gehen wir zusammen zum Einwohnermeldeamt und dann bin ich endlich wieder offiziell ein Mitglied der Gesellschaft. Ist das nicht schön?“
Die Hündin bestätigte das mit einem Wuff und schnupperte interessiert an den Papieren. Aber dann überlegte sie es sich offensichtlich anders und rannte zu dem Haken, an dem ihre Leine hing, schnappte sich das Lederband und zog es herunter. Livia musste lachen. “Recht hast du. Den ganzen Tag in Gebäuden eingesperrt zu sein, ist nicht unser Ding. Ich brauche auch noch etwas frische Luft.“
Sie schlugen den Weg Richtung Wald ein. Nach der Begegnung mit dem Sucher stand ihr erst recht der Sinn nach einem Bad in der kühlenden Strömung des Baches. Vielleicht ließ sich sogar eine Forelle fangen. Sachmet rannte ein Stück voraus, schnüffelte abseits des Weges und hetzte kurz einem Kaninchen hinterher, ehe sie wieder zu Livia zurückkehrte.
Dieses kleine Fleckchen, das so unberührt wie die tiefste Wildnis Kanadas wirkte, war der Grund für ihre Entscheidung gewesen, hier eine Wohnung zu kaufen. Sie und Sachmet brauchten solch einen Ruhepunkt, wo vor allem Livia sie selbst sein konnte. Der Waldstreifen, die Wiese und der Bachlauf reichten dicht an den Ort heran und lohnten sich nicht für Jäger und Freizeitschützen. Dennoch bot es genug Freiheit für die Hündin und die Lykanerin. Es war perfekt, wie ein Zeichen, ein Geschenk.
Natürlich hätte sie auch eine Wohnung in Kelowna nehmen können, aber die Stadt engte sie zu sehr ein. Eine Blockhütte weit außerhalb bot hingegen nicht genug Schutz. Keine anderen Menschen, Maschinen und Geschäfte, die mit ihren vielschichtigen Gerüchen als Tarnung dienten.
Die Gegend hier war sowohl bei Touristen als auch bei Auswanderern sehr beliebt. Hier tummelten sich Leute aus aller Herren Länder. Es war demnach leicht unterzutauchen, sich einzufügen als einer von ihnen. Zugezogene fielen hier nicht auf, sorgten nicht für Misstrauen – auch nicht, wenn sie zurückhaltend waren und lieber für sich blieben. Wenn man dann noch solch ein Kleinod wie den Bachlauf am Waldrand in direkter Nachbarschaft fand, musste man zugreifen. Das hatte Livia getan und nun lebte sie schon seit fast zwei Monaten hier. Unbescholten, einsam, aber akzeptiert.
Als sie das Wasser erreichten, streifte Livia mit einem sinisteren Lächeln ihr Top und ihre verwaschene Jeans ab, um nackt in die belebenden Fluten zu gleiten.
Hier, wo die Bäume sie von den Häusern abschirmten und sich die Dunkelheit der Nacht, wie ein zweites Gewand um sie legte, fühlte sie sich relativ sicher. Nichts, außer den vertrauten Geräuschen der Waldbewohner drang an ihre Ohren. Einen Augenblick hielt sie inne, lauschte hockend in die Dunkelheit, ob sie eventuelle Gefahren in der Nähe ausmachen konnte. Schließlich gab sie sich ihrer Natur hin. Nicht schnell wie im Kampf, sondern langsam und genüsslich. Livia streckte sich auf allen vieren am Ufer aus und rekelte sich im Gras, das noch die Wärme der Sonne vom Tag gespeichert hatte. Es glitt streichelnd über ihre Haut, der Duft von Erde und Kräutern flutete ihre Nase und weckte ihre zweite Seele. Das Fell drang sacht durch ihre weiche Haut, ihre Schnauze wurde lang, die Reißzähne schoben sich hervor. Ihr schlanker Leib verformte sich Stück um Stück zu einem athletischen Wolfskörper in kupferfarbenem Pelz und ihre schmalen, langen Hände wurden zu breiten, kräftigen Pfoten.
Kaum, dass die Transformation vollendet war, sprang Livia auf und rannte mit Sachmet an ihrer Seite um die Wette. Sie tollten über die Wiese wie zwei ausgelassene Welpen, balgten miteinander und rollten als ein Knäuel von Pfoten und Fell durch das Gras, bis sie beide außer Atem waren und die Verlockung des Wassers die Oberhand gewann. Sie hielten auf den Bachlauf zu. Zwei Blitze, gold und silbern, die pfeilschnell dahinglitten.
Als Wolf erreichten Livias Läufe kaum den Grund, nachdem sie ins Wasser gesprungen war, das über ihr zusammenschlug und sie einen Augenblick des Atems beraubte, ehe sie den Kopf wieder herausstreckte. Sie schwamm ein kurzes Stück, bis sie Boden unter den Füßen spürte. Dabei genoss sie es, wie sich ihr Fell mit dem Wasser vollsog und so die Hitze aus ihren Gliedern vertrieb.