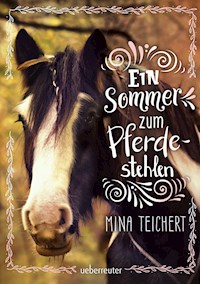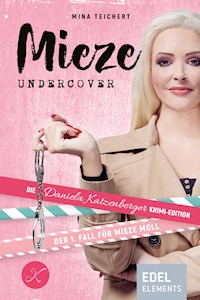Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ueberreuter Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine einfühlsame Geschichte ab 10 Jahren, die zeigt, dass wir Hilfe brauchen, um aus unserer Trauer zu erwachen Nach einem tragischen Reitunfall verbringt die 15-jährige Enola den Sommer auf dem Shetlandponyhof ihrer Tante in Schotlland. Ihre Eltern hoffen, dass sie dort den Verlust und das Geschene verarbeiten kann. Doch auch die süßen Shettys schaffen es nicht, sie aus ihrer Trauer und ihren Selbstzweifeln zu holen. Erst als sie das alte Tagebuch eines Jungen namens Georgie findet, der in den 30er Jahren mit seinem Pit-Pony Lucky in den Kohleminen verschüttet wurde, rührt sich wieder etwas in ihr. Denn egal, wie schlimm die Situation auch war, Georgie verlor nie den Mut. Als sich dann auch noch der schneeweiße Shetty-Wallach Pitty und die Nachbarskinder Fiona und Finley langsam in Enolas Herz schleichen, schöpft sie wieder neuen Mut. Ein neues Pferdeabenteuer ab 10 Jahren von Bestseller-Autorin Mina Teichert mit den beliebten Shetland-Ponys in der Hauptrolle
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die 15-jährige Enola soll nach einem tragischen Reitunfall den Sommer über nach Schottland auf den Shetlandponyhof ihrer Tante. Doch auch die süßen Shettys schaffen es nicht, sie aus ihrer Trauer und ihren Selbstzweifeln zu holen. Erst als sie das alte Tagebuch eines Jungen namens Georgie findet, der in den 30er Jahren mit seinem Pit-Pony Lucky in den Kohleminen verschüttet wurde, rührt sich etwas in ihr. Denn egal, wie schlimm die Situation auch war, Georgie verlor nie den Mut. Könnte auch ihr das gelingen?
Der neue Pferderoman von Mina Teichert!
Inhalt
Schottland
Erinnerungen sind das halbe Leben
Unglück über Unglück
Heiter bis wolkig
Es könnte stürmisch werden
Es wird Regen geben
Stumme Zeugen
Schmetterlinge sind auch nur hübsche Motten
Jedes Leben zählt
Starkregen
Schafe
Wenn Drachen lachen
Ungeheuer und Dunkelheit
Wohin mit all den Herzen?
Wenn einer in die Grube fällt …
Gegen die Zeit
Was wenn?
Das Ende der Welt
Über den Wolken
Schottland
Ich muss zugeben, ich bin noch nie gerne geflogen. Schon als kleines Kind nicht. Und wenn man mich fragt, ich hätte liebend gerne darauf verzichtet, nach Schottland zu reisen, um meine Tante Hillary zu besuchen. Aber mich hat keiner gefragt. Mein Koffer wurde sogar für mich gepackt, als würde man es gar nicht erwarten können, mich loszuwerden. Dabei hatte ich zuvor gerade erst sechs Wochen im Krankenhaus und dann Monate in der Reha verbracht. Man sollte wirklich meinen, dass meine Eltern meine Gegenwart länger ertragen würden als ein paar Wochen.
Mein Magen zieht sich zusammen, vermutlich weil das Flugzeug in den Sinkflug geht und den Flughafen von Edinburgh ansteuert. Der kleine Junge neben mir quietscht fröhlich auf und strampelt mit den Beinen, dabei verpasst er mir einen ordentlichen Tritt gegen mein schlimmes Knie. Ich verschlucke einen Schmerzenslaut und ringe mir trotzdem ein Lächeln ab. Er heißt Justus und ist fünf Finger alt. Und nach der letzten Stunde, in der ich von ihm mit Filzstiften erstochen, Bilderbüchern erschlagen und Kuscheltieren erstickt wurde, kann ich es nicht erwarten, den Nervzwerg endlich loszuwerden.
»Wir gehen jetzt gaaanz schnell runter«, kräht er und klimpert mit den blauen Augen. Ich unterdrücke einen genervten Seufzer. Stattdessen lächle ich sparsam und antworte: »Ja, endlich landen wir und können alle aussteigen. Yay.«
»Hui«, macht er und wirbelt mit seinem Stoffkrokodil. Seine Mutter guckt stoisch aus dem Fenster. Ich frage mich, ob sie mit offenen Augen schläft oder sich ihr Kind einfach mal wegdenkt.
»Ja, hui«, imitiere ich den Knirps, der beständig herumwippt. »Und jetzt versuchen wir mal, ganz still zu sitzen, damit das Flugzeug nicht umkippt, okay?« Ich gebe zu, ein schwacher Versuch. Aber man kann es ja mal probieren.
»Ein Flugzeug kippt nicht um«, hofft der Zwerg. »Mama, das kippt nicht um, oder?«, vergewissert er sich.
»Nein, Schatz. Ganz bestimmt nicht.« Nur kurz streift mich ihr Blick, bevor sie nach etwas in ihrer Tasche sucht.
»Du brauchst keine Angst haben«, flüstert mir der Kleine nun zu und tätschelt aufmunternd meine Hand. Diese Geste sollte etwas mit mir machen, ich weiß es, denn ich war einmal ein soziales Wesen. Ich mochte sogar Kinder mal wirklich. Doch jetzt ist da nichts. Nur das dunkle Pochen in meiner Brust, dort, wo einst ein fröhliches Herz schlug. Denn seit dem Unfall ist alles anders. So viel ist kaputt. Nicht nur mein Bein, sondern mein ganzes Leben.
Das Flugzeug sinkt. Ich ziehe den Gurt fester, versuche, an Justus-fünf-Finger-alt und seiner Mutter vorbei aus dem Fenster zu schauen. Wir fallen durch weiße Wolken und mein Magen zieht sich noch heftiger zusammen. Augenblicklich verkrampft sich alles in mir, meine Finger krallen sich in den Gurt und ich zähle innerlich bin zehn.
»Hui«, macht Justus erneut und in mir ist es, als höre ich Sarah, meine beste Freundin, die mich anfeuert.
»Yay! Hüa!«, jubelt sie. Galoppiert direkt auf meiner Höhe durch den Wald und filmt mich mit dem Handy. So wie sie es oft getan hat, wenn wir ausgeritten sind und alle gemeinsam mit den anderen Wettrennen machten. Für eine Millisekunde spüre ich den Wind, der mir den Atem nimmt und höre donnernde Hufe auf Waldboden.
»Wir sind da!«, kräht der kleine Justus. Das dämliche Krokodil fliegt mir um die Ohren, das Flugzeug bremst und ich kneife die Augen zu.
Ich kann Sarahs Aufschrei wieder in mir hören und fühlen, als diese verdammte Wildschweinrotte aus dem Dickicht schoss und meine Stute Hope zu Tode erschreckte. Es ging alles so wahnsinnig schnell, dass ich kaum reagieren konnte. Damals – an dem Tag, der alles veränderte. Das Donnern ihrer Hufe in mir wird ohrenbetäubend. Ich kann es in jeder Faser meines Körpers fühlen und ich versuche, dem Flashback zu entkommen.
»Mama, kann ich jetzt aufstehen?«, will Justus wissen und ich öffne die Augen. Er fingert bereits an dem Verschluss des Gurtes herum. Seine Mutter fängt seine Hände ein und drückt ihn in den Sitz. »Wir müssen erst richtig landen, Schatz.«
Der Schub der Flugzeugdüsen kehrt sich um, die Räder setzen auf Asphalt und ich denke, ich falle, als wir landen.
»Jetzt?« Justus juchzt.
»Nein, erst wenn wir stehen und die Lichter dort oben ausgehen«, erklärt sie geduldig und drückt seine kleine Hand.
»Hey, du? Enola, richtig?«, spricht mich seine Mutter an. Sie sieht mich lieb an. »Alles in Ordnung mit dir?«
Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Geräusche mache. Kleine abgehackte Laute, die sich nach Schluchzern anhören, aber keine sind. Eher eine Reaktion auf die nahende Panikattacke.
»Ja, alles gut. Ich hasse fliegen.« Mein Lächeln schmerzt auf meinem Gesicht und Justus tätschelt mich erneut. Diesmal an der Wange. Wie kann es sein, dass er so entzückend ist und sich alles in mir gegen seine Fürsorge sträubt?
»Zum Glück haben wir es ja geschafft«, meint sie und das Flugzeug wird langsamer. Bald darauf steht es und Unruhe bricht aus. Alle packen ihre Sachen, ziehen sich ihre Jacken an und reihen sich in die Schlange zum Ausgang ein. Dabei bekomme ich die Reisetasche eines Typen gegen die Schulter.
»Du?«, spricht mich Justus an. »Ich werde Kühe streicheln«, erzählt er mir. »Schottlandkühe. Die sind anders als unsere. Hübscher«, meint er.
»Na so was, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei«, sage ich und stehe auf. Im nächsten Moment fange ich seinen Sturz auf, weil seine kleinen Füße sich in der Schlaufe seines Rucksacks verheddern.
Die Stewardessen verabschieden sich freundlich von jedem ihrer Fluggäste und schon bald werden alle durch den Ausgang in den Flughafen gespült. Ich bin beinahe das Schlusslicht, als ich an der Gepäckausgabe ankomme. Mein Bein macht mir richtig zu schaffen, es tut höllisch weh nach dem langen Sitzen und ich atme erleichtert auf, als mein Koffer auf dem Transportband erscheint und ich die Empfangshalle verlassen kann.
Der kleine Justus-fünf-Finger-alt winkt mir zum Abschied zu und ich entdecke Tante Hillary, die bereits auf mich wartet. Sie trägt einmal mehr ihren extravaganten Hut auf dem rotbraunen Lockenkopf.
Es ist ein komisches Gefühl, hier anzukommen. Eine Mischung aus leiser Freude, gepaart mit Gleichgültigkeit und sogar Widerwillen. Dabei war ich als kleines Kind sehr gerne bei ihr zu Besuch gewesen und habe die schottische Landschaft, das raue Meer und natürlich die Ponys auf ihrem Hof geliebt.
Hillary winkt und ich umrunde den Typen, der mich im Flugzeug mit seiner Tasche geschubst hat. Er starrt auf sein Handy, achtet nicht auf seine Umgebung. Das Stimmengewirr in der Halle wird immer lauter und bald schon schließt mich Hillary in die Arme.
»Enola, Süße, da bist du ja endlich. Wie war der Flug?«, nuschelt sie mit ihrem weichen schottischen Akzent in mein Haar. Ich wurde zweisprachig erzogen, aber meine Tante spricht auch ein wenig Deutsch.
»Keine Turbulenzen, die Schwierigkeit war eher, durch den Metalldetektor zu kommen«, scherze ich und deute auf mein Knie, das seit Neuestem von Metall zusammengehalten wird. Hillary gibt mich frei, mustert mich besorgt. »Oh, Schatz. Es tut mir so leid, was geschehen ist«, betont sie immer wieder. Wie schon so oft am Telefon und ich beiße die Zähne zusammen. Ich will es nicht hören. Und nicht darüber reden.
»Ja, das ist vorbei«, versuche ich mir selbst beizubringen. Doch wie immer, wenn ich das behaupte, empfinde ich eigentlich genau das Gegenteil.
Sanft legt sie den Arm um meine Schulter, nimmt mir den Koffer ab und schlendert mit mir zum Ausgang. In der Ferne sehe ich Justus, wie er seiner Mutter entkommt und auf einen Stand mit Brötchen zurennt.
»Es hätte schlimmer kommen können. Du hast einen Schutzengel gehabt«, findet Hillary und der warme Strom Heizungsluft vor der automatischen Tür hüllt uns ein.
»Ja, genau«, brumme ich und Wut schäumt in mir hoch. Mein verschissener Schutzengel hätte seinen Job besser machen können. Oder etwa nicht? Wenn ich meine Aufgaben so erledigen würde, nur so zu etwa 60 Prozent, dann würde ich meinen Schulabschluss vermutlich nicht mal schaffen. Wenngleich ich jetzt sowieso hinterherhinke, im wahrsten Sinne des Wortes. Draußen angekommen, pfeift mir der schottische Sommerwind um die Nase. Hillary wirft meinen Koffer auf den Rücksitz ihres uralten Jeeps und hält mir dann die Beifahrertür auf.
»Na dann, mal rein in das gute Gefährt«, singt sie vergnügt und mein Knie zwiebelt, als ich es beuge und mich auf den fleckigen Sitz fallen lasse.
»Du wirst nicht glauben, was die letzten Tage so los war«, fängt sie an zu berichten. »Du kommst genau richtig. Ich kann deine Hilfe wirklich gebrauchen.« Sie zwinkert mir zu, schließt die Tür und ist verdammt schnell selbst im Wagen. Der Motor stottert, als sie ihn anlässt, wie früher schon. Hillary könnte sich durchaus mal ein neues Auto zulegen. Mama sagt, finanziell ginge das ohne Probleme. Sie hat einen guten Job als Grafikerin und ihre Shetlandpony-Zucht läuft auch bestens.
»Wir erwarten noch ein ganz spätes Fohlen. Ist das nicht toll? Du kannst miterleben, wie es auf die Welt purzelt. Tinystar fohlt zum ersten Mal. Ich hab dir doch Fotos geschickt?« Ihre Augenbrauen wackeln lustig und mein Mundwinkel zuckt.
»Ja, die winzige Scheckstute.«
»Genau, sie gehört zu den Minis. Mit nur 68 Zentimeter Stockmaß ist sie meine Kleinste.«
Jemand hupt, denn Tante Hillary hat anscheinend die Vorfahrt missachtet, aber sie fährt unbekümmert weiter.
Mein Blick heftet sich auf das Museumsschild des National Mining Museum in Newtongrange, als wir die Schnellstraße entlangdüsen. Schottland verfügt über große Kohlevorkommen, besonders innerhalb des industriellen Gürtels zwischen Dundee, Glasgow und Edinburgh. Soweit ich weiß, haben sogar Tante Hillarys und Mamas Vorfahren in einer Zeche gearbeitet.
Die zweite Hälfte der Fahrt, nachdem wir die Brücke überquert haben, spricht Hillary mich auf Sarah an.
»Und hast du dich noch mit deiner Freundin getroffen?« Ihr Blick wird ernst und ich wünschte, sie würde nicht so viel reden.
»Ich hab mit ihr geschrieben«, antworte ich und weiß, dass es nicht dasselbe ist. Sarah hatte mich nach dem Unfall im Krankenhaus besucht und ich hatte sie weggeschickt. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, wieso. Aber ihr war nichts passiert, den anderen drei Reitern auch nicht. Nur mir.
Und ich hatte das Gefühl, sie konnte überhaupt nicht verstehen, was in mir vorgeht. Und zu allem Überfluss fing sie immer wieder an, von diesem Tag zu reden, was es nicht gerade einfacher machte, die Bilder aus meinem Kopf zu bekommen.
»Du solltest sie nicht so auf Abstand halten, Enola. Sie ist deine Freundin, sie will bestimmt nur dein Bestes und für dich da sein.«
»Ich weiß.« Mama hatte auch versucht, mit mir darüber zu sprechen. Jeder braucht Freunde, gerade in schweren Zeiten, hatte sie gemeint.
»Das wird alles wieder. Du wirst schon sehen«, schließt Hillary und lässt ihre beringten Finger über meinen Oberschenkel tanzen.
»Ich weiß, ich brauch nur einfach noch etwas Zeit für mich«, sage ich dann irgendwann tonlos, während unvermittelt Regen einsetzt und mit Wucht an die Fensterscheibe schlägt.
»Na, sieh mal einer an«, wundert sie Hillary. »Dabei war doch Sonne angesagt für heute.«
Sie setzt den Blinker, biegt auf den Landweg in Richtung Nirgendwo. Die Landschaft versinkt im Regen, der Scheibenwischer kommt kaum gegen die Wassermassen an und ich lege meine Stirn ans kühle Fensterglas. Ich kann die alte Burgruine Ravenscraig Castle sehen, wie sie immer wieder aus dem Dunst des Unwetters auftaucht. Geisterhaft und wunderschön.
»Stell dir vor, der alte Bob hat jetzt ’ne Frau«, erzählt meine Tante vom Hufschmied des Ortes. Wir hatten uns das alle für ihn gewünscht, denn er ist wirklich einer der charmantesten Männer in ganz Schottland.
»Das ist ja schön.«
»Ja, und Claire ist auch noch nett. Gerade erst zugezogen aus den Highlands. Du wirst sie mögen.«
»Hm«, mache ich und hoffe inständig, dass Hillary nicht vorhat, Gott und die Welt zu sich einzuladen, solange ich bei ihr bin.
»Sie ist jeden Freitag auf dem Markt und verkauft eigenen Honig und selbst gemachten Schmuck«, erzählt sie weiter.
Am Horizont taucht der Strand auf, ich kann das Tosen der Wellen sehen, wie sie aufs Land zurollen und sich an den Felsen brechen.
»Und weißt du, was echt interessant ist an dieser Frau?«
»Nein, was denn?«
»Sie kann aus der Hand lesen.« Hillary lacht.
»Ja, genau. Ich glaube nicht an so etwas«, sage ich und blicke sie vielsagend an. Als ich zehn war, habe ich mir weismachen lassen, man könne mit einem Ouija-Brett die Toten rufen. Effie und Finley Froggatt, die Nachbarskinder, hatten mich damals ganz schön auf die Schippe genommen.
Ihr Lächeln verrutscht. »Och, wirklich nicht? Wie bedauerlich.«
»Was hat sie dir denn weisgesagt?«, frage ich, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich das wünscht.
»Och, nur dies und das.«
»Was genau?«
»Dass ich bald Gesellschaft haben werde. Und siehe da, sie hatte recht«, freut sie sich und zwinkert mir zu.
Es wird still im Wagen, nur draußen tost es weiter.
Irgendwann taucht das hübsche Schild am Straßenrand auf. In geschwungenen Buchstaben und in Rosen eingebettet steht dort Hillary McKenzie Cottage Shetland Stud farm und wir biegen auf den holprigen Weg, der über einen Hügel führt.
»Wie viele Ponys hast du denn zurzeit?«, frage ich, weil ich das Gefühl habe, ich muss etwas sagen. Ich möchte keine schlechte Stimmung verbreiten, will nicht, dass Hillary es bereut, mich geholt zu haben. Egal, wessen Idee das Ganze letztlich war.
»Oh, lass mal überlegen. Die acht Stuten, die bereits ihre Fohlen bei Fuß haben … die Nachzucht, eine Herde aus zehn Jungtieren und Tiny, die bald ihr Fohlen bekommt, und drei Hengste. Die stehen gerade etwas weiter entfernt auf der Sommerweide und die Stuten mit den Kleinen in der Halle am Haus.«
»Ach, stimmt ja. Du hattest ja extra angebaut.«
Das eigentliche Cottage ist nämlich gar nicht mal groß. Es besteht aus einem ziemlich winzigen Haupthaus aus grauem Stein und einem Nebengebäude mit zwei kleinen Boxen und dem Hühnerstall.
»Ich hab die Halle an die hintere Weide bauen lassen. In ihr stehen die Stuten und die Jährlinge wie in einem Offenstall und ich kann von vorne mit dem kleinen Traktor hinein, ausmisten und Ballen umherfahren. Das macht die Arbeit um einiges leichter.«
»Das glaub ich sofort.« Als ich acht war, mussten wir ständig Ställe ausmisten. So war die Hälfte des Tages gefüllt und raubte manchmal den ganzen Spaß an der Ponyhaltung.
»Und dann wäre da noch Pitty, ein etwas älterer Wallach«, fügt Hillary an und seufzt. »Ich habe ihn von einem Nachbarn übernommen, vor einigen Jahren, da er nach dem Verlust seiner Frau wegzog und Pitty nicht mitnehmen wollte.«
»Das war lieb von dir. Für die Zucht kannst du ihn ja nicht gebrauchen.«
Wiesen erstrecken sich auf beiden Seiten des Weges. Sie sind überwiegend mit Schafzäunen eingegrenzt, und während wir eine kleine Anhöhe erreichen, erscheint auch schon das Cottage.
»Oh und ob man mit Pitty was anfangen kann. Ich muss gestehen, der Kleine ist ein wahres Wunder. Er wurde von Kindern geritten, legt sich auf Kommando hin und geht einwandfrei vor der Kutsche.«
»Ach so?« Ich schaue zu Hillary, die sich auf die Lippe beißt, als sie durch ein Schlagloch hüpft.
»Und er ist ein wahrer Entfesselungskünstler. Ich wollte ihn in Houdini umbenennen, allerdings hört er eben nur auf seinen Namen Pitty.«
»Da bin ich ja mal gespannt«, entgegne ich.
Plötzlich reißen die Wolken wieder auf, der Regen ebbt ab und schon kann ich die erste kleine Herde erkennen. Sie stehen dicht an dicht in der Nähe der Bäume. Die verschieden farbigen Hinterteile in Regenrichtung.
»Kannst du sein, du wirst ihn bestimmt mögen. Ich hatte selten ein so freundliches Pony«, sagt sie und fügt theatralisch an: »Ich wünschte nur, er hätte nicht so viel Unsinn in seinem dicken Kopf.«
Unsinn. Das Wort hallt in mir wider. Es ist verwandt mit Leichtsinn. Und als leichtsinnig hatte man uns Mädchen betitelt, nachdem der Unfall passiert war.
Vielleicht hättet ihr kein Wettrennen im offenen Gelände machen sollen, hatte man gesagt. Womöglich hättet ihr euch dabei nicht noch filmen sollen, dann wärt ihr konzentrierter gewesen.
Hätte, hätte, Fahrradkette, hatte Mama die anderen irgendwann angeschnauzt. Das hilft nun wirklich niemanden mehr, diese Vorhaltungen.
Der Jeep wird langsamer, Hillary parkt vor dem Nebengebäude mit seinem Lavendelbeet und dem blauen Rolltor. Mit Schmackes zieht sie die Handbremse an.
»Da wären wir, my Dear«, sagt sie feierlich und steigt aus.
Sie ist verflixt schnell bei mir und will mir hinaushelfen, doch ich schlage ihre stützende Hand aus. Ich muss auch alleine klarkommen, denn es wird nicht immer jemand da sein, der das tun will.
»Ich schaff das alleine«, sage ich etwas zu scharf und schäme mich augenblicklich, als sie sich wortlos dem Koffer widmet.
»Du bekommst das Zimmer im Dachgeschoss«, verrät sie mir, als wir eintreten. Ich schaue mich um, mein Blick huscht durch den Flur, der sofort ins gemütliche Wohnzimmer mit seinem Kamin übergeht. Die offene Küche mit ihren an den Wänden hängenden Tellern ist gleich dahinter.
»Hier sieht es ja immer noch aus, als wäre die Zeit vor einhundert Jahren stehen geblieben«, sage ich und nehme Hillary den Koffer ab.
»Ich mag es so. Wie zu Großvaters Zeiten.«
Ich zerre den Koffer hinter mir her, zur schiefen Treppe, die unter das Dach führt. Das Haus ist nicht sonderlich hoch, dafür aber nicht wirklich gerade. Möglicherweise ist das dem schottischen Wind geschuldet, der ständig ums Gemäuer pfeift und es nach seinen Vorstellungen biegt.
Ich setze den Fuß auf die erste Stufe, sie knarzt unter meinem Gewicht, und als ich den Koffer anhebe, passiert es: Mein kaputtes Knie gibt nach und ich krache beinahe hin. Autsch! Gerade noch so greift Hillary mir unter den Arm.
»Scheiße!«, stoße ich aus und starre im nächsten Moment in zwei glimmende Augen, die mich fixieren. Etwas hockt im Halbdunkel des Obergeschosses auf der letzten Stufe.
»Oh, das ist Dobby, mein Hauself«, klärt meine Tante mich auf. Ich komme wieder auf die Beine. Dieser Dobby, ein graues Ungetüm aus Fell mit Krallen, peitscht mit dem Schwanz.
»Der unterstützt dich im Haushalt?« Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei Harry Potter sah Dobby sehr viel freundlicher aus.
»Nicht unbedingt«, meint Hillary.
»Und in welcher Funktion ist der dann hier?«
»Mäusefänger, schätze ich.« Hillary wedelt mit der Hand in seine Richtung.
»Hat er was?«, frage ich besorgt.
»Schlechte Laune, er hat immer schlechte Laune, dieser Kater. Aber er tut nichts. Solange man ihn nicht auf den Arm nimmt«, meint meine Tante und Dobby denkt gar nicht daran, den Weg frei zu machen. Er glotzt mich weiter aus gelben Augen an, als warte er nur darauf, dass ich mich in Reichweite seiner Krallen befinde.
»Bist du sicher, dass er nichts tut? Eine Narbe im Gesicht reicht mir.« Und sie ist immerhin fünf Zentimeter lang und verläuft mir quer über die Stirn. Ganz zu schweigen vom Riss in meiner Lippe, den man auch noch sehr gut erkennen kann.
Hillary wirft eine herumliegende Socke nach dem Viech und es trollt sich. Das kann ja heiter werden.
Erinnerungen sind das halbe Leben
Das kleine Zimmer mit seinen Vorhängen aus Spitze sieht einladend und warm aus. Ich kann mich noch gut an das alte Holzbett mit seinen Löchern erinnern, in dem ich mit Mama zusammen geschlafen hatte, als wir das letzte Mal hier waren. Sacht schiebe ich den Koffer in die Nische vor dem Schrank und gehe zum Fenster, um hinauszuschauen.
»Am besten, ich lasse dich erst mal auspacken, okay?«, fragt Hillary und wippt im Türrahmen stehend auf den Zehen. Dobby guckt durch ihre Beine und faucht.
»Ich räume meine Klamotten in den Schrank und komme dann zu dir runter«, antworte ich und ziehe die Gardine weiter auf. Von hier aus kann ich bis zum Hügel gucken, an dem Hillarys Grundstück beginnt. Die Wiesen und Weiden sind von alten, für das Land typischen Steinmauern unterbrochen, beim angrenzenden Nachbarn grasen Schafe und wenn ich an der alten Eiche vorbeischaue, sehe ich die Stutenherde.
»Lass dir alle Zeit der Welt. Ich bin unten und koche uns was Hübsches.« Hillary zwinkert mir zu und geht dann zurück zur Treppe. Leider folgt ihr Dobby, der Hauself, nicht, sondern setzt sich nun in den Türrahmen und beobachtet mich.
»Wenn Blicke töten könnten, was?«, sage ich zu dem Viech und es blinzelt.
»So wie es aussieht, bin ich nicht ganz so leicht totzukriegen«, verrate ich der Katze und öffne den Schrank. Er ist beinahe leer, nur die unteren Fächer sind mit Blümchenbettwäsche gefüllt, mit der auch das Bett bereits bezogen ist.
»Du kannst also aufhören, mich so fies anzugucken.« Dobby denkt nicht dran.
Und ich wage es nicht, ihm den Rücken zuzukehren. Also ziehe ich den Koffer aus der Ecke und wuchte ihn zwischen mich und die Katze.
»Verdammt«, murre ich, als ich sehe, was Mama mir alles einpackt hat. Kleider und Röcke mit Leggings und Pullovern. Ich hätte sie das letzte Mal, als wir einkaufen waren, nicht anmeckern sollen, dass der Stoff von Jeans mir am Knie wehtut. Jetzt hab ich den Salat. Ich hänge das erste Kleid aus Wolle auf einen Bügel, dann ein anderes aus Seide. Beim nächsten Herzschlag bleibt mir die Luft weg. Meine Finger berühren den ledrigen Stoff meiner Reithose und ich zucke zurück, als hätte ich mich verbrannt.
Wie kommt sie darauf, dass ich sie je wieder brauche? Ich habe ihr klar und deutlich gesagt, dass ich niemals mehr auf ein Pferd steigen werde. Niemals!
Ich lasse mich auf den Hintern sinken, zwischen Bett und Koffer. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Dobby sich näher gewagt, sitzt nun nicht mehr direkt im Türrahmen, sondern etwa einen halben Meter davor.
»Verpiss dich einfach«, knurre ich. Dobby miaut.
»Ich bin nicht freiwillig hier, beschwer dich gefälligst woanders.«
Dobbys Augen werden groß, sein Fell sträubt sich. Es sieht etwas pikiert aus, wie er mich anguckt, sich erhebt und dann eilig verschwindet.
Ich bin allein. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird, alles in den Schrank zu räumen. Das Allerletzte, das ich aus dem Koffer fische, ist Hasi. Ein Stofftier, das ich seit Kindertagen habe und das ich immer noch mit ins Bett nehme. Hasi war der Einzige, den ich im Krankenhaus in meiner Nähe ertrug. Mit einem gezielten Wurf landet er auf dem Kopfkissen, bevor ich mich aufraffe und nach unten gehe.
Unten angekommen erwartet mich ein Teller Rührei und Kakao vom Feinsten. Mit Sahne und Streuseln.
»Du musst hungrig sein«, vermutet Hillary und rückt mir einen Stuhl mit Schafspelz zurecht.
»Ein bisschen.«
»Ich könnte ein ganzes Pony verspeisen«, scherzt Hillary und zupft an meinem Flechtzopf, während ich mich setze.
»Ich fürchte, von deinen Ponys wird niemand satt«, gehe ich auf sie ein und mir steigt ein vertrauter Geruch in die Nase. Ich wette, Tante Hillary haut immer noch Tabasco ins Ei. Noch zu gut kann ich mich an einen Tag im Winter erinnern, als Effi zu Besuch kam und nicht auf die Schärfe im Essen vorbereitet war. Sie lief puterrot an und trank den Kakao in einem Zug. Dabei verschluckte sie sich allerdings so sehr, dass ein Teil davon aus ihrer Nase lief. So unangenehm wie lustig.
Sofort sind auch andere Erinnerungen da: die Wasserschlacht am Strand. Effi hatte Wasserbomben gemacht und mir die erste in die Hand gedrückt, um ihren großen Bruder Finley damit abzuwerfen. Es war recht kühl, ein rauer Ostwind pfiff uns um die Ohren und wir wollten den tosenden Wellen dabei zusehen, wie sie auf den Strand rollten.
»Hey, Enola, wag es nicht!«, rief mir Finley, der gemütlich ein Buch las, schon von Weitem zu. Natürlich schüchterte er mich sofort ein und ich blieb stehen. Effi hingegen überlegte nicht lange. Sie warf gleich zwei in seine Richtung. Und kurz darauf befand ich mich eher als Unbeteiligte inmitten eines Krieges, aus dem wir alle patschnass hervorgingen.
»Iss etwas, Liebes«, holt mich Hillary aus den Gedanken zurück.
Nachdenklich stochere ich im Rührei und beobachte Dobby, wie er auf den Stuhl neben Hillary springt und auf ihren Teller schaut.
»Soll ich Effi zu morgen mal einladen?«, fragt meine Tante und rettet ihr Essen vor dem frechen Kater, der schon seine Tatze danach ausgestreckt hatte.
»Nein, nein. Ich schaue selbst bei ihr vorbei, wenn mir danach ist«, beeile ich mich zu sagen und in meinem Magen summt es unangenehm. Ein bisschen fühlt es sich an wie Schmetterlinge. Die hatte ich, als ich in Fiete verknallt war und er mir meinen ersten Kuss gab. Doch diese hier sind böse. Fiese kleine Schmetterlinge, die immer mal wieder aufschwirren, mich an meine Traurigkeit erinnern und in meine Magenwände stechen.
»Sie wird sich ganz bestimmt sehr freuen, ganz sicher«, meint meine Tante und klopft auf Dobbys Tatze, weil er immer noch bettelt. Für einen Moment sieht er wirklich niedlich dabei aus, wie er sie anstupst und anblinzelt.
»Wie bist du denn zu diesem Goldschatz gekommen?«, interessiere ich mich für den neuen Mitbewohner, der nun wieder mich anstarrt, als würde er mir gerne die Tür zeigen und mich rausjagen.
»Ach, das war eine lustige Geschichte«, beginnt meine Tante. »Erinnerst du dich noch an Siobhan, die Fischerin?«
Ich nicke und probiere das Rührei. Es ist schärfer, als ich dachte.
»Sie ist ins Krankenhaus gekommen …«
»Lustige Geschichte«, murmle ich und öffne meinen Zopf, fahre mit den Fingern durch das Flechtwerk, um es zu entwirren. Als könne ich damit auch meine Gefühle entzerren.
»Komm schon, ich bin noch nicht fertig. Sie hatte etwa zwanzig von denen.« Hillary nickt zu Dobby. »Und sie mussten versorgt werden. Das halbe Dorf hat gerade eine Katze zu betreuen und …«
»Lass mich raten: Diesen Kater wollte niemand?«, vermute ich. Jetzt ist Dobby richtig pikiert, seine Augen sind riesig und er hat einen empörten Ausdruck im Katzengesicht.
Hillary lacht und tätschelt seinen dicken Kopf.
»So in etwa, er ist ein bisschen schwierig«, gibt sie liebevoll zu und greift zur Milchkanne, was Dobby klagende Laute entlockt. Schließlich bekommt er einen kleinen Teller vor die Nase. Ganz langsam wandern meine Gedanken zu Hope. Ich sehe meine schöne schwarze Stute, wie sie nach einer Möhre in meiner Hand angelt in ihrer unverwechselbaren Art, mit schief gelegtem Kopf und die Oberlippe ganz weit nach vorne geschoben. Wie aus einem antrainierten Reflex schüttle ich kaum merklich den Kopf, vertreibe die Bilder aus meinem Hirn.
»Die meisten der Katzennehmer haben Kinder und die mag Dobby leider gar nicht«, erzählt sie und der Kater schleckt genüsslich seine Milch.
»Aber er fängt hervorragend Mäuse, was für meinen Stall wirklich ein Segen ist. Und er hat einen gewissen Unterhaltungswert«, findet Hillary.
Ich runzle die Stirn. Ich fand Horrorfilme nie besonders unterhaltsam, und dieser Kater könnte einem entsprungen sein.
»Deine alte Katze gefiel mir trotzdem besser«, kann ich mir nicht verkneifen, als ich an die schwarz-weiße Lieselotte denke. Sie konnte Schnurren wie eine Weltmeisterin und war total verschmust. Selbst nachdem ich sie mit in die Badewanne genommen hatte, was sie zugegeben nicht so prickelnd fand, war sie immer noch nett und schlief am Fußende des Bettes.
Nachdem ich aufgegessen, meinen Teller in die Spüle gestellt und den Tisch abgewischt habe, schlüpfe ich in karierte Gummistiefel. Meine Tante hat fast nur karierte Sachen, ganz schottisch, wie sie findet. Sie kann sogar Dudelsack spielen und hat schon mal versucht, es mir beizubringen. Leider bin ich total talentfrei, was Musikinstrumente angeht.
Während Hillary bereits in voller Stallmontur neben mir steht und am Hintereingang des kleinen Hauses auf mich wartet, klaut dieser blöde Dobby mein Haargummi, das ich auf die Ablage gelegt hatte. Das werde ich bestimmt eine Weile nicht wiederbekommen, so wie er guckt. Und ob ich es überhaupt will, so wie er darauf herumbeißt und es vollsabbert, ist eine andere Frage.
»Schenk ich dir«, sage ich zu dem Vieh, in der Hoffnung, dass er nun frei ist. Wie bei Harry Potter eben, wenn man einem Hauself Kleidung schenkt.
»Und bemüh dich nicht, du schuldest mir nichts«, beeile ich mich klarzustellen. Nicht dass er auf die Idee kommt, mir dienen zu wollen.
Als wir aus dem Haus treten, bricht die Sonne durch die grauen Wolken und zaubert in der Ferne einen Regenbogen, der sich von der Küste bis zum Hügel erstreckt.
»Schau mal, wie wundervoll«, freut sich meine Tante. »Das macht Hoffnung auf schönes Wetter.«
Hoffnung. Hope.
Die Stille in mir wird ohrenbetäubend, als ich einmal mehr versuche, nicht an mein Pferd zu denken. Nicht an ihre Schönheit, nicht an die Verbundenheit mit ihr. Nicht an all die Momente, in denen ich dem Himmel so nahe war – mit ihr an meiner Seite. Ich möchte mir die Ohren zuhalten, treibe meine Schritte voran, folge Hillary und verstehe kein Wort, von dem, was sie erzählt. Wasser spritzt, als ich durch eine Pfütze laufe, die Blätter des krummen Baums auf dem Hof flüstern. Der Wind treibt trockenes Laub vor sich her und wir erreichen die neue Halle, das Domizil der Herde.
Sie ist geräumig und hell, links stehen Heulageballen und gepresste Späne. Auf der anderen Seite parkt ihr kleiner Traktor. Hillary steuert den hinteren Bereich des Offenstalls an und die ersten Ponys heben ihre Köpfe und wiehern zur Begrüßung. Es ist wirklich schön, dass alles dem Bedarf der Tiere angepasst ist und sie selbst entscheiden können, ob sie drinnen oder draußen sein wollen.