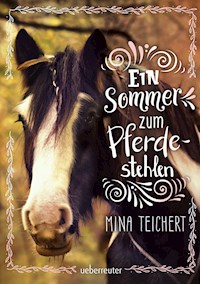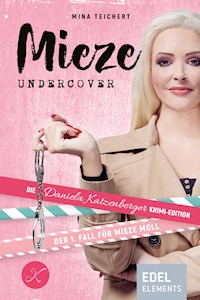13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Tollpatschig, verträumt, chaotisch – so wird Mina als Kind von ihrer Umwelt wahrgenommen. Doch je älter sie wird, desto mehr überfordert sie ihr Alltag durch die allgegenwärtige Reizüberflutung. Schließlich bekommt sie die Diagnose, die ihre Zukunft verändert: Mina hat ADS – und mit einem Mal kann ihr geholfen werden. Feinfühlig, authentisch und mit bewundernswertem Witz berichtet Mina Teichert von kleinen Krisen, Missgeschicken und Einschränkungen, mit denen sie leben muss, aber auch von ihrer bunten, verrückten Sicht auf die Welt. Mina Teichert gibt einen Einblick in die Krankheitsbilder ADS und ADHS, erklärt, warum eine solche Diagnose gerade bei Mädchen häufig sehr spät gestellt wird welche Therapieformen es gibt und wie man mit ADS im Erwachsenenalter umgehen kann. Ihr Buch beantwortet nicht nur viele Fragen rund um eine der häufigsten Volkskrankheiten unserer Zeit, sondern zeigt vor allem, dass auch mit ADS und ADHS ein erfülltes Leben möglich ist. Eine unverzichtbare Hilfestellung für Eltern, deren Kinder betroffen sind!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
MINA TEICHERT
Neben der Spur, aber auf dem Weg
Warum ADS und ADHS nicht das Ende der Welt sind
VORBEMERKUNG
Dieses Buch ist eine Anlehnung an mein Leben mit ADS. Nicht zu verwechseln mit einer Autobiografie, die eine oft chronologische Beschreibung der eigenen Lebensgeschichte darstellt, in der die absolute Authentizität zählt.
Hier sind neunzig Prozent Mina drin, und die restlichen zehn Prozent wurden des Unterhaltungsfaktors zuliebe angepasst und fiktiv gestaltet.
Außerdem ist mein Gedächtnis keine verlässliche Quelle.
Bitte fragt euren Arzt und Apotheker nach möglichen Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten. Und lest aufmerksam den Klappentext.
Dann bleibt nur noch zu sagen: Hals- und Beinbruch und viel Vergnügen neben der Spur. Denn dort kann es auch ganz hübsch sein!
Prolog
Mit angespannten Gliedern saß ich im Sprechzimmer meines Hausarztes Dr. Wendt und wartete. In Gedanken ging ich wieder und wieder die letzten Stunden durch und grübelte. Was war passiert?
Ich war einkaufen gewesen: rein in den Laden, leicht angespannt. Raus aus dem Laden, vollkommen aufgelöst. Wie konnte es sein, dass mich etwas so Simples wie die Nahrungsmittelbeschaffung in solch eine Lage gebracht hatte? Schwitzen, erhöhter Puls und Gereiztheit waren ja eine Sache. Aber das, was mir eben geschehen war, eine ganz andere.
Mein Mund wurde trocken, und ich schluckte gegen Tränen der Scham an. Ich hatte mich tatsächlich vollgepinkelt, vollgepisst. Wie bei einem Kleinkind oder Mamas Pudel, wenn er sich freut, war es nass und warm an meinen Beinen heruntergelaufen. Himmelherrgottnocheins!
Der Auslöser? Der genervte Blick einer hageren Kassiererin an der Kasse, nachdem ich ihr aus Versehen meine Krankenkassenkarte und anschließend den Personalausweis anstelle der EC-Karte gegeben hatte. Oder redete ich mir das nur ein, und es gab eigentlich gar keinen Auslöser? Hatte ich vielleicht einfach nur vergessen, wie man es rechtzeitig auf die Toilette schafft?
Endlich schwang die Tür in meinem Rücken auf, und der Arzt, den ich seit einigen Jahren wegen andauernder Kopfimplosionen konsultierte, betrat den Behandlungsraum. Er sah besorgt aus oder eher angespannt, und ich spürte sofort, wie meine Hände wieder feucht wurden. Mist.
»So, Wilhelmina. Ich hatte mir ja bereits Ihre Akte von meinem Vorgänger, Ihrem Kinderarzt Dr. Eckhard, zukommen lassen«, sagte er zur Begrüßung und schob seine Brille höher auf die Nasenwurzel. Einen Moment lang wirkte er so unschlüssig, wie ich mich fühlte.
Ich konnte mich nämlich gerade nicht entscheiden, ob ich wütend oder verängstigt war oder einfach Schmerzen hatte. Es kam oft vor, dass ich meine hübschen Missempfindungen nicht auseinanderhalten konnte, denn Schmerzen hatte ich mittlerweile oft. Etwa 24 Stunden am Tag.
»Ja und?«, fragte ich also den Arzt und ergriff seine Hand, die er mir entgegenhielt, ohne mich wirklich anzusehen. »Bin ich jetzt neuerdings inkontinent? Mit 24?«
Er setzte sich mir gegenüber, breitete Papiere auf dem wuchtigen Tisch zwischen uns aus und faltete anschließend seine Hände wie zum Gebet. »Nein«, sagte er gedehnt. Seine dunkelblonden Haare fielen ihm leicht in die Stirn, während er mich eindringlich musterte, und ich wurde rot. Ich hasste es, wenn man mich so anschaute. »Mit Ihrer Blase ist alles in Ordnung, da bin ich mir sicher«, unterstrich er.
Na toll.
»Und was ist mir dann gerade eben passiert?«, wollte ich eine Erklärung für das Unfassbare haben.
»Das Problem ist nicht physischer Natur«, antwortete er und begann, mich mit seiner Ruhe wahnsinnig zu machen. Verdammt, konnte er nicht einfach ausspucken, was er dachte? Hinter dem Arzt prasselte Regen an die Fensterscheibe. Die ersten Tropfen malten ein eigenwilliges Muster auf das vom Pollenflug verschmutzte Glas, und ich musste gegen den Drang ankämpfen, aufzustehen und es mit dem Finger nachzuzeichnen.
»Das sagten Sie auch zu meinen Kopfschmerzen«, antwortete ich irgendwann mit piepsiger Stimme.
»Ja eben.«
Mein rechtes Bein, das ich über das andere geschlagen hatte, begann zu zappeln.
»Ich habe Ihre Unterlagen lange studiert. Ihre Kopfschmerzen sind Spannungskopfschmerzen …«, begann er, und ich unterbrach ihn hitzig.
»Das sagten Sie ja bereits mehrmals bei den letzten Terminen. Und dass ich keinen Gehirntumor habe, auch.« Das glaubte ich ihm allerdings immer noch nicht. Man kann unmöglich so oft solche Kopfschmerzen haben, ohne dass die Ursache im eigenen Schädel liegt.
»Und Ihre anderen Symptome deuten alle auf dasselbe hin«, sprach Dr. Wendt ungerührt weiter.
»Ich bin nicht bescheuert«, warnte ich meinen Arzt und hob vorsichtshalber mahnend den Zeigefinger.
»Um Gottes willen, nein«, beeilte er sich.
»Ich simuliere auch nicht, und ich habe keine Borderline-Störung. Das habe ich Ihnen bereits erklärt. Das war eine Fehldiagnose des Jugendpsychiaters damals.« Die unschöne Erinnerung aus meiner Teenagerzeit drängte sich hervor. »Und wenn Sie mir nicht glauben, dann sind Sie wirklich der schlechteste Arzt der Welt.«
Jetzt lehnte Dr. Wendt sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Seine Augenbrauen hoben sich leicht, was ihm etwas Linkisches verlieh. »Ich kenne Ihre kleinen Ausbrüche ja langsam, aber wäre es möglich, das Ganze ohne Anfeindungen zu besprechen?«, fragte er nett.
»Natürlich.«
»Super.«
»Also, warum ist mir dieser Scheiß passiert?«
»Weil Sie eine Panikattacke hatten, Wilhelmina«, diagnostizierte er.
Mein Mund verzog sich zu einem Strich.
»Deshalb auch der Schwindel und das Herzrasen.« Er machte eine Pause. Wartete auf meinen Protest. Doch mein Kopf war plötzlich mit Zuckerwatte gefüllt. Dicker klebriger Zuckerwatte, an der alle Gedanken hoffnungslos haften blieben, bevor sie mein Bewusstsein erreichen konnten.
»Aber der Ursprung Ihrer ganzen Probleme liegt woanders«, fuhr er fort.
»Aha. Doch ein Tumor«, schlug ich träge vor. Deshalb konnte ich also so oft nicht denken. Das musste es sein. Ich fühlte mich nämlich regelmäßig dumm wie ein Toastbrot.
»Erinnern Sie sich noch an den Test, den Sie für mich ausgefüllt haben?«, fragte Dr. Wendt nach, und für einen Moment konnte ich ihm wirklich nicht mehr folgen.
»Hähm«, kam es aus mir heraus.
»Es war ein Test zur Indikation von ADS. Sie wissen doch, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.« Oh, ja, da klingelte was. Mein Bruder leidet seit frühester Kindheit unter ADHS. »Der Test ist durch und durch positiv«, meinte Dr. Wendt ernst und beugte sich etwas weiter nach vorn.
»Positiv? Positiv für mich, also habe ich kein AD-Dings, oder was?« Ich sah ihn fragend an.
»Leider doch. Meiner Meinung nach leiden Sie seit Ihrer Kindheit an einer ausgeprägten Reizfilterschwäche, deshalb auch die Probleme während Ihrer Ausbildungszeit. Daraus haben sich Begleiterkrankungen entwickelt. Ihr Untergewicht, die Essstörungen, die Spannungsschmerzen und jetzt eine Angsterkrankung. Sie brauchen dringend psychologischen Beistand und eine Verhaltenstherapie.«
»Bullshit!?«, stieß ich aus und bemühte mich, die Panik aus meiner Stimme herauszufiltern. Ich hatte keine besonders gute Erinnerung an den psychologischen Beistand in meiner Jugend, der mir ungeniert eine Meise attestiert hatte.
Dr. Wendt hingegen sah zufrieden aus. »Wie kann ich es am besten erklären, Wilhelmina? Sie leben ja schon manchmal in Ihrer eigenen Welt und …«
Ich protestierte. »Das macht aber nichts, man kennt mich da.«
Er lächelte milde. »Medikamente könnten helfen. Es gibt viele positive Beispiele, in denen Menschen wie Sie endlich den Nebel um sich herum lüften und ihre Fähigkeiten neu entfalten konnten. Dadurch ist ein ganz normales Leben möglich.«
»Normal ist relativ«, antwortete ich vorsichtig und suchte in meinem jetzt übervollen Kopf nach einem brauchbaren Gedanken.
»ADS ist keine Krankheit im eigentlichen Sinne, Wilhelmina. Es ist eher ein Gendefekt.«
»Das wird ja immer schöner.«
In Dr. Wendts Mundwinkel zuckte es, und ich versuchte, mein Gehirn davon abzuhalten, sich endgültig abzuschalten. »Mein kleiner Bruder hatte ADHS …«, stammelte ich, und der Arzt fiel mir ins Wort.
»Sehen Sie, es vererbt sich in vielen Fällen. Womöglich sind Ihre Eltern ebenfalls betroffen.«
»Nee, wohl kaum. Aus denen ist was geworden.« Mein Vater ist Kriminalbeamter und meine Mutter Erzieherin. Keine Blitzbirnenkarrieren, aber immerhin.
»Aus Ihnen wird auch etwas werden«, versuchte es der Arzt und tätschelte über seine Unterlagen hinweg meine Hand, mit der ich mich krampfhaft an der Tischplatte festhielt. »Wenn Sie sich helfen lassen, versteht sich.«
Hieß das im Klartext, dass ich mir, wenn ich mir nicht helfen ließ, den Strick nehmen konnte, wie ich es schon so oft geplant hatte?
Ich verengte die Augen. »Mein Bruder hatte als Kind eine Duracell im Arsch. Wenn man ihm eine Tüte Gummibärchen gab, schwirrte der wie ein Zisselmännchen eine Stunde lang im Kreis umher, ohne auch nur eine Sekunde innezuhalten. So bin ich nicht.«
»Ich weiß, dass Sie anders sind. Bei Ihnen fehlt die Hyperaktivität. Aus dem Grund hat es wahrscheinlich keiner festgestellt. In den Achtzigerjahren standen die Behandlung und die Früherkennung noch ganz am Anfang. Und Kinder, bei denen die Auffälligkeit durch die Hyperaktivität fehlt, rutschen leicht durch das Raster. Aber die Reizüberflutung, der Sie ausgeliefert sind, ist die gleiche. Und das, gepaart mit dem Unverständnis der Umwelt, hat Sie krank gemacht.« In seinem Gesicht stand ein seltsames »Hurra« geschrieben.
Ich sagte: »Mmpf.«
»Sie sind eher das Gegenteil von einem Zappelphilipp. Sie sind ruhig und verträumt. Ein Hans Guck-in-die-Luft. Wenn ich die ganzen kleinen Unfälle Revue passieren lasse, bei denen Sie sich eine Gehirnerschütterung nach der anderen zugezogen haben … Erst die Sache mit dem Fahrrad, das Sie übersehen haben. Dann der Auffahrunfall. Und der Treppensturz. Und das ist bei Weitem nicht alles. Menschen mit ADS haben ein erhöhtes Unfallrisiko, müssen Sie wissen.«
Das hörte sich ganz an nach: »Herzlichen Glückwunsch. Der Kandidat hat hundert Punkte.«
»Super«, hauchte ich. »Und jetzt?«
»Jetzt gehen wir es an und räumen auf«, erklärte er fröhlich.
Na fein, dachte ich und sagte nichts mehr.
Teil 1
IM HIER UND JETZT MIT ADS
Wie diese Diagnose mir vermutlich das Leben rettete? Ich schätze, es war das Wissen, dass ich nicht einfach tiefbegabt bin. Also doof. Mittlerweile sind mehr als zehn Jahre vergangen, und ich habe nicht den Arzt gewechselt. Zuerst dachte ich, ich würde es tun. Und ganz ehrlich? Ich hätte Dr. Wendt am liebsten zur Hauptverkehrszeit mit Malkreide auf die A1 gesetzt.
Nach einer kurzen Wutphase ließ ich mich dann aber doch auf ihn ein und muss im Nachhinein sagen: Ich hatte Glück. Denn er kniete sich richtig rein in meinen Fall und gab mir vor jedem Schritt, den ich ab diesem Zeitpunkt zu gehen hatte, einen beherzten Schubs. Und nachdem ich endlich wusste, was mit mir nicht stimmte, konnten wir mit dem Aufräumen beginnen und mein Leben in eine halbwegs normale Bahn lenken. Ich hatte Hilfe. Seltsamerweise nicht unbedingt immer aus den eigenen Reihen, wie Familie und Freunde, denn da gab es seit Anbeginn meiner Zeit immer wieder Menschen, die mit meinen Macken nichts anfangen konnten und auch kein Verständnis dafür hatten – traurig, aber wahr. Gleichzeitig jedoch irgendwie auch saukomisch, wenn man bedenkt, dass die Evolution dem Menschen als Basisausstattung einen Blinddarm mitgibt und dann an solchen wichtigen Features wie Empathie spart.
Neben einer wundervollen Therapeutin, die mir das Fliegen auf einem Hexenbesen beibrachte (dazu später mehr, yeah!), gab es Leute mit den gleichen Problemen wie meinen eigenen, die mir einen neuen Blick auf mich selbst ermöglichten.
Heute bin ich glücklich verheiratet – na gut, das zweite Mal, aber damit stehe ich nun wirklich nicht allein da – und habe eine tolle, zuckersüße Teenager-Tochter, die ich recht gut groß bekommen habe. Trotz (oder gerade mithilfe) kreativer Problemlösungen und Tagesplanungen. Aber auch dazu kommen wir später. Denn wir beginnen im »Hier und Jetzt«.
Mittlerweile lebe ich als Frau eines Landwirtes und Autorin ein Leben inmitten der Natur. Idyllisch und fast ein wenig abgelegen. Wir haben viele glückliche Milchkühe, zwei Ponys namens Amy und Lotta, fröhliche Hühner und einen frei laufenden Schwiegervater, der meinen Mann regelmäßig aus der Reserve lockt. Es muss ja Herausforderungen im Leben geben. Klingt alles völlig normal? Na dann passt auf, wie mein Alltag aussieht!
Willkommen in meinem Leben!
Reizfilterschwäche
Reizfilterschwäche ist ein Wort, das allein beim Aussprechen Kopfschmerzen verursacht, womit es hervorragend das veranschaulicht, was es bedeutet. Nämlich, dass alles, was um mich herum geschieht – lärmt, klingt, riecht oder auch nur aussieht –, meine Aufmerksamkeit erregt und von mir beachtet werden will. Alltag mit Reizfilterschwäche fühlt sich also so ähnlich an, als wenn man am Morgen von Heiligabend in die Stadt rennt, um schnell noch Geschenke einzukaufen. Und das an sieben Tagen pro Woche, zwölf Monate im Jahr. Glaubt mir, da hat man ständig dringend Urlaub nötig.
Sofern man ihn denn genießen kann.
Ich bin noch dabei, es mir anzuerziehen. Denn in ungewohnter Umgebung stoße ich grundsätzlich an meine vom ADS gesteckten Grenzen. Und an die Grenzen der Geduld meines lieben Mannes, der zu solchen Gelegenheiten dauerhaft damit beschäftigt ist, kleine und mittlere Katastrophen von mir abzuwenden. Tja, was soll ich sagen? Er wusste, worauf er sich einließ, als er mich heiratete. Und ich liebe ihn dafür, dass er mich so nimmt, wie ich bin.
Ein Beispiel gefällig? Na dann, auf geht’s:
Ich mache einen Ausfallschritt und hake mich bei meinem Schatz ein. Mein Magen fühlt sich noch ein wenig flau an, nach den vielen engen Kurven, die wir fahren mussten, um Funchal zu erreichen. Urlaub auf der Blumeninsel Madeira, das war schon immer mein Traum, und endlich bin ich hier. Ab jetzt heißt es: Vorsicht, Portugal, hier kommt Wilhelmina!
»Alles klar?«, fragt mich Jonas und schmunzelt über meine Aufregung, die ich nur mühsam verbergen kann. Eigentlich meide ich Städte und große Menschenansammlungen. Doch wie heißt es so schön: Solange man nicht tot ist, darf man sich dem Leben nicht entziehen. Oder so ähnlich.
»Natürlich«, antworte ich also cool und blinzle gegen die Sonne an, die mir die Sicht verblendet, als wir aus der Tiefgarage ins Freie treten. Jonas bleibt stehen und versucht, sich zu orientieren. Mein Blick saugt sich derweil an dem gegenüberliegenden Hauseingang fest, der mit Meeresmotiven bemalt ist. Türkis trifft Gold. Meerjungfrauen wiegen sich im Wasser. Ein Gedanke stößt den anderen an. Erinnerungen werden wach und rufen allesamt durcheinander. Verrückt nach Aufmerksamkeit.
»Moment. Wo willst du hin?«, fragt Jonas plötzlich und hält mich am Arm zurück, als ich schon im Begriff bin, einfach loszuwatscheln. Ich schaue irritiert zu ihm auf und wieder nach vorn.
»Mina?«, fragt Jonas ernst. »Du guckst schon, wo du hinläufst, oder?« Er hebt eine Augenbraue.
»Natürlich«, antworte ich leichthin und schiebe mich in seinen Arm. Seine Hände streichen über meinen Rücken, und ich hauche ihm einen Kuss auf die Wange. Erst jetzt erkenne ich die Absperrung, die mich von dem hübschen Meerjungfrauenbild trennt. Hätte bestimmt komisch ausgesehen, wenn ich sie umgerannt hätte und, verheddert in gelb-schwarze Bänder, zu Boden gegangen wäre.
»Komm, wir gehen vom Zentrum aus in die Altstadt«, schlägt Jonas vor und reißt mich aus meinen Gedanken. Ein albernes Glucksen steckt in meiner Kehle, und ich löse mich aus der Umarmung, die mir so viel Sicherheit gibt. Jonas ist mein Puffer zwischen mir und der Welt – kein Wunder, dass ich ihn gern als Schutzschild missbrauche.
»Hey, Minchen? Bereit?«, fragt mein Puffer noch einmal und küsst meine Nasenspitze. Ich lege meinen Arm um seine Hüfte und schmiege mich einen Moment an ihn.
»Bereit, wenn du es bist«, antworte ich und spähe in Richtung Stadtkern. Wie Ameisen tummeln sich die Leute dort und huschen emsig umher. Der Wind weht ein Raunen und Brummen zu uns herüber, und ich denke an die Ruhe, die wir heute Morgen am Meer genossen haben. Bis auf das kräftige Schlagen der Wellen, die gegen den rauen Fels der Küste rollten, war dort nichts zu hören. Nur Gedanken, die mit dem Wind um die Wette flüsterten. Hier würde es anders sein.
»Also los«, ermuntert mich Jonas und lässt den Stadtplan in seiner Hosentasche verschwinden. Er greift meine Hand und führt mich auf die Straße.
Ich bin damit beschäftigt, nicht über einen Bordstein zu stolpern, weil meine Aufmerksamkeit temporär bei einer Gruppe einheimischer Mädchen weilt, die sich zu streiten scheinen. Ihre Kleider sind alle weiß oder cremefarben, ihre Haare von dem typisch portugiesischen Dunkelbraun, das in der Sonne einen seidigen Glanz entwickelt. Zwei von ihnen gestikulieren wild. Es erinnert mich an ein Theaterstück, das ich einmal gesehen habe. Die Bilder spielen sich vor meinem inneren Auge ab, und die Dialoge hallen laut in mir wider.
»Kommst du bitte?« Jonas sieht mich auffordernd an, weil ich wieder stehen geblieben bin. Jetzt beeile ich mich, mit ihm in die Gasse zu treten, die sich zwischen verlebten Gebäuden windet und als Tor zum wahren Leben von Funchal fungiert. Ich nehme die Einzelheiten der Umgebung in mich auf. Die Farbe der Häuser, die an einigen Ecken Blasen schlägt. Form und Abweichungen von dem, was ich aus Deutschland kenne. Gerüche: Salz und gebrannte Kastanien. Wenige Schritte und wir erreichen das Zentrum, und plötzlich sind wir mitten in einem Strom von Menschen. Wie ein Fischschwarm zieht er uns mit sich mit, und ich fasse Jonas’ Hand fester. Auf einem Platz rechts von uns steht ein Pulk aus Touristen, die sich deutlich von den Einheimischen abheben. Oder ist es links von uns? Ich konnte rechts noch nie von links unterscheiden. Irgendwo spielt Musicalmusik. Sie verwirrt mich. Ich starre den bärtigen jungen Mann an, der Memory aus Cats schmettert. Immer wieder huschen Menschen durch mein Sichtfeld. Als die Bläser eines kleinen Orchesters einsetzen, übersehe ich einen Hund vor meinen Füßen. Ich verliere den Halt und rudere mit den Armen, der Griff von Jonas’ Hand löst sich. Ein Bus donnert viel zu laut und viel zu nah vorbei. Ein Fahrzeug hupt. Eine Frau verkauft Maronen und ruft es in die Welt. Zwei Männer, die uns entgegenkommen, ein Portugiese mit Lederhaut und einer mit tiefen Furchen im Gesicht, trennen mich endgültig von Jonas. Der Terrier-Mischling mit dem roten Halsband schaut mich immer noch vorwurfsvoll an, weil ich ihn aus Versehen getreten habe.
»Sorry«, hauche ich, und endlich löst er seinen durchdringenden Hundeblick von mir.
Jemand schiebt mich weiter. Meine Augen folgen dem Hund, der seinen Weg fortsetzt. Er bleibt an einer Ampel stehen, wartet darauf, dass die Fahrzeuge für ihn halten. Ein Ford wird langsamer, der Hund setzt eine Pfote auf die Straße, beobachtet den Wagen, der für ihn stoppt. Verrückt, schießt es mir durch den Kopf. Er geht ganz allein hier in diesem Trubel spazieren. Weicht geschickt Leuten aus, hat alles im Griff und ein Ziel. Weiter entfernt kann ich das Meer erkennen. Im Hafen liegen die Aida und die Queen Elizabeth. Der blaue Himmel spannt sein Zelt über diese Kulisse. Ob er dorthin möchte? Der Hund? Wind frischt auf, trägt den Geruch von Fisch und Blumen zu mir herüber. Ein Markt auf der anderen Straßenseite. Die Bläser hinter mir erreichen ihren Gipfel. Das Finale eines Weihnachtsliedes rückt näher, und die Musik wird zu Lärm. Furchtbarer Lärm! Neben mir sagt jemand etwas auf Englisch. Die Stimme klingt wie die meines Lehrers in der neunten Klasse. Ob der noch lebt? Er wurde krank, damals. Sterben. Sterben ist bestimmt nicht leicht. Ich schaue mich hektisch um. Wo ist Jonas? Ich sehe nur noch Farben, die um mich herum huschen. Gesichter, die immer mehr an Bedeutung verlieren. Der Krach lässt mein Herz schneller schlagen, und ich beginne zu schwitzen.
»Scheiße«, jammere ich und mahne mich zeitgleich zur Ruhe. Wie ich es hasse, wenn meine Stimme ins Weinerliche kippt. Endlich entdecke ich Jonas nicht weit von mir, und ich steuere nach links (oder rechts?). Seine Augen weiten sich vor Schreck.
Oh, oh! Ich kann meinen Lauf gerade noch stoppen und renne nicht in das entgegenkommende Fahrrad. Puh! Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ein irres Lächeln zuckt um meinen Mundwinkel. Mein Blick findet den Hund wieder, der bereits auf der Strandpromenade entlangläuft. Er trifft einen guten Bekannten. Einen Schäferhund. Sie begrüßen sich mit wedelnden Schwänzen. Ich muss darüber lachen. Keine Ahnung, warum. Am Rande erkenne ich das Hindernis, als ich eine alte Frau mit schweren Tüten umrunden will. Es knallt. Mein Kopf, allem voran meine Nase, tuschiert einen Laternenmast, und ich sinke augenblicklich in die Knie. Autsch! Das darf doch wohl nicht wahr sein!?
»Minchen!« Vage bekomme ich mit, wie Jonas hilflos die Arme hebt. Die Frau mit den Tüten versucht, mir aufzuhelfen. Wirklich nett. Sie hat zwei verschiedene Augenfarben. Das eine Auge ist fast schwarz, das andere von einem schmutzigen Grün. Sie lächelt.
»Obrigada«, sage ich. Danke. Das einzige Wort auf Portugiesisch, das ich kenne.
»Was machst du denn?«, höre ich Jonas sagen. Er verkneift sich ein Lachen. Muss komisch ausgesehen haben der Unfall. Zwischen meinen Fingern, die ich mir auf den Mund und die Nase presse, quillt dunkles Rot hervor.
»Oh, nein!«, quieke ich wie ein Ferkel, das man über eine grüne Wiese hetzt.
»Kein Problem. Das wird wieder«, sagt Jonas routiniert und hilft mir auf. Die Frau reicht mir ein Taschentuch. Und mir reicht der Ausflug.
Tja, wie gesagt: Urlaub ist eine feine Sache, wenn man weiß, ihn zu genießen. So denke ich, als wir im Behandlungszimmer des Krankenhauses ankommen. Es geht doch nichts über neue Sinneseindrücke. Und dem Leben kann man sich ja schließlich nicht entziehen. Oder so ähnlich.
Vorsichtig schaue ich meinen Mann an, der sich lässig auf einem Stuhl neben mir niederlässt. Dafür liebe ich ihn: dass er den Abbruch unseres kurzen Stadtbummels hinnimmt ohne zu murren und, viel wichtiger, ohne mir einen Vorwurf zu machen. Es gab Menschen in meinem Leben, die hätten mir was erzählt. Jonas nicht. Und dabei ist es ja genauso auch sein Urlaub. Ich werfe meinem Mann einen schmachtenden Blick zu.
Der Arzt kommt herein, grüßt nur knapp und zeigt uns eine Röntgenaufnahme. »Ihre Nase ist nicht gebrochen«, erklärt er und mustert mich lange. Dabei lässt er seine Fingerknöchel knacken. Wie unangenehm.
»Juhu!«, versuche ich, die Stimmung zu heben, und starre zurück. Er ist für einen Portugiesen hochgewachsen und trägt eine Brille. Für einen Moment bleibt er unschlüssig stehen, dann setzt er sich auf einen Hocker mit Rollen und schiebt sich näher an mich heran.
»Das ist doch gut, oder nicht?«, hake ich nach, als er immer noch nichts sagt. Im nächsten Augenblick rührt er sich, zückt eine Taschenlampe und leuchtet mir in die Augen. Ich blinzle.
»Trotzdem siehst du aus, als hättest du einen Zusammenstoß mit einem Omnibus gehabt«, scherzt Jonas.
Der Arzt unterbricht sein Tun und schaut meinen Mann skeptisch an. Er hat wohl nicht viel Sinn für Humor.
»Das kannst du nicht wissen«, antworte ich. »So eine Begegnung blieb mir bis jetzt erspart.« Ich versuche zu grinsen. Meine aufgeplatzte Lippe schmerzt dabei.
»Bitte die Augen geöffnet lassen«, fordert mich der Arzt auf, und ich denke an zu Hause. Wie schön wäre es jetzt daheim.
»Zuletzt sah ich vor etwa einem Jahr so aus, nachdem wir renoviert hatten«, berichte ich dem Arzt in Plauderlaune. »Als wir die alten Tondachpfannen unseres Hauses abnahmen, hat mich eine davon genau hier getroffen.« Ich zeige auf den Knochen oberhalb meines Auges. »Ich war wohl zu lange damit beschäftigt, mich darüber zu wundern, dass sie ins Rutschen kommen können, um zu reagieren.«
Jetzt ziehen sich die Augenbrauen des Arztes zusammen. Grüblerisch. Oder genervt.
»Und davor war ich auf eine Harke getreten. Ganz slapstickmäßig, wie im Bilderbuch. Und davor, ach, ich könnte ewig so weitermachen. Kurzum, eine Unfallversicherung lohnt sich bei mir«, zwitschere ich weiter.
Stille tritt ein. Eine unangenehme Stille. Der Arzt hebt mein Kinn leicht an und tastet anschließend meinen Dickschädel ab.
»Haben Sie Schmerzen?«, will er wissen. Ich lese sein Namensschild: M. Cortez. Das kommt mir spanisch vor.
»Nein, eigentlich nicht sehr stark.«
Dr. M. Cortez brummt. »Möchten Sie mir noch einmal erklären, wie Sie sich diese Verletzung zugezogen haben?«, fragt er, und Jonas wirft mir einen warnenden Blick zu.
Verdammt. Denk nach, Wilhelmina! Wo läuft der Hase gerade hin?
»Ich möchte Sie bitten, draußen auf Ihre Frau zu warten«, fordert der Doktor plötzlich Jonas auf zu gehen. Mein Magen zieht sich alarmiert zusammen.
»Ähm, nein. Mein Mann bleibt hier«, sage ich schnell. Mein Kopf beginnt, Domino zu spielen. Das tut er immer, wenn ich mich krampfhaft versuche zu konzentrieren. Es ist in etwa so, als würden sich Hunderte Gedanken laut in meinem Schädel bemerkbar machen. Natürlich nur die, die fallen. Und es erfordert Fingerspitzengefühl, gezielt einen Gedanken nach dem anderen zu greifen, ohne eine Kettenreaktion auszulösen.
»Ich möchte Sie noch einmal untersuchen. Währenddessen kann sich Ihr Mann schon einmal um die Formalitäten kümmern«, schlägt Dr. M. Cortez in einem seltsamen Tonfall vor. Ich blinzle erneut.
»Aber …«
Jonas erhebt sich umständlich und flüstert mir zu: »Ich bin mir nicht sicher, ob der Arzt dir die Story mit dem Laternenmast abgekauft hat.«
Mir wird schlagartig klar, dass der Vorwurf häuslicher Gewalt die Luft schwängert.
»Oh, nein. Ich glaube, hier entsteht gerade ein Missverständnis«, versuche ich, den Arzt, der sich ausgiebig Notizen macht, aufzuklären. Er sitzt immer noch auf seinem Hocker und entfernt sich rollenderweise von mir. »Mein Mann hat nichts mit meinem Veilchen zu tun.«
»Was meinen Sie?«, fragt Dr. Cortez und runzelt jetzt noch ein wenig mehr die Stirn. Und das, ohne aufzusehen.
»Bei mir handelt es sich um eine neurologische Besonderheit«, beginne ich und schlage mir innerlich vor den Kopf. »Nicht bei mir, bei meinem Gehirn. Ich habe ADS.« Ich straffe mich und versuche, selbstbewusst zu wirken. Guckt der mich jetzt bitte schön einmal an? »Ich leide unter einer ausgeprägten Reizfilterschwäche. Und aus diesem Grund passieren mir manchmal Unfälle«, versuche ich es weiter. Domino! Ich kann es fühlen. Zehn, neun, acht … »Ich weiß es erst, seitdem ich 24 bin, wissen Sie?« Ich räuspere mich. »Früher hatte ich den Verdacht, unter einer besonderen Art der Geisteskrankheit zu leiden. Kein Scherz.« Ich kichere blöd. »Vorsichtshalber hab ich niemandem verraten, dass ich oft das Gefühl hatte, verrückt zu sein, wenn mich alles so überrannt hat. Aber jetzt …« Ich hole Luft. »Bei ADS, kurz für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Aufmerksamkeitsdefizitstörung – wobei Störung so ein unschönes Wort ist –, handelt es sich um eine neurochemische und neurobiologische Besonderheit, die das Zusammenspiel von Aufmerksamkeit und Motivationssystem beeinträchtigt und falsche Signale sendet«, bete ich herunter. Dr. Cortez schaut mich an. Nachdenklich. »Sie kennen vielleicht den englischen Begriff? Attention Deficit Disorder? ADD?« Ich glaube, bei dem klingelt immer noch nichts, und ich werde ernsthaft unruhig. »Wissen Sie, es gibt ADS oder auch ADHS schon sehr lange. Bekannt ist es seit dem 19. Jahrhundert. Nur nicht unter dem Namen ADS. Sagt Ihnen der Zappelphilipp etwas, von Heinrich Hoffmann? Aus dem Struwwelpeter? Nein?«
Nein? Natürlich nicht. Nur weil der Arzt ein bisschen deutsch spricht, hat er bestimmt nicht unsere Literatur oder Geschichte studiert. Sein Mund kräuselt sich leicht. Was soll das jetzt wieder bedeuten?
»Ich bin mehr der Hans Guck-in-die-Luft. Der wäre beinahe ertrunken, weil er sich allzu oft ablenken ließ und schließlich ins Hafenbecken fiel. Heinrich Hoffmann schrieb die Geschichten 1845 für seine eigenen Kinder. Als Warnung. Ich schätze, er hat versucht, durch Angst ein normales Verhalten seiner Sprösslinge zu erzwingen, die vielleicht ähnlich aus der Art schlugen wie ich zum Beispiel. Keine gute Idee, wenn Sie mich fragen.« Ich stehe auf. »Es besteht in jedem Fall ein erkennbarer Zusammenhang zum Verhalten mit ADS.«
Jonas macht das Zeichen für Sprechdurchfall, das er mir immer gibt, wenn ich nicht aufhöre zu reden. Ich stelle mich neben ihn und versuche, meine Gedanken zu ordnen. Und den Mund zu halten.
»Ich schätze, das hier ist nicht der beste Moment, meine neurologische Besonderheit zur Sprache zu bringen, oder?«, frage ich vorsichtig in die lustige Runde. Jonas schweigt. Der Arzt kritzelt etwas auf einen Zettel.
»Ich überweise Sie«, sagt er plötzlich ernst. Scheiße. Echt jetzt? Ich reiße die Augen auf.
»Mann, Sie verstehen aber auch gar keinen Spaß, oder?«, höre ich mich plappern, weil ich plötzlich Angst habe, dass er mich in eine Nervenklinik einweisen will. Gibt es eine auf Madeira?
»Kein Spaß«, antwortet der Arzt stoisch. Ob er mich überhaupt verstanden hat? »Ihren Schneidezahn sollte sich ein Kollege der Zahnmedizin ansehen.«
Puh! Ich lächle. War mir gar nicht bewusst, dass der Zahn ebenfalls was abbekommen hat.
»Oh, ja. Gut«, sage ich erleichtert.
Dr. M. Cortez gibt mir die Hand, drückt sie leicht, während er uns dezent zur Tür geleitet. Ich habe das Gefühl, er kann uns gar nicht schnell genug wieder loswerden.
»Ich wünsche Ihnen alles Gute«, sagt er knapp. Jonas bedenkt er mit einem Kopfnicken und schon schließt sich die Tür hinter uns.
»Ihnen auch. Vielen Dank«, antworte ich noch. Draußen angekommen atme ich auf.
»Für einen Moment dachte ich, der will mich in die Klapse einweisen«, sage ich lahm und suche mit den Augen unseren kleinen Mietwagen. »Dann hieße es: Au revoir, Meeresrauschen, Palmen und Pizzeria. Hallo, Zwangsjacke.« Ich bekreuzige mich innerlich. Was für eine Horrorvorstellung!
Tatsächlich weiß ich aus meiner Jugend, wie so eine Einrichtung aussieht. Nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Doch wie es sich in Portugal verhält, will ich lieber nicht herausfinden. Zumal ich in solch einer Einrichtung wirklich fehl am Platz bin. Damals wie heute.
»Lustig. Könnte entspannt für mich werden«, scherzt Jonas, und ich knuffe ihn in die Seite. »Da kann dir zumindest nichts passieren, und ich könnte dich wieder abholen, wenn unser Rückflug geht, Schatz«, plaudert er weiter, und ich mache einen Schmollmund. »Guck nicht so«, fordert er und drückt mich an sich. »Du weißt doch, dass ich ohne dich nicht kann.«
»Ich liebe dich auch«, flüstere ich und gebe ihm einen Kuss. Autsch! Meine Lippe! Die hatte ich vergessen.
Verdammt, jetzt habe ich Heimweh. Zu Hause ist es doch am schönsten. Es ist sicherer als im Dschungel der unbekannten Sinneseindrücke. Mir reichen die Reize, die in der normalen Welt – also daheim – auf mich einwirken ja schon aus, um wahnsinnig zu werden. Und dort kenne ich jede Gefahrenquelle. Und meine Unfallärzte.
Mit Leichtigkeit planlos
Zurück zu Hause muss ich nur schnell Weihnachten überstehen, dann kann ich mich in aller ADS-Herrgotts-Hektik dem Silvesterchaos widmen …
»Mama, hast du es bald mal?«, fragt meine dreizehnjährige Tochter Louisa mich, während ich die vorsortierten Äpfel in der Obstabteilung anstarre. Zwanzig Cox, 24 Elstertal. Ich zähle weiter. Bis zum Jahreswechsel sind es nur noch ein paar Stunden, und der Countdown bis Mitternacht läuft bereits laut in mir ab. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werde ich nicht bis zum Feuerwerk durchhalten, sondern vorher irgendwo im Haus einschlafen – wie fast jedes Jahr – und die nächsten Tage vor Erschöpfung durchschlummern. Weihnachten, das Fest der Liebe? Pah, Weihnachten mit meinem ADHS-Bruder Henry und mir ist das Fest der Supernovas … Ich wundere mich jedes Mal, wenn wir es allesamt mehr oder weniger unbeschadet überstanden haben. Aber – es ist uns auch dieses Jahr wieder geglückt. Wir leben noch.
»Mama?«, höre ich Louisa maulen. Gleich wird sie mit dem Fuß aufstampfen.
»Ja, gleich«, antworte ich und höre auf, über Farbgebung und Geschmack zu sinnieren. Warum ist Golden Delicious nicht halb so deliziös wie Pink Lady? Und warum meinen die Leute, dass sich Boskop am besten zum Backen von Apfelkuchen eignet? Meine Hände kramen das kleine Diktiergerät aus meiner Jackentasche.
»Erna bitten, für meinen Geburtstag Apfeltarte zu backen. Nicht vergessen«, spreche ich mir auf das Band. Mein Geburtstag ist bereits in zwei Wochen, und wenn ich meine Mutter nicht rechtzeitig dafür einplane, wird sie es schlicht nicht für mich tun. Diesbezüglich ist sie stur. Eine unangenehme Eigenschaft unserer Familie, die man auch als Gendefekt bezeichnen könnte. Diese Sturheit vererbt sich eins zu eins auf jede weibliche Person in unserer Familie. Obwohl, meine Mutter bildet da vielleicht eine Ausnahme. Sie ist noch eine Spur sturer. Denn sie wollte bis zuletzt nicht wahrhaben, dass mit mir etwas nicht stimmt. Dass ich ADS haben könnte. Ich war doch so ein liebes Kind. Aber dazu kommen wir später.
»Mama, jetzt komm weiter. Ich möchte heute noch nach Hause«, murrt Louisa weiter und übernimmt den Einkaufswagen. Ich trotte ihr hinterher und stelle fest, dass ich den Einkaufszettel vergessen habe. Wie etwa jedes zweite Mal, wenn einer angefertigt wird, blieb er einsam auf dem Küchentisch zurück.
»Oh nein!«, stoße ich aus.
Louisa bleibt stehen, verengt ihre Augen. »Was geht, Mama?«
Ich lächle schief. »Weißt du noch, was wir aufgeschrieben haben?«
Louisa schüttelt den Kopf, und eine kleine Welle der Verzweiflung droht mich zu überrollen. Müde! Ich werde müde. Und das bedeutet, mein Gehirn schaltet früher oder später auf out of order. Oder es beschwert sich mit fiesen Kopfschmerzen.
Glücklicherweise überspült die Verzweiflung nur meine Füße, denn Louisa beginnt nun doch, die Liste aus dem Kopf aufzuzählen. Gut, dass ich ihr alles diktiert habe! Denn wenn man es selbst schreibt, bleibt es im Gedächtnis.
»Du bist großartig, mein Frosch«, jubiliere ich und stoße mit einem älteren Herrn zusammen, der mich daraufhin komisch ansieht. Ich schaue zu Boden, entschuldige mich.
»Ich weiß«, antwortet meine kleine Retterin zwei Schritte vor mir und beginnt, die Dinge, die wir brauchen, in den Wagen zu räumen.
Es ist nicht so, dass ich nicht ohne Begleitung einkaufen kann. Meistens komme ich gut allein klar und bringe fast alles mit, was ich vorhatte zu kaufen. Und einige Dinge, die ich nicht vorhatte zu kaufen, natürlich auch. Allerdings sind diese Impulseinkäufe eine Gefahr für meinen Geldbeutel und für mein Zeitmanagement. Denn sie machen mir zusätzliche Arbeit, weil ich die gekauften Artikel später wieder zurückbringen muss.
»Habe ich dir schon einmal gesagt, wie sehr ich es schätze, dass du mit mir einkaufen gehst, Lou?«, frage ich meine Tochter und bücke mich nach einem Knopf, der auf dem Boden liegt. Blau mit Punkten.
»Ja, hast du«, antwortet sie und hebt eine ihrer Augenbrauen, während sie mich beobachtet. »Wir sollten mal über mein Taschengeld sprechen«, schlägt sie grinsend vor und biegt in den nächsten Gang.
»Du Teufelchen«, rufe ich ihr nach. Mein Blick bleibt an einem potenziellen Impulseinkauf hängen. Reduzierte Kuschelsocken. Lila und so fluffig. Oh, die mag ich. Mein Magen beginnt, freudig zu kribbeln, und meine Hände greifen sofort nach dem flauschigen Stoff.
»Hey, das stand nicht auf der Liste, Mama«, erinnert mich mein kleiner Wachhund, als er nachschaut, wo ich bleibe.
»Ich weiß. Aber wir brauchen welche. Du übrigens auch«, sage ich und suche nach dem Preis. 1,99 Euro. Das ist erschwinglich, würde ich meinen.
»Mein Sockenfach ist voll«, antwortet Louisa gedehnt.
»Du musst aber auch mal die Löcher mit Socken wegwerfen, Kind.«
»Was?« Louisa lacht.
»Die Socken, wenn sie kaputt sind«, erkläre ich. »Du sollst sie dann in den Müll schmeißen.«
»Ach so.«
Ich lege vier Paar in den Einkaufswagen.
»Hier, die zwei kaufe ich dir. Magst du sie?«, frage ich fröhlich. Endorphine werden ausgeschüttet.
»Klar. Schanke dön«, sagt sie. Ich blinzle verwirrt.
»Danke schön, meine ich, Mama. War ’ne Wertverwochslung.«
»Witzig«, antworte ich und schiebe Louisa samt Einkaufswagen weiter. Wortverwechslungen sind bei uns ein Highlight solcher Tage, an denen es mir zu stressig wird. Man muss seine Schwächen ja mit Humor nehmen, nicht wahr? Louisa und ich tun das jedenfalls schon immer. Sie hat von Anfang an gelernt, meine Unzulänglichkeiten mit Gelassenheit zu nehmen. So wie ich mittlerweile. Und das war weiß Gott nicht immer so. Das könnt ihr mir glauben!
Louisa hatte schon als Kleinkind ein Vokabular verinnerlicht, das alle dazugehörigen Wort- oder Silbenverdrehungen beinhaltete. Im Kindergarten sprach sie deshalb ein wahres Kauderwelsch, das oft nur wir beide verstanden. Wenn sie zum Beispiel ihre Kindergärtnerin bat, ihr zu helfen, die Hose in die Stummiegiefel zu stecken, weil es sonst basse Neine gebe, verstand diese mein Kind nicht immer auf Anhieb. Dass Louisa dazu auch noch sehr schnell sprach, machte die Sache nicht leichter. Lustig wurde es, wenn sie mit anderen Kindern redete, denn sie klärte die Mitzwerge darüber auf, dass sie nachmittags zum Kundertirnen ging. Wenn sie jedoch erzählte, dass sie nach dem Keksturnen noch Kinder backen wollte, wurde es brenzlig. Es gab tatsächlich ein Mädchen, das uns nach dieser Aussage aus Sicherheitsgründen erst einmal nicht mehr besuchen wollte. Schade eigentlich, denn die Kekse waren uns gut gelungen, nach dem Kinderturnen.
Bald ist der Einkaufswagen voll, und ich will ihn zur Kasse fahren, doch Louisa stoppt mich.
»Hast du nicht etwas vergessen?«, fragt sie und übt einen langen Augenaufschlag.
»Nein, ich glaube nicht«, antworte ich und bin auf der Hut. Immer wenn sie mich so ansieht, möchte sie etwas.
»Wir dürfen doch jetzt im Unterricht Musik hören«, versucht sie, mir auf die Sprünge zu helfen.
Ich runzle die Stirn.
»Das hab ich dir doch erzählt. Alle, die an ihrem Themenblock arbeiten, dürfen mit ihrem MP3-Player Musik hören, und ich möchte neue Songs dafür herunterladen. Dazu brauche ich ein neues Guthaben für iTunes.« Sie wedelt mit einer Gutscheinkarte vor meiner Nase herum. Ich durchwühle mein Hirn nach dem Gespräch, das wir darüber geführt haben müssen.
»In der Schule?«, höre ich mich unsicher fragen.
»Jahaa!«, antwortet sie gedehnt. »Glaubst du mir nicht, oder was?«, fragt sie und rollt gekonnt die Augen. »Zu dem Thema gab es sogar ’nen Elternbrief.«
»Natürlich glaube ich dir«, antworte ich schnell und nehme ihr die Geschenkkarte ab. »Weißt du, was mir noch einfällt? Du und Mieke, ihr wollt doch bestimmt alkoholfreien Sekt zum Anstoßen um zwölf Uhr haben, oder?«
Ihre Augen leuchten auf. »Klaro«, zwitschert sie.
»Holst du dann noch eine Flasche?«, bitte ich sie, und sie flitzt los. Ich zücke mein Diktiergerät. »Memo an mich: Checken, ob ein Elternbrief existiert, der die Mitnahme eines MP3-Players in die Schule thematisiert. Memo Ende.« Sicher ist sicher. Louisa ist ein Schatz. Aber sie ist nicht doof, und dann und wann nutzt sie meine Schwächen für sich.
Als wir aus dem Laden treten, beginnt es tatsächlich zu schneien, und ich fluche innerlich. Schnee auf Fahrbahnen macht mich nervös. Nervöser als ich ohnehin schon werde, wenn ich unterwegs bin.
Louisa schiebt den Wagen an den Kofferraum unseres Autos heran, und ich wühle in meiner Handtasche nach dem Schlüssel. Während ich das tue, beobachte ich, wie sich die weißen Flocken auf Louisas Mütze legen und sie zudecken. Meine Hände suchen die Jackentaschen ab. Ohne Erfolg. Und mir wird unangenehm warm in meiner Winterjacke.
»Nee, oder?«, fragt Louisa und pustet sich eine Locke aus dem Gesicht. Unter langen Wimpern schaut sie mich an. »Du hast den Schlüssel nicht im Laden gelassen, oder?«
Ich grüble. Fast bin ich mir sicher, dass ich ihn nicht in der Hand hatte. Zumindest nicht im Laden. Nicht wie damals im Möbelhaus, als wir ihn nach zweistündiger Suche bei den Ledergarnituren zwischen der Deko wiederfanden. Ich hatte ihn auf einem Bücherregal in eine Muschelschale gelegt, während ich die Preislisten studierte. Anschließend waren wir weitergeschlendert. Ohne Schlüssel.
»Nein, auf keinen Fall«, antworte ich, und Louisa filtert die Unsicherheit aus meiner Stimme.
»Wo hast du ihn denn das letzte Mal gesehen?«, fragt sie routiniert. Meine Gedanken beginnen zu fallen. Einer nach dem anderen, jeder stößt den nächsten an. Domino! Ich denke an den Schnee, der mein Kind einnimmt. An Schneemänner, um genau zu sein, und Karottennasen. An Karotten, die wir nicht gekauft haben, obwohl sich unsere beiden Ponys Lotta und Amy sicher gefreut hätten. Louisa umrundet den Einkaufswagen, murmelt etwas und zieht am Kofferraumdeckel.
»Und siehe da, er geht auf«, höre ich sie wie durch Watte sagen. Im nächsten Moment trifft mich ein Schneeball an der Schulter.
»Erde an Mama!«, ruft meine Tochter. »Guck mal. Der Wagen ist offen.«
Oh, Überraschung!
»Hast du den Schlüssel vielleicht stecken lassen?«
Ich reagiere und jubiliere innerlich, als ich mich in den Wagen beuge und ihn entdecke. »Hab ihn!«, rufe ich und ziehe ihn ab. Kühl liegt er in meiner Hand, und ich lasse ihn einmal klimpern, um zu verinnerlichen, dass er wieder da ist.
Neben uns befördert ein Mann mit Basecap scheppernd Bierkisten und Feuerwerkskörper in sein Auto und erinnert mich daran, dass Louisa und ich losmüssen. Das Mittagessen wartet. Und ich muss es erst noch kochen. Also verstauen wir in Windeseile die Einkäufe und sehen zu, dass wir Platz machen für andere Verrückte, die begriffen haben, dass dies die letzte Möglichkeit in diesem Jahr ist, um an Lebensmittel zu gelangen.
Während ich ausparke, suche ich nach einem Sender, auf dem etwas gespielt wird, mit dem ich Autofahren kann. Nicht jedes Lied eignet sich dazu. Es muss zu meinem Herzschlag passen. Das ist wichtig. Auf keinen Fall Helene Fischer. Das verträgt sich nicht mit meinem Puls, und ich werde nervös. Das gilt für jegliche Art von Schlager, wenn ich so darüber nachdenke. Und Heavy Metal kommt auf der Unmöglichen-Liste gleich danach, dicht gefolgt von Hip-Hop. Wobei man das nicht unbedingt verallgemeinern kann. Gar keine Musik ist jedoch auch keine Lösung, denn dann bekomme ich das Gefühl, keinen Puls zu haben, was sich genauso blöd anfühlt.
Also drücke ich weiter lustig auf den Knöpfen des Radios herum und suche. Hinter mir hupt jemand, weil es ihm zu lang dauert. Ich schaue mich um. Der Fahrer eines BMW gestikuliert wild.
»Vielleicht solltest du erst mal weiterfahren«, schlägt Louisa vor und tippt irgendwas in ihr Handy. Eine Nachricht über WhatsApp an ihre Freundin vermutlich.
Ich entschuldige mich per Handzeichen bei dem ungeduldigen Menschen und lege den ersten Gang ein. Langsam rolle ich vorwärts, und endlich finde ich etwas im Radio. Mr. Brightside von The Killers. Schneeflocken wirbeln durch die Luft, legen sich auf die Windschutzscheibe und werden von den Wischern vertrieben. Mein Blick folgt ihnen.
»Warum schneit es eigentlich immer zu spät? Ich hatte so gehofft, dass wir einmal weiße Weihnachten haben würden«, mault Louisa und starrt hypnotisiert auf ihr Handy. Ich verlasse die Seitenstraße und ordne mich vorschriftsmäßig in den Verkehr ein.
»Das kann ich dir auch nicht sagen, mein Schatz«, antworte ich nachdenklich und schaffe es nicht mehr über die Ampel. Das Rot leuchtet mir viel zu grell entgegen. »Aber Silvester in Weiß kann auch romantisch sein, das kannst du mir glauben.« Ich denke an mein erstes Silvester mit Jonas. Und an die heißen Küsse im kalten Schnee.
»Romantisch? Echt jetzt? Es geht mir nicht um Romantik, Mama. Weihnachten muss weiß sein, weil es so in den Geschichtsbüchern steht«, klugscheißt mein Teenager.
»Ach wirklich? Da steht drin, dass der Schlitten des Weihnachtsmannes nur durch Schnee fahren kann?« Jetzt ernte ich einen kurzen Blick, den ich nicht deuten kann.
»Mann, in der Bibel hat es geschneit, als Josef mit Maria nach Bethlehem gezogen ist«, erklärt sie.
Ich blinke rechts.
»Ja, aber Bethlehem ist nicht Ottersbach«, gebe ich zu bedenken und leide in Gedanken mit der armen Maria. Das muss echt mies gewesen sein, mit Wehen in der Kälte. Scheiße! Ich wollte noch zur Apotheke. Das war einer der Hauptgründe, warum ich mich heute hinters Steuer gesetzt habe. Es wird grün, und ich gebe Gas. Im Radio läuft inzwischen Fettes Brot. Das geht gar nicht. Ich hätte lieber einen MP3-Stick mitnehmen sollen. Dann könnte mich das Radio nicht nerven.
»Mama!«, ruft Louisa aus.
Meine Augen weiten sich, und ich biege vor einem sich viel zu schnell nähernden Fahrzeug, das jetzt scharf bremst, links ab. Links, nicht rechts.
»Holler the wood fairy«, stoße ich aus. »Der war aber flott unterwegs.«
Louisa klammert sich an das Armaturenbrett. »Du hast rechts geblinkt!«, stellt sie klar.
»Alles unter Kontrolle«, beruhige ich sie und wische unauffällig meine feuchten Hände eine nach der anderen an meiner Jeans ab.
»Der war aber echt zu schnell«, meint Louisa und schüttelt den Kopf über die Frechheit des Rasers. Ja, auf den letzten Drücker werden wohl alle ein wenig hektisch.
Die Apotheke kommt in Sicht, und ich fahre auf den Hof. Als der Motor verstummt, atme ich einmal tief durch. Runterkommen ist für mich nicht immer leicht, und ich greife automatisch auf eine meiner Übungen zurück. Ich spanne die Muskeln in den Beinen einige Sekunden lang an und atme dann langsam wieder aus. Anschließend wiederhole ich das Ganze mit meinen Armen und den Händen.
»Das gibt Ärger«, murmelt Louisa plötzlich und deutet nach hinten. Der Wagen, den ich eben geschnitten habe, ein Ford Kuga, ist mir gefolgt und hält unweit von uns. Ein Mann mit silbrigem Haar und einem Oberlippenbart steigt aus und hält in schnellen Schritten auf uns zu. Ich weiß nicht, warum, aber Männer mit Oberlippenbart sind mir grundsätzlich unsympathisch.
Ich beobachte ihn im Rückspiegel und zähle seine Schritte. Fünf, sechs, sieben … bei vierzehn müsste er uns erreicht haben. Deshalb versuche ich, ihn erst einmal zu ignorieren, und tue so, als suchte ich etwas in der Handtasche. Leider klopft es dann doch an der Scheibe meiner Fahrertür.
»Mist«, stoße ich aus und lasse das Fenster runter. Louisa sieht amüsiert aus und hat sogar ihr Handy in ihre Tasche gesteckt. Dieses Szenario scheint interessanter zu sein als Facebook und Co.
»Ja, bitte?«, sage ich freundlich, und der Typ beugt sich zu mir herunter. Der kalte Wind weht sein scharfes Aftershave zu uns herein.
»Sind Sie noch ganz dicht?«, fragt er mich.
Nett. Ich lächle stur weiter. »Natürlich. Und Sie?«, frage ich zurück.
Seine Stimme wird gefährlich leise. »Sie haben mir die Vorfahrt genommen. Das hätte böse ins Auge gehen können.«
»Ist ja alles gut gegangen«, versuche ich einzulenken.
»Einen Führerschein haben Sie schon, oder?«
Ich starre auf seine schmalen Lippen, die eine bläuliche Färbung haben. Ob der Mann Durchblutungsprobleme hat?
»Wie war die Frage noch mal?« Meine Stimme hört sich dünn an, und das ärgert mich sofort.
»Ob Sie eine Fahrerlaubnis besitzen.« Er deutet ein Kopfschütteln an und schnalzt mit der Zunge. Gott, er erinnert mich an meinen letzten ungnädigen Ausbilder im Autohaus Holke, als ich versucht habe, Bürokauffrau zu werden. Das hatte nicht sollen sein. Schon gar nicht mit so einem Vorgesetzten.
»Wer will das wissen? Sind Sie Polizist?«, höre ich mich fragen. Hoffentlich nicht.
»Wenn ich das wäre, hätten Sie die längste Zeit Ihren Lappen gehabt, das können Sie mir glauben.«
»Ist ja gut«, antworte ich lahm. Meine Hände spannen sich an und entspannen sich wieder. Mein Puls bleibt trotzdem hoch.
»Eine Entschuldigung wäre das Mindeste, meinen Sie nicht?«, bohrt er jetzt auf eine unangenehme Art weiter.
»Schade«, sage ich bedauernd. »Ich habe es mir vor langer Zeit abgewöhnt, mich bei Leuten wie Ihnen zu entschuldigen.«
Er steckt seinen Kopf noch ein bisschen mehr durch die offene Fensterscheibe. »Das wird ja immer frecher.«
Gut. Dann kann ich ja jetzt richtig loslegen.
»Wenn Sie nicht mit so viel Gas in Ihrer protzigen Karre unterwegs gewesen wären, hätten Sie nicht so scharf bremsen müssen«, sage ich und drücke mit Schwung meine Tür auf. Er beeilt sich zurückzutreten und stolpert beinahe.
»Sind Sie verrückt?«
»Ist das eine Fangfrage?« Ich spüre, wie mein Blut immer heftiger durch meinen Körper gepumpt wird. Ruhig bleiben ist die Devise! Ich zähle innerlich bis zehn. Die Worte, die aus dem wütenden, schmallippigen Mund des Mannes kommen, werden dumpf und verschwimmen in meinen Ohren zu einem Brei. Acht, neun, zehn. Atmen!
»Jetzt hören Sie mal zu, Fräulein. Sie ziehen mal ganz schnell Ihre Schrauben im Kopf an und …«
Mir fällt auf, dass sein Wagen mit laufendem Motor auf einem Behindertenparkplatz steht.
»Übrigens, netter Parkplatz«, explodiere ich. So viel zur Impulskontrolle. »Sie sind zu doof, um sich an Geschwindigkeitsregeln zu halten, und zu blind, einen Behindertenparkplatz von anderen zu unterscheiden. Ich leide an einer Rechts-links-Wahrnehmungsstörung. Welche Entschuldigung haben Sie?« Ich brülle aus voller Lunge. Mein ganzer Körper bebt, und meine Hände ballen sich an meiner Seite zu Fäusten. Der Mann macht einen Schritt rückwärts, verengt die Augen zu Schlitzen. »Ich habe Sie etwas gefragt«, schreie ich weiter. Ich spüre, wie mir die Hitze in den Kopf steigt.
»Sie sind ja total irre«, stellt er fest.
»Das macht nichts. Sie sind ja ein genauso komplett dämlicher Korinthenkacker mit Affinität zum unangebrachten Maßregeln.«
Er schnappt nach Luft und sagt nichts mehr. Seine Gesichtsfarbe wechselt von grau zu weiß.
Gut. Bevor es Verletzte gibt, sollte ich nach Hause fahren und Apotheke Apotheke sein lassen. Schade. Kopfschmerztabletten wären gut gewesen. Jetzt sofort.
Louisa hält sich die Hand vor den Mund und versucht, ihr Lachen zu verstecken, als ich wieder einsteige. Der Typ steht mit offenem Mund da und schaut zu, wie ich ihm davonfahre.
»Wir könnten die andere Apotheke nehmen, wenn du möchtest«, schlägt meine Kleine vor. Ich zucke die Achseln und biege auf die Straße ein.
»Kommt drauf an, welches Lied gespielt wird«, antworte ich und stelle das Radio wieder an.
Drei Tage später, am 3. Januar, sitze ich gerade an einer Kurzgeschichte und grüble über Grammatik nach, als es an der Haustür klingelt. Vergnügt springe ich auf und hüpfe aus dem Büro. Ich erwarte eine Büchersendung, die ich kaum erwarten kann. Jonas ist schneller als ich und nimmt ein Einschreiben vom Postboten entgegen.
»Kein Paket?«, murre ich und stelle fest, dass mir Jonas’ Gesichtsausdruck nicht gefällt. Die Freude über das Erscheinen des Postboten verpufft gänzlich.
»Was ist los?«, frage ich nervös, und er hält mir das Schreiben entgegen.
»Unfall mit Fahrerflucht? Kannst du mir etwas dazu sagen?« Seine Stimme ist rau. Und mir schießt sofort der Silvestertag durch den Kopf.
»So ein Mistkerl. Der hat mich angezeigt?« Ich stoße ein freudloses Lachen aus und versuche, die Einzelheiten des Zusammentreffens mit Mister Unsympathisch zu rekonstruieren. »Es gab keinen Unfall. Ich habe einem Typen an der Ampel aus Versehen die Vorfahrt genommen, aber es ist gar nichts passiert. Das schwöre ich«, ereifere ich mich und versuche, das Schreiben zu entziffern. Die dämlichen Buchstaben tanzen alle durcheinander und lassen sich nicht in eine sinnvolle Reihenfolge bringen.
»›Gar nichts passiert‹ kann ja nicht sein«, sagt Jonas gedehnt. »Hier ist von einem Auffahrunfall die Rede, am 2. Dezember des letzten Jahres.« Ich werde hellhörig. 2. Dezember ist nicht 31. Dezember.
»Wo steht das denn zum Teufel?«, quieke ich, und Jonas deutet auf eine Zeile.
»Hier steht, dass du den Unfallort einfach verlassen hast, ohne dem Unfallgegner deine Personalien mitzuteilen.«