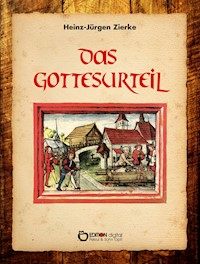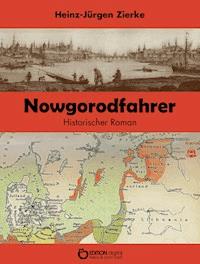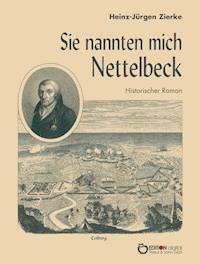4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Schritte, tapp tapp, tapp tapp. Nicht laut, aber deutlich vernehmbar, vierfüßig, wenn er sich nicht täuschte, und ganz in der Nähe, vielleicht hinter der Bohlenwand. Ein unverständliches Wispern begann, mal dumpf, mal glucksend, dann stöhnend, als würgte der Teufel seine Großmutter, und löste sich in einem verhaltenen Schrei …! Unheimlich, gespenstisch, Schauder erregend, aber nicht ohne Humor und Ironie geht es zu in diesen wundersamen Geschichten. Pommern und die Uckermark haben da allerhand zu bieten: Ein Teufel macht in der Gestalt eines hübschen Mädchens dem starken Geschlecht ganz schön zu schaffen, Ferdinand lässt sich von einem Männchen mit einem großen Hut helfen, eine Frau ohne Kopf erscheint und ein uralter, steingrauer Wels, dem Merkwürdiges widerfährt, taucht auf. Aber nicht nur in der Vergangenheit spukt es, auch die Gegenwart ist nicht frei von makabren Ereignissen, lässt uns Heinz-Jürgen Zierke wissen. Eine Äbtissin macht einem Dienstreisenden Angst, auf Schloß Spyker stören dunkle Gestalten eine Schulung, und schließlich geht es um viel Geld, einen Besenbinder und - um Spucke in einer Spuk- und Spuckgeschichte an einem nicht näher bezeichneten Ort. Manche Stadt und manches Dorf allerdings finden deutliche Erwähnung. Und so kann der geneigte Leser überprüfen, ob dergleichen Un-Heimlichkeiten auch heute noch stattfinden in: Stralsund, Tribsees, Voigdehagen, Rom, Lübz, Parchim, Abtshagen, Gornow, Wildenbruch, Jamund, Torgelow, Saal, Damgarten, Putgarten, Sagard, Arkona, Jatznick, Kölzow, Stolzenburg, Pasewalk, Greifenberg, Prenzlau, Woldegk, Neubrandenburg, Fürstenwerder, Ueckermünde und auf Schloß Spyker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Heinz-Jürgen Zierke
Spuk auf Spyker
Wundersame Geschichten
ISBN 978-3-95655-288-5 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1998 im Hinstorff Verlag Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Der Teufel als Mädchen
Nicht weit von Stralsund, in südliche Richtung geschaut, lag ein Gütchen, das nicht eben sehr groß war, aber seinem Besitzer ein sorgenfreies Leben gestattete, wenn auch kein solches, wie es in seinen Kreisen üblich war. Der Herr gab weder Bälle noch rauschende Feste; er trank auch nicht, spielte nicht und wettete nicht auf Pferde, ja, nicht einmal im Lotto. Dafür plagte ihn eine andere Leidenschaft, für die er freilich kaum Geld aufwendete: Er stieg den jungen Mädchen nach, die er mit feurigen Augen und sanften Worten leicht zu gewinnen wusste.
Wie gesagt, diese Leidenschaft kostete ihn wenig, da er sie nicht an Damen oder solche, die sich dafür ausgaben, verschwendete. Er suchte sein Vergnügen lieber bei prallen Bauerndirnen. Da er aber mit den Jahren die Mädchen seines Hofes und die des nahen Dörfchens nur allzu gut kannte, dachte er eines Tages daran, sich in der Umgebung umzuschauen. Mädchen sind ja wie Unkraut, sie wachsen immer wieder nach. Pflückt man eine Blüte, sprießt schon die nächste Knospe. Er befahl also seinem Leibknecht Franik, das Coupé im Schatten der uralten Eiche bereitzustellen.
Franik - ein seltsamer Name für unsere Gegend. Der Herr hatte ihn aus der Kaschubei mitgebracht, wie er sagte. Er war einige Zeit in der fernen Stadt Bütow in Garnision gewesen, bevor er seines angegriffenen Herzens wegen den Abschied nehmen durfte. Franik - seinen Burschen, der ihn unermüdlich mit geübtem Blick auf die Schönheiten der Landschaft aufmerksam gemacht hatte, löste er beim Regiment aus und behielt ihn als Knecht.
Franik bürstete die Polster der Kutsche, denn sein Herr bekam vom Staub leicht das Niesen, spannte an und fuhr vor. Der Junker stieg ein und prahlte: „Das erste Weib, das uns über den Weg läuft, ziehe ich mir in den Wagen.“ Sprach’s, lehnte sich genüsslich zurück und nickte ein.
Sie waren kaum eine Viertelstunde gefahren, als ihnen eine Frau entgegenkam. Die Jüngste war sie wohl nicht mehr. Herbe Falten kerbten das Gesicht, und ein grünes Kopftuch versteckte die grauen Fäden in dem aschblonden Haar. Sie zog am Strick eine braunbunte Ziege hinter sich her, mit der sie zum Bock wollte.
Franik weckte den Schlafenden: „Herr, die erste Frau.“ Der Angesprochene schreckte hoch , rieb sich die Augen, sah die Alte, schlug beide Hände vors Gesicht und schrie: „Pfui, die alte Hexe! Gib den Pferden die Peitsche, Franik!“
„Frau ist Frau, Herr.“
„Für dich vielleicht. Hast selber keine Zähne und magst am Gepökelten lutschen. Ich aber will Frischfleisch, Frischfleisch.“ Wieder lehnte er sich zurück.
Sein Wunsch erfüllte sich. Ein junges Weib mit flatternden Haaren, geröteten runden Augen und prallen Lippen kam den Weg entlang. Ihr Atem ging schwer; sie hatte eine gehörige Last zu schleppen, die ihres eigenen Körpers.
„Herr, eine Frau! Frischfleisch, Frischfleisch, und gleich die doppelte Portion. Da lohnt sich das Kauen.“
Wieder schreckte der Junker hoch, steckte den Kopf aus dem Fenster und zog ihn gleich wieder ein. „Keine Frau. Ein Mehlsack, Franik, ein Mehlsack. Lass die Zossen laufen!“
„Frau ist Frau“, gab Franik zurück und knallte mit der Peitsche.
„Wenn ich mir die in die Kutsche ziehe, bricht mir das Achsholz.“
Sie zuckelten weiter über den ausgefahrenen Landweg. Die geteerten Achsen ächzten; die rindslederne Federung hielt den Kutschkasten mühsam im Gleichgewicht. Vom nahen Kiefernwald wehte ein strenger Harzgeruch herüber.
Da trat hinter einem Gebüsch aus wuchernden Rotdornsträuchern, das die Biegung des Weges verdeckte, ein wunderhübsches Mädchen hervor, rank und schlank wie eine Erle, biegsam wie eine Haselrute, die Augen leuchteten wie glimmende Kienspäne, die Haut war glatt wie Buchenrinde.
Diesmal brauchte Franik seinen Herrn nicht zu wecken. Der riss beim Anblick des Mädchens die Augen weit auf, das Wasser lief ihm im Munde zusammen; er schnalzte mit der Zunge und leckte sich die Lippen.
„Halt an, Franik! Die ziehe ich mir auf den Schoß und fahre mit ihr in die Jagdhütte.“ Er öffnete den Schlag weit.
Franik, dieser nüchterne Kerl, verspürte ein brenzliches Kitzeln in den Nüstern. Er konnte gerade noch rufen: „Dat Gesicht is söt, awer de Föt, de Föt!“, da setzte die hübsche Fremde auch schon den Fuß auf das Trittbrett, wobei sie den Rock etwas anheben musste. So sah auch der Herr den gespalteten Huf.
Hastig schloss er den Schlag und klemmte dem Teufel den linken Mittelfinger ein.
„Zum Teufel mit dem Teufel!“, rief er schreckensbleich. „Fahr zu, Franik, fahr zu! Wende auf dem Rübenacker und dann nach Hause, an der Voigdehagenschen Kirche vorbei! Ich hab genug von dem Weibsvolk!“
Franik riss an der Leine und drosch auf die Tiere ein. Fast wäre der Wagen bei der jähen Wende umgestürzt. Der Teufel fiel in eine Furche, sprang aber gleich wieder auf. Es gelang ihm, einen Federträger zu packen. Er machte sich klein und ließ sich in seinem schwankenden Versteck in voller Karriere gutswärts kutschieren, wobei er wütend an dem verletzten Finger lutschte.
Kurz vor der Hofeinfahrt verwandelte er sich in eine Pferdebremse und setzte sich auf den Rücken des fahlen Wallachs. Das gequälte Tier schlug wütend mit dem Schwanz; da ihm aber der Herr die Schwanzhaare hatte kürzen lassen, konnte er den Peiniger nicht verscheuchen. Franik hatte Mühe, ihn in seine Box zu bringen.
Der Herr schlich mit schlotternden Knien in seine Kammer, ließ sich eine Kanne Richtenberger bringen und trank, bis er besinnungslos aufs Bett fiel.
Racheschnaubend trieb nun der Teufel im Stall sein Unwesen. Er kroch den Tieren in die Ohren, stach sie unter dem Schwanz und machte keinen Unterschied zwischen Acker- und Kutschpferden. Verzweifelt donnerten die Hufe gegen die Wände. Das wütende Schnauben und das ängstliche Wiehern drangen bis ins Herrenhaus hinüber.
Freilich, wenn einer der Knechte den Stall betrat, ganz gleich, ob es Franik war, der Kleinknecht oder auch nur der Schweinehirte, hörte das Rumoren auf. Betrat aber eine der Mägde den Stall, was selten vorkam, denn Pferdedienst ist Männersache, dann fuhr ihnen der Teufel unter die Röcke und setzte ihnen so zu, dass sie schreiend davonliefen und sich nachher stundenlang kratzen mussten.
Das ging drei Tage lang so. Dann sagte der Leibknecht zu seinem Herrn: „Das ist die Rache für den Teufelsfinger. Wir müssen den Paster holen.“
Der Voigdehäger Pastor kam, schlug in der offenen Stalltür drei Kreuze, betete ein Vaterunser und das lutherische Glaubensbekenntnis, sang das schöne Lied „Freu dich sehr, o meine Seele“ und schlug noch einmal drei Kreuze. Solange der Geistliche auf dem Hofe blieb, und das währte einige Stunden, denn nach seinem anstrengenden Tun musste er ein stärkendes Mahl zu sich nehmen und ausgiebig dazu trinken, vernahm selbst die Großmagd, die sonst das Gras wachsen hörte, keinen Laut aus dem Stall. Kaum aber hatte der würdige Herr die Gemarkung des Gutes verlassen, ging ein Gepolter los, dass man meinen musste, die Pfeiler trügen den Stall nicht mehr und wollten einstürzen.
Zwei Tage später holte man den Pastor aus Tribsees. Der geistliche Hirte einer größeren Gemeinde musste auch eine größere Macht über die Geister haben. Dieser tat nichts anderes als sein Amtsbruder, außer dass er ein anderes Lied sang: „Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeine.“
Man weiß nicht, wie weit die langen Jahre, die der Graukopf seinem Amte schon vorstand, die Freundschaft zum Heiland abgenutzt hatten; auf die Dauer jedenfalls versagte ihm Christus den erflehten Beistand. Der Geistliche blieb der Entfernung wegen über Nacht im Hause und auch noch zum Mittagessen. Es gab gut abgehangene Kaninchenkeulen. Kaum aber hatte Franik das Hoftor hinter ihm zugesperrt, summte und brummte es im Stall, als wäre ein Hornissenschwarm eingefallen, und während die Kutsche den Birkenhain durchfuhr, polterte es so, dass selbst die uralte Eiche vor dem Hause in ihren Wurzeln erbebte. Der Grimmener Geistliche, den man als nächsten bemühte, verschaffte Herrn und Hof auch keine Ruhe, und selbst der Hauptpastor der Stralsunder Marienkirche, der für jeden Satz ein Lot Silber forderte, betete vergeblich.
Der Herr fragte sich in seinen schlaflosen Nächten, ob er das verhexte Gut verkaufen sollte, nahm aber davon Abstand. Das ganze schwedische Pommern wusste von dem Spuk; bis nach Preußen hatte sich die Geschichte herumgesprochen. Er hätte Hof und Land weit unter Wert verkaufen müssen. Der Erlös wäre wohl nicht einmal ausreichend gewesen, um in der Stadt ein angemessenes Leben zu führen, schon gar nicht, anderswo ein Gut zu erwerben, nicht einmal im billigen Mecklenburg. Sollte er sich vielleicht als Verwalter auf dem Besitztum eines Standesgenossen verdingen?
Da brachte Franik eines Abends die Nachricht mit, dass in Abtshagen ein Mann logiere, der sich auf der Durchreise nach Mönkebude befinde, wo er einen Neck bannen solle, der den Hafffischern die Zeesen verknote. Wenn man dem eine Handvoll Silber anbiete, würde er sich gewiss auch mit dem Teufel anlegen.
Der Herr schickte also nach dem Manne, einem hageren Alten, aus dessen faltigen Gesicht borstige schwarze Brauen hervorstachen, die sich wie Schutzdächer über helle, glasige Augen wölbten.
„Woher kommt Ihr, wenn die Frage erlaubt ist?“
„Aus Rom.“
„Aus Rom? Vom Papst?“ Der Gutsherr war ein strenger Lutheraner, sagte sich aber nach kurzem Überlegen, dass die Papisten einige Jahrhunderte mehr Erfahrung in der Teufelsaustreibung hätten.
Der Fremde beruhigte ihn: „Nicht aus Rom im Welschland, sondern aus Rom in Mecklenburg, zwischen Lübz und Parchim gelegen.“
Der Herr staunte: „Ist der heilige Vater aus dem unruhigen Italien in das biedere Mecklenburg geflohen? Hat er auch seine Kardinäle mitgebracht? Müssen wir nun alle katholisch werden, oder wird der Papst lutherisch?“
„Fürchtet Euch nicht, Herr! Seit Urzeiten gab es zweimal Rom in der Welt, jenes südliche und jenes nordische. Als unser Heiland Jesus Christus das Ende seiner irdischen Tage nahe wusste, empfahl er seinen Lieblingsjüngern Petrus und Paulus, Rom zur Hauptstadt der Christenheit zu machen, konnte aber nicht mehr sagen, welches Rom er meinte. Der Heilige Geist, der ihn abführte, hatte es allzu eilig. St. Peter war für das welsche Rom, St. Paul für das deutsche. Petrus obsiegte.“
„Traut Ihr Euch dennoch, es mit dem Teufel aufzunehmen?“
„Wenn auch mein heimatliches Rom nicht Hauptstadt des Glaubens geworden ist, so verfügen doch seine Einwohner, sofern sie von den ersten Siedlern des Ortes abstammen, über geheime Kräfte, von denen ich schweigen muss, damit sie sich nicht verflüchtigen. Ans Werk also.“ Der Hagere trat vor die Stalltür und riss sie auf. Sofort trat drinnen Ruhe ein. Er hob die Hand und schlug ein paar Figuren, nein, Kreuze waren es nicht, meinte Franik später. Dann hob er den Kopf, als wollte er in den Wolken Zeichen lesen, senkte ihn, wie um mit den Blicken Löcher in die Erde zu bohren, bis zur Hölle hinunter, murmelte etwas in einer Sprache, die niemand kannte, nicht einmal Franik, und sagte mit erstickender Stimme: „Wollt Ihr des Teufels ledig sein, so müsst Ihr die Eiche vor Eurem Hause fällen.“
Der Gutsherr erbleichte. „Es ist ein alter Weisspruch: Wenn die Eiche fällt, brennt das Haus.“
„Pappperlapp! Spökenkiekerei! Wollt Ihr Ruhe, müsst Ihr die Eiche fällen, Wurzeln und Krone entfernen und den Stamm der Länge nach in fünf gleiche Teile zersägen, mit eigener Hand, versteht sich.“
„Mit eigener Hand? Das ist unmöglich.“
„Franik mag Euch helfen, kein anderer. Legt die fünf Balken zu einem Fünfeck vor die Stalltür, zu einem Drudenfuß.“
„Drudenfuß? Das ist Teufelswerk.“
„Dem Bösen kann man nur mit Bösem beikommen.“ Sprach’s, ließ sich das versprochene Silber in die Tasche schütten und stakste davon. In Abtshagen ward er nicht mehr gesehen.
Am Morgen machten sich Herr und Knecht ans Werk. Fünf volle Tage brauchten sie, den Baum zu fällen und den Stamm zu teilen. Dem Herrn wuchsen blutige Schwielen an den Händen, aber er ließ nicht nach, denn im Pferdestall rumorte und polterte es ärger als zuvor. Die Tiere waren schon so schwach, dass man sie nicht einmal mehr vor einen Kutschwagen spannen konnte.
Nun machten sie sich daran, die Kloben an der vorgesehenen Stelle zurechtzulegen. Der Rücken schmerzte, die Arme erlahmten, die zerschrammten Hände versteiften sich; der letzte Balken entglitt dem Herrn. Franik konnte ihn allein nicht halten. Die scharfe Kante traf seinen linken Fuß, der sich grün und blau verfärbte und anschwoll wie ein Elefantenbein. Der Knecht stöhnte schwer und schlug lang hin. Wie ihn der Herr auch rüttelte und schüttelte, Franik kam nicht wieder zu sich.
Der Herr rief den Kuhknecht, der den Ohnmächtigen auf eine Schubkarre lud und ihn nach Bartmannshagen zur Kräuterhexe karrte.
Unter Ächzen und Fluchen rückte und schob der Junker den Balken auf seinen Platz. Niemand half ihm, denn niemand durfte ihm helfen.
Der Mond hing schon über den Weiden, die die Bäk säumten, da war das schwere Werk endlich getan. Der Lärm im Stall ebbte allmählich ab. Der durstgeplagte Herr verlangte nach einem Krug Bier. Er hatte ihn noch nicht ausgetrunken, als er das Karrenrad quietschen hörte. Der Kuhknecht kam zurück, allein. Die Kräuterhexe hatte Franik bei sich behalten, um ihn zu kurieren. Todmüde sank der Herr auf sein Lager, ohne auch nur die Stiefel auszuziehen.
Alten Weissagungen sollte man nicht zuwiderhandeln. Noch in dieser Nacht, genauer: eine Stunde nach Mitternacht, schlug eine helle Lohe aus dem Dach. Bis zum Morgengrauen brannten Haus und Stall nieder; Scheunen, Schuppen, Herr und Gesinde, Getier und Gerät, alles fraßen die gierigen Flammen. Keine Spur blieb übrig, nicht einmal ein verkohlter Balken. Die Asche verwehte der Wind, den Rest spülte der mit dem Frühlicht einsetzende Regen fort. Heute weiß niemand mehr, wo das Gut einst gelegen hat. Selbst der Name des Herrn ist vergessen.
Der alte Franik hätte wohl beides verraten können. Er war ja nicht im Hause gewesen und also auch nicht mitverbrannt. Da er aber dank der Kunst der weisen Frau den verletzten Fuß am Morgen wieder aufsetzen konnte, humpelte er, als er von den Geschehnissen der Nacht erfuhr, zurück in seine kaschubische Heimat. Und wie sollen wir ihn dort erreichen?
Der Schneider Plück
Auf einem Hügel unweit des Dorfes stand eine Mühle, in der nur der Müller und seine Tochter wohnten. Er hätte gern einen Gesellen und an diesem zugleich einen Eidam gehabt, der ihm im Gewerbe nachfolgen konnte, denn das stete Heben der schweren Säcke hatte seinen Rücken vorzeitig gebeugt. Aber es fand sich niemand, der es länger als zwei oder drei Tage in der Mühle aushielt, denn in dieser ging ein Spuk um, der „der Schwarte“ genannt wurde, welcher die zugewanderten Müllerburschen nicht nur böse erschreckte, sondern ihnen auch derbe Püffe und Maulschellen verabreichte. So mied alles, was Gerstenkleie von Haferschrot unterscheiden konnte, Mühle und Ortschaft.
Eines Abends klopfte doch ein Wanderbursche den Müller heraus.
„Gott schütze das ehrsame Handwerk!“
„Bist du ein Müllerbursche?“
„Nicht Arbeit suche ich, sondern ein Nachtquartier.“
Der Müller sah den Ankömmling misstrauisch an. Er machte einen ganz braven Eindruck, war aber nicht eben kräftig und also keine Hilfe in der Mühle, schon gar nicht gegen den Schwarten. Doch er mochte ihn nicht in die finstere Nacht hinausschicken. Wenn der Spuk dem Fremden etwas antat, so war es nicht sein Fell, das gezaust wurde.
„Ja, wenn du keine Angst hast.“
„Angst? Ich? Ich bin ein Schneider, Mann. Wovor sollte sich ein Schneider fürchten!“ Er stellte sich in Positur, zog die Elle aus dem Stiefelschaft und zeigte ein paar Fechthiebe.
Der Müller kannte die Mär von dem tapferen Schneiderlein, das Riesen, Einhörner und andere Ungeheuer bezwungen hatte. Dieser aber sah eher aus, als ob ihn die sieben Fliegen, die er erschlagen wollte, mit ihren Flügelschlägen vom Tisch wedelten.
„Und wie willst du Quartier und Frühstück bezahlen?“
„Mir Kornsäcke auf den Rücken zu laden, das kannst du nicht von mir verlangen; ich bin kein Esel. Wenn Ihr mich nicht um Gotteslohn beherbergen wollt, so kann ich Euch die Hosen flicken oder aber Eurer Tochter Rock und Mieder weiten, auf die feinste französische Art, so wahr ich der Schneider Plück aus Gornow bin.“
Mit dieser Antwort wusste der Müller nichts anzufangen. Weder den einen noch den andern Namen hatte er je gehört. Landkarten waren damals im Pommernland noch nicht verbreitet, und selbst wenn er eine besessen hätte, wäre schwerlich das Dörfchen hinter dem Walde eingezeichnet gewesen, zumal es jenseits des Oderstromes lag, in einem Landstrich also, von dem jeder rechte Vorpommer meinte, dort lebten Hunnen und Tatern.
„Nun ja“, meinte der Müller zögerlich, „ich sage dir aber, in meiner Mühle spukt es. Ich schlafe deswegen schon im Pferdestall auf der Häckselkiste, aber der Platz reicht nicht für zwei.“
„Ach was“, entgegnete der Schneider leichthin, „gegen Spuk bin ich gefeit, zweifach sogar. Erstens, weil ich ein Schneider bin. Wie ihr wisst, sitzen wir Schneider mit gekreuzten Beinen auf dem Arbeitstisch, und das Kreuz hilft gegen alle bösen Geister. Fragt Euren Priester!“
Der Hausherr hob zweifelnd die Schultern. „Und zweitens?“
„Das ist eine lange Geschichte. Wenn ich die erzählen soll, muss ich mich setzen, und ohne eine Kruke Bier und einen Knust Brot, der ohne Speck allzu nackt aussieht, fallen mir die rechten Worte nicht ein.“
Also führte der Müller, froh, in dem Spukhaus Gesellschaft zu haben, den Schneider in die Küche, setzte ihm zu essen und zu trinken vor und ließ ihn erzählen.
„Ich stamme, wie gesagt, aus Gornow. Das ist ein von Christus und allen Heiligen gesegneter Ort, wo aus purem Sand die Gerste so hoch wächst, dass sich ein Hirsch darin verstecken kann. Vor Zeiten aber war dieser Fleck ein wüster Dreesch, auf dem nur Brennnessel und Zinnkraut gediehen. Dafür lag weiter westlich eine reiche Stadt, deren Bewohner eine prächtige Kirche erbaut und drei wohltönende Glocken in den Turm gehängt hatten. Sie trieben Handel mit der halben Welt, bis nach Vineta hinauf, und wurden reich und reicher, einige jedenfalls. Aber wie das bei den Reichen so geht, sie vergaßen über ihrem Geld bald Jesum und Christum. Zuletzt beteten sie statt des Kreuzes eine uralte Eiche an, die unweit der Toreinfahrt die Stadtmauer überschattete.
Dieser Baum war aus einer Eichel entsprossen, die der Brudermörder Kain, als ihn der Erzengel aus dem Paradies scheuchte, heimlich eingesteckt und auf seiner unsteten Wanderung an eben dieser Stelle aus einem Loch in der Hosentasche verloren hatte.
Der Schöpfer bewies lange Geduld. Als die Städter aber einen Priester, der sie an ihre Christenpflicht mahnte, an jener Eiche aufknüpften, geriet er außer sich. Er schmetterte die Faust auf die nächste Wolke. Ein Donnerwetter brach hernieder. Ein Regenschwall überflutete die Straßen, füllte die Keller, unterwühlte die Fundamente, und die Stadt mitsamt ihren Bewohnern, mit Hunden und Hühnern, mit Kühen und Kellerasseln versank im unergründlichen Schlamm. Nur die Kirchturmspitze stach ein wenig daraus hervor, vom tiefen Wasser des neu entstanden Sees umspült. Die Glocken blieben unversehrt. Wenn man in den Zwölften um Mitternacht durch den Wald geht, kann man sie läuten hören, noch heute.
Nicht alle Bewohner der Stadt ertranken elendiglich. Etliche Kaufleute waren in Geschäften unterwegs. Als sie bei ihrer Rückkehr statt ihrer Stadt einen abgrundtiefen See vorfanden, kauften sie für das auf der Reise gewonnene Geld Äcker, Wiesen und Vieh, bauten Häuser, suchten sich Frauen unter den Töchtern des Landes und wurden Bauern. Ihr Dorf nannten sie Wildenbruch.“
„Nie gehört“, sagte der Müller und schaute angestrengt aus dem Fenster.
„Ärmere Bürger hatten im nahen Wald Strauch zu Brennholz gezogen und ihre Frauen und Kinder nach Beeren und Pilzen geschickt. Sie zogen ostwärts und machten mit Fleiß und Schweiß den öden Dreesch urbar, den sie Gornow nannten.“
Der Müller rutschte auf seinem Stuhl unruhig hin und her. Der Schneider erzählte unbeirrt weiter.
„Jedes Jahr am Johannistag befällt die Glocken der versunkenen Stadt eine unbezähmbare Sehnsucht nach Sonne. Dann ruft die eine den andern zu: Anne Susanne, kumm mit mi to Lanne! Die andern zieren sich ein wenig, auch in gereimten Sprüchen, denn Glocken reden nur in Reimen, dann aber schwingen sie sich ans Ufer und aalen sich in dem wärmenden Schein. Aber nur ein Sonntagskind kann sie sehen. Wir andern halten sie für unförmige graue Steine.
Eines warmen Johannistages badete ein kleines Mädchen in dem klaren Wasser des Görensees. Da es kein Sonntagskind war, erkannte es die Glocken nicht und legte achtlos sein Hemdchen zum Trocknen auf einen der Steine. Das Hemd gehörte aber seiner an einem Sonntag geborenen Schwester. Unter diesem Sonntagsmädchenhemd verwandelte sich der grüngraue Stein wieder in eine goldglänzende Glocke. Weinend lief das Mädchen, nackt, wie es war, heim nach Gornow, um den Verlust des Kleidungsstückes zu beichten.
Der Widerschein der Sonne, die sich in dem glänzenden Metall spiegelte, weckte die Gier der Wildenbrucher Bauern, die Langholz aus dem Walde abfuhren. Sie lösten die schweren Schleppketten von den Baumstämmen, schlangen sie um die Glocke und ließen die Pferde anrucken. Hüh, hoh! Doch wie sie die Tiere auch mit den Peitschen traktierten, das kostbare Fundstück rührte sich nicht. Ein zweites Gespann wurde herbeigeholt, ein drittes, zuletzt versuchten sich zwölf Pferde. Vergeblich. Die Ketten sprangen, aber die Glocke stand wie angenietet an ihrem Platz. Die Bauern gaben auf und zogen fluchend ab.
Die Gornower hatten dem weinenden Mädchen zuerst nicht glauben wollen, waren ihm aber dann doch neugierig gefolgt. Als die Wildenbrucher wegfuhren, meinte der Vater des Mädchens, es müsste wohl eine Bewandtnis haben, dass seine Tochter die Glocke erlöst hätte. Da er kein Zugvieh besaß, lieh er sich zwei klapperdürre Ochsen; prallgefütterte Pferden gab es in ganz Gornow nicht. Kaum hatte er die Tiere vorgespannt, löste sich die Glocke auch schon vom Wiesenboden und ließ sich so leicht den Sandweg hinauf nach Gornow ziehen, als glitte sie über grüne Seife.