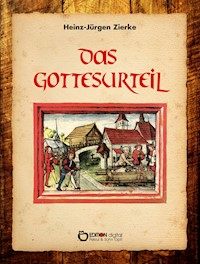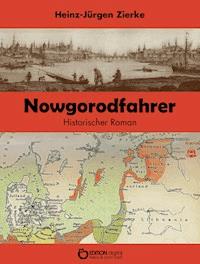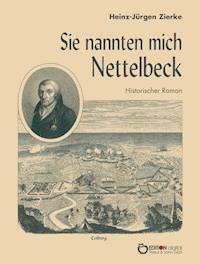6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ich bin’s“, sagt Martin ganz unbefangen, als der alte Latotzki ihn fragt, ob er denn der Mann sei, der einen ganzen Betrieb auf den Kopf stellen könne. Der Alte hat sich neben ihn gesetzt, obwohl noch genug andere Plätze frei sind. Martin ist der Neuling in dem alten Bus, der über Land durch den Kiefernwald fährt. Er kennt Latotzki nicht und auch nicht das hübsche Mädchen Doris, das seine eigenen Absichten verfolgen wird. Er kennt hier niemanden, jedoch werden sie alle ihn kennenlernen. In seiner Aktentasche steckt mit dem Diplom der in den Umrissen vollendete Plan eines Umbaus: er will das alte, aber fehlerfrei funktionierende Werk automatisieren. Es ist sein Lebensplan. Er kennt das Leben noch nicht, wie es ist und sein soll. In seiner Tasche steckt aber auch noch ein Schnitzmesser, das er immer dann hervorholen wird, wenn er sich nicht zu helfen weiß. Mit dem Bären aus Pappelholz, der dabei entsteht, hat es seine besondere Bewandtnis. Nach Jahr und Tag wird Martin in seiner Kate Besuch bekommen. Der Werkleiter wird den Bären sehen, aber auch schon das Modell eines modernen Betriebes. Er ist nachdenklich geworden wie so mancher in diesem Werk hinter dem Walde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Heinz-Jürgen Zierke
Eine Chance für Biggers
ISBN 978-3-95655-276-2 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1970 im VEB Hinstorff Verlag Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Pünktlich um halb eins traf der Triebwagen in Stecklin ein. Martin hob den Koffer aus dem Gepäcknetz, schlenderte pfeifend über den Bahnsteig, wartete geduldig, bis sich die Menge durch die Sperre gedrängt hatte, sah sich in der niedrigen Halle nach den Fahrplänen des Kraftverkehrs um und trat auf den Bahnhofsvorplatz hinaus, von wo der Werkbus nach Pötterdiek fahren sollte.
Pötterdiek, der entscheidende Schritt! dachte er, und gleich darauf: Unsinn, drei Stufen Bahnhofstreppe und zwölf Meter Kopfsteinpflaster! Er hasste große Worte.
Das Spannbetonwerk Pötterdiek kannte er vom Papier her genau, in der Praxis aber nicht besser, als man es nach einer zweistündigen Betriebsbesichtigung kennen kann, von der zudem vierzig Minuten einem Referat über die Bedeutung der Spannbetonmastenherstellung für die Beleuchtung sozialistischer Verkehrswege gehört haben.
Exkursion hatte Esebeck, der Direktor der Fachschule, diese Veranstaltung genannt, derselbe Esebeck, der laut auflachte, als er ihm mitteilte, nicht nach Berndshof werde er gehen, sondern nach Pötterdiek.
„Das konnte ich mir denken, Biggers. Das modernste Werk der Republik, eine Freude, dort zu arbeiten. Aber nicht Sie! Sie waren in Berndshof im Praktikum, Sie schreiben Ihre Abschlussarbeit über Berndshof; übermorgen in vierzehn Tagen kommt der Direktor und bringt die Vorverträge mit. Jetzt können Sie gehen.“ Martin hatte nach Pötterdiek geschrieben und nach einer Woche eine Zusage erhalten. Was Berndshof betraf, so kam ihm der Zufall zu Hilfe: Berndshof stellte die Produktion von Schwerbetonfertigteilen ein. Esebeck trommelte mit den Fingerknöcheln auf die Schreibtischplatte, als er Martins Vorvertrag mit Pötterdiek gegenzeichnete. „Verdient haben Sie’s ja eigentlich nicht!“
Und er schrieb in Martins Abschlusszeugnis: „Biggers kann bei seinen Fähigkeiten noch mehr leisten, wenn er bestimmte, sich nachteilig auf sein Gesamtverhalten auswirkende charakterliche Mängel überwindet.“
„Der soll noch an mich denken!“, sagte Martin, als er in den Bus kletterte.
„Recht so, lass dich nur nicht unterkriegen!“ Der Mann mit dem Rucksack, der mit ihm an der Haltestelle gewartet hatte, setzte sich an seine Seite. Martin sah mit einem kurzen Blick das braungraue dünne Haar des Nachbarn, der Mützenrand hatte sich in die Stirn eingedrückt, eine gerade fleischige Nase, einen etwas eingefallenen Mund, ein rasiertes, aber bartdunkles Kinn. Er sah die Hände, die den Rucksack auf den Knien hielten, kurze, kräftige Finger mit breiten Kuppen und horniger Haut, Maurerhände.
Martin, der nicht zu einem Gespräch aufgelegt war, nickte nur kurz, dann sah er aus dem Fenster: So hatte er sich die Taiga vorgestellt, damals. Die letzten Häuser der Kreisstadt, flachdachige Einzelhäuser, standen schon verloren zwischen hohen kahlen Stämmen, die dürre Kronen trugen. Und dann begann der Wald, Kiefernwald, märkische Heide, märkischer Sand, ein paar Birken am Wegesrand, hin und wieder verkrüppeltes Unterholz, zur Abwechslung eine Sumpfwiese mit einem schwarzen Graben.
„Es ist einsam bei uns“, sagte der Nachbar und rückte den Rucksack auf den Knien zurecht, „aber nicht das Dorf, das ist wie eine kleine Stadt, es ist alles da, was wir brauchen, mehr noch: jede Woche Kino im Kulturhaus. Aber wer geht da schon hin, du weißt ja, das Fernsehen. Freilich, ihr jungen Leute ... Wenn du ins Theater willst, fährst du in die Kreisstadt, jeden vierten Donnerstag im Monat. Tanzen kannst du im Herbst auf dem Betriebsfest und im Februar auf dem Feuerwehrball. Öfter lohnt es sich auch nicht; junge Leute halten sich nicht bei uns. Hast du Kinder?“
„Ich bin allein.“
Die Straße trat aus dem Wald hervor. Die Felder waren weit wie eine Steppe.
„Lässt sich denn hier kein Fenster aufmachen?“
Martin sah sich um. Zwei Bänke zurück saß ein Mädchen mit kurzem dunklem Haar und einem rundlichen Gesicht. Es blies den Atem gegen die Augenbrauen und tupfte sich mit einem Taschentuch die Stirn. Ihre Hand war ungewöhnlich groß, es sah aus, als flüstere sie hinter ihr mit geschlossenen Lippen.
Martin drehte sich wieder um.
„In welcher Abteilung fängst du an?“
Er musste antworten, der Alte würde doch keine Ruhe geben. „Mal sehen!“
„Kannst dir wohl den Arbeitsplatz aussuchen? Hast gute Freunde, wie?“
„Ach was, ich habe mir da nur so einiges ausgedacht für die Technologie - ich gehe natürlich in die Technologie.“
„Soso, hast also studiert, bist ein unruhiger Kopf, wie? Unser Werk - na, das wirst du schon wissen, die nehmen nämlich nicht jeden bei uns.“
Martin blies gegen die Scheibe, die sofort beschlug, und wischte sie wieder blank. Draußen war nichts zu sehen als Kiefernwald, einmal eine Lichtung und hinter einem Gartenzaun aus Reisiggeflecht ein schilfgedecktes Häuschen, dann wieder hohe borkige Stämme und am Boden Blaubeersträucher.
Er war neugierig auf das Werk, nicht wegen des Kulturhauses oder wegen der fast städtischen Einrichtungen, er freute sich auf die Arbeit. Endlich durfte er zeigen, dass er etwas leisten konnte, mit eigener Kraft. „Gesamtverhalten ..., charakterliche Mängel ...“, ach was, in der Praxis hatte allein die Leistung zu gelten. Der Wald lichtete sich und gab den Blick frei auf einen blassblauen See.
„Kann man baden in Pötterdiek?“
„Bis zum See gehst du vom Dorf aus eine halbe Stunde. Oder hast du ein Auto?“
„Na, so hoch ist das Stipendium ja auch wieder nicht gewesen.“
„Du bist doch nicht von der Schulbank zum Studium gegangen?“
„War zwei Jahre beim Industriebau.“
„Hast also Geld verdient.“
„Für Unterkunft, Essen, Wäsche und Bücher. Die Bücher liegen noch bei den Wirtsleuten in der Bodenkammer.“
„Hast du keine - ach ja, du bist allein. Der Wald ist das Schönste hier. Ohne den Wald würden wir umkommen vor Staub und Sand. Und jetzt schlagen wir ihn Morgen für Morgen, denn er steht auf Kies. Wir könnten ja tiefer gehen, aber da ist der Sand zu fein. Schade! Die ausgebeuteten Flächen forsten wir natürlich wieder auf. Aber bis so ein Baum heranwächst! Das geht nicht so schnell wie beim Menschen. Oder man pflanzt Pappeln. Doch die geben keinen Wald. Übrigens brauchst du nicht zum See zu gehn, wenn du baden willst. Wir haben ein Schwimmbecken gebaut, wo früher die alte Lehmgrube war, der Pötterdiek. Für mich wäre das freilich nichts, man hockt da zu eng aneinander. Ich an deiner Stelle ginge zum See. Man legt sich ins Gras oder unter die Bäume und schaut auf das dunkelgrüne Wasser, sieht den Haubentauchern zu, den Blesshühnern, Libellen stehen überm Schilf, Störche treiben über die Wiese, der Rohrspatz schimpft, und hoch oben kreist die Gabelweihe. Du kannst auch in den Wald gehn, schmale Pfade zwischen Moos und Farnkraut. Hast du mal ’ne Eule aus dem Tagschlaf aufgeschreckt? Wie sie sich duckt und die Flügel spreizt, als wollte sie sich auf dich stürzen! Ach, was weißt du schon, du Stadtmensch!“
Das Mädchen mit dem rundlichen Gesicht beugte sich vor. „Sie sieht man aber niemals am See, Herr Latotzki. Und ich würde so gern mal mit Ihnen um die Wette schwimmen!“
„Als ich noch ’n Junge war, Doris, und auch später noch, als junger Mensch, da hatte ich keine Zeit, am Wasser rumzuliegen. Mein Vater war Pferdeknecht und ich der einzige Junge unter den fünf Kindern. Aber wir hatten einen wunderschönen See, dicht am Dorf, und mittendrin ’ne Insel aus Mummeln, am Ufer Kalmus und Binsen. Wisst ihr, wie Kalmus riecht? Ist auch gut gegen Krankheiten. Nachts, wenn der Pächter schlief, hab ich manchmal geangelt. Bei Vollmond waren auf der Mummelinsel Jungfrauen, aber ich konnte doch nicht schwimmen, ich hab’s auch später nicht gelernt. Was soll ich da jetzt am Badestrand? Soll ich mich mit den Dreijährigen im Flachen balgen? Ich geh in den Wald, da merk ich nichts von euerm Lärm.“
Martin hörte nicht mehr zu. In der Kurve sah er hinter einer Schonung die graue Esse eines Heizhauses aufragen. Er beugte sich vor und legte sein Gesicht an die Scheibe, als käme er so schneller an das Werk heran. Aber die Straße wandte sich wieder nach der anderen Seite, und sein Blick traf nur noch Schafgarbe und Disteln im Graben, ein bleiches Roggenfeld und einen schwarzblauen Wald am Horizont.
Fast am Ziel, dachte er, und es befiel ihn eine seltsame Unruhe. Er streckte die Hand nach dem Koffer aus, um den Heftdeckel herauszunehmen, der ganz oben lag; er hatte Lust, mit den Fingern über die Zeichnung zu streichen und die Vertiefungen zu betasten, die seine Hand in das Papier gedrückt hatte. Latotzki legte ihm die Hand auf den Arm. „Nächste Haltestelle erst!“
Das Mädchen stieg am Dorfanger aus.
Das Werk lag seitab.
„Hier rechts! Dort aus den Kiefern siehst du jetzt den Schornstein aufsteigen. Schwer zu sehn gegen die Sonne. Wenn wir um den Kussel herum sind, siehst du die Zementsilos ..., da! Und dort die Schlosserei und die Bewehrungswerkstatt. Was so wie ein Hochhaus ohne Fenster aussieht, ist der Mischturm, unser Stolz, weißt du, Automatik! Der dicke Klotz daneben: die Fertigung; die Sozialgebäude und Baracken kannst du von hier aus nicht sehn.“
„Alles ein bisschen grau ...“
„Grau, sagst du? Grau? Komm erst mal hin! Da sind mehr Farben, als es Namen dafür gibt. Grau! Eine Wiese sieht von Weitem auch bloß grün aus, aber wenn du barfuß durchs Gras gehst - komm erst mal hin! Dort hinten das dunkle Gebäude, das ist das Kieswerk, sieben Stock, noch höher als der Mischturm. Dort musst du dann mal raufsteigen. Wenn das Werk vor dir liegt, unter dir - von allen Seiten drängen sich die Hallen an den Mischturm, als wollten sie ihn hochheben. So ungefähr muss das der Herrgott gefühlt haben, damals am sechsten Tage, bei der Gütekontrolle, so wie’s geschrieben steht: Und er sah, dass es gut war.“
„Ja, ja, ich werde mir das alles schon noch genau ansehen, so aus der Nähe.“
„Und was sagst du jetzt, auf den ersten Blick?“
„Daraus lässt sich noch was machen - da muss nur der Richtige kommen.“
Die stumpfen Finger klopften irgendeine Melodie auf die breiten Riemen des Rucksacks. „Und der bist du wohl?“
„Erraten!“, sagte Martin ernst, „ich bin’s.“
Der Bus bog ab, schaukelte an der Rampe vorüber, an der eine lange Reihe Zementwaggons stand. Staub wirbelte auf, grauer Staub. Sie überquerten das Gleis, wurden fast vom Sitz geschleudert. Latotzki schimpfte, eine Frau lachte, ein Mann stieß einen Pfiff aus, Martin hielt sich an der Rücklehne des Vordersitzes und stieß doch mit dem Kopf heftig gegen die Scheibe. Er spürte den Schmerz nicht gleich, die Aufregung war zu groß, der Puls klopfte ihm in den Schläfen. Er fand sich selbst albern wie ein Mädchen vor der ersten Tanzstunde.
Der Pförtner schob die Brille hoch und nickte ihnen zu. Einen Ausweis verlangte er nicht; er nahm wohl an, dass Martin zu Latotzki gehörte, und den kannte er, den brauchte er nicht zu kontrollieren.
Martin stand auf dem Werkhof und fühlte sich klein neben den haushohen Stapeln von Dachplatten. Ein beladener Lastwagen streifte ihn fast. Er sprang zur Seite. Der Fahrer lachte. Aber die Befangenheit dauerte nicht lange. Er stellte den Koffer ab, reckte sich, fuhr dann mit den Fingerspitzen über die harten Betonplatten. Er sah zu, wie die Lasthaken der Traverse die Platten wie spielend packten und anhoben, und da dachte er wieder an seine Zeichnungen. Doch als er den Kopf wandte, um den Weg der Platten zu verfolgen, erinnerte ihn ein ziehender Schmerz daran, dass er mit der Stirn gegen die Scheibe geprallt war.
Latotzki zog ihn weiter. „Komm, da ist schon jemand, der dich ins Büro bringen kann, ich muss nämlich nach der anderen Seite, in die Schlosserei. - Stefanie!“
Ein Mädchen, in der einen Hand einen Arbeitsschutzhelm, in der anderen zerknittertes Papier, kletterte über einen Haufen gerissener Maste.
„Stefanie, nimm den jungen Mann mit zur Verwaltung. Aber sieh dich vor, das ist ein unruhiger Geist, ich glaube, der will das Werk auf den Kopf stellen.“
Martin, der ja den Weg kannte, folgte gehorsam dem Mädchen.
Stefanie drängte: „Meine Schicht fängt gleich an.“
Er beschleunigte die nächsten Schritte, setzte dann aber den Koffer ab und griff sich an den Kopf.
Sie sah sich nach ihm um und lachte. „Ihnen wächst ja ein Horn!“
„Ja.“
„Etwas Hartes dagegendrücken! Haben Sie ein Taschenmesser?“
Er zuckte die Achseln.
Bevor er begriff, was geschah, hatte sie ihren Helm gegen die Beule gepresst. Er fuhr zurück vor Schmerz. Aber sie umfasste seinen Hinterkopf und hielt ihn fest.
Als sie den Helm wegnahm, fragte er: „Ist es jetzt weg?“
„Holt sich beim ersten Schritt eine Beule! - Der Kaderleiter sitzt im dritten Zimmer links.“
Damit ließ sie ihn stehen.
2. Kapitel
Erschöpft von der langen Sitzung - sie hatten viel geraucht und es war heiß gewesen - zog sich Arvid Jassoy die fünf Treppen hinauf. Er nahm sich zusammen. Irene sollte nicht merken, wie müde er war.
„Kinderlos? Ganz nach oben!“, hatte man ihm damals bei der Wohnungskommission gesagt, als er, jung verheiratet, vor acht Jahren nach Pötterdiek gekommen war. Er fing als Schichtleiter an, er war tüchtig, was man bald bemerkte. Abends studierte er. Vor drei Jahren hatte man ihn als Produktionsleiter in eins der Zweigwerke geschickt und nun zurückbeordert.
„Ganz nach oben!“, sagte er vor sich hin und legte auf dem Treppenabsatz eine Pause ein.
Seine Rückkehr war nicht triumphal verlaufen. Der Werkdirektor hatte ihm die Hand gegeben, „da sind Sie ja wieder“ gemurmelt und ihn flüchtig in seine Aufgaben eingeführt, „na, Sie kennen sich ja aus.“ Die Parteisekretärin hatte „du weißt, was wir von dir erwarten“ gesagt und seine Rückmeldung ins Grundbuch eingetragen.
Auch Irene hatte ihn ohne Jubel empfangen. Dennoch, er wollte dort neu beginnen, wo sie vor drei Jahren aufgehört hatten.
Eigentlich hatte er nur sechs Monate in Brinkenhagen bleiben sollen, aber als man ihn da nach einem halben Jahr noch brauchte, war er ohne Widerspruch geblieben. Warum hatte er eigentlich Irene nicht nachgeholt? Sie hätte sich in der Universitätsstadt schnell eingelebt, da gab es Theater, Vorträge, Museen, Bibliotheken, Kaufhäuser, eine Wohnung wäre zu beschaffen gewesen, nicht sofort, gewiss, aber doch nach acht oder neun Monaten. Es hatte sich nicht so ergeben, er hatte nicht daran gedacht, oder es war ihm nicht notwendig erschienen, und die Arbeit hatte seine ganze Kraft in Anspruch genommen. Nicht, dass er seine Frau vergessen hätte - ihr Foto stand vor ihm auf den Tisch -, jedoch er konnte sich bald ihr Gesicht, wie es wirklich war, nicht mehr vorstellen, er hörte ihre Stimme nicht mehr, sie war ihm nicht mehr nah. Ein wenig fühlte er sich auch als Märtyrer der Arbeit, die er gewissenhaft und ohne die Stunden zu zählen verrichtete.
Zuerst fuhr er alle vier Wochen nach Hause und war froh und fand es in Ordnung. Dann fuhr er seltener, ihm war zumute, als müsste er immer wieder von Neuem um Irene werben, wie damals, und das wunderte ihn. Im zweiten Jahr fuhr er nur noch zu den großen Festtagen, der Entschluss machte ihm Mühe. Irenes Briefe wurden kürzer, sie klangen ihm fremd, er verzögerte die Antworten. Das Päckchen zu ihrem Geburtstag schickte er drei Tage zu spät ab. Dass andere Frauen an seinem Versagen schuld gewesen wären, hätte er bestritten. Na schön, da war die Studentin gewesen, sie hatte ihn ins Museum geschleppt, von der norddeutschen Backsteingotik erzählt und ihm die zerbröckelnde Klosterruine im Nachbardorf gezeigt. Sie hatte mit ihm Eis geleckt, Schnitzel gegessen, Sekt getrunken und ihm am Ende gestanden, dass sie für ältere Herren doch nicht so sehr viel übrig habe. Er war gekränkt gewesen, er zählte knapp über dreißig. Eine Romanze also, vier Wochen nur und im Ergebnis nicht sehr ehrenhaft für ihn, er dachte nicht gern daran. Irene konnte kaum davon erfahren haben. Und später? Die paar Nächte, in denen er das Alleinsein nicht ertragen hatte, hinterließen nur Unbehagen.
Als er nach seiner Rückkehr Irene davon berichten wollte, lächelte sie spöttisch und hatte plötzlich so viel zu tun, dass sie ihm nicht zuhören konnte. In den Nächten lagen sie nebeneinander, aber er spürte nur an ihren Atemzügen, dass sie da war. Einmal hatte er sich ein Herz gefasst und den Arm nach ihr ausgestreckt, doch als er schon glaubte, sie wolle sich ihm zuwenden, sprang sie auf, nahm ihre Bettdecke und legte sich in der Wohnstube auf die Couch. Am nächsten Abend kam sie wieder ins Schlafzimmer. Er wiederholte den Versuch nicht.
Vor drei Wochen hatte ihn die Parteileitung in Brinkenhagen um eine Aussprache gebeten. „Willst du denn so weiterleben? Die Familie getrennt, kein Besuch, vielleicht nicht einmal ein Brief, wie denkst du dir das? Du sagst, dass du mit deiner Frau nicht zerstritten bist und dir auch keine andere angeschafft hast. Also, wir meinen, dass du jetzt wieder nach Pötterdiek gehst. Finanzielle Einbußen wirst du nicht haben. Fahr also nach Hause und bring das mit deiner Frau in Ordnung, damit ihr lebt wie Menschen!“ Das „also“ war ihm auf die Nerven gegangen.
So etwas ist leicht gesagt und schwer getan. Irene ließ nicht mit sich reden. Gewiss, über gleichgültige Dinge konnten sie sprechen. Er erzählte vom Betrieb, sie von der Schule. Er berichtete von Dingen, die er früher nicht erwähnt hätte. Sie hörte zu und warf ab und zu ein mattes „aha“ oder „wirklich“ ein.
Er hatte den oberen Treppenabsatz erreicht, wo er tief Luft holte. Er öffnete die Wohnungstür einen Spalt und hörte Irenes Schritte in der Wohnung.
Er holte sich den Teller mit der aufgewärmten Gemüsesuppe aus der Küche.
„Wieder wegen Biggers! Schließlich muss ich mit ihm arbeiten.“
Er hörte, wie Irene Türen und Schubkästen im Schlafzimmer öffnete, und er sprach laut, damit sie ihn verstehen konnte.
„Sie haben noch keine Unterkunft für ihn. Da offenbaren sich die Fehler in unserem Wohnungsbau. Im Dorf leben jetzt siebenmal so viel Leute wie früher. Wir bauen Wohnungen für Familien, Einzelpersonen werden nicht bedacht. Wenn wenigstens der eine oder andere ein Zimmer abgeben könnte! Aber bei zwei oder zweieinhalb Räumen? Ach, was rege ich mich auf! Wir haben schließlich eine gute Parteisekretärin, die wird Rat wissen.“
„Warum sagst du fortwährend ‚schließlich'?“
Dass sie das bemerkte, nahm er als Zeichen wiedererwachenden Interesses. „Eine dumme Angewohnheit. Entschuldige!“
Er spülte den leeren Teller ab und legte ihn in die Abwaschschüssel.
Sie schloss einen Schubkasten. Holz schrammte auf Holz. Man müsste die Kanten mit Stearin einreiben. „Nimm du ihn doch auf!“
„Ich verstehe nicht.“ Er stieß die Tür auf und sah, dass Irene Koffer packte. „Du willst fort?“
„Ins Ferienlager.“
„Mit zwei Koffern?“
„Ich komme nicht mehr zurück.“
Er trat ans Fenster, sah aber nicht hinaus. Er hielt die Augen geschlossen, hörte den Lärm der Stare, die einen Kirschbaum plünderten.
Sie stellte das Gepäck im Flur ab und kam noch einmal ins Zimmer. Ob sie mir wenigstens die Hand gibt? dachte er.
„Das ist ja alles so einfach! Da wird ein Beschluss gefasst: du gehst zu deiner Frau zurück, und drei Jahre sind vergessen. So ist es programmiert, so führt es Arvid Jassoy aus. Aber ohne mich! Ich bin das Rauschen auf der Regelstrecke, der Störfaktor, den ihr nicht berechnet habt. Ich kann nämlich so nicht leben. Hier ist überhaupt alles programmiert. Das fängt schon bei den Kindern an. Aus der Art, wie sie morgens auf den Schulhof kommen, kann man errechnen, welche Fehler ihnen in der sechsten Stunde im Diktat unterlaufen werden. Aber ich will da leben, wo die Menschen noch lachen oder sich ärgern, je nach ihrer Stimmung, nicht nach einem vorgesehenen Programm. Ich möchte wirklich nicht ungerecht sein, Pötterdiek ist schöner geworden, statt der Katen fünfstöckige Häuser, aber die Wände so dünn, dass man die Nachbarn durch zwei Zimmer hört: das macht nichts, man weiß ja, was sich die anderen sagen, es ist programmiert. Und wenn mal einer an der falschen Stelle hustet, gibt’s eine Hausversammlung. Kinderkrippe und Spielplätze habt ihr gebaut, Kaufhalle, Schwimmbecken, Schule und Kulturhaus, wo ihr Karten spielen könnt oder Schach oder, wenn das Programm es will, auch tanzen. Ihr tut was für den Menschen, ihr tut so viel, dass für ihn nichts mehr zu tun bleibt. Doch - er darf die Grünflächen zwischen den Häusern pflegen. Aber ich will keine Rabatten mit Stiefmütterchen und Astern vor meinem Fenster haben, nur weil es im Programm der Hausgemeinschaft steht. Ich will vielleicht Löwenzahn oder Gänseblümchen oder Schafgarbe oder Grasnelken, ja, ganz gewöhnliche Grasnelken.“
„Irene, ich bin schließlich nicht nur wegen des Beschlusses –“
„Schließlich, schließlich! Ich gehe ‚schließlich‘ auch nicht nur deinetwegen fort.“
„Du hast einen anderen?“
„Ist das nicht gleichgültig? Aber nein, du musst die Gründe für mein Fortgehen codieren, auf eine Lochkarte übertragen und vom Analogrechner analysieren lassen, damit du weißt, ob du die Scheidung einreichen sollst oder dir ein Verhältnis nehmen oder was weiß ich. Danke, ich kann meine Koffer allein tragen.“
Arvid Jassoy sah seiner Frau lange nach. Als ihm klar wurde, dass sie für immer fortging, schrie er die geschlossene Tür an: „Wie du willst! Dann nehme ich eben den Biggers!“ '
3. Kapitel
Die Sekretärin ließ Martin warten, zehn Minuten, eine Viertelstunde. Dann, ohne dass er bemerkt hätte, wie sie sich mit dem Werkleiter verständigte, öffnete sie ihm die Polstertür.
Pflugradt warf einen kurzen Blick auf die Personalpapiere, wobei er die Unterlippe zwischen die Zähne klemmte, und sagte plötzlich so laut, als müsste er sich gegen den Lärm der Vibratoren verständlich machen: „Wir setzen Sie als Schichtleiter ein.“
Martin erschrak, er spürte das Zucken unter dem linken Knie, das ihn stets befiel, wenn Ärger bevorstand, als wollte es ihn daran erinnern, dass er sich zusammennehmen müsste.
Pflugradt spielte mit dem faustgroßen, grüngläsernen Quader, der ihm als Briefbeschwerer diente, hielt ihn gegen die einfallenden Sonnenstrahlen und sagte mit einer Stimme, die Widerspruch ausschloss: „Selbstverständlich haben Sie eine Recht auf drei Monate Assistentenzeit, in der Sie alle Abteilungen unseres Werkes kennenlernen könnten. Aber wir können sie Ihnen nicht gewähren. Wir setzen Sie gleich als Schichtleiter ein.“
Aus dem Quader ergoss sich grünlicher Lichtschaum über Pflugradts Handgelenke.
Martin wandte seinen Blick ab und sagte fest: „Meine Fähigkeiten liegen in der Technologie. Ich arbeite über technologische Probleme.“
„Gewiss, als Schichtleiter haben Sie sich um die Einhaltung der technologischen Normen zu kümmern.“
„Ich kann dem Werk nützlicher sein, wenn ich in der technologischen Abteilung arbeite.“
„Als Fachschulabsolvent und ohne Spezialausbildung? Interessant.“
„Es kommt nicht darauf an, welche Schulbank man gedrückt hat. Ich werde Ihnen meine Arbeit ...“
Pflugradt setzte den Briefbeschwerer hart auf die Schreibtischplatte. Die scharfe Kante riss eine Schramme in die Politur.
„Und Sie glauben, dass ich Ihretwegen einen Diplom-Ingenieur zum Schichtleiter degradiere?“
„Natürlich nicht. Ich meine nur ..., ich habe mir da nämlich so allerlei ausgedacht ...“
„Na, ausgezeichnet - das werden Sie als Schichtleiter brauchen können.“ Er legte den Daumen auf den Knopf der Wechselsprechanlage. „Rufen Sie Jassoy!“
Martin fragte sich, wozu der Werkleiter diese Anlage brauchte; er sprach doch laut genug, das Mädchen im Vorzimmer verstand ja jedes Wort durch die Wand.
„Unser Produktionsleiter. Er wird Sie einarbeiten. Vierzehn Tage genügen, dann stehen Sie auf eigenen Füßen. Worauf wir Wert legen, wissen Sie ja: Pünktlichkeit, Akkuratesse, Knappheit, mit einem Wort: Präzision.“
Martin wagte es noch einmal: „Die technologische Konzeption des Werkes ...“, aber Pflugradt erhob sich, wuchs wie ein Rauchpilz in die Höhe und Breite und kam auf ihn zu. Martin senkte den Kopf. Der Direktor ging an ihm vorbei zur Tür. Dann trat Jassoy ein.
Als er später in Jassoys Wohnzimmer saß, nahm er die Zeichnung aus dem Hefter, glättete die Falten und betrachtete sie lange. Fachschulabsolvent und ohne Spezialausbildung! hatte Pflugradt gesagt. Überschätze dich nicht! Du bist Autodidakt, hatte seine Mutter damals zu ihm gesagt. Bestreitet doch, dass ich etwas von modernen Produktionsmethoden verstehe, anhand dieser Zeichnung bestreitet das, wenn ihr könnt! dachte er. Können Sie so eine Zeichnung lesen, Kollege Werkleiter? Pünktlichkeit, Akkuratesse, Knappheit, mit einem Wort: Präzision! Bitte sehr: akkurate Striche auf glattem Papier, präzis berechnet! Ich an Ihrer Stelle, Herr Kollege, würde vor Freude aufjauchzen, ich würde auf den Schreibtisch springen und mit dem Briefbeschwerer Fußball spielen, wenn mir jemand mit so einer Idee käme. Freilich, Sie kennen sie ja noch nicht, haben mich ja nicht einmal anhören wollen. Noch erfüllt das Werk den Plan, was brauchen Sie an die Zukunft zu denken?
Ein Schlüssel kreischte im Schloss. Martin schlug den Hefter zu und legte ihn weg. Wenn der Direktor nichts davon wissen wollte, wie sollte sich sein Produktionsleiter dafür interessieren. Der war bestimmt auch nur Praktiker.
Jassoy sank schlaff in den Sessel, müde Falten über der Nasenwurzel; er atmete durch den offenen Mund. Seine Spannkraft hatte für acht Stunden im Betrieb ausgereicht, jetzt konnte er, so schien es, sich nicht einmal aufraffen, in die Küche zu gehen und Kaffee zu brühen.
Er redete, versuchte seinem Gast zu erklären, weshalb er ihn aufgenommen hatte. Doch er fand nicht die richtigen Worte; er wiederholte sich, brach mitten im Satz ab, und wenn er den Gedanken wieder aufnahm, strich er sich mit dem gekrümmten Zeigefinger über das rechte Augenlid.
Martin verschränkte die Hände ineinander, um diese Geste nicht nachzuäffen.
Er begriff nicht so recht: Jassoys Frau war weg. Ihr Bild stand auf dem Schreibtisch, eine billige Fotografie, die nicht viel von ihrem Wesen verraten konnte. Vielleicht war sie für immer weg, vielleicht nur für ein paar Wochen? Er wollte nicht fragen. Was ging ihn das an! Er würde nicht in dieser Wohnung bleiben, nicht lange.
Er sah über Jassoy hinweg auf das nüchterne Streifenmuster der Tapete, das nur durch einen farbschwachen Druck von Brüllows „Mittag in Italien“ Aufgelockert wurde. Ein schlechter Druck! Er hatte in Moskau das Original gesehen; er mochte es nicht: zu glatt, fand er, zu rund auch die Schultern des Mädchens, das sich die Weintrauben in den Mund streifte, zu ebenmäßig ihr Gesicht, zu gefällig der Faltenwurf ihrer Gewänder. Aber das Original war dunkel und kräftig in den Farben.
Er begann dieses Bild zu hassen, ebenso die Tapete, den niedrigen Raum mit dem Ofen aus grünen Kacheln, die Wasserpalmen und Azaleen auf dem Fensterbrett, den Globus auf dem Bücherschrank. Auch das Foto auf dem Schreibtisch, die vertrocknete Rose in der Keramikvase daneben. Sobald er nur ein wenig Zeit fände, wollte er sich nach einer anderen Bleibe umsehen. Irgendwo im Dorf musste doch ein Zimmerchen zu finden sein, und wenn es eine Dachkammer mit schrägen Wänden wäre!
Er war gewiss nicht so unruhig und unverträglich, wie Latotzki zu glauben schien. Aber es war ihm zum Beispiel unangenehm, wenn ihm jemand beim Essen auf den Mund und beim Schreiben auf die Hände sah, die körperliche Nähe fremder Menschen reizte ihn.
Er hörte Jassoy noch immer reden; er bekam Lust, ins Freie zu gehen, etwas Vernünftiges zu tun, sich ein Stück weiches Holz zu suchen, Pappel oder Linde, und zu schnitzen, ein Tier vielleicht, einen Büffel mit gesenkten Hörnern oder einen Bären mit erhobener Pranke. Aber draußen war es längst dunkel. Und wohin hätte er auch gehen sollen? Noch war ihm alles hier fremd.
So begann dann der Alltag des Schichtleiters: kurze Brigadebesprechung, Vorstellung, Einführung in die Aufgaben des Tages, Gang durch die Halle, Lärm, Staub, Dampf, der aus der Durchlaufkammer strömte, Geruch von frischem Beton, wie Martin ihn von der Baustelle her kannte. Er atmete tief.
Dann im Büro: Pläne, Listen, Materialanforderungen, Abrechnungen, Arbeitsschutzvorschriften, Standards - Beratungen, Besprechungen, Versammlungen, Leitungssitzungen mit Aschenbechern voller Zigarettenreste, mit Limonade und Kaffee, viel Kaffee.
Auch Ärger blieb nicht aus. Die Schlosserei rief an. Die Stifte, die zum Verkeilen des Spannstahls dienten, waren abzuholen. Martin, in Eile, da er eine Vibrationsmessung vornehmen wollte, rief den Mann an der Spannmaschine.
Der sah ihn groß an. „Nicht mein Bier!“
„Haben Sie nicht begriffen?“
Der Mann brummte etwas Unverständliches.
Martin trat einen Schritt näher. „Nun?“
„Geh ja schon.“
Der Brigadier beschwerte sich bei Jassoy: „Und was kommt raus dabei? Zwei Maste weniger und nur hundertvier Prozent! So kommen wir nicht auf unser Geld.“
Jassoy wies Martin auf seinen Fehler hin. „Die Aufgaben sind genau festgelegt, alle. Jeder weiß, was er zu tun hat und was nicht. Die Brigade ist ein gut eingespielter Apparat. Ein unüberlegter Auftrag ist wie ein Druck auf die falsche Taste: ein Durcheinander in den Schaltungen, die Rückkopplung kreischt, kein vernünftiger Ton kommt heraus. Sieh dir die Abrechnungsbogen an!“
„Ziemlich empfindlich, euer Apparat.“
„Aber sehr leistungsfähig, unser Apparat, wenn er vorschriftsgemäß bedient wird.“
„Und wer kennt die Vorschrift?“
„Zum Beispiel der Brigadier - und du, wenn du erst länger hier bist. Klar, du bist neu, niemand wird dir übel nehmen, wenn du etwas nicht gleich weißt. Aber du hättest mit dem Mann anders reden sollen.“
„Zum Diskutieren war keine Zeit.“
„Eine Frage hätte schließlich genügt.“
Zwei Tage darauf bemerkte Martin, dass der Kranführer keine Gehörschutzwatte verwendete.
„Ich höre ja so kaum was. Der Krieg, wissen Sie, Haubitzen, fünfzehn Zentimeter, da hat keiner nach Ge-
hörschutzwatte gefragt. Da hieß es: Daumen auf die Löffel, Maul auf, ganze Batterie Feuer! Nun halt mal die Hände an die Ohren, wenn du Granaten schleppst sechsundneunzig Pfund das Stück. - Wenn ich mir jetzt noch die Ohren verstopfe, bin ich taub.“
„Dann muss man Ihnen einen anderen Arbeitsplatz geben.“ Er schickte den Mann in die Sanitätsstube. Beide Fertigungsbahnen warteten zwanzig Minuten auf den Kran.
Die Sekretärin des Ökonomischen Direktors kam ohne Schutzhelm in die Halle. Martin zog sie unter einer herabhängenden Kette fort.
„Machen Sie, dass Sie hinauskommen!“
„Aber ich wollte doch nur ...“
„Hinaus!“ Er schob die junge Frau, der die Tränen in die Augen traten, durch die Tür. „So eine Unvorsichtigkeit! Wagen Sie es nicht noch mal, ohne Helm ...“ Sie hörte nichts mehr, sie sprang, ohne sich umzusehen, über Schienen und umherliegende Formteile. Martin lachte laut über die Art, wie sie, durch den engen Rock behindert, die Beine warf.
Natürlich beschwerte sie sich bei ihrem Chef, der sofort Jassoy anrief.
Biggers, auf dem Weg in sein Büro, hörte durch die dünnwandige Tür, wie der Produktionsleiter ihn in Schutz nahm: „Aber Kollege Quappendorf, Sie wissen doch: neue Besen kehren gut. Theoretisch war er sogar im Recht, in der Lautstärke selbstverständlich nicht. Aber bei dem Lärm in der Halle kann das so ein Neuling schwer abschätzen. Frau Krewt wird sich wieder beruhigen, schließlich isst auch sie die Suppe nicht so heiß, wie sie sie vom Feuer nimmt.“
Martin riss die Tür auf. Erschrocken legte Jassoy den Hörer auf die Gabel.
„Setzt mir die Suppe vor, die ich mir eingebrockt habe, und zwar so heiß, wie sie vom Feuer kommt! Ich werde sie auslöffeln, allein, ich brauche keinen Beschützer. Aber damit du’s weißt: ich habe es satt, immer der Neue zu sein. Komme ich in die Schlosserei, ruft man dem Meister zu: Hans, der Neue will was von dir! - Komme ich eine Minute nach vier in die Kantine, heißt es: Eigentlich ist schon geschlossen, aber weil Sie neu sind! - Ich will nicht neu sein, und ich brauche auch keinen Beschützer. Was ich tue, verantworte ich!“
Jassoy verließ mit hochgezogenen Schultern das Zimmer.
Sie stritten sich nur im Betrieb. Wenn Jassoy nach Hause kam, ließ er sich, nachdem er in der Küche ein kümmerliches Abendbrot verzehrt hatte, in den Sessel fallen und stellte das Fernsehgerät an. Sah er, dass Martin Papier und Bleistift vor sich hatte, holte er sich ein Buch aus dem Schrank. Aber er las nicht. Er starrte mit halb geschlossenen Augen das Bild auf dem Schreibtisch an. Martin hätte es am liebsten aus dem Fenster geworfen.
Manchmal versuchte Jassoy, mit ihm zu reden, über Leichtathletikrekorde, über irgendetwas oder über Irene. Nach ein paar kargen Antworten versiegte das Gespräch.
Weshalb, dachte Martin, spricht er mit mir nicht über unsere Arbeit? Hier hätten wir doch Zeit und Muße. Will der Herr Produktionsleiter in seinen vier Wänden seine Ruhe haben? Darf man Arbeitszeit und Feierabend so voneinander trennen?
Er war ungerecht, weil er den anderen nicht verstand: Wenn Jassoy sich mit seinem Gast zerstritte, wäre er ganz allein.
Aber Martin fragte sich, warum Quappendorf sich bei Jassoy beschwert und nicht ihn selbst angerufen hatte und warum Nix, der Cheftechnologe, ihm kein Wort davon gesagt, dass er die Druckwerte der Spannmaschine in die falsche Spalte des Formulars eingetragen hatte, und sie hatten doch in der Leitungssitzung nebeneinandergesessen. Weil ich neu bin? Fürchten sie, dass meine Mutter ...? Mein Gott, da kann ich sie beruhigen, ich hab die Frau drei Jahre nicht gesehen, ich habe auch nicht die Absicht, mich bei ihr über jemanden zu beklagen.
Es war ihm früher schon geschehen, dass er wegen seiner Mutter in eine Sonderstellung geriet, und es war ihm nie recht gewesen. Den Anfang machte damals seine Lehrerin, eine rotblonde Frau, die meistens in einem zu weiten Trainingsanzug herumlief. In den ersten Schultagen behandelte sie ihn mit der gleichen betulichen Strenge und Freundlichkeit wie die anderen Kinder. Wenn er seine Buchstaben und Zahlen sauber und ordentlich in die Zeile brachte, malte sie ihm ein rotes Kreuzchen an den Heftrand, schrieb er krumm oder hielt er die Reihe nicht ein, bekam er eine schwarze Null, und wenn er sein Taschentuch vergaß - was ihm aber nur ein einziges Mal passierte, als seine Mutter, die sonst jeden Morgen Mappe und Hosentasche kontrollierte, eine Stunde früher zum Dienst gegangen war - oder wenn er gar einen Tropfen Tinte auf das Heft spritzte, trug sie ihm einen Ordnungsstrich ein. Eines Tages hospitierte der Direktor, der immer lächelte. Als Martin durch einige rasche Antworten auffiel, flüsterte die Lehrerin ihrem Vorgesetzten zu: „Der Sohn von Frau Uttenhöwt!“ Da strich sich der Direktor mit seinen langen rauchgelben Fingern über das schüttere Haar, das dicht über dem linken Ohr scharf gescheitelt war, und sagte mit seiner festlichen Stimme: „Brav, mein Junge, machst deiner Mutter Ehre!“ Und die Lehrerin setzte Martin von der dunklen Bankseite in die Fensterreihe um, wo helles Licht auf Bücher und Hefte fiel.
Oder jene Zeichenstunde im ersten Oberschuljahr. Der Lehrer, den sie Sheriff nannten, weil er einen karierten Mantel trug und Pfeife rauchte, gab einem Mitschüler, dem Sohn eines Bauern, einen Tadel, weil er zu dem Thema „Obsternte“ zwei Jungen gezeichnet hatte, die in einem fremden Garten Äpfel stahlen und vom Besitzer überrascht wurden; beim Sprung über den Zaun zerriss sich der eine die Hose. Sehr viel Grün und Braun hatte der Junge auf das Blatt gekleckst und einen kecken Tupfen rosa Fleisch.
Der Sheriff überraschte ihn, als die Stunde erst halb um und die Zeichnung noch lange nicht fertig war. Martin protestierte gegen den Tadel, das Bild sei doch sehr originell und lustig.
„Keine Diskussion!“, sagte der Sheriff, klappte sein Notizbuch zu und vertiefte sich wieder in seine Zeitschrift.
Martin legte sein angefangenes Bild fort und begann ein neues, das genau das darstellte, was dem Kameraden den Tadel eingebracht hatte, nur noch greller in den Farben und gröber in den Umrissen. Als er das Blatt abgab, schob der Sheriff die Brille in die Stirn und sah Martin schräg von oben an.
„Originell nicht, gewiss nicht, weder originell noch lustig, immerhin: wie Sie das Gelb gegen das Blau abgesetzt haben - und die violetten Schatten im Laub! Eigenwillig und mit einem Gefühl auch für Nuancen.“ Martin bekam keinen Tadel.
Die Armeezeit ließ sich anders an. Die Uniform machte alle gleich; er war einer unter vielen, nicht groß, nicht klein, sein Platz war in der Mitte der Kolonne. Aber der Unteroffizier fand bald heraus, dass sein Gedächtnis eine Handvoll Fakten mehr speicherte als das seines Nebenmannes.
An einem freien Nachmittag, als Martin auf einer Bank im Kasernengarten saß und sein Taschenmesser an einer Steingutscherbe schliff, trat der Unteroffizier heran und sah ihm zu, wobei er portionsweise den Rauch der Zigarette aus der Nase blies.
Martin strich mit der Fingerkuppe über die Schneide, fand sie noch zu stumpf zum Schnitzen und sah den Vorgesetzten missmutig an.
„Wir haben beschlossen, dass Sie in unserem Fortbildungszirkel Vorträge halten, Mathematik, Kybernetik und so. Als Abiturient ...“
Martin schüttelte den Kopf.
Der Unteroffizier setzte sich neben ihn auf die Bank. „Ihr Wissen hat Ihnen die Gesellschaft nämlich nicht zu Ihrem Privatvergnügen gegeben, sondern damit Sie es weitervermitteln.“
Martin prüfte das Messer an einem trockenen Ast. „Ist das ein Befehl?“
Über der Nase des Unteroffiziers zogen sich die Brauen zusammen, aber er sprach leise, überraschend leise, wenn auch mit einer gewissen Härte im Ton: „Nur eine Frage des Bewusstseins.“
Wieder nahm Martin eine Sonderstellung ein. Zum Glück fiel nie der Name seiner Mutter.
Vor drei Jahren hatte er die Verbindung zu ihr abgebrochen, endgültig; er hatte nicht einmal mehr ihre Briefe beantwortet.