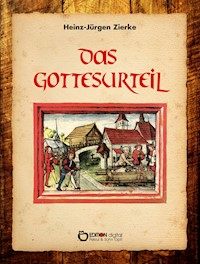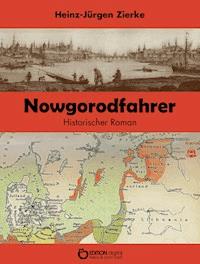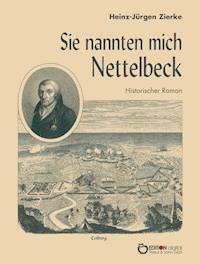7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem Morgen im Februar 1848. Hinrich Knubbe hebt die Peitsche. „Schlag zu!", befiehlt Herr von Negendangk. Aber Knubbe lässt die Peitsche sinken vor dem Bauern Krumbeck, dem Vater seiner Braut. Und der Herr hetzt ihn mit Hunden vom Hof. In der Stunde der Not findet Hinrich neue Freunde, Bauernsöhne, Tagelöhner, Bürger aus der Kreisstadt. Nur Krumbeck verschließt vor ihm das Tor. Der landstolze Kleinbauer will seine Tochter nicht dem Leibkutscher geben. Negendangk ruft Militär. Da bricht in Berlin die Revolution aus. Die Soldaten ziehen ab. Die Bauern veranlassen Krumbeck, seine Zustimmung zur Hochzeit zu geben. Kaum aber haben sich die Stürme der Revolution gelegt, erhalten Knubbe und seine Freunde im Dorf den Gestellungsbefehl. Jetzt vor der Ernte? Sie ziehen zum Landratsamt, um ihre Freistellung zu verlangen. Neugierige strömen ihnen zu. Die Behörden fürchten einen Aufstand und schicken nach den Kürassieren. Fünf Mann schlagen sich nach Berlin durch. Sie geraten in den Sturm auf das Zeughaus. Hinrich wird verwundet. Er will Preußen verlassen. Aber die Sehnsucht nach Gertrud und dem Kind, das sie erwartet, lässt ihn noch einmal die Heimat aufsuchen. Unerkannt gelangt er bis zu Krumbecks Gehöft. Aber der Bauer, aus Angst um seine Tochter, liefert ihn den Häschern aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
Heinz-Jürgen Zierke
Sieben Rebellen
Roman
ISBN 978-3-95655-286-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1967 im VEB Hinstorff Verlag Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines Bildes von Friedrich Wilhelm Heinrich Theodor Hosemann
© 2015 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. KAPITEL
Das Küchenmädchen Grete Koppen hätte sich gern noch einmal unter die Decke gekuschelt, aber ihre Freundin Berta schüttelte sie heftig und brüllte ihr ins Ohr: „Aufstehen! Er pfeift!"
„Wer pfeift?“
„Wer schon! Dein Leibkutscher."
Sie liefen beide zugleich ans Küchenfenster, stießen sich gegenseitig an und kicherten. Ein Glück, dass die Mamsell noch nicht unten war, aber so eilig hatte die es nie.
Das Fenster klemmte. Der stete Wrasen ließ das Holz quellen, und in der Februarkälte hatte sich Eis in die Ritzen gesetzt. Berta schlug mit ihrer fleischigen Hand gegen den Riegel. Das Eis knirschte, es gab nach, das Fenster ließ sich aufstoßen. Die eisige Morgenluft brannte in den verschlafenen Gesichtern.
Der Pferdeknecht und Kutscher Hinrich Knubbe schleppte Wasser in den Stall und pfiff dabei laut vor sich hin. Als der alte Kuhknecht Wilhelm Schüller seinen grauen Kopf aus der Stalltür steckte, um sich, wie jeden Morgen, über den frühen Lärm zu beschweren, fischte Hinrich ein Stück Eis vom Brunnenrand und zielte damit auf die dicken Zapfen, die in dichter Reihe von der Dachtraufe herabhingen. Der Wurf saß. Ein armlanges Eisstück zersplitterte vor Schüllers Füßen, fast hätte es ihm die Stummelpfeife aus der Hand geschlagen.
„Den Vogel, der am Morgen pfeift, den holt am Abend die Katze“, zeterte der Kuhknecht und zog sich in die dunstige Wärme des Stalles zurück.
„Gute Laune heute. Wer weiß, wo er gestern Abend war!", stichelte Berta, während sie sich das Gesicht abspülte.
Grete war die Neckereien der Freundin gewöhnt und antwortete doch immer wieder darauf.
„Er ist wieder spät nach Hause gekommen und doch als erster auf den Beinen." Sie fachte die Glut an, die versteckt unter der Asche glimmte, und legte kieniges Kiefernholz nach, das hell aufflammte.
„Hast wieder die halbe Nacht wach gelegen, und dann kannst du morgens nicht aus den Laken finden!“
„Pah, ich hab nicht gewartet, ich konnte nur nicht einschlafen. Meinetwegen soll er glücklich werden mit dem Bauernmädchen, ich sehe nichts davon."
„Du hast es gut, kommst heraus aus dieser Sandkuhle. Aber ich an deiner Stelle hätte nicht so schnell aufgegeben. Was ist denn an Gertrud Krumbeck dran? Die ist genauso dürr wie du. Ich verstehe nicht, was er an ihr findet."
Grete war wirklich sehr schmal. Wie ein Rehkitz, dachte sie manchmal, wenn sie sich im Spiegel sah, nur nicht so staksig auf den Beinen. Berta war dagegen kräftig und drall, hatte runde Arme, breite Hüften und ein glattes Gesicht, das immer ein wenig rot schien, vor Lachen oder vor Anstrengung, je nachdem.
„Die Wirtschaft gibt ihm Wilhelm Krumbeck nie im Leben. Eigentlich dumm von dem Bauern. Ist doch selbst nur ein armer Schlucker, und einen besseren Schwiegersohn als Hinrich kann er sich gar nicht wünschen: groß und kräftig - was er anpackt, gelingt ihm -, und immer ist er freundlich. Ich habe ihn noch nie wütend gesehen. Nur manchmal fliegt ein Schatten über seine Augen und macht sie traurig. Ob er dann an seine Mutter denkt? Ich glaube, in einem solchen Augenblick hast du dich in ihn verliebt. Werde bloß nicht eifersüchtig, weil ich für ihn schwärme. Ich gönne ihn dir."
Grete rührte die dampfende Grütze um, die die Mägde und Knechte zum Frühstück bekamen. „Ach, jetzt fängt der auch noch an!“ Ein dünner, erfrorener Ton klirrte durch den Morgen, brach ab, setzte neu an, seufzte, kreischte auf, stöhnte, zitterte, fing sich zu einer eintönigen Melodie, die niemand kannte. Inspektor Merker kratzte auf seiner Geige. Grete zog das Fenster zu.
„Dann wird es heute sein Abschiedsessen? Oder deins für ihn natürlich. Rühr ihm nur einen Kloß Butter an seine Grütze; die Mamsell merkt’s schon nicht. Ab morgen, wenn ich austeile, kriegt er nicht ein Lot mehr als alle andern. Das hat er schon deinetwegen verdient." Grete keilte stumm die Grütze in die Blechschüsseln. So sehr sie sich auf die neue Stellung in der Stadt freute, so schwer drückte der Gedanke, Hinrich vielleicht nie mehr zu sehen. Sie schalt mit sich selbst deswegen; denn Hinrich hatte keinen Blick für sie, er war immer freundlich, ja, aber nie freundlicher als zu Berta Siewert oder Trine Pust auch. Dass Grete seine Grütze mehr schmälzte, dass sie ihm den Kanten Brot breiter, die Scheibe Speck dicker schnitt, bemerkte er wohl gar nicht. Er hatte nur Augen für Gertrud Krumbeck, und doch kam sich Grete verloren vor wie ein Groschenstück im Hafersack, wenn sie sich vorstellte, dass sie übermorgen früh nicht mehr von Hinrichs Pfeifen geweckt wurde.
Berta versuchte zu trösten: „Vielleicht war er wirklich nicht bei ihr. Ich glaube, gestern ist der schwarze Uhrmacher aus Witgard wieder da gewesen. Dann sitzen sie stundenlang im Krug und reden noch mehr, als sie rauchen. Ich habe immer geglaubt, Reden ist Frauensache, aber die Männer sind viel schlimmer.“
Der kratzende Geigenton brach ab. Die Mädchen hörten, wie der Inspektor sein Fenster aufriss und Knubbe heranrief: „Du musst mal zu Krumbecks laufen. Ich weiß, du tust es gerne."
Grete sah, dass Hinrichs frostbleiches Gesicht errötete. „Der Alte soll mit seinem Gespann sofort herüberkommen. Wir müssen Dung auf den Schlag am Schwedengraben fahren. Wenn es erst taut, bleiben uns die Wagen im Lehm stecken."
„Kann sein", druckste Hinrich, „dass er das Frostwetter selbst nutzen will."
„Das soll er sich ja nicht einfallen lassen, sonst holt ihn der Leibhaftige! Er kann froh sein, dass wir jetzt seine Spanndienste nehmen und ihn nicht in der Saatzeit holen.“
„Um die Zeit, Herr Inspektor, wird er wohl schon draußen sein. Wilhelm Krumbeck ist ein Frühaufsteher."
„Dann scheuchst du ihn vom Acker zurück. Herr im Himmel, sei nicht so umständlich schon in der Morgenfrühe!“
„Scheint wieder eine einsame Nacht gehabt zu haben," kicherte Berta.
Hinrich fürchtete sich wohl, Wilhelm Krumbeck vor die Augen zu treten. Er fand eine neue Ausrede: „Ich kann bloß nicht weg hier, Herr Inspektor. Der gnädige Herr hat mir gestern Abend noch sagen lassen, dass er heute früh in die Stadt will. Ich muss den Wagen noch putzen, und umziehen muss ich mich auch.“
„Muss man sich um jeden Kleinkram selbst bemühen. Was sind das nur für Leute hier!" Dabei wirtschaftete er schon zwanzig Jahre für den Herrn von Negendangk auf Krummenhus.
Die Mädchen konnten nicht länger lauschen. Sie mussten die Grütze in die Leutestube bringen. Der Inspektor konnte fuchsteufelswild werden, wenn die Leute auf das Essen warten mussten und deswegen zu spät aufs Feld kamen.
Wilhelm Krumbeck hatte sich in aller Herrgottsfrühe aus dem warmen Bett gewälzt. Den Dung - in schweren, harten Klumpen - hatte er noch gestern Abend auf den Wagen geworfen. Er wollte das klare Winterwetter nutzen. Solange der Frost im Boden stak, waren Wege und Felder befahrbar. Trat erst Tauwetter ein, saugte sich der sandige Lehmboden voll Schneewasser. Dann brachte der scheckige Wallach, der nun auch die besten Jahre hinter sich hatte, nicht einmal eine leere Karre über den Acker.
Krumbecks Wirtschaft gehörte zu den kleinsten im Dorf. Es war ein Kossätenhof, die Felder abgelegen und wenig ertragreich. Als vor fünfundzwanzig Jahren der Grundherr seine Bauern regulieren ließ, hatte Wilhelm Krumbecks Vater, der damals noch wirtschaftete, die Hälfte seines Besitzes abtreten müssen. Er besaß nicht genug blanke Taler, um den Acker freizukaufen. Außerdem musste er sich verpflichten, wie andere Kleinbauern auch, drei Tage im Vierteljahr Spanndienste zu leisten und in der Kartoffelernte sechs Tage Handdienste. Er hatte es noch gut, er hatte seinen Hof behalten und vierzehn preußische Morgen Land. Der alte Blatty dagegen verlor seinen ganzen Acker; er musste seinen Hof in eine Büdnerstelle umwandeln und sogar noch einen Einlieger ins Haus nehmen, einen Tagelöhner, wie er nun selber einer war. Zu Hand- und Spanndiensten konnte ihn die Herrschaft nun allerdings nicht mehr heranziehen. Wenn sich Wilhelm Krumbeck und seine Familie redlich quälten, und das taten sie, brachte sein bisschen Land gerade genug ein, dass sie nicht Hunger litten und das Nötigste auf dem Leibe hatten. In schlechten Jahren, und die beiden letzten Ernten waren sehr gering ausgefallen, gab es dann wochenlang nur Salz zu den Pellkartoffeln - das Brot konnte man mit Borkenmehl strecken, Kaffee ließ sich aus Eicheln brennen, Öl aus Bucheckern pressen.
Zu dem eigenen hatte Krumbeck noch drei Morgen Kirchenland gepachtet, gleich hinter dem Papenpfuhl. Dort lud er die Fuhre ab, band dann das Pferd an eine Weide am Wegrand und begann die gefrorenen Dungklumpen, so gut es ging, auszubreiten. Das war eigentlich Frauenarbeit, aber die Bäuerin hatte sich den linken Fuß verstaucht, und die Tochter wollte heute mit Mine Joeper, die Butter auf den Markt brachte, in die Stadt, um in Simon Kattentids Apotheke essigsaure Tonerde für Umschläge zu besorgen. Als er die Haufen verstreut hatte, kehrte er zu seinem Wagen zurück und streifte mit der dreizinkigen Forke den Schmutz von den Kurkeln. Als er aufsah, um das Gerät auf den Wagen zu werfen, bemerkte er hinter dem Judenberg einen Mann, der wild mit den Armen fuchtelte und dann wieder die Hand an den Mund legte, als ob er rufe. Der Wind stand ihm entgegen. Krumbeck hörte kein Wort.
Er band den Schecken los und wollte den Wagen wenden. Nun erkannte er den jungen Awitz, der mit großen Sprüngen auf ihn zueilte.
„Wilhelm, Wilhelm, komm nach Hause, deine Frau!" Krumbeck hielt den Wagen an. „Was ist?"
Jochen Awitz, der Bauernsohn ohne Land, war vor Aufregung und Anstrengung außer Atem; er japste nach Luft und winkte dem Dorf zu.
Was war mit Elsbeth geschehen? War sie ausgeglitten, hatte sie sich im Fallen etwas getan? Hatte sie sich einen Kessel mit Brühwasser über den Leib gerissen? Hatte die störrische Kuh sie gegen die Wand gedrückt und ihr die Rippen gebrochen? Warum ließ Jochen Awitz seine Arbeit liegen und rannte hier heraus? Wilhelm Krumbeck bückte sich, um die heruntergefallene Peitsche aufzuheben. Als seine Hand in den Schnee tauchte, spürte er die eisige Kälte.
Endlich brachte Awitz ein paar verständliche Worte hervor: „Der Inspektor wollte dich holen, zum Dienst auf den Hof."
„Was ist mit meiner Frau?"
„Er hat sie geschlagen, mit der Reitpeitsche geschlagen, quer übers Gesicht!"
Krumbeck schoss das Blut in die Ohren. Mit der Reitpeitsche ins Gesicht! Mit seinen harten Bauernhänden wollte er den aufgedunsenen Speckkopf des Inspektors packen und auf den schwammigen Nacken stauchen, dass die Stiefel aus den Nähten platzten.
„Du sollst vor den Landrat klagen. Wir Bauern werden alle unseren Namen druntersetzen."
Krumbeck riss dem Schecken das Geschirr herunter, fasste in die Mähne und schwang sich auf den Rücken des Tieres, das sich aufbäumte und in großen Sätzen davonsprengte, angestachelt von wütenden Tritten in die Weichen.
Jochen Awitz konnte gerade noch zur Seite springen und sich an den Stamm der Weide klammern. Die dünne Eisdecke des Papenpfuhls hätte ihn nicht getragen.
Hinrich Knubbe suchte sich Spachtel, Bürste und Wolllappen und ließ sich in der Küche einen Eimer heißes Wasser geben. Berta zeigte lachend ihre weißen Zähne und winkte mit den Augen zu Grete hinüber, die vor dem Küchenschrank stand wie ein zittriges Fohlen. Eigentlich schade, dass sie fortgeht, dachte Hinrich, aber verdenken kann man es ihr nicht; hier muss sie ihr ganzes Leben lang Grütze rühren, Kessel scheuern oder, wenn sie älter wird, über den Acker kriechen. Sie vertrocknet und hat vom Leben nichts gesehen als Mühe und Arbeit.
Hinrich hatte seine ersten Kinderjahre, solange die Mutter lebte, in dem Städtchen Zernikow verbracht. Lag es daran, dass es so unendlich lange her war, oder vergoldete die Erinnerung an die Eltern jene Zeit - das Leben in der Stadt erschien ihm viel bunter und fröhlicher. Als er dann allein stand in der Welt und die alte Nachbarin, deren Namen er längst vergessen hatte, ihn hierher brachte zu den fremden Menschen und den vielen bösen Tieren, glaubte er wie Daniel in die Löwengrube gefallen zu sein. Aber die Tiere hatten Mitleid mit ihm, und an die Menschen gewöhnte er sich. Zur Schule durfte er nur noch im Winter gehen. „Er hat genug gelernt in der Stadtschule, drei Jahre lang", meinte der Inspektor, und der Herr stimmte ihm zu. Das schien wahr zu sein, denn er konnte besser lesen und schreiben und wusste mehr von der biblischen Geschichte als selbst die Dorfkinder im achten Schuljahr. „Armer Junge", hatte ihn der Kantor bedauert, „dich Perle wirft man vor die Säue.“ Das stimmte nun nicht, denn Hinrich war nicht Schweinehirt geworden, sondern Pferdejunge. Und heute war er herrschaftlicher Kutscher, der den gnädigen Herrn in die Stadt fahren durfte; denn Herr von Negendangk, der junge, wollte den Nachbarn, den Wedells und Ostens, die so viel mehr Land besaßen, wenigstens etwas voraus haben: anstelligere Leute. Bei diesem Wetter den Wagen zu waschen, bereitete kein Vergnügen. Wenn Hinrich die froststarren Hände in das Wasser tauchte, brannten sie wie Feuer, und wenn er sie dann herauszog, um mit dem nassen Lappen die Speichen abzureiben, schnitt die Kälte messerscharf in die Gelenke.
Im Grunde war die Arbeit überflüssig. Wenn Hinrich von einer Fahrt zurückkam, musste er jedes Mal die Kutsche gründlich reinigen. Kein Schlammspritzer durfte den Lack beflecken, kein Staubkorn sich in die Polsterritzen setzen, und die Felgen und Speichen mussten leuchten, als hätte sie der Stellmacher eben erst eingesetzt. Aber vor jeder Ausfahrt verlangte der Herr eine neue Säuberung.
Heute schrubbte und wischte Hinrich gerne. Er wusste, diesen Vormittag war auch Gertrud in Witgard. Wenn der Herr von Negendangk sich im Hotel de Prusse festsetzte, brauchte Hinrich nicht auf ihn zu warten. Er konnte mit Gertrud Hand in Hand über den Markt schlendern, auch ein Stückchen an der Iserbäk entlang oder die Pappelallee nach Uchtdorf.
Ein Glück, dass er gestern doch noch im Krug eingekehrt war! Er hatte nicht viel Lust gehabt. Der schwarzhaarige Uhrmacher predigte den Kleinbauern und Tagelöhnern den Weg zum Glück. Alles Übel komme vom Eigentum, glaubte er, und es müsse neu verteilt werden, damit es den Menschen nütze und kein Unheil über sie bringe. Die Tagelöhner forderte er auf, Land zu verlangen, und die Bauern sollten die Dienste verweigern, das seien feudale Relikte. Keiner wusste, was ein feudales Relikt ist, aber es hörte sich so an, dass sie ihm recht gaben. Hinrich gab nichts auf solche Worte. Aus anderer Leute Mehl ließ sich gutes Brot backen, und der Pastor versprach in der Kirche auch die ewige Seligkeit, und hatte doch noch nicht einmal durch eine Zaunritze ins Himmelreich gelauscht.
Hinrich wollte kein Land. Wenn er nur Gertrud bekam, war er glücklich genug. Alles andere fand sich dann. Schließlich war er dann doch gegangen, eigentlich nur, weil der Weg an Krumbecks Gehöft vorbeiführte und er wenigstens einen Blick auf das Fenster werfen wollte, hinter dem Gertrud schlief. Er hatte sich auch im Krug nicht aufgehalten. Er kannte die Gäste und ihre Fragen, und Stojentins Antworten wusste er auch halb auswendig. Wenn der Uhrmacher überlegte, pfiff er leise vor sich hin, eine einfache Melodie, die sich in den Köpfen festhakte und die Männer auch den Tag über nicht losließ. Friedrich Weinbeck pfiff sie sogar seinem Rotfuchs ins Ohr, der erschrocken über den Hof galoppierte und fast die Milchtiene umgerissen hätte.
Hans Dethloff fragte den Uhrmacher nach dem Text des Liedes. Stojentin winkte seine Zuhörer zu sich heran, sie steckten die Köpfe zusammen, und er sang ihnen leise vor:
„Kein Graf, kein Fürst, kein Edelmann
soll nicht mehr existieren."
Peter Piewerlink, der Krüger, ging gleich dazwischen. So etwas wollte er nicht hören. Was seine Gäste redeten, ging ihn nichts an, wenn sie nur fleißig tranken; er hörte nicht hin. Aber solche Lieder durften sie nicht singen. Das litt er nicht. Hinrich nahm seine Jacke und ging. Jacob Dobritz schloss sich ihm an, ging aber zum Glück in anderer Richtung nach Hause. Wie eine Klette hing die Melodie auch Hinrich an. Er pfiff sie noch, als er das letzte Gehöft des Dorfes, Krumbecks Wirtschaft, erreichte. Das Gut lag dreihundert Schritt weiter zum See hin. Hinter den kleinen Scheiben des Kammerfensters schimmerte Licht. Gertrud schlief also noch nicht. Ob sie ans Fenster trat und einen Gruß herunterwinkte? Er pfiff ein wenig lauter. Wilhelm Krumbeck konnte ihn nicht hören; die Schlafstube ihrer Eltern lag nach dem Hof zu.
Die Kerze verschwand. Das Fenster klappte. Gertrud steckte den Kopf heraus.
„Hinrich?"
„Ich bin’s."
„Du, morgen früh gehe ich nach Witgard. Hast du nicht in der Nähe der Landstraße zu tun?“ Sie richteten es oft so ein, dass er sie auf dem Weg abpasste, wenn sie zur Stadt ging oder zurückkam.
„Das nicht, aber ich muss den Herrn nach Witgard fahren. Hotel de Prusse, wie immer.“
„Wirklich? Ich hab nur nicht lange Zeit. Mine Joeper geht mit."
„Die hält den Mund."
„tschüs!"
Hinrich pfiff noch, als er über die abgesperrte Pforte vor der Schlossbrücke kletterte. Und am Morgen hatte er sich kaum von seinem Lager über der Häckselkiste erhoben und mit einer Handvoll Schnee die Müdigkeit aus der Stirn gerieben, da pfiff er schon wieder. Er pfiff das gleiche Lied auch noch, als er des Edelmanns Kutsche polierte. Er pfiff immer, wenn er froh war. Hufgetrappel näherte sich von der Schlossbrücke. Eine Herde überwinterter Gänse stob beiseite. Die Dogge Thoas zerrte an der Kette, als witterte sie ein krankgeschossenes Reh. Ein bunt gescheckter Ackergaul trabte heran, die Wintereisen schlugen Funken auf dem Kopfsteinpflaster. Neugierige Gesichter erschienen an den Fenstern.
Das war Krumbecks Pferd, und wahrhaftig! der Reiter war der Bauer selbst. Hatte er nicht Dung fahren sollen zum Schlag am Schwedengraben?
Simon Angelloz, zwei Bund Stroh auf der Forke, sprang ihm aus dem Weg. Krumbeck beugte sich herunter und fragte ihn etwas. Angelloz wies mit der freien Hand auf die Schlosstreppe.
„Beim Herrn? Mir gleich, ich wollte ihn mir auch aus der Hölle angeln!" Des Bauern Stimme überschlug sich vor Wut.
Er konnte nur den Inspektor meinen. Hatte Merker etwas angestellt? Hatte er vielleicht Gertrud beleidigt; er konnte kein Mädchen in Ruhe lassen, das war bekannt. Hinrich packte den Peitschenstiel, den er in den Halter am Kutschbock stecken wollte, fester und behielt ihn in der Hand.
Krumbeck ritt an ihm vorbei, ohne auf ihn zu achten. Vor der Freitreppe sprang er ab und lief die Stufen hinauf. Der erschöpfte Wallach trabte zutraulich zu Hinrich heran, der ihm die verschwitzten Flanken trocken rieb. Das Tier konnte sich den Tod holen in dieser eisigen Luft.
Die Dogge Thoas heulte auf und riss an der Kette, dass sich das Halsband tief einschnitt. Der Wallach kippte böse die Ohren zurück. Hinrich trat zur Seite, um die Peitsche aus der Hand zu legen. Er kam nicht dazu.
Herr von Negendangk trommelte mit den Fäusten gegen das Fensterkreuz, das nicht nachgab, und schlug die Scheiben ein.
„Hilfe! Knubbe, hilf! Mord!"
Irgendwo im Haus kreischte ein Mädchen auf.
„Knubbe, hierher! Hilfe!“
Hinrich hetzte mit großen Sprüngen die Freitreppe hinauf und riss die Tür zum Türkischen Salon auf. Herr von Negendangk stand am Fenster und zitterte wie eine Kuh vor dem Schlachten. Krumbeck hatte den Inspektor gepackt und schlug mit seiner harten Faust immer in das feiste Gesicht hinein.
„Schlag zu! Er bringt uns alle um!“
Hinrich hob die Peitsche. In diesem Augenblick ließ Krumbeck von dem zurücksinkenden Inspektor ab und hob die verwunderten Augen zu Hinrich auf.
„Schlag zu, schlag zu!"
Arm und Peitsche zitterten. Aber Hinrich schlug nicht. Krumbeck richtete sich auf, stand Hinrich gegenüber mit gesenktem Kopf, hängenden Armen und erschlafften Händen. Wartete er auf Hinrichs Schlag?
Hinrich ließ die Peitsche sinken. Der Alte vor ihm straffte sich, hob den Kopf, seine Mundwinkel bewegten sich; Hinrich glaubte, er wollte sprechen, da spie er ihm vor die Brust.
„Schlag zu! Schlag endlich zu!" Negendangk klammerte sich noch immer ans Fensterbrett und achtete nicht auf die Wunden, die ihm die Glassplitter rissen.
Krumbeck stakste mit eckigen Schritten zu seinem Pferd und führte es am Zügel vom Hof. Der Hund Thoas heulte langgezogen hinter ihm her.
Hinrich stand noch immer, starr wie ein geknicktes Grabkreuz, mitten im Türkischen Salon.
„Du schlägst nicht? Du schlägst nicht?" Negendangk bemerkte das Blut an seinen Händen, noch betäubte der Schreck die Schmerzen.
„Pack! Steckt alle unter einer Decke! Gesindel! Hinaus! Aus meinen Augen! Vom Hof!"
Er riss den Fensterflügel auf. Seine Wut war heftiger als seine Angst. Das Holz brach. Scherben fielen klirrend in den Hof. „Simon! Wilhelm! Karl! Die Hunde los! Hetzt Knubbe vom Hof! Ein Jakobiner! Die Hunde!"
2. KAPITEL
In den ersten Tagen glaubte Grete, sie könnte sich nie an die engen, gepflasterten Straßen Witgards gewöhnen, in denen sich die Häuser so dicht an den Fahrweg drängten, dass die Kutscher nicht mit den Peitschen knallen konnten, weil sie sonst die Fensterscheiben einschlugen. Die Dorfstraße daheim war so breit, dass zwei schwere Ochsenwagen aneinander vorbeikamen und dann immer noch Platz blieb für eine Bäuerin mit zwei Mollen Brotteig. Vom Gehweg konnte auch niemand in die Stuben schauen, denn die Straße und die weitlüftige Häuserzeile waren getrennt durch Vorgärten mit Stachelbeersträuchern und Kirschbäumen.
Am meisten ärgerte sich Grete über das harte Kopfsteinpflaster. Wenn sie am Morgen von Bäcker Mollings Stand auf dem Markt die Frühstücksbrötchen holte, klapperten ihre Holzpantoffeln, als tanzten sie über eine große Trommel. Gewiss, auch der Schlosshof Krummenhus war gepflastert, aber zwischen den Steinen wuchs in der wärmeren Jahreszeit doch wenigstens Gras, und die Beine konnten sich in dem weichen Sand der Landwege erholen, in dem man oft bis an die Knöchel einsank. In der Stadt, ließ Grete sich erzählen, musste jeder Hausbesitzer im Winter Schnee fegen und im Sommer das Gras ausrupfen lassen. Für jeden Grashalm, den der Polizeidiener fand, hatte der Bürger einen Silbergroschen in die Armenkasse zu zahlen. Jetzt war allerdings kein noch so kleines Hälmchen zu finden. Gewiss war der strenge Frost den milden Westwinden gewichen; am Tage, wenn die Stuben geheizt wurden, tropfte es schon aus den Ritzen der hölzernen Dachtraufen, und in den flachen Rinnsteinen lief das schmutzige Schmelzwasser den Marktberg hinunter, aber in den Nächten erstarrte es wieder zu blankem Eis.
Die Gassenjungen machten sich einen Spaß daraus, morgens mit derben Stöcken die Eiszapfen abzuschlagen. Am Montagmorgen wäre so ein Brocken fast in Gretes Milcheimer gefallen. Das Mädchen konnte gerade noch ausweichen, hob aber das Eis auf und warf es dem nächstbesten Jungen an den Kopf. Das war der Sohn des Stadtschreibers Kickermann. Seine Mutter erzählte es am Nachmittag Elisabeth Kattentid, und die schalt ihr Dienstmädchen tüchtig aus.
Grete führte nun dem Apotheker Simon Kattentid und seiner erwachsenen Tochter das Haus, versorgte Küche, Boden und Keller, und später kam noch der Kräutergarten dazu. Die Hausfrau war vor drei Jahren an Engbrüstigkeit gestorben; die Pillen und Mixturen ihres Mannes hatten dagegen so wenig geholfen wie die Aderlässe des Wundarztes Bütz. Bis jetzt hatte Ernestine, die langjährige Stütze des Apothekers, den Haushalt besorgt. Nun war sie in die Jahre gekommen und hatte sich ins Sabinenstift zurückgezogen. Sie stammte aus besserer Familie. Ihr Vater, ein Tuchhändler, war 1806, als die Franzosen das Hohenlohesche Korps in die Uckerwiesen trieben, durch eine verirrte Kugel umgekommen, ihre Mutter überlebte ihn nur um zwei Jahre. Ernestine, für die sich in jenen unruhigen Jahren kein Freier fand, der den Handel hätte weiterführen können, verkaufte das Haus und das kleine Warenlager und erwarb für den Erlös ein Anrecht auf einen Platz im Stift. Dann zog sie zu einer älteren Freundin, der Mutter Simon Kattentids. Sie blieb im Hause, als die alte Dame längst unter den schattigen Linden des Erbbegräbnisses ruhte, überlebte noch Simons Frau und gönnte sich endlich, als ihr das Podagra das Auf- und Niedersteigen der engen, steilen Treppen im Apothekerhause verwehrte, im Stift einen geruhsamen Lebensabend.
Als ihre Nachfolgerin kam Grete ins Haus. Elisabeth, die Tochter des Apothekers, kümmerte sich kaum um die Wirtschaft, sie kontrollierte selbst die Abrechnungen nur selten. Womit beschäftigte sie sich eigentlich? Sie las, ging spazieren, konnte stundenlang am Fenster stehen und auf die Gasse hinausstarren. Oder träumte sie? Grete begriff diese Untätigkeit nicht. Sie war schon in den frühen Kinderjahren angehalten worden, immer etwas zu tun. Sie sah es auch in anderen Familien: die Kinder konnten kaum richtig auf den Beinen stehen, da mussten sie schon mit anpacken, zuerst der Mutter zur Hand gehen, dann im Hausgarten und auf dem Deputatland herumwühlen, und schließlich nahmen die Eltern sie mit aufs Feld. Für die Schule blieb nur in den Winterwochen etwas Zeit. Mit dreizehn oder vierzehn Jahren nahm die Herrschaft die Mädchen in Dienst, später heirateten sie, und dann kam zur Tagesarbeit noch der Haushalt. Nur wenn sie Kinder bekamen, konnten sie sich zwei Tage ausruhen. Vielleicht gab es deswegen so viel Kinder im Dorf. Elisabeth Kattentid war nicht hübsch; sie wusste es wohl, aber sie gab sich auch keine Mühe, es zu verbergen. Sie übertünchte die Blässe ihrer Wangen nicht mit rotem Puder, sie versteckte die Ausdruckslosigkeit ihrer Augen nicht hinter geschwärzten Wimpern. Eitel ist sie nicht, dachte Grete Koppen.
Oft wenn Grete ihre junge Dienstherrin sah, überraschte sie sich dabei, wie sie sich hämisch über Elisabeths Magerkeit freute. Zu Hause hatte ihre Freundin Berta sie dürr gescholten. Als sie zum ersten Mal zum Tanz ging, hatte sie sich ein Tuch ins Mieder gesteckt, um eine kräftige Brust vorzutäuschen. Heute musste sie lachen, wenn sie daran dachte. Dieses Stadtmädchen mit dem komischen Namen war noch viel, viel dürrer als sie. Mademoiselle Elisabeth, wie sie sich gerne nennen ließ, war einen halben Kopf größer als Grete und in den Schultern noch schmaler, in der Brust flacher, von den Hüften gar nicht zu reden. Einmal, als sie ihr morgens die Schokolade ans Bett reichte, hatte Grete ihre Beine gesehen, sie waren kaum stärker als der gedrehte Spazierstock des Herrn Apothekers. Berta sollte noch ein Wort von dürr sagen!
Bei ihren vielen Laufereien kam Grete nur selten dazu, an Hinrich zu denken. Dass ihn der Herr vom Hof gejagt hatte, wusste sie noch. Von Tine Krenzin, die sie auf dem Markt traf, erfuhr sie, dass ihn die Bauern im Dorf reihum beköstigt hatten und ihm auch das Nachtlager gaben. Er musste es abarbeiten. Nur Wilhelm Krumbeck verriegelte das Tor, wenn Hinrich in die Nähe des Gehöftes kam.
Grete war dankbar für die Nachrichten, aber sie ärgerte sich auch gleichzeitig, dass Tine feuchte Augen bekam, wenn sie von Hinrich sprach. Sie war erst sechzehn, und ihr Vater besaß den größten Hof in Krummenhus. Gab es denn keine anderen Burschen im Dorf als Hinrich? Er hatte doch mit dem einen Bauernmädchen genug Ärger. Warum musste er sich überhaupt in so eine vergaffen? Bauer und Knecht verträgt sich auf dem Acker, aber nicht in der Stube.
Grete kam mit ihren Gedanken nie zu Ende. Sie sagte sich, dass nun kein Weg mehr von Hinrich zu Gertrud führte und dass er frei war für sie; sie bekam schon Leibschmerzen vor Aufregung, und dann rief das Fräulein und wollte die Schuhe geputzt oder die Haare aufgesteckt haben. Oder sie musste für den Herrn Apotheker Flaschen und Kruken spülen. Sie warf die Zöpfe über die Schulter und vergaß ihre Träume.
Jede Arbeit wartete auf sie: Fenster putzen, Wäsche einweichen, Fußböden stählen, Teppiche bürsten. Erst abends, wenn sie zur Marktecke ging, um aus dem städtischen Brunnen zwei Eimer Wasser für die Nacht zu holen, hatte sie zwanzig Schritte Zeit, an Hinrich zu denken. Wenn sie dann die Treppe zu ihrer Bodenkammer hinaufgestiegen war, den kümmerlichen Kerzenstumpf ausgeblasen und sich unter das klammkalte Federbett verkrochen hatte, schlief sie ein, ohne auch nur ihr Nachtgebet, in das sie Hinrich einschließen wollte, vor sich hinmurmeln zu können.
Die steilen Stiegen ermüdeten sie am meisten. Im Schloss benutzte sie nur die breite Freitreppe mit ihren siebzehn bequemen Stufen. Die Zimmer in den oberen Stockwerken betrat Grete nie, den Bergfried kannte sie nur von unten. Die Küchenmädchen schliefen in einem Verschlag neben der abgeschlossenen Speisekammer. In den Keller durfte nur die Mamsell hinuntersteigen; die Gnädige hatte Angst, die Mädchen könnten unter ihren Röcken etwas davonschleppen, was der Herrschaft gehörte. Dieses uralte, unheimliche Stadthaus hatte mehr Treppen als der Fisch Gräten. Die morschen Stufen knarrten bei jedem Schritt, Grete fürchtete durchzubrechen und in den modrigen Keller zu stürzen, wo Asseln und Tausendfüßler hausten und Ratten und Mäuse.
Dieses Haus, das in seinem Erdgeschoss die Grüne Apotheke beherbergte, war eins der ältesten Häuser der Stadt. Nur die beiden Kirchen, das Spital St. Jürgen und die Stadtmauer mit ihren Toren und Türmen waren vor ihm erbaut. Das Rathaus war weit jünger, das war erst vor hundert Jahren von einem berühmten Baumeister errichtet worden, nachdem der alte Fachwerkbau dem großen Stadtbrand zum Opfer gefallen war. Simon Kattentid war stolz auf das Alter seines Hauses und stolzer noch auf das Alter seiner Familie, die in diesem Hause wohnte, soweit des Stadtschreiber Kickelmanns Urkunden in die Vergangenheit hinabreichten. Die Kattentids waren eine alte Färberfamilie, ihr gehörten vielfach die Altermänner der Zunft an. Der letzte Färber Kattentid wurde im Nordischen Krieg von marodierenden Dänen erschlagen. Das Erbe übernahm sein jüngerer Bruder Mattes; er besaß zum Färber weder Verstand noch Neigung, hatte sich aber auf Reisen, die ihn bis nach Magdeburg und Wittenberg führten, in allerlei Wissenschaften versucht. Da er einmal einem kurfürstlichen Rat gefällig gewesen war, verhalf ihm dieser zu einem Privileg. So kam Witgard zu der ersten Apotheke in zwölf Meilen Umkreis. Zwar gab es nicht viele Kranke, die nach seinen Pillen verlangten, aber der genügsame Mattes war schon zufrieden, wenn ihm nur Zeit blieb, über Gott und die Welt zu meditieren. Im zehnten Jahr brachen die Schwarzen Pocken aus, fast die Hälfte der Bewohner des Städtchens fiel der Seuche zum Opfer. Mattes blieb von der Ansteckung verschont, fortan hielten ihn die Überlebenden für einen kunstreichen Mann.
Seine Genügsamkeit und sein Wissensdurst hatten sich auf Simon vererbt. Auch Simon saß lieber über einem Schweinslederband als über einem steinernen Mörser. Sein jüngerer Bruder hatte in Berlin in eine kleine Druckerei einheiraten können, er versorgte den Älteren mit mancher neuen Schrift. Aus der Zeit, in der er mit der Freischar des Majors Lützow gegen die Welschen gezogen war und das Glück gehabt hatte, den flammenden Versen Theodor Körners zu lauschen, stammte seine Vorliebe für Gedichte. Er ließ sich die Neuerscheinungen kommen und las sie in seinen stillen Stunden vor sich hin, niemals laut, er hätte sich vor seiner eigenen Tochter geschämt.
Er gab sein Geld für Bücher aus und hätte doch besser daran getan, Groschen auf Groschen zu legen, um seiner Tochter eine Zukunft zu schaffen. Sein alter Freund, der Wundarzt Bütz, gab sich redlich Mühe, ihm durch reichliche Verschreibungen Kundschaft zuzuführen; aber in dieser gesunden Gegend erkrankten gewöhnlich nur solche Menschen, die das Geld für die Medizin nicht besaßen. Oder sie hielten sich an ein Allheilmittel, das Simon Kattentid in seinen Regalen nicht führte: den Richtenberger Korn. So hielt der Apotheker sich und sein Haus zwar über Wasser, aber die paradiesische Insel des Reichtums erblickte er nur aus der Ferne. Seine Vorväter hatten sich in Notzeiten damit geholfen, dass sie verschiedene würzige Liköre brauten. Aber Simon Kattentid, der Volksmann, brachte es nicht übers Herz, dem Verführer Alkohol Kupplerdienste zu leisten. Er stellte die Destillation ein. Abends setzte sich Simon Kattentid gern in die „Drei Kronen“, wo sich die Bürger zu einem Glas Weißbier zusammenfanden, um über die Unvollkommenheit dieser Welt zu stöhnen. Der Apotheker hörte zu, zuerst still, dann warf er ab und zu ein Wort ein, ein recht überlegtes, und schließlich trug er vor, wie er die Welt einrichten würde, wenn er der Schöpfer wäre oder doch wenigstens in den profanen Angelegenheiten über sie zu befinden hätte.
Seine Gedanken, die er sich in jahrelangem Sinnen zurechtgelegt hatte, lockten immer mehr Zuhörer an; an jedem Abend wurde die Runde um seinen Tisch größer. Er drängte sich nie auf, er hörte sich ihre Sorgen an und gab dann seinen Rat. Der Bäcker Molling hätte gern auf das Siebenpfundbrot zwei Pfennige abgeschlagen, und der Bürstenbinder Lutkewer, der elf Kinder ernähren musste - sechs von seiner ersten, fünf von der zweiten Frau - hätte es gern um zwei Pfennige billiger gehabt.
„Das ist eine der Antinomien der heutigen Welt", erklärte Kattentid, „wobei Thesis und Antithesis gleich begründet sind. Thesis: Es liegt in der Natur jedes Gewerbes, seine Überschüsse vergrößern zu wollen. Antithesis: Es liegt in der Natur des Menschen, sich sättigen zu wollen. Versuch einer Synthesis: Meister Molling verkauft sein Brot billiger und dafür eine größere Anzahl.“
„Ich wollte wohl, aber wer soll sie mir abkaufen?“
„Durch den geringeren Preis ist eine größere Anzahl Personen in den Stand gesetzt, die erforderlichen Mittel zum Ankauf benötigter Nahrungsmittel aufzubringen."
„Das ist Unsinn", stritt Molling, der leicht heftig wurde, „ich bin abhängig von den Mehlpreisen, und wenn ich’s Brot nur um einen Pfennig verbillige, muss ich draufzahlen."
„Ergo: Synthesis verworfen. Antinomie unter heutigen Verhältnissen nicht auflösbar. Woraus folgt: die Verhältnisse müssten geändert werden. Der Bürger, bisher ein Passivum, muss sich in ein Aktivum verwandeln - populär gesagt, meine Herren: Das Bürgertum ist ein Mühlrad, das die Arbeit leisten muss, nämlich das Getriebe der Gesellschaft in Gang halten, aber abhängig ist von dem Wasserstrom staatlicher Gesetze und Verordnungen. Dieser Strom aber wird reguliert von der absoluten Gewalt. Das Bürgertum kann nur gedeihen, wenn es sich selbst an das Wehr stellt und die Hand, die den Strom reguliert, lenkt. Wer wüsste besser, welche Kraft vonnöten ist, um dem Mühlrad die höchste Effektivität abzuzwingen.“
Seine Zuhörer klatschten Beifall. Simon Kattentid war der Mittelpunkt eines Kreises aufrecht denkender Bürger.
Man konnte nicht den ganzen Abend vor einem einzigen Glas sitzen. Abgestandenes Bier und abgestandene Gedanken schmecken gleich schal. Der Apotheker sah sich genötigt, die verpönte Destillation wieder aufzunehmen. Er tat es, damit sie ihn in den Stand setzte, Wahrheit und Erkenntnis zu verbreiten. Jedoch beschränkte er sich auf einen süßen Himbeerlikör für adlige Damen, schwach in den Prozenten und mild in seiner Wirkung auf das Gemüt.
Nun aber sah Kattentid seine Position bedroht durch den schwarzbärtigen Uhrmacher, der erst vor wenigen Monaten hier zugezogen war. Er hatte halb Europa durchwandert und wusste fesselnd davon zu erzählen. Aber er hatte wohl auch kuriose Ideen mitgebracht, Ideen, die nicht gedruckt werden durften, Kattentid fand nichts davon in den Schriften, die er sich zusenden ließ. Der Apotheker war weiß Gott für Freiheit und Fortschritt, aber was der Uhrmacher verkündete, grenzte fast an Revolution. Das war gefährlich. Wer sichergehen und sein Ziel nicht verfehlen will, muss langsam gehen.
Zuerst fand Stojentin nur Anklang bei den jüngeren Leuten. Gewiss, die Jugend war rasch mit dem Wort, laute Reden liebte sie. Die Jünglinge, die später einmal als ehrsame Bäckermeister, Tuchhändler oder gar Ratsherren die überkommene Ordnung für die beste hielten, opponierten heute dagegen. Sie träumten von Freiheit, denn sie waren abhängig von den Groschen, die ihnen ihre Mütter heimlich in die Rocktaschen steckten. Sie riefen nach Demokratie, denn sie hätten gern mitzureden gehabt über ihrer Väter Ladenkassen.
Der Weber Grietzmann und der Zigarrenmacher Rule führten Stojentin in den Kreis der „Drei Kronen“ ein, und der Uhrmacher fand bald seine Zuhörer. Rule, der sich gern „Fabrikant" nennen ließ, denn er beschäftigte fünf Gesellen und sieben angelernte Frauen, lauschte ihm am eifrigsten. Immer wieder musste er ihm von den Riesenwerken in den großen Städten und am Rhein erzählen, die so viel Leute beschäftigten, dass der Besitzer sie gar nicht alle kannte. Er träumte sich wohl auch schon als Meister von hundert Gesellen. Nur wenn Stojentin seine Lieblingsthese erläuterte: „Alles Übel kommt von dem ungleich verteilten Eigentum", rückte Rule von ihm ab. Um seinen Platz stritten sich dann der Kistenmacher Boddiker und der Buchhandlungsgehilfe und Redakteur Mahnkopp. Der Kistenmacher verlangte, dass endlich das Rauchen auf offener Straße erlaubt sein sollte, und der lang aufgeschossene, sommersprossige Redakteur machte sich eifrig Notizen. Hin und wieder fand man dann etwas von Stojentins Gedanken in den Spalten des „Witgardschen Couriers", dessen Besitzer, der Buchhändler Max Grigolat, darauf schwor, dass es lediglich Mahnkopps scharfer Feder zuzuschreiben sei, wenn seine Zeitung, die dreimal wöchentlich zwei Doppelseiten herausbrachte, dem amtlichen „Kreis- und Volksblatt" immer mehr Abonnenten abzog.
Ein Glück, fand Kattentid, dass Stojentin nicht jeden Abend die „Drei Kronen" aufsuchte. Es hieß, er wäre viel auf den Dörfern. Sollte er doch den Bauern die gerechte Verteilung des Eigentums predigen. Vielleicht fielen die auf ihn herein. Und er auf sie. Hatte er doch vorgestern von ihnen verlangt, sie sollten eine Petition an den Landrat abfassen und verlangen, dass der Schlossherr von Negendangk einem Bauern, dessen Weib der Inspektor unsanft zur Arbeit aufgefordert hatte, Schmerzensgeld zahle und einem Knecht, den er wegen Widersetzlichkeit vom Hof gejagt, in Gnaden wieder aufnehme. Mahnkopp hatte ihn unterstützt und laut nach Freiheit geschrien. Glücklicherweise war dem Oberlehrer Nippolt das schöne Wort eingefallen: „Die Mutter der Freiheit heißt Einsicht!“ Die Bürger hatten eingesehen, dass man den Landrat nicht verärgern dürfe. Sie wollten die Bauern nicht daran hindern, beim Landrat zu petitionieren, aber sie wollten sie auch nicht aufmuntern.
Und nun kam Stojentin mit dieser Nachricht. Schon in der Tür blieb er stehen und schwenkte seinen Zylinder. Der frische Luftzug, den er mitbrachte, ließ die trüben Öllämpchen aufflackern. „Freunde!", rief er und schloss die Tür. Die Flammen beruhigten sich, die Gespräche verstummten. Selbst der Oberlehrer, der gerade dem Wundarzt erläuterte, alles Unheil im Reich gründe sich auf das Faktum, dass seinerzeit nicht der Erzherzog Karl, der Sieger von Aspern, Kaiser geworden war, sondern der steifsinnige, bigotte Franz, unterbrach seine gelehrten Ausführungen und wandte sich dem Ankommenden zu.
„In München. Freunde, in München hat das Volk den König Ludwig gezwungen, die Gräfin Landsfeld außer Landes zu jagen, die spanische Tänzerin!"
Die Männer an den Tischen sprangen auf. Jakob Fredrichs, der Wirt, begann um seine Gläser zu bangen. „Erzählen Sie, Herr Uhrmacher! Woher haben Sie die Nachricht?“
„Von einem Durchreisenden, der mit der Berliner Post eintraf und sofort weiterreiste. Es heißt, fast hätte Ludwig selbst gehen müssen. Zweitausend Bürger sind vor das Schloss gezogen. Fürst Leiningen selbst hat ihre Forderungen überbracht."
„Ja, auf die Fürsten mögen die Könige vielleicht hören!“
„Zweitausend Bürger standen im Schlosshof. Das Volk hat dem Souverän seinen Willen aufgezwungen.“
„Und überhaupt“, rief Rule dazwischen, „ist es ein Unsinn, wenn drei Meilen von hier, im Großherzogtum Strelitz, kein Mensch meine Zigarren rauchen kann, nur weil der Staat den hohen Zoll aufschlägt, damit er sein Militär bezahlen kann."
Mahnkopp griff Kattentids alten Gedanken auf. „Die Männer, die am Stauwehr unseres Staates stehen, müssen ausgewechselt werden, wenn der Teich nicht überlaufen und der Druck der Wassermassen nicht das Mühlrad zerbrechen soll. Ob nicht kluge Worte unseren König zu dieser Einsicht brächten?"
„An ihn kommt keiner heran, der’s ihm sagen könnte, er fräße sich denn durch einen Berg von Lakaien und Adelsherren."
Kattentid wollte die Aufregung besänftigen, aber er kam nicht zu Wort.
„Darum müssen wir den Bauern und Dienstleuten von Krummenhus beistehen gegen Negendangk."
Jörg Lutkewer pfiff laut und ungeniert Stojentins Lied. Er brauchte nicht zu singen, die Herren kannten den Text:
„Kein Graf, kein Fürst, kein Edelmann.“
Nippolt hob beschwörend die Hände. „Meine Herren, Sie hören es! Den Bauern helfen, hieße Aufruhr predigen und Anarchie. Nein, die Bauernseele begreift niemals, dass es nicht um - mit Verlaub - Kuhfladen und Mäusedreck geht, sondern um die hehrsten Ideale der Menschheit!“
„Ob sie begreifen oder nicht, sie stärken unseren Haufen."
„Welch ein Irrtum! Nicht die Zahl der Köpfe entscheidet über den Zustand eines Gemeinwesens, sondern ihre Klarheit. Der Bauer ist seiner Natur nach Materialist, essen und arbeiten, das ist sein Leben. Die Idee der Freiheit kann nur in einem denkenden Kopf geboren und verwirklicht werden.“ Er trank sein Bier aus und ging.
„Ein kluger Kopf, unser Oberlehrer", nickköppte Bäcker Molling, „ein wirklich kluger Mensch!“
Stojentin beschloss, noch einmal mit Kattentid zu reden. Der Apotheker war wohl ein bisschen versponnen, er kam zu wenig unter die Menschen, Jakob Fredrichs Bierstube war nicht die Welt, aber Kattentid hatte sich doch die Fähigkeit zum Nachdenken bewahrt. Er musste einsehen, dass die Not auf ihrem Weg von den Dörfern in die großen Städte auch die Flecken und Kleinstädte nicht liegen ließ. Es war derselbe Knebel, der sie presste, die Bürger wie die Bauern.
Doch er traf den Apotheker nicht an. Die Tochter des Hauses, Elisabeth, forderte ihn auf: „Treten Sie nur ein. Sicher wird mein Vater sich freuen, Sie auf ihn warten zu sehen."
Unkonventionell, geradezu modern, dachte Stojentin und vergaß die schweren Gedanken, die ihm in der Nacht die Träume vergällt hatten.
Er nahm auch heute im Studierzimmer auf einem harten, scharfkantigen Stuhl Platz. Auf dem Schreibpult neben dem Fenster lag ein weißer Zettel - an den Rändern eingerissen, bemerkte er und ärgerte sich, dass ihm so etwas Albernes auffiel. Warum saß er steif wie ein Knotenstock in der Ecke? Er musste ein Gespräch mit der Gastgeberin beginnen. Sollte er ihr ein Kompliment über ihr Kleid sagen? So etwas hörten die Damen gern.
Aber davon verstand er zu wenig. Oder über ihr Haar? Doch das hatte jene Farbe, von der er nicht zu sagen wusste, ob sie blond oder braun hieß. Ober ihren Mund? So etwas sagte man wohl nicht. Ihre Augen? Das war allzu plump. Blieb nur das Wetter. Doch darüber konnte jeder Bauer sprechen.
„Sie hatten sich gestern sehr ereifert, Herr Uhrmacher?" Stojentin erschrak. Der Zylinder mit der schwungvollen Krempe entglitt ihm. Er bückte sich danach. Elisabeth auch. Sie war schneller, nahm den Hut und legte ihn auf das Pult. Es war ihm peinlich.
„Danke, vielen Dank! Gestern Abend also, nun ja, unter Männern, beim Bier.“ Warum stotterte er nur? Dieses Mädchen war doch wirklich nicht so hübsch, dass sie einen aus dem Gleichgewicht bringen konnte.
„Mein Vater sprach davon. Natürlich hat er mir nicht erzählt, worüber Sie disputierten, ich bin schließlich ein Mädchen."
„Gewiss, gewiss.“
„Sie hätten das Talent, sagt mein Vater, nicht nur sich, auch ihre Zuhörer in Feuer zu reden."
„So ist es. Ich meine, man gibt sich Mühe. Bin ihm sehr verbunden, Ihrem Herrn Vater." Wirkten seine Worte doch tiefer, als er es selbst spürte? Ihm war es vorgekommen, als hätte er gegen eine Lehmwand gesprochen.
Sie schwiegen eine Weile. Was sollte er auf das Lob antworten? Sollte er vor ihr seine Ideen ausbreiten, ihr den Mechanismus des Eigentums demonstrieren, dessen unregelmäßiger Gang die Welt in Unordnung brachte? Das war wohl nichts für junge Frauen. Selbst Männer begriffen es nicht, wie das Exempel des Oberlehrers Nippolt bewies. Nur Geduld, mahnte er sich, nur Geduld, sie werden es lernen. Er war als Uhrmacher Feinarbeit gewöhnt, der Mensch aber ist die komplizierteste Mechanik.
„Der Herr war viel auf Reisen?“
Jetzt gab sie ihm das Stichwort, jetzt wusste er zu reden: „Es ist so Brauch in der Zunft. Durch ganz Deutschland bin ich gewandert, bis nach Bayern und Baden hinaus und für drei Wochen in die Schweiz, dann den Rhein aufwärts bis zu den großen Städten, Köln und Düsseldorf und wie sie heißen. Dort ist ein anderes Leben."
„Wie interessant! Erzählen Sie, erzählen Sie."
Sie vertieften sich so in ihr Gespräch, dass sie aufschraken, als die Türglocke bellte. Das Mädchen ließ den Hausherrn ein.
Seltsam, dachte Stojentin, zu ihm bin ich gekommen. Nun ist er da, und ich ärgere mich fast.
Wirklich, er hatte seinen ganzen Wortvorrat herausgesprudelt, nun war sein Kopf leer wie nach einer Biernacht. Keine halbe Stunde blieb er mehr, sagte nichts von dem, was er hatte sagen wollen, und verabschiedete sich, ohne an seinen Hut zu denken, der auf dem Schreibpult lag.
Draußen schien die Sonne warm, als sollte es einen frühen Frühling geben. Die Dachrinnen tropften. Stojentin ging mitten auf dem Damm und bemühte sich, den schmutzigen Pfützen auszuweichen.
Das Dienstmädchen Grete brachte ihm den Hut nach. Er wollte ihr einen Groschen Trinkgeld in die Hand drücken. Sie nahm in nicht.
„Ich wollte Sie lieber etwas fragen, Herr Stojentin."
„Fragen Sie schon. Wenn ich antworten kann, will ich es gerne tun." Er sah Grete an. Sie hatte große braune Augen. Seit wann bemerke ich das? wunderte er sich und versuchte sich an Elisabeths Augenfarbe zu erinnern. Es gelang ihm nicht.
„Sie haben neulich zu dem Herrn Apotheker von einem Knecht gesprochen, von Hinrich Knubbe aus Krummenhus."
„Ganz recht." Knubbes wegen war er zu dem Apotheker gegangen, hatte aber vergessen, mit ihm darüber zu reden. Jetzt konnte er nicht mehr umkehren. Vielleicht versuchte er es an einem der nächsten Tage noch einmal.
„Wissen Sie, was er jetzt macht?"
„Ich sehe ihn morgen. Soll ich ihm etwas bestellen?“
„Kein Wort, bitte. Sagen Sie ihm auch nicht, dass ich gefragt habe." Sie lief fort.
Stojentin behielt den Hut in der Hand. Ein warmes Frühjahr kündigte sich an.
3. KAPITEL
Auf kurze, strenge Winterwochen folgten früh ein paar warme Tage. Ende Februar lag kein Schnee mehr auf den Feldern, der Boden war frostfrei. Die Bauern nutzten die Zeit, zogen hinaus mit Pferd und Pflug, um die sandharte Ackerkrume aufzubrechen und für die Sommersaat vorzubereiten. Mutter Awitz hatte kaum den Kupferkessel, in dem sie den Mittagsbrei kochte, ausgekratzt und gescheuert, da musste sie ihn erneut aufs Herdfeuer setzen. Die Männer, die den Tag über schwer arbeiteten, kamen abends ausgehungert heim.
Christian Awitz, der Bauer, war schon da. Er hob den schweren Kessel vom Herd und goss die Kartoffeln ab. Der heiße Dampf schlug ihm in die Augen, und er musste den Kopf abwenden. Das Kartoffelwasser, mit Schalen, Gerstenkleie, Eichelschrot und Kastanienmehl verrührt, bekamen die Schweine.
Als er die heißen Kartoffeln auf den blank gescheuerten Tisch schüttete, kam Jochen nach Hause. Er zog die Joppe aus, warf sie über die Lade und nahm eine Kartoffel vom Tisch.
„Lass dir wenigstens Zeit, bis die anderen da sind.“ Jochen legte die Frucht, deren dünne Schale in seiner Hand platzte, zurück auf den Haufen. „Na ja“, brummte er, „muss mich auch erst waschen."
Christian Awitz hatte drei Söhne. Wilm, der älteste, stand bei den Kürassieren. Nach seiner Dienstzeit sollte er den Hof übernehmen. Christian fühlte schon die Last seiner Jahre. Wenn er fünf Stunden hinter dem Pflug herging, setzte sich Wasser in seinen Beinen. Mit dem Daumen konnte er richtige Dellen in die Waden drücken.
Man wird eben alt, dachte er und rückte sich den Schemel zurecht. Fritz, der zweite Sohn, konnte vielleicht auf dem Hof bleiben und Wilm zur Hand gehen. Für Essen, Trinken und eine wollene Jacke auf dem Leib langte es gerade noch. Und Jochen? War Wilm Bauer, musste er heiraten, Kinder stellten sich ein, nicht wenige, Wilm war ein stattlicher Kerl. Fritz heiratete wohl auch, das war nun mal so im Leben. Dann wurde es eng im Haus, selbst wenn die beiden Alten sich auf den Weg machten, von dem es keine Rückkehr gibt.
Sollte Jochen als Knecht gehen, zu Negendangk oder auf den Schulzenhof? Nein, ein Bauernsohn taugte nicht zum Knecht, und wenn er auch auf einem noch so kleinen Hof aufgewachsen war. Am Ende musste er in die Stadt ziehen. Dort ging der Junge ein, wurde pflasterlahm wie ein Bauernpferd auf diesen neumodischen Kunststraßen, erblindete, weil die Augen in den engen, krummen Gassen keinen Platz zum Schauen fanden, vertrocknete zwischen den steinernen Häusern.
Wenn Jochen in eine kleine Wirtschaft einheiraten könnte! Früher hatte Christian an Gertrud Krumbeck gedacht. Aber das tat Jochen Hinrich Knubbe nicht an. Dass auch immer mehr Jungen aufwuchsen, als es Wirtschaften gab!
Die Frau stellte eine Schale mit körnigem Salz auf den Tisch und schimpfte: „An den kurzen Tagen müssten auch zwei Mahlzeiten reichen. Abends kann man sich ins Stroh werfen, Hunger schläft sich weg."
„Sind doch bloß Kartoffeln und Salz, Mutter."
„Du bist immer spendabel, und ich muss einteilen. Wir haben kaum genug für uns, und du holst dir fremde Leute auf den Hof. Willst wohl den Großbauern spielen.“
Wie immer, wenn seine Frau schimpfte, rieb sich Christian das linke Knie und schwieg. Es war besser, sie ausreden zu lassen, dann wurde sie von allein wieder zugänglich.
Jochen fuhr die Mutter an: „Hinrich ist kein Fremder. Wir Bauern haben alle etwas gutzumachen an ihm, nicht nur eine Handvoll trockener Kartoffeln."
Christian vergaß vor Staunen, das Knie zu reiben. Was für einen Ton der Junge gegen die Mutter wagte! Und die Alte blieb ruhig dabei. Sie schüttelte nur den grauen Kopf. „Was musste er die Hand gegen seinen Brotherrn erheben? Gott hat die Herren in die Daunen gesetzt und die Knechte ins Stroh.“
„Mutter, du weißt nicht, was du sagst. Sollte er mit der Peitsche auf einen Menschen losgehen wie auf ein störrisches Stück Vieh?"
„Aus dem Weg gehen, aus dem Weg gehen! Ich hätte mich hinter die Häckselkiste geschlichen. Vor dem Blitz und dem Unrecht soll man sich ducken."
Der Bauer schlug mit der Faust auf den Tisch. Ein paar Kartoffeln sprangen hoch und rollten hinunter, fielen zur Erde. Die Katze haschte danach und zog sich mit ihrer Beute unter den Schrank zurück.
„Du redest, wie du’s verstehst!", schrie Christian die erschrockene Frau an. „Misch dich nicht in Männersachen! Und du, Junge, häng deine Jacke an den Nagel. Mit der Mutter wird nicht gestritten."
Jochen hob die Jacke auf, schwieg aber nicht. „Was wahr und recht ist, muss gesagt werden.“
„Mit der Wahrheit redest du dich um Kopf und Kragen, Junge, wenn du sie zu laut aussprichst!“
Die Mutter wollte einlenken. „Ist doch kein Leben für einen Mann. Ihr reicht ihn herum von einem Hof zum andern, ein Dreschholz, das man sich ausborgt. Und wenn das Korn im Sack und das Stroh leer ist, wirft man es in die Ecke."
„Schluss jetzt! Kiewt euch wie zwei Hähne um einen Regenwurm. Ich werd ihn aus dem Haus weisen, dann hab ich meine Ruhe vor euch.“
„Wenn du das tust, Vater, geh ich mit!“
Was war nur in den Jungen gefahren? Er hätte seinem Vater nicht solche Antwort geben dürfen. Da die Hoftür klappte und Hinrich und Fritz anlangten, sparte er sich die Zurechtweisung für später auf.
Die Haustür knarrte. Ich muss sie schmieren, dachte Christian, wäre bloß das Fett nicht so knapp.
Sie nahmen am Tisch Platz. Hinrich saß auf der Fensterseite neben Jochen. Die Frau reichte jedem ein Stück geräucherten Speck. Hinrich bekam die dickste Scheibe. „Donnerwetter, Mutter", entfuhr es dem Bauern, „was ist denn heute für ein Feiertag?“
„Ach du Dummlack!“ Marta Awitz lächelte müde und biss in eine dicke, mehlige Kartoffel.
Hinrich aß hastig. Er war nicht hungriger als sonst, aber die Scheibe Speck beunruhigte ihn. Alle hatten sie ihn angesehen, als die Bäuerin ihm das dicke Stück herüberreichte. Mitten in der Woche Speck! Pellkartoffeln und Salz, wer Durst hatte, schöpfte sich eine Kelle Wasser, das war die tägliche Abendmahlzeit der Bauern. An heißen Tagen gab es eine Schüssel dicker Milch dazu und sonntags Schmalz. Eine Speckschwarte oder einen Zipfel Wurst gab es nur in guten Zeiten. Gute Zeit aber war jetzt nicht.
Er erhob sich, ohne gesättigt zu sein, und ging hinaus. Niemand fragte nach dem Grund. Beim Mahl sprach man nicht. Draußen zog er die Leinenjacke enger um die Schultern und knöpfte sie bis oben zu. Der Wind wehte doch noch recht scharf. Dabei hatte er noch gut eine Stunde Zeit, vielleicht länger. Wenn er jetzt in der Dämmerung zu den drei Weiden hinunterging, wusste morgen das ganze Dorf, dass er sich heimlich mit Gertrud traf. Dann sperrte ihr Vater sie ganz ein. Gestern schon hatte Hinrich vergeblich gewartet. Ihr Vater bewachte sie wie ein Hütehund die Herde; jeden Abend musste sie eine neue Lüge ersinnen, um seinen Argwohn zu täuschen. Oder war es Gertrud müde, sich mit dem Geächteten heimlich für eine halbe Stunde zu treffen? Hinrich schlug das Beil in den Klotz, dass es tief in das Holz drang und stecken blieb. Er hatte Mühe, die Schneide herauszuziehen, er ruckte, zerrte und hätte fast den Helm abgebrochen.
Wenigstens vergaß er dabei die dummen Gedanken. Er nahm einen Kloben nach dem andern und spaltete ihn zu Kleinholz. Als Jochen ihn ansprach, schrak er auf. „Heute hackst du hier Holz, morgen breitest du dort Mist; heute für eine Handvoll Kartoffeln, morgen für einen Teller Mehlbrei. Heute Nacht kriechst du ins Stroh, morgen unter einen verlausten Woilach. Ist das ein Leben!“ Er nahm Hinrich das Beil aus der Hand und strich mit dem Daumen über die Schneide, als prüfe er die Schärfe.
„Ihr wollt mich los sein. Darum also das Abschiedsessen."
Jochen knuffte den Freund in die Rippen. „Wir kommen der Sache auf den Grund, sagte der Schiffer, da lief sein Kahn auf den Strand. Weißt du, eigentlich müsste ich dich jetzt verprügeln, aber vielleicht begreife ich dich. Ich weiß ebenso wenig wie du, was aus mir werden soll. Ich stelle mir vor, Hinrich, der Mensch muss ein Ziel haben. Man kann doch nicht dahinleben wie der Wurm, immer im Dreck kriechen; vorne frisst man ihn in sich hinein, und hinten gibt man ihn wieder von sich. Am Ende wird man breitgetreten und ist selbst nichts weiter als ein Dreck. Verstehst du? Ein Ziel muss man haben, irgendwohin wollen!“
„Ein Ziel müsste man haben. Es ist nur so schwer, sich ein Ziel zu suchen, wenn man bisher einfach dahingelebt hat, ohne sich Gedanken zu machen über den nächsten Tag. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Tag und Nacht, Regen und Sonnenschein, alles kam, ohne dass man etwas dazu getan hat, selbst für das Essen sorgte die Leuteküche. Die Arbeit teilte der Inspektor ein - er vergaß dich nicht, du brauchtest dir keine zu suchen. Das Korn hast du gesät und geeggt, und dann wuchs es. Du kümmerst dich nicht um Regen und um Wind, und im Sommer kannst du es schneiden. Wenn es nicht wächst und an seiner Stelle Kratzdisteln und Schachtelhalm emporschießen, dann muss das der Herr mit seinem Geldbeutel ausmachen. Wir leben wie die Ackergäule: wir kriegen unsern Hafer vorgeschüttet und gehen, wohin uns die Leine lenkt, und wenn wir nicht wollen, kriegen wir eins mit der Peitsche. So war das. Aber jetzt komme ich mir vor wie ein Zugvogel, der sich vor unserer nördlichen Kälte fürchtet und sich nicht in den warmen Süden retten kann, weil er nicht gelernt hat, die Flügel zu gebrauchen. Ich habe schon daran gedacht, in die Stadt zu ziehen, nicht nach Witgard, weiter weg, vielleicht nach Berlin. Arbeit muss sich doch finden lassen. Komm mit, Jochen! Du kannst hier auch nichts weiter werden als Knecht. Und wenn du Glück hast, findest du eine Frau und setzt Kinder in die Welt, die dann wieder Knecht werden, bis ans Ende der Welt. Komm mit! Leute und Bäume wachsen überall."
„Mag schon sein, Hinrich, aber alte Leute und alte Bäume kann man nicht mehr verpflanzen. Ich bin hier groß geworden, Hinrich. Ich muss Sand durch die Hände rinnen lassen können und im Sommer das junge Korn riechen, wenn es blüht und im Herbst die frischen Kartoffeln rösten in der Asche, gleich auf dem Acker. Ein anderes Leben kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei dir ist es vielleicht anders, du bist in der Stadt geboren."
„Ich red auch nur so dahin, Jochen, ich kann ja nicht fort von Gertrud."
Jochen setzte sich auf den Hauklotz. „Du versteifst dich da auf etwas, Hinrich. Dass ein Bauer als Knecht geht, das hab ich schon gehört, aber dass sie einen Knecht zum Bauern machen? Komm lieber mit in den Krug! Der Uhrmacher ist wieder da. Wir wollen uns wenigstens anhören, wie schön das Leben sein könnte."
„Vielleicht komme ich später noch hin.“