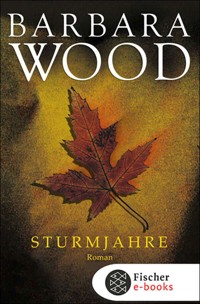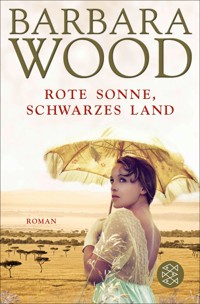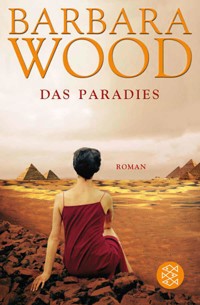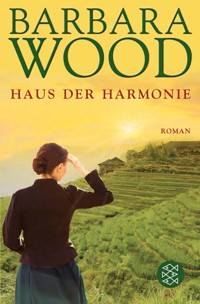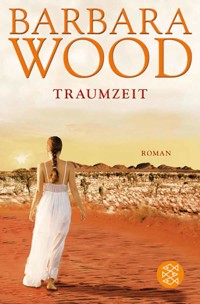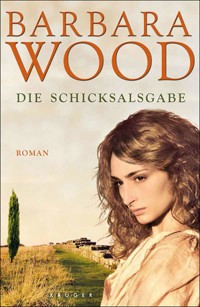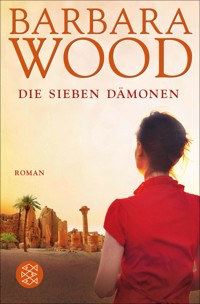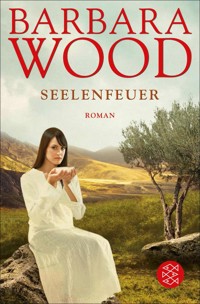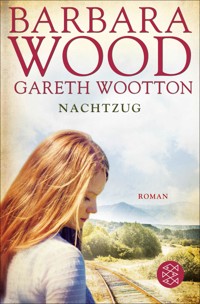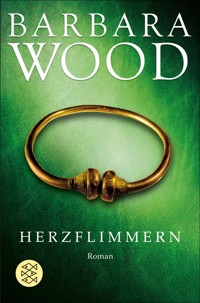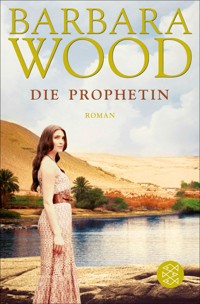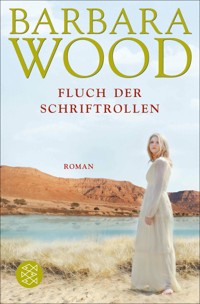9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausdrucksstark, atmosphärisch, anders: drei Romane von Bestsellerautorin Barbara Wood in einem Bundle »Das Perlenmädchen«: Sie ist die beste Perlentaucherin ihres Stammes. Aber Tonina darf nicht auf der tropischen Insel bleiben, die ihre Heimat ist. Allein muss sie auf das Festland, um dort die heilbringende Pflanze zu suchen, die das Leben ihres Großvaters retten kann. Ihr Ziel ist die Hauptstadt des Maya-Reiches. Unwissentlich wird sie zum Werkzeug einer Intrige. Als sie aus der Mayastadt flüchtet, weiß sie noch nicht, dass ihr abenteuerlicher Weg sie zum Geheimnis ihrer eigenen Herkunft führen wird… »Haus der Harmonie«: Über viele Generationen hinweg haben die Frauen der Familie Lee in chinesischer Tradition heilpflanzliche Medizin hergestellt. Jetzt hat Charlotte den Konzern übernommen und geht den Familienweg erfolgreich weiter. Doch plötzlich muss sich die junge Geschäftsfrau dafür verantworten, dass angeblich drei Menschen durch ihre Produkte zu Tode gekommen sind. Eine große Familiensaga zwischen China und Amerika, in der Spannung und schicksalhafte Gefühle raffiniert miteinander verknüpft sind. »Rote Sonne, schwarzes Land«: Kenia 1963 – Deborah flieht aus einem brennenden Land vor einer verbotenen Liebe. Einst war ihre Familie nach Kenia gekommen, um den Eingeborenen die Segnungen der modernen Medizin zu bringen. 15 Jahre später kehrt Deborah nach Kenia zurück und stellt sich auch ihrer eigenen Vergangenheit ... Die schicksalhafte Familiensaga über eine weiße Siedlerfamilie und einen afrikanischen Stammesverband.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2719
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Barbara Wood
Starke Frauen, weites Land
Drei Romane in einem Bundle: Das Perlenmädchen / Haus der Harmonie / Rote Sonne, schwarzes Land
Über dieses Buch
»Das Perlenmädchen«: Sie ist die beste Perlentaucherin ihres Stammes. Aber Tonina darf nicht auf der tropischen Insel bleiben, die ihre Heimat ist. Allein muss sie auf das Festland, um dort die heilbringende Pflanze zu suchen, die das Leben ihres Großvaters retten kann. Ihr Ziel ist die Hauptstadt des Maya-Reiches. Unwissentlich wird sie zum Werkzeug einer Intrige. Als sie aus der Mayastadt flüchtet, weiß sie noch nicht, dass ihr abenteuerlicher Weg sie zum Geheimnis ihrer eigenen Herkunft führen wird…
»Haus der Harmonie«: Über viele Generationen hinweg haben die Frauen der Familie Lee in chinesischer Tradition heilpflanzliche Medizin hergestellt. Jetzt hat Charlotte den Konzern übernommen und geht den Familienweg erfolgreich weiter. Doch plötzlich muss sich die junge Geschäftsfrau dafür verantworten, dass angeblich drei Menschen durch ihre Produkte zu Tode gekommen sind. Eine große Familiensaga zwischen China und Amerika, in der Spannung und schicksalhafte Gefühle raffiniert miteinander verknüpft sind.
»Rote Sonne, schwarzes Land«: Kenia 1963 – Deborah flieht aus einem brennenden Land vor einer verbotenen Liebe. Einst war ihre Familie nach Kenia gekommen, um den Eingeborenen die Segnungen der modernen Medizin zu bringen. 15 Jahre später kehrt Deborah nach Kenia zurück und stellt sich auch ihrer eigenen Vergangenheit ... Die schicksalhafte Familiensaga über eine weiße Siedlerfamilie und einen afrikanischen Stammesverband.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Barbara Wood ist international als Bestsellerautorin bekannt. Allein im deutschsprachigen Raum liegt die Gesamtauflage ihrer Romane weit über 14 Millionen, mit Erfolgen wie ›Rote Sonne, schwarzes Land‹, ›Traumzeit‹, ›Kristall der Träume‹ und ›Dieses goldene Land‹. 2002 wurde sie für ihren Roman ›Himmelsfeuer‹ mit dem Corine-Preis ausgezeichnet. Barbara Wood stammt aus England, lebt aber seit langem in den USA in Kalifornien.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER digiBook
Das Perlenmädchen:
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Woman of a Thousand Secrets« im Verlag St. Martin's Press, New York.
© 2008 by Barbara Wood
Das Buch wurde von der Literarischen Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2008 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Haus der Harmonie:
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Perfect Harmony« im Verlag Little, Brown, Boston und New York.
© 1998 by Barbara Wood
Das Buch wurde von der Literarischen Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 1998 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Rote Sonne, schwarzes Land:
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Green City under the Sun« im Verlag Randomhouse, Inc., New York.
© 1988 by Barbara Wood
Das Buch wurde von der Literarischen Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 1989 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd°, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491032-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Das Perlenmädchen
[Widmung]
PROLOG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
ERSTES BUCH MAYAPÁN [1]
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
ERSTES BUCH MAYAPÁN [2]
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
ZWEITES BUCH
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
DRITTES BUCH
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
VIERTES BUCH
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
FÜNFTES BUCH
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
Haus der Harmonie
Erster Teil [1]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Erster Teil [2]
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Zweiter Teil [1]
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Zweiter Teil [2]
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Rote Sonne, schwarzes Land
Für meinen Mann George, [...]
Ein Personenverzeichnis, Familiengenealogien und [...]
Vorwort
Prolog
Erster Teil [1]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Erster Teil [2]
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Siebenter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Achter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Neunter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Danksagung
Die Hauptpersonen
Chronologie der wichtigsten Ereignisse in Kenia
1824–1826
1846–1849
1885. Kapitel
1899. Kapitel
1905. Kapitel
1919. Kapitel
1920. Kapitel
1921. Kapitel
1928. Kapitel
1944. Kapitel
1950. Kapitel
1952. Kapitel
1953–1956
1960. Kapitel
1963. Kapitel
1969. Kapitel
1977. Kapitel
1978. Kapitel
1982. Kapitel
1987. Kapitel
Barbara Wood
Das Perlenmädchen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Veronika Cordes
Für meinen Mann George in Liebe
PROLOG
1
Es waren Rachegedanken, die Macus Herz erfüllten. Er musste das Mädchen ausfindig machen, das seinen Bruder gedemütigt hatte.
Unter dem Vorwand, sie könnte durchaus als Braut für ihn in Frage kommen, erkundigte er sich im Dorf nach Tonina und erfuhr, dass sie am Strand der westlichen Lagune anzutreffen sei, dort, wo die Perlentaucherinnen ihren täglichen Austernfang einholten.
Sein Bruder, der sich jetzt mit dem gemeinsamen Kanu auf der anderen Seite der Insel verbarg, hatte versucht, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Es sei schlimm genug, dass ein einfaches Mädchen ihn bei einem Schwimmwettbewerb besiegt hätte; Macus Racheplan würde alles nur noch schlimmer machen. »Sie schwimmt eindeutig besser als wir«, hatte er gesagt. »Du kannst sie nicht schlagen, Bruder.« Aber der zweiundzwanzigjährige Macu von der nahe gelegenen Halbmondinsel war stolz und voller Dünkel und verachtete Mädchen, die sich anmaßten, den Männern überlegen zu sein.
Die Perleninsel war ein kleiner grüner Punkt im türkisfarbenen Meer jenseits der Westspitze einer Landmasse, die später einmal Kuba genannt werden sollte. Sie verfügte über lediglich zwei zugängliche Häfen: die westliche Lagune und eine Bucht an der nördlichen Spitze, wohin Macu und seine Freunde, felsigen Untiefen ausweichend, mit ihrem Kanu gepaddelt und schließlich an einem schmalen Strand gelandet waren. Von dort aus führte ein Pfad durch dichte Bäume und Sträucher in ein betriebsames Dorf, in dem Kinder herumtobten, Frauen mit Kochtöpfen hantierten und Männer in den zahlreichen Schuppen, in denen Tabak getrocknet wurde, ihrem Tagewerk nachgingen.
Eine kleine Gruppe Neugieriger folgte Macu durch die Siedlung und hinunter zum Strand. Er achtete nicht auf das Geplapper um ihn herum, war, die Hände zu Fäusten geballt, erfüllt von dem Gedanken an Rache. Derart zielstrebig schritt er über den heißen weißen Sand, dass Reiher und Pelikane vor ihm die Flucht ergriffen und Männer verdutzt von ihren Ausbesserungsarbeiten an Kanus und Fischernetzen aufblickten. Nackte Kinder, die in dem ruhigen, warmen Wasser der friedlichen Lagune nach Muscheln gruben, sahen gespannt dem Fremden nach.
Macu war dunkelbraun, untersetzt und muskulös, sein fast nackter, von Narben übersäter Körper mit unzähligen Symbolen und Verzierungen bemalt. Sein langes schwarzes Haar, das ihm offen auf die Schulter fiel, wies ihn als unverheiratet aus, und außer einem aus Palmfasern gewebten Lendenschurz trug er zahlreiche Halsketten und Schutz verheißende Amulette. Dass er ein Fremder war, verdeutlichte die seinem Clan eigene Tätowierung auf der Stirn. Die Gruppe, die unter der warmen Tropensonne über den breiten Sandstreifen zwischen der limonengrünen Lagune und dem üppigen Dschungel landeinwärts hinter ihm her trottete, bestand aus den jungen Männern, die ihn von der Halbmondinsel begleitet hatten, sowie aus ein paar Dorfbewohnern, die ihre Arbeit unterbrochen hatten, weil sie ahnten, dass dieser Nachmittag mit einer willkommenen Zerstreuung aufwarten würde.
Kein Mann hatte sich je für die arme, unscheinbare Tonina interessiert.
Die Perlentaucherinnen hatten sich am Ende der Bucht, wo eine Felsklippe aus dem Meer ragte, versammelt. Die noch vom Meerwasser nassen dunkelbraunen Körper der zwölf- bis dreiundzwanzig Jahre alten Mädchen glänzten, und während sie die mit Austern gefüllten Netze aus ihren Kanus luden und die Muscheln auf den kühlen Sand unter schattigen Kokospalmen häuften, wurde gelacht und gescherzt. Obwohl Macu das Mädchen, das herauszufordern er gekommen war, noch nie gesehen hatte, erkannte er sie sofort. »Schön ist sie nicht«, hatte sein Bruder gesagt, so als wäre eine Niederlage, die ihm ein hübsches Mädchen beigebracht hätte, weniger beschämend. »Sie hat, ehrlich gesagt, nichts Anziehendes an sich.« Er hatte sie so genau beschrieben, dass Macus Blick sofort auf das Mädchen im Grasrock fiel, das Tonina hieß.
Sein Bruder hatte recht. Obwohl Tonina ihr langes Haar, das mit vielen Muscheln und einigen Perlen durchwoben war, die bei jeder Bewegung leise klimperten, offen trug und ihr Gesicht und die Arme mit unzähligen weißen Symbolen und Zeichen bemalt waren, sah sie nach Macus Geschmack keineswegs reizvoll aus. Kein Wunder, dass sie noch nicht verheiratet war. Alles an Tonina ließ zu wünschen übrig. Außer ihrer viel zu hellen Hautfarbe waren ihre Hüften sowie ihre Taille zu schmal, und bei allen Göttern!, Awak hatte nicht übertrieben: Das Mädchen war ungewöhnlich groß. Hätte Macu nicht ihre vom Tauchen noch mit Wasser benetzten goldfarbenen Brüste gesehen, hätte er sie für einen Mann gehalten.
Er verbarg seinen Zorn, damit sie nicht merkte, was er vorhatte, ging auf die Mädchen zu, hob die Hand wie zu einem freundlichen Gruß und rief: »Hallo!«
Die Mädchen fuhren herum. Als sie den gut aussehenden jungen Mann erblickten, setzten sie sich unwillkürlich sofort in Positur.
Tonina beachtete ihn zunächst nicht – noch nie hatte sich ein junger Mann für sie interessiert –, bis sie zu ihrem Erstaunen feststellte, dass das charmante Lächeln und die aufreizenden Blicke ihr galten. Sie hatte keine Ahnung, dass er der Bruder des Jünglings war, dem sie Tage zuvor davongeschwommen war – ebenso wenig wie sie wusste, dass sie ihn dadurch gedemütigt hatte.
Macu musterte das hochgewachsene, aber ansonsten nichtssagende Mädchen. Es war sein Plan, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und ihr dann, wenn er sie besiegt hatte, stolzgeschwellt zu verkünden, dass er es für Awak getan habe.
Der Plan bedeutete jedoch auch, den Geist eines uralten Meeresungeheuers herauszufordern.
Auf allen umliegenden Inseln kannte man die Legende von der Bestie, die an einer verbotenen Stelle in der Lagune der Perleninsel, unweit der Öffnung im Riff, wo das ruhige Gewässer auf das raue Meer traf, schlief. Man erzählte sich, dass dort das Skelett eines riesigen Seeungeheuers auf dem Meeresboden lag und dass der Geist des Monsters das Gewässer unsicher machte. Wenn die Männer von der Perleninsel mit ihren Kanus durch das Riff und über die Knochen des Untiers paddelten, gossen sie Kassavewein ins Wasser und baten das Monster, sie unbehelligt passieren zu lassen.
Dort zu schwimmen hatte noch niemand gewagt.
Weil Macu nicht hier aufgewachsen war, fühlte er sich gegen die Angst vor dem Geist des Meeresungeheuers gefeit. Tonina dagegen kannte bestimmt allerlei Geschichten, die sich um diesen Geist rankten, und würde sich deshalb hüten, schwimmend in dessen Revier einzudringen. In der warmen Nachmittagssonne, während Passatwinde durch die sich wiegenden Palmen strichen und Möwen am Himmel kreisten, begann Macu mit seinem Täuschungsmanöver.
»Bist du die, die man Tonina nennt?«, fragte er.
Nicht gewohnt, dass ihr ein Mann Aufmerksamkeit schenkte, lächelte Tonina verschämt. Junge Burschen hatten nichts für Mädchen übrig, die größer waren als sie selbst, aber da Macu genauso groß war wie sie, nahm sie an, dass ihn das nicht störte.
Mit wachsender Neugier scharten sich die Perlentaucherinnen um die beiden. Macu nannte Tonina seinen Namen, um sich dann großspurig über seine Geschicklichkeit und seine Erfolge beim Speerfischen auszulassen, ein Verhalten, das als Auftakt einer Brautwerbung üblich war. Bei allem, was er vorbrachte, übertrieb er maßlos – und legte damit wohlbedacht seine Falle aus, wusste er doch, dass das Ritual der Brautsuche auf der Insel vorsah, dass alle Bewerber ihre Fähigkeiten letztendlich unter Beweis stellen mussten.
Er bedachte Tonina mit einem Lächeln und fragte sie dann: »Bringst du den Mut auf, mit mir zu der Stelle zu schwimmen, an der es spukt, und nach einem Knochen des Monsters zu tauchen?«
»Guama! Da ist ein junger Mann von der Halbmondinsel. Er interessiert sich für Tonina!«
Toninas Großmutter, die in einem der Schuppen, in denen der Tabak trocknete, Blätter zu Zigarren rollte, hob erschrocken den Kopf. »Was? Ein junger Mann? Bist du sicher?«
»Sie sind in der Bucht. Und er fordert sie zu einem Wettkampf heraus!«
Guama blinzelte. Ein Jüngling, der sich für ihre Enkelin interessierte? Tonina war einundzwanzig und noch immer nicht verheiratet. Jedes Frühjahr kamen junge und auch ältere Männer von anderen Inseln auf der Suche nach einer Braut auf die Perleninsel, aber Tonina hatte bislang keiner von ihnen beachtet. War das Unerwartete schließlich doch noch eingetreten? Dass ein junger Mann Tonina begehrte?
Möge dem so sein, hoffte Guama inbrünstig. Das Mädchen musste unbedingt heiraten, was sonst hatte sie denn vom Leben zu erwarten? Wozu war eine Frau nütze, wenn nicht dazu, Kinder zu bekommen, sie großzuziehen und für einen Mann das Essen zuzubereiten? Gewiss, Tonina war eine geschickte Perlentaucherin, eine der besten, aber die Zeitspanne des Perlentauchens währte nicht lange. Die meisten Mädchen tauchten, bis sie ihr erstes Kind erwarteten, und dann war es damit vorbei.
Als sie dem Knaben zum Strand hinunter folgte, musste Guama an das Wettschwimmen vor ein paar Tagen denken, bei dem Tonina alle abgehängt hatte, auch wenn die Großmutter sie immer wieder beschwor, sie sollte die jungen Männer gewinnen lassen. Unseligerweise jedoch war Tonina durch und durch ehrlich und brachte es nicht über sich, sich selbst und andere zu belügen.
»Was für ein Wettkampf soll das sein?«, fragte Guama jetzt, mit einem Mal misstrauisch geworden.
»Raus zu den Knochen des Seeungeheuers zu schwimmen.«
»Guay!«, entfuhr es der Alten derart entsetzt, dass sie den Ausdruck benutzte, der in der Sprache der Inselbewohner Schmerz, Überraschung oder höchste Besorgnis verriet. Im Laufschritt hetzte sie zum Strand, so schnell ihre altersschwachen Beine es gestatteten.
Zu Macus Bestürzung ging Tonina auf die Herausforderung ein. Die Zuschauer hielten den Atem an. Ein Wetteifern um Tauchtiefe und Ausdauer war durchaus üblich – weit hinunterzutauchen, hoher Wellengang und gefährliche Strömungen, dies alles machte den Inselbewohnern nichts aus –, etwas ganz anderes dagegen war, zu einer Stelle im Meer zu schwimmen, an der ein Geist herumspukte. Macu hatte darauf vertraut, dass Tonina den Wettkampf entweder sofort ablehnen oder aber bald derart in Panik geraten würde, dass sie umkehrte und ihm den Sieg überließ.
Was Macu nicht wusste, war, dass Tonina keine Angst vor Meeresungeheuern oder deren Geistern empfand. Nichts im Ozean vermochte sie zu erschrecken. Und jetzt befand sich Macu in einer Zwickmühle. Aller Augen waren auf ihn gerichtet. Einen Rückzieher zu machen, war unmöglich.
Wieder übermannte ihn der Zorn, aber er beherrschte sich. »Also dann abgemacht!«, meinte er lächelnd.
Tonina streifte sich den Grasrock ab, den alle Inselfrauen ab dem Einsetzen ihrer Menstruation trugen, ließ ihn in den Sand gleiten. Nur noch mit einem einfachen Baumwollschurz bekleidet, der von einer Schnur um ihre Taille gehalten wurde und ihr Hinterteil und ihre Scham bedeckte, folgte sie Macu in die Brandung. In ihrem fast nackten Zustand kam ihre Körpergröße vollends zur Geltung; es zeigte sich, dass sie Macu fast überragte.
Gebannt verfolgten die am Strand Zurückgebliebenen das Geschehen. Keiner hatte je die Knochen des Ungeheuers in Augenschein genommen. Würden Macu und Tonina unversehrt zurückkehren?
Guama kam zu spät. Sie konnte nur noch hilflos vom Strand aus zusehen, wie die beiden ins Wasser tauchten und auf das Riff zuschwammen.
Guamas schlohweißes Haar war nach hinten gekämmt und zu einem kunstvollen, mit Palmfasern befestigten Knoten verschlungen. Dennoch hatten sich ein paar lange Strähnen selbständig gemacht und umflatterten, von der Tropenbrise bewegt, ihr Gesicht. Sie wischte sie weg, den Blick starr auf die Schwimmer geheftet. War dies das endgültige Zeichen? Das Zeichen, das sie seit sechs Tagen – seit dem Auftauchen der Delphine – befürchtete? Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, ob Toninas Status einer Unverheirateten als Botschaft von den Göttern zu verstehen sei. Dass es ihr nicht bestimmt war, auf der Perleninsel zu bleiben.
Verhielten sich deshalb die Götter gegenüber Tonina so grausam? Hatten sie sie deshalb so erschaffen, dass die Blicke der Männer sich von ihr abwandten? Gewiss, das Mädchen lachte gern und war warmherzig und zutraulich, aber sie war nun mal mit dieser unseligen goldenen Hautfarbe geschlagen, mit langen Gliedmaßen und schmalen Hüften. Jahrelang hatte Guama alles getan, um ihre adoptierte Enkelin dem Schönheitsideal der Insel anzupassen. Sie hatte ihr Tabaksaft in die Haut gerieben, um sie dunkler zu machen; sie hatte ihr Kassavewurzeln zu essen gegeben, damit sie Fett ansetzte. Aber die Farbe wusch sich ab, und das Fett schmolz von ihrem geschmeidigen Körper. Beim barbicu, der jährlichen Brautschau, wurde Tonina von den Männern der anderen Inseln einfach übersehen, weshalb sie noch immer den Gürtel aus den Gehäusen der Kaurischnecke trug, das Zeichen der Jungfräulichkeit. Für die Jüngeren war es eine Auszeichnung, ein Hinweis darauf, dass sie noch unberührt waren, da ein solcher Gürtel erst in der Hochzeitsnacht abgelegt werden durfte. Für Tonina allerdings war der Keuschheitsgürtel inzwischen zu einem Schandmal geworden, weil er aller Welt verkündete, dass sie mit ihren einundzwanzig Jahren noch Jungfrau war, von keinem Mann begehrt. Guama hob den Blick zu der Klippe, die über der Bucht aufragte, und sah ihren Ehemann auf seinem Posten stehen, wo er den Wind und den Himmel und das Meer nach Hinweisen auf einen huracán absuchte. Der mit einem Lendenschurz aus Palmfasern bekleidete rundliche Alte, dessen faltiger nussbrauner Körper mit den Symbolen seiner heiligen Berufung bemalt war, war der wichtigste Mann auf der Insel, wichtiger sogar als der Stammeshäuptling.
Da man nie wusste, wann ein huracán drohte, ließ sich keine entsprechende Vorsorge treffen, um alle in Sicherheit zu bringen. Derartige Stürme konnten ganze Volksstämme vernichten. Die Perleninsel jedoch war mit einem Mann gesegnet, der einer Ahnenreihe von Sturmlesern entstammte, die die Fähigkeit besaßen, einen huracán über weite Entfernungen hinweg zu erahnen, auch wie stark er sein würde und wann er sich über der Insel austoben würde.
Guama stellte allerdings fest, dass ihr Ehemann sein Augenmerk nicht auf den Horizont gerichtet hatte, sondern auf die jungen Leute unter ihm. Und als sie sah, wie gebannt er auf Tonina starrte, wusste sie, dass dies an den Delphinen lag.
Seit sie und Huracan das Delphinpärchen vor sechs Tagen jenseits des Riffs hatten herumtollen sehen, hatten sie immer wieder nach Zeichen und Omen Ausschau gehalten, um den Wunsch der Götter zu deuten. Forderten sie etwa Tonina zurück? Sollte sie nur auf Zeit unter ihnen geweilt haben? Und schickten sie sich jetzt an, fragte sich Guama beklommen, ihnen Tonina, die zu der mit einem Tabu belegten Stelle schwamm, wegzunehmen?
Das Wasser in der Bucht war tief und warm und von einer sanften Strömung bewegt. Man konnte bis auf den sandigen Boden sehen, auf dem stachlige Seeigel und Seesterne lebten. Wortlos schwammen Tonina und Macu nebeneinander her, immer weiter weg vom Strand, zusehends näher an das große Korallenriff heran. Der Wellengang wurde stärker, Teppiche von Seetang bedeckten das Wasser. Macu zog, von seinem Zorn vorwärtsgepeitscht, davon, dachte nur daran, diese junge Frau zu demütigen, die sich einbildete, besser als ein Mann zu sein. Er tauchte unter dem Tang hindurch und kurz darauf auf der anderen Seite wieder auf.
Anstatt weiterzuschwimmen, blieb Tonina wassertretend zurück und beobachtete ihn. Sie dachte daran, wie oft Guama ihr geraten hatte, bei einem Wettkampf einen Jungen gewinnen zu lassen. Diesmal werde ich mich daran halten, sagte sie sich. Macus Lächeln gefiel ihr, und die unverhoffte Aufmerksamkeit, die ihr ein gut aussehender Fremdling schenkte, ließ ihr Herz höher schlagen. Wenn sie ihn gewinnen ließ, würde er vielleicht abermals auf die Perleninsel kommen und sie nach einer Zeit des Werbens heiraten.
Und dann könnte sie wie alle anderen sein und endlich anerkannt werden.
Sie tauchte unter. Aber statt unterhalb des Tangs auf das verfemte Gewässer zuzuhalten, schwamm sie zu einer von der Sonne beschienenen Stelle des Korallenriffs, wo es von Fischen nur so wimmelte.
Hier, inmitten farbenprächtiger Fischschwärme, die hin und her flitzten, fühlte sie sich wohl. Sie ließ sich über verästelte Korallen und Nester von Schwämmen treiben, lächelte einem vorbeigleitenden goldglänzenden Fisch zu. Ein Glücksgefühl überkam sie. Macu hatte sie angeschaut, sie auserwählt! Zum ersten Mal spürte Tonina, die bislang immer nur mit ihrem Aussehen gehadert hatte, wie schön es war, die Aufmerksamkeit eines jungen Mannes auf sich gelenkt zu haben.
Sie drehte sich auf den Rücken, blickte über die Wasseroberfläche, auf der das Sonnenlicht tanzte und glitzerte. Nur noch ein Weilchen so verharren, dann würde sie zur anderen Seite des Tangteppichs zurückschwimmen, vor Macu auftauchen und ihm den Sieg in diesem Wettkampf zugestehen.
Macu hatte die Lungen mit Luft vollgesogen, ehe er senkrecht nach unten getaucht war. Jetzt sah er sich in einer wundersamen Welt, in der lebende Korallen im gesprenkelten Sonnenlicht tanzten und bunte Fische ihn umschwänzelten. Als er urplötzlich das massige, vom Sonnenlicht nur schwach beleuchtete Skelett unter sich ausmachte, zog sich alles in ihm zusammen. Es gab es also doch, dieses Ungeheuer. Und wie riesig es war! Zögernd schwamm er näher. Das Rückgrat des Monsters lag auf dem sandigen Boden, und seine Rippen waren auf eigenartige Weise nach oben gekrümmt. Merkwürdig war auch die braune Färbung der Knochen.
Seine Furcht wandelte sich zu Neugier. Macu tauchte nach unten und fasste nach einer Rippe. Sie war aus Holz!
Er riss die Augen auf. Das hier war kein Meeresungeheuer, sondern ein unglaublich großes Kanu. Allerdings kein Einbaum wie die der Inselbewohner, nein, dieses hier war aus einzelnen Holzsparren zusammengefügt, wie er das von Kriegskanus her kannte. Ein Bootsbauer auf der Insel konnte es unmöglich gefertigt haben. Wer aber dann? Wann war es an diesem Riff zerschellt? Etwas glitzerte im Sand. Es sah aus wie eine Qualle, war aber eigenartig geformt und mit leuchtend grünen und blauen Kerben verziert. Macu griff danach, stellte fest, dass das Gebilde hart wie Stein, aber durchsichtig war.
Seine Lungen verkrampften sich. Höchste Zeit, wieder aufzutauchen. Aber in diesem Moment wurde er von einer Strömung erfasst, die seinen Körper in einem Bogen seitlich an das Boot trieb. Als er am Ende eines langen, geschwungenen Halses den furchterregenden Kopf mit dem geöffneten Rachen und den gezackten Zähnen über sich erblickte, musste sich der zu Tode erschrockene Macu eingestehen, dass er es wohl doch mit einem Meeresungeheuer zu tun hatte.
Von Panik erfasst, aber ohne den Gegenstand loszulassen, den er aus dem sandigen Grund geklaubt hatte, suchte er blindlings aufzutauchen. Dabei geriet er in den wuchernden Tang. Mit Armen und Beinen dagegen ankämpfend, während seine Lungen um Luft rangen und in seiner Brust höllische Schmerzen tobten, verhedderte er sich immer mehr in dem dichten Tanggestrüpp.
Vom Strand aus beobachtete Guama angespannt und voller Sorge das Geschehen. Wie leichtsinnig von diesem Jungen, Tonina herauszufordern, in verbotenes Gewässer zu schwimmen! Und wie naiv von Tonina, darauf einzugehen! Guama wusste zwar, dass nichts im Meer ihrer Enkelin Furcht einzuflößen vermochte. Aber auch wenn Tonina unter dem besonderen Schutz von Delphingeistern stand, gab es doch Grenzen.
Als sie Tonina seitlich des Seetangteppichs wieder auftauchen sah, seufzte sie erleichtert auf. Macu indes ließ auf sich warten. Unsäglich lange. Und dann tauchte Tonina unvermittelt unter den Tang.
Sie fand Macu verstrickt in den grünen Fängen und bewusstlos, mit leeren, starren Augen dahintreibend, das offene Haar sanft von der Strömung bewegt. Sie musste ihm helfen! In fliegender Eile entriss Tonina ihn den Tangarmen und zerrte ihn mit kraftvollen Beinschlägen an die Wasseroberfläche. Dann umschlag sie mit festem Griff seine Brust und schwamm so schnell sie konnte zurück an Land.
Guama, die mit Ertrunkenen umzugehen verstand, nahm die beiden in Empfang. Kaum hatte man Macu auf den Sand gezogen, kniete sie nieder und legte die Hand auf seinen Brustkasten. Er atmete nicht, aber sein Herz schlug noch. Sie rollte ihn auf die Seite und bearbeitete mit der Faust seinen Rücken. Dann öffnete sie seinen Mund, drückte die Kinnlade nach unten und schlug ihm erneut auf den Rücken. Während die Umstehenden in erwartungsvollem Schweigen verharrten, rief sie verschiedene Götter an, erflehte ihr Erbarmen und ihre Kraft.
Beim dritten Knuff musste Macu husten. Beim vierten schoss Wasser aus seinem Mund, er gurgelte, stieß auf und rang nach Luft.
Als seine Freunde ihm auf die Beine halfen, wichen die anderen zurück, um ihnen den Weg freizumachen. Wortlos sahen sie zu, wie Macu taumelnd den Strand verließ. Und dann starrten die Inselbewohner Tonina an, die tropfnass und völlig ausgepumpt im Sand kauerte.
Langsam traten sie den Rückzug an. Sie war in ein mit einem Tabu belegtes Gewässer geschwommen. Das Meeresungeheuer hatte versucht, sich Macus zu bemächtigen, aber Tonina hatte dem Monster die Stirn geboten.
Bekümmert sah Guama, wie die Inselbewohner Tonina den Rücken kehrten und zu ihrem eigenen Schutz Zeichen in die Luft malten. Für die alte Frau stand jetzt fest, dass dies das Omen war, auf das sie gewartet hatte, der Hinweis darauf, dass für Tonina, dieses innig geliebte Mädchen, das einem kinderlosen Ehepaar so viel Freude gebracht hatte, die Zeit gekommen war, die Perleninsel zu verlassen.
Von schmerzlichen Gedanken erfüllt, machte sich Guama auf den Heimweg. Unvermittelt stieß sie mit dem Fuß auf etwas Hartes im Sand. Sie schaute zu Boden. Als sie eine zu einer Kugel zusammengerollte tote Qualle erblickte, runzelte sie die Stirn. Nein, eine Qualle war das nicht. Sie hob das, was da lag, auf und streifte den Sand ab.
Da der Gegenstand noch feucht war, musste Macu ihn mit an Land gebracht haben. Wozu diente er? Er war hart, aber weder aus Stein noch aus Ton. Dafür durchsichtig und mit satten Farben durchsetzt, sodass er aussah wie zu Kugelform versteinertes Wasser mit darin eingeschlossenen Pflanzen. Die Form war ihr immerhin vertraut, schmiegte sich das Objekt doch in ihre Hand wie die Schale einer Kokosnuss.
Guama wusste weder, dass das erstaunlich durchsichtige Material Glas genannt wurde, noch dass es auf der anderen Seite der Welt, in einem klimatisch weitaus kälteren Land namens Deutschland mundgeblasen worden war. Sie konnte nicht ahnen, dass der kostbare Becher von einem Besitzer zum nächsten weitergereicht worden und schließlich bei einem rotbärtigen Forscher gelandet war, der das Trinkgefäß auf seinem mit einem Drachen am Bug verzierten Schiff in seine neue Heimat – Vinland – mitgenommen hatte.
Guama wusste nur, dass Macus Hand das merkwürdige Gefäß umklammert hatte, als Tonina dem jungen Mann an den Strand geholfen hatte. Und da Guama fest davon überzeugt war, dass es für alles, was sich ereignete, einen Grund gab, meinte sie, dass dieser ausgefallene Gegenstand irgendwie mit Tonina zusammenhing. Deshalb wollte sie den Becher behalten und ihn ihrer Enkelin schenken.
Als sie sich auf dem Weg zurück ins Dorf zum hundertsten Male sagte, dass das Mädchen eigentlich gar nicht ihre Enkelin war, seufzte sie wehmütig auf. Tonina war niemandes Enkelkind.
Sie war nicht einmal ein menschliches Wesen.
2
Ist Macu böse auf mich? Toninas stumme Frage richtete sich an das Meer. Habe ich etwas falsch gemacht? Warum dürfen die anderen Liebe und Nähe erleben, ich aber nicht?
Die Antwort des Meeres war das gedämpfte Rauschen der Brandung, das leise Schscht der Wellen weit draußen.
Dies war Toninas Lieblingsplatz, ein schmaler Felseinschnitt zwischen Mangroven und Seegras. Da kaum jemand dieses entlegene Fleckchen aufsuchte, war es mit der Zeit Toninas ureigener Zufluchtsort geworden.
Hier war es auch, wo vor einundzwanzig Jahren ihr Leben auf der Perleninsel begonnen hatte.
Guama war nicht müde geworden, ihr die Geschichte immer wieder zu erzählen. Huracan hatte von seinem Beobachtungsposten oben auf der Klippe ein Delphinpärchen ausgemacht, das mit irgendetwas zu spielen schien. Ein kleines braunes Etwas schaukelte zwischen ihnen auf den Wellen, während sie sich aus dem Wasser schnellten und wieder eintauchten und dabei herumschnatterten, so als versuchten sie, die Aufmerksamkeit des alten Mannes auf sich zu lenken.
Huracan war hinuntergeklettert, an den im Dunkel liegenden Strand, und hatte beobachtet, wie die Delphine dieses Etwas in Richtung Land schubsten, und dann, offenbar darauf bauend, dass die Strömung den Rest erledigen würde, verblüffend harmonisch hoch aus dem Wasser sprangen, wieder eintauchten und Richtung Horizont entschwanden.
Als das Etwas auf Huracan zutrieb und sich dann in knorrigen Mangrovewurzeln verfing, meinte er, das Wimmern eines Tieres zu vernehmen. Er watete ins Wasser und sah, dass das schaukelnde Etwas ein wasserdichter Korb mit Deckel war, aus dem Wehlaute drangen. Vorsichtig hob er den Deckel, schaute in den Korb und sah ein Baby, das in besticktes Tuch gehüllt war. Sein Gesichtchen war verzerrt und rot, und es schrie jetzt aus Leibeskräften. Huracan war mit seinem kostbaren Schatz ins Dorf geeilt, geradewegs zu Guama, die zweifellos wissen würde, was zu tun war. Sie hatte sechs Kinder in die Welt gesetzt und alle sechs überlebt. Als die letzte Tochter gestorben war, hatte Guama nur noch schlafen und nie wieder aufwachen wollen. Aber kaum dass ihr das quäkende kleine Wesen in die Arme gelegt wurde, waren ihre Lebensgeister zurückgekehrt.
Sie nannten das Baby Tonina, was in ihrer Sprache »Delphin« bedeutete, und weil es nicht dunkelbraun wie die Inselbewohner war, sondern eine Haut wie goldfarbener Sand hatte, glaubten Huracan und Guama, dass Tonina das Kind eines Meeresgottes war, der den götterfürchtigen Eheleuten das Baby als Trost im Alter geschickt hatte.
Als das Kind heranwuchs, hatte es jedoch mit seinem ungewöhnlichen Äußeren in der Dorfgemeinschaft Misstrauen erregt, und bald war Tonina als Außenseiterin abgestempelt worden. Die Kinder hatten sie grausam verhöhnt, indem sie ihr weismachten, sie sei im Meer ausgesetzt worden, weil ihre Eltern sie nicht gewollt hätten. Als sie das hässliche Baby gesehen hätten, spotteten die Mädchen und Jungen, hätten sie es dem Ozean überlassen.
Tatsächlich lag etwas Geheimnisvolles über ihrem Leben. Was zum Beispiel besagte das seltsame Amulett, das sie, als Huracan sie gefunden hatte, an einer Schnur um den Hals trug? Ihren Großeltern war das Material, aus dem es gefertigt war, unbekannt. Wer hatte es ihr umgehängt? Was bedeutete es, mit welchen Menschen verband es sie?
Vor langer Zeit hatte Guama aus Palmfasern eine kleine Hülle gewebt und darin das Amulett verborgen, sodass niemand außer Huracan und ihr selbst es zu Gesicht bekommen hatte, nicht einmal Tonina, der die Großmutter nur erzählt hatte, dass es sich um einen wundersamen Stein von rosa schimmernder Farbe handle, in den magische Symbole eingeritzt seien, und der, in die Sonne gehalten, durchsichtig wirke.
Guama hatte Tonina freigestellt, den Stein aus der Umhüllung zu nehmen, wann immer sie den richtigen Zeitpunkt dafür gekommen halte. Oftmals war Tonina versucht gewesen, den kleinen Beutel zu öffnen, hatte es aber dann doch nicht getan. Der Talisman würde sie, so sagte sie sich, nur noch mehr zur Außenseiterin machen.
Und dann gab es da noch dieses ausgefallene Tuch, das damals ihren kleinen Körper umhüllt hatte – feinste Baumwolle, eine Seltenheit auf den Inseln.
Ihre Gedanken kehrten zurück zu Macu. Tonina hatte sich weniger in ihn verliebt als vielmehr in das, was er verkörperte: die Zugehörigkeit, von der sie seit jeher träumte. Durch die Heirat mit Macu würde sie sich in einem Stamm einen festen Platz sichern. Sie würde nicht mehr allein sein.
Tonina stand auf, strich über den Gurt um ihre Taille, von dem Gehäuse der Kaurischnecken herabhingen, das Zeichen ihrer Jungfräulichkeit. Im letzten Tageslicht fuhr sie zweifelnd über die Gehäuse der Kaurischnecke. Ob ihr dieser Gürtel jemals abgenommen werden würde?
Auf der anderen Seite der Insel hockte eine verdrossen schweigende Gruppe um ein Lagerfeuer. Die Flammen erhellten die flächigen, dunkelbraunen Gesichter von jungen Männern, die bemüht waren, die Ereignisse des Tages zu begreifen.
Etwas Unglaubliches war geschehen, etwas, das mit Meeresungeheuern zu tun hatte und mit Todesbedrohung. Macu war ertrunken. Tonina hatte ihn an Land gezogen. Und die alte Frau hatte ihn zurück ins Leben geschüttelt. Hatte der Geist des Meermonsters versucht, sich Macus Seele zu bemächtigen? Angesichts einer solchen Ungeheuerlichkeit verschlug es den jungen Männern die Sprache.
Macu selbst hing düsteren Gedanken nach. Den ganzen Abend über, während sie ihren Fisch gebraten und verzehrt hatten, mit jedem hinuntergewürgten Bissen gewann eine Idee in ihm Gestalt: Das Mädchen musste bestraft werden.
3
Guama holte den kleinen Korb vom Dachsparren herunter, den sie dort seit einundzwanzig Jahren aufbewahrte, und stellte ihn behutsam auf dem Boden der Hütte ab.
Es war an der Zeit, Abschied zu nehmen.
Die Delphine waren zurückgekommen, hatten sich in perfekt übereinstimmenden Bögen aus dem Wasser geschnellt, sodass jeder auf sie aufmerksam geworden war. Sie hatten den ihnen eigenen Delphinschrei ausgestoßen, wie um zu sagen: Das Mädchen gehört uns.
Nur: Wie sollte sie ihre Enkelin dazu bringen, die Perleninsel zu verlassen?
Natürlich könnte sie Tonina einen entsprechenden Befehl erteilen, aber dies würde der alten Frau furchtbaren Kummer bereiten. Und wie entsetzlich wäre es erst für Tonina, des Hauses verwiesen zu werden, in dem sie sich wohlgefühlt hatte, und allein in einem Kanu davonpaddeln zu müssen, ohne recht zu verstehen, warum. Nein, Guama musste einen Vorwand ersinnen, damit Tonina freudigen Herzens von der Insel aufbrach.
Als sie auf den kleinen Korb blickte, der auf den Meeren getrieben war, und auf das zusammengefaltete Tuch darin – kam ihr eine rettende Idee. Eine Notlüge …
Die alte Frau erschauerte. Sie wusste, dass die Perleninsel nicht das Ende der Welt war, nicht einmal ihr Mittelpunkt. Weiter nördlich, östlich und südlich erhoben sich Hunderte von Inseln aus dem Meer. Viele aus ihrem Volk waren schon zu diesen Inseln gesegelt. Die Menschen dort führten ein Leben, das sich von dem auf der Perleninsel nicht sonderlich unterschied, abgesehen vielleicht von einigen Bräuchen oder der Sprache. Im Westen hingegen … Erneut überkam sie Angst, worauf sie ein Stoßgebet an Lokono richtete, den Geist des Alls.
Im Westen lag das, was Festland genannt wurde, weil es hieß, es handle sich hierbei nicht um eine Insel, sondern um ein unendlich großes Land. Einige behaupteten, dass es dort eine völlig andere Welt gebe, mit eigentümlichen Inseln und fremdartigen Völkern – Menschen, die auf Bäumen lebten, die auf dem Kopf liefen, die durch den Mund gebaren.
Obwohl es eindeutig die Götter des Meeres gewesen waren, die ihr Tonina gebracht hatten, und Guama, abergläubisch und götterfürchtig, davon überzeugt war, das Mädchen stamme von den Göttern ab, war sie doch klug genug, um zu wissen, dass die Frau, die Tonina geboren hatte, ein Mensch gewesen sein musste. Das Amulett und das Einschlagtuch waren der Beweis dafür. Warum aber diese Mutter ihr Baby der Obhut der Meeresgötter anvertraut hatte, blieb für Guama ein unlösbares Rätsel.
War das Kind geopfert worden? Hatte Huracan, als er das Baby in Sicherheit brachte, einen Frevel begangen? Und was stand Tonina bevor, wenn sie aufs Meer zurückkehrte?
Würde man sie ein zweites Mal opfern?
Guama schloss die Augen. Großer Lokono, betete sie, leite mich.
»Guama«, erklang es leise, und das Herz der Alten machte einen Satz, weil sie glaubte, die Stimme eines Gottes vernommen zu haben. Aber als sie die Augen aufschlug, erblickte sie Tonina, die an der Tür stand.
»Da bist du ja! Du sollst doch nachts nicht draußen sein, Kind«, sagte sie. Wie die Gesichter aller Inselbewohner war auch das von Tonina zum Schutz vor Geistern mit Symbolen und phantasievollen Mustern sorgfältig bemalt. Und nun musste sie aufbrechen und ihre Bestimmung finden, dachte Guama traurig.
»Dein Großvater ist krank«, begann die Alte. »Ernsthaft krank, Tonina. Auch wenn er es sich nicht anmerken lässt.«
Tonina sah sich in der geräumigen Hütte um. Im Schein der Fackel gewahrte sie den Großvater, der in seiner hamac schlummerte. »Muss er sterben?«, fragte sie mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen.
»Nicht sofort, nicht heute«, erwiderte Guama mit gedämpfter Stimme. »Er wird sich seines Lebens erfreuen bis zu dem Tag, da er die Augen nicht mehr öffnet.«
»Kannst du ihn nicht heilen?« Guama war berühmt für ihr Wissen um Heilkräuter und Wundermittel.
»Die Medizin, die man dafür braucht, gibt es nicht auf unserer Insel. Aber ich habe von einer Pflanze gehört … einer roten Blume mit solchen Blütenblättern« – mit den Händen bildete sie eine Blüte, indem sie die Handgelenke aneinanderlegte und mit den gespreizten Fingern einen nach unten gerichteten Kelch formte.
»Die Blüte reckt sich nicht der Sonne entgegen«, sagte sie, »sondern neigt sich nach unten, wie die rote Heliconia, die bei uns wächst.«
Tonina sah sie ernst und aufmerksam an. Im Dorf ging das Leben weiter wie sonst auch – Familien versammelten sich um Feuerstellen, Kinder tobten herum –, derweil ein voller Mond am Himmel aufzog. »Es heißt, dass die Blütenblätter mächtige Geister enthalten, die jedwede Krankheit heilen.«
»Und wo findet man diese Blume?«, fragte Tonina.
»Auf dem Festland.«
Tonina erschrak. Vom Festland kannte sie nur Sagen und furchterregende Geschichten. »Wie kommt man dort hin?«, fragte sie und malte sich bereits aus, wie der Stammeshäuptling Mannschaften von starken Ruderern zusammenstellte und auf die Reise schickte.
Guama umschloss Toninas Hände. »Hast du die Delphine im Wasser spielen sehen, jenseits des Riffs?«
Tonina lächelte. Sie war zu den beiden hinausgeschwommen, hatte zu ihnen gesprochen und mit ihnen im Wasser herumgetollt.
»Sie sind nicht zufällig hier, Tonina. Sie bringen eine Botschaft. Sie wollen, dass du dich auf das Festland begibst, die Blume mit den magischen Kräften aufspürst und sie uns bringst.«
Tonina starrte sie entgeistert an. »Ich, Großmutter? Bist du dir sicher?«
»Die Botschaft ist eindeutig.«
Ihre müden alten Augen hefteten sich auf die Enkelin. »Nach deiner Rückkehr wird man dich ehren für das, was du getan hast. Das Leben von Huracan zu retten bedeutet, das Inselvolk zu retten«, sagte sie leise. »Davon wird man noch jahrelang sprechen. An jeder Kochstelle wird man deinen Namen rühmen. Dieses Jahr wird eingehen als das Jahr, in dem Tonina die Perleninsel rettete.«
Dieses Jahr wird eingehen als das Jahr, in dem Tonina aufs Meer zurückkehrte.
Sie streichelte das Gesicht des Mädchens, das sie so sehr liebte. »Und dann«, sagte sie abschließend, »dann werden die jungen Männer dich anschauen und sagen, dass du schön bist.«
Tonina bemühte sich, ihre Angst zu unterdrücken. Das Festland! Allein der Gedanke, die Perleninsel zu verlassen! Über das weite Meer zu fahren und dieses unbekannte Land zu betreten! Aber Großvater brauchte ihre Hilfe.
»Ich fahre«, sagte sie.
Obwohl Guama gewusst hatte, dass Tonina sich der Aufgabe stellen würde, wurde ihr schwer ums Herz. »Wie du weißt, legen die heftigen Stürme zwischen der Winter- und der Sommersonnenwende eine Pause ein. In dieser Zeit musst du zurückkommen, Tonina. Wir werden also im Frühjahr, um das Fest der Tag- und Nachtgleiche, Ausschau nach dir halten.«
Da die Wintersonnenwende bereits in einem Monat bevorstand, durfte Tonina keine Zeit verlieren. Sie umfasste die Hände der Großmutter. »Ich werde zu den Geistern meiner Delphine beten und ihren Beistand erflehen«, sagte sie entschlossen. »Und ich verspreche dir, dass ich mit der heilkräftigen Blume zurückkomme.«
»Bruder!« Awak stürzte zum Lager in der kleinen Bucht und weckte die Freunde auf. »Es hat sich etwas ereignet!«
Sich die Augen reibend, lauschten sie seinem Bericht über Toninas Auftrag. »Sie versammeln sich bereits an der Lagune, das große Kanu legt bald ab.«
Macu begriff sofort, welch günstige Gelegenheit sich ihm da bot. Er würde allen zeigen, wer der Größte war. Er würde derjenige sein, der mit der Wunderblume zurückkam. Dann wäre die Demütigung in der Lagune vergessen.
Auch Tonina würde man vergessen, da sie niemals zurückkehren würde.
4
Bei Tagesanbruch versammelten sich alle Dorfbewohner, um ein Ereignis mitzuerleben, das noch Generationen später in aller Munde sein würde. Die zwanzig Mann, die als Besatzung für das große Kanu ausgewählt worden waren, fieberten dem Abenteuer entgegen, schon weil ihr Ziel nicht irgendeine Insel war, sondern das gefürchtete unbekannte Festland!
Als Huracan vor einundzwanzig Jahren Tonina aus dem Wasser gefischt hatte, war er zu dem Schluss gelangt, dass der kleine Korb an der südlichen Küste des Festlands, möglicherweise von einem Gebiet aus, das Quatemalán genannt wurde, zu Wasser gelassen worden war. Von dort, so seine Überlegung, musste Tonina stammen, und demnach würde sie dort auch das Volk wiederfinden, zu dem sie gehörte. Deshalb hatten er und Guama behauptet, dass dort die gesuchte Blume wachse.
Im Dämmerlicht des anbrechenden Tages, während Frauen das große, aus einem Baumstamm gehöhlte Kanu mit Vorräten beluden, schaute Guama auf das Mädchen. Ihr ganzes Leben, so sagte sich die Alte, hatte sich Tonina immer in der Nähe des Wassers aufgehalten. Das Meer war ihr Element. Wie sollte sie in einem Land überleben, das unendlich war?
Huracan schien es, als wirke seine Enkelin, die da inmitten der Inselbewohner stand, schon wie eine Fremde. Als hätte die Verwandlung bereits begonnen.
Der Grund dafür war ihre Kleidung.
Huracan waren die Geschichten eines Taino-Händlers eingefallen, der regelmäßig auf die Perleninsel kam und Baumwolle gegen Perlen eintauschte. »Auf dem Festland«, hatte er gesagt, »tragen sie jede Menge Kleider, vor allem die Frauen. Nackte Brüste sind tabu.«
Diese Bemerkung hatte Huracan zu schaffen gemacht – Tonina musste unbedingt so gekleidet sein, wie es sich in der Fremde gehörte. Guama hatte also aus zwei hamacs einen weiten Kittel zugeschnitten und zusammengenäht, der zur Hälfte über einen Rock reichte.
Während das Kanu mit gesalzenem und getrocknetem Fisch beladen wurde, mit zerstampftem Schildkrötenfleisch und harten Maniokfladen, dachte Huracan voller Sorge an all die unbekannten Gefahren, vor denen er Tonina nicht schützen konnte. Wenigstens sollten sich die Bootsleute für den Fall vorbereiten, dass sie sich verteidigen mussten. Da die Männer auf der Perleninsel keine Krieger waren und sich deshalb ihre Waffen auf einfache Holzspeere und Steinmesser beschränkten, bestand Huracan darauf, dass sie zusätzlich Knüppel sowie Pfeile und Bogen mitnahmen.
Und dann wurde es Zeit, aufzubrechen. Guama betete singend zu Lokono, malte Tonina beschützende Symbole auf Gesicht und Arme und gab ihr den durchsichtigen, aus einem harten Material gefertigten Becher.
Als sie Toninas Finger um das kühle Trinkgefäß schloss, spürte sie die eigenartige Kraft, die von dem Becher ausging. Was sie nicht ahnen konnte, war, dass in dem Land, aus dem der Becher stammte, dieser heutige Tag, an dem Tonina die Perleninsel verließ, einer von vielen im Jahre des Herrn 1323 war. Ebenso wenig wusste sie, dass in jenem Land auf der anderen Seite des östlichen Meers bleichgesichtige Männer ihre Körper in Kettenhemd und Rüstung zwängten und die Frauen in enge Mieder und prächtige Kleider. Guama wusste auch nichts von Königen und Armeen, die mit Armbrust und Streitross in den Krieg zogen, und dass in zweihundert Jahren solche Bleichgesichter auf die Perleninsel kommen und im Namen ihres einzigen Gottes das Leben der Inselbewohner für immer verändern sollten.
Alles, was Guama an diesem Tag in der Lagune sagen konnte, war: »Dieses Gefäß stammt von dem Meeresungeheuer. Große Kraft wohnt ihm inne. Gib gut darauf acht, geliebte Enkeltochter, und es wird dafür sorgen, dass du heil zu uns zurückkehrst.« Dann versagte ihr die Stimme.
Auch Huracan überreichte Tonina ein Geschenk, einen kleinen Beutel mit Perlen. »Du wirst viele seltsame Dinge auf dem Festland sehen, Enkelin«, sagte er und blickte ihr in die Augen. »Wenn du zurück bist, kannst du uns von all den Herrlichkeiten berichten.«
»Das werde ich, Großvater«, erwiderte Tonina erregt und gleichzeitig bedrückt, nicht zuletzt weil Macu nicht erschienen war, um ihr Lebewohl zu sagen. Sie umarmte die geliebten Großeltern.
Ehe sie das Kanu bestieg, bückte sie sich noch einmal kurz und griff sich eine Handvoll Sand, den sie in ihrem kleinen Medizinbeutel verstaute, in dem sich bereits eine kleine blaue Strandschnecke sowie ein Delphinzahn befanden – Glücksbringer, die ihre Verbundenheit mit der Insel sicherstellen sollten.
»Ich verspreche dir, lieber Großvater, mit der gesuchten Blume zurückzukommen, damit du noch lange lebst und die Menschen auf dieser Insel vor Stürmen warnen kannst. Dies schwöre ich beim Geist meines Delphintotems.«
Sie bemerkte die bewundernden Blicke der Menge. Wenn sie mit der Heilpflanze zurückkehrte, würde sie endlich Anerkennung finden.
Während sie sich von den anderen verabschiedete, nahm Huracan Yúo, den Ersten Ruderer, beiseite und raunte ihm zu: »Hör gut zu, was ich dir jetzt sage, Neffe: Wenn ihr Festland erreicht habt, schlagt ihr in der ersten Nacht euer Lager am Strand auf. Und sobald Tonina eingeschlafen ist, lässt du mit deinen Männern das Boot wieder zu Wasser, und ihr begebt euch sofort auf den Heimweg.«
Yúo war zunächst verdutzt. Als er dann aber den Blick seines Onkels auffing, begriff er. »Meinst du, sie findet zu ihren Leuten?«, fragte er leise.
Huracan schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ihr Schicksal liegt jetzt in der Hand der Götter. Toninas Zeit bei uns geht zu Ende.«
Als das Kanu mit den zwanzig Ruderern sowie mit Tonina, die, das Gesicht dem Wind zugekehrt, im Bug kniete, durch die schmale Passage im Riff hinaus aufs offene Meer glitt, wandte sich Huracan gen Osten – und hielt unvermittelt den Atem an.
Toninas Aufbruch hatte ihn davon abgehalten, seiner täglichen Pflicht als Sturmbeobachter nachzukommen. Jetzt spürte er, dass sich ein Unwetter zusammenbraute. Ein gewaltiger Sturm. Ein schrecklicher Sturm.
Sein Blick wanderte wieder zu dem da draußen auf dem Meer so klein und ungeschützt wirkenden Kanu mit der zerbrechlichen Ladung, und entsetzt stellte er fest, dass es schon zu weit weg war, um es zurückzurufen. Er konnte Tonina und die Männer nicht mehr warnen.
Ein Hurrikan zog auf.
ERSTES BUCHMAYAPÁN [1]
5
Die Perleninsel entschwand zusehends den Blicken, und dann glitt das lange Einbaumkanu mit seinen zwanzig Ruderern, einem Bootsführer und einem Passagier unter dem weiten, wolkenlosen Himmel über das offene Meer. Die Möwen begleiteten sie nicht länger, die sich brechende Brandung war nicht mehr zu hören. Die endlose Stille des Ozeans umgab sie, wurde nur durchbrochen vom rhythmischen Eintauchen der Ruder und von Yúos gleichmäßigem Trommelschlag. Das Gesicht gen Westen gerichtet, kniete Tonina im Bug und blinzelte mit gemischten Gefühlen in das gleißende Sonnenlicht, das von der Oberfläche des kabbeligen Wassers reflektiert wurde.
Für Yúo und seine Männer, allesamt Ruderer von Kindesbeinen an, gab es nichts Schöneres, als mit dem Boot auf die offene See hinauszufahren. Heute jedoch war Yúo, der mit der Trommel den Takt für die Ruderer vorgab, bedrückt. Als Einziger wusste er, was Tonina bevorstand.
Das von Lokono, dem Geist des Alls, gesegnete große Kanu mit den eingeschnitzten und aufgemalten zauberkräftigen Symbolen hatte ein Gewässer erreicht, das noch keinen Namen hatte, später einmal aber die Bezeichnung Yucatán-Kanal tragen sollte. Hier kam der Wind von Norden, und weil die Strömung in Gegenrichtung verlief, wurde die See zusehends rauer. Aber Yúo und seine Männer waren geschickt und stark und lenkten ihren robusten Einbaum, der sich bereits auf langen Strecken bewährt hatte, gekonnt durch die Wellen. Dunkle Wolken, Windböen, die sich kurzfristig zu heftigen Stürmen auswuchsen, waren dagegen ein ständiges Risiko und erforderten die ganze Aufmerksamkeit der Mannschaft. Yúo beobachtete unentwegt den Horizont.
Und plötzlich sah er …
Er riss die Augen auf. Da war noch ein Boot. »Guay!«, schrie er und deutete nach Süden.
Die zwanzig Ruderer starrten gebannt auf das, was sie ausmachten. War das ein feindliches Kanu vom Festland? Jeder dachte an das, was man sich – ob wahr oder unwahr – von den grausamen Maya-Kriegern erzählte, die in diesen Gewässern ihr Unwesen trieben, und legte sich, den Blick auf das sich nähernde Boot geheftet, ins Zeug.
Bis sie verblüfft feststellten, dass das Kanu aus der Richtung der Perleninsel kam.
Als Tonina den Bootsführer des kleineren Kanus winkend am Bug stehen sah, schlug ihr Herz höher. Macu!
Freundlich winkend steuerte Macu, Wind und Wellengang geschickt ausnutzend, mit hoher Geschwindigkeit auf das sehr viel größere Boot zu; was man von Toninas Boot aus nicht sah, war, dass sein Bruder Awak und weitere Kumpane sich flach auf den Boden des Kanus drückten, sodass nur vier Ruderer das Boot vorwärts zu bewegen schienen. Kurz vor der Kollision, so Macus Plan, würde er seinen Männern das Zeichen geben, aufzuspringen und mit Pfeilen und Speeren anzugreifen.
Als er den jungen Mann in dem rasch auf ihn zukommenden Kanu erkannte, winkte Yúo lächelnd zurück.
Toninas Herz klopfte. Warum war Macu hier? Wollte er sie auf das Festland begleiten?
Als das kleinere Kanu fast bei ihnen angelangt war, gab Yúo seinen Männern den Befehl, die Ruder aufzustellen.
Macu grinste und gab seinen Leuten, die sich versteckt hielten, ein Zeichen.
»Wir wollten euch Glück wünschen!«, rief er, als sein Boot beidrehte.
»Danke!«, rief Yúo zurück, und sein Lächeln entblößte die perlweiß schimmernden Zähne in seinem dunkelbraunen Gesicht. »Mögen die Götter uns alle auf dieser Reise segnen.«
Beide Rudermannschaften legten eine Pause ein, man hörte nur noch die Wellen seitlich an die langen, schmalen Boote klatschen. Als Macus Kanu nahe genug beigedreht hatte, dass ein Mann auf das andere hinüberspringen konnte, wandte er sich zu seinen Leuten um und wollte den Befehl zum Angriff geben, als etwas Scharfes seinen Schenkel traf.
Überrascht sah er nach unten. Ein brennender Pfeil hatte sich in sein Fleisch gebohrt.
Im nächsten Augenblick ging ein Hagel von Feuerpfeilen auf das kleinere Kanu nieder. Macus Männer sprangen auf und schleuderten ihre eigenen Pfeile und Speere.
Entgeistert verfolgte Tonina den Kampf.
Sie konnte nicht wissen, dass ihre Großmutter vor Beginn der Reise heimlich Yúo gewarnt hatte: »Ich traue diesem Macu nicht. Nachdem Tonina ihm das Leben gerettet hatte und seine Freunde ihn vom Strand wegführten, habe ich gesehen, wie er sich umschaute und ihr einen bösen Blick zuwarf. Nein, ich traue ihm nicht.«
»Wir werden auf alles vorbereitet sein«, hatte Yúo ihr versichert. Und er wusste auch, wie er das anstellte. Wenn Tonina im Bug saß und in Richtung Westen Ausschau nach Land hielt, würde ihr entgehen, dass im Heck ihres langen Kanus Yúos Männer hockten, bereit, sich mit sogenannten Feuerpfeilen zu verteidigen – mit Pfeilen, deren Spitze mit Harz ummantelt war und die man an der glimmenden Asche entzündete, die man für das Lagerfeuer auf dem Festland mitnahm. Beim Näherkommen des anderen Kanus hatte Yúo Macu nicht aus den Augen gelassen; er hatte die Nervosität auf den Gesichtern der lediglich vier Ruderer in dessen Boot gesehen. Und dann hatte er die geduckten Männer erspäht. So konnte Yúo als Erster zuschlagen.
Mittlerweile loderte auf Macus Kanu bereits hier und dort Feuer auf. Männer schöpften um die Wette Wasser, um die Flammen zu löschen; mit Messern und Äxten bewaffnet, sprangen andere hinüber auf Toninas Kanu. Ein Kampf Mann gegen Mann entbrannte, man brüllte und stach und schlug aufeinander ein. Das Kanu schwankte bedrohlich. Tonina hielt sich mit beiden Händen an der Bordkante fest, sie schrie vor Entsetzen.
Rauchschwaden stiegen aus dem kleineren Kanu auf, das die Strömung samt der dort befindlichen Männer mit sich riss.
Wie durch einen dicken Nebel sah Tonina, wie sich Macu mit wutverzerrtem Gesicht auf Yúo stürzte, einen Knüppel schwang und mit einem heftigen Schlag Yúos Kopf traf. Huracans Neffe stürzte zu Boden. Macu stieg über ihn hinweg, holte erneut aus und ließ den Knüppel auf dem Schädel eines weiteren Mannes von der Perleninsel niedergehen.
Fassungslos verfolgte Tonina, wie der Kampf von Mann gegen Mann immer brutaler wurde. Schmerzensschreie erfüllten die Luft. Schon trieben Leichen auf den Wellen, purpurnes Blut ergoss sich in alle Richtungen. Toninas Kanu schwankte durch die Kämpfenden gefährlich. »Guay!«, schrie sie.
Und dann geschah das Unvorstellbare: Das Kanu schaukelte unkontrolliert von einer Seite zur anderen und kenterte plötzlich, schwemmte Kämpfer und Tonina ins Wasser.
Während es ihr gelang, sich an dem umgekippten Einbaum festzuklammern, trieben die anderen durch die starke Strömung zu dem anderen Kanu, auf dem die Feuer inzwischen gelöscht worden waren, kletterten längsseits hinauf, zogen verwundete Kameraden und Feinde aus dem Wasser. Der Kampf war vergessen; jetzt half einer dem anderen ins Boot.
Hilfeschreie gellten durch die Luft, Tonina blieb wassertretend bei ihrem Boot und hielt in all dem Durcheinander Ausschau nach Hilfesuchenden. Das Meer war ihr Element, aber nun saugte sich das Gewebe ihrer aus hamacs gefertigten Kleidung voll Wasser. Es wurde so schwer, dass sie kaum die Beine bewegen konnte. Kurz entschlossen löste sie den Knoten um ihre Taille, und der Rock sank in die Tiefe.
Als Erstes schwamm sie zu einem Mann von der Perleninsel und schleppte ihn zurück zu dem gekenterten Kanu. Erst als sie seine Hand auf den Bootsrumpf legte, merkte sie, dass er tot war. Seine Hand glitt ab, und er trieb davon, das Gesicht unter Wasser.
Sie schwamm zu einem anderen Mann – zu einem von der Halbmondinsel, der zwar noch lebte, aber im Kampf einen Arm verloren hatte. Während sie sich abmühte, ihn zu dem kieloben treibenden Boot zurückzuschaffen, vernahm sie verzweifelte Rufe. Sie wandte sich um und sah, dass das kleinere Kanu zu sinken begann. Es war überlastet, außerdem hatte eines der Feuer an der Längsseite ein Loch gebrannt. Die Männer schrien und stürzten übereinander, als das Kanu in der kabbeligen See verschwand. Tonina winkte, rief. Ihr Kanu war größer und stabiler. Wenn sie es schafften, es wieder aufzurichten …
Da sah sie die Haifische.
Wieder schrien die Männer, die versuchten, gegen die Strömung von dem sinkenden Kanu weg zu dem von Tonina zu gelangen. Schreckensrufe und Schmerzensgebrüll gellten auf, als die Rückenflossen der Raubfische zwischen den verzweifelten Männern auftauchten. Ein entsetzliches Morden hob an, begleitet von hoch aufspritzenden Fontänen, Hilferufen, sich blutrot färbendem Wasser.
Als Tonina Macu im Wasser treiben sah, bewusstlos und das Gesicht himmelwärts gerichtet, griff sie nach ihm und zog ihn zu sich. Mit großer Mühe schaffte sie es, sich auf den Kiel zu hieven und Macu mit hochzuziehen. Zitternd und verzagt hockte sie nun auf dem schwankenden Bug, Macu neben sich fest umklammernd.
Abrupt wurde das Kanu von einer kräftigen Gegenströmung erfasst, Tonina und Macu trieben von den Haien fort. Ungläubig bemerkte sie, wie das Gemetzel, das eben noch um sie herum getobt hatte, allmählich ihrem Blickfeld entschwand, auch die Überlebenden, die es nicht geschafft hatten, sich auf das robuste, wenngleich umgekippte Kanu zu retten. Von insgesamt einunddreißig Menschen waren nur Tonina und Macu übrig geblieben.
Tonina schluchzte. Mit schmerzenden Armen hielt sie den bewusstlosen Macu fest. Sie begriff nicht, was geschehen war. Was hatte ihn bewogen, ihr Kanu anzugreifen? Sie drückte ihr Gesicht an sein kaltes, nasses Haar und weinte bitterlich. Lange würde sie ihn nicht mehr festhalten können. Ihre Kräfte schwanden. Ihre Muskeln verkrampften sich. Angstvoll hielt sie Ausschau nach Haifischen.
Und dann tauchte einer auf. Ein kleiner, junger Hai. Kam rasch näher. Mit einer einzigen, wie selbstverständlichen Bewegung riss er das Maul auf und verbiss sich in Macus Schienbein. Das Wasser färbte sich blutrot. Tonina schrie auf. Mit aller Kraft versuchte sie, Macu höher auf den Bootsrumpf zu ziehen und gleichzeitig sich selbst über Wasser zu halten.
Die Bestie wandte sich um, kam zurück. Tonina umklammerte Macu noch fester, aber anstatt vorbeizugleiten, rammte der Hai das Boot. Infolge des Anpralls lockerte sich Toninas Griff um Macus Brust, und der junge Mann glitt ins Wasser. Gelähmt vor Angst sah sie, wie sein Kopf untertauchte und der Hai nach dem Bewusstlosen schnappte. Rasch suchte der Hai das Weite, eine Blutspur hinter sich lassend.
Zu keiner Regung fähig, starrte sie ihm nach. Dem unendlichen Meer preisgegeben, ohne irgendwo Land zu erspähen, nicht einmal die Leichen der anderen Männer, fühlte sie ihre Kräfte vollends schwinden. Ihre Muskeln versagten den Dienst, und Dunkelheit schlug über ihr zusammen.
6
Tonina träumte, sie säße auf dem Rücken eines großen, grauen Tiers.
Sie erkannte in dem Tier das Meeresungeheuer aus der Lagune, das irgendwie wieder zum Leben erwacht war, mit Fleisch und Haut um das gewaltige Knochengerüst. Es war gekommen, um sie aufzunehmen, und jetzt hockte sie auf seinem Rücken, krallte sich an einer Rückenflosse fest, glitt mit ihm durch das Wasser.
Als sie aufwachte und feststellte, dass sie sich an einem einsamen Strand befand, fragte sie sich, ob das vielleicht gar kein Traum gewesen war, ob nicht vielmehr ihre Beschützer, die Delphine, sie einmal mehr in Sicherheit gebracht hätten.
Unbeweglich lag sie da, lauschte der Brandung und dem Wind, der in den Palmen rauschte, schaute empor zum tiefblauen Himmel. Der Sand unter ihr war warm und trocken. Sie stützte sich auf die Ellbogen, wischte sich Sand und Algen aus dem Gesicht und blickte an sich hinunter.
Ihre Beine waren nackt. Ihr fiel ein, dass sie im Meer den hamac-Rock abgestreift hatte. Entblößte Beine und dafür oben verhüllt zu sein fand sie merkwürdig, war sie es doch gewohnt, den Busen frei zu lassen und die Beine zu bedecken. Genau andersherum. War sie etwa in einer Welt gelandet, in der alles verkehrt herum war?
Ihre Blicke suchten den Strand ab. Keine weiteren Überlebenden des kurzen Kampfes auf hoher See, der so tragisch geendet hatte. Auch keine Spur von ihrem Einbaum oder dem dort verstauten Proviant. Dafür trug sie noch immer ihren wasserdichten Reisesack auf dem Rücken. Grund genug, den Göttern dafür zu danken.