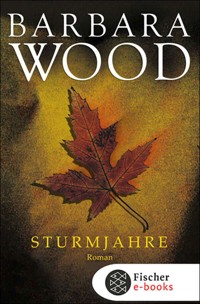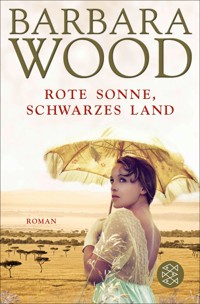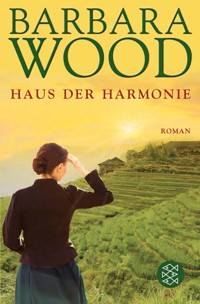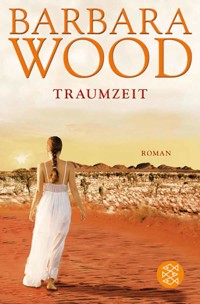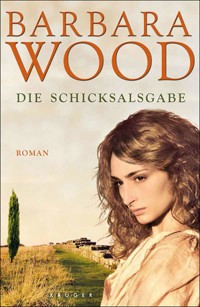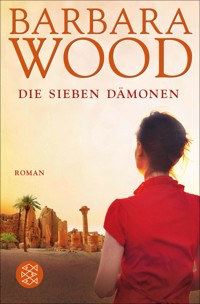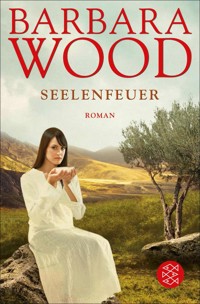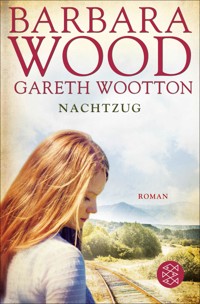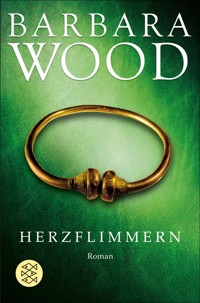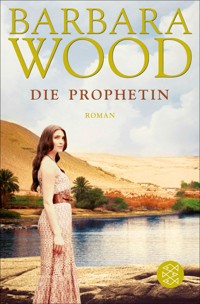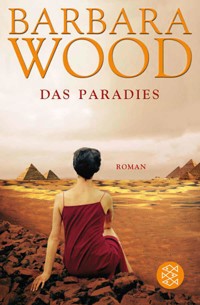
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lesegenuss von der Bestsellerautorin Barbara Wood: Khadija, Amira und Jasmina – drei ägyptische Frauen erzählen von ihren verschlungenen Lebenswegen zwischen Fundamentalismus und westlicher Lebensart: Khadija hat einen unbeugsamen Willen, mit dem sie bis ins hohe Alter einen Fünfzig-Personen-Haushalt regiert. Ihre Vergangenheit liegt tief unter dem Wüstensand begraben. Amira ist die Tochter eines ägyptischen Vaters und einer englischen Mutter. Die Entwurzelte studiert Medizin und wird Ärtzin in Amerika. Jasmina ist als Bauchtänzerin im ganzen arabischen Raum berühmt. Durch ihr unkonventionelles Leben bringt sie ihre Familie in Verruf. Die Geschichte einer gespaltenen Familie, in der drei starke Frauen ihren Weg zum Glück zwischen Tradition und Moderne suchen müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1076
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Barbara Wood
Das Paradies
Roman
Über dieses Buch
Eine ägyptische Familie, deren Mitglieder ihr Leben im Zwischenraum von Tradition und westlichen Lebenswegen gestallten müssen. Im Sog sozialer und politischer Umwälzungen müssen sich auch die Frauen der Familie Raschid entscheiden, worin sie ihr persönliches Glück suchen wollen:Khadija, die unbeugsame Herrin über einen Fünfzig-Personen-Haushalt, hat ihre Vergangenheit die tief unter dem Wüsetnsand begraben. Amira, Tochter eines Ägypters und einer Amerikanerin, folgt ihrem Traum und geht nach Amerika, um Ärztin zu werden. Die junge Jasmina, die als Bauchtänzerin im gesammten arabischen Raum berühmt wird, bringt durch ihren Erfolg die Familie in Gefahr.Sie alle müssen sich dem Schatten stellen, der über dem Hause Raschid zu liegen scheint…
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Barbara Wood ist international als Bestsellerautorin bekannt. Allein im deutschsprachigen Raum liegt die Gesamtauflage ihrer Romane weit über 13 Mio., mit Erfolgen wie ›Rote Sonne, schwarzes Land‹, ›Traumzeit‹, ›Kristall der Träume‹, ›Das Perlenmädchen‹ und ›Dieses goldene Land‹. Die Recherchen für ihre Bücher führten sie um die ganze Welt. 2002 wurde sie für ihren Roman ›Himmelsfeuer‹ mit dem Corine-Preis ausgezeichnet. Barbara Wood stammt aus England, lebt aber seit langem in den USA in Kalifornien.Im Fischer Taschenbuch Verlag ist das Gesamtwerk von Barbara Wood erschienen: ›Rote Sonne, schwarzes Land‹, ›Traumzeit‹, ›Herzflimmern‹, ›Sturmjahre‹, ›Lockruf der Vergangenheit‹, ›Bitteres Geheimnis‹, ›Haus der Erinnerungen‹, ›Spiel des Schicksals‹, ›Die sieben Dämonen‹, ›Das Haus der Harmonie‹, ›Der Fluch der Schriftrollen‹, ›Nachtzug‹, ›Das Paradies‹, ›Seelenfeuer‹, ›Die Prophetin‹, ›Himmelsfeuer‹, ›Kristall der Träume‹, ›Spur der Flammen‹, ›Gesang der Erde‹, ›Das Perlenmädchen‹ und ›Dieses goldene Land‹, sowie die Romane von Barbara Wood als Kathryn Harvey, ›Wilder Oleander‹, ›Butterfly‹ und ›Stars‹.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Prolog Al Tafla, ein Dorf am Nil (Gegenwart)
Erster Teil (1945)
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Zweiter Teil (1952)
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Dritter Teil (1973)
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Vierter Teil (1988)
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Epilog Al Tafla
Dieses Buch ist Achmed Abbas Ragab gewidmet.
Er hat zwei gestrandete Amerikaner gerettet und in seinem Haus aufgenommen.
Schokan, Achmed!
PrologAl Tafla, ein Dorf am Nil (Gegenwart)
»Doktor! Doktor!«
Amira blickte zur Tür und sah draußen auf dem schmalen Weg Achmed; der junge Fellache kam in letzter Zeit öfter zur Krankenstation und bot stumm seine Dienste an. Achmed war intelligent und versuchte auf seine Weise, etwas von dem zu begreifen, was die Ärztin hier tat. Er saß auf einem Esel und deutete außer Atem zur Dorfstraße. »Ein Auto aus Kairo ist gekommen, Doktor! Das Auto steht mitten im Dorf! Eine vornehme Frau sitzt darin!«
»Danke, Achmed«, sagte Amira und dachte: Sie ist also gekommen. Ich bleibe hier und werde sie nicht begrüßen. Sie muß zu mir kommen …
Achmed wendete den Esel, trieb ihn mit leichten Stockschlägen an und ritt schnell zur Hauptstraße zurück. Amira unterdrückte ihre plötzliche Angst und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den kleinen Patienten, einen Säugling. Seine Fontanelle war so eingesunken, daß er ein Loch im Kopf zu haben schien. Während sie behutsam das Baby untersuchte, wehte vom Fluß ein sanfter Wind durch die offene Tür der Ambulanz. Er trug aus der Ferne Musik und Lachen in das Untersuchungszimmer und verbreitete auch den Bratenduft eines Lamms am Spieß. Dr. van Kerk erinnerte sich auf diese Weise daran, daß in einem Haus am Dorfrand eine Hochzeit gefeiert wurde. Der junge Hussein heiratete die hübsche, aber arme Sandra, die durch diese Ehe ihrer Familie zu mehr Ansehen im Dorf verhalf. Der aufreizende Klang der Trommeln verkündete den Dorfbewohnern, daß die Frauen den Bauchtanz begonnen hatten, um damit die Fruchtbarkeit des Brautpaars zu beschwören. So wie die Sitte es verlangte, würde später Blut fließen, um die Jungfräulichkeit der Braut unter Beweis zu stellen. Amira fragte sich, ob zu der Entjungferungszeremonie ihre Hilfe notwendig sein würde. Man rief sie manchmal, wenn es einem Bräutigam nicht gelang, die Jungfernhaut der Braut zu durchstoßen, und nur ein Skalpell diese Aufgabe erfüllen konnte. Obwohl Dr. Amira van Kerk keine Fellachin, keine Nilbäuerin, war, gehörte sie mittlerweile in allen Bereichen des Lebens zum Dorf und stand in dem ewigen Kreislauf von Geburt und Tod für alle hier an einem wichtigen Platz. Zu ihren Pflichten gehörte sogar manchmal, bei der Empfängnis eines Kindes zu helfen.
Aber was sollte sie tun, wenn die Brauteltern sie rufen ließen, während ihre Besucherin bei ihr war? Würde Amira den Mut aufbringen, den Gast aus Kairo einfach sitzen und warten zu lassen?
Habe ich überhaupt den Mut, sie zu begrüßen?
Amira konzentrierte sich auf den Säugling mit der eingefallenen Fontanelle, dem Zeichen für einen lebensgefährlichen Flüssigkeitsmangel. Diese Diagnose mußte die Ärztin in Al Tafla oft stellen. »Hör mir gut zu, Fatima«, sagte sie auf arabisch zu der noch sehr jungen Mutter, »ich habe dir das schon einmal gesagt. Dein Kind hat schweren Durchfall und bekommt nicht genug Flüssigkeit. Das Loch im Kopf bedeutet, daß du dafür sorgen mußt, daß dein Baby genug trinkt.«
»Oh nein, Doktorin, es ist der böse Blick, der meinen Abdu bedroht! Jemand beneidet mich um meinen Sohn und hat ihn verflucht!« Die junge Fellachin flüsterte eindringlich und bebend: »Ja Allah.« Bei Gott! »Nein, es ist nicht der böse Blick, Fatima«, widersprach Amira energisch, »in seinem Bauch sind Bakterien. Sie sind der Grund für den schweren Durchfall, und das führt zu der Austrocknung.« Sie hob mahnend den Finger und sagte nochmals streng: »Du mußt ihm mehr zu trinken geben.« Amira versuchte, nicht an die Frau zu denken, die jeden Augenblick in der Krankenstation erscheinen würde. »Fatima, dein Baby ist in großer Gefahr.«
Tränen stiegen der jungen Mutter in die Augen. Sie war vierzehn Jahre alt, und es war ihr erstes Kind.
Amira holte aus dem kleinen Kühlschrank hinter ihrem Schreibtisch eine Babyflasche mit einer klaren Flüssigkeit. Sie entfernte den Verschluß und schob dem Baby den Sauger zwischen die Lippen. Der Kleine begann sofort zu trinken. »So«, sagte sie und legte Fatima die Saugflasche in die Hand, »achte darauf, daß er alles trinkt.« Dann ging Amira zu einem Schrank und nahm einige Packungen mit dem Aufdruck der Weltgesundheitsorganisation heraus. Auf den Etiketten stand: Orales Rehydrationsmittel. Sie gab die Packungen der jungen Mutter und sagte: »Löse den Inhalt einer Packung in einem Krug Wasser von dieser Größe auf«, sie zeigte es ihr, »aber du mußt das Wasser zuerst kochen. Wenn es abgekühlt ist, füllst du damit die Flasche«, Amira deutete auf die Babyflasche, »laß ihn so viel und so oft trinken, wie er kann. Fatima, versprich mir, du mußt das auch wirklich tun, denn es ist Gottes Wille. Hast du verstanden? Komm morgen wieder, damit ich deinen Sohn noch einmal untersuchen kann.«
Amira sah der Fellachin nach, die auf dem staubigen, heißen Weg barfuß hinunter zum Nil ging, während die späte Nachmittagssonne bereits ihre schrägen, noch immer sengenden Strahlen über das Land warf. Amira nahm langsam das Stethoskop ab und schob es in die Seitentasche ihres weißen Arztkittels. Sie bezweifelte, daß die junge Mutter ihre Anweisungen wirklich befolgen würde. Der Aberglaube beherrschte das Leben der Fellachen so sehr, daß Mütter aus Angst vor dem bösen Blick einer neidischen unfruchtbaren Frau ihre Säuglinge nicht zu waschen wagten. Fatima hatte ihren Sohn seit der Geburt nicht ein einziges Mal gewaschen. Das hatten sie erst hier in der Ambulanz und fast gegen den Willen der Mutter getan. Kein Wunder, daß er bald nach der Geburt eine Infektion und Durchfall bekommen hatte.
Dr. van Kerk trat vor einen Spiegel an der weiß getünchten Wand. Er hing zwischen einem Bild von Ägyptens Präsident Mubarak und einem Kalender mit einem Photo des Assuanstaudamms. Auf dem Kalender war ein Datum eingekreist – ihr Geburtstag. Amira würde bald acht- undvierzig werden.
Unter eine Ecke des Spiegels hatte sie ein Photo geklemmt: Sie und Greg standen selbstbewußt lächelnd auf dem Pier in Santa Monica und hielten Zuckerwatte in den Händen. Damals feierten sie den Jahrestag ihrer Hochzeit – zwei Fremde, die trotz allem die Hoffnung nicht aufgeben wollten und auf die Liebe wie auf ein Wunder warteten.
So viele Jahre sind inzwischen vergangen, dachte Amira, und Santa Monica ist auf der anderen Seite der Welt. Es gab keinen Greg mehr, so wie es auch die anderen nicht mehr gab, die ihr einmal begegnet waren und in ihrem Leben eine Rolle gespielt hatten.
Amira betrachtete sich im Spiegel und schob ein paar blonde Strähnen unter ihren Turban. Diese Kopfbedeckung gehörte zu ihrem »islamischen Gewand«. Sie trug einen hellen pfirsichfarbenen Kaftan mit kunstvoller schwarzer Seidenstickerei auf Ärmeln und Kragen. Der veilchenblaue Turban paßte gut zu ihren hellblauen Augen – »Sie sind so blau wie der Nil bei Sonnenaufgang«, hatte Declan einmal gesagt. Dr. Declan Connor war so ganz anders als Greg. Wo mochte Declan in diesem Augenblick wohl sein? Wie weit war er von ihr entfernt? Wie viele Meilen war er vor ihr geflohen?
»Doktor!« hörte sie draußen Achmed wieder rufen. Die Fellachen hatten schon lange aufgehört, sie van Kerk zu nennen, denn im Arabischen gab es kein »V«. »Der Wagen kommt hierher. Sie haben eine sehr vornehme Besucherin«, rief der junge Mann, »eine Lady! Eine sehr reiche Lady!«
Amiras Herz begann heftig zu schlagen. Wie hatte Khadija sie nur ausfindig gemacht? Al Tafla war ein winziger Fleck auf der Landkarte. Amira hatte vor sechsundzwanzig Jahren Ägypten verlassen und geschworen, das Land nie wieder zu betreten. Woher wußte Khadija, daß sie zurückgekommen war? Warum hatte Khadija beschlossen, sie nach all den vielen Jahren aufzusuchen?
Amira blickte sich in der kleinen Ambulanz um, als könnte sie die Antworten auf ihre Fragen dort finden. Aber sie sah nur weiß getünchte Wände, den geputzten Fußboden und die Plakate, auf denen in arabisch stand, wie Krankheiten übertragen wurden. Auf einem sehr alten, vergilbten Plakat versicherte Gamal Abd el Nasser den Ägypterinnen, daß der Koran die Geburtenkontrolle billige. Das Plakat hing neben Amiras Universitätsdiplom aus dem Jahre 1977, auf dem das Castillo Medical College in Kalifornien ihr den erfolgreichen Abschluß des Medizinstudiums bescheinigte.
Als sie auf dem Weg Motorengeräusch und Stimmen hörte, holte sie tief Luft und stellte zu ihrer Überraschung fest, daß sie nicht nur aufgeregt war, sondern auch Angst hatte.
Die große schwarze Limousine rollte im Schrittempo auf die Krankenstation zu. Dahinter folgten in gebührendem Abstand viele Dorfbewohner von Al Tafla. Die Nachricht von der Ankunft der reichen Lady hatte sich in Windeseile verbreitet, und immer mehr schlossen sich neugierig und aufgeregt den anderen an.
Als der Wagen vor dem kleinen Steingebäude hielt, stieg der Chauffeur aus und öffnete mit einer leichten Verbeugung den hinteren Wagenschlag. Khadija verließ würdevoll den Wagen, und alle verstummten bei ihrem Anblick. Auf einen Stock gestützt, ging sie die wenigen Schritte bis zur geöffneten Tür der Ambulanz. Sie war ganz in Weiß gekleidet, das Zeichen ihrer Pilgerreise nach Mekka. Kopf, Schultern und die untere Gesichtshälfte verhüllte ein weißer Seidenschleier. Sie trug einen blendend weißen Kaftan mit weiten Ärmeln, die bis zu den Handgelenken reichten. Der Saum des Kaftans schleifte über den Boden. Als sie in der Tür stand, wirkte sie im Gegenlicht der untergehenden Sonne wie ein geheimnisvoller weißer Schatten. Amira sah nur die dunklen Augen, die sich klar und forschend auf sie richteten. Die zwei Frauen betrachteten sich stumm, während hinter Khadija der aufgewirbelte Staub in den Sonnenstrahlen tanzte und die Dorfbewohner sich in einem dichten Halbkreis vor der Tür drängten und aufgeregt miteinander flüsterten. Wer war diese reiche, bedeutende Frau, die ihre Doktorin besuchte?
Khadija brach schließlich das Schweigen und sagte auf arabisch: »Gott schenke dir Frieden und SEINE Gnade.«
Amira starrte sie an. Diese Frau besaß noch immer die Macht, in ihr Angst, Ehrfurcht und auch Zorn auszulösen. Amira hatte sie einst aus ganzem Herzen geliebt und verehrt, aber dann geschah das Schreckliche, sie war bis ins Innerste verwundet und konnte diese Frau nur noch verachten.
Erinnerungen stellten sich bei ihrem Anblick blitzartig ein: die fünfjährige Amira sucht weinend mit einem aufgeschlagenen Knie bei Khadija Schutz und Trost – Amira hört staunend, wie Khadija wundersame Geschichten von Heiligen und Dschinns erzählt – Khadija erklärt Amira vor ihrer Hochzeitsnacht die ehelichen Pflichten einer Frau …
Oh ja, das war Khadija für sie gewesen, eine Frau, die alles zu wissen schien, die jede menschliche Schwäche, Tugend und alle Anfechtungen verstand und akzeptierte.
Aber Khadija hatte tatenlos zugesehen, wie Amira praktisch zum Tode verurteilt wurde.
Und jetzt stand diese Frau in dem ehrenvollen Gewand einer Pilgerin vor ihr und stützte sich mit der einen Hand nachdenklich auf den Stock. Amira fand, sie sei kleiner als in ihrer Erinnerung, aber ihr angeborener Adel und der förmliche Stolz, den alle an ihr kannten, waren noch immer unverändert spürbar. Amira lächelte unbewußt, denn sie erinnerte sich an Sandelholz und Veilchen, an das erfrischende Plätschern des alten Brunnens im Innenhof des herrschaftlichen Hauses in der Paradies-Straße und vor allem an den köstlichen Geschmack der reifen, zuckersüßen Aprikosen, die Khadija ihnen an heißen Nachmittagen in den Garten brachte. Und sie erinnerte sich an ihren letzten Tag in Ägypten, als sie enterbt, verflucht und verstoßen aus dem Land geflohen war.
»Auch dir schenke Gott Frieden, SEINE Gnade und SEINEN Segen. Mein Haus sei auch dein Haus.«
Aber das waren nur leere und bedeutungslose Worte, ein Ritual der Höflichkeit, weiter nichts.
Nach einer leichten Verbeugung und einer höflichen Geste verließ Amira mit ihrem Gast die Ambulanz. Wie immer, wenn Fremde nach Al Tafla kamen, begleiteten die Dorfbewohner die Besucherin. Während die Dunkelheit herabsank, gingen sie wie bei einer Prozession den Fußpfad am Nil entlang. Es roch nach gebratenem Fisch und kochenden Bohnen. Die Frauen standen vor ihren Hütten. Halbnackte Kinder drängten sich um sie und starrten mit großen Augen auf die weiß gekleidete vornehme Frau. Amira und Khadija schwiegen, aber die wachsende Spannung war nur allzu deutlich. Khadija blickte unverwandt geradeaus und hielt den weißen Schleier fest über die untere Gesichtshälfte. In ganz Ägypten trugen die Frauen wieder den traditionellen Schleier. Khadija Raschid hatte ihn nie abgelegt.
Als sie den Dorfrand erreichten, war die Sonne bereits dunkelrot hinter den Bergen im Westen versunken. Orangefarbene und rosarote Strahlen glühten wie ein heißes Feuer über dem blauen Nil und den grünen Feldern, die von der Dunkelheit bereits in tiefes Schwarz getaucht waren. Um Al Tafla wuchsen Orangen- und uralte Feigenbäume. Auch Wein wurde hier angebaut. Es war ein typisches Dorf am Nil. Die Frauen trugen riesige Wasserkrüge auf den Köpfen, die sie im Fluß gefüllt hatten. Kinder trieben Wasserbüffel mit Stöcken vor sich her, und die Männer kehrten müde von den Feldern zurück – so wie ihre Ahnen schon zur Zeit der Pharaonen.
Amira bewohnte allein ein kleines, frisch gestrichenes Haus direkt am Nil. Es stand inmitten schattenspendender Maulbeerbäume. Sie führte Khadija zur Veranda hinauf, wo ein junges Dienstmädchen den vornehmen Gast scheu begrüßte. Auf eine Geste von Khadija reichte der Chauffeur dem Dienstmädchen die braune Ledertasche, die sie neben einen Stuhl stellte, und dann eilte sie ins Haus, um Tee und Gebäck zu bringen. Die Dorfbewohner blieben zurück, denn das Haus war der persönliche Bereich von Dr. van Kerk. Nur in Notfällen erschienen sie hier. Als sie sahen, daß sich die Ärztin mit ihrer Besucherin in die Rattansessel der Veranda setzte, nickten sie zufrieden, und die Menge zerstreute sich. Das aufregende Ereignis war für sie vorüber.
Unausgesprochene Worte lagen in der Luft, während Amira und Khadija schweigend beobachteten, wie der Feuerzauber im Westen langsam verblaßte und der Himmel schließlich so violett wie aufblühender Lavendel wurde. Der zärtliche Wind, der über den Nil wehte, strich sanft über die weißen Falten und spielte mit dem fleckenlosen Seidenschleier der alten Frau. Amira staunte, daß Khadija die lange Fahrt allein gemacht hatte, denn sie verließ so gut wie nie das Haus. Erst als Neun- undvierzigjährige hatte sie sich zum ersten Mal allein auf die Straße hinaus gewagt. Jetzt war Khadija bestimmt bald neunzig, aber noch immer bei Kräften, denn nur auf ihren Stock gestützt, hatte sie den Weg von der Klinik zu dem Haus zu Fuß zurückgelegt. So würdevoll war sie gegangen, daß niemand ihr Alter und ihre Gebrechlichkeit ahnte.
Weiter reichte Amiras Bewunderung nicht, denn Khadija war ihre Feindin, und nur zögernd und widerwillig hatte sie die Wiederbegegnung über sich ergehen lassen – die erste nach so vielen Jahren. Amira biß die Zähne zusammen. Sie würde nicht zuerst sprechen. Khadija hatte in einem Telegramm ihren Besuch in Al Tafla angekündigt, also sollte sie das Schweigen brechen.
Das Dienstmädchen servierte auf dem besten Messingtablett und in Porzellantassen den heißen Minztee. Auf zwei Tellern brachte sie Aprikosenplätzchen und Mandarinen. Sie stellte die gefüllte Teekanne auf den Tisch und verschwand wieder im Haus.
Als sie gegangen war, richtete Khadija ihre dunklen mandelförmigen Augen auf Amira. Die großen Schwäne am Fluß verließen das sumpfige Ufer und glitten ins Wasser zurück. Amira konnte das Schweigen nicht länger ertragen und fragte:
»Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut, und dafür bin ich Gott dankbar.«
»Wie hast du erfahren, daß ich hier bin?«
»Ich habe Itzak Misrachi nach Kalifornien geschrieben. Er kannte deine Adresse. Du siehst gut aus, Amira«, fügte sie mit leichtem Beben in der Stimme hinzu. »Du bist jetzt Ärztin, das ist gut so. Du hast einen sehr verantwortungsvollen Beruf.« Sie breitete die Arme aus. »Willst du mich nicht umarmen?«
Amira zuckte wie unter einem Peitschenhieb zusammen. Diese Frau war bei ihrer Geburt die Hebamme gewesen. Ihre nach Mandeln duftenden Hände hatten Amira berührt, als sie auf die Welt kam. Sie wußte, Khadija hatte sie geküßt, wie sie alle Neugeborenen mit einem Kuß auf dieser Welt begrüßte. Aber als sie das unergründliche Glühen in den schwarzen Augen sah, konnte sie diese Frau nicht umarmen. Khadija hatte das kantige Gesicht der Beduinen aus der Wüste und hielt das schmale Kinn so stolz wie eine Königin – alle ihre Kinder und Enkel besaßen diese Züge, auch Amira van Kerk, denn sie war eine geborene Raschid, und diese Frau war ihre Großmutter.
Khadija suchte ihren Blick. Der Schleier vor dem Gesicht bewegte sich kaum, als sie sagte: »Du gehörst nicht mehr zu uns, Amira. Du bist Amerikanerin. Und doch trägst du ein islamisches Gewand. Bist du noch eine Gläubige?«
Amira stockte der Atem. Welch eine Kraft lag in dieser Stimme, die sie in ihren Träumen verfolgt hatte – auch noch während des Exils in den USA, und sie dachte bitter: Also hat sich im Grunde nichts geändert? Sie antwortete: »Sechsundzwanzig Jahre war ich für euch tot. Ihr habt mir meinen Namen und meine Identität genommen und mich zu einem Geist unter den Lebenden gemacht. Warum kommst du jetzt zu mir?«
»Amira, ich bin gekommen, weil mir im Traum ein Engel erschienen ist, und ich weiß, daß ich bald sterben werde. Der Engel hat gesagt, daß mir Gott in SEINER großen Gnade eine letzte Möglichkeit schenkt, um vor meinem Tod die Familie von dem Fluch zu befreien, der auf ihr liegt. Wenn mir das nicht gelingt, dann werden die Raschids in alle Ewigkeit verdammt sein … verdammt bis zum Jüngsten Gericht.«
Khadija hob die Hand mit der zarten Haut, unter der sich die dunkelblauen Adern deutlich von dem weißen Gewand abhoben, und nahm den Schleier vom Gesicht. Als die weiße Seide zur Seite fiel, sah Amira ihre gealterten Züge, aber noch immer war die Schönheit von einst unverkennbar, als Khadija mit überraschend sanfter und jugendlicher Stimme sagte: »Nur du, Amira, kannst Gottes Fluch von unserer Familie nehmen. Es ist in deine Hände gegeben.«
Amira starrte sie voll Entsetzen an. Sie hörte wieder Khadijas Worte an jenem Abend in Kairo, als sie erklärt hatte: »In der Stunde deiner Geburt fiel ein Fluch auf unsere Familie.« Seit sechsundzwanzig Jahren lebte Amira in dem schrecklichen Bewußtsein: Ich habe meiner Familie Unheil gebracht …
Khadija schien ihre Gedanken zu lesen und sagte: »Du bist nicht schuld an diesem Fluch, obwohl er in der Nacht deiner Geburt uns alle aufs neue traf. Ein anderer hat diesen Fluch über uns gebracht.« Und sie dachte: Jetzt weiß ich, wer es war. Aber dieses Geheimnis wollte sie mit ins Grab nehmen, wenn der Fluch von ihnen allen genommen sein würde.
Amira blickte auf den Nil, der in dem letzten Licht des Tages noch einmal blaßblau schimmerte, ehe er völlig schwarz wurde. Feluken – schmale Boote mit dreieckigen Segeln – zogen geometrische Wellen über das Wasser; die hohen Dattelpalmen wurden vor dem Nachthimmel zu zottigen Silhouetten.
Geliebte und vertraute Namen fielen Amira ein – Jasmina, Tahia und Mohammed. Diese Namen waren ihr in all den Jahren nie über die Lippen gekommen. Jetzt sehnte sie sich danach, sie auszusprechen. Amira wollte wissen: Leben sie noch? Fragen sie nach mir? Aber diese Genugtuung würde sie Khadija nicht gewähren. »Du hast mich sechs- undzwanzig Jahre in dem Glauben gelassen, ich hätte meine Familie ins Unglück gestürzt und sei von Gott verflucht worden. Du hast mir all mein Glück, meine Liebe und eine Familie geraubt. Warum sollte ich dir helfen? Und warum gerade ich?«
»Weil mir nur noch wenig Zeit bleibt, Amira«, erwiderte Khadija ruhig. »Komm mit mir nach Kairo zurück. Du bist Ärztin, du mußt deine Familie heilen.«
Als Amira verbittert den Kopf schüttelte und stumm auf den Fluß starrte, fügte Khadija leise hinzu: »Wir dürfen keine Feindinnen sein, Amira. Du bist meine Enkeltochter, und ich liebe dich aus ganzem Herzen.«
»In aller Achtung vor dir, Großmutter, ich kann nicht vergessen, was damals geschehen ist …«
»Es war für uns alle traurig, mein armes Kind. Aber laß dir sagen, ich habe als kleines Mädchen etwas so Schreckliches erlebt, daß ich nur noch weinen konnte. Ich habe geweint, bis keine Tränen mehr kamen und ich zu sterben glaubte. Ich bin nicht gestorben, aber in meinem tiefsten Innern blieb eine grauenhafte Angst zurück. Damals habe ich geschworen, daß ich meine Kinder vor solchen Qualen schützen würde. Ibrahim war mein Sohn und ist dein Vater. Amira, ich konnte mich damals nicht gegen ihn stellen. Nach dem Gesetz kann ein Mann mit seinen Kindern tun, was ihm beliebt. Er ist Herr über seine Familie. Aber ich habe um dich getrauert, Amira.«
Amira erstarrte. Hatte Khadija deshalb das Telegramm geschickt? Mit zitternder Stimme fragte sie: »Ist mein Vater … ist er tot?«
»Nein, Amira, dein Vater lebt noch. Aber um sein Leben zu retten, bitte ich dich, nach Hause zu kommen. Er ist sehr krank, Amira. Er liegt im Sterben. Er braucht dich.«
»Hat er dich darum gebeten, mich zurückzuholen?.«
Khadija schüttelte den Kopf. »Dein Vater weiß nicht, daß du hier bist. Ich habe gefürchtet, wenn er erfährt, daß ich bei dir bin und du vielleicht nicht mit mir kommst, dann würde ihn das völlig vernichten.«
Amira mußte mit den Tränen kämpfen. »Warum stirbt er? Was für eine Krankheit ist es?«
»Nicht sein Körper ist krank, Amira, sondern seine Seele. Seine Seele stirbt. Er hat den Willen verloren zu leben.«
»Wie kann ich ihn dann noch retten?«
»Er stirbt auch deinetwegen. An dem Tag, an dem du Ägypten verlassen hast, verlor er seinen Glauben. Er war überzeugt davon, daß Gott ihn verlassen hatte. Das glaubt er noch immer. Amira, du darfst deinen Vater nicht so sterben lassen, denn dann wird Gott ihn wirklich verlassen, und er kommt nicht in das Paradies.«
»Es ist seine Schuld …«, aber Amira versagte die Stimme.
»Amira! Glaubst du wirklich, daß du alles weißt? Glaubst du zu wissen, warum dein Vater das tat, was er getan hat? Kennst du alle Geschichten unserer Familie? Bei dem Propheten – Friede sei mit ihm –, du kennst die Geheimnisse unserer Familie nicht, die Geheimnisse, die auch dein Leben bestimmen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, daß du sie kennenlernst.« Khadija nahm die Ledertasche auf den Schoß und holte eine alte geschnitzte, mit Elfenbein eingelegte Schatulle heraus. Auf dem Deckel stand auf arabisch: Gott der Barmherzige. »Du erinnerst dich an die Misrachis. Sie waren unsere Nachbarn in der Paradies-Straße. Sie mußten Ägypten verlassen, weil sie Juden sind. Marijam Misrachi war meine beste Freundin. Wir haben unsere Geheimnisse gegenseitig gehütet. Ich will dir alle unsere Geheimnisse anvertrauen, denn du stehst meinem Herzen am nächsten, und ich möchte dich mit deinem Vater aussöhnen. Ich werde dir sogar Marijams größtes Geheimnis erzählen. Sie ist gestorben, deshalb darf ich mit dir darüber sprechen. Und dann werde ich dir von meinem eigenen schrecklichen Geheimnis berichten, das nicht einmal dein Vater kennt. Aber zuerst mußt du dir alles andere anhören.«
»Ich kann nicht mit dir nach Kairo zurückfahren. Vergiß nicht, ich bin für euch alle tot«, sagte Amira und verschluckte das gewohnte »Umma«, Mutter, mit dem sie Khadija immer angesprochen hatte.
»Dein Vater und ich haben dich für tot erklärt, mein Kind, weil …«
Amira hob die Hand. »Sajjida«, unterbrach sie Khadija und wählte bewußt die förmliche Anrede, »was geschehen ist, ist geschehen. Und alles stand von Anbeginn der Zeit so bei Gott geschrieben. Ich werde nicht mit dir nach Kairo zurückfahren!«
Aber Khadija achtete nicht auf ihren Einwurf, sondern öffnete den Deckel der Schatulle. Amira erschauerte. Sie hatte Angst vor dem, was dort zum Vorschein kommen mochte, aber sie wollte es auch wissen. Es klang kläglich, als sie flüsterte: »Ich möchte deine Geheimnisse nicht hören …«, denn sie begriff, daß Khadija sie auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen wollte.
»Du wirst mir deine Geheimnisse anvertrauen«, sagte Khadija. »Ja, denn auch du hast Geheimnisse.« Sie seufzte. »Wir wollen uns vertrauen, und wenn Gott aus unserem Mund die ganze Geschichte hört, dann flehe ich IHN an, uns in SEINER großen Güte erkennen zu lassen, was wir tun müssen.« Sie holte tief Luft und begann langsam zu erzählen: »Das erste Geheimnis, Amira, reicht in das Jahr vor deiner Geburt zurück. Damals war der Zweite Weltkrieg gerade vorüber, und die Welt feierte den Frieden. Es geschah in einer warmen Sommernacht, einer Nacht voller Hoffnungen und Versprechungen. In dieser Nacht versank unsere Familie noch tiefer in den Abgrund …«
Erster Teil(1945)
1. Kapitel
»Prinzessin, sieh nur, dort oben am Himmel! Siehst du das geflügelte Pferd über den Himmel galoppieren?«
Das kleine Mädchen blickte zum nächtlichen Himmel hinauf, sah aber nur das endlose Sternenmeer. Als die Kleine den Kopf schüttelte, wurde sie liebevoll umarmt. Noch während sie unter den vielen Sternen das fliegende Pferd suchte, hörte sie in der Ferne ein dumpfes Donnern wie bei einem Gewitter.
Plötzlich umgab sie ohrenbetäubender Lärm und Geschrei. Die Frau, die sie an sich drückte, rief: »Gott helfe und beschütze uns!« Im nächsten Augenblick tauchten kriegerische schwarze Gestalten aus der Dunkelheit auf. Sie ritten auf riesigen Pferden und trugen schwarze wehende Gewänder. Das Mädchen glaubte, sie seien vom Himmel auf die Erde gekommen, und hoffte, die großen gefiederten Flügel zu sehen.
Aber dann flohen sie vor den unheimlichen Reitern und rannten durch die Nacht – Frauen und Kinder. Sie wollten sich verstecken, während Schwerter im Licht der Lagerfeuer blitzten und laute Schreie zu den kalten, unbeteiligten Sternen hinaufstiegen.
Das Mädchen klammerte sich an die Frau. Sie kauerten hinter einer großen Truhe. »Still, Prinzessin«, flüsterte die Frau, »sie dürfen uns nicht hören.«
Angst, Entsetzen und dann – dann wurde die Kleine brutal aus den schützenden Armen der Frau gerissen. Sie schrie …
Khadija erwachte. Es war dunkel im Zimmer, aber sie sah, daß die silbernen Strahlen des Frühlingsmondes wie ein Mantel über ihr Bett fielen. Sie richtete sich auf und schaltete die Nachttischlampe ein. Es wurde sofort angenehm hell, und sie legte die Hand auf die Brust, als könnte sie damit das rasend schlagende Herz beruhigen. Khadija dachte: Die Träume fangen wieder an.
Deshalb erwachte sie nicht ausgeruht, denn die Träume quälten sie mit beängstigenden Bildern im Schlaf – waren es Erinnerungen? Sie wußte nicht, ob die Dinge, die sie in den Träumen erlebte, auf tatsächlichen Ereignissen beruhten oder nicht. Aber wann immer die Träume sich einstellten, warfen sie ihren Schatten auf den Tag, und Khadija mußte die Vergangenheit in der Gegenwart durchleben, wenn es tatsächlich Erinnerungen aus einer vergangenen Zeit waren. Zwei Leben schienen sich gleichzeitig vor ihren Augen zu entfalten. In dem einen war das kleine Mädchen dem Terror hilflos ausgeliefert, und im anderen versuchte die erwachsene Frau in einer unberechenbaren Welt Ordnung zu schaffen und ihr einen Sinn zu geben.
»Das Kind …«, murmelte Khadija, und ihr fiel wieder ein, daß ihre Schwiegertochter in den Wehen lag. Wie lange hatte sie wohl geschlafen? Im Haus schien es eigenartig still zu sein.
Bei jeder Geburt im Raschid-Haus in der Paradies-Straße stellten sich die Traumbilder ein und störten ihren Schlaf. Waren es vielleicht Vorboten der Zukunft? Um sich zu beruhigen, ging Khadija in das angenehm nach Mandeln duftende Marmorbad und ließ aus dem goldenen Hahn kaltes Wasser über die Hände laufen, ohne das Licht einzuschalten. Sie betrachtete sich im Spiegel und sah, wie der Mond ihr Gesicht erschreckend weiß erscheinen ließ. Unwillkürlich mußte sie an ihren Mann denken, der bereits fünf Jahre im Grab lag.
Sie wusch sich das Gesicht mit dem kalten Wasser und trocknete es sorgfältig mit einem Leinenhandtuch. Dann kämmte sie sich die Haare und strich über den langen Rock. Khadija hatte sich angekleidet auf das Bett gelegt, weil sie damit rechnete, zu ihrer Schwiegertochter gerufen zu werden, wenn es soweit war. Nachdenklich ging sie in das Schlafzimmer zurück. Im Mondlicht sah sie das Photo auf dem Nachttisch. Es schimmerte eigenartig, und der Mann in dem silbernen Rahmen schien sie stumm anzulächeln.
Sie nahm Alis Bild in die Hände. Wie immer, wenn sie etwas bedrückte, suchte sie Trost bei ihm. »Was bedeuten die Träume, geliebter Mann?« fragte sie.
Es war eine ruhige Nacht bei den Raschids. Alle nahmen Rücksicht auf Khadijas Schwiegertochter, denn die junge Frau stand vor der großen Aufgabe, ihr erstes Kind gesund auf die Welt zu bringen. »Sag mir«, bat Khadija leise den Mann mit dem eindrucksvollen Schnurrbart unter der Hakennase, »warum kommen diese Träume immer dann, wenn ein Kind geboren wird? Ist es ein Omen, das ich nicht verstehe, oder sind es die Bilder meiner Angst?« Sie seufzte. »Ali, was ist in meiner Kindheit geschehen, daß ich jedesmal von Grauen und Entsetzen gepeinigt werde, wenn ein neues Leben in diese Familie kommt?« Khadija träumte manchmal auch von einem kleinen Mädchen, das verzweifelt schluchzte. Aber sie wußte nicht, wer das Kind war. »Bin ich das?« fragte sie ihren Mann auf dem Photo. »Nur du kanntest das Geheimnis meiner Herkunft, geliebter Mann. Vielleicht hast du noch mehr gewußt, es mir aber nie gesagt. Du warst ein erwachsener Mann und ich noch ein Kind, als du mich in dein Haus geholt hast. Warum kann ich mich nicht an mein Leben davor erinnern?«
Als sie auf ihre Frage nur das Rascheln der Blätter im Garten hörte, stellte sie das Photo wieder auf den Nachttisch zurück. Was Ali auch gewußt haben mochte, er hatte sein Wissen mit ins Grab genommen. Deshalb gab es für Khadija Raschid keine Antworten auf die Fragen nach ihrer Familie, nach ihrer Herkunft, nach ihrem Geburtsnamen. Niemand in der Familie kannte ihr Geheimnis. Als ihre Kinder noch klein gewesen waren und sich nach den Verwandten ihrer Mutter erkundigten, antwortete sie immer ausweichend: »Mein Leben begann an dem Tag, an dem ich euren Vater geheiratet habe. Seine Familie wurde auch meine Familie«, denn Khadija hatte keine Erinnerungen an ihre Kindheit, nur die geheimnisvollen Träume …
»Herrin?« hörte sie eine Stimme an der Tür.
Khadija drehte sich um. Die alte Magd, die schon vor Khadijas Geburt bei den Raschids gedient hatte, stand im Zimmer. Khadija fragte: »Ist es soweit?«
»Ja, Herrin, es ist bald soweit.«
Khadija schob den Traum und ihre Fragen beiseite und eilte durch den langen Gang zur Treppe. Ihre Schritte waren auf den kostbaren Teppichen fast unhörbar. In den Kristallvasen und goldenen Kandelabern spiegelte sich ihr Bild.
Neben der Treppe stand ein kleiner Junge und fragte sie ängstlich: »Stirbt die Tante?« Der Wind wehte inzwischen stürmisch und übertönte das Stöhnen aus dem Zimmer, wo ihre Schwiegertochter lag.
»Tante Fatheja ist in Gottes Händen«, antwortete Khadija freundlich und lauschte auf ein Zeichen, das der Wind ihr geben mochte, der die Fensterläden klappern ließ. Es war der alljährliche Chamsîn. Er kam aus der Wüste und erfüllte die Nacht mit gespenstischen Geräuschen, während er durch Kairos breite Alleen und enge Gassen fegte und das herrschaftliche Haus in der Paradies-Straße in einen feinen Sandschleier hüllte.
»Aber was hat die Tante?« fragte der Junge seine Großmutter. »Ist sie krank?« Der Dreijährige fürchtete sich, denn er erinnerte sich daran, wie Tante Zou Zou ihm erzählt hatte, daß mit dem Wüstenwind die umherirrenden Seelen der Menschen kamen, die in der Wüste gestorben waren und denen der Weg zum Paradies auf ewig versperrt war. Omar fürchtete, der Wind sei heute nacht gekommen, um seine Tante Fatheja in das Reich der Toten zu holen.
»Sie bekommt ein Baby. Geh wieder in dein Zimmer und schlaf, mein Junge.«
Aber Omar wollte nicht schlafen. Er fürchtete sich. Auch wenn seine Großmutter ihn beruhigen wollte, so wußte er doch, daß etwas nicht stimmte. Sonst waren alle fröhlich, lachten und unterhielten sich laut, und er fand überall offene Arme und einen Schoß, wo er verwöhnt wurde. An diesem Abend schien alles wie in einem Alptraum zu sein. Schatten huschten über die Wände, die Messinglampen schaukelten und zuckten, während seine Tanten und die anderen mit Handtüchern und heißem Wasser in das Schlafzimmer eilten und es kurz darauf seufzend wieder verließen. Es roch überall nach Weihrauch. Die Frauen flüsterten nur miteinander, und niemand kümmerte sich um den verängstigten Omar, der unbemerkt seiner Großmutter folgte, als sie das Zimmer betrat, in dem alle Raschids ihre Kinder bekamen. Er sah in einer Ecke die unheimliche alte Quettah, die Astrologin, über ihre Karten und Instrumente gebeugt. Sie bereitete sich darauf vor, im Augenblick der Geburt den Stern des Neugeborenen zu bestimmen. Omar rannte schutzsuchend zu seiner alten Tante Zou Zou, die mit dem aufgeschlagenen Koran in der Hand leise murmelnd betete.
Zu Khadijas Erleichterung war ihre Schwiegertochter umringt von den Tanten und Frauen, die im Haus lebten. Sie trösteten die erschöpfte Fatheja, betupften ihr die Stirn, gaben ihr zu trinken, beruhigten die werdende Mutter nach besonders heftigen Wehen, und sie beteten. Die eleganten Frauen hatten die seidenen Schleier hochgeschlagen und dufteten nach teuren Parfüms.
Die Raschids waren eine reiche und vornehme Familie. Zur Zeit waren es dreiundzwanzig Frauen und Kinder im Alter von einem Monat bis zur sechsundachtzigjährigen Zou Zou. Als Schwestern, Töchter und Enkelinnen der ersten Frauen von Ali Raschid waren sie alle miteinander verwandt. Und zu ihnen gehörten auch die Witwen seiner gestorbenen Söhne und Neffen. Nur die Jungen unter zehn Jahren durften nach islamischer Sitte bei den Frauen sein. Nach ihrem zehnten Geburtstag verließen sie die Mutter und lebten im Männerteil auf der anderen Seite. Zur Zeit wohnten dort sieben Männer. Dr. Ibrahim Raschid, Khadijas Sohn, war mit achtundzwanzig das Oberhaupt der Sippe. Die inzwischen zweiundvierzigjährige Khadija herrschte im Frauenteil, dem früheren Harem. Ali Raschids wurde hier noch immer in dem großen Porträt gedacht, das über dem Bett hing: ein großer, untersetzter Mann, der auf einem kostbar geschnitzten Stuhl thronte. Niemand hatte seine große Macht zu seinen Lebzeiten jemals angezweifelt.
Als Khadija an das Bett trat, spürte sie noch immer die Wirkung ihres Traums. Noch vor wenigen Augenblicken hatte sie in einem Lager in der Wüste gesessen und zu den Sternen aufgeblickt. Wer war die Frau, die sie bei dem Überfall hatte verstecken wollen? Ihre Mutter? Aber warum hatte die Frau sie mit gewisser Ehrerbietung in der Stimme »Prinzessin« genannt? Khadija konnte sich an ihre Mutter nicht erinnern. Sie träumte immer wieder von dem Sternenhimmel dieser Nacht, so daß sie manchmal glaubte, nicht von einer Frau geboren, sondern von einem dieser fernen funkelnden Sterne gekommen zu sein.
Während sie ihrer Schwiegertochter ein kaltes Tuch auf die Stirn legte, fragte sie sich stumm: Was ist aus der Frau geworden, die das Mädchen so liebevoll an sich drückte? Hat man sie umgebracht? Habe ich sie sterben sehen? War es ein grauenhaftes Blutbad in der Wüste, bei dem alle von den umheimlichen schwarzen Gestalten getötet wurden? Kann ich mich deshalb nur in Träumen an meine Vergangenheit erinnern?
Nachdenklich verrührte Khadija einen Löffel Honig in dem Fencheltee für ihre Schwiegertochter. Während sie Fatheja beim Trinken half, betrachtete sie aufmerksam den gewölbten Leib unter dem Satinlaken.
Fatheja öffnete den Mund zu einem stummen Schrei. Sie versuchte, nicht laut zu schreien, denn eine Frau, die bei der Geburt schwach wurde, entehrte die Familie. Khadija ersetzte das naßgeschwitzte Kissen durch ein trockenes und betupfte Fathejas Stirn.
»Bismillah!« In Namen Gottes! flüsterte eine der jungen Frauen, die ebenfalls am Bett stand. »Was ist denn eigentlich mit ihr los?«
Khadija schlug das Laken zurück und stellte zu ihrer Überraschung fest, daß das Baby sich unerklärlicherweise gedreht hatte und sich nicht länger in der normalen Geburtslage befand, sondern quer lag. Khadija mußte an eine andere Nacht vor beinahe dreißig Jahren denken. Sie war damals dreizehn gewesen und erst vor kurzem als Braut in das Raschid-Haus gekommen. Eine Frau lag in den Wehen, und das Kind hatte sich ebenfalls seitlich gedreht. Khadija wußte, daß damals Mutter und Kind gestorben waren.
Um ihre Besorgnis zu verbergen, redete sie beruhigend auf Fatheja ein und winkte Doreja, ihre geschiedene Stieftochter, die Weihrauch brannte, um damit Dschinns, Dämonen und andere böse Geister vom Kindbett zu vertreiben, mit einer Geste zu sich. Sie bat Doreja leise, ihre Nachbarin Marijam Misrachi zu holen. Marijam war ihre beste Freundin, und sie brauchte jetzt ihre Hilfe, denn sie mußten das Kind so schnell wie möglich in die normale Stellung mit dem Kopf nach unten drehen. Fatheja würde bald gebären, und wenn das Kind im Geburtskanal steckenblieb, dann waren sie verloren.
Nefissa bemerkte von dem Drama, das sich in dem großen Himmelbett vollzog, nur wenig. Ihr Rücken und ihre Schultern schmerzten, denn sie saß kerzengerade und blickte unverwandt auf die Straßenlaterne vor dem Haus. Sie mußte in dieser unbequemen Stellung sitzen, um die Straße hinter der hohen Mauer überhaupt sehen zu können. Sie starrte durch eine der vielen Öffnungen der Maschrabija, einem kunstvollen Flechtgitter, das noch aus den Zeiten des Harems stammte. Damals hatte es den Frauen ermöglicht, unbemerkt die Straße zu beobachten.
Nefissa saß nicht zum ersten Mal am Fenster. Khadija und die anderen Frauen wußten nicht, daß sie in den vergangenen zwei Wochen jeden Mittag und jeden Abend am Fenster gesessen und gewartet hatte.
Vom Dach konnte man normalerweise Kairos tausend Kuppeln und Minarette und an klaren Mondnächten die Pyramiden sehen, die auf der anderen Nilseite wie gespenstische Dreiecke in die Luft ragten. Aber weil der Chamsîn – auf arabisch »fünfzig«, weil der Wind fünfzig Tage wehte – einen Sandschleier über die Stadt legte, sah man an diesem Abend weder den Nil noch den Mond. Auch die Straßenlampen warfen nur einen gelblichbraunen Schein. Wenn hin und wieder ein Wagen vorbeifuhr, wirkten die Scheinwerfer wie trübe Augen.
Nefissa dachte enttäuscht: Heute wird er bestimmt nicht kommen!
Ihre Spannung stieg, als sie das Klappern von Hufen auf dem Pflaster hörte und eine Kutsche vorbeirollte. War die Zeit schon vorüber? Hat er mich möglicherweise nicht gesehen? Nefissa saß nicht am üblichen Fenster. Hatte er zu ihrem Schlafzimmer hochgeblickt, sie nicht gesehen, war enttäuscht weitergegangen und würde vielleicht nie mehr kommen?
Sie zog den seidenen Schleier fester vor das Gesicht; die anderen Frauen sollten ihre Enttäuschung nicht sehen, denn keine kannte ihr Geheimnis. Sie wären alle über ihr Verhalten entsetzt gewesen. Nefissa war erst seit kurzem Witwe, und man erwartete von ihr ein vorbildliches tugendhaftes Leben. Aber wie konnte man das von ihr, die gerade erst zwanzig geworden war, verlangen? Ihr Mann war ein Playboy gewesen, den sie kaum kannte. Er hatte sein Leben in Nightclubs verbracht, und Autorennen waren seine Leidenschaft gewesen. Ein paar Wochen vor der Geburt seiner Tochter Tahia war er in seinem Rennwagen tödlich verunglückt. Nefissa war drei Jahre mit einem Fremden verheiratet gewesen. Und jetzt sollte sie den Rest ihres Lebens um diesen Mann trauern?
Das konnte und wollte sie nicht.
Ein Stöhnen vom Bett riß sie aus ihren Gedanken. Die arme Fatheja. Sie empfand für ihre Schwägerin großes Mitgefühl, denn vor drei Jahren hatte sie in diesem Bett Omar zur Welt gebracht und erst vor einem Monat die kleine Tahia. Khadija, ihre Tanten und Cousinen hatten ihr ebenso Beistand geleistet wie diesmal Fatheja. Aber Nefissas Wehen waren nicht so schlimm gewesen. Fatheja mußte sehr leiden, und Nefissa wünschte von ganzem Herzen, daß ihre Schwägerin mit einem Sohn belohnt werden würde.
Der Wind fegte durch den Innenhof, und Nefissa richtete ihre Aufmerksamkeit wieder nach draußen. Der menschenleere Garten wirkte unheimlich, Sand und Blätter wirbelten um den Brunnen. Sie blickte sehnsüchtig auf die Straße, auf die nur verschwommen erkennbare Straßenlaterne, und ihre Angst wuchs.
Als Nefissa in ihrem Rücken die besorgten Stimmen der Frauen hörte, fuhr sie zusammen und wollte ihren Platz am Fenster verlassen. Aber in diesem Augenblick näherte sich die schattenhafte Gestalt eines Mannes dem Tor in der Mauer. Der Mann kämpfte gegen den Wind und hatte den Kragen hochgeschlagen, der fast sein Gesicht verdeckte. Nefissa starrte in die Dunkelheit. Ist er es?
Sie hielt den Atem an.
Er blieb unter der Laterne stehen, und dann sah sie im Lichtschein undeutlich eine Uniform, die Uniform eines Offiziers, und ihr Herz begann heftig zu schlagen. Er war gekommen! Der Mann richtete seinen Blick auf das dreistöckige Haus, und Nefissa mußte sich zusammennehmen, um nicht laut zu rufen: »Hier bin ich! Hier, hinter diesem Fenster!«
Geh nicht! Bleib stehen. Vielleicht kommst du nicht noch einmal …
Plötzlich hob er die Hand über die Augen und blickte auf das Gitter, hinter dem sie saß. Sie zog den Schleier fester, öffnete die kleine Klappe in der Maschrabija und wartete auf das Zeichen, daß er sie entdeckt hatte.
Vor zwei Wochen saß Nefissa am Fenster ihres Schlafzimmers und blickte gelangweilt auf die Straße. Plötzlich sah sie einen englischen Offizier auf dem Gehweg. Er blieb unter der Straßenlaterne stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden, und hob dabei den Kopf. Ihre Blicke trafen sich zufällig, und Nefissas Herz schien stillzustehen. Sie wagte nicht zu atmen, hielt den Schleier regungslos vor das Gesicht, und er sah nur ihre Augen. Der Mann blieb länger als notwendig unter der Laterne stehen und sah sie bewundernd an.
Danach erschien er jeden Tag gegen ein Uhr mittags und kurz vor Mitternacht. Der britische Offizier blieb unter der Straßenlaterne stehen, blickte zu Nefissas Fenster hinauf, und wenn er sie sah, zündete er sich mit einem Streichholz eine Zigarette an. Er betrachtete sie durch den Rauch, und sie sah seine leuchtend blauen Augen voll Verlangen auf sich gerichtet – dann ging er weiter.
Obwohl der Wind den großen, schlanken Mann umwehte, gelang es ihm, im Schutz der Hände das Streichholz zu entflammen und die Zigarette anzuzünden. Das war das Zeichen! Er hatte sie gesehen! Ihre Geduld war wieder einmal mit einem kurzen Blick auf sein Gesicht belohnt worden – er war blond, hatte eine helle Haut, und Nefissa fand, er sah besser aus als jeder andere Mann, den sie kannte.
Wenn sie doch nur den Mut hätte, den Schleier sinken zu lassen. Wenn sie ihn doch nur kennenlernen könnte. Aber das war unmöglich, und es durfte nicht sein! Das Gesetz verlangte von den Frauen zwar nicht mehr, sich in der Öffentlichkeit zu verschleiern, aber Nefissa war Khadijas Tochter, und alle Frauen der Raschids schützten ihre Ehre mit dem Schleier. Nefissa durfte das Haus nur an den Festtagen der Heiligen verlassen oder wenn sie ihre Freundin, Prinzessin Faiza, im Palast besuchte.
Welche Möglichkeit gab es für sie, ihren Offizier kennenzulernen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hatte?
Während sie ihn dort draußen beobachtete und er seine blauen Augen auf sie gerichtet hatte, fragte sich Nefissa, was er wohl denken mochte. Staunte er wie die Ägypter, daß der Zweite Weltkrieg endlich vorbei war? Hatte er wie seine britischen Offizierskameraden und alle in Ägypten geglaubt, der Kampf werde noch zwanzig Jahre dauern? Nefissa fand es schön, daß es keine Verdunklung, keine Angst vor Bombenangriffen mehr gab. Sie mußten nicht mehr mitten in der Nacht das Haus verlassen und in dem Luftschutzbunker warten, den ihr Bruder auf dem Gelände hatte errichten lassen, weil es undenkbar war, daß die Raschids in einem der öffentlichen Bunker Schutz suchten. Mußte ihr Verehrer mit den wunderbaren blauen Augen wie alle Briten befürchten, daß nach dem Ende des Kriegs in Kairo die engländerfeindliche Haltung wachsen werde? Die Ägypter würden möglicherweise jetzt den Abzug der Engländer fordern, die schon so lange in Ägypten herrschten …
Nefissa wollte nicht an Krieg oder Politik denken. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, daß man »ihren« Offizier aus Ägypten vertrieb. Sie wollte wissen, wer er war. Sie wollte mit ihm reden und … mit ihm schlafen. Aber sie wußte, das war nur ein Traum. Falls jemand ihre heimliche Liebe entdeckte, dann würde Khadija sie streng bestrafen. War nicht Nefissas ältere Schwester Fatima verstoßen worden, weil sie eine schreckliche Sünde begangen hatte? Nefissa wußte nicht, was Fatima getan hatte, aber Khadija hatte ihre Bilder aus dem Photoalbum entfernt, und niemand durfte mehr von ihr sprechen. Wenn Khadija ihrer geliebten ältesten Tochter nicht verzeihen konnte, dann gab es für Nefissa erst recht kein Erbarmen.
Das verstohlene Treffen ging zu Ende. Er drehte sich – zögernd? – um und verschwand in der Nacht. Nefissas Hände zitterten. Wie sollte sie die Stunden bis zum nächsten Mittag überstehen, bis sich das Ritual hoffentlich wiederholte? Sie war in diesen Mann verliebt und kannte nicht einmal seinen Namen.
Jemand zog an ihrem Rock. Omar machte sich bemerkbar. »Warte …«, murmelte sie, denn sie wollte die Erregung noch genießen, die der Offizier in ihr ausgelöst hatte, aber ihr kleiner Sohn forderte energisch seine Rechte. Seufzend setzte sie ihn auf den Schoß. Er knöpfte ihr das Mieder auf und begann zufrieden, an der Brust zu trinken.
»Wie geht es ihr?« fragte Marijam und trat an das Bett.
»Das Kind kann jeden Augenblick geboren werden, wenn Gott es so will, aber es liegt falsch.«
Khadija griff nach einem Amulett, das sie bereits beim Einsetzen der Wehen neben das Bett gelegt hatte, denn es besaß die besondere Kraft der Sterne. Sie hatte es an sieben aufeinanderfolgenden Nächten vor dem Vollmond auf das Dach gelegt, damit es das Licht der Sterne in sich aufnehmen konnte. Bevor sie Fatheja berührte, nahm Khadija das Amulett in die Hände, um seinen Zauber wirken zu lassen.
Der Sturm heulte, die Messinglampen schaukelten, und Zou Zou las mit leiser Stimme aus dem Koran: »Es steht geschrieben, daß uns nichts widerfährt, was Gott nicht gewollt hat. ER ist unser Hüter. Nur auf Gott sollt ihr vertrauen.«
Als Khadija sanft die Hände auf Fathejas Leib legte und dabei Marijam stumm anwies, es ihr gleichzutun, flüsterte die junge Frau: »Mutter …«, ihre fiebrigen Augen glänzten wie zwei schimmernde schwarze Perlen, »wo ist Ibrahim? Wo ist mein Mann?«
»Ibrahim ist beim König und kann nicht nach Hause kommen.« Es gelang den beiden Frauen, mit sanftem Druck das Kind in die richtige Lage zu drehen, aber sobald sie die Hände zurückzogen, sahen sie, wie sich der Unterleib langsam bewegte und das Baby wieder die Querlage einnahm.
Als Khadija den angstvollen Blick ihrer Schwiegertochter sah, sagte sie ruhig: »Gott wird uns führen. Wir müssen das Baby so lange in der richtigen Lage halten, bis es geboren ist.«
Khadija und Marijam brachten das Kind zum zweiten Mal in die richtige Lage. Aber bei der nächsten Wehe drehte es sich hartnäckig wieder quer.
Da wußte Khadija, was sie jetzt tun mußte. »Bereite Haschisch vor«, sagte sie zu Doreja.
Marijam legte Fatheja die Hand auf die glühende Stirn und murmelte ein Gebet. Marijam hieß mit Nachnamen Misrachi, das bedeutete auf arabisch »Ägypter«. Die Misrachis lebten schon seit vielen Generationen in Kairo, aber Marijam betete hebräisch, denn sie war Jüdin. Als die Nazis fast bis Alexandria vorgerückt waren, hatten Christen und Muslime die Juden in ihren Häusern versteckt. Marijam und ihr Mann hatten in dem großen Haus neben den Raschids jüdische Familien aufgenommen.
Sie sah Khadija stumm an. Die beiden Frauen mußten sich nicht mit Worten verständigen. Sie waren Freundinnen und kannten sich so gut, daß sie gegenseitig ihre Gedanken lesen konnten.
Bald erfüllte der würzige Geruch der Haschischpfeife den Raum. Khadija sprach eine Stelle aus dem Koran, wusch sich dabei Hände und Arme und trocknete sie mit einem frischen Handtuch ab. Das Wissen, auf das sie sich jetzt verließ, stammte von ihrer Schwiegermutter, denn Ali Raschids Mutter war eine Heilerin gewesen. Viele Bräute litten oft in der neuen Umgebung einer anderen Familie, denn sie befanden sich meist in Gesellschaft ihrer Schwiegermutter und bekamen ihren Mann nur selten zu sehen. So geschah es nicht selten, daß die jungen Frauen eher wie Dienstboten und weniger als Familienmitglieder behandelt wurden. Marijam wußte, daß Khadija Glück gehabt hatte. Ali Raschids Mutter besaß das unerschöpfliche Wissen alter medizinischer Geheimnisse, die über viele Generationen hinweg weitergegeben wurden. Die alte Frau war schon lange tot, aber sie hatte mit viel Geduld der verängstigten dreizehnjährigen Khadija die Kunst des Heilens beigebracht. Auch ihr Sohn Ali war Arzt gewesen. Khadija und Ibrahim setzten diese Tradition fort, für die die Raschids bekannt waren. Khadijas Können reichte noch weiter zurück und stammte aus einem anderen Harem, aber das wußte sie nur aus den Träumen.
Fatheja zog langsam an der Haschischpfeife, bis ihre Augen starr wurden. Khadija legte ihr eine Hand auf den Leib, führte das Baby von oben und griff dann mit der anderen von unten nach dem Kind.
»Sie soll weiterrauchen«, sagte sie ruhig zu Marijam und versuchte, sich das Kind vorzustellen – zwei winzige Beine, die sich in der fetalen Lage an den kleinen Körper drückten. Khadija mußte sie fassen und langsam nach unten ziehen. Das Problem bestand darin, daß die Fruchtblase schon lange geplatzt und das Fruchtwasser ausgelaufen war. Deshalb umschloß der Uterus fest das Kind, und es konnte leicht zu einer Verletzung kommen.
Fatheja sog krampfhaft an der Pfeife, aber der Schmerz wurde unerträglich. Sie warf den Kopf zur Seite, konnte sich nicht länger beherrschen und schrie laut auf.
Khadija sagte zu Doreja ruhig und bestimmt: »Ruf im Palast an. Laß Ibrahim ausrichten, daß er sofort nach Hause kommen soll.«
»Bravo!« rief König Farouk. Da er gerade ein »Cheval« gewonnen hatte, versiebzehnfachte sich sein Einsatz. Deshalb brach sein Gefolge am Roulette-Tisch in lauten Jubel aus.
Zwei Männer beklatschten den König besonders begeistert – Ibrahim Raschid und Hassan al-Sabir, der neben Ibrahim stand und in der einen Hand ein Glas Champagner hielt, während die andere auf dem Po einer auffallend hübschen französischen Blondine lag. Hassan sprach zwar angeregt über den nächsten möglichen Gewinn des Königs, aber in Wirklichkeit richtete sich seine Aufmerksamkeit auf den tiefen Ausschnitt des raffinierten Abendkleids der Blondine. »Riskieren Sie alles, Eure Majestät. Das Glück steht heute auf Ihrer Seite!«
Hassan hatte die geschliffene Aussprache eines geborenen Engländers, denn er hatte in Oxford studiert. Dort hatte er auch Ibrahim kennengelernt. Wie die meisten Söhne der Aristokratie Kairos erhielten sie ihre Ausbildung im Ausland, um dort unter anderem zu lernen, sich wie richtige englische Gentlemen zu benehmen. Wie Ibrahim hatte auch Hassan olivbraune Haut, große braune Augen und gelockte schwarze Haare. Die beiden jungen Männer hatten erst vor kurzem ihren achtundzwanzigsten Geburtstag gefeiert. Sie standen sich so nahe wie Brüder, denn sie hatten zusammen ihre Unschuld verloren, als sie sich zu diesem Zweck in London gemeinsam eine Prostituierte nahmen.
»Ja, tun Sie das, Majestät«, stimmte Ibrahim seinem Freund zu. »Möge Gott Ihren Reichtum vergrößern.«
Hassan war ein reicher Playboy-Anwalt und hatte nur den Ehrgeiz, das Leben zu genießen. Ibrahim war sogar noch reicher. Er hatte von seinem Vater im ertragreichen Nildelta einen riesigen Grundbesitz geerbt und besaß große Anteile in der Baumwollindustrie und an Reedereien. Vor allem war er ein Pascha, ein Herr. Auch er wollte nichts anderes als ein schönes Leben haben. Seine Wünsche sollten jederzeit in Erfüllung gehen; dazu gehörten natürlich auch alle erdenklichen Vergnügungen. Aber an das Vergnügen dachte er jetzt nicht, während die Herren im Frack und die Damen in Abendkleidern über den nächsten Gewinn des Königs staunten.
Als der König es nicht bemerkte, blickte Ibrahim verstohlen auf seine Uhr. Es wurde spät, und er wollte unbedingt zu Hause anrufen und sich nach seiner Frau erkundigen. Aber Ibrahim durfte den Roulette-Tisch nicht verlassen, um mit seiner Frau zu telefonieren. Er gehörte zum königlichen Gefolge, und als Leibarzt des Königs mußte er an Farouks Seite bleiben.
Ibrahim hatte den ganzen Abend Champagner getrunken. Sonst trank er nicht soviel, aber er wollte sich auf diese Weise beruhigen. Seine junge Frau würde vielleicht noch heute ihr erstes Kind bekommen. Ibrahim war in seinem ganzen Leben noch nie so nervös gewesen.
Erstaunlicherweise munterte ihn der Champagner nicht auf. Im Gegenteil, mit jedem Glas, mit jedem neuen Beifallssturm am Roulette-Tisch wuchs seine Niedergeschlagenheit. Er fragte sich, was das alles für einen Sinn haben sollte. Diese albernen Vergnügen fand er keineswegs unterhaltsam. Er warf einen prüfenden Blick auf die Herren, die sich um den König drängten – eine Schar junger Männer, die alle aussahen wie er selbst. Wir sind eigentlich Arbeitsbienen oder besser gesagt Drohnen, dachte er bitter und nahm das nächste Glas Champagner vom Tablett eines Kellners. Jedermann wußte, daß Farouk sein Gefolge mit einem besonderen Blick für Attraktivität und Geschliffenheit auswählte – junge Männer mit olivbrauner Haut, mit schönen braunen Augen und schwarzen Haaren. Sie waren alle um dreißig oder Ende zwanzig, reich und ohne sonstige Verpflichtungen, trugen Fräcke, die sie in der Savile Row in London bestellten, und sprachen ein manieriertes Englisch, das sie in England gelernt hatten. Aber auf dem Kopf tragen sie alle, stellte Ibrahim mit ungewohntem Zynismus fest, den roten Fez, das eifersüchtig gehütete Symbol der ägyptischen Oberklasse. Einige hatten ihren so weit in die Stirn geschoben, daß er fast auf den Augenbrauen saß. Araber, die keine Araber sein wollen, dachte Ibrahim geringschätzig, Ägypter, die sich als englische Gentlemen fühlen.
Ibrahim hatte zwar eine beneidenswerte Stellung, trotzdem überkam ihn hin und wieder diese Art Niedergeschlagenheit. Gewiß, er war der königliche Leibarzt, aber das konnte er sich nicht als eigenes Verdienst anrechnen, denn er hatte diese Stellung seinem einflußreichen Vater zu verdanken.
»Bei Gott«, murmelte Ibrahim seinem Freund Hassan zu und blickte wieder verstohlen auf die Uhr, »es ödet mich an. Ich möchte nach Hause zu meiner Frau. Ich liebe meine Frau. Sie braucht mich.« Ibrahim sprach so leise, daß niemand ihn hören konnte. Er durfte mit seinen Worten nicht das königliche Vergnügen beeinträchtigen. An diesem Abend besuchte der König das elegante Casino am Nil, den Club Cage d’Or. Die teuersten Wagen fuhren dort vor, und der ägyptische König verspielte im Kreis seiner britischen und ägyptischen Freunde unglaubliche Summen. Die Nightclub-Runde hatte bereits vor eineinhalb Tagen begonnen, als es Farouk in den Sinn kam, mit seinem Gefolge von einem Club zum anderen, von einem Hotel zum nächsten zu ziehen. Und noch war ein Ende nicht abzusehen.
Es hatte viele Nachteile, Farouks Leibarzt zu sein, und dazu gehörte auch, Abende wie diese an seiner Seite zu verbringen. Im Grunde, so dachte Ibrahim, ist das reine Zeitverschwendung. Ich stehe unter diesen hellen Kronleuchtern und habe Kopfschmerzen, weil ich die albernen Rumbaklänge des Orchesters nicht mehr hören kann, während diese Frauen in hautengen Kleidern mit den befrackten Herren tanzen, als würden sie es in aller Öffentlichkeit miteinander treiben.
Als Leibarzt kannte Ibrahim den König inzwischen besser als jeder andere. Er kannte ihn sogar besser als Königin Farida. Den Gerüchten nach hatte Farouk einen sehr kleinen Penis und eine sehr große Pornographiesammlung. Ibrahim wußte, nur das eine stimmte, aber er wußte auch, daß der fünfundzwanzigjährige Farouk im Grunde noch ein Kind war. Der König aß leidenschaftlich gerne Eis, freute sich über dumme Witze und verschlang Dagobert Duck-Comics, die er regelmäßig aus Amerika bezog. Zu seinen Leidenschaften gehörten Katherine Hepburn-Filme und das Roulette, aber auch Jungfrauen wie die Siebzehnjährige mit der milchweißen Haut, der er an diesem Abend den königlichen Arm gereicht hatte.
Die Menge um den Roulette-Tisch wuchs, denn jeder wollte sich im königlichen Licht sonnen, das besonders hell strahlte, denn Farouk hatte eine Glückssträhne. Ägyptische Bankiers, türkische Geschäftsleute und europäische Adlige, die Hitlers Truppen entkommen waren, drängten sich um ihn und gratulierten ihm zu seinem Gewinn. Nachdem Rommels Einmarsch überstanden war, feierte die Stadt ausgelassen die deutsche Kapitulation. In den lauten Nightclubs konnten keine unguten Gefühle aufkommen, noch nicht einmal gegen die Engländer.
Hassan amüsierte sich über die schlechte Laune seines Freundes. »Du bist doch ein richtiger Exzentriker!« spottete er, klatschte und jubelte wie die anderen, als der König wieder gewann, und strich dabei der Blondine genießerisch über den Po. Hassan wußte nicht einmal, wie sie hieß. Er hatte die bezaubernde junge Dame hier im Casino kennengelernt, aber er wollte sie erobern und heute noch mit ihr schlafen. »Vergiß nicht, mein Lieber«, sagte er zu Ibrahim, »Ehefrauen sind dazu da, das Haus sauber zu halten, Kinder zu bekommen, und sie müssen mit dir schlafen, wenn du willst. Aber es ist absurd, sie so zu lieben, wie du andere Frauen liebst.«
Ibrahim lachte. Wie die meisten jungen Männer führte Hassan eine typische ägyptische Ehe. Er hatte die Frau geheiratet, die seine Eltern ihm ausgesucht hatten. Sie war still und gefügig. Er liebte sie weder noch verabscheute er sie. Sie brachte ihm Kinder zur Welt und erhob keine Einwände gegen seine nächtlichen Ausflüge. Ibrahims Beziehung zu Fatheja war ganz anders. Ibrahim liebte sie so sehr, wie es nach Hassans Meinung kein ägyptischer Mann, der etwas auf sich hielt, einem anderen gestehen würde.
Ibrahim blickte noch einmal auf die Uhr. Er vermutete, daß die Wehen bei seiner Frau begonnen hatten, und er wollte in ihrer Nähe sein. Aber es gab noch einen Grund für seine Unruhe, ein Grund, der in Ibrahims Augen beschämend war. Er wollte wissen, ob er seinem Vater gegenüber die Pflicht erfüllt hatte, einen Sohn zu zeugen. »Das bist du mir und unseren Ahnen schuldig«, hatte Ali Raschid ihm noch kurz vor seinem Tod gesagt. »Du bist mein einziger lebender Sohn. Du trägst die Verantwortung dafür, daß unsere Sippe weiterbesteht. Ein Mann, der keine Söhne zeugt, ist kein richtiger Mann«, hatte Ali gesagt. »Töchter zählen nicht, denn wie schon das alte Sprichwort sagt: ›Alles unter einem Schleier bringt nur Kummer und Sorgen.‹«
Ibrahim konnte sich noch gut an Farouks verzweifelten Wunsch erinnern, von Königin Farida einen Sohn zu bekommen. Der König hatte von Ibrahim sogar Potenzmittel und ein Aphrodisiakum haben wollen. Und dann kam der Salut, als Farouks Kind geboren war. Ganz Kairo lauschte mit angehaltenem Atem, und alle waren enttäuscht, als die Kanonen nur einundvierzig Schüsse feuerten und nicht einhundertundeinen wie bei einem Sohn.
Sohn oder Tochter, Ibrahims Unruhe wuchs, und er wollte unbedingt zu seiner mädchenhaften Frau. Für ihn war sie ein kleiner Schmetterling.
Er stieß Hassan an und sagte leise: »Na los, und laß dir etwas einfallen, damit ich hier wegkomme.« Aber als Hassan nur eine Grimasse schnitt, mußte er doch lachen. Trotz Müdigkeit und Kopfweh, bei allem Lärm, Zigarettenrauch und Alkohol konnte sich Ibrahim glücklich preisen. Noch heute würde sein erstes Kind geboren werden, und vielleicht war es nach Gottes Willen sogar ein Sohn. Dann konnte er auch bald wieder mit Fatheja schlafen. Wir machen eine Reise nach Europa, schwor er sich. Der schreckliche Krieg ist vorüber, und wir können uns die zweiten Flitterwochen gönnen …
Der König hatte noch einmal Glück, und während alle Farouk zu seinem unglaublichen Erfolg gratulierten, blickte Ibrahim versonnen in sein Champagnerglas und erinnerte sich an den Tag, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Auf einem Gartenfest in einem der königlichen Paläste gehörte sie zu den hübschen jungen Frauen im Gefolge der Königin. Ihre Zartheit und Schönheit hatten ihn bezaubert, und er verliebte sich in sie, als sich ein Schmetterling auf ihre Stirn setzte und sie aufschrie. Die anderen umringten Fatheja besorgt, und Ibrahim eilte mit Riechsalz zu ihr. Aber als der Kreis der Frauen sich öffnete, saß sie nicht weinend in der Mitte, sondern lachte. In diesem Augenblick wußte er: Dieser kleine Schmetterling wird meine Frau sein.
Die aufgeregte Menge am Roulette-Tisch drückte die Blondine gegen Hassan, und sein Verlangen nach ihr stieg.