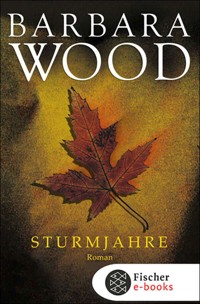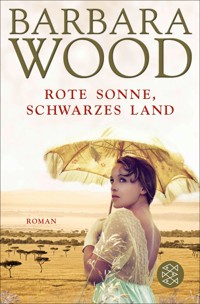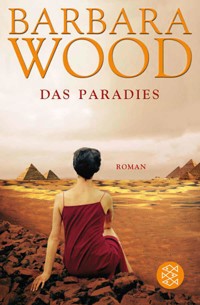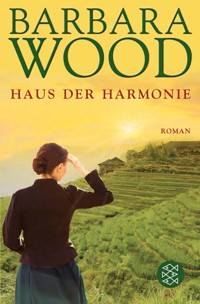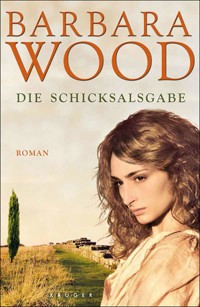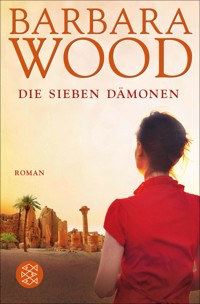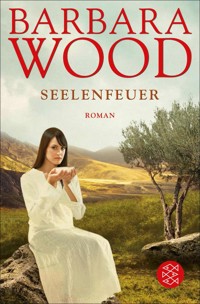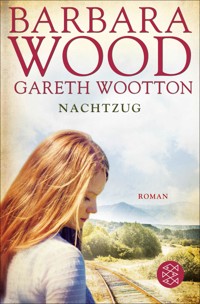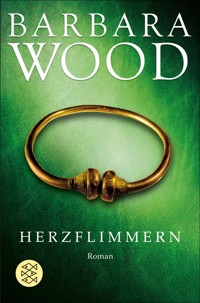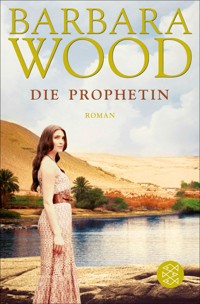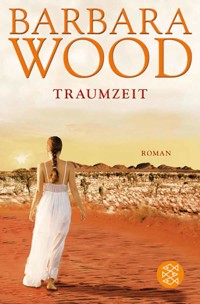
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lesegenuss von der Bestsellerautorin Barbara Wood: Als die Engländerin Joanna Drury 1871 in Melbourne ankommt, ahnt sie nicht, in welcher Weise sich ihr Schicksal erfüllen wird. Vierzig Jahre zuvor waren ihre Großeltern nach Australien ausgewandert, um mit den Aborigines zu leben – vier Jahre später gab es keine Spur mehr von ihnen. Nur ihre kleine Tochter wurde verstört aufgefunden und nach England zurückgeschickt. Was ist damals passiert? Joanna macht sich auf die Suche nach dem dunklen Familiengeheimnis und trifft auf die große Liebe … Im Herz des geheimnisvollen Fünften Kontinents erfüllt sich das Schicksal einer lange verloren geglaubten Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 917
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Barbara Wood
Traumzeit
Roman
Über dieses Buch
Als Joanna Drury 1871 in Melbourne von Bord ihres Schiffes aus England geht, ahnt sie noch nicht, was ihr in Australien bevorsteht und in welcher Weise sich ihr Schicksal hier erfüllen wird. Vierzig Jahre zuvor waren ihre Großeltern nach Australien gekommen, ein junges Missionarsehepaar, das, auf der Suche nach dem wahren Garten Eden, im Landesinneren mit den Aborigines leben wollte. Vier Jahre später gab es keine Spur mehr von ihnen. Nur ihre kleine Tochter tauchte als verstörtes Kind, versehen mit wenigen geheimnisvollen Habseligkeiten, wieder an der Küste auf und wurde zurück nach England gebracht. Sie war Joannas Mutter - nun macht sich Joanna selbst auf die Suche nach den Spuren ihrer Familie und stößt auf ihrem eigenen Traumpfad bis in das unerforschte Herz des Fünften Kontinents vor …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Barbara Wood ist international als Bestsellerautorin bekannt. Allein im deutschsprachigen Raum liegt die Gesamtauflage ihrer Romane weit über 13 Mio., mit Erfolgen wie ›Rote Sonne, schwarzes Land‹, ›Traumzeit‹, ›Kristall der Träume‹, ›Das Perlenmädchen‹ und ›Dieses goldene Land‹. Die Recherchen für ihre Bücher führten sie um die ganze Welt. 2002 wurde sie für ihren Roman ›Himmelsfeuer‹ mit dem Corine-Preis ausgezeichnet. Barbara Wood stammt aus England, lebt aber seit langem in den USA in Kalifornien.Im Fischer Taschenbuch Verlag ist das Gesamtwerk von Barbara Wood erschienen: ›Rote Sonne, schwarzes Land‹, ›Traumzeit‹, ›Herzflimmern‹, ›Sturmjahre‹, ›Lockruf der Vergangenheit‹, ›Bitteres Geheimnis‹, ›Haus der Erinnerungen‹, ›Spiel des Schicksals‹, ›Die sieben Dämonen‹, ›Das Haus der Harmonie‹, ›Der Fluch der Schriftrollen‹, ›Nachtzug‹, ›Das Paradies‹, ›Seelenfeuer‹, ›Die Prophetin‹, ›Himmelsfeuer‹, ›Kristall der Träume‹, ›Spur der Flammen‹, ›Gesang der Erde‹, ›Das Perlenmädchen‹ und ›Dieses goldene Land‹, sowie die Romane von Barbara Wood als Kathryn Harvey, ›Wilder Oleander‹, ›Butterfly‹ und ›Stars‹.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Inhalt
Teil Eins 1871
Kapitel Eins
1. Kapitel
2. Kapitel
Kapitel Zwei
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Drei
1. Kapitel
2. Kapitel
Kapitel Vier
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Fünf
1. Kapitel
2. Kapitel
Kapitel Sechs
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Sieben
1. Kapitel
Kapitel Acht
1. Kapitel
2. Kapitel
Kapitel Neun
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Zehn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Kapitel Elf
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Teil Zwei 1873
Kapitel Zwölf
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Kapitel Dreizehn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Vierzehn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Fünfzehn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Kapitel Sechzehn
1. Kapitel
2. Kapitel
Kapitel Siebzehn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Teil Drei 1880
Kapitel Achtzehn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Kapitel Neunzehn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Kapitel Zwanzig
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Kapitel Einundzwanzig
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Kapitel Zweiundzwanzig
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Dreiundzwanzig
1. Kapitel
2. Kapitel
Teil Vier 1885–1886
Kapitel Vierundzwanzig
1. Kapitel
Kapitel Fünfundzwanzig
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Kapitel Sechsundzwanzig
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Siebenundzwanzig
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Achtundzwanzig
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Kapitel Neunundzwanzig
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Kapitel Dreißig
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Kapitel Einunddreißig
1. Kapitel
2. Kapitel
Teil Eins1871
Kapitel Eins
1
Joanna träumte.
Sie sah sich am Arm eines hübschen jungen Offiziers, war dankbar für den Halt, den er ihr bot, doch über dieses Gefühl hinaus unempfindlich gegenüber seiner fürsorglichen Aufmerksamkeit. Sie nahm auch die englischen Soldaten in ihren schnittigen Uniformen und die vornehmen Damen in den eleganten Kleidern und Häubchen nicht wahr. Offiziere zu Pferde hoben die Säbel zum Salut, als man die beiden Särge in die Gräber gleiten ließ. Joannas Gedanken kreisten nur um eines: Sie hatte die beiden einzigen Menschen verloren, die sie liebte, mit achtzehn Jahren stand sie plötzlich allein auf der Welt.
Die Soldaten legten die Gewehre an und feuerten in die Luft. Joanna hob überrascht den Kopf, als über ihr der blaue Himmel aufriß. Durch den schwarzen Schleier vor ihrem Gesicht sah sie die Sonne – viel zu groß, viel zu heiß und der Erde zu nahe.
Als der Regimentskommandant an den Gräbern von Sir Petronius und Lady Emily Drury den Nachruf verlas, sah ihn Joanna erstaunt an. Weshalb sprach er so undeutlich? Sie verstand seine Worte nicht. Sie betrachtete die Menschen, die ihren Eltern die letzte Ehre erwiesen. Von den Dienstboten bis zu den höchsten Rängen des Heeres und indischer Würdenträger waren sie alle erschienen. Niemand außer ihr selbst schien die Rede des Kommandanten als undeutlich oder ungewöhnlich zu empfinden.
Joanna spürte, daß etwas nicht stimmte, und plötzlich hatte sie Angst.
Dann erstarrte sie. Am Rand der Menschenmenge sah sie einen Hund. Dieser Hund hatte ihre Mutter umgebracht.
Aber man hatte das Tier doch erschossen! Joanna war mit eigenen Augen Zeuge, als ein Soldat das Tier tötete! Und doch war dieser Hund wieder da. Seine schwarzen Augen schienen sie zu durchbohren. Als er sich jetzt geduckt und drohend in ihre Richtung bewegte, wollte Joanna schreien. Aber sie konnte nicht schreien.
Der Hund rannte in großen Sätzen auf sie zu, er sprang, aber anstatt sie anzugreifen, flog er geradewegs in den Himmel, begann zu glühen, explodierte und wurde zu zahllosen heißen, weißen Sternen.
Die Sterne kreisten am Himmel wie ein strahlendes Karussell von überwältigender Schönheit und majestätischer Macht.
Dann formten sich die Sterne am Himmel zu einem langen, gewundenen und mit Diamanten gepflasterten Weg. Doch eigentlich war es kein richtiger Weg, denn er bewegte sich.
Aus dem Weg wurde eine riesige Schlange, die über den tiefschwarzen Nachthimmel glitt.
Der diamantene Körper der Schlange funkelte und leuchtete in den Farben des Regenbogens. Er entrollte sich langsam und kroch auf sie zu. Joanna spürte, wie die kalte Hitze des Sternenfeuers sie erfaßte. Der gewaltige Schlangenleib wurde größer, immer größer, bis sie mitten auf dem Kopf der Sternenschlange ein einziges feurig leuchtendes Auge sah. Die Schlange öffnete das Maul, und Joanna sah den schwarzen Schlund – ein Tunnel des Todes, der sie verschlingen wollte.
Sie schrie.
Joanna schlug die Augen auf und wußte zuerst nicht, wo sie sich befand. Dann spürte sie das sanfte Wiegen des Schiffs und sah im schwachen Licht die Wände der Kabine. Jetzt erinnerte sie sich: Sie war an Bord der Estella auf dem Weg nach Australien.
Sie setzte sich auf und griff nach den Streichhölzern, die auf dem kleinen Tisch neben ihrem Bett lagen. Ihre Hände zitterten so heftig, daß sie die Lampe nicht anzünden konnte. Sie legte sich das Umschlagtuch um die Schultern, stand auf und ging zum Bullauge. Mit Mühe gelang es ihr schließlich, es zu öffnen. Die kalte Meerluft strich ihr über das glühende Gesicht. Sie schloß die Augen und versuchte, sich zu beruhigen.
Der Traum war so wirklich gewesen.
Sie holte tief Luft und fand die vertrauten Geräusche des Schiffs tröstlich – das Quietschen der Takelage und das Knarren der Masten. Langsam kehrte sie in die Wirklichkeit zurück. »Es war nur ein Traum«, murmelte sie leise, »wieder ein Traum …«
»Sind Träume unsere Verbindung mit der geistigen Welt?« hatte Joannas Mutter, Lady Emily, in ihr Tagebuch geschrieben. »Sind sie Botschaften oder Warnungen oder geben sie Antworten auf die Geheimnisse dieser Welt?«
»Ich wünschte, ich wüßte es, Mutter«, flüsterte Joanna und starrte auf das endlose Meer, das sich bis zu den Sternen erstreckte.
Sie hatte die Sterne über Indien immer als strahlend und überwältigend empfunden. Aber jetzt fand Joanna, sie seien nicht mit dem einzigartigen Schauspiel an diesem nächtlichen Himmel zu vergleichen. Die Sterne bildeten Formationen, die sie noch nie gesehen hatte. Die vertrauten Sternbilder ihrer Kindheit waren verschwunden. Neue leuchteten jetzt über ihr, denn sie befand sich inzwischen bereits in der südlichen Hemisphäre.
Joanna dachte über den Traum nach und über seine mögliche Bedeutung. Es war verständlich, daß sie von dem Begräbnis träumte und auch von dem Hund. Aber wieso träumte sie von einer Sternenschlange und weshalb die Angst? Warum schien die Schlange sie vernichten zu wollen?
Wenige Wochen vor ihrem Tod hatte Lady Emily in ihr Tagebuch geschrieben: »Träume quälen mich. Ein ständig wiederkehrender Alptraum, für den ich keine Erklärung habe, macht mir unerträgliche Angst. Die anderen Träume sind seltsame Bilder von Ereignissen, die mich zwar nicht beängstigen, die mir aber unglaublich wirklich zu sein scheinen. Handelt es sich dabei um verlorene Erinnerungen? Taucht auf diese Weise endlich langsam meine Kindheit wieder auf? Wenn ich es nur wüßte! Ich spüre, daß die rätselhaften Träume die Antwort auf mein Leben enthalten. Ich muß diese Antwort bald finden, oder ich werde sterben.«
Geräusche, die über das Wasser drangen, rissen Joanna aus ihren Gedanken. Sie hörte die Stimme eines Mannes aus der Dunkelheit: »Schlag, Schlag, Schlag«, und das rhythmische Eintauchen von Rudern ins Wasser. Joanna fiel wieder ein, daß die Estella in einer Flaute lag.
»So etwas habe ich noch nie erlebt«, hatte der Kapitän am Vortag zu ihr gesagt. »In all den Jahren zur See bin ich auf diesen Breiten noch nie in eine Windstille geraten. Ich kann es mir absolut nicht erklären. Ich muß wohl die Barkassen zu Wasser lassen und sehen, ob meine Männer uns mit Rudern aus dem Windloch herausbringen können.«
Joannas Angst stellte sich wieder ein.
Sie hatte gewußt, daß es so kommen würde. Sie hatte es geahnt. Bereits in dem Sanatorium in Allahabad, wo sie sich nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod der Eltern ein paar Wochen erholte, hatte sie von dieser bedrohlichen Windstille geträumt.
Warum …? Sie fröstelte unter dem Umschlagtuch und dachte: Kann das, was meine Mutter quälte und schließlich tötete, auch mich bis hierher auf dieses Meer verfolgen?
»Du mußt nach Australien fahren«, hatte Lady Emily wenige Stunden vor ihrem Tod zu Joanna gesagt. »Du mußt die Reise allein machen, die wir zusammen vorhatten. Etwas vernichtet uns. Du mußt die Ursache finden und dem Unheil ein Ende setzen, sonst wird dein Leben wie das meine enden – zu früh, und ohne daß jemand weiß, warum.«
Joanna wandte sich vom Bullauge ab und sah sich in der winzigen Kabine um. Als wohlhabende junge Frau konnte sie sich für die lange Fahrt von Indien nach Australien eine Einzelkabine leisten. Jetzt war sie dafür sehr dankbar. Sie wollte auf dieser Reise niemanden in der Kabine bei sich haben. Sie mußte mit ihrer Trauer allein sein. Sie brauchte Zeit, das zu verstehen, was ihrer Familie und ihr selbst zugestoßen war. Sie mußte langsam begreifen, was sie eigentlich auf die andere Seite der Welt führte und in ein Land, von dem sie so wenig wußte.
Joanna blickte auf die Papiere, die auf dem kleinen Sekretär lagen. Sie enthielten ein altes Erbe, das Erbe von Großeltern, die sie nie gekannt hatte. Joanna hatte versucht, diese Papiere zu entziffern, so wie ihre Mutter versucht hatte, ihre Bedeutung zu verstehen. Auf dem Sekretär lag auch das Tagebuch ihrer Mutter – Lady Emilys ›Leben‹, ein Buch voll von ihren Träumen, Ängsten und vergeblichen Bemühungen, das Geheimnis ihres Lebens zu enthüllen: die verlorenen Jahre, an die sie keine Erinnerungen besaß, und die Alpträume, die offenbar eine beängstigende Zukunft prophezeiten. Dort lag auch eine Grundbesitzurkunde – auch sie gehörte zu dem Erbe, das jene Großeltern Joanna hinterlassen hatten. Niemand wußte, wo sich das in der Urkunde bezeichnete Land befand, und weshalb die Großeltern es gekauft oder ob sie dort gelebt hatten.
»Aber ich spüre es deutlich, Joanna«, sagte Lady Emily am Ende ihres Lebens, »die Antwort zu allen Fragen liegt an diesem Ort, den diese Urkunde nennt. Das Land befindet sich irgendwo in Australien. Vielleicht bin ich dort geboren worden. Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich, ob die Frau, die ich in meinen Träumen sehe, dort ist oder einmal dort war. Es ist denkbar, daß meine Mutter noch dort ist, daß sie noch lebt. Aber das wäre sehr unwahrscheinlich. Ich weiß nur, man nannte den Ort Karra Karra. Du mußt ihn suchen, Joanna, damit meine Seele Ruhe findet. Du mußt ihn suchen, um dich zu retten, aber auch um deine zukünftigen Kinder zu retten.«
Mich retten? Uns retten?
Wovor, dachte Joanna bekümmert. Was hat das alles nur zu bedeuten?
Auf dem Sekretär lag außerdem ein Brief – ein zorniger Brief, in dem stand: »Du sprichst von einem Fluch. Das ist eine Versündigung an Gott.« Der Brief trug keine Unterschrift, aber Joanna wußte, er stammte von ihrer Tante Millicent, die Joannas Mutter, Emily Drury, großgezogen hatte. Tante Millicent hatte sich angstvoll geweigert, mit der Tochter ihrer Schwester über die Vergangenheit zu sprechen. Und dann stand auf dem Sekretär noch eine Miniatur von Lady Emily – das Bildnis einer schönen Frau mit traurigen Augen. Wie fügten sich diese Dinge in das Rätsel ihres tragischen Todes? Und was haben sie mit meinem Schicksal zu tun? dachte Joanna.
»Ich weiß nicht, weshalb Ihre Mutter stirbt«, hatte der Arzt zu Joanna gesagt, »das zu verstehen, übersteigt mein Wissen und meine Fähigkeiten. Sie ist nicht krank, und doch scheint sie zu sterben. Ich glaube, es ist weniger ein Leiden des Körpers als des Geistes. Aber ich finde keine Erklärung dafür und kann auch keine Ursache benennen.«
Einige Tage vor diesem Gespräch war ein tollwütiger Hund auf dem Garnisonsgelände aufgetaucht, wo ihr Vater stationiert war. Der Hund entdeckte Joanna, die sich vor Angst erstarrt hilflos an eine Mauer drückte. In diesem Augenblick erschien Lady Emily und stellte sich zwischen ihre Tochter und den Hund. Das tollwütige Tier wollte angreifen und setzte zum Sprung an. Ein Soldat sah die Gefahr, zielte, schoß, und der Hund fiel tot vor ihren Füßen zu Boden.
»Lady Emily hat alle Symptome der Tollwut, Miss Drury«, erklärte der Arzt, »aber der Hund hat Ihre Mutter nicht gebissen. Ich verstehe nicht, weshalb die Symptome bei ihr auftreten.«
Joanna blickte aus dem Bullauge auf das dunkle Meer. Sie hörte, wie die Männer in den Booten versuchten, das Schiff wie ein riesiges, hilfloses blindes Wesen durch die Nacht zu ziehen. Und sie dachte daran, wie ihre Mutter im Sterben gelegen hatte und sich nicht gegen die Macht wehren konnte, die sie tötete. Nur wenige Stunden nach dem Tod seiner geliebten Frau hatte ihr Mann, Oberst Petronius, den Dienstrevolver an seine Schläfe gesetzt und abgedrückt.
»Unheimliche Kräfte sind am Werk, meine liebste Joanna«, hatte Lady Emily gesagt, »sie erheben nach all den vielen Jahren Anspruch auf mich. Sie werden auch auf dich Anspruch erheben. Bitte … geh nach Australien. Finde heraus, was geschehen ist, und verhindere, daß dieses schleichende Gift auch dich tötet … Was immer es sein mag, verhindere, daß dieser Fluch auch dich trifft.«
Joanna erinnerte sich an das, was die Mutter ihr vor langer Zeit anvertraut hatte. »Ein Kapitän brachte mich zu Tante Millicent nach England, als ich vier Jahre alt war«, erzählte Lady Emily damals. »Ich war auf seinem Schiff gewesen, das offenbar aus Australien kam. Ich hatte nur wenig bei mir. Ich war stumm. Ich konnte nicht sprechen. Ich kann mir nur vorstellen, daß die Ereignisse in Australien, an die ich mich nie erinnern konnte, im wahrsten Sinne des Wortes unaussprechlich gewesen sein müssen.
Millicent sagte, es habe Monate gedauert, bis ich überhaupt ein Wort über die Lippen brachte. Joanna, es ist wichtig zu erfahren, warum das so war, und was unserer Familie in Australien zugestoßen ist.«
Vor einem Jahr dann, nach Lady Emilys neununddreißigstem Geburtstag, begannen Träume sie zu quälen, und sie glaubte, es könne sich dabei um Erinnerungen an die verlorenen Jahre ihrer Kindheit handeln. Sie schilderte diese Träume in ihrem Tagebuch: »Ich bin ein kleines Kind. Eine junge Frau hält mich in den Armen. Sie hatte eine sehr dunkle Haut. Menschen stehen um uns herum. Wir alle warten schweigend auf etwas. Wir blicken auf eine Art Höhle. Ich beginne zu reden, aber man sagt mir, daß ich schweigen soll. Irgendwie weiß ich, daß wir auf meine Mutter warten. Ich möchte, daß sie kommt. Ich habe große Angst um sie … Ich spüre die heiße Sonne auf meinem Körper. Ich frage mich, ob das eine Erinnerung an meine Jahre in Australien ist. Aber was bedeutet dieser Traum?«
Joanna blickte zu den Sternen am Himmel auf und suchte das Kreuz des Südens. Seine Spitze deutete nach Australien, das nur noch wenige Tage entfernt lag. Joanna war entschlossen, dorthin zu gehen und die Antworten zu finden. Als sie am Bett ihrer Mutter gesessen und mit angesehen hatte, wie die schöne Lady Emily an einer rätselhaften Krankheit starb, dachte Joanna: Jetzt ist es vorbei. Mutter, deine jahrelangen Alpträume, die namenlosen Ängste – alles ist vorbei. Jetzt hast du Frieden.
Aber im Sanatorium, wo Joanna sich nach dem Tod der Eltern von dem Schock erholte, hatte sie einen Traum: Sie befand sich auf einem Schiff mitten auf dem Meer. Das Schiff lag in einer Flaute. Die Segel hingen schlaff an den Masten, und der Kapitän erklärte seiner Mannschaft, Wasser und Lebensmittel seien bedenklich knapp. Und im Traum hatte Joanna irgendwie gewußt, daß sie der Grund für diese Flaute war.
Sie war voller Entsetzen aufgewacht und hatte im selben Augenblick erkannt, was immer Lady Emily das ganze Leben über verfolgt haben mochte, war nicht mit ihr gestorben. Es war nun das Erbe ihrer Tochter.
Während Joanna hörte, wie die Matrosen sich in der Dunkelheit in die Riemen legten und versuchten, die Estella aus der Windstille zu schleppen, überkam sie plötzlich das Gefühl, sie habe keine Zeit zu verlieren. Die Dringlichkeit ihrer Aufgabe wurde ihr in aller Deutlichkeit bewußt. Es konnte kein Zufall sein – der Traum und das Schiff in der Flaute. Es war also doch etwas Wahres an den dunklen Geheimnissen, die ihre Mutter so gequält hatten. Joanna blickte in die Nacht und versuchte, sich den Kontinent vorzustellen, der nur wenige Tage entfernt lag: Australien! Dort warteten möglicherweise die Geheimnisse der Vergangenheit und die ihrer Zukunft.
2
»Melbourne! Der Hafen von Melbourne! Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit, von Bord zu gehen!«
Joanna stand mit den anderen Passagieren an Deck und sah, wie der Hafen von Melbourne näher kam. Sie wollte möglichst schnell von Bord und weg von der kleinen Kabine. Sie warf einen Blick über die Menschenmenge, die sich zur Ankunft des Schiffes am Kai versammelt hatte, dann hob sie den Kopf und betrachtete die nicht weit vom Hafen entfernte Silhouette der Stadt. Joanna fragte sich beklommen, ob sie dort hinter den Gebäuden und Kirchtürmen die Antworten finden würde, die ihre Mutter gesucht hatte. Vielleicht lagen sie auch irgendwo im Innern eines Landes, das für Tausende von Jahren nur von Nomaden, von den Aborigines, bewohnt worden war. Sie wünschte, das Herz wäre ihr in diesem Augenblick nicht so schwer gewesen.
Die Landungsbrücke wurde am Schiffsrumpf befestigt. Dann versammelten sich die Offiziere des Schiffs und verabschiedeten sich von den Passagieren. Als Joanna den Kopf hob und zum Himmel aufblickte, mußte sie sich an der Reling festhalten, so überwältigend war das strahlende Licht. Eine solche Kraft und Intensität hatte sie noch nicht erlebt – das war nicht die heiße, sinnliche Sonne Indiens, unter der sie aufgewachsen war, auch nicht das sanfte, dunstige Licht Englands, das sie als Kind erlebt hatte. Australiens Sonne war groß, stark und klar. Und Joanna empfand die grellen, durchdringenden Strahlen beinahe als aggressiv.
Sie entdeckte eine Gruppe Männer, dem Aussehen nach Arbeiter, die schnell die Gangway heraufstiegen. An Deck angelangt, griffen sie nach den Gepäckstücken und versprachen den Passagieren, ihnen die Sachen für nur einen oder zwei Penny an Land zu tragen. Ein junger Schwarzer näherte sich Joanna. »Ich mach’ das für Sie, Miss«, erklärte er und griff nach ihrem Schrankkoffer. »Ich verlange nur sechs Pennys. Wohin wollen Sie?«
Sie sah ihn mit großen Augen an. Es war ihre erste Begegnung mit einem Aborigine, einem der australischen Ureinwohner. Ihr ganzes Leben lang hatte sie von diesen Menschen gehört. »Ja«, sagte sie nach kurzem Zögern. »Bitte bringen Sie mein Gepäck hinunter zum Kai.«
Der Mann packte den Griff an einem Ende des Koffers und hob ihn hoch. Er lächelte Joanna an. Dann verschwand sein Lächeln, und er musterte sie plötzlich eingehend. Seine Augenlider zuckten, er ließ den Koffer los und drehte sich auf dem Absatz um. Er griff nach dem Korb, mit dem sich eine ältere Frau abmühte. »Soll ich Ihnen den Korb tragen, Lady?« fragte er, und als die Dame nickte, folgte er ihr über das Deck und entfernte sich von Joanna.
Ein Träger der Reederei kam mit einem kleinen zweirädrigen Karren auf sie zu. »Darf ich Ihren Koffer an Land bringen, Miss?« fragte er.
»Was hat das zu bedeuten?« fragte sie und wies auf den Aborigine.
»Nehmen Sie es nicht persönlich, Miss. Vermutlich war ihm der Koffer zu schwer. Diese Menschen halten nicht viel von richtiger Arbeit. Ich werde Ihnen das Gepäck hinunterbringen.«
Sie folgte dem Mann die Gangway hinunter und drehte sich noch einmal verwirrt nach dem Ureinwohner um. Aber er schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein.
»Da wären wir, Miss«, sagte der Träger, als sie am Kai standen. »Werden Sie abgeholt?«
Sie sah auf die vielen Menschen, von denen einige den ankommenden Passagieren zuwinkten, und dachte an einen Tagebucheintrag ihrer Mutter. Lady Emily hatte dort geschrieben: »Manchmal frage ich mich, ob irgendwo in Australien noch jemand von meiner Familie lebt – meine Eltern vielleicht?«
Joanna gab dem Mann ein paar Münzen und sagte: »Nein. Nein, ich werde nicht abgeholt.«
Inmitten der aufgeregten Menschenmenge zwang sich Joanna, darüber nachzudenken, was als nächstes zu tun war. Zuerst brauchte sie eine Unterkunft. Sie mußte irgendwie mit dem für ihren Lebensunterhalt ausgesetzten Geld zurechtkommen, denn das ganze Erbe würde man ihr erst in zweieinhalb Jahren auszahlen. Als nächstes würde sie jemanden suchen müssen, der ihr half, den Grundbesitz ihrer Familie ausfindig zu machen, und jemanden, der noch etwas über die Verhältnisse in Australien vor siebenunddreißig Jahren wußte.
Plötzlich hörte Joanna hinter sich lautes Geschrei. Jemand rief: »Haltet ihn! Haltet den Jungen!«
Sie drehte sich um und sah an Deck einen kleinen Jungen, der wie ein Blitz durch die Menge rannte. Er konnte höchstens vier oder fünf sein. Ein Steward verfolgte ihn erst in die eine und dann in die andere Richtung.
»Haltet ihn!« rief der Mann atemlos. Als die Leute das Kind festhalten wollten, drehte der Kleine sich blitzschnell um, stürmte die Gangway hinunter und dicht an Joanna vorbei.
Sie sah, wie der Junge mit seinen dünnen Beinchen in seiner kurzen Hose ziellos hin und her rannte. Als der Steward ihn schließlich einholte, ließ er sich fallen und begann, den Kopf auf den Boden zu schlagen.
»Aber, aber!« rief der Mann, packte den Jungen am Kragen und schüttelte ihn. »Hör damit auf!«
»Warten Sie!« sagte Joanna, »Sie tun ihm weh!«
Sie kniete sich neben den Jungen, der sich im Griff des Stewards wand, und sah, daß er sich die Stirn aufgeschlagen hatte. »Hab keine Angst«, beruhigte sie ihn, »niemand wird dir etwas tun.« Sie öffnete die Tasche, holte ein Tuch heraus und betupfte sanft die Wunde. »Siehst du«, sagte sie, »jetzt tut es nicht mehr weh.«
Sie sah den Steward an. »Was ist denn geschehen?« fragte sie. »Er hat schreckliche Angst.«
»Tut mir leid, Miss, ich weiß es nicht. Und ich bin auch kein Kindermädchen. Man hat ihn in Adelaide an Bord gebracht, und jemand mußte sich um ihn kümmern. Er war in den letzten Tagen unter Deck und hat mir nichts als Ärger gemacht. Er wollte nichts essen, nicht reden …«
»Wo sind seine Eltern?«
»Weiß ich nicht, Miss. Ich weiß nur, er hat mir nur Ärger gemacht und soll hier von Bord. Jemand wird ihn abholen.«
Joanna bemerkte, daß am Hemd des Jungen mit einer Sicherheitsnadel ein Geldschein und ein Blatt Papier festgesteckt waren. Auf dem Papier stand: ADAM WESTBROOK. »Heißt du Adam?« fragte sie. »Adam?«
Der Junge starrte sie an, sagte aber nichts.
Der Steward machte Anstalten, sich den Geldschein zu nehmen. »Ich glaube, nach all der Mühe, die ich mit ihm hatte, habe ich das wohl verdient.«
»Das Geld gehört ihm«, sagte Joanna. »Nehmen Sie es ihm nicht weg.«
Der Steward sah sie verblüfft an, betrachtete das hübsche Gesicht der jungen Dame und hörte an ihrer Stimme, daß sie gewohnt war, Befehle zu geben. Er bemerkte das teure Kleid, und als er den Anhänger an ihrem Schrankkoffer sah, der verriet, daß sie erster Klasse gereist war, kam er zu dem Schluß, sie müsse eine Dame der besseren Gesellschaft sein. »Sie haben vermutlich recht«, sagte er. »Wissen Sie, ich habe nichts gegen Kinder. Aber er war wirklich eine Zumutung. Die ganze Zeit hat er nur geweint und solche Ausbrüche gehabt. Und er wollte nicht reden – nicht ein einziges Wort! Also, ich muß wieder an Bord.« Ehe Joanna etwas erwidern konnte, übergab ihr der Steward ein Bündel und verschwand in der Menge.
Joanna betrachtete den Jungen aufmerksam. Er hatte ein blasses, sehr zartes Gesicht. Sie dachte: Wenn ich ihn hochhebe und gegen das Licht halte, kann ich durch ihn hindurchsehen. Warum war er allein auf dem Schiff? Und welches Unglück, welche schreckliche Qual hat ihn jetzt dazu getrieben, sich selbst zu verletzen …?
Plötzlich hörte Joanna die Stimme eines Mannes. »Entschuldigen Sie, Miss, aber ist das Adam?«
Sie hob den Kopf und sah einen gutaussehenden Mann vor sich. Er hatte ein kantiges Kinn, eine gerade Nase und von der Sonne eingebrannte Fältchen um die rauchgrauen Augen.
»Ich bin Hugh Westbrook«, sagte er und zog den Hut. »Ich möchte Adam abholen.« Er lächelte sie an, dann kniete er sich vor Adam: »Hallo, Adam. Es ist ja gut. Ich bin gekommen, dich nach Hause zu bringen.«
Ohne den Hut glaubte Joanna eine Ähnlichkeit zwischen dem Jungen und dem Mann zu sehen – der gleiche Mund, eine schmale Oberlippe und eine vollere Unterlippe. Und als der Mann das Kind ernst ansah, erschien zwischen seinen Augenbrauen die gleiche senkrechte Falte wie bei dem Jungen.
»Ich nehme an, du hast Angst, Adam«, sagte Westbrook. »Es ist alles in Ordnung. Dein Vater war mein Vetter. Wir sind also miteinander verwandt. Du bist auch mein Vetter.« Er streckte die Hand aus, aber Adam wich zurück und drückte sich an Joanna.
Westbrook hatte ein in braunes Packpapier gewickeltes Paket bei sich. Er löste die Schnur und sagte: »Hier, das habe ich für dich gekauft. Ich dachte, du möchtest vielleicht etwas Neues anziehen … So etwas, wie wir auf Merinda tragen. Hat dir deine Mutter von meiner Schaffarm Merinda erzählt?«
Als der Junge nicht antwortete, erhob sich Hugh Westbrook und sagte zu Joanna: »Das habe ich in Melbourne gekauft.« Er hielt ein Jäckchen in der Hand, das um Stiefel und einen Hut gewickelt gewesen war. »In dem Brief stand nichts Genaues darüber, was der Kleine vielleicht brauchen würde. Aber vorerst reicht es. Und später kann ich dir mehr kaufen. Hier, das ist für dich«, sagte er und hielt Adam das Jäckchen hin. Aber der Junge stieß nur einen seltsamen Schrei aus und verbarg den Kopf in seinen Armen.
»Bitte«, sagte Joanna, »bitte, lassen Sie mich ihm helfen.« Sie nahm das Jäckchen und zog es dem Jungen an. Aber es war zu groß. Adam schien darin zu verschwinden.
»Und wie ist es damit?« fragte Westbrook und setzte dem Jungen den Hut auf den Kopf. Er rutschte Adam über Augen und Ohren bis auf die Nase.
»Na ja«, meinte Joanna.
Westbrook sah sie an: »Ich hätte nicht gedacht, daß er noch so klein ist. Er wird im Januar fünf. Ich habe keine Erfahrung mit Kindern und sehe jetzt, daß ich mich verschätzt habe.« Er sah Adam nachdenklich an und sagte dann zu Joanna: »Ich dachte, der Junge würde für sich selbst sorgen können. Ich habe keine Ahnung, was ein so kleines Kind braucht. Auf der Farm arbeiten wir den ganzen Tag. Wie ich sehe, braucht Adam viel Zuwendung.«
Joanna blickte auf das Kind hinunter und auf die Platzwunde an seiner Stirn. »Er leidet sehr«, sagte sie. »Was ist mit ihm passiert?«
»Ich weiß es nicht genau. Sein Vater ist vor einigen Jahren tödlich verunglückt. Damals war Adam noch ein Baby. Und vor kurzem ist seine Mutter gestorben. Die Behörden haben mich benachrichtigt und mir mitgeteilt, daß Adam plötzlich verwaist ist. Sie haben angefragt, ob ich als sein nächster Angehöriger bereit sei, ihn aufzunehmen.«
»Der arme Junge«, murmelte Joanna und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Wie ist seine Mutter denn gestorben?«
»Das weiß ich nicht.«
»Ich hoffe, er war nicht dabei. Er ist noch so jung. Aber etwas scheint schreckliche Spuren bei ihm hinterlassen zu haben. Was hast du denn erlebt, Adam?« fragte ihn Joanna. »Sag es uns bitte. Weißt du, es wird dir helfen, wenn du darüber sprichst.«
Aber der Junge starrte mit großen Augen auf einen riesigen Kran, der Fracht von einem Schiff entlud.
Joanna sagte zu Westbrook: »Meine Mutter erlitt einen Schock, als sie noch ein kleines Kind war. Sie hatte etwas Schreckliches mit angesehen, und das hat sie ihr ganzes Leben lang verfolgt. Niemand konnte ihr helfen, niemand ihren seelischen Schmerz verstehen und ihr die Liebe und die Zuneigung schenken, die sie brauchte. Sie wuchs bei einer Tante auf, der das notwendige Mitgefühl fehlte, und vermutlich ist ihre seelische Wunde nie verheilt. Ich glaube, sie ist schließlich an den Folgen dieser schrecklichen Kindheitserlebnisse gestorben.«
Joanna legte die Hand unter Adams Kinn und hob sein Gesicht. Sie sah in seinen Augen Qualen und auch Angst. Für ihn scheint das alles ein Alptraum zu sein, dachte sie, für ihn gehören wir alle zu einem schrecklichen Traum.
Sie bückte sich zu dem Jungen: »Du träumst nicht, Adam. Du bist wach. Glaub mir, es ist alles in Ordnung. Man wird für dich sorgen. Niemand will dir wehtun. Ich habe auch schreckliche Träume. Sie verfolgen mich ständig. Aber ich weiß, daß es nur Träume sind, und sie können mir nichts anhaben.«
Westbrook beobachtete Joanna, die begütigend auf den Jungen einredete. Ihm fiel auf, wie sanft sich ihr schlanker Körper Adam zuneigte. Wie die Eukalyptusbäume im Busch, dachte er und mußte lächeln. Und als er sah, wie der Junge sich beruhigte, sagte er: »Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das war sehr freundlich von Ihnen. Sie haben es sicher eilig. Wenn Sie abgeholt werden, dann wird man Sie suchen, Miss …«
»Drury«, sagte sie. »Joanna Drury.«
»Machen Sie hier Ferien, Miss Drury?«
»Nein, ich mache keine Ferien. Meine Mutter und ich wollten zusammen nach Australien kommen. Wir wollten uns um einige Familienangelegenheiten kümmern. Es geht dabei auch um geerbtes Land. Aber sie ist gestorben, bevor wir Indien verlassen haben. Deshalb bin ich jetzt allein hier.« Sie lächelte. »Ich war noch nie in Australien. Schon der erste Eindruck ist überwältigend.«
Westbrook sah sie an und bemerkte zu seiner Überraschung ein Leuchten in ihren Augen, das aber schnell wieder verschwand. Es hatte noch etwas anderes in ihrem Lächeln gelegen, und er begriff, daß es Angst gewesen war. Er hörte die Zurückhaltung in ihrer Stimme, die klang, als seien die Worte eingeübt. Aber dahinter schien sich ein Geheimnis zu verbergen. Hugh mußte sich eingestehen, daß diese Frau ihn faszinierte.
»Wo liegt dieses Land, nach dem Sie suchen?« fragte er. »Ich kenne Australien ziemlich gut.«
»Ich weiß es nicht. Es muß in der Nähe eines Ortes mit dem Namen Karra Karra liegen. Kennen Sie Karra Karra?«
»Karra Karra. Das klingt wie ein Ort der Aborigines. Ist er hier in Victoria?«
»Tut mir leid, ich weiß es nicht.«
Westbrook sah sie erstaunt an. Dann meinte er: »Ich kenne viele Leute in Australien. Ich würde mich freuen, Ihnen zu helfen, das Land zu finden.«
»Das wäre sehr liebenswürdig von Ihnen, Mr. Westbrook. Aber Sie werden Adam sicher schnell nach Hause bringen wollen.«
Er sah, wie sie sich eine Haarsträhne aus der Stirn strich, und die anmutige Geste machte ihn sprachlos. Er warf einen Blick auf die Männer, die sich um die Gangway drängten und die weiblichen Passagiere musterten, die in Australien einwandern wollten. Einige hielten Tafeln mit der Aufschrift: »Suche eine Frau, die kochen kann«, und: »Gesunde Frau gesucht! Ehe nicht ausgeschlossen.« Einige Mutige riefen den Frauen ihre Wünsche zu. Westbrook stellte sich vor, wie es Joanna mutterseelenallein in Melbourne ergehen würde. Es war eine rauhe Siedlerstadt, in der viermal mehr Männer als Frauen lebten. Sie würde den Rücksichtslosen und Unverschämten ausgeliefert sein.
»Miss Drury«, sagte er, »darf ich fragen, wo Sie in Melbourne wohnen werden?«
»Ich werde mir wohl zuerst ein Hotel suchen und dann eine Pension oder eine Wohnung.«
»Ich denke mir, Miss Drury, daß wir uns vielleicht gegenseitig nützlich sein können. Sie brauchen Hilfe, um Australien kennenzulernen, und ich brauche Hilfe mit Adam. Können wir nicht ein Abkommen treffen? Sie helfen mir einige Zeit mit Adam, damit er sich bei uns eingewöhnt, und ich werde dafür sorgen, daß Sie dieses Karra Karra finden. Es wäre nicht für lange. Ich werde in einem halben Jahr heiraten«, sagte er. »Meine Schaffarm Merinda ist nicht gerade luxuriös. Ich glaube, Sie sind sehr viel Besseres gewöhnt. Das Wohnhaus ist eher eine Hütte und besteht im wesentlichen aus einer Veranda und einem Zimmer. Aber Sie können es zusammen mit Adam für sich haben. Ich werde dafür sorgen, daß es Ihnen an nichts fehlt. Ich möchte, daß der Junge sich von Anfang an bei mir wohl fühlt, und bei Ihnen scheint er ruhiger zu werden.«
Als er ihre Unsicherheit spürte, fügte er hinzu: »Ich kann Ihr Zögern verstehen. Aber was haben Sie zu verlieren? Unser Abkommen lautet: Sie kommen mit mir nach Merinda und sorgen ein halbes Jahr für Adam. Ich werde Ihnen helfen, das zu finden, wonach Sie suchen. Australien ist drei Millionen Quadratmeilen groß. Der größte Teil ist noch unerforscht, aber von dem Wenigen, was besiedelt ist, kenne ich das meiste. Sie werden nicht in der Lage sein, Ihr Ziel allein zu erreichen. Sie brauchen Hilfe. Ich habe viele Freunde, und einer davon ist Anwalt. Ich könnte ihn bitten, nach dem Land zu suchen, das Sie geerbt haben. Denken Sie bitte darüber nach, Miss Drury. Vielleicht kommen Sie auch nur für einen Monat, damit wir einen Anfang finden, und ich werde Ihnen helfen, Ihre Sache in Gang zu bringen. Ich verspreche Ihnen, es wird nichts Unschickliches geschehen. Denken Sie darüber nach, während ich das Fuhrwerk hole.«
Joanna beobachtete ihn, als er in der Menge verschwand. Dann spürte sie eine kleine Hand, die sich in die ihre schob. Adam sah sie mit seinen großen grauen Augen fragend an, und Johanna dachte über diese unerwartete Wendung der Ereignisse nach.
Sie erinnerte sich an alles, was sie geopfert hatte, um hierher zu kommen. Sie hatte soviel zurückgelassen – ihre Freunde in Indien, die Städte, die sie so gut kannte, die Kultur, in der sie aufgewachsen war, und nicht zuletzt den gutaussehenden jungen Offizier, der bei der Beerdigung ihrer Mutter an ihrer Seite stand. Er hatte sie um ihre Hand gebeten …
Plötzlich bekam sie Heimweh. Sie beobachtete, wie die Leute Fuhrwerke und Kutschen bestiegen oder davonritten. Sie sah den dichten Verkehr auf den Straßen, die nach Melbourne führten, und ihr wurde bewußt, daß sie zum ersten Mal in ihrem Leben allein war – eine Fremde unter Fremden in einem unbekannten Land. Ohne die Bitte ihrer Mutter, nach Australien zu fahren, wäre es so einfach für sie gewesen, in Indien zu bleiben.
Sie mußte an den jungen Ureinwohner denken, der an Bord gekommen war. Warum hatte er sie so merkwürdig angesehen und sich geweigert, ihren Koffer zu tragen? Und dann fiel ihr ein, daß sie im Grunde überhaupt keine andere Wahl gehabt hatte, als nach Australien zu kommen.
Sie dachte wieder an Hugh Westbrook und gestand sich erstaunt ein, daß sie ihn eigentlich sehr anziehend fand. Er sah gut aus und war jung – ungefähr dreißig, vermutete sie. Aber es war mehr als das. Joanna kannte nur Männer mit makellosen Uniformen und diszipliniertem, absolut korrektem Benehmen. Selbst der Heiratsantrag des jungen Offiziers war steif und höflich gewesen, als halte er sich genau an eine Dienstvorschrift. Dieser junge Mann hätte nicht im Traum daran gedacht, eine Dame anzusprechen, der er nicht förmlich vorgestellt worden war. Westbrook dagegen wirkte ungezwungen und ausgeglichen. Er schien seinen eigenen Regeln zu folgen, und das gefiel Joanna.
Er hatte versprochen, ihr bei der Suche nach Karra Karra behilflich zu sein. Sie wußte, jemand mußte ihr helfen. Und er hatte gesagt, ihm sei Australien vertraut. Soll ich ihm auch den anderen Teil der Geschichte erzählen, überlegte sie, soll ich ihm von den Träumen erzählen und den schrecklichen Ereignissen, die ihnen folgen? Nein, das wollte sie nicht – noch nicht. Denn sie hatte ja selbst keine Erklärung dafür, war sich unsicher, ob diese Dinge tatsächlich oder nur in ihrer Einbildung existierten.
Als die Erinnerung an den jungen Ureinwohner auf dem Schiff wieder auftauchte – sein seltsamer Blick und die Abruptheit, mit der sich von ihr abgewendet hatte –, schob Joanna diesen Gedanken energisch beiseite. Das tat sie auch mit dem Traum von dem Schiff in der Flaute, der in Erfüllung gegangen war. Sie versuchte, sich statt dessen vorzustellen, wie Hugh Westbrooks Schaffarm sein mochte. Lag sie inmitten von sanften grünen Hügeln und saftigen Weiden wie die Farmen, die sie einst in England gesehen hatte? Standen dort große schattenspendende Eichen? Zirpten Sperlinge in einem Garten hinter der Küche? Oder unterschied sich Hugh Westbrooks Zuhause von den Farmen in England? Joanna hatte über Australien, diesen seltsamen und geheimnisvollen Kontinent, so viel wie möglich gelesen. In diesem Land gab es keine Huftiere, keine großen Raubkatzen. Die Bäume warfen im Herbst nicht die Blätter ab, sondern die Rinde, und einige behaupteten, die Ureinwohner seien die älteste Menschenrasse der Erde. Und plötzlich wurde Joanna neugierig. Ja, sie wollte das alles kennenlernen.
»Nun, Miss Drury? Wie lautet Ihre Antwort?«
Joanna drehte sich um und sah Hugh Westbrook an. Er hatte den Hut nicht wieder aufgesetzt, und ihr fiel auf, daß ihm die Haare kreuz und quer auf dem Kopf lagen. Sie kannte nur pomadisierte Männer, denn die Offiziere achteten sehr darauf, daß ihre geölten Haare immer glatt anlagen. Westbrooks lange Haare fielen locker und wellig in alle Richtungen, als habe er es aufgegeben, sich zu kämmen, und lasse sie wachsen, wie die Natur es wollte.
Joanna spürte den Druck der kleinen Finger in ihrer Hand und erinnerte sich daran, wie verzweifelt dieser kleine Junge den Kopf auf den Boden geschlagen hatte, als versuche er, unaussprechliche Eindrücke zu verjagen. Deshalb antwortete sie: »Also gut, Mr. Westbrook. Ich komme für einige Zeit mit Ihnen.«
Er lächelte sie erleichtert an. »Möchten Sie in der Stadt noch etwas besorgen? Vielleicht wollen Sie Ihrer Familie einen Brief schicken und Ihre Adresse mitteilen.«
»Nein«, sagte sie, »ich habe keine Familie.«
Als Westbrook den großen Koffer im Wagen verstaute, öffnete Joanna eine kleinere Tasche. Sie holte eine Flasche und einen sauberen Verband heraus. Dann betupfte sie Adams Wunde.
»Womit behandeln Sie die Wunde?« fragte Westbrook.
»Eukalyptusöl«, erwiderte Joanna. »Es wirkt antiseptisch und beschleunigt die Heilung.«
»Ich wußte nicht, daß es außerhalb Australiens Eukalyptusbäume gibt.«
»Man hat einige nach Indien gebracht, wo ich gelebt habe. Meine Mutter kaufte das Öl bei einem ansässigen Drogisten. Sie hat es oft verwendet. Zu ihren Begabungen gehörten die Medizin und das Heilen.«
»Ich dachte immer, außerhalb von Australien wisse kein Mensch etwas über die Heilkraft von Eukalyptusöl. Natürlich verdanken wir dieses Wissen den Aborigines. Sie benutzten Eukalyptus als Heilmittel schon viele Jahrhunderte, bevor der weiße Mann hierherkam.«
Der Wagen setzte sich langsam in Bewegung. Sie verließen den Kai, die Menschen und die Estella. Joanna fragte sich, was sie möglicherweise irgendwo in dem drei Millionen Quadratmeilen großen Land finden würde. Sie dachte an eine geheimnisvolle junge Schwarze, von der ihre Mutter erzählt hatte, weil sie öfter in ihren Träumen aufgetaucht war, dachte auch an die Großeltern, die vor mehr als vierzig Jahren auf diesen Kontinent gekommen waren. Joanna dachte an Träume und Alpträume und daran, welche Bedeutung sie haben mochten. Und sie dachte daran, daß sie an den Ort zurückkehren würde, wo alles seinen Anfang genommen hatte, wo auch die bruchstückhaften Erinnerungen der Mutter ihren Anfang nahmen. Dort hatte etwas begonnen, das ein Ende finden mußte.
Schließlich beschäftigte sich Joanna mit dem Mann neben ihr und dem kleinen verletzten Jungen. Diese Menschen waren unvermutet in ihr Leben getreten. Und plötzlich überkam sie Staunen und das Gefühl einer unbestimmten Angst.
Kapitel Zwei
1
Pauline Downs konnte ihre Hochzeitsnacht kaum erwarten. Während die Näherin die letzten Nadeln an dem eleganten Peignoir befestigte, drehte sich Pauline hierhin und dorthin und bewunderte sich in dem hohen Spiegel. Sie konnte kaum ihre Erregung unterdrücken.
Wenn Hugh mich darin sieht!
Es war der allerletzte Schrei – das heißt, es waren nur die Wochen vergangen, die Schnittmuster und Stoff für den Transport von Paris nach Melbourne gebraucht hatten. Der Peignoir aus blassem, pfirsichgelbem Satin war mit Valenciennespitze besetzt und hatte die winzigen Knöpfe, die nur das Haus Worth produzieren konnte. Der schimmernde Stoff umspielte Paulines schlanken Leib, betonte die vollen Brüste und die glatte Hüfte. Er umspielte die Füße fast wie eine Schleppe und ließ die große, schlanke Pauline noch größer wirken. Viele Wochen hatte sie gebraucht, um den richtigen Schnitt für diesen Peignoir zu finden, den sie in ihrer ersten Nacht mit Hugh Westbrook tragen wollte. Jetzt war er fertig, und Pauline wünschte sich nichts sehnlicher, als daß auch jene Nacht gekommen sei.
Der Peignoir war nur ein Teil der riesigen Ausstattung, die sie für ihre Flitterwochen vorbereitete. In der Suite in Lismore, ihrem Haus im westlichen Distrikt, türmten sich die Stoffballen, Modezeitschriften, Schnittmuster und Roben in verschiedenen Stadien der Fertigstellung. Es waren alles keine gewöhnlichen Kleider. Pauline hielt sich nicht für eine gewöhnliche Frau. Sie würde sicherstellen, daß ihre Brautausstattung nach der allerletzten Mode war, auch wenn sie auf der anderen Seite der Welt in einer Kolonie lebte, die üblicherweise ein paar Jahre hinter der europäischen Mode herhinkte.
Wunderbar, dachte Pauline, als sie einen Blick auf die Kleider warf, die sie als Mrs. Hugh Westbrook tragen würde. Mit den beschwerlichen alten Krinolinen war es endlich vorbei. Aus Europa kam eine völlig neue Mode, und Pauline konnte es nicht erwarten, diese radikal neue Erfindung vorzuführen, die man Tournüre nannte, und die gewagten, hinten gerafften Röcke, die den Saum einige Zentimeter vom Boden hoben. Und erst die Stoffe! Blaue Seide und zimtfarbener Satin mit schwarzem oder goldenem Samt gefaßt und zur Betonung von Hals und Händen mit weißer Spitze besetzt. Ihr platinblondes Haar und die blauen Augen konnten nicht vollkommener dazu harmonieren. Mode gehörte zu Paulines Leidenschaften. Wenn sie sich nach der neuesten kleidete, half ihr das, zu vergessen, daß sie nicht in London war, sondern in einer Kolonialprovinz, die zu Ehren der englischen Königin den Namen Victoria trug.
Pauline gehörte zu Victorias feiner ländlicher Gesellschaft. Sie war auf einer der ältesten und größten Schaffarmen der Kolonie geboren und aufgewachsen. Sie kannte in ihrem Leben nur Luxus. Ihr Vater nannte sie ›meine Prinzessin‹, und sein Sohn Frank mußte ihm versprechen, daß er seiner Schwester auch nach dem Tod des alten Downs ein Leben in Reichtum und Sorglosigkeit ermöglichen werde. Jetzt lebte sie, umsorgt von vielen Dienstboten, mit ihrem Bruder Frank in dem zweistöckigen Herrenhaus der fünfundzwanzigtausend Morgen Land umfassenden Farm im westlichen Distrikt. Paulines Leben kreiste um Fuchsjagden und Wochenendgesellschaften, um festliche Bälle und gesellschaftliche Ereignisse und unterschied sich darin wenig vom Leben des reichen Landadels in England. Frank und seine Schwester gaben in dieser Schicht den Ton an und setzten die Maßstäbe, an denen die anderen sich orientierten. Pauline vertrat den Standpunkt, auch wenn man in einer Kolonie lebe – oder vielleicht gerade deshalb! –, dürfe man unter keinen Umständen ›verwildern‹.
Nur in einem Punkt folgte Pauline nicht der Mode ihrer Zeit: Sie war mit vierundzwanzig noch nicht verheiratet.
Natürlich hatten sich ihr immer wieder Gelegenheiten zur Ehe geboten. Viele Verehrer hatten sich große Hoffnungen gemacht. Aber meist waren es rauhe Männer, die es im Busch zu Reichtum gebracht hatten und in das Viehzuchtgebiet gekommen waren, um in ihren prächtigen Häusern die großen Herren zu spielen. Das viele Geld hatten ihnen die Schafe eingebracht oder Goldfunde, und einige waren sogar reicher als ihr Bruder. Aber Pauline fand, daß diese Männer keine Manieren und keine Erziehung besaßen. Sie spielten, tranken aus der Flasche und benahmen sich unerträglich vulgär. Sie hatten keine Achtung vor Rang und Namen. Noch schlimmer war, ihnen fehlte der Ehrgeiz, ihr Benehmen zu ändern, denn sie sahen keinen Grund dazu. Hugh Westbrook war anders. Auch er kam aus dem Busch. Er hatte sich als Goldgräber ein kleines Vermögen erworben und gehörte zu den Viehzüchtern, die mit ihren Leuten zur Arbeit hinausritten und selbst die Pfähle für die Zäune in den Boden schlugen. Aber in vieler Hinsicht unterschied er sich von den Männern, die sie kannte. Etwas in Hughs Wesen hatte Pauline schon bei der ersten Begegnung fasziniert. Das war bereits vor zehn Jahren gewesen, als er Merinda kaufte. Damals war Pauline erst vierzehn und Hugh zwanzig.
Sie hatte sich nicht wegen seines guten Aussehens in ihn verliebt. Sie glaubte, daß er mehr besaß als nur Muskeln und ein anziehendes Lächeln. Vor allem war er ehrlich, und das konnte man von den wenigsten Männern im Busch sagen. Außerdem spürte sie in ihm eine besondere Kraft – eine stille Kraft –, die nicht von der Art war, wie sie im prahlerischen und großtuerischen Gehabe der anderen Männer zum Ausdruck kam, die miteinander konkurrierten. Pauline fand, Hugh strahle eine tief wurzelnde, verläßliche und unerschütterliche Kraft aus. Deshalb sah sie weniger den Mann von heute in ihm, sondern den Mann, der er in der Zukunft sein würde.
Als Hugh Merinda gekauft hatte, gab es dort nur eine Rindenhütte und ein paar kranke Schafe. Mit seinen beiden Händen und einem starken Willen war Hugh allein darangegangen, Merinda in mühsamer Arbeit zu einer Farm zu machen, auf die er jetzt stolz sein konnte. Damals hatte Paulines Bruder Frank geglaubt, der junge Queensländer würde Merinda wieder verkaufen, noch bevor das erste Jahr um war. Aber Hugh bewies Frank und allen anderen Viehzüchtern, daß sie sich in ihm getäuscht hatten. Und jetzt, nach zehn Jahren, bestand kein Zweifel daran, daß Hugh Westbrook noch viel mehr erreichen würde.
Wir werden beide zusammen noch mehr erreichen, mein Liebster, dachte Pauline. Wenn andere Hugh sahen, fielen ihnen vielleicht nur die schwieligen Hände und die staubigen Stiefel auf, aber wenn Pauline ihn ansah, dann stand vor ihr der kultivierte Gentleman, der er eines Tages sein würde – denn dazu würde sie ihn machen. Dafür liebte sie ihn.
»Das reicht für heute«, sagte Pauline zu der Näherin. »Gönnen Sie sich eine Pause und trinken Sie eine Tasse Tee. Ach, und würden Sie bitte Elsie sagen, sie soll mir ein Bad einlassen?«
Pauline hatte ihre Hoffnungen auf Hugh Westbrook lange Zeit für sich behalten. Die Gesellschaft im westlichen Distrikt hatte erwartet, sie werde jemanden aus ihrer Klasse heiraten – einen reichen, angesehenen Mann –, aber Pauline hatte sich Hugh in den Kopf gesetzt. Sie sorgte dafür, daß sie ihm bei jeder erdenklichen Möglichkeit begegnete: auf der jährlichen Landwirtschaftsausstellung, bei Tanzfesten und Einladungen auf den umliegenden Farmen, beim Pferderennen und bei ihr zu Hause, wenn Hugh mit ihrem Bruder Frank Probleme der Schafzucht besprach. Und jedesmal, wenn sie ihn sah, wuchs ihr Verlangen. Manchmal erschien er unerwartet auf seinem Pferd. Wenn er dann lächelte und ihr zuwinkte, schlug ihr Herz schneller. Danach konnte Pauline abends nicht einschlafen. Sie stellte sich immer wieder vor, wie es wohl sein mochte, seine Frau zu sein und mit ihm in einem Bett zu liegen …
An den genauen Zeitpunkt, an dem sie wußte, daß sie ihn heiraten würde, konnte sie sich nicht mehr erinnern. Aber ihre vorsichtige und, fein gesponnene Verführung dauerte beinahe drei Jahre. Sie zog Hugh in einen Flirt, der bei ihm den Eindruck erweckte, er habe sie dazu verführt. Man mußte Pauline nicht sagen, wie ihr Haar im Mondlicht wirkte. Deshalb machte sie in mondhellen Nächten Spaziergänge mit Hugh im Garten. Sie wußte auch, wie gut sie aussah, wenn sie mit dem Bogen am Schießstand stand. Deshalb sorgte sie für Hughs Anwesenheit bei den Wettbewerben, an denen sie teilnahm. Als sie von seiner Vorliebe für Dundee-Kuchen und Eiercurry erfuhr, fand sie bald ebenfalls großen Geschmack daran. Als Hugh erzählte, sein Lieblingsdichter sei Byron, las Pauline tagelang Byrons Werke.
Schließlich begann Hugh, über die Ehe zu reden. Er wurde dreißig, und immer öfter hörte sie bei ihm den Satz: »Wenn ich verheiratet bin«, oder »Wenn ich Kinder habe«. Da wußte Pauline, die Zeit war gekommen. Doch andere Frauen machten sich ebenfalls Hoffnungen. Pauline zweifelte nicht mehr daran, daß er viel für sie empfand, aber eine eindeutige Äußerung hatte sie von ihm noch nicht gehört. Und so kam ihr großes Geheimnis in die Welt.
Die gesamte feine Gesellschaft wäre schockiert gewesen, wenn bekannt geworden wäre, was sie getan hatte. Sie hatte Hugh einen Antrag gemacht. Ihre Freundinnen hätten erklärt, ein solches Vorgehen erniedrige eine Dame, und kein Mann sei es wert, sich so schamlos ›wegzuwerfen‹. Pauline hielt es für ein sehr pragmatisches Vorgehen. Die Zeit verging. Mehrere Frauen im Distrikt luden Hugh zum Tee oder zu Ausritten ein und schenkten ihm bei gesellschaftlichen Veranstaltungen ihre Aufmerksamkeit. Pauline sah sich deshalb eines Tages aus ganz praktischen Erwägungen dazu veranlaßt, Hugh zu einem Picknick am Fluß einzuladen – an diesem Tag lag Regen in der Luft. Sie ritten zusammen aus und aßen am Fluß ein köstliches Eiercurry und Dundee-Kuchen. Sie sprachen über Schafe, über die Kolonialpolitik, über den aufsehenerregenden Darwin und den neuen Roman von Jules Verne. Und dann öffnete der Himmel seine Schleusen, als habe Pauline es so inszeniert. Sie und Hugh mußten unter den nahen Bäumen Schutz suchen. Aber natürlich wurden sie naß, stolperten auf dem weichen Boden, mußten sich aneinander festhalten, weil sie so ausgelassen lachten. Und dann sagte Pauline: »Weißt du, Hugh, ich finde, wir sollten heiraten.« Er hatte sie daraufhin so fest und leidenschaftlich geküßt, daß Pauline später fand, sein flammender Kuß habe die Blitze in Schatten gestellt, die um sie herum zuckten. Er hatte sie nur einmal geküßt, aber das reichte. Hugh hatte gesagt: »Heirate mich«, und Pauline hatte gewonnen.
Doch nach der offiziellen Verlobung stellte Pauline fest, Hugh auf einen Hochzeitstermin festzulegen, war ebenso schwer, wie einen Wirbelwind festzuhalten. Seine Farm stand immer an erster Stelle: Die Hochzeit konnte nicht im Winter sein, wegen der notwendigen Ausbesserungsarbeiten, hatte er gesagt, auch nicht im Frühling, weil dann die Lämmer geworfen und die Schafe geschoren wurden. Im Sommer hatte er alle Hände voll zu tun mit dem Desinfizieren der Herden und der Zucht, und im Herbst …
Aber Pauline wies ihn sehr ruhig und sachlich darauf hin, daß der Herbst auf jeder Farm die ruhigste Jahreszeit sei, und so hatten sie sich auf einen Hochzeitstermin im März geeinigt.
Alles verlief planmäßig, bis der Brief von den südaustralischen Behörden eintraf, die Hugh von Adam Westbrooks Schicksal in Kenntnis setzten.
Plötzlich entdeckte Pauline einen dunklen Fleck in ihrer Vision der gemeinsamen Zukunft. Sie und Hugh würden nicht nur für einander dasein, sich nicht leidenschaftlich, spontan und hemmungslos lieben können. Ihr Eheleben begann bereits mit der Last eines Kindes – dem Kind einer anderen Frau. Pauline wollte nicht daran denken, was Hugh mit nach Hause bringen mochte: einen wilden Jungen aus dem Busch. »Du bist nicht verantwortlich für dieses Kind«, hatte sie gesagt, ihre Worte jedoch sofort bedauert, denn Hughs Augen blitzten vor Zorn. Pauline hatte ihm daraufhin schnell versichert, sie werde den Jungen gerne aufnehmen, aber in ihrem Herzen fürchtete sie das Kind.
Sie war noch nicht bereit, Mutter zu sein. Sie wollte sich zuerst daran gewöhnen, eine Ehefrau zu sein. Sie wußte, daß zur Mutterschaft bestimmte Opfer gehörten und ein Leben, das meist bedeutete, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Pauline konnte sich nicht vorstellen, wie das Leben einer Mutter aussah. Ihre Mutter war vor vielen Jahren während einer Grippeepidemie gestorben, die auch ihre beiden Schwestern und der jüngere Bruder nicht überlebten. Pauline war mit ihrem älteren Bruder Frank unter der Obhut des Vaters und einer Reihe von Gouvernanten aufgewachsen. Sie wußte nicht, wie eine Beziehung zwischen Müttern und Kindern aussah, und die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Sie wünschte sich eine Tochter. Sie malte sich oft aus, wie es sein würde, ihrer Tochter Reiten und Jagen beizubringen und vor allen Dingen, was es bedeutete, etwas Besonderes zu sein. Pauline glaubte, es erfülle eine Mutter mit großer Befriedigung, eine Tochter zu formen und zu erziehen. Aber die Gefühle zwischen Mutter und Tochter – Liebe, Ergebenheit und Pflichtbewußtsein – schien sie nie ganz verstehen zu können.
»Ihr Bad ist eingelassen«, sagte Paulines Zofe und unterbrach damit ihre Gedanken.
Nach dem ermüdenden, wenn auch aufregenden Tage der Beschäftigung mit Schnittmustern und Stoffen, den Anproben, bei denen sie stillstehen mußte, während die beiden Näherinnen mit Nadeln und Scheren wirkten, freute sich Pauline auf ein langes Bad, das sie in vollen Zügen genießen wollte. Sie war eine sinnliche Frau. Sie ließ sich von den glatten Perlen an ihrem Hals küssen, von der Federboa die nackten Schultern streicheln und überließ sich dem schmeichelnden Luxus von zartem Satin und weichen Spitzennachthemden. Stoffe bereiteten ihr Vergnügen. Selbst die Härte der in Silber und Gold gefaßten Edelsteine bereitete ihren Fingerspitzen Genuß. Frank war reich genug, seine Schwester mit französischem Champagner zu verwöhnen, und auf ihren Tisch kamen nur die erlesensten Gerichte. Pauline saß stundenlang am Flügel und überließ sich dem Genie eines Chopin und Mozart. Sie ritt tollkühn während der Jagden, nahm die gefährlichsten Hindernisse und sprang über die breitesten Gräben. Sie glühte vor Begeisterung bei dem Gefühl, das Pferd zu beherrschen, durch die Luft zu schweben und das Schicksal herauszufordern. Es gab nicht wenig, das Pauline Downs mit ihren vier- undzwanzig Jahren nicht ausgekostet hatte. Es fehlte ihr nur noch das eine – der Gipfel aller Freuden: Sie hatte noch nicht mit einem Mann geschlafen.
Während Pauline sich wohlig im heißen Wasser rekelte und langsam den Schwamm über den Körper gleiten ließ, warf sie einen Blick in den dunstigen Spiegel und sah, daß Elsie, die Zofe, ihr frische Unterwäsche zurechtlegte. Elsie war eine junge hübsche Engländerin, und Pauline wußte, daß sie mit einem der Stallburschen von Lismore ging. Sie sah der Zofe nach, die das Badezimmer verließ, und fragte sich, was Elsie wohl mit ihrem jungen Liebhaber tat, wenn sie alleine war.
Und plötzlich durchzuckte sie Neid.
Sie betrachtete ihr Bild in dem großen Spiegel. Sie sah das, wie sie wußte, schöne Gesicht mit den ebenmäßigen Zügen, das von dichten blonden Locken umrahmt wurde, und dachte: Pauline Downs, die Tochter einer der ältesten und reichsten Familien von Victoria, beneidet ihre Zofe!
Aber, so mußte sie sich eingestehen, es ließ sich nicht leugnen!
Schlafen sie miteinander? überlegte sie. Lieben sie sich, Elsie und ihr hübscher junger Verehrer? Umarmen sie sich jedesmal, wenn sie sich treffen? Laufen sie dann zu einem versteckten Platz, wo sie sich küssen, streicheln und die Hitze, Härte und Weichheit ihrer Körper spüren?
Pauline schloß die Augen und sank tiefer in das heiße Wasser. Sie ließ die Hände über die Schenkel gleiten und spürte wieder das Sehnen. Dieses Sehnen wurde allmählich zu einem körperlichen Schmerz. Es war ein Verlangen, eine Begierde und das unstillbare Bedürfnis, in Hugh Westbrooks Armen zu liegen. Ihre Gedanken kreisten um die Hochzeitsnacht. Sie rief sich den einzigen Kuß an jenem regnerischen Nachmittag am Fluß ins Gedächtnis und spürte wieder seinen harten Körper, der sich an sie drückte und das Versprechen, das von ihm für zukünftige Liebesnächte ausging.
Bald ist es soweit, dachte Pauline. Nur noch sechs Monate, und ich liege mit Hugh im Bett. Dann werde ich endlich die Ekstase erleben, von der ich schon so lange träume …
Die Uhr im Schlafzimmer schlug die volle Stunde, und Pauline wurde plötzlich bewußt, daß es bereits spät war. Frank mußte inzwischen von Melbourne zurück sein und Nachrichten haben, die für sie von größter Bedeutung waren. Hat er Erfolg gehabt? fragte sie sich.
Pauline war fest entschlossen, ihre Hochzeit zu einem Fest zu machen, wie es der westliche Distrikt noch nicht erlebt hatte. Deshalb mußte Frank, dem die Melbourne Times gehörte, seinen Einfluß geltend machen und eine weltberühmte Opernsängerin dafür gewinnen, auf ihrer Hochzeit zu singen. Pauline wollte sich nicht mit einer australischen Sängerin begnügen. Mochte die Stimme auch noch so makellos sein, eine Sängerin aus der Kolonie würde die Hochzeit nur zu einem kolonialen Ereignis machen. Aber im Februar sollte die Royal Opera Company im Rahmen einer Tournee in Melbourne sein, und Dame Lydia Meacham, eine umjubelte englische Diva, die von Covent Garden bis Petersburg für ihre klare und bezaubernde Stimme bekannt war, würde auch dabeisein. Pauline hatte Frank wissen lassen, es sei ihr Traum, daß Dame Lydia auf ihrer Hochzeit singe.
Frank konnte sich nicht so recht mit der Idee anfreunden. Außerdem hielt er nicht allzuviel von der Royal Opera Company. »Sie behandeln uns, als seien wir ein unerwünschtes Stiefkind«, erklärte Paulines Bruder immer verärgert, wenn die Opera Company zu einer Tournee in die australischen Kolonien aufbrach. »Sie erscheinen hier mit ihrem vornehmen Getue und ihrer hochgestochenen Art und benehmen sich, als würden sie uns eine große Gunst erweisen.«
Aber das stimmt doch auch, dachte Pauline, denn schließlich sind die Kolonien nun einmal so weit von England entfernt …
Sie erinnerte sich an ihre Erlebnisse und Gefühle vor vielen Jahren bei ihrem ersten Ball in England. Es war nahezu eine Katastrophe gewesen! Pauline war sich hoffnungslos altmodisch vorgekommen, und die anderen Mädchen an der London Academy hatten gestaunt, daß sie in Kleidern von vorgestern auf dem Ball erschien. Als sie ihre Verwirrung und Verlegenheit bemerkten, trösteten sie Pauline mit den Worten, es sei natürlich verständlich, denn sie komme schließlich von so weit her. Man hatte sie mit dieser herablassenden Nachsicht behandelt, die Pauline schließlich als unvermeidlich hinnahm, wenn jemand erfuhr, daß sie aus Australien kam. »Sie kommen eben aus den Kolonien«, sagten die Leute über die Geschwister, und man schien weder sie noch das Land, in dem sie lebten, ernst zu nehmen. Die jungen Mädchen wollten nicht absichtlich grausam sein. Sie brachten nur ganz offen ihre Geringschätzung für jemanden zum Ausdruck, der aus einem so fernen Land kam, aus Kolonien, mit denen sich die Engländer wenig beschäftigten – und wenn sie es taten, dann erschienen ihnen die Menschen von dort rückständig und provinziell.
Damals hatte man Pauline zu ihrem gesellschaftlichen ›Debüt‹ nach London geschickt. Die Töchter der reichen Familien in den Kolonien schickte man zur Ausbildung immer ›nach Hause‹, und zu Hause war England. Paulines Mutter, die auf einer Farm in Neusüdwales aufgewachsen war, hatte in ihrem entsprechenden Alter die lange Reise nach England ebenfalls unternommen. Und Pauline wollte diese Tradition auch mit ihren Töchtern fortsetzen. Sie sollten in England ›debütieren‹, denn das gehörte sich so.
Pauline stieg aus der Wanne und hüllte sich in das Badetuch, das ihr Elsie reichte. Frank muß jeden Augenblick eintreffen, dachte sie ungeduldig, denn sie wollte unbedingt von ihm die ersehnte Nachricht hören. Hatte er Dame Lydia für die Hochzeit engagieren können? Alles sollte perfekt sein: die Trauung, das Hochzeitsfest, die Flitterwochen – ihr Leben.
Pauline lächelte, als ihre Gedanken zu Hugh und der Hochzeitsnacht zurückkehrten. Sie hoffte, es werde ihr gelingen, sie zu einer Nacht der Überraschungen zu machen – für sie beide.
2
»Frank!« rief John Reed und ging zu seinem Freund hinüber, der in Finnegans Pub an der Bar stand. »Seit wann bist du wieder zurück?«