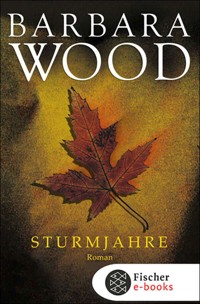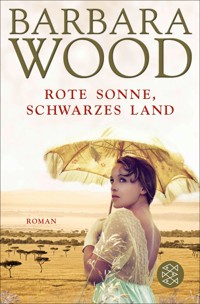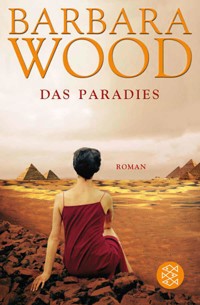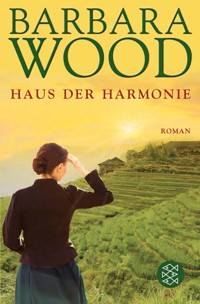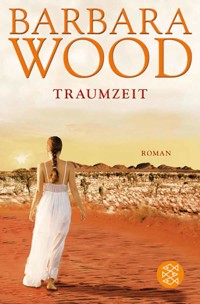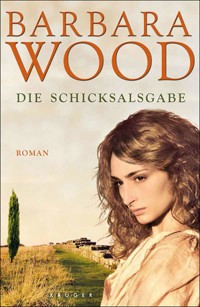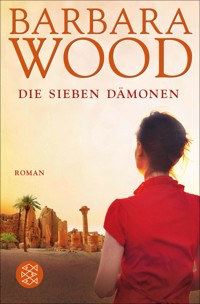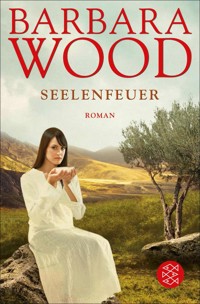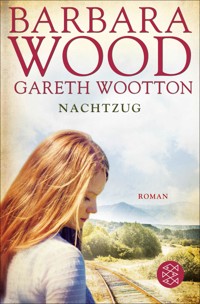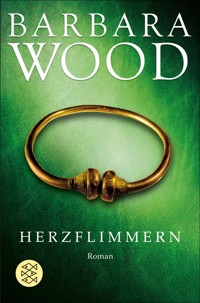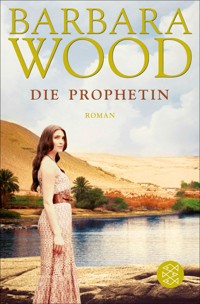8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lesegenuss von Bestsellerautorin Barbara Wood: Ein Erdrutsch in den Hügeln von Los Angeles legt eine Höhle mit uralten Wandmalereien mystischer Sonnenmotive frei. Die junge Archäologin Erica Tyler entdeckt dort die Mumie einer Indianerin. Aber sie muss um diese Ausgrabung kämpfen: gegen die Grundstückseigentümer der Gegend, gegen Kunsträuber – und vor allem gegen ihren Widersacher Jared Black, der die Rechte der Indianer vertritt. Als ein Anschlag auf Erica verübt wird, ist ihr Retter ausgerechnet Jared. Kann sie ihm vertrauen? »Eine Saga voller Spannung und Sinnlichkeit.« Cosmopolitan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Barbara Wood
Himmelsfeuer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Susanne Dickerhof-Kranz und Veronika Cordes
Fischer e-books
Für meinen Mann, George, in Liebe
Kapitel 1
Das Lenkrad fest umklammert, jagte Erica den Geländewagen über den Feldweg, wich Buckeln aus, rumpelte durch Schlaglöcher. Neben ihr saß, aschfahl und verschreckt, ihr Assistent Luke, Mitte zwanzig, der nach bestandenem Examen jetzt an seiner Dissertation arbeitete. Luke hatte das lange blonde Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden und trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck Archäologen stehen auf ältere Semester.
»Soll wüst aussehen, Dr. Tyler«, sagte er jetzt, als Erica die gewundene Zufahrtsstraße hinaufpreschte. »Angeblich ist der Swimmingpool in der Versenkung verschwunden, einfach so.« Er schnippte mit den Fingern. »In den Nachrichten hieß es, die Doline zieht sich über die gesamte Länge der Mesa, das heißt, sie verläuft unterhalb der Villen von Filmstars, auch der von diesem Rocksänger, der im Fernsehen war, und von dem Baseballspieler, der letztes Jahr sämtliche Runs für sich verbucht hat, und von einem berühmten Schönheitschirurgen. Unter ihren Häusern. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet.«
Erica war nicht sicher, was das bedeutete. Ihre Gedanken drehten sich nur um eins: die erstaunliche Entdeckung, die damit einherging.
Zur Zeit des Unglücks hatte sie an einem staatlichen Projekt oben im Norden gearbeitet. Das Erdbeben vor zwei Tagen, mit einer Stärke von 7.4, war bis San Luis Obispo im Norden und bis San Diego im Süden zu spüren gewesen und hatte im südlichen Kalifornien Millionen Einwohner aus dem Schlaf gerissen. Es war das schwerste Beben seit Menschengedenken und dem Vernehmen nach der Auslöser dafür, dass tags darauf ein Swimmingpool von hundert Fuß Länge, mit Sprungbrett, Rutschbahn und allem Drum und Dran, wie vom Erdboden verschluckt worden war.
Etwas Erstaunliches hatte sich fast unmittelbar darauf ereignet: Als der Pool versank, war Erdreich nachgerutscht und hatte menschliche Knochen sowie die Öffnung zu einer bis dahin unbekannten Höhle freigelegt.
»Das könnte der Fund des Jahrhunderts sein!« Luke wandte den Blick kurz von der Straße und sah seine Chefin an. Da es noch dunkel und die Bergstraße nicht beleuchtet war, hatte Erica die Armaturenbeleuchtung des Wagens angeknipst. Das Licht fiel auf ihr schulterlanges, leicht gelocktes kastanienbraunes Haar und die vom jahrelangen Aufenthalt in der Sonne gebräunte Haut. Dr. Erica Tyler, mit der Luke seit sechs Monaten zusammenarbeitete, war Mitte dreißig, und obwohl er sie nicht unbedingt als Schönheit bezeichnet hätte, fand er sie doch auf andere, nicht unbedingt von Äußerlichkeiten bestimmte Weise reizvoll. »Eine tolle Chance für einen Archäologen, sich zu profilieren«, fügte er hinzu.
»Warum wohl haben wir gerade sämtliche Verkehrsregeln missachtet, um hier runterzubrettern?«, grinste sie ihn an und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Straße, rechtzeitig genug, um einem erschrockenen Eselhasen auszuweichen.
Sie erreichten das Plateau der Mesa, von wo aus man in der Ferne das Lichtermeer von Malibu sah. Das übrige Panorama, im Osten Los Angeles, im Süden der Pazifische Ozean, wurde von Bäumen, höheren Bergspitzen und den Villen von Millionären verstellt. Erica manövrierte den Jeep an herumstehenden Feuerwehrautos vorbei, an Einsatzwagen der Polizei, Lastern, Übertragungswagen und jeder Menge PKW, die entlang der von der Polizei mit gelbem Band markierten Absperrung parkten. Schaulustige saßen auf Kühlerhauben und Autodächern, um von dort aus das Geschehen zu verfolgen, Bier zu trinken und Betrachtungen über Katastrophen und deren Bedeutung anzustellen oder auch nur um eine Zeit lang das Spektakel zu genießen, ungeachtet der per Megaphon verbreiteten Warnungen, dass das Gelände gefährdet sei.
»In den zwanziger Jahren soll die gesamte Mesa der Schlupfwinkel von einer ausgeflippten Spiritistin gewesen sein«, sagte Luke, als der Wagen zum Stehen kam. »Die Leute kamen hier rauf, um mit Geistern zu sprechen.«
Erica erinnerte sich an Wochenschauen aus der Stummfilmära, in denen über Sister Sarah berichtet worden war, eine schillernde Persönlichkeit aus Los Angeles, die nicht nur für Hollywood-Größen wie Rudolph Valentino und Charlie Chaplin Séancen abgehalten hatte, sondern auch bei Massenveranstaltungen in Theatern und Auditorien aufgetreten war; als ihre Anhänger dann in die Hunderttausende gingen, war sie in die Berge gezogen und hatte hier in diesem Tal die Kirche der Geister gegründet.
»Wissen Sie, wie dieser Ort ursprünglich genannt wurde?«, fragte Luke und löste den Sicherheitsgurt. »Ich meine, bevor die Spiritisten ihn mit Beschlag belegten? Lange davor«, sagte er, wobei er mit lange davor gleichsam Pergamentrollen mit Wachssiegeln und Duelle im Morgengrauen heraufbeschwor. »Cañon de Fantasmas.« Theatralisch ließ er die verstaubten Worte auf der Zunge zergehen. »Tal der Geister. Klingt unheimlich!« Er schüttelte sich.
Erica lachte. »Luke, wenn Sie’s als Archäologe zu was bringen wollen, dürfen Sie sich nicht von Geistern ins Bockshorn jagen lassen.« Sie selbst hatte ständig mit Phantomen und Gespenstern, Geistern und Kobolden zu tun. Sie spukten in ihren Träumen herum und begleiteten ihre Ausgrabungen, und wenn sie ihr auch immer wieder entwischten, sie verwirrten, neckten und frustrierten, hatten sie sie doch niemals verschreckt.
Nachdem Erica aus dem Wagen gestiegen war und den Nachtwind auf ihrem Gesicht spürte, starrte sie regungslos auf das Schreckensszenario. Sie hatte bereits Augenzeugenberichte gehört, wie das Erdbeben den Boden unterhalb der umzäunten Gemeinde von Emerald Hills Estates, einer exklusiven Wohnanlage in den Bergen von Santa Monica, zum Schwanken gebracht hatte und welche Gefahr der Erdrutsch für die umstehenden Villen darstellte. Aber auf das, was sie jetzt sah, war sie nicht vorbereitet.
Obwohl der Himmel im Osten bereits heller wurde, wölbte sich noch immer hartnäckig die Nacht über Los Angeles, weshalb in Abständen Scheinwerfer um das Gelände herum aufgebaut worden waren, um eine Gegend, aus der sich protzige Villen unter einem milchigen Mond wie marmorne Tempel abhoben, in grelles Licht zu tauchen. Im Zentrum dieser unwirklichen Szene befand sich ein schwarzer Krater – der Teufelsschlund, der den Swimmingpool des Filmproduzenten Harmon Zimmerman verschlungen hatte. Hubschrauber knatterten darüber hinweg, warfen grelle Lichtkegel auf Sachverständige, die Gerätschaft in Stellung brachten, auf mit Bohrern und Karten bewaffnete Geologen, auf Männer in Schutzhelmen, die mit wärmenden Kaffeetassen in den Händen den Anbruch des Tages erwarteten, auf Polizisten, die bemüht waren, Bewohner zu evakuieren, die sich sträubten, ihr Haus zu verlassen.
Erica zückte ihren Ausweis, der sie als Anthropologin im Dienste des Staatlichen Archäologischen Instituts legitimierte, und wurde mit ihrem Assistenten durch die gelbe Absperrung gewunken. Sie eilten zum Krater, wo die Feuerwehr von Los Angeles dabei war, den Rand der Abbruchstelle zu begutachten. Erica sah sich suchend nach dem Zugang zu der Höhle um.
»Da drüben?« Lukes magerer Arm deutete auf die gegenüberliegende Seite des Kraters. In etwa fünfundzwanzig Meter Tiefe konnte Erica nicht viel mehr als eine vertikale Spalte in der Klippe ausmachen. »Sieht gefährlich aus, Dr. Tyler. Wollen Sie da etwa reingehen?«
»Wäre nicht die erste Höhle, die ich betrete.«
»Was zum Teufel haben Sie denn hier verloren?!«
Erica fuhr herum und sah einen hochgewachsenen Mann mit grauer Löwenmähne und finsterer Miene auf sich zustapfen: Sam Carter, Leiter der Abteilung Archäologie beim Amt für Denkmalschutz in Kalifornien, ein Mann mit farbenfrohen Hosenträgern und Stentorstimme. Und sichtlich alles andere als begeistert, sie hier zu sehen.
»Sie wissen, warum, Sam.« Erica strich sich das Haar aus dem Gesicht und sah auf das Chaos. Bewohner der bedrohten Häuser stritten sich mit der Polizei herum, beschwerten sich über die Zumutung, ihr Anwesen verlassen zu müssen. »Erzählen Sie mir von der Höhle. Waren Sie schon drin?«
Sam bemerkte zweierlei: dass in Ericas Augen ein inneres Fieber glühte und dass ihre Jacke schief geknöpft war. Sie hatte offenbar alles stehen und liegen lassen und war wie von Furien gehetzt von Santa Barbara herübergekommen. »Noch nicht«, sagte er. »Ein Geologe und ein paar Sachverständige überprüfen gerade die Beschaffenheit der Schichtung. Sobald sie grünes Licht geben, werd ich mal einen Blick reinwerfen.«
Er rieb sich das Kinn. Erica loszuwerden würde nicht leicht sein. Wenn diese Frau sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war sie nicht abzuschütteln. »Was ist mit dem Gaviota-Projekt? Ich nehme doch an, Sie haben es in zuverlässigen Händen zurückgelassen?«
Erica hörte gar nicht zu. Sie starrte auf das gähnende Loch am Hang und stellte sich vor, wie jetzt klobige Stiefel auf der empfindlichen ökologischen Struktur der Höhle herumtrampelten, betete, dass dabei nicht wertvolle historische Hinweise unabsichtlich zerstört wurden. Archäologische Funde in diesem Bergland waren kümmerlich genug, ungeachtet der Tatsache, dass es seit zehntausend Jahren besiedelt war. Die wenigen Höhlen, die man entdeckt hatte, erwiesen sich als herzlich unergiebig, weil man zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts diesem unwegsamen Gebirge mit Bulldozer und Dynamit zu Leibe gerückt war, zugunsten von Straßen, Brücken und dem Fortschritt schlechthin. Begräbnisstätten waren umgepflügt, Umfriedungen von Dörfern eingeebnet, alle Spuren menschlicher Besiedlung zerstört worden.
»Erica?«, versuchte es Sam abermals.
»Ich muss da rein«, sagte sie.
Er wusste, dass sie die Höhle meinte. »Erica, Sie sollten gar nicht hier sein.«
»Übertragen Sie mir den Job, Sam. Sie werden doch hier graben. Zumal, wie es in den Nachrichten hieß, Knochen gefunden wurden.«
»Erica …«
»Bitte.«
Unwillig machte Sam kehrt und stapfte zurück durch Zimmermans verwüsteten Garten und weiter bis zum Ende der Straße, wo man eine provisorische Einsatzzentrale eingerichtet hatte. Leute hielten Clipboards und sprachen hastig in ihr Handy, drängten sich um metallene Klapptische und Stühle; Sprechfunkgeräte und Überwachungskameras waren aufgestellt worden, dazu ein schwarzes Brett für Nachrichten. Ein unweit geparkter Imbisswagen wurde von unterschiedlich Uniformierten belagert, deren Dienstabzeichen sie als Mitarbeiter der südkalifornischen Gaswerke auswiesen, der Wasser- und Elektrizitätswerke, der Polizei von Los Angeles, des Bezirks-Einsatzkommandos. Sogar von der Humanitären Gesellschaft war jemand da und versuchte, verirrte Tiere aus der evakuierten Zone aufzuspüren.
Erica schloss zu ihrem Boss auf. »Was ist eigentlich passiert, Sam? Was führt dazu, dass ein halbes Grundstück plötzlich im Erdboden versinkt?«
»Um das herauszufinden, arbeiten Ingenieure aus der Gegend und staatliche Geologen rund um die Uhr. Die Männer da drüben« – er wies die Straße entlang, dorthin, wo man gerade unter grellem Scheinwerferlicht Bohrgerät einsatzbereit machte – »werden Bodenproben entnehmen, um den Untergrund der Wohnanlage genau zu analysieren.« Jetzt fuhr Sams kräftige Hand über die topographischen Karten und geologischen Gutachten, die auf den Tischen ausgebreitet und an den Ecken mit Steinen beschwert waren. »Diese Unterlagen kamen vor ein paar Stunden von der Stadtverwaltung. Das hier ist ein geologisches Gutachten von 1908. Und hier eins von 1956, als das Areal für eine Bebauung ins Auge gefasst, das Vorhaben dann aber nicht realisiert wurde.«
Erica studierte abwechselnd beide Karten. »Sie stimmen nicht überein.«
»Offenbar hat der jetzige Bauherr nicht überall auf dem Gelände Bodenproben durchführen lassen – was auch nicht Auflage war. Die Tests, die vorgenommen wurden, weisen fest gefügten Untergrund und gewachsenen Fels aus. Aber, wie sich jetzt herausgestellt hat, wurde nur der nördliche und südliche Rand der Mesa geprüft, das heißt die beiden Bergketten, die den Canyon umschließen. Erinnern Sie sich an Sister Sarah aus den zwanziger Jahren? Hier war ihr religiöses Refugium oder was immer das damals war, und es sieht ganz danach aus, als hätte sie den Canyon aufschütten lassen, ohne Erlaubnis dafür einzuholen oder die Behörden auch nur in Kenntnis zu setzen. An die üblichen Verdichtungsmaßnahmen hat natürlich kein Mensch gedacht, und die Aufschüttung dürfte weitgehend mit organischen Stoffen erfolgt sein – Holz, Pflanzen, Kompost –, die nach und nach verrottet und zusammengesunken sind.« Sam starrte mit müden Augen die Straße hinunter, wo inmitten gepflegter Rasenflächen Springbrunnen und exotische Bäume standen. »Die Leute hier haben auf einer Zeitbombe gesessen. Würde mich nicht wundern, wenn die ganze Gegend über kurz oder lang in sich zusammenstürzen würde.«
Während er sprach, ließ er Erica nicht aus den Augen, die die Hände in die Hüften gestemmt hatte und wie ein Sprinter, der kaum erwarten kann, dass das Rennen beginnt, von einem Fuß auf den anderen trat. So sah sie immer aus, wenn sie hinter etwas her war. Erica Tyler war eine der engagiertesten Wissenschaftlerinnen, die er kannte, auch wenn ihr die eigene Begeisterung gelegentlich zum Verhängnis wurde. »Ich weiß, weshalb Sie hier sind, Erica«, sagte er müde, »aber ich kann Ihnen den Job nicht geben.«
Sie wirbelte zu ihm herum, mit hochroten Wangen. »Sam, Sie haben mich verdammt noch mal lange genug Abalonemuscheln zählen lassen!«
Er wollte ja gar nicht abstreiten, dass Ericas Fähigkeiten und Wissen bei der Erforschung von Molluskenlagern völlig vergeudet waren. Aber nach dem Debakel mit dem Schiffswrack im vergangenen Jahr hatte er es für nötig gehalten, dass sie einige Zeit mal ein paar Warteschleifen in einem untergeordneten Job einlegte. Deshalb hatte sie das letzte halbe Jahr einen unlängst entdeckten Erdhügel erforscht, der Indianern als Zufluchtsort gedient hatte, die vor viertausend Jahren nördlich von Santa Barbara gelebt hatten. Ericas Arbeit bestand darin, die Tausende von Abalonemuscheln, die dort gefunden wurden, zu sortieren, zu klassifizieren und ihr Alter zu bestimmen.
»Sam«, beschwor sie ihn und griff nach seinem Arm. »Ich brauche diesen Job. Es geht um meine Karriere. Ich muss die Scharte mit Chadwick auswetzen …«
»Erica, die Chadwick-Panne ist genau der Grund, weshalb ich Ihnen den Job nicht übertragen kann. Es mangelt Ihnen an Disziplin. Sie sind impulsiv, lassen den nötigen wissenschaftlichen Abstand und die Objektivität außer Acht.«
»Ich habe meine Lektion gelernt, Sam.« Erica war zum Heulen zumute. Das »Chadwick-Fiasko« hatte man im Kollegenkreis Erica Tylers Schiffbruch genannt. Sollte sie für den Rest des Lebens dafür büßen? »Ich werde besonders sorgfältig sein.«
Er runzelte die Stirn. »Erica, Sie haben mein Institut zu einer Lachnummer gemacht.«
»Und mich tausendmal dafür entschuldigt! Sam, seien Sie doch einsichtig. Sie wissen, dass ich alles an Felsmalerei auf dieser Seite des Rio Grande erforscht habe. Niemand ist besser qualifiziert. Als ich im Fernsehen die Höhlenmalerei hier sah, wusste ich: Das ist genau mein Job.«
Sam fuhr sich durch die dichte Mähne. Typisch Erica, von jetzt auf gleich alles stehen und liegen zu lassen. Hatte sie sich überhaupt die Mühe gemacht, einen anderen mit dem Gaviota-Projekt zu betrauen?
»Kommen Sie, Sam. Lassen Sie mich bei einem Projekt mitmachen, für das ich geboren bin.«
Er blickte in ihre Bernsteinaugen und sah Verzweiflung darin. Er wusste nicht, wie es war, beruflich diskreditiert, von Kollegen verhöhnt zu werden, und konnte nur ahnen, wie sehr die vergangenen zwölf Monate Erica zugesetzt hatten. »Ich sag Ihnen was«, meinte er. »Ein Mitglied der Suchmannschaft hat sich erboten, nochmals in die Höhle reinzugehen und Fotos zu machen. Sie dürften in Kürze vorliegen. Sie können sie sich anschauen, mal sehen, wie Sie die Piktogramme deuten.«
»Eine Suchmannschaft?«
»Nachdem der Pool abgerutscht war, stellte sich heraus, dass Zimmermans Tochter vermisst wurde. Deshalb ordnete der Sheriff die Suche nach ihr in diesen Erdmassen an. Und so kam’s, dass man auf die Höhlenmalerei stieß.«
»Und das Mädchen?«
»Tauchte von allein wieder auf. Scheint zur Zeit des Erdbebens mit ihrem Freund in Las Vegas gewesen zu sein. Hören Sie, Erica, es bringt nichts, hier noch länger rumzuhängen. Ich setze Sie nicht auf diese Sache an. Fahren Sie zurück nach Gaviota.« In dem Augenblick, da er das sagte, wusste Sam bereits, dass sie seiner Anordnung nicht Folge leisten würde. Wenn Erica Tyler sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war es unmöglich, ihr das auszureden. Wie letztes Jahr, als Irving Chadwick das versunkene Schiffswrack entdeckt und behauptet hatte, es sei ein vor der kalifornischen Küste gesunkenes chinesisches Boot und damit ein Beweis seiner Theorie, dass Asiaten Amerika nicht nur über die Beringstraße, sondern auch übers offene Meer erreicht hätten. Erica hatte sich bereits für Chadwicks Hypothese erwärmt; als er sie dann einlud, im Schiffswrack gefundene Töpfereien zu begutachten, stand für sie fest, dass dies tatsächlich ein Beweis dafür war.
Sam hatte schon damals versucht, sie davon abzuhalten, voreilige Schlüsse zu ziehen, und sie beschworen, langsam und bedacht die Sache anzugehen. Aber Ericas zweiter Name war Überschwang. Sie verkündete weiterhin lauthals, die Töpfereien seien echt, und eine Zeit lang hatten sie und Irving Chadwick sich im Rampenlicht gesonnt. Als sich später dann herausstellte, dass das Schiffswrack eine Fälschung war, und Chadwick zugab, dies alles selbst in Szene gesetzt zu haben, war es für Erica Tyler zu spät. Ihr Ruf war ruiniert.
»In den Nachrichten hieß es, man habe Knochen gefunden«, sagte sie jetzt. »Was haben Sie denn darüber schon herauskriegen können?«
Sam griff nach einem Clipboard, wohl wissend, dass sie versuchte, Zeit zu gewinnen. »Alles, was wir haben, sind kleine Fragmente. Da sich immerhin auch Pfeilspitzen darunter befanden, war das Grund genug, mein Büro anzurufen. Hier ist der Bericht des Coroners.«
Während Erica einen Blick darauf warf, sagte Sam: »Wie Sie sehen, beträgt die Menge an stickstoffhaltigen Komponenten im Knochen weniger als vier Gramm. Und der Benzidinsäuretest weist keinerlei eiweißhaltige Substanz nach.«
»Was bedeutet, dass die Knochen älter als hundert Jahre sind. Konnte der Coroner sagen, wie viel älter?«
»Leider nicht. Und durch Bodenanalysen ist das auch nicht festzustellen, weil wir nicht genau bestimmen können, in welcher Schicht die Knochen lagen. Dieser Canyon wurde vor siebzig Jahren aufgeschüttet, und voriges Jahr, bei den Ausschachtungsarbeiten für den Swimmingpool, wurde das Erdreich umgeschichtet. Als der Untergrund verwässerte und dann bei dem Beben der Boden nachgab, rutschten die Erdmassen an den Seiten nach. Alles hat sich miteinander vermischt. Trotzdem haben wir Pfeilspitzen gefunden und primitives Werkzeug aus Feuerstein.«
»Was auf eine indianische Begräbnisstätte hindeutet.« Sie reichte ihm das Clipboard. »Die NAHC ist doch sicher schon informiert worden?«, fragte sie und sah sich nach jemandem um, der ein Abgesandter der State of California Native American Heritage Commission sein mochte, der Kommission zur Wahrnehmung von Besitzansprüchen der Indianer.
»Selbstverständlich«, kam es gepresst von Sam. »Und sie ist bereits hier. Das heißt, er.«
Sie las Sams Blick. »Jared Black?«
»Ihr alter Gegner.«
Erica und Black waren in der Vergangenheit bereits wegen rechtlicher Angelegenheiten der amerikanischen Ureinwohner aneinander geraten, mit höchst unerfreulichem Ausgang.
Ein junger Mann kam auf sie zugelaufen, mit schmutzverkrustetem Gesicht und Schutzhelm. Er reichte ihnen die Polaroidfotos, die er in der Höhle gemacht hatte, und entschuldigte sich für deren amateurhafte Qualität. Sam dankte dem jungen Burschen und teilte die Aufnahmen zwischen sich und Erica auf.
»Mein Gott«, flüsterte Erica, als sie eins nach dem anderen betrachtete. »Wirklich … wunderschön. Und diese Symbole …« Sie stockte.
»Na, was halten Sie davon?«, brummte Sam mit Blick auf die Fotos. »Hinweise auf einen bestimmten Stamm?«
Als sie nicht antwortete, blickte er sie an. Erica starrte mit leicht geöffneten Lippen auf das Material in ihrer Hand. Einen Augenblick lang meinte Sam, sie sei leichenblass geworden, bis ihm klar wurde, dass dieser Effekt wohl vom fluoreszierenden Licht herrührte, das man hastig um die Unglücksstelle herum installiert hatte. »Erica?«
Sie zwinkerte, als ob sie aus einem Trancezustand erwachte. Als sie ihn ansah, hatte Sam ganz kurz das komische Gefühl, dass sie gar nicht wusste, wer er war. Dann kehrte Leben in ihr Gesicht zurück. »Das ist der Fund des Jahrhunderts, Sam«, sagte sie. »Diese Malereien sind umwerfend und außerdem besser erhalten als alles, was ich bisher gesehen habe. Überlegen Sie mal, welche Lücken in der Geschichte der Ureinwohner wir füllen könnten, sobald diese Piktogramme entziffert sind. Sam, bitte schicken Sie mich nicht zurück zu diesen Abalonemuscheln.«
Er seufzte tief. »Also gut. Schauen Sie sich ein, zwei Tage hier um, und lassen Sie uns eine vorläufige Analyse zukommen. Anschließend aber«, sagte er und hob die Hand, »geht’s wieder nach Gaviota. Ich kann Sie nicht mit diesem Projekt beauftragen, Erica. Tut mir Leid. Interne Gründe.«
»Aber Sie sind doch der Boss …« Sie brach unvermittelt ab.
Er folgte ihrem Blick und wusste, was sie abgelenkt hatte. In dieser kühlen Stunde kurz vor Tagesanbruch, zwischen übernächtigt wirkenden, unrasierten Männern, die nach Kaffee lechzten und Schlaf und sauberen Sachen, wirkte Commissioner Jared Black, perfekt gestylt in einem dreiteiligen Maßanzug mit feinem Nadelstreifen, seidener Krawatte und auf Hochglanz polierten Schuhen, als hätte er eben einen Gerichtssaal verlassen. Als er näher kam, sah man die funkelnden dunklen Augen unter den gerunzelten Brauen.
»Dr. Tyler. – Dr. Carter.«
»Commissioner.«
Obwohl er sich vehement für die Interessen der Indianer einsetzte, war Jared Black ein reiner Angloamerikaner. Es sei seiner irischen Abstammung zuzuschreiben, hatte er einmal erklärt, dass er sich für die Nöte unterdrückter Völker engagiere. »Wann«, wandte er sich an Sam Carter, »rechnen Sie damit, die Stammeszugehörigkeit der Höhlenmalereien zu identifizieren?« Seinem Ton nach erwartete er umgehend Antwort.
»Das hängt von den Leuten ab, die ich mit dieser Aufgabe betraue.«
Jared würdigte Erica keines Blicks. »Es versteht sich wohl von selbst, dass ich meine eigenen Experten hinzuziehe.«
»Nachdem wir unsere Voruntersuchungen abgeschlossen haben«, entgegnete Carter. »Ich brauche Sie wohl nicht darauf hinzuweisen, in welcher Reihenfolge das gehandhabt wird.«
Jared Blacks Augen flackerten. Zwischen ihm und dem Leiter des Staatlichen Archäologischen Instituts herrschte keine Sympathie. Carter hatte sich gegen Blacks Berufung in die Kommission ausgesprochen und als Grund dafür Jareds massive Abneigung gegen akademische und wissenschaftliche Institutionen angeführt.
Ericas Zusammenprall mit Jared Black lag vier Jahre zurück. Damals war ein gewisser Mr. Reddman, ein wohlhabender Mann, der sich in die Einsamkeit zurückgezogen hatte, gestorben und hatte eine bemerkenswerte Kollektion indianischer Artefakte hinterlassen. Sie sollten in seinem Haus ausgestellt werden, das laut Verfügung in ein nach ihm benanntes Museum umzuwandeln war. Man hatte Erica hinzugezogen, um die unschätzbare Sammlung zuzuordnen und zu katalogisieren, und als sie sie einem kleinen Stamm aus der Gegend zuschrieb, beauftragte dieser Stamm den Anwalt Jared Black, spezialisiert auf Grundbesitz- und Eigentumsrechte, vor Gericht Anspruch auf die Objekte zu erheben. Erica ersuchte den Staat, der Klage entgegenzutreten, da der Stamm plane, die Objekte ohne vorherige historische Analyse wieder zu vergraben. »Die Vergangenheit, von der diese Knochen und Artefakte zeugen«, hatte sie vorgebracht, »ist nicht nur die der Indianer, sondern die aller Amerikaner.« Der Prozess hatte hohe Wellen geschlagen, vor dem Gerichtsgebäude waren demonstrierende Gruppen aufmarschiert –, amerikanische Ureinwohner, die die Rückgabe all ihres Landes und ihrer Kultgegenstände forderten; Lehrer, Historiker und Archäologen, die für die Errichtung eines Reddman-Museums eintraten. Jared Blacks Frau, ein Stammesmitglied der Maidu und eine leidenschaftliche Verfechterin der Rechte der Indianer – einmal hatte sie sich sogar vor einen Bulldozer geworfen, um zu verhindern, dass eine Autobahn durch Indianerland gebaut wurde –, war unter denen gewesen, die sich am lautstärksten dafür eingesetzt hatten, »die Kollektion nicht in die Hand des weißen Mannes zu geben.«
Der Prozess schleppte sich über Monate hin, bis Jared schließlich auf ein bislang unbekanntes Detail stieß: Reddman hatte ohne Wissen der Behörden die Objekte auf seinem eigenen Grundstück, einem Grundstück von fünfhundert Morgen, ausgegraben und unerlaubterweise behalten. Weil zudem die Objekte auf einen altindianischen Erdwall schließen ließen – und Erica, obwohl sie für die andere Seite arbeitete, zugeben musste, dass das Anwesen aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Boden eines uralten Dorfes errichtet worden war –, erklärte Jared Black, dass folglich das Grundstück dem Gesetz nach nicht Mr. Reddman gehört habe, sondern den Nachfahren der damaligen Dorfbewohner. Die fünfhundert Morgen sowie weit mehr als tausend indianische Relikte – darunter seltene Töpfer- und Flechtwaren, Bogen und Pfeile – wurden dem Stamm ausgehändigt, der aus genau sechzehn Mitgliedern bestand. Reddmans Museum wurde niemals gebaut, die Artefakte nie mehr gesehen.
Erica dachte daran zurück, wie die Medien den Kampf zwischen ihr und Jared inner- und außerhalb des Gerichtssaals hochgespielt hatten. Ein inzwischen berühmtes Foto der beiden Streithähne, aufgenommen auf den Stufen vor dem Gerichtsgebäude, war an die Boulevardpresse verkauft worden und unter der Überschrift »Heimlich ein Liebespaar?« veröffentlicht worden. Der Lichteinfall und das unglückliche Timing des Kameraauslösers hatten Erica und Jared in einer jener überspannten, nur Bruchteile von Sekunden dauernden Posen festgehalten, die genau das Gegenteil von dem vermuten lassen, was Sache ist: Erica scheint ihm erwartungsvoll entgegenzusehen, mit weit aufgerissenen Augen, die Zunge zwischen die Lippen geschoben, während Black, der auf der oberen Stufe und damit über ihr steht, die Arme ausstreckt, als wollte er sie im nächsten Augenblick stürmisch umarmen. Beide waren über das Foto und die missverständliche Deutung empört gewesen, kamen aber überein, die Sache auf sich beruhen zu lassen, schon um dem Klatsch nicht noch weiter Vorschub zu leisten.
»Und ich brauche Sie wohl nicht darauf hinzuweisen, Dr. Carter«, sagte er zu Sam, »dass ich hier bin, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Schändung auf ein Minimum beschränken, und dass ich, sobald die MLD feststehen, Sie und Ihre Mitgrabräuber persönlich und mit besonderer Freude von diesem Gelände begleiten werde.«
Als sie seinen Abgang beobachteten, bohrte Sam die Hände in die Taschen und brummte: »Dieser Kerl ist wirklich nicht mein Fall.«
»Dann tun Sie wohl gut daran«, meinte Erica, »mich in dieses Projekt nicht einzubinden. Denn das würde bei Jared Black das Fass zum Überlaufen bringen.«
Sam sah sie an und bemerkte den Anflug eines Lächelns um ihre Mundwinkel. »Sie wollen diesen Job unbedingt, wie?«
»War ich zu ironisch?«
»Also gut«, sagte er und rieb sich den Nacken. »Eigentlich bin ich dagegen, aber ich denke doch, dass Gaviota ein anderer übernehmen kann.«
»Sam!« Sie konnte nicht anders, als ihm um den Hals zu fallen. »Sie werden es nicht bereuen, Ehrenwort!« Und dann packte sie ihren Assistenten am Arm, schlug ihm dadurch die angeknabberte Bärentatze aus der Hand und sagte: »Luke, an die Arbeit!«
»Es überrascht mich, dass Sam Carter Sie mit diesem Projekt betraut hat, Dr. Tyler«, sagte Jared Black kühl, als sie sich oben auf der Klippe einfanden.
»Ich verstehe einiges von Felsmalerei.«
»Wenn ich mich recht erinnere, auch von chinesischen Schiffswracks.«
Noch ehe Erica antworten konnte, fuhr er fort: »Ich gehe davon aus, dass Sie sich mit der jüngsten Ergänzung des Native American Graves Protection and Repatriation Act vertraut gemacht haben, der zufolge die Entnahme und Analyse von historischen Artefakten zu wissenschaftlichen Zwecken zwar gutgeheißen wird, mit besagten Analysen aber keine Beschädigung einhergehen darf und …«
Sie blieb betont ruhig, gerade wegen seines überheblichen Tons und weil sie wusste, dass er es auf eine Konfrontation mit ihr anlegte. Allein schon seine Unterstellungen ärgerten sie. Jared Black wusste genau, dass Erica in dem Ruf stand, im Umgang mit Artefakten so vorsichtig zu sein wie kaum ein anderer Anthropologe und dass bei allen ihren Untersuchungen von Zerstörung nicht die Rede gewesen sein konnte.
Sie unterdrückte ihren Zorn. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als Jared zuzugestehen, jeden Schritt ihrer Arbeit zu überwachen. Wenn es Ericas Job war zu bestimmen, zu welchem Stamm die Knochen und die Höhlenmalerei gehörten, war es Jareds Aufgabe, die MLD – die höchstwahrscheinlichen Nachkommen – zu eruieren und ihnen auszuhändigen, was immer Erica fand.
Sie spürte Jareds Blick auf sich ruhen und fragte sich, ob er noch wusste, wie sie sich kennen gelernt hatten. Das war im Bezirksgericht gewesen, als Erica zum ersten Mal im Fall Reddman aussagen sollte. Sie und Black waren sich noch nie begegnet; sie waren zwei Fremde, die sich den Lift teilten. Beim ersten Halt stieg eine schwangere Frau zu, beim zweiten eine Frau mit einem etwa fünfjährigen Jungen. Als sich der Aufzug wieder in Bewegung setzte, starrte der kleine Junge mit großen Augen die Schwangere an. Sie bemerkte seine Neugier und sagte nachsichtig: »Ich erwarte ein Baby. Ein kleines Mädchen oder einen kleinen Jungen wie dich.« Der Junge dachte angestrengt nach und fragte dann: »Meinst du, du könntest es dann später gegen ein Pony eintauschen?« Worauf die Schwangere begütigend lächelte und die Mutter des Jungen einen roten Kopf bekam. Beim nächsten Halt stiegen die drei aus, und nachdem sich die Türen wieder geschlossen hatten, prusteten Erica und der Fremde los. Erica erinnerte sich, dass sie seine ausgeprägten Grübchen wahrgenommen hatte und dass er unverschämt gut aussah. Er wiederum hatte sie mit einem bewundernden Blick bedacht. Dann hatten sich die Türen geöffnet, und sie waren begrüßt worden. Als sie hörte, dass er mit »Mr. Black« angesprochen wurde, war sie wie angewurzelt stehen geblieben. Und als der Anwalt für das Reddman-Anwesen sie Erica nannte, war auch Jared jählings versteinert. Sie hatten sich angestarrt, im selben Augenblick die peinliche Situation erkannt. Sie waren Feinde, Generäle in gegnerischen Kriegslagern. Dennoch hatten sie unabsichtlich ihren Spaß zusammen gehabt, hatten gemeinsam gelacht, sogar ein bisschen geflirtet.
Es erschreckte Erica, verunsicherte sie, wenn sie daran dachte, dass sie, wenn auch nur drei Minuten lang, diesen Mann anziehend gefunden hatte.
Die Öffnung der Höhle lag fünfundzwanzig Meter unterhalb des Hügelkamms hinter dem Zimmerman-Areal, und während über den Bergen im Osten der neue Tag anbrach und die Senke von Los Angeles in klares, abgasfreies Licht tauchte, zurrte Erica den Kinnriemen ihres Schutzhelms fest. Neben ihr, ebenfalls mit letzten Handgriffen beschäftigt, stand Luke, der zum ersten Mal mit einem frischen Fund in Berührung kam und entsprechend aufgeregt war. Mit der Entschlossenheit eines antiken Kriegers, der seine Lenden für die Schlacht gürtet, schlang er sich das Seil mit dem Karabinerverschluss um.
Jared Black rüstete sich ebenfalls. Er hatte seinen eleganten Anzug gegen etwas Robusteres getauscht: einen geliehenen Overall, der auf dem Rücken den Schriftzug Southern California Edison trug. Sein Gesichtsausdruck war keineswegs erwartungsvoll, eher trotzig-grimmig. War er sauer? Warum denn? Wollte er mit diesem Projekt nichts zu tun haben? Hatte man ihn gezwungen, es zu übernehmen? So wie Erica die Sache sah, müsste Jared Black doch überglücklich sein, die Arbeit der NAHC und seinen persönlichen Kreuzzug für die Rechte der amerikanischen Ureinwohner einmal mehr ins Rampenlicht zu rücken.
Oder war seine Verstimmung persönlicher Natur? Hatte er ihr noch immer nicht verziehen, was sie an dem Tag gesagt hatte, als sie und ihre Gruppe den Reddman-Prozess verloren hatten? »Mr. Black ist ein ausgemachter Heuchler«, hatte sie vorgebracht, »wenn er einerseits behauptet, für die Erhaltung der indianischen Kultur einzutreten, und andererseits entsprechende historische Zeugnisse der Erde übergibt und damit in Vergessenheit geraten lässt.«
»Sind Sie bereit, Dr. Tyler?«, fragte der Bergführer, nicht ohne sich zu vergewissern, dass Erica ordnungsgemäß angeseilt war und ihr Klettergurt und der Abseilachter wirklich saßen.
»So bereit wie nur irgend möglich«, gab sie zurück und lachte nervös auf. Noch nie hatte sie sich über eine Klippe abgeseilt.
»Okay. Folgen Sie einfach meinem Beispiel, dann klappt’s schon.«
Am Rande der Klippe drehte sich der Führer um, das Gesicht zum Felsabbruch gekehrt, und machte vor, wie man sich weit hinauslehnte und so den kontrollierten Abstieg anging, wie man durch den Achterknoten Seil nachließ, indem man den Druck auf den Strang lockerte, der durch die rechte Hand lief, und dass der andere Arm beim langsamen und vorsichtigen Hinuntertasten nach hinten ausgestreckt den Seillauf regulierte. Als sie den Zugang zur Höhle erreichten, half er erst Erica ins Innere, dann Luke und Jared, die hinter ihr waren.
Die vier seilten sich aus und starrten ins Dunkel. So klein die Höhle auch sein mochte, die Finsternis jedenfalls war gewaltig. Der einzige Lichtblick in der beklemmenden Schwärze waren die spärlichen Lichtpunkte von den Lampen auf ihren Helmen. Als sie mit den Füßen scharrten, hallte ein schwaches Echo von Sandsteinwänden wider, erstarb in der unergründlichen Ferne.
Auch wenn Erica am liebsten einfach ins Innere gerannt wäre und sich die Malereien angeschaut hätte, verharrte sie am Eingang und tastete mit ihrer Taschenlampe systematisch den Boden ab, die Wände, die Decke. Als sie sich überzeugt hatte, dass die Oberflächen nichts archäologisch Bedeutsames aufwiesen, nichts, was unabsichtlich hätte zerstört werden können, sagte sie: »Also dann, meine Herren, gehen wir rein. Passen Sie auf, wo Sie hintreten.« Der Lichtkegel ihrer Taschenlampe streifte die Höhlenwände und die Deckenwölbung. »Wir sollten von jetzt an versuchen, uns zeitlich zurückzuversetzen und uns vorzustellen, was die Menschen damals hier gemacht haben könnten und damit auch, welche Spuren sie hinterlassen haben.«
Sie gingen langsam los, achteten darauf, wohin sie mit ihren Stiefeln traten, derweil acht Lichtkreise wie weiße Motten über Sandsteinformationen tanzten. »Wir können von Glück sagen«, meinte Erica beiläufig, »dass diese Höhle an der Nordflanke der Berge liegt. Sie ist trockener als die Südflanke, wo die ganze Gewalt der Pazifikstürme anbrandet. Der Schutz vor Regen hat zur Erhaltung der Malereien beigetragen. Und möglicherweise auch weiterer Artefakte.«
Schweigend gingen sie weiter. Lichtkegel huschten über weiche Felskonturen, ließen geschwärzte Oberflächen und Büschel von Flechten erkennen. Jeder der vier Eindringlinge war voll konzentriert, seine Sinne geschärft, aufmerksam. Schließlich erreichten sie das Ende der Höhle.
»Da«, sagte der Führer. Er deutete auf die Malereien.
Erica trat erwartungsvoll näher, setzte behutsam einen Fuß vor den anderen. Als die Karbidlampe an ihrem Helm die Piktogramme streifte, stockte ihr der Atem. Die satten Farben der Kreise, die Rot- und Gelbtöne: wie prächtige Sonnenuntergänge! Hinreißend, phantastisch, lebendig. Und außerdem …
»Können Sie diese Symbole deuten, Dr. Tyler?«, fragte der Führer und legte dabei den Kopf schief, um aus dieser scheinbar wirren Collage von Linien, Kreisen, Formen und Farben etwas herauszulesen.
Erica antwortete nicht. Regungslos starrte sie auf das Gemälde, wie hypnotisiert von den leuchtenden Sonnen und Monden an der Wand.
»Dr. Tyler?«, fragte er erneut. Jared und Luke tauschten einen Blick. »Dr. Tyler«, sagte Luke, »alles in Ordnung mit Ihnen?« Als er ihre Schulter berührte, fuhr sie zusammen.
»Was?« Sie sah ihn entgeistert an, fing sich dann wieder. »Ich bin nur … Ich hatte nicht erwartet, ein derart gut erhaltenes Gemälde vorzufinden. Kein Graffito …«, stieß sie ein wenig atemlos aus. »Zu Ihrer Frage, was die Symbole bedeuten«, fuhr sie dann mit festerer Stimme fort, etwas gezwungen, so als müsste sie sich darauf besinnen, wo sie war. »Die religiöse Einstellung in der hiesigen Gegend war auf Schamanismus ausgerichtet, eine Form der Verehrung, die auf der persönlichen Interaktion zwischen einem Schamanen und dem Übernatürlichen basiert. Der Schamane versetzte sich durch den Verzehr von Stechäpfeln oder auf andere Weise in einen Trancezustand und betrat dann die Welt der Geister. Man nannte dies die Suche nach Visionen. Wenn er aus seinem Trancezustand wieder erwachte, hielt er seine Visionen auf Felsen fest. Dies nennt man von Trance beeinflusste Kunst. Jedenfalls ist dies eine der Theorien zur Deutung der südwestlichen Felsmalerei.«
Der Führer beugte sich vor. »Wie kommen Sie darauf, dass das hier das Werk eines Schamanen ist?«, fragte er. »Könnte es sich nicht einfach um ein Graffito handeln und gar nichts bedeuten?«
Erica musterte eingehend den größten der Kreise, der blutrot und von merkwürdigen Punkten umgeben war. Dies hier hat sehr wohl etwas zu bedeuten. »Man hat Laborstudien über dieses Phänomen angestellt und nennt es die Neuropsychologie veränderter Zustände. Was die Studien ergeben haben, ist, dass es universelle Bilder bei Menschen aus völlig unterschiedlichen Kulturen gibt, ob bei amerikanischen oder afrikanischen Ureinwohnern oder australischen Aborigines. In erster Linie handelt es sich dabei um farbenfrohe geometrische Formen, die sich mehr oder weniger spontan im optischen System bilden. Sie können es selbst ausprobieren. Schauen Sie kurz in grelles Licht und schließen Sie dann rasch die Augen. Die gleichen Muster bilden sich heraus: Punkte, parallele oder gezackte Linien, Spiralen. Wir nennen sie Metaphern der Trance.«
Er verzog das Gesicht. »Aber die hier sehen nach nichts aus.«
»Sollen sie auch nicht. Diese Symbole sind Ausdruck eines Gefühls oder einer spirituellen Ebene, etwas, das in Wirklichkeit keine körperliche Struktur hat und deshalb nicht darzustellen ist. Allerdings …« Sie legte die Stirn in Falten, als ihre Taschenlampe eine undefinierbare Form erhellte, verlängert durch etwas, das wie ausgestreckte Arme oder Hörner wirkte. »Es gibt hier einige andere Elemente, die verblüffend sind.«
Luke wandte sich ihr zu, blendete sie kurz mit der Lampe an seinem Helm. »Verblüffend? Inwiefern?«
»Einige dieser Formen passen nicht zu dem, was wir bisher über Trancevorstellungen wissen. Zum Beispiel dieses Symbol hier. Bei all meinen Studien der Felskunst ist mir so etwas noch nicht untergekommen. Die meisten anderen Symbole dagegen tauchen auch in Piktogrammen und Petroglyphen im Südwesten auf. Diese Handabdrücke zum Beispiel. Der Handabdruck ist in der Felskunst weit verbreitet, man findet ihn überall auf der Welt. Er ist die Tür, durch die der Schamane die Welt der Geister betrat. Aber diese anderen Symbole« – sie deutete darauf, vorsichtig, ohne die Fläche zu berühren – »sind mir neu.« Sie schwieg; ihr leichter Atem hörte sich in der Höhle wie ein Luftzug an. »Und da ist noch etwas Erstaunliches an diesen Malereien.«
Ihre Begleiter warteten ab.
»Neben den Piktogrammen, die charakteristisch sind für die ethnographisch erfassten Kulturen dieser Gegend, weist das Wandbild auch typische Motive der Pueblo auf. Eigentlich eine Vermischung mehrerer Kulturen. Südliches Paiute, Shoshone. Irgendwo südliches Nevada.«
»Können Sie das Alter der Malereien bestimmen, Dr. Tyler?«, fragte Luke ehrfürchtig.
»Jedenfalls datieren sie aus einer Zeit, die deutlich früher ist als 500 nach Christus, das lässt sich aus den Darstellungen schließen: Speerschleudern statt Pfeil und Bogen, die in der Neuen Welt um das 5. Jahrhundert herum gebräuchlich wurden. Um das Datum genauer zu bestimmen, müssten wir elektronische Analysen von Mikroproben und eine C14-Altersbestimmung durchführen. Grob geschätzt würde ich sagen, dass diese Malerei an die zweitausend Jahre alt ist.«
Zum ersten Mal meldete sich Jared Black zu Wort. »Wenn der Künstler aus dem Süden Nevadas kam, dann ist das doch eine gewaltige Entfernung. Da hätte er ja immerhin das Death Valley durchqueren müssen.«
»Entscheidender ist doch die Frage: Warum hat er das getan?«, entgegnete Erica. »Die Shoshone und Paiute wagten sich niemals über ihre Stammesgrenzen hinaus. Obwohl sie zur Nahrungssuche umherzogen, waren sie eher sesshaft und blieben auf ihrem angestammten Gebiet. Was hat dazu geführt, dass dieser eine seinen Clan verließ und einen so weiten und bestimmt äußerst beschwerlichen Weg zurücklegte?«
Obwohl Jareds Augen unter seinem Helm nicht deutlich zu erkennen waren, spürte Erica seinen durchdringenden Blick. »Demnach vermutlich eine Shoshone-Malerei?«, sagte er.
»Das ist nur eine Vermutung. Studien von Dürreperioden sagen uns, dass vor etwa fünfzehnhundert Jahren Umweltveränderungen in den ostkalifornischen Wüstengebieten die Vorfahren der Gabrieliño-Indianer, eine shoshonisch sprechende Gruppe, nach Los Angeles verschlagen haben. Falls diese Leute einen eigenen Stammesnamen hatten, ist er über die Zeiten hinweg in Vergessenheit geraten.«
»Aber das hier stammt doch von diesen Vorfahren?«, drängte Jared.
Sie bemühte sich, ihre Verärgerung zu unterdrücken. Jared Black war jemand, der Antworten wie aus der Pistole geschossen verlangte. »Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen. Tatsächlich glaube ich, dass dies hier älter als fünfzehnhundert Jahre ist. Und bedenken Sie, dass ›Gabrieliño‹ ein Sammelbegriff der Franziskaner für die verschiedenen Stämme in dieser Gegend war.« Sie sah ihn scharf an. »Wir müssen also sehr vorsichtig mit unseren Bezeichnungen sein.«
»Mit Bestimmtheit können Sie es demnach nicht sagen?«
Ihre Gereiztheit schlug allmählich in Zorn um. Sie wusste, worauf er hinauswollte. Den gleichen Vorwurf hatte er ihr im Verlauf des Reddman-Prozesses gemacht, auf ihren Einwand hin, sie benötige mehr Zeit, um die Stammeszugehörigkeit der Knochen und Artefakte zu bestimmen. Damals hatte er durchaus Recht gehabt: Erica hatte Zeit gewinnen wollen. Jetzt aber entsprach es der Wahrheit: Sie hatte keine Ahnung, welchem Stamm die Wandmalereien zuzuordnen waren.
Sie trat zurück und bemerkte, dass der Boden unterhalb des Bildes anders beschaffen war als der übrige Boden der Höhle. Er war erhöht und von einer Struktur, die nicht nach einer natürlichen Formation aussah. Sie blickte hinauf zur Decke. Kein Anzeichen für einen Einsturz. Sie kauerte sich an mehreren Stellen nieder und zerrieb die Erde zwischen den Fingern. Überall von derselben Beschaffenheit, gleichmäßig vom Wind in die Höhle hineingeweht. »Da die Malerei nicht eindeutig auf einen bestimmten Stamm schließen lässt«, sagte sie, »schlage ich vor, wir halten anderswo nach Beweismaterial Ausschau. Da wäre zum Beispiel dieser eigenartige Hügel hier.«
Lukes blonde Brauen wölbten sich, seine Augen glänzten erwartungsvoll. »Sie glauben, hier ist etwas vergraben?«
»Möglicherweise. Die rußigen Wände deuten darauf hin, dass Lagerfeuer oder Fackeln gebrannt haben, was bedeuten kann, dass dieser Hügel aus Schichten besteht, die im Laufe von jahrhundertelanger Habitation aufeinander gehäuft wurden.«
»Und jetzt fallen die Heuschrecken drüber her«, murmelte Jared.
»Keine Heuschrecken, Mr. Black. Nur ich. Ich werde die Einzige sein, die hier tätig wird, schon um sicherzustellen, dass der Erdhügel möglichst weitgehend erhalten bleibt.«
»Ausgraben ist Zerstörung, Dr. Tyler.«
»Auch wenn Sie’s nicht glauben, Mr. Black, aber es gibt tatsächlich Archäologen, die nichts davon halten, an einer Stätte zu graben, nur weil sie da ist. Es muss eine gefährdete Stätte sein. Oder aber es geht, wie in diesem Fall, darum, die Stammeszugehörigkeit unseres Höhlenkünstlers zu ergründen. Möglicherweise sind wir über einen einzigartigen geschichtlichen Hinweis gestolpert.«
»Oder über Gräber, und die sollte man in Ruhe lassen.«
Sie blickte zu Jared, dessen Gesicht durch das Spiel von Licht und Schatten in scharf abgegrenzte Flächen unterteilt war, und wandte sich dann Luke zu. »Als Erstes führen wir eine geochemische Bodenanalyse durch und messen den Phosphatgehalt. Dadurch erfahren wir zumindest, ob diese Höhle bewohnt war. Bis dahin wäre es schön, wenn Sie ein bisschen was von dieser Wand sauber machten. Unter der Rußschicht könnten sich weitere Piktogramme verbergen.«
Als sie sich umdrehte, um noch etwas zu Jared Black zu sagen, sah sie zu ihrer Überraschung, dass er zum Eingang der Höhle zurückgegangen war. In voller Größe und breitschultrig, die eine Hand an die Mauer gelehnt, in der anderen den Schutzhelm haltend, zeichnete sich seine Silhouette gegen die Morgensonne ab. Am Rande der Klippe stehend sah er aus, als sei er drauf und dran, sich in die Lüfte zu schwingen.
Dieser Augenblick hatte etwas Surreales – die dunkle Höhle, dazu das bedrückende Gefühl der Gesteinsmassen, die Enge der Sandsteinwände, die Stille, die eigentlich mit Frieden erfüllt war, und dann die Öffnung hinaus ins grelle Sonnenlicht über dem Pazifik und oberhalb davon der Lärm von Arbeitsgruppen, Polizei, Sensationshungrigen. Warum stand er dort? Was beobachtete er?
Noch etwas fragte sich Erica: Warum war er derart gereizt hier aufgetaucht? Jared Black schien so angriffslustig wie ein Grizzly, der sein Junges verteidigt. Wenn sie ihn nur irgendwie davon überzeugen könnte, dass sie bereit war, mit ihm zusammenzuarbeiten, dass sie nicht Gegner zu sein brauchten. Aber unbegreiflicherweise schien er versessen darauf zu sein, sie zum Feind abzustempeln. Der Reddman-Prozess lag vier Jahre zurück, und dennoch kam es ihr so vor, als ob das Adrenalin aus jener Schlacht, aus der er siegreich hervorgegangen war, noch immer durch seine Adern floss. Jared Black war ein Mann, der sich auf einen Kampf vorbereitete, und Erica wusste nicht, warum.
Sie leuchtete weitere Ecken der Höhle mit ihrer Taschenlampe aus, als der Lichtkegel auf etwas auf dem Boden fiel. »Luke, was hat Ihrer Meinung nach das da zu bedeuten?«
Luke sah auf den Boden und bemerkte, dass dort Erde aufgeworfen und etwas Weißlich-Graues zum Vorschein gekommen war. »Ganz frisch«, sagte er, »wahrscheinlich eine Verwerfung infolge des Erdbebens.«
Erica ging in die Hocke und entfernte mit einem kleinen Pinsel vorsichtig die lockere Erde.
»Allmächtiger«, japste Luke und riss die Augen auf.
Jared kam zurück und sah schweigend mit an, wie Erica mit Hilfe ihres Pinsels etwas freilegte, etwas, das wie ein Stein aussah, mit einem Loch darin. Und einem weiteren. Und dann … Zähne.
Ein menschlicher Schädel.
»Das ist ein Grab!«, flüsterte Luke überwältigt.
»Von wem?«, fragte der Führer nervös.
Erica, die spürte, wie ihr Adrenalinspiegel vor Erregung unvermittelt in die Höhe schoss, antwortete nicht. Aber sie war sich ihrer Sache gewiss. Noch ehe sie zu graben begonnen und Beweise gefunden hatte, wusste sie, dass sie auf die Überreste des Künstlers gestoßen war, von dem das Sonnenbild stammte.
Kapitel 2
Marimi Vor zweitausend Jahren
Marimi verfolgte die Bewegungen der Tänzer in der Mitte des Kreises und sagte sich, dass die heutige Nacht von Zauber erfüllt sein würde.
Sie konnte den Zauber bereits in ihren Fingern spüren, die geschickt die ovale Unterlage für das bald zu erwartende Baby flochten, die zarten Weidenzweige kreuzweise miteinander verwoben; die Oberfläche würde noch mit Rehleder bezogen und über dem Kopf des Neugeborenen ein geflochtener Sonnenschutz angebracht werden. Sie konnte den Zauber in ihrem Leib spüren, in dem sich neues Leben regte, ihr erstes Kind, das sie im Frühjahr erwartete. Sie sah den Zauber in den geschmeidigen Gliedern ihres jungen Ehemanns, der tanzend die diesjährige Piniennussernte feierte, ein gut aussehender, sehr männlich wirkender Jäger, der sie in die Ekstase körperlicher Liebe zwischen Mann und Frau eingeführt hatte. Marimi hörte Zauber im Lachen der Männer, ob sie nun tanzten oder spielten oder Geschichten erzählten und dabei ihre Tonpfeifen rauchten; sie hörte es in den Weisen der Musikanten, die ihre aus hohlen Vogelknochen gefertigten Pfeifen und Flöten aus Holunderholz erklingen ließen; Zauber lag auch im munteren Plappern der Frauen, die im Schein der vielen Lagerfeuer ihre hübschen Körbe flochten; im Geschrei der Kinder, die Reifen- und Stockspiele veranstalteten oder Ringkämpfe auf dem feuchten Waldboden; von Zauber kündeten auch die Gesichter der verliebten jungen Mädchen, die hinter vorgehaltener Hand ihrem zukünftigen Gatten zulächelten. Eine »Geisternacht« nannte es ihre Mutter, wenn die Geister der Vorfahren von den Seelen der Bäume und Felsen und Flüsse angerufen wurden, um das Einssein aller Dinge zu feiern. Für Marimi eine Zeit überwältigender Freude, eine schöne, eine besondere Nacht.
Nur dass sich in ihre Freude über diese festlich begangene Nacht unversehens Angst einschlich.
Auf der anderen Seite des großen Kreises, um den die Familien den Tänzern zusahen, war ein schwarzes Augenpaar fest auf sie gerichtet: die alte Opaka, die Schamanin des Clans, prächtig anzuschauen in ihrem rehledernen Gewand und geschmückt mit Perlen und kostbaren Adlerfedern. Marimi erschauerte unter dem durchdringenden Blick, und die feinen Härchen auf ihrer Haut richteten sich auf. Opaka verschreckte jeden, selbst die Häuptlinge und Jäger, mit ihrem reichen und geheimnisvollen Zauberwissen, weil sie mit den Göttern sprach, weil sie als Einzige des gesamten Clans das Geheimnis kannte, mit der Sonne und dem Mond und allen Erdgeistern zu kommunizieren und deren Macht zu beschwören.
Gewöhnliche Menschen waren nicht in der Lage, zu den Göttern zu sprechen. Wenn ein Mitglied des Clans bei den Göttern einen Gunstbeweis erflehen wollte, musste ein Schamane eingeschaltet werden. Ob sich eine unfruchtbare Frau ein Kind wünschte oder eine ältliche Jungfer einen Ehemann, ob die Geschicklichkeit eines in die Jahre gekommenen Jägers schwand oder ob eine Großmutter nicht mehr fingerfertig genug zum Flechten von Körben war, ob eine Schwangere Schutz vor dem bösen Blick suchte, ein Vater sich fragte, ob im ausgetrockneten Bachbett neben der Unterkunft seiner Familie je wieder Wasser fließen würde, alle wandten sie sich ehrfurchtsvoll an den Schamanen des Clans und trugen ihm demütig ihr Anliegen vor. Jedes Gesuch war mit einer Bezahlung verbunden, ein Grund dafür, weshalb die Schamanen so wohlhabend waren, ihre Hütten die am prächtigsten ausgeschmückten, ihre Ledergewänder die weichsten, ihre Perlenschnüre die schönsten. Arme Familien konnten nur mit Samenkörnern bezahlen, die reichen dagegen mit Schafsgehörn und Elchhäuten. Allen aber stand frei, sich an den Schamanen zu wenden, und alle erhielten sie – durch den Mund des Schamanen – Antwort von den Göttern. In Marimis Clan war der Schamane eine Frau, die allmächtige Opaka. Marimi hatte einmal miterlebt, wie die Alte einen Mann hatte krank werden und dann sterben lassen, nur indem sie auf ihn gedeutet hatte. So mächtig war Opaka.
Warum aber starrte sie jetzt ausgerechnet Marimi an, mit ihren schwarzen, wie Nadelstiche brennenden Augen?
Die junge Frau versuchte, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen, und wandte sich wieder ihrer Flechtarbeit zu, sagte sich nochmals, dass die heutige Nacht eine besondere war.
Es war die Zeit der jährlichen Zusammenkunft, zu der alle Familien des Volkes, das sich selbst die Topaa nannte, ihre Sommerunterkünfte verließen und sich aus allen Richtungen, auch dorther, wo die Erde den Himmel stützt, in den Bergen einfanden, zur Piniennussernte – etwa fünfhundert Familien, alle mit ihrer eigenen runden Grashütte und einem Lagerfeuer. Mit langen Stangen wurden dann die Zapfen von den Bäumen geholt, man röstete die Nüsse und aß sie oder zermahlte sie zu einem Brei, unter den man Wildbret und Fleischsaft mischte; was übrig blieb, wurde für die kommenden Wintermonate aufbewahrt. Während die Frauen Nüsse sammelten, veranstalteten die Männer eine Treibjagd auf Kaninchen, fingen sie mit Netzen ein und erlegten die Menge, die sie im Winter als Nahrung benötigten.
Zur selben Zeit wurden Eheschließungen vereinbart, was nicht leicht war angesichts der komplizierten Regeln, die festlegten, wer wen heiraten durfte. Da mussten die Abstammung überprüft und bedacht, die Götter angerufen, Omen gedeutet werden. Obwohl die Topaa alle einem Stamm angehörten, waren sie Mitglieder verschiedener Clans, die wiederum unterteilt waren in zweite und erste Familien. Jeder Clan besaß sein eigenes Tiertotem: Puma, Falke, Schildkröte. Die zweite Familie – Großeltern, Tanten, Onkel und Cousinen – nannte sich nach ihrer Abstammung: Volk vom kalten Fluss, Volk in der Salzwüste. Die erste Familie, zu der Mutter, Vater und deren Nachkommenschaft zählte, leitete ihren Namen von ihrer angestammten Nahrungsquelle ab, von ihrer Tätigkeit oder von Besonderheiten des Landstrichs – »Büffelbeerenesser«, »Flussbewohner« oder, wenn sie Schneidewerkzeug aus einem weißen Gestein herstellten, »Weiße Messer«. Marimi gehörte dem Clan des Rotschwänzigen Falken an, ihre zweite Familie war die der Eselhasenjäger. Der junge Mann, der sie sich zur Frau erkoren hatte, kam aus dem Schildkröten-Clan, dem Volk aus dem Staubigen Tal, den Pfeifenmachern. Er hatte Marimi bei der letzten Ernte mit seinen Possen entzückt, war fesch herausgeputzt und auf seiner Flöte spielend an ihrer Hütte vorbeistolziert, hatte mit Gesten seine Geschicklichkeit beim Speerwerfen angedeutet, aber nicht mit ihr gesprochen. Das war strengstens untersagt. Als sie dann ein Körbchen Lakritze hinausgestellt hatte, um ihm zu bedeuten, dass er ihr gefiel, hatte er dafür gesorgt, dass sein Vater Kontakt mit ihrem aufnahm. Die beiden Männer hatten sich mit den Häuptlingen ihrer Clans besprochen und die zahlreichen Punkte festgelegt, die es zu verhandeln galt, die Geschenke bestimmt und ob die Braut fortan in der Familie des Bräutigams leben sollte oder umgekehrt. Wenn der zukünftige Ehemann aus einer Familie mit wenigen Frauen kam, zog seine junge Frau mit ihm, und wenn die Frau aus einer Familie mit Witwen und unverheirateten Schwestern stammte, ging der Mann mit ihr. In Marimis Fall war ihr Vater der einzige Mann unter acht Frauen. Deshalb nahm er Marimis Bräutigam freudig als Sohn bei sich auf.
Zur Erntezeit wurde auch an die Grenzen des angestammten Landes der Topaa erinnert, und man lehrte die Kinder, sich die Flüsse einzuprägen, die Wälder, die Bergzüge, die das eigene Gebiet von dem benachbarter Stämme trennten – dem der Shoshone im Norden, dem der Paiute im Süden –, und mit wem die Topaa weder Handel trieben noch sich vermischten noch Kriege anzettelten, schärfte ihnen auch ein, dass es streng verboten war, im Gebiet eines anderen Stammes zu jagen, Samenkörner zu sammeln oder Wasser zu holen.
Zu jeder Pinienernte errichteten die Familien auf dem Gebiet ihrer Vorfahren Unterkünfte, ebendort, wo die jeweilige Familie sich seit jeher zur Erntezeit zusammengefunden hatte. Das Fleckchen, auf dem Marimi ihre Matte ausgebreitet hatte und jetzt den Korb für das Baby flocht, war dieselbe Stelle, auf der ihre Mutter und die Großmutter und ihre Großmütter bis zurück zu den Anfängen ebenfalls ihre Matten ausgebreitet und Babykörbchen geflochten hatten. Eines Tages würde auch ihre erstgeborene Tochter genau an dieser Stelle sitzen und Körbe flechten und dabei den gleichen Tänzen zuschauen, den gleichen Spielen. Die jährliche Piniennussernte bedeutete also mehr als nur das Sammeln von Nahrung für den Winter. Hier war es, wo das Volk die Geschichten seiner Vorfahren erzählt bekam, denn die Topaa hielten engen Kontakt zu ihrer Vergangenheit, stellten dadurch sicher, dass das, was früher gewesen war, auch heute noch Gültigkeit hatte und morgen auch, bis zum Ende der Zeit. Die jährliche Zusammenkunft zeigte auf, welchen Platz jeder Einzelne in der Schöpfung einnahm und dass er oder sie Teil eines Ganzen war, dass die Topaa und das Land, die Tiere und Pflanzen, der Wind und das Wasser zusammengehörten, miteinander verbunden waren wie die kunstvollen Körbe, die die Frauen flochten.
Die Clans blieben über die Piniennussernte hinaus und überwinterten in den Bergen; erst wenn das junge Grün zu sprießen begann, rüstete man sich zum Aufbruch, zogen die Familien wieder in ihr angestammtes Zuhause, bis zur nächsten Ernte. Marimi und ihr Mann, ihre Mutter und ihr Vater sowie sechs Schwestern kehrten dann dorthin zurück, wo die Familie seit Anbeginn der Zeit gelebt hatte und wo sie fortan wieder der Jagd nach Eselhasen nachgehen würden. Dort würde sie auch ihr erstes Kind gebären und Mutter werden und somit an Ansehen gewinnen, so dass man ihr, wenn sie im nächsten Jahr wieder in den Pinienwald kamen, mit mehr Achtung und Ehrerbietung begegnen würde.
Diese strahlende Zukunft war es, auf die sich Marimi zu konzentrieren versuchte, während Opakas unheimlicher Blick sie durchdrang und erschauern ließ. Warum starrte die Schamanin sie so an?
Das Verhalten der Schamanen des Clans war geheimnisvoll und unergründlich, und es galt bereits als tabu, auch nur Betrachtungen darüber anzustellen oder gar darüber zu sprechen, besaßen doch allein die Schamanen die Macht, sich zwischen der realen und der übernatürlichen Welt zu bewegen. Immer vor Beginn der Ernte, noch ehe die erste Familie ihre erste Unterkunft errichtete, wurden die Gotthütten der Schamanen gebaut. Alle packten mit an, selbst Kinder und Alte, schnitten die besten Äste und Zweige, opferten die besten Häute und Kienspäne, damit die Gotthütte die Götter willkommen heißen konnte und durch Vermittlung der Schamanen die Ernte und das Volk gesegnet wurden. Schon weil man in einer Welt lebte, die unsicher war und gelegentlich mit bösen Überraschungen aufwartete, war es unerlässlich, dass die Schamanen, noch ehe der erste Zapfen vom ersten Baum geholt wurde, sich in die Gotthütten begaben und in Trance versetzten, um in diesem Zustand mit den übernatürlichen Mächten zu kommunizieren und Anweisungen und Prophezeiungen zu erhalten und manchmal neue Gesetze.
Deshalb fürchtete sich Marimi auf einmal vor dieser Nacht der Festlichkeiten. Opaka besaß die Macht der Götter, und aus ihrem Blick, dessen war Marimi sich sicher, sprach Feindseligkeit. Warum? Marimi hatte keine Ahnung, wodurch sie sich den Zorn der Alten zugezogen haben konnte. Hätte ein anderes Stammesmitglied Anlass zu Groll gegeben, wäre Marimi zur Schamanin gegangen und hätte sie angefleht, den Schutz der Götter vor dieser Person zu erbitten. Aber diesmal war es die Schamanin selbst, die Marimi mit einem bösen Blick bedachte!
Sie schreckte zusammen, als ihr unvermittelt Tika einfiel.
Tika war die älteste Tochter der Schwester ihrer Mutter gewesen und von klein auf Marimi schwesterlich verbunden. Gemeinsam hatten sie die geheiligten Riten der Geschlechtsreife abgelegt, und als Marimi und Tika sowie zwölf weitere Mädchen den Initiationswettlauf bestritten hatten und Marimi gewann, das heißt, vor allen anderen die Hütte der Schamanin erreichte, hatte Tika ihr als Einzige Beifall gespendet. Tika war es auch, die während der letztjährigen Ernte heimliche Botschaften zwischen Marimi und dem jungen Jäger hin- und hergebracht hatte, denn es war ihnen untersagt, miteinander zu sprechen, solange die Eheverhandlungen im Gange waren. Und es war Tika, die Marimi und ihrem Ehemann zur Hochzeit einen so ausnehmend kunstvoll verzierten Korb geschenkt hatte, dass der gesamte Clan bewundernd darüber sprach.
Und dann kam Unglück über Tika. Sie hatte sich in einen jungen Mann verliebt, den Opaka für die Enkelin ihrer Schwester bestimmt hatte. Jedem anderen hätte Tika beiliegen können, so Marimis Vermutung, ohne verstoßen zu werden. Aber als man diese beiden in der Grashütte eines Onkels überraschte, berieten sich die Medizinmänner und -frauen, rauchten ihre Pfeifen der Weisheit und bestimmten, dass das Mädchen zu verstoßen sei, der Junge dagegen nicht, weil ihrer Meinung nach das Mädchen ihn angestiftet hatte, ein Stammesgesetz zu brechen. Da der Stamm aus Angst vor der Vergeltung der Götter keines ihrer Mitglieder tötete, nicht einmal dann, wenn sie sich des schlimmsten Verbrechens schuldig gemacht hatten, wurden die Übeltäter lebendig zum Tode verurteilt. Ihr Name, ihre Habe und ihre Vorräte wurden ihnen abgesprochen, sie selbst aus dem schützenden Kreis verbannt, in den sie niemals zurückkehren konnten. Keiner durfte mit ihnen sprechen oder sie ansehen, ihnen auch nichts zu essen anbieten oder Wasser oder Unterkunft. Die Angehörigen schnitten sich die Haare ab und trauerten, als ob der Verstoßene wirklich gestorben wäre. Als Tika zu einer der Namenlosen wurde, hatte Marimis Herz um sie geweint. Jetzt dachte sie daran zurück, wie sie die Freundin am Rande des Pinienwaldes hatte stehen sehen, schwankend wie eine verlorene Seele. Am liebsten wäre sie zu ihr gegangen, hätte den schützenden Kreis verlassen, Tika Nahrung und warme Decken gebracht. Aber das hätte auch Marimi zu einer Verstoßenen gemacht.
Weil sie bereits »tot« waren, lebten Verstoßene nicht lange. Nicht nur, weil sich die Nahrungsbeschaffung als schwierig erwies und weil man den Elementen ausgesetzt war, sondern weil auch der Geist in ihnen erstarb. Wenn der Lebenswille erlosch, ließ der Tod nicht lange auf sich warten. Nach wenigen Tagen war Tika nicht mehr am Rande des Lagers gesichtet worden.
»Mutter«, wandte sich Marimi an die Frau, die, die Beine überkreuzt und mit einer kniffligen Flechtarbeit beschäftigt, neben ihr saß und sang. Singen hauchte dem Korb Leben ein und damit Geist und befähigte die Finger, einen Mythos oder eine wundersame Geschichte in das Muster zu weben. Marimis Mutter war dabei, das Rautenmuster ihres Korbs mit der Geschichte von der Erschaffung der Sterne zu beseelen. »Mutter«, sagte Marimi jetzt etwas lauter, »Opaka beobachtet mich.«
»Ich weiß, meine Tochter. Nimm dich in Acht. Wende die Augen ab.«
Marimis Blick huschte nervös über die von Lärm erfüllte Ansiedlung, wo der Rauch von fünfhundert Lagerfeuern zum Himmel stieg. Ihr Zuhause im Sommer war die große Wüste, in der die Vegetation hauptsächlich aus Beifuß bestand, während diese Berge bewaldet waren, Pinien und Wacholder wuchsen. Was sich an Spukgestalten in dieser laubreichen Gegend herumtrieb, hätte Marimi in Angst und Schrecken versetzt, wäre da nicht der schützende Kreis gewesen, in dem sie sich zusammen mit ihrem Volk aufhielt. Nachts, wenn die Familien auf ihren Pelzdecken lagen und angsterfüllt dem Stöhnen der Geister in den Bäumen lauschten, hofften sie, dass die Fetische der Schamanen, die man um das Lager herum ausgelegt hatte, stark genug sein würden, die Geister fern zu halten. Deshalb sträubte sich auch keiner, den Schamanen zu bezahlen, denn ein mächtiger Schamane verhieß Sicherheit für den Clan und dass die Götter über ihn wachten. Nur allzu deutlich stand ihnen das entsetzliche Schicksal des Eulen-Clans vor Augen, dessen Schamane an einem steilen Abhang tödlich abgestürzt war und sechsunddreißig Familien hinterlassen hatte, die nun niemand mehr in der Welt der Geister vertrat und in deren Namen niemand mehr zu den Göttern sprach. Noch vor dem Ablauf eines Mondes waren Männer, Frauen und Kinder allesamt krank geworden und gestorben. Der Eulen-Clan existierte nicht mehr.
Marimis Angst wurde immer stärker. Sie zwang sich, nur noch an das Körbchen für ihr Baby zu denken. Aber ihre Finger waren jetzt steif und ungelenk, und sie ahnte, dass der Zauber, den sie in dieser Nacht spürte, nicht unbedingt ein guter Zauber war …
Die Augen auf Marimi an der gegenüberliegenden Seite des Kreises der Tänzer geheftet, dachte Opaka an die Zeit zurück, da sie selbst einen so reizvollen Anblick geboten hatte. Sie saß auf ihrem erlesenen Büffelfell, umgeben von Geschenken und Essen, Perlen und Federn – Gaben, die man ihr gebracht hatte, um Gunstbeweise und den Segen der Götter zu erflehen –, und stellte verbittert fest, dass Marimi mit ihrem runden Gesicht, den lachenden Augen, dem sinnlichen Mund und dem schimmernden schwarzen Wasserfall von Haar – eben all dem, was die Aufmerksamkeit nicht nur des jungen Jägers und jetzigen Ehemanns geweckt hatte – genau das verkörperte wie einstmals Opaka, ehe Alter und zu viele Seelenreisen außerhalb ihres Körpers sie ausgelaugt hatten. Jetzt war Opaka gebeugt, weißhaarig und fast zahnlos.
Aber das war nicht der Grund, weshalb sie das Mädchen hasste. Das Gift, das in Opakas brüchigen Adern floss, hatte sich sechs Winter zuvor zusammengebraut, während der Piniennussmangelzeit, als die Familien ins Waldgebiet gekommen waren und feststellen mussten, dass die Pinienzapfen bereits abgefallen waren und auf dem Boden verrotteten. Als sie erkannten, dass die Götter die Jahreszeit hatten zu früh anbrechen lassen und das Volk Hunger leiden würde, hob ein großes Wehklagen an, und die Schamanen zogen sich in die Gotthütten zurück, um geweihten Mesquite zu verbrennen und zu fasten und Stechäpfel zu essen und zu singen und um Visionen von den Göttern zu erbitten, aus denen sich ableiten ließ, wo das Volk Piniennüsse finden würde. Aber die Götter hatten die Gebete der Schamanen nicht erhört, weshalb den Topaa eine schreckliche Hungersnot bevorzustehen schien.
Und dann war Marimis Mutter mit einer unglaublichen Geschichte bei Opaka vorstellig geworden.
Ihre Tochter, die damals neun Sommer zählte, sei das Opfer einer schweren Krankheit geworden, die mit Kopfschmerzen und Erblindung und Schwerhörigkeit einhergehe. Die Mutter habe den Kopf des Kindes in kaltes Wasser gesteckt und dafür gesorgt, dass sich die Kleine im Schatten aufhielt, und als die Krankheit überstanden gewesen sei, habe Marimi der Mutter von einem Pinienwald auf der anderen Seite des Flusses erzählt. Das sei ein Hirngespinst, habe die Mutter gemeint, und lediglich auf den Hunger und die merkwürdigen Kopfschmerzen zurückzuführen. Sie habe ihre Tochter beschworen, über die Vision Stillschweigen zu bewahren; es stehe allein Opaka zu, dem Clan zu sagen, wo Nahrung zu finden war. Aber Marimi habe auf ihrer Vision von einem Pinienwald jenseits der Grenzen der Topaa beharrt, in dem niemand lebe oder je gelebt habe, es somit kein Tabu sei, dort hinzuziehen und eine reiche Piniennussernte einzubringen.
Als dann die Schamanen aus ihrer Hütte getreten seien und verkündet hätten, diesmal gebe es keine Piniennüsse und auch keine Kaninchenjagd, da niemand Kaninchen im Wald gesehen habe, und dass die Götter sich von ihrem Volk abgewandt hätten, sei in Marimis Mutter der Entschluss gereift, Opakas Rat hinsichtlich der Visionen ihrer Tochter einzuholen. Der Wald, habe das Kind behauptet, sei in Richtung der aufgehenden Sonne zu erreichen, über einen Fluss hinweg oben auf einem fruchtbaren Hügelkamm.