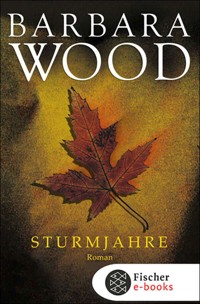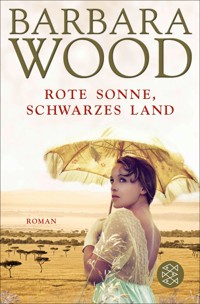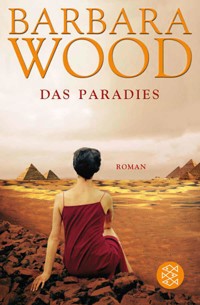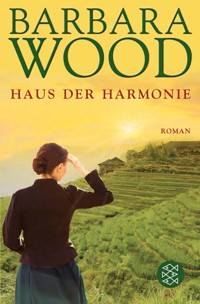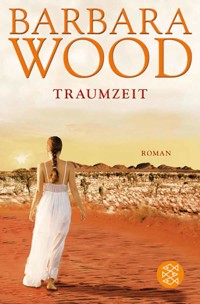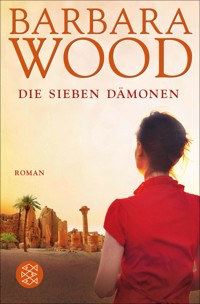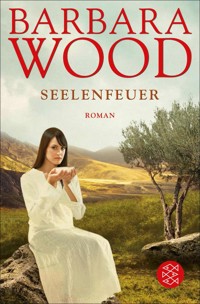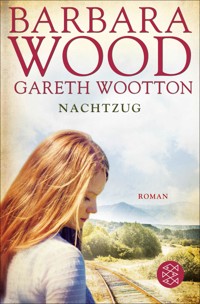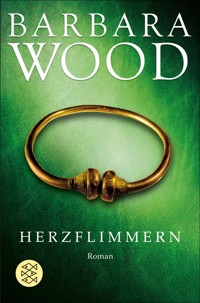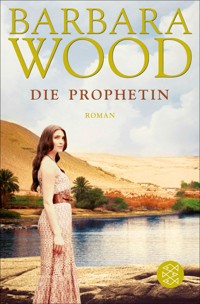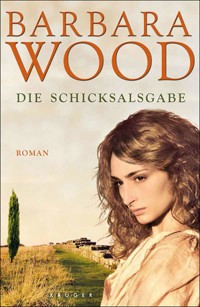
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fluch oder Segen? Ihre geheimnisvolle Gabe führt die junge Ulrika bis an die Grenzen der Welt. Sie weiß, dass sie anders ist als ihre römischen Freundinnen: Ulrika hat Visionen, die sie vor allen verheimlicht, die sie aber nach Germanien rufen. Dort rettet sie der Handelsherr Sebastianus aus höchster Gefahr. Gemeinsam brechen sie auf zu einer Reise: Sebastianus will eine Karawane bis nach China führen, Ulrika forscht nach dem Geheimnis ihrer Gabe. Ihre Suche führt beide bis an die Grenzen der Welt und tief ins Herz der Finsternis. Als Sebastianus bei Kaiser Nero in Ungnade fällt, eilt Ulrika zu ihm nach Rom. Darf sie ihre Schicksalsgabe einsetzen, um den Mann zu retten, den sie liebt? Das Leseerlebnis voller Leidenschaft und Abenteuer von Bestsellerautorin Barbara Wood.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Barbara Wood
Die Schicksalsgabe
Roman
Fischer e-books
Für meinen Ehemann Walt, in Liebe
1
Sie war auf der Suche nach Antworten.
Am Morgen war die neunzehnjährige Ulrika mit dem Gefühl aufgewacht, dass irgendetwas nicht stimmte. Während sie gebadet und sich angekleidet hatte und ihre Sklaven ihr anschließend das Haar hochgesteckt und die Sandalen geschnürt hatten, um dann das Frühstück, bestehend aus Weizenkleie und Ziegenmilch, aufzutragen, hatte sich dieses Gefühl noch verstärkt. Das rätselhafte Unbehagen verging nicht, im Gegenteil, es wurde immer stärker und drängender. Also beschloss sie, die Straße der Wahrsager aufzusuchen, wo Seher und Mystiker, Astrologen und Zukunftsdeuter allerlei Lösungen für die Geheimnisse des Lebens versprachen.
Als sie jetzt, von einem Vorhang abgeschirmt, in einer Sänfte durch die lärmenden Straßen Roms getragen wurde, grübelte sie darüber nach, woher dieses Unbehagen rühren mochte. Gestern noch war alles in Ordnung gewesen. Sie hatte Freundinnen besucht, war durch die Läden geschlendert, die Pergamente und Schriftrollen feilboten, hatte eine Zeitlang an ihrem Webstuhl verbracht – das typische Tagesprogramm eines jungen Mädchens ihrer Gesellschaftsschicht und Abstammung. Aber dann hatte sie dieser seltsame Traum heimgesucht …
Kurz nach Mitternacht, so Ulrikas Traum, war sie aus dem Bett aufgestanden und ans Fenster getreten. Dann kletterte sie hinaus und landete barfuß im Schnee. Statt Obstbäumen, wie sie hinter der Villa wuchsen, umgaben sie in ihrem Traum hohe Föhren, ein richtiger Wald, und Wolkenfetzen trieben über einen winterlichen Mond. Sie entdeckte Spuren im Schnee – Abdrücke von mächtigen Tatzen, die in den Wald hinein führten. Ulrika folgte ihnen, spürte das Mondlicht auf ihren nackten Schultern, und dann stand sie auf einmal vor einem ausgewachsenen zottelhaarigen Wolf mit goldgelben Augen. Ruhig setzte sie sich in den Schnee, worauf das Tier sich neben ihr niederließ und den Kopf in ihren Schoß legte. Die Nacht war klar, so klar wie die Augen des Wolfs, der zu ihr aufblickte. Unter dem Fell konnte sie seinen gleichmäßigen Herzschlag spüren. Die goldgelben Augen blinzelten und ihr war, als läge darin ein Ausdruck von Vertrauen, von Liebe, ja, von Zuhause.
Verwirrt war Ulrika aufgewacht. Warum habe ich von einem Wolf geträumt?, hatte sie überlegt. Was für einen Grund mag es dafür geben? Hängt das womöglich mit meinem Vater zusammen, der vor langer Zeit im fernen Persien gestorben ist und dessen Name Wulf war?
Hatte der Traum etwas zu bedeuten? Wenn ja, was?
Ihre Sklaven setzten die Sänfte ab, und Ulrika stieg aus. Sie war ein hochgewachsenes junges Mädchen. Über ihrer langen Tunika aus blassrosa Seide lag die farblich darauf abgestimmte Palla über Kopf und Schultern, das hellbraune Haar und den schlanken Hals verbarg sie in jungfräulicher Zurückhaltung. Ihre selbstbewusste Haltung und ihr sicheres Auftreten ließen nichts von der inneren Unruhe erkennen, die sie belastete.
Die Straße der Wahrsager war eine schmale Gasse im Schatten dicht besiedelter Wohnhäuser. Die Zelte und Buden der Spiritisten, Schlangenbeschwörer, Seher und Zukunftsdeuter, eins bunter bemalt als das nächste und mit glitzernden Objekten verziert, sahen vielversprechend aus. Das Geschäft der Lieferanten von Glücksanhängern, magischen Reliquien und Amuletten blühte.
Als Ulrika die Gasse betrat, um jemanden zu finden, der ihren Traum von dem Wolf deuten konnte, machten fahrende Händler aus Zelten und Buden lauthals auf sich aufmerksam, gaben sich als »echte Chaldäer« aus, mit direkter Verbindung zur Zukunft und im Besitz des Dritten Auges. Als Erstes begab sie sich zu einem Vogeldeuter, der für ein paar Münzen aus den Innereien seiner in Verschläge gepferchten Tauben weissagte. Seine Hände waren blutverkrustet. Er versicherte Ulrika, dass sie noch vor Ende des Jahres einen Ehemann finden würde. Der Rauchdeuter, den Ulrika als Nächsten an seinem Stand aufsuchte, verkündete, dass der Weihrauch ihr fünf gesunde Kinder verhieß.
Ungeduldig ging sie weiter, bis sie ganz hinten in der Gasse auf eine armselig wirkende Gestalt traf, die weder einen Stand noch ein Zelt ihr eigen nannte, sich nicht einmal eines schattigen Plätzchens erfreuen konnte. Mit überkreuzten Beinen hockte sie auf einer zerfransten Matte am Straßenrand. Ihr langes weißes Gewand hatte seine besten Tage hinter sich, ihre knöchernen langgliedrigen Hände ruhten auf mageren Knien. Da die Frau den Kopf gesenkt hielt, sah man nur ihr Haar, das ihr, schwärzer als Pech und in der Mitte gescheitelt, über Schultern und Rücken fiel. Ulrika konnte sich nicht erklären, warum es sie ausgerechnet zu dieser armseligen Wahrsagerin zog – vielleicht war sie ja mehr um Ehrlichkeit bemüht denn auf Geld aus? –, jedenfalls blieb sie vor ihr stehen und wartete ab.
Nach kurzer Zeit hob die Wahrsagerin den Kopf, und Ulrika war verblüfft über das ungewöhnliche Gesicht, das ihr entgegenblickte: Es war lang und schmal, knochig und von gelblichem Teint, umrahmt von dem nachtdunklen Haar. Traurige schwarze Augen unter gewölbten Brauen blickten Ulrika an. Wie ein Wesen aus einer anderen Welt wirkte die Frau, und sie schien alterslos zu sein. War sie zwanzig oder achtzig? Neben ihr hatte sich eine braunschwarz gefleckte Katze zusammengerollt. Ulrika erkannte in ihr eine Ägyptische Mau, die dem Vernehmen nach älteste Katzenrasse, möglicherweise sogar die Urmutter aller Katzen.
Sie richtete ihr Augenmerk wieder auf die glänzenden schwarzen Augen, aus denen Traurigkeit und Weisheit sprachen.
»Du hast eine Frage«, eröffnete die Wahrsagerin in perfektem Lateinisch das Gespräch und starrte Ulrika unverwandt an.
Der Lärm in der Gasse verebbte. Ulrika fühlte sich wie gebannt von schwarzen ägyptischen Augen, die braune Katze döste vor sich hin.
»Du willst mich wegen eines Wolfs befragen«, sagte die Ägypterin mit einer Stimme, die älter zu sein schien als der Nil.
»Ich habe ihn im Traum gesehen, Weise Frau. War das ein Zeichen?«
»Ein Zeichen wofür? Stell deine Frage.«
»Ich weiß nicht, wohin ich gehöre, Weise Frau. Meine Mutter ist Römerin, mein Vater Germane. Ich wurde in Persien geboren und war fast mein ganzes Leben lang mit meiner Mutter auf Wanderschaft. Denn sie folgte einer Bestimmung. Wo immer wir hinkamen, fühlte ich mich als Außenseiterin. Es bedrückt mich, Weise Frau, dass ich, wenn ich nicht weiß, wohin ich gehöre, niemals wissen werde, wer ich bin. War der Traum von dem Wolf ein Hinweis, dass ich in das Land am Rhein gehöre, zu dem Volk meines Vaters? Ist es für mich an der Zeit, Rom zu verlassen?«
»Überall um dich herum gibt es Zeichen, Tochter. Die Götter geleiten uns, wohin auch immer wir gehen.«
»Du sprichst in Rätseln, Weise Frau. Kannst du mir wenigstens meine Zukunft vorhersagen?«
»Da wird ein Mann sein«, kam es von der Wahrsagerin, »der dir einen Schlüssel anbietet. Nimm ihn.«
»Einen Schlüssel? Wofür?«
»Das wirst du verstehen, wenn die Zeit kommt …«
2
Als Ulrika den Garten hinter der hohen Mauer auf dem Esquilin, einem der sieben Hügel, auf denen Rom erbaut ist, betrat, presste sie die Hand an die Brust, bis sie unter dem Seidengewebe ihres Gewandes das Kreuz Odins spürte, das beschützende Amulett, das sie von klein auf begleitete. Sie betastete seine vertrauten Umrisse, die sich an ihren Busen drückten, und versuchte sich einzureden, dass sich alles zum Guten wenden würde. Aber das Unbehagen, mit dem sie heute Morgen aufgewacht war, hatte sie den ganzen Tag über begleitet, so dass sie jetzt, da eine orangerote Sonne nach und nach hinter Roms Marmorgebäuden verschwand, kaum atmen konnte. Wie wünschte sie sich, alles wäre wieder so wie immer! Selbst Themen, die sie noch tags zuvor verärgert hatten, wären ihr jetzt, an diesem späten Nachmittag, als Ablenkung willkommen. Zum Beispiel die Frage, ob sie, wie es alle erwarteten, Drusus Fidelius heiraten wollte.
Es lag Ulrika fern, ungehorsam zu sein. Rom erzog seine Töchter zu Ehefrauen und Müttern. Alle ihre Freundinnen waren entweder verheiratet oder versprochen (ausgenommen die zu ihrem Leidwesen durch eine Hasenscharte entstellte Cassia, was eine Garantie für lebenslange Jungfernschaft war). Andere Zukunftspläne gab es auch gar nicht. Eine alleinstehende junge Frau ohne den Schutz eines Mannes war eine Seltenheit. Sogar Witwen kamen bei männlichen Verwandten unter. Ulrika hatte ihrer besten Freundin anvertraut, nicht heiraten zu wollen, weder Drusus Fidelius noch sonst irgendeinen Mann. Worauf die Freundin ausgerufen hatte: »Aber kein junges Mädchen will freiwillig unverheiratet bleiben! Ulrika, was willst du denn sonst mit deinem Leben anfangen?« Auf diese Frage hatte Ulrika keine andere Antwort gehabt als die, dass sie seit jeher das unbestimmte Gefühl habe, sie sei zu etwas anderem berufen. Was das war, wusste sie allerdings nicht zu sagen. Ihre Mutter hatte sie zwar in den Grundlagen der Heilkunst unterrichtet, in der Herstellung und dem Gebrauch von Medizinen, in Anatomie und wie man Krankheiten diagnostizierte, aber Ulrika wollte nicht in die Fußstapfen der Mutter treten, keine Heilkundige werden.
Vom Garten aus verfolgte sie, wie nach und nach die für den Abend geladenen Gäste eintrafen, und konnte einmal mehr beobachten, wie die römischen Männer ihre weiblichen Anverwandten mit einem Wangenkuss begrüßten. Nicht unbedingt aus Zuneigung, sondern um zu prüfen, ob ihre Schwestern oder Töchter nach Alkohol rochen. Ständig übten Männer irgendeine Kontrolle aus. Die Frauen in Germanien dagegen wurden, wie Ulrika gehört hatte, von ihren Männern mit weit mehr Respekt behandelt und als ebenbürtig erachtet.
Vor dem Hintergrund von Roms Villen und Straßen war Ulrika zur Frau herangereift. Sie hatte dicht bevölkerte und lärmende Städte kennengelernt und genoss jetzt ein luxuriöses Leben in einem herrschaftlichen Haus auf dem Esquilin-Hügel. Warum sehnte sie sich dann nach Gebirgen und Wäldern, die in Nebel und Geheimnis eingehüllt schienen? Seit sie lesen konnte, hatte sie alle Schriften über das Volk ihres Vaters – die Germanen – verschlungen, derer sie habhaft werden konnte, hatte deren Kultur und Bräuche, deren Überzeugungen und Geschichte aufgesogen. Sogar ihre Sprache hatte sie sich angeeignet – heimlich. Denn wann immer sie Freundinnen von ihrem Interesse an den Germanen erzählt hatte, war sie auf Unverständnis und Ablehnung gestoßen.
Welchen Sinn hatte das alles?, fragte sie sich jetzt, als sie die Gäste erkannte, die im Hof von Tante Paulinas Haus eintrafen, die Damen in fließenden Tuniken, die Herren in langen, kleidsamen Togen. Diente das alles zur Vorbereitung auf die Reise in das Land, in das sie, Ulrika, wirklich gehörte? Es würde keine leichte Reise werden. Wulf, ihr Vater, war noch vor ihrer Geburt gestorben. Und sollte es noch Verwandte von ihm geben, dürfte es für Ulrika ein Ding der Unmöglichkeit sein, dies in Erfahrung zu bringen, geschweige denn, diese Verwandten ausfindig zu machen. Sie wusste nur, dass Wulf ein Fürstensohn und ein Held seines in den Wäldern lebenden Volks gewesen war und dass er ihr eine Blutlinie von rheinländischen Stammesfürsten und mystischen Seherinnen vererbt hatte.
Eine frische Brise wehte durch den Garten, rührte spielerisch an Ästen und dem feinem Gewebe von Ulrikas langem Gewand. Sie war nach der neuesten Mode gekleidet, die mehrere Schichten Stoff vorschrieb, was durch ein knielanges Überkleid sowie Schals in jeweils verschiedenen Längen und Blautönen – von dunklem Azur bis zur Färbung des morgendlichen Himmels – erreicht wurde. Ihr langes Haar, das geflochten und am Hinterkopf zu einem Knoten frisiert war, verbarg ein weicher safrangelber Schleier, die Palla, die auch die Arme bedeckte und unterhalb der Taille endete. Goldene Ohrringe und Armreife vervollständigten ihre Garderobe.
Sie fröstelte. Wenn es mir bestimmt ist, von hier wegzugehen, wie soll ich das dann tun?
»Da bist du ja, Liebes.«
Ihre Mutter kam auf sie zu. Mit ihren vierzig Jahren bewegte sich Selene anmutig und graziös; feine Leinenstoffe in Rot- und Orangetönen umhüllten die schlanke Gestalt. Ihr dunkelbraunes Haar war am Hinterkopf zu einem schlichten Knoten geschlungen und mit einem scharlachroten Schleier bedeckt.
»Paulina sagte mir, du seist hier draußen.« Mit ausgebreiteten Armen ging Selene auf ihre Tochter zu.
Paulina war eine verwitwete Patrizierin, und dies war ihr Haus. Als beste Freundin ihrer Mutter nannte Ulrika sie Tante Paulina. Da Paulina in Roms höchsten Kreisen verkehrte, lud sie dementsprechend nur die Elite der Bürger der Stadt zu sich ein. Zu diesem Kreis gehörte auch Selene, Ulrikas Mutter, als Heilkundige und enge Freundin von Kaiser Claudius.
Als sich Ulrika und ihre Mutter Arm in Arm dem Haus näherten, kamen sie an drei Männern in militärischer Haltung vorbei, die über Angriffsstrategien debattierten. Sie trugen lange weiße Tuniken und darüber purpurfarben gesäumte Togen. Kaum dass sie der beiden Frauen ansichtig wurden, unterbrachen sie ihr Gespräch, um sie zu grüßen und sich vorzustellen. In dem Moment, da der eine, ein gut aussehender Mann mit gebräuntem Gesicht und schneeweißen Zähnen, sich als Gaius Vatinius zu erkennen gab, merkte Ulrika, wie sich die Schultern ihrer Mutter versteiften. »Befehlshaber Vatinius?«, sagte Selene. »Müsste ich schon von dir gehört haben?«
Einer der anderen Männer lachte. »Wenn nicht, Verehrteste, wäre er am Boden zerstört! Vatinius wäre erschüttert, wenn er erkennen müsste, dass es in Rom auch nur eine schöne Frau gibt, die nicht weiß, wer er ist.«
Ulrika, der die gepresste Stimme der Mutter nicht entgangen war, musterte eingehend den Mann, den Selene mit »Befehlshaber« angesprochen hatte. Er war hochgewachsen, Anfang vierzig, mit tiefliegenden Augen und einer langen, geraden Nase. Wie aus Marmor gemeißelt wirkte er. Der Anflug eines gekünstelten Lächelns, das seine Lippen umspielte, zeugte von Arroganz.
»Bist du vielleicht«, hörte Ulrika die Mutter stockend fragen, »jener Gaius Vatinius, der vor einigen Jahren am Rhein kämpfte?«
Sein Lächeln vertiefte sich. »Du hast also doch von mir gehört.«
Gaius Vatinius wandte sich Ulrika zu, musterte sie unverhohlen von Kopf bis Fuß. Im nächsten Augenblick meldete ein Sklave, dass das Mahl aufgetragen sei, worauf sich die drei Männer mit einer kurzen Entschuldigung in Richtung Haus begaben.
Ulrika sah, dass ihre Mutter kreidebleich geworden war. »Gaius Vatinius hat dich erschreckt, Mutter. Wer ist er?«
»Er befehligte einst die Legionen am Rhein«, antwortete Selene, wobei sie dem Blick ihrer Tochter auswich. »Aber das war lange vor deiner Geburt. Lass uns hineingehen.«
Vier Tische standen im Speisesaal, jeder auf drei Seiten von Ruhebetten flankiert. Die Platzierung der Gäste folgte einem strengen Protokoll, demzufolge die Ehrengäste jeweils auf dem Ruhebett an der linken Seite des Tisches lagerten. Die vierte Seite des Tisches blieb frei, damit die Sklaven ungehindert Speisen und Getränke auftragen konnten. Gebratene Fasanen im Federkleid prangten in der Mitte der Tafel, um sie herum Platten und Schalen mit verschiedenen Speisen, von denen die Gäste sich selbst bedienen konnten. Die Stimmen von mehr als dreißig Personen schwirrten durch den Raum, drohten schier die Klänge der Panflöte zu übertönen, die ein Musikant spielte.
Ulrika wollte sich gerade auf ihren Platz neben einem Rechtsgelehrten namens Maximus niederlassen, als sie kurz einen Blick hinüber zu Gaius Vatinius warf. Sie mochte kaum ihren Augen trauen.
Auf dem Fußboden neben dem Befehlshaber saß ein riesiger Hund.
Ulrika runzelte die Stirn. Wie kam ein Gast auf die Idee, seinen Hund zu einer Essenseinladung mitzunehmen? Sie musterte die anderen Gäste, die sich ungezwungen mit Wein und Delikatessen bedienten. Empfand denn niemand sonst diesen Hund als völlig fehl am Platze?
Mit leichtgeöffneten Lippen und angehaltenem Atem sah sie wieder auf das Tier. Nein, das war kein Hund –, sondern ein Wolf! Groß und grau und zottelhaarig, mit bohrendem Blick und gespitzten Ohren, wie der Wolf in ihrem Traum. Und er starrte sie unverwandt an, derweil Gaius Vatinius mit seinen Tischnachbarn plauderte.
Ulrika konnte sich vom Anblick des mächtigen Tiers nicht losreißen.
Während sie weiterhin reglos verharrte, merkte sie, dass der Wolf langsam aus ihrem Blickfeld schwand, bis nichts mehr von ihm zu sehen war. Ulrika zwinkerte. Er hatte sich doch gar nicht von seinem Lager erhoben! Nicht den Speisesaal verlassen. Er hatte sich einfach in Luft aufgelöst, vor ihren Augen.
Es war ihr, als verlöre sie den Boden unter den Füßen. Zitternd tastete sie nach dem Ruhebett und sank darauf nieder. Die Kehle schnürte sich ihr zusammen. Jetzt begriff sie, warum sie sich den ganzen Tag über so unwohl gefühlt hatte.
Die Krankheit hatte sich wieder eingestellt.
3
Sie hatte geglaubt, sie wäre die geheimnisvolle Krankheit, die ihre Kindheit überschattet und über die sie mit niemandem, nicht einmal mit ihrer Mutter, gesprochen hatte, losgeworden, als sie ihr zwölftes Lebensjahr erreichte. Sie wusste nicht mehr, wann sie zum ersten Mal etwas gesehen hatte, was andere nicht sahen, oder von etwas geträumt hatte, das sich noch gar nicht ereignet hatte, oder die Hand von jemandem berührt und gewusst hatte, dass dieser Mensch Seelenqualen litt. Als sie als Achtjährige mit ihrer Mutter beim Metzger war und dieser ein Hackebeil suchte, hatte Ulrika ihm zugerufen: »Es ist hinten unter einen Tisch gefallen.« Der Metzger war in einen rückwärtig gelegenen Raum gegangen und sichtbar verblüfft mit dem Hackebeil zurückgekommen.
Diesen verblüfften Gesichtsausdruck hatte Ulrika häufig genug erlebt, um zu wissen, dass das, was sie sah oder spürte, ob im Traum oder als Vision, nicht normal war. Da sie sich jedoch damals schon in jeder Stadt, in der sie und ihre Mutter für eine Weile lebten, als Außenseiterin fühlte, hatte sie gelernt, ihre Zunge zu hüten und die Leute auf eigene Faust nach verschwundenen Hackebeilen suchen zu lassen.
An einem Sommertag vor sieben Jahren schließlich, als Ulrika und ihre Mutter einen Ausflug aufs Land unternahmen, hatte Ulrika, umsummt von Bienenschwärmen und inmitten betörender Blumendüfte, um die Zeit, da die Sonne am höchsten stand, unvermittelt eine junge Frau erblickt, die aus dem Wald angerannt kam. Mit flatterndem Haar, den Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen, die Arme mit Blut befleckt.
»Mutter, wovor läuft diese Frau weg?«, hatte Ulrika gefragt und überlegt, ob sie ihr zu Hilfe eilen sollten. »Sie sieht so verängstigt aus, und ihre Hände sind voller Blut.«
»Welche Frau?«, hatte Selene gesagt und sich umgeschaut.
Als sich dann die verängstigte Frau vor ihren Augen in Luft auflöste, hatte Ulrika erschrocken festgestellt, dass es wieder eine ihrer geheimnisvollen Visionen gewesen war, wenngleich sie diesmal so deutlich und lebensecht erschienen war wie noch nie zuvor. »Niemand, Mutter, sie ist schon weg.«
Das war vor sieben Jahren gewesen.
Danach hatten Ulrika keine Halluzinationen mehr heimgesucht, keine seltsamen Träume oder Vorahnungen von wunderlichen Orten, da gab es keine Eingebungen, wie es um die Seelenverfassung anderer stand, keine Hinweise, wo sich Verlorenes wiederfinden ließ. Mit Beginn der Pubertät war Ulrika endlich wie alle anderen Mädchen gewesen, normal und gesund. Bis sie heute, anlässlich Tante Paulinas Gastmahl, erneut eine Vision erlebt hatte.
Die Stimme von Gaius Vatinius riss sie aus ihren Gedanken.
»Wir müssen diese Germanen zur Ordnung rufen«, erklärte er gerade seinen Tischnachbarn. »Unter Tiberius wurden Friedensverträge mit den Barbaren unterzeichnet, und jetzt brechen sie sie. Ich werde diese Aufstände ein für alle Mal beenden.«
Die Gäste in Paulinas Speisesaal lehnten sich zurück, stützten sich dabei mit dem linken Arm ab, während sie mit der rechten Hand den Speisen zusprachen. Der Ehrenplatz an Ulrikas Tisch gebührte Befehlshaber Vatinius. Ihre Mutter, die ihm als Tischdame zugedacht war, hatte ihren Platz links von ihm, Ulrika saß ihrer Mutter gegenüber. Die anderen Tischnachbarn waren ein einflussreiches Ehepaar, Maximus und Juno, der Finanzbeamte Honorius und Aurelia, eine ältere Witwe. Man erfreute sich an in Knoblauch und Zwiebeln gedünsteten Pilzen, an knusprigen Anchovis und Sperlingen, die mit Pinienkernen gefüllt waren.
Als Befehlshaber Gaius Vatinius, ein eingefleischter Junggeselle, merkte, dass Ulrika ihn anstarrte, unterbrach er das Gespräch und musterte sie seinerseits. Ihre außergewöhnliche Schönheit entging ihm keineswegs – ihre Haut schimmerte wie Elfenbein, das Haar war von der Farbe dunklen Honigs. Und dann die blauen Augen: bei Römerinnen eine Seltenheit. Ein Blick auf ihre linke Hand verriet ihm, dass sie unverheiratet war, was ihn angesichts ihres Alters überraschte.
Er bedachte sie mit einem charmanten Lächeln und sagte: »Ich langweile dich wohl mit meinen Soldatengeschichten.«
»Durchaus nicht«, versicherte Ulrika. »Und das Rheinland hat mich schon immer interessiert.«
»Warum können sie nicht Ruhe geben und sich wie zivilisierte Menschen benehmen?«, warf Aurelia verärgert ein. »Wenn man bedenkt, was wir für die Welt getan haben. Unsere Aquädukte, unsere Straßen.«
Vatinius wandte sich der Älteren zu. »Was die Barbaren so wütend macht, ist, dass Kaiser Claudius vor vier Jahren eine Siedlung am Rhein aus dem Status einer Garnison in den Rang einer Kolonie erhoben hat. Zu Ehren seiner Gattin Agrippina, die dort geboren wurde, nannte er sie Colonia Agrippinensis. Das war der Zeitpunkt, zu dem die Überfälle mit Macht einsetzten. Offenbar hat die Romanisierung eines alten germanischen Gebiets dazu geführt, dass die Barbaren sich auf ein längst überholtes Stammesbewusstsein besonnen haben und meinen, ein freies germanisches Volk sein zu wollen.« Vatinius winkte mit einer schwer beringten Hand. »Claudius hat mir die ehrenhafte Aufgabe übertragen, Colonia zu verteidigen, was immer es kostet.«
Ulrika griff nach ihrem Weinbecher, vermochte aber nicht zu trinken. Der Wolf … und jetzt war die Rede von neuerlichen Kämpfen in Germanien.
»Die Barbaren waren lange Zeit über friedlich«, sagte Maximus, der reiche und dicke Rechtsgelehrte. Er hielt die Hand hoch, worauf sein persönlicher Sklave vortrat und ihm die fetttriefenden Finger abwischte. »Wie mir zu Ohren gekommen ist, werden die Stämme von einem einzigen rebellischen Anführer aufgewiegelt. Weißt du, wer er ist?«
Ein Schatten verfinsterte Vatinius’ gut geschnittenes Gesicht. »Wir wissen nicht, wer er ist, wir kennen nicht einmal seinen Namen. Wir haben ihn noch nie zu Gesicht bekommen. Dem Vernehmen nach ist er aus dem Nichts aufgetaucht, und jetzt führt er die germanischen Stämme in eine neue Rebellion. Sie greifen an, wenn wir es am wenigsten erwarten, und verschwinden anschließend spurlos in den Wäldern.«
Vatinius nippte an seinem Weinbecher, ließ sich dann von einem Sklaven die Lippen abtupfen. »Ich werde diesen Anführer aufstöbern«, fuhr er fort, »und an ihm ein Exempel statuieren, das heißt, ihn öffentlich hinrichten lassen, als Warnung für alle, denen der Sinn nach Aufruhr und Rebellion steht.«
»Was macht dich so sicher, Befehlshaber Vatinius«, fragte Ulrika, »dass du Erfolg haben wirst? Soviel ich weiß, sind die Germanen listenreich. Was schwebt dir vor, um für einen klaren Sieg zu sorgen?«
»Ich habe einen Plan, der nicht misslingen kann.« Er lächelte zuversichtlich. »Weil er auf dem Element der Überraschung fußt.«
Ulrikas Herz raste. Mit zitternder Hand griff sie nach einer Olive. »Ich könnte mir vorstellen«, gab sie zu bedenken, »dass die Barbaren mittlerweile sämtliche Taktiken der Legionen kennen, selbst jene, die auf dem Überraschungsmoment basieren.«
»Mein Plan geht in eine ganz andere Richtung.«
»Inwiefern?«
Er schüttelte den Kopf. »Das würdest du nicht verstehen.«
Sie ließ nicht locker. »Soldatengeschichten langweilen mich ganz und gar nicht, Gaius. Ich habe Cäsars Bericht über den gallischen Krieg gelesen. Beabsichtigst du etwa, gegen die Barbaren Kriegsmaschinerie einzusetzen?«
Statt zu antworten, schaute er sie eine Weile sinnend an, bewunderte das honigbraune Haar, das ovale Gesicht, ihre direkte Art – das Mädchen war weder spröde noch schüchtern! –, und dann, geschmeichelt über ihr Interesse und beeindruckt von ihrem Sachverstand, kam er nicht umhin zu sagen: »Das ist genau das, was die Barbaren erwarten. Ich aber habe etwas ganz anderes vor. Diesmal werde ich sie mit ihren eigenen Waffen schlagen.«
Sie sah ihn fragend an.
»Der Kaiser hat mir für diesen Feldzug völlige Handlungsfreiheit gewährt. Ich habe Vollmacht, so viele Legionäre aufzubringen, wie ich brauche, und so viel an Kriegsmaschinerie, wie ich für nötig halte. Die Barbaren werden Katapulte und bewegliche Türme, berittene Truppen und Fußsoldaten zu sehen bekommen. Alles typisch römisch. Was sie nicht zu sehen bekommen«, sagte er und nahm einen Schluck Wein, »sind die Kampfeinheiten, die von Barbaren ausgebildet und angeführt überall in den Wäldern hinter ihnen verteilt sein werden.«
Ulrika starrte Gaius Vatinius an. Eine kalte Faust schien ihr das Herz zu zerquetschen. Er hatte tatsächlich vor, die Germanen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Sie senkte den Blick auf ihre Hände, spürte, wie ihr Puls in den Fingerspitzen pochte. Und sie dachte: Es wird ein schreckliches Gemetzel geben.
4
Ulrika fand keinen Schlaf.
Unruhig warf sie sich ihren wollenen Umhang über das Nachthemd und verließ das Schlafzimmer. Obwohl es im Haus dunkel und still war, wusste sie, dass ihre Mutter bestimmt noch nicht zu Bett gegangen war. Selene nutzte diese ruhige Zeit für Eintragungen in ihr Tagebuch und um medizinische Texte zu studieren, Medizinen zu brauen. Sie war keineswegs überrascht, als Ulrika bei ihr anklopfte. »Ich dachte mir schon, dass du kommst«, sagte sie und schloss die Tür, sobald ihre Tochter eingetreten war. Eine Kohlenpfanne verbreitete Wärme, unweit davon standen zwei Sessel mit Fußschemeln.
So bestürzt und verstört Ulrika Tante Paulinas Festmahl auch verlassen hatte, so fühlte sie sich jetzt in diesem kleinen Raum, in dem ihre Mutter heilbringende Tränke, Elixiere, Puder und Salben zusammenmischte, auf einmal besänftigt. Schriftrollen reihten sich neben alten Texten und Papyri – allesamt enthielten sie Zaubersprüche und Gebete und Beschwörungsformeln zum Heilen von Krankheiten. Denn genau das war es, wozu sich Ulrikas Mutter berufen fühlte – kranke Menschen gesund zu machen.
Sosehr es Ulrika auch drängte, ihrer Mutter endlich einmal von den Visionen und Träumen und Vorahnungen aus Kindertagen und auch von der Vision von dem Wolf beim Festmahl am heutigen Abend zu berichten und sie zu fragen, was das alles zu bedeuten habe und wie denn ihre Krankheit zu heilen sei, sagte sie stattdessen, nachdem sie Platz genommen hatte: »Mutter, heute Abend hast du kaum etwas gegessen. Du warst blass und ungewöhnlich schweigsam. Und wie du Befehlshaber Vatinius angestarrt hast – warum erschreckt er dich so?«
Selene setzte sich der Tochter gegenüber, griff zu einem langen Schüreisen und stocherte damit in der Kohlenpfanne herum. »Es war Gaius Vatinius, der vor vielen Jahren das Dorf deines Vaters niedergebrannt und deinen Vater in Ketten abgeführt hat. In den Jahren unseres Zusammenseins hat Wulf oft davon gesprochen, dass er nach Germanien zurückkehren und an Gaius Vatinius Rache nehmen wollte.«
Selene seufzte tief. Sie hatte gewusst, dass dieser Tag kommen würde, hatte sich davor gefürchtet. Und jetzt, da es so weit war, merkte sie, wie ihr der Mut schwand. Sie dachte zurück an den Tag, als die damals neunjährige Ulrika weinend ins Haus gestürmt war, weil ein Junge aus der Nachbarschaft sie einen Bastard genannt hatte. »Er sagt, ein Bastard ist ein Kind, das keinen Vater hat. Und weil ich keinen Vater habe, bin ich ein Bastard.« Selene hatte sie beschwichtigt. »Hör nicht auf das, was andere sagen. Sie wissen nichts. Natürlich hast du einen Vater. Aber er ist gestorben, und jetzt weilt er bei der Göttin.«
Natürlich hatte Ulrika die Mutter mit Fragen bestürmt, und Selene hatte ihr daraufhin alles berichtet, was sie über Wulfs Volk wusste. Sie hatte ihr von der Weltesche erzählt, vom Land der Eisriesen und von Mittelerde, wo Odin wohnte. Ulrika hatte erfahren, dass sie nach ihrer germanischen Großmutter genannt worden war, der Seherin des Stammes, deren Name, wie Wulf gesagt hatte, Ulrika lautete, was so viel wie »Wolfsmacht« bedeutete. Auch dass ihr Vater ein Fürstensohn seines Stammes war, ein Kind des als Held verehrten Arminius, hatte Selene Ulrika erzählt. Nur dass Wulf ein Kind der Liebe war, ein unehelicher Sohn von Arminius, hatte sie der Tochter verschwiegen. Dieses Geheimnis bewahrte Selene. Genug war genug.
Aus all dem hatte sich Ulrika einen imaginären Vater erschaffen. Bei ihren Spielen bildeten Holzlöffel einen Föhrenwald, und ein mit Wasser gefüllter Graben wurde zum Rhein erklärt. Sie hatte sich Geschichten vom Fürstensohn Wulf ausgedacht, in denen er nach vielen Abenteuern und Schlachten und Romanzen immer den Sieg davontrug. »Mama, erzähl mir doch noch mal«, pflegte Ulrika die Mutter zu drängeln, »wie mein Vater aussah«, und dann beschrieb Selene Wulf als Krieger mit langem blonden Haar und muskulösem Körperbau. Mit zwölf Jahren ließ Ulrika von Puppen und auch von Spielen, die sie sich ausdachte, ab und verlegte sich auf das Lesen von Schriften jeglicher Art, verschlang alles, was ihr über Germanien in die Hände fiel, um die Wahrheit und die Zusammenhänge über das Volk ihres Vaters und ihr Land zu erfahren.
Jetzt blickte sie forschend in das Gesicht der Mutter, das von der Kohlenglut bernsteinfarben beleuchtet wurde. »Da gibt es doch noch etwas, ist es nicht so, Mutter? Etwas, das du mir verschweigst?«
Selene sah ihre Tochter, dieses Kind, das seit dem Augenblick seiner Zeugung im fernen Persien von Magie und Geheimnis umgeben war, freimütig an. Sie dachte an die Gabe, die Ulrika möglicherweise von ihrer germanischen Blutlinie vererbt bekommen hatte – eine hellseherische Fähigkeit, die Selene bei ihrer Tochter bereits im Kindesalter beobachtet hatte. Die kleine Ulrika konnte damals sagen, wo verloren gegangene Sachen zu finden waren, und unerwartete Ereignisse nahm sie so gelassen hin, als wäre sie darauf vorbereitet. Sie erkannte, wenn jemand bekümmert war, noch ehe Selene selbst diese seelische Notlage bemerkt hatte. Die Mutter respektierte, dass Ulrika annahm, diese Fähigkeit für sich behalten zu haben, schon weil sie sich sicher war, dass ihre Tochter eines Tages kommen und eine Erklärung für diese absonderlichen Wahrnehmungen von ihr erbitten würde. Der Zeitpunkt für ein solches Gespräch schien vor sieben Jahren gekommen zu sein, anlässlich eines Ausflugs aufs Land, als Ulrika behauptet hatte, eine Frau gesehen zu haben, die in panischer Angst aus dem Wald auf sie zugerannt sei. Aber da war keine Frau gewesen. Selene hatte dies als eine weitere Vision gedeutet, die Ulrika erlebt hatte. Merkwürdig war jedoch, dass der Tochter diese Fähigkeit danach abhanden gekommen zu sein schien, so als ob der Eintritt ins Erwachsenenalter die zarte, einfühlsame Gabe der Wahrnehmung überlagert und vollständig abgeschottet hätte.
Die Mutter seufzte abermals tief auf. »Es gibt etwas, was ich dir längst hätte sagen sollen. Ich hatte es auch immer vor. Aber solange du klein warst, meinte ich, du würdest es nicht verstehen, deshalb sagte ich mir immer: später, wenn Ulrika älter ist. Aber der richtige Zeitpunkt stellte sich einfach nicht ein. Ulrika, ich habe dir erzählt, dass dein Vater noch vor deiner Geburt bei einem Jagdunfall umgekommen ist, damals, als wir in Persien lebten. Aber so verhielt es sich nicht. Wulf hatte Persien längst verlassen und war nach Germanien zurückgekehrt.«
Gedämpfte Geräusche hallten in der Ferne – von ächzenden Rädern auf der ansonsten verwaisten Straße hinter der hohen Mauer der Villa, das Klapperdiklapp von Pferdehufen auf dem Kopfsteinpflaster, der einsame Ruf eines Nachtvogels.
»Er verließ Persien, weil ich darauf bestand«, fuhr Selene leise fort. »Wir waren noch nicht lange dort, als wir hörten, dass Gaius Vatinius vor uns durchgezogen und inzwischen auf dem Weg ins Rheinland war. Ich beschwor deinen Vater, ihm unverzüglich zu folgen. Ich selbst wollte in Persien bleiben.«
»Und er ging fort? Obwohl er wusste, dass du schwanger warst?«
»Das wusste er nicht. Ich habe es ihm verschwiegen, weil er sonst bei mir geblieben wäre. Dein Vater war ein ehrenhafter Mann. Sobald das Kind da gewesen wäre, hätte er uns nie wieder verlassen. Ich hatte kein Recht, mich in sein Leben zu drängen, Ulrika.«
»Kein Recht! Du warst seine Frau!«
Selene schüttelte den Kopf. »Nein, war ich nicht. Wir waren nicht verheiratet.«
Ulrika starrte die Mutter fassungslos an. »Wulf hatte bereits eine Frau«, sagte Selene und vermied es, der Tochter in die Augen zu schauen. »Er hatte in Germanien eine Frau und einen Sohn. Deinem Vater und mir war kein gemeinsames Leben bestimmt. Sein Schicksal erwartete ihn im Rheinland, und ich wollte, wie du weißt, meiner eigenen Berufung folgen. Jeder von uns musste seinen eigenen Weg finden.«
»Er ging aus Persien fort, ohne von deiner Schwangerschaft zu wissen«, murmelte Ulrika. »Demnach hat er nichts von mir erfahren.«
»Nein.«
»Demnach weiß er auch bis heute nichts von mir!« Der Gedanke traf Ulrika wie ein Schlag. Sie konnte das alles kaum fassen. »Mein Vater hat keine Ahnung, dass es mich gibt!«
»Er ist nicht mehr am Leben, Ulrika.«
»Wie kannst du dir da so sicher sein?«
»Wenn dein Vater Germanien erreicht hätte, dann hätte er Gaius Vatinius aufgespürt und Rache genommen.«
»Und da Gaius Vatinius lebt, kann das deiner Meinung nach nur bedeuten, dass mein Vater tot ist«, sagte Ulrika leise.
Selene wollte nach der Hand der Tochter greifen, aber Ulrika entzog sich ihr. »Du hattest kein Recht, mir das zu verschweigen!«, rief sie. »Mein ganzes bisheriges Leben war eine Lüge!«
»Es geschah zu deinem eigenen Besten, Ulrika. Als Kind hättest du nicht verstanden, warum ich zuließ, dass dein Vater in sein Land zurückkehrte.«
»Ich bin schon lange kein Kind mehr, Mutter«, stieß Ulrika aus. »Du hättest mir schon vor Jahren die Wahrheit sagen können, anstatt sie mich auf diese Weise entdecken zu lassen.« Abrupt stand sie auf. »Du hast mir meinen Vater genommen. Und heute Abend hast du seelenruhig mit angesehen, wie ich mich mit diesem Ungeheuer unterhalten habe.«
»Ulrika …«
Aber Ulrika war schon zur Tür hinausgestürmt.
5
Ulrika lag auf ihrem Bett und starrte zur Decke ihres Schlafgemachs hoch. Aus der Ferne drangen die Geräusche des nächtlichen Verkehrs auf den Straßen der Stadt an ihr Ohr. Das Herz pochte ihr bis zum Halse. Sie hatte geweint, aber nur kurz, und dann angefangen, intensiv nachzudenken. Jetzt, da sie in die Dunkelheit starrte, versuchte sie, sich über ihre Gefühle Klarheit zu verschaffen. Es tat ihr leid, wie hässlich sie zu ihrer Mutter gewesen war, wie sie auf und davon gerannt war.
Morgen werde ich mich als Erstes bei ihr entschuldigen, dachte sie. Und vielleicht können wir in aller Ruhe über Vater reden, vielleicht hilft das, diesen Riss zu kitten, zu dem es zwischen uns nicht hätte kommen dürfen.
Ihr Vater …
Wie konnte ihre Mutter so sicher sein, dass er tot war? Wieso war Gaius Vatinius der Beweis dafür? Nur weil der General noch lebte, hieß das noch lange nicht, dass Wulf es nicht gelungen war, seine Heimatlande am Rhein zu erreichen.
Ulrika schlüpfte aus dem Bett und trat ans Fenster, atmete tief die von Frühlingsduft erfüllte Nachtluft ein. Der Garten unter ihr zog sich wie ein zartes weißes Laken den Hügel hinauf – rosa und orangefarbene Blütenblätter, die im Mondlicht weiß wirkten, rieselten wie Schneeflocken von den Obstbäumen.
Ulrika dachte an das verschneite Rheinland, an ihren kriegserprobten Vater, wie ihn die Mutter so oft beschrieben hatte – hochgewachsen, voller Energie, mit kantigen, stolzen Gesichtszügen und wachsamen Augen. Wenn er Persien vor zwanzig Jahren verlassen hatte, wäre er erst nach Unterzeichnung der Friedensverträge in seine Heimat zurückgekehrt. Germanien hätte sich demnach nicht länger im Krieg mit Rom befunden. Wie so viele seiner Landsleute hätte Wulf sich friedlich niederlassen und seinen Landbesitz bewirtschaften können. Nur durch das von Claudius kürzlich erlassene Dekret, den Status von Colonia aufzuwerten und die umliegenden Wälder zum Zwecke der Besiedlung zu roden, waren alte Wunden wieder aufgebrochen, war der alte Hass wieder aufgeflammt, wurde wieder gekämpft.
War es denkbar, dass unter diesen Kriegern ihr Vater war? War er vielleicht der neue Held, der sein Volk in die Rebellion führte?
Jetzt wurde ihr klar, was ihr Traum von dem Wolf bedeutete: Sie sollte nach Germanien aufbrechen, den Rhein hinauf.
Als Ulrika noch jünger war und alles verschlang, was sie über das Volk ihres Vaters zu lesen bekam, hatte ihr die Mutter bei einem der besten römischen Händler mit Papyri die neueste Landkarte von Germanien besorgt. Gemeinsam hatten Mutter und Tochter die topographischen Gegebenheiten studiert. Gestützt auf Wulfs Beschreibungen seiner Heimat bis hin zu Details wie der Biegung eines Nebenflusses, der in den Rhein mündet, war es ihnen gelungen, die Gegend zu bestimmen, in der sein Stammesverband lebte. Wulf zufolge war seine Mutter dort die Hüterin einer heiligen Stätte aus alter Zeit.
Selene hatte die Stelle mit Tinte gekennzeichnet: den heiligen Hain der Göttin der rotgoldenen Tränen. »Es heißt«, hatte sie ihrer Tochter erklärt, »dass Freia ihren Ehemann so sehr liebte, dass sie jedes Mal, wenn er zu einer langen Reise aufbrach, rotgoldene Tränen weinte.«
Ulrika eilte zu der Mahagonitruhe am Fuße ihres Bettes, kniete sich davor, stemmte den schweren Deckel hoch und suchte dann so lange zwischen Leinen und Kinderkleidern und kostbaren Erinnerungen an ein Leben auf der Wanderschaft herum, bis sie auf jene Karte stieß und sie mit zitternden Händen entrollte. Da war sie, die markierte Stelle, wo Wulfs Stamm lebte.
Sie presste die Karte an sich, und mit einem Mal erfüllten sie neuer Mut und die Gewissheit, ein neues Ziel vor Augen zu haben. Aber die Zeit drängte! Gaius Vatinius war bereits im Begriff, seine Legionen zusammenzustellen. Schon morgen würden sie zum Marsch nach Norden aufbrechen.
Sie griff nach ihrem Umhang. Ich muss Mutter Bescheid sagen. Ich muss mich für mein selbstsüchtiges Verhalten und meine Respektlosigkeit entschuldigen und sie dann bitten, mir bei der Planung meiner Reise zu helfen.
Aber die Räume der Mutter waren dunkel. Da Selene tagsüber unermüdlich damit beschäftigt war, anderen zu helfen, wollte Ulrika sie nicht wecken.
Sie verschob ihr Vorhaben auf den frühen Morgen.
6
Ulrika wurde von ihren Sklaven geweckt, die ihr das Frühstück und heißes Wasser für ein Bad brachten. Wichtiger jedoch war ihr, sich bei ihrer Mutter zu entschuldigen und sie in ihr Vorhaben einzuweihen.
Ich werde Geld benötigen, sagte sie sich und ging auf die verschlossene Tür zu. Ich werde nur ein paar Sklaven mitnehmen, um rascher voranzukommen. Mutter wird mir sagen, welche Route die beste ist und auch die schnellste. Gaius Vatinius bricht heute mit einer Legion von sechzig Hundertschaften auf – sechstausend Mann. Ich muss Germanien noch vor ihnen erreichen, ich muss das versteckte Lager meines Vaters ausfindig machen und seine Leute warnen …
»Tut mir leid, junge Herrin«, sagte Erasmus, der alte Majordomus, als er die Tür zu Selenes Schlafzimmer öffnete. »Deine Mutter ist nicht hier. Sie wurde vor Tagesanbruch zu einem Notfall gerufen. Eine schwierige Geburt … Gut möglich, dass sie zwei Tage fortbleibt.«
Zwei Tage! Ulrika rang die Hände. Sie durfte nicht einen Tag länger warten.
»Weißt du, wohin sie gegangen ist? Zu wem?«
Aber der alte Mann hatte keine Ahnung, zu wem seine Herrin gerufen worden war.
Ulrika überlegte. Rom war riesengroß, die Einwohnerzahl immens. Ihre Mutter mochte sich irgendwo in dem unendlichen Gewirr von Straßen und Gassen aufhalten.
Sie ging wieder zurück in ihr Zimmer, überlegte hin und her und änderte dann ihren Plan. Ich werde es allein versuchen, beschloss sie. Mutter wird Verständnis dafür haben. Wie oft schon haben wir im Schutze der Nacht Hals über Kopf eine Stadt oder ein Dorf verlassen? Wie oft schon waren wir unterwegs, um Mutters Bestimmung zu folgen?
Sie zog einen leeren Bogen Papyrus aus ihrem Schreibtisch, befeuchtete die trockene Tinte, machte sie mit der Spitze einer Rohrfeder geschmeidig und schrieb nach kurzem Nachdenken: »Geliebte Mutter, ich verlasse Rom. Ich glaube, dass mein Vater noch am Leben ist, deshalb muss ich ihn vor Gaius Vatinius’ Vorhaben warnen, seine Krieger in einen Hinterhalt zu locken. Ich möchte ihm im Kampf beistehen. Und ich möchte alles über sein Volk erfahren. Über mein Volk.«
Sie hielt inne und lauschte darauf, wie das Haus langsam erwachte. Sklaven begannen ihre Arbeit, Rufe erschallten, die brüchige Stimme des alten Erasmus krächzte Befehle. Die Stoffbahnen vor dem Fenster bauschten sich in der Frühlingsbrise. Ein Schauer freudiger Erregung überlief Ulrika. Dies war der Aufbruch, nach dem sie sich gesehnt hatte, ohne zu wissen, wie er aussehen könnte. Keine ziellos verschwendeten Tage mehr, keine pflichtschuldigen Heiratspläne, die sie nur langweilten. Nichts konnte sie von ihrem Unternehmen abhalten.
Sie dachte an die Menschen, die sie in diesen geheimnisvollen Wäldern kennenlernen würde, von denen sie so oft geträumt hatte. Und verwundert begriff sie, dass es noch einen weiteren Grund gab, so schnell wie möglich in die Heimat ihres Vaters aufzubrechen – jene Visionen und Träume und Ahnungen, die sie in ihrer Kindheit so verschreckt hatten, diese seltsame Krankheit, die anscheinend jetzt zurückgekehrt war. Möglicherweise war ihr deshalb in der Nacht zuvor der Wolf erschienen, möglicherweise fand sie eine Erklärung für diese Krankheit – und sogar Heilung – bei dem kriegerischen Volk ihres Vaters, in den nebelumhüllten Wäldern im hohen Norden.
»Neunzehn Jahre lang hatte ich keinen Vater«, schrieb Ulrika weiter, »diese verlorene Zeit möchte ich wiedergutmachen. Und ich möchte dem Mann, der mir das Leben geschenkt hat, etwas zurückgeben. Ich liebe dich, Mutter. Du hast mich beschützt, als ich noch keine Federn hatte und mein Nest gefährdet war. Du nanntest mich ein Geschenk der Göttin, das Wunderkind, das in deinem einsamen Exil zu dir kam, und deshalb warst du dir auch bewusst, dass ich dir niemals ganz gehören, dass die Göttin mich eines Tages zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe rufen würde. Dieser Ruf scheint mich jetzt zu ereilen. Ich glaube, ich werde bald herausfinden, wohin ich gehöre, und dann wird mir auch bewusst werden, wer ich bin.
Liebste Mutter, ich werde dich immer lieben und ehren, und ich bete, dass wir eines Tages wieder zusammen sein werden. Ich werde dich in meinem Herzen bewahren, Mutter, wohin mein Weg mich auch führen mag, welches Schicksal auch immer mir beschieden ist.«
Um die Tinte zu trocknen, streute sie Sand darüber, und als sie den Bogen zusammenrollte und mit rotem Wachs versiegelte, tropfte eine Träne auf das Schriftstück. Sie verschwamm zu einem Klecks, der Ähnlichkeit mit einem Stern aufwies.
Im Atrium traf sie auf Erasmus, der das Säubern der marmornen Vogeltränken beaufsichtigte. Nur bei ihm wusste Ulrika den Brief für die Mutter in sicheren Händen. Mit einem »Gewiss doch, junge Herrin« senkte Erasmus den kahlen Schädel und ließ die Schriftrolle in einer der vielen geheimen Taschen seines farbenprächtigen Gewandes verschwinden. »Sobald die Herrin zurück ist, werde ich ihr das Schreiben aushändigen.«
Tausend Gedanken umkreisten Ulrika, als sie sich mit gebotener Umsicht ans Packen machte. Wie sollte sie in den so weit entfernten Norden gelangen? Colonia lag fast am Rande der Welt. Sollte sie Sklaven mitnehmen oder sich allein auf den Weg machen? Einen Augenblick lang erwog sie, Tante Paulina um Rat zu fragen oder ihren Stiefvater oder ihre beste Freundin, verwarf diese Gedanken aber gleich wieder. Sie alle würden doch nur versuchen, sie von ihrem Vorhaben abzubringen.
Sie packte die einfachsten Gewänder ein, die sie besaß, außerdem ein zusätzliches Paar Sandalen, Geld, einen weiteren Umhang. Der Medikamententruhe ihrer Mutter entnahm sie kleine Gefäße mit Arzneien, mit Kräutern gefüllte Beutelchen, Brotschimmel, Bandagen, ein Skalpell und Faden zum Vernähen von Wunden.
Ohne sich zu verabschieden, verließ sie die Villa und machte sich auf den Weg zum Forum, wo sie auf dem Markt Proviant sowie einen ledernen Wasserschlauch erstand. Dann folgte sie eiligen Schritts der Hauptstraße, die durch die Stadtmauer hinaus nach Norden, auf freies Gelände führte, nicht ohne den Schutz der Göttin anzuflehen und die Große Mutter zu bitten, ihr die Kraft zu schenken, der einzigen Familie, der einzigen Welt, die sie je gekannt hatte, den Rücken zu kehren – und sich mutig und beherzt einem unbekannten Schicksal zu stellen.
7
Ungeduldig auf und ab gehend, wartete Sebastianus Gallus darauf, was ihm sein persönlicher Sterndeuter zu vermelden hatte. Sie mussten unbedingt heute von Rom aus aufbrechen.
Der Anführer der wohlausgestatteten Karawane, ein junger Mann mit breiten Schultern, bronzefarbenem Haar und gestutztem Bart, hielt vor seinem Zelt inne und musterte seinen alten Freund.
Der beleibte Grieche hockte in der Morgensonne an einem niedrigen Tisch. Die Gerätschaften für seine astrologischen Deutungen in den Händen, beugte er sich über Aufzeichnungen und Sternenkarten. Solange Sebastianus denken konnte, diente Timonides der Gallus-Familie; der erfolgreiche Händler unternahm nichts, ohne vorher den Astrologen zu befragen. An diesem Morgen stimmte jedoch irgendetwas nicht mit ihm. Deshalb machte sich Sebastianus Sorgen.
Timonides genoss für sein Leben gern gutes Essen und war noch keinen Tag lang krank gewesen war. Neuerdings litt er jedoch an einem Übel, das leider auch seine Fähigkeit beeinträchtigte, genaue Horoskope zu erstellen. Sebastianus hatte den alten Timonides zu den besten Ärzten Roms geschleppt, aber alle hatten den Kopf geschüttelt und gesagt, sie könnten nicht helfen, Timonides müsse sich für den Rest seines Lebens mit seinen Schmerzen abfinden.
Während er weiterhin darauf wartete, dass sich der bedauernswerte Timonides mit qualvoll verzerrtem Gesicht zum täglichen Horoskop aufraffte, spielte Sebastianus mit dem breiten goldenen Reif um seinen rechten Arm und spähte durch die Schwaden der unzähligen morgendlichen Lagerfeuer auf der Via Flaminia, dem außerhalb der Stadt gelegenen Sammelpunkt der Handelszüge.
An diesem Treffpunkt im Norden Roms, an dem Sebastianus Gallus inmitten einer Ansammlung von Zelten, Arbeitern und Bergen von Ware gegenwärtig lagerte, herrschte emsiges Treiben. Händler aus allen Ecken der Welt fanden sich hier ein, ob mit Waren aus fernen Ländern oder im Begriff, Vorbereitungen für den Aufbruch dorthin zu treffen. Die Karawane des jungen Gallus, die aus Kutschen, Fuhrwerken, Pferden, Maultieren und Sklaven bestand, sollte eigentlich längst nach Germania Inferior unterwegs sein, zu den nördlichen Ausläufern des Rheins, wo man auf Nachschub von Wein aus Spanien wartete, auf Getreide aus Ägypten, Stoffe aus Italien und ausgesuchte Luxusartikel, die Sebastianus von Kaufleuten aus Ägypten, Afrika und Indien übernommen hatte.
Der Aufbruch hätte bereits vor zwei Tagen erfolgen sollen. Sebastianus jedoch scheute sich, das Lager zu verlassen, ehe Timonides nicht die Zustimmung der Sterne signalisierte. Der junge Mann war felsenfest davon überzeugt, dass die Götter ihre Botschaften durch die Gestirne vermittelten und dass man nur die Sterne, die Planeten, den Mond und die Kometen zu beobachten brauche, um aus ihnen den ihm vorbestimmten Weg abzulesen. Weil er aber nicht mit der mysteriösen Krankheit gerechnet hatte, die seinen Sternkundigen niederwarf, blieb Gallus nichts anderes übrig, als tatenlos zuzusehen, wie andere Kaufleute und Händler ihre Männern anwiesen, die Zelte ab- und nach Norden, Osten oder Westen aufzubrechen.
»Hierher, junge Frau! Der Mann da wird dich übers Ohr hauen! Ich dagegen bin eine ehrliche Haut. Ich bringe dich zu deinem Ziel, wo immer du hinwillst!«
Sebastianus wandte sich in Richtung der prahlerisch vorgebrachten Worte und machte Hashim al Adnan aus, einen dunkelhäutigen Araber, der ein kleines Vermögen mit ägyptischem Papyrus verdiente, den er an Schreiber und Schriftrollenhersteller im Norden lieferte. Er hielt sich unter dem gestreiften Vordach seines eigenen Zelts auf und schien zu versuchen, einem anderen Karawanenführer, einem dickwanstigen Syrer namens Kaptah der Neunte (gemäß seinem Status als neuntes von fünfzehn Kindern), einen Kunden abspenstig zu machen. Um Kaptah herum standen Amphoren mit Olivenöl, die zu Siedlungen im gebirgigen Norden transportiert werden sollten. Er machte eine Drohgebärde in Richtung Hashim und wandte sich dann der möglichen Kundin zu. »Dieser Mann da ist ein Mistkerl. Er wird dich ausrauben und in den Bergen aussetzen, auf dass dir die Raben die Augen aushacken. Ich bin der Ehrlichste weit und breit. Hör dich ruhig mal um.«
Handelskarawanen nahmen unabhängig Reisende mit, sofern sie gut bezahlten und für ihre eigenen Bedürfnisse aufkamen. Sich in den Schutz großer Handelszüge zu begeben war das Sicherste, ob für eine Geschäftsreise, einen Besuch bei Verwandten oder Ähnliches. Selbst Sebastianus hatte heute Morgen einer kleinen Gruppe die Mitreise gestattet, mehreren Brüdern, die zu einer Hochzeitsfeier nach Massilia wollten. Sie verfügten über eine eigene Kutsche und zahlten gut für den sicheren Geleitschutz.
Sebastianus nahm die Gestalt, um deren Aufmerksamkeit der Araber und der Syrer wetteiferten, näher in Augenschein. Ihrem schlanken Körper und ihrer Haltung nach musste sie jung sein. Und dem kostbaren Stoff ihres Gewandes nach zu schließen sowie der Palla, die ihren Kopf bedeckte, wohlhabend. Allerdings waren weder persönliche Sklaven noch Leibwächter als Begleitung zu entdecken. Noch merkwürdiger schien, dass sie mehrere Bündel geschultert hatte, dazu einen Wasserschlauch und eine Tasche mit Proviant. Eine junge Frau allein unterwegs? Bestimmt wollte sie nicht weit reisen, in die nächste Ortschaft vielleicht.
Während die beiden Händler weiterhin um ihre Aufmerksamkeit wetteiferten, schweiften Sebastianus’ Gedanken wieder zu seinen Sorgen: Er musste wirklich dringend aufbrechen. Seine Eile hatte nichts mit seinen üblichen Geschäften entlang des Rheins zu tun. Nein, Sebastianus Gallus hatte ein ehrgeiziges Ziel: Er wollte als Erster bis an die Enden der Welt vordringen, wo Gerüchten zufolge Schiffe über den Erdenrand segelten und Pferde auf Nimmerwiedersehen in eisige Nebelschwaden galoppierten.
Sebastianus befand sich in einem Wettstreit um das begehrte Kaiserliche Diplom, das dem Gewinner den Auftrag einbrachte, eine Karawane ins ferne China zu führen. An diesem lärmenden, sonnigen Frühlingsmorgen bedrückte ihn der Gedanke, dass er gegen vier weitere Händler antrat, die er als fähig, zuverlässig und anständig erachtete und die die China-Route ebenso verdienten wie er. Aber Kaiser Claudius würde das Diplom nur an einen vergeben.
Jeder Bewerber sollte seine angestammte Handelsroute absolvieren, sich dabei aber durch eine besondere Leistung hervortun. Eine solche Leistung, das wusste Sebastianus, würden seine vier Mitstreiter in Claudius’ Augen zweifellos erbringen. Badru der Ägypter war nach Afrika aufgebrochen, wo er billige Kleidung und kleine Schmuckstücke gegen Schildkrötenpanzer und Elfenbein einzutauschen gedachte; außerdem bot sich Badru die Gelegenheit, ein seltenes Tier für Roms Arena mitzubringen. Sahir der Hindu befand sich auf dem Weg nach Südosten, um Parfüm und Weihrauch zu erwerben, und höchstwahrscheinlich stieß er dort auf das eine oder andere kostbare Buch für den Kaiser. Adon der Phönizier wiederum hatte sich mit einer Ladung Pfeffer und Nelken nach Spanien aufgemacht, von wo er zweifellos mit edelsten Weinen, wie Claudius sie schätzte, zurückkehren würde. Gaspar der Perser schließlich, dessen Handelsroute ihn ins Zagros-Gebirge führte, würde bestimmt eine seltene Blume aufstöbern, die der Legende nach ein wirkungsvolles Aphrodisiakum enthielt (es war bekannt, wie sehr Claudius daran gelegen war, sich seiner jungen Frau Agrippina gegenüber als guter Liebhaber zu beweisen). Sebastianus Gallus der Spanier hingegen zog wie üblich nach Norden, um Bernstein, Zinn, Salz und Pelze einzutauschen. Womit aus dem Rheinland könnte er schon die Aufmerksamkeit von Kaiser Claudius erregen und ihn dazu bringen, ihm, Gallus, das begehrte Diplom zuzusprechen?
Was ihm zudem Sorgen bereitete, war das Gerücht, dass römische Legionen unter dem Kommando von Gaius Vatinius gen Norden marschierten, um mit aller Härte gegen aufständische Barbaren vorzugehen. Krieg konnte zwar gut fürs Geschäft sein, in diesem Fall aber Sebastianus’ Chancen auf den Gewinn des Diploms schmälern.
Ungeduldig blickte er hinüber zu Timonides, der sich redlich, aber vergeblich bemühte, einen kupfernen Winkelmesser auf einer Karte, auf der die Tierkreise abgebildet waren, zu positionieren. Ob es vielleicht besser wäre, einen anderen Astrologen hinzuzuziehen? Sebastianus rann die Zeit durch die Finger!
Er wollte sich doch unbedingt einen Namen machen. Sein Vater, sein Großvater und weitere Verwandte hatten ausnahmslos neue Handelswege erschlossen, hatten sich ausgezeichnet und das Ansehen der bereits bekannten und geachteten Gallus-Familie gemehrt. Jetzt drängte es Sebastianus, sich dadurch zu beweisen, dass er die Route nach China für Kaiser Claudius eröffnete, die letzte unbekannte Grenze überschritt, die letzte Gelegenheit wahrnahm, einen neuen Handelsweg zu erschließen. Damit könnte er eben auch den Ruhm ernten, als erster Mann aus dem Westen bis zum Palast des Kaisers von China vorgedrungen zu sein.
»Ich nehme dich bis Colonia mit! Dieser Mann da zieht nicht weiter als bis Lugdunum, dort wird er dich dir selbst überlassen! Ich habe eine schöne Kutsche mit nur drei weiteren Mitfahrern.«
Als er Hashims Versprechungen hörte, wandte sich Sebastianus überrascht um. Die junge Frau wollte bis ins ferne Colonia?
Er sah, wie Kaptah eifrig mit seinem Abakus hantierte, einer tragbaren Rechenmaschine aus Kupfer und Perlen, wie sie von Kaufleuten, Bauleitern, Bankiers und Steuereintreibern benutzt wurde. Der gedrungene Syrer kalkulierte den Fahrpreis der jungen Frau nach Meilen und Verpflegung, addierte zusätzliche Kosten für Wasser, für die Bereitstellung eines Esels, sogar für einen Platz am nächtlichen Lagerfeuer.
»Geldschneiderei!«, brüllte Hashim, und sein dunkelhäutiges Gesicht lief tiefrot an. »Werte junge Frau, bei mir musst du nicht auf einem Esel reiten, sondern kannst für ein wenig mehr Geld auf einem Wagen mitfahren.«
Die junge Frau schaute unentschlossen von einem zum andern, und als die beiden Karawanenführer sahen, dass sie sich nach rechts wandte und einen Blick auf die Reihen der Zelte und umfriedeten Lager warf, die unter einer verstaubten Tafel mit der Aufschrift GERMANIA INFERIOR versammelt waren, krakeelten beide gleichzeitig los, behaupteten, dass alle anderen nach Norden ziehenden Händler ihr nur das letzte Geld abknöpfen und sie dann als Sklavin an die Barbaren verkaufen würden.
Da Gallus die beiden Kerle oft genug als skrupellose Halsabschneider erlebt hatte und nicht wollte, dass das Mädchen ihnen schutzlos ausgesetzt war, mischte er sich ein. »Brüder!«, rief er betont jovial und ging auf sie zu. »Ich stelle nicht zum ersten Mal fest, dass ihr alle beide, je lauter ihr herumbrüllt, desto unverschämtere Lügen auftischt.«
Er wandte sich an die junge Frau, und unwillkürlich verschlug es ihm die Sprache. Unter ihrem Schleier, von dem sie sich einen Zipfel sittsam ans Kinn drückte, da man römischen Mädchen beibrachte, niemals das ganze Gesicht zu verdecken, aber gegebenenfalls bereit dazu zu sein, machte er lichtbraunes Haar und blaue Augen aus. Sebastianus starrte in das ovale Gesicht mit dem reizenden, spitz zulaufenden Kinn, den geschwungenen Brauen, der schmalen Nase. Am faszinierendsten jedoch fand er ihre Augen.
Einen Moment lang war er nicht in der Lage, auch nur ein Wort herauszubringen. Augen wie die Farbe der Lagune in der berühmten Blauen Grotte auf Capri, die er einmal besucht hatte!
»Diesen Männern kannst du nicht trauen«, sagte er dann lächelnd und bedachte die beiden Händler, die zu lautem Protest anheben wollten, mit einem warnenden Blick. »Schurken sind das – zwar liebenswert, aber dennoch Schurken. Wenn es dir recht ist, helfe ich dir bei der Suche nach einem zuverlässigen Händler, der dafür sorgt, dass du sicher dein Ziel erreichst. Wohin willst du denn?«, fragte er sicherheitshalber, weil er meinte, sich verhört zu haben.
»Nach Colonia«, wiederholte sie. Entschlossen und nachdrücklich. Sebastianus hielt Ausschau nach ihren Begleitern. Vielleicht trafen sie ja erst später ein, wahrscheinlich sogar, weil sie so viel Gepäck für die anscheinend wohlhabende junge Frau zu schleppen hatten.
»Wie viele kommen mit dir mit?«
Ulrika blickte auf zu dem Fremden, der ihr zu Hilfe gekommen war. Er überragte sie um Haupteslänge, die Morgensonne ließ seine Haarspitzen bronzefarben aufblitzen. Er hatte markante Wangenknochen, eine schmale, gerade Nase, und sein Bart war so kurz gestutzt, dass er sich kaum mehr als ein Schatten auf seinem Kinn abzeichnete. Ulrika vermutete, dass er kein Römer war; er sprach Lateinisch mit einem leichten Akzent, so als sei dies nicht seine Muttersprache. Jetzt bemerkte sie die handtellergroße Muschel, die, an einer Lederschnur befestigt, in Brusthöhe seiner weißen Leinentunika hing. Sie erkannte sie als Kammmuschel, von denen es, wie sie wusste, jede Menge entlang der Küste im Nordwesten Spaniens gab. Wie sie gehört hatte, trugen die Galicier solche Muscheln zum Gedenken an ihr Zuhause und zum Zeichen, dass sie stolz auf ihr Volk und ihre Kultur waren.
Rätselhaft kam ihr dieser Spanier dennoch vor. Seine Stirn war bereits von Falten durchzogen, so als beschäftigte ihn seit langem ein Problem, für das sich noch immer keine Lösung abzeichnete. Kein Mann, der im Frieden mit sich selbst oder mit der Welt lebte, befand sie. Eindrücke stürmten auf sie ein: Obwohl er immer wieder lächelte, schien er verärgert zu sein, aber auf wen oder worüber war nicht zu ergründen; sein Blick wirkte offen, aber gleichzeitig dennoch vorsichtig-abwartend; und trotz seines ungezwungenen Auftretens schien er sich innerlich an der Kandare zu halten, so als befürchtete er, die Kontrolle zu verlieren. Hatte etwas – oder jemand – ihn vor langer Zeit gekränkt?
»Ich reise allein«, gab sie Auskunft und wich einen Schritt zurück, um auf Abstand zu diesem Mann zu gehen. Als sie heute Morgen ihr Zuhause verlassen hatte, entschlossen, sich auf den Weg ins Rheinland zu begeben, hatte sie nicht damit gerechnet, wie schwierig es sein würde, von einer Karawane mitgenommen zu werden. Wem konnte sie vertrauen?
»Du willst ganz allein nach Colonia?«, fragte der Galicier überrascht. »Ist eine nicht ungefährliche Gegend, als junges Mädchen da allein hinzureisen.«
Sie schaute ihm in die Augen. Hatte sie jemals Augen mit einer derart grünen Iris gesehen? »Ich habe dort Verwandte.«
Seine Stirnfalten vertieften sich. »Trotzdem ist es gefährlich«, sagte er, »für ein junges Mädchen, das allein unterwegs ist …«
»Unterwegs zu sein ist nichts Neues für mich. Ich bin in Persien geboren, und seit meinem dritten Lebensjahr ziehe ich in der Welt herum. Ich war in Jerusalem und Alexandria. Ich habe sogar das mare nostrum auf einem Schiff überquert.«
»Mag ja sein«, entgegnete er, »trotzdem wird man in dir nur die schutzlose Frau sehen. Du solltest eine Familie ausfindig machen, die nach Norden zieht und einverstanden ist, dass du dich ihr anschließt, oder aber eine Gruppe von mehreren Frauen. Leider besteht meine eigene Karawane ausschließlich aus Männern, da kann ich nicht ununterbrochen die Verantwortung für deine Sicherheit übernehmen.« Er lächelte. »Mein Name ist Sebastianus Gallus. Ich werde dir helfen, einen verlässlichen Führer zu finden, der dich nach Colonia bringt. Ich kenne fast jeden im Karawanengewerbe, ob Ehrenmann oder Gauner.«
»Ich bin Ulrika, und ich danke dir für dein freundliches Angebot.«
Als Hashim und Kaptah, die neugierig das Gespräch belauscht hatten, sich darüber aufregen wollten, dass Sebastianus drauf und dran war, ihnen ihre Kundin wegzuschnappen, brachte er sie mit einem strengen Blick zum Verstummen. Dann machte er sich mit der jungen Frau auf den Weg, außer Reichweite der beiden Händler, die sich jetzt gegenseitig beschuldigten, ein einträgliches Zubrot vermasselt zu haben. Ein letzter Blick galt seinem Lager, in dem sich Timonides, der Sterndeuter, noch immer den Kopf hielt und wimmerte.
Auch Ulrika sah den Fettwanst mit dem weißen Haarkranz um den kahlen Schädel. »Was fehlt ihm denn?«, fragte sie.
»Das wissen wir nicht. Er ist mein Astrologe, aber im Moment scheint er nicht in der Lage zu sein, ein Horoskop zu erstellen.«
Ulrika kämpfte mit sich. Sie hatte es eilig, in den Norden aufzubrechen, aber der beleibte Mann litt zweifellos Qualen. »Vielleicht kann ich helfen.«
Die Sternenkarten verschwammen vor seinem getrübten Blick. Timonides war zum Heulen zumute. Noch nie war er derart verzweifelt gewesen, derart deprimiert. Die Sterne waren sein Leben, seine Seele, und die Botschaften, die sie übermittelten, bedeuteten ihm mehr als sein eigener Atem. Er hatte ihnen und der Deutung der darin enthaltenen Geheimnisse sein Leben untergeordnet – und jetzt, Himmel nochmal!, vermochte er nicht einmal Kassiopeia vom Löwen zu unterscheiden!
In der vergeblichen Hoffnung, den Schmerzen Einhalt zu gebieten, hob er den Kopf und sah seinen Meister, offensichtlich in Begleitung einer jungen Frau, auf sich zukommen.
Einen Augenblick lang vergaß Timonides tatsächlich seine Schmerzen und beobachtete, wie Sebastianus der jungen Frau das Gepäck samt Wasserschlauch und Proviant abnahm und sich selbst auflud, so dass sie ungehindert und sittsam ihren Schleier an das Gesicht drücken konnte – eine den Römerinnen eigene Geschicklichkeitsübung, über die Timonides immer wieder staunte.
Ein merkwürdiges Mädchen, befand er, als die beiden näherkamen. Dem Faltenwurf, der Farbe ihres Gewandes und der Palla nach zu schließen war sie eine Patrizierin, und doch hatte sie ihr Gepäck bislang selbst getragen. Zweifellos hatte sie vor, Verwandte zu besuchen, vielleicht einer werdenden Mutter beizustehen – Anlässe, weswegen Frauen vornehmlich Reisen unternahmen. Zu seiner Überraschung ging sie, ohne zu zögern, auf ihn zu.
»Sind es Zahnschmerzen, die dir zu schaffen machen?«
Timonides schaute in himmelblaue Augen, umrahmt von hellbraunem Haar. Beim Zeus, wo hatte sein Meister nur dieses Mädchen entdeckt! »Von den mir verbliebenen Zähnen, junge Frau«, sagte er, »macht mir, den Göttern sei Dank, keiner Kummer. Was mir Qualen bereitet, ist meine Kinnlade.«
»Mein Name ist Ulrika«, sagte sie freundlich, »darf ich mal sehen?« Ungeniert setzte sie sich ihm gegenüber, streckte die Hand aus und tastete mit den Fingerspitzen unendlich sanft sein Kinn und den Hals ab. »Nimmt der Schmerz zu, wenn du etwas isst?«
»So ist es«, sagte er niedergeschlagen. Timonides war nicht umsonst so dick. Astrologie war das Zentrum seines spirituellen und religiösen Lebens, Essen dagegen der Mittelpunkt seiner menschlichen Existenz. Er aß für sein Leben gern. Vom Frühstück am Morgen, wo er Weizenfladen und Honig verspeiste, bis zum Abendessen aus gebratenem Schweinefleisch mit Pilzen bestand sein Tag daraus, unablässig zu kauen und zu schlucken und sich den Wanst vollzuschlagen. Wenn er zwischendurch eine Pause einlegte, schwelgte er in Erinnerungen an seine letzte Mahlzeit und freute sich auf die nächste. Eher hätte er auf Frauen verzichtet, als seine Essgewohnheiten eingeschränkt. Aber jetzt bekam er keinen Bissen hinunter! War das Leben überhaupt noch etwas wert?
»Ich glaube, ich kann dir helfen«, sagte die junge Frau leise, aber bestimmt.
»Das bezweifle ich«, schluchzte er auf. »Mein Meister hat mich in der Stadt zu einem Arzt gebracht, der hat meinen Hals und das Kinn mit einem heißen Senfbrei eingeschmiert. Einen Ausschlag hab ich davon bekommen, wie Feuer hat das gebrannt! Der zweite Arzt verschrieb Mohnwein, damit hab ich nur noch geschlafen. Der dritte zog mir sämtliche Backenzähne. Keine weiteren Ärzte!«
Er war misstrauisch, als sie weiterhin an ihm herumtastete, auch wenn er zugeben musste, dass sie zartfühlend zu Werke ging, ganz anders als die Ärzte, die ihm rücksichtslos den Mund so weit aufgerissen hatten, dass er schon befürchtete, sie würden ihm den Kiefer ausrenken.
Als sie eine empfindliche Stelle unterhalb seiner Kinnlade berührte und er prompt aufjaulte, nickte sie wie zur Bestätigung und bat Sebastianus, Timonides etwas Süßes oder Saures zu essen zu bringen. Der Spanier verschwand in einem Zelt und kam mit einer kleinen gelben Frucht zurück, die Ulrika als eine aus Indien importierte und dementsprechend teuer gehandelte Zitrone erkannte. Statt sie zu schälen, schob sie sie im Ganzen dem alten Griechen in den Mund und sagte: »Beiß da fest drauf.«
Timonides tat wie befohlen, wenn auch unter heftigem Protest – wusste dieses Mädchen nicht, dass Zitronen eine Medizin und nichts zu essen waren! –, und während er Mühe hatte, die saure Frucht nicht auszuspucken, massierte Ulrika die Stelle unterhalb seiner Kinnlade, drückte gnadenlos daran herum.