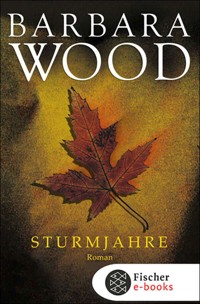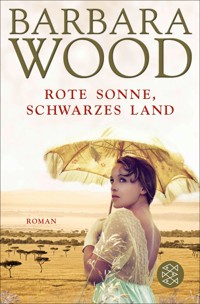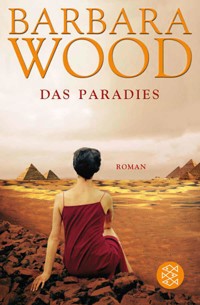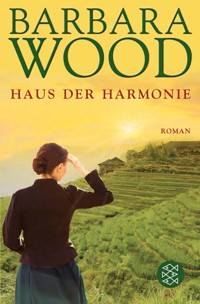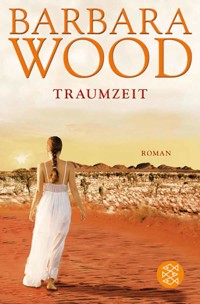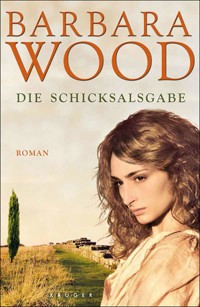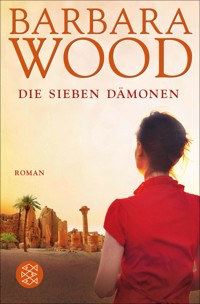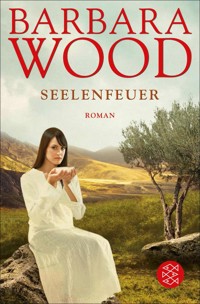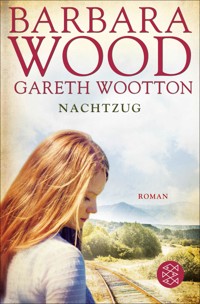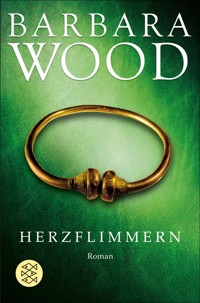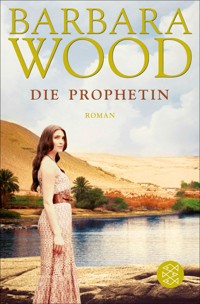
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den letzten Tagen des Jahres 1999 macht die junge Archäologin Catherine Alexander eine sensationelle Entdeckung: alte Schriftrollen aus der Zeit des Christentums, die Prophezeiungen über das Ewige Leben und das Letzte Gericht beinhalten. Hoch brisant darin ist ein Bericht über die ausgeprägt weibliche Führung der urchristlichen Kirche. Ist die einzigartige Stellung des Papstes und der männlichen Priesterschaft also anzuzweifeln? Ein erbitterter Kampf zwischen dem Vatikan, den Medien und skrupellosen Sammlern beginnt – und Catherine muss um ihr Leben fürchten. Der große Jahrtausendwende-Roman über die ursprüngliche Stellung der Frau in der katholischen Kirche. Von der Bestsellerautorin Barabra Wood
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 786
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Barbara Wood
Die Prophetin
Roman
Über dieses Buch
Der große Jahrtausendwende-Roman von Barbara Wood. Im Jahre 1999 entdeckt die junge Archäologin Catherine Alexander Schriftrollen aus der Zeit des frühen Christentums. Auf der ganzen Welt steigt das »Jahrtausendfieber«. Die Menschen stürzen sich auf die Aussagen und Prophezeiungen der Schriftrollen über das ewige Leben und das Letzte Gericht. Aus ganz anderen Gründen hat der Vatikan die Brisanz dieser Schriftrollen erkannt: Die Texte geben Grund für erhebliche Zweifel an der Stellung des Papstes und der ausschließlich männlichen Priesterschaft. Mit der Jagd von Catherine auf die letzte noch fehlende Schriftrolle beginnt gleichfalls die Jagd auf sie und ihren Beschützer Pater Michael Garibaldi.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Für Carlos
Prolog
In der Wüste Sinai
Der erste Tag
Scharm el Scheich, Golf von Akkaba
Santa Fe, New Mexico
Scharm el Scheich, Golf von Akkaba
Mexiko
Scharm el Scheich, Golf von Akkaba
Mexiko
Scharm el Scheich, Golf von Akkaba
Santa Fe, New Mexico
Der zweite Tag
Scharm el Scheich, Golf von Akkaba
Santa Fe, New Mexico
Scharm el Scheich, Golf von Akkaba
Santa Fe, New Mexico
Der dritte Tag
John F. Kennedy-Airport, New York
Santa Fe, New Mexico
Der vierte Tag
Malibu, Kalifornien
Santa Barbara, Kalifornien
Der Vatikan, Rom
Santa Barbara, Kalifornien
Santa Fe, New Mexico
Santa Ynes-Berge, Kalifornien
Santa Fe, New Mexico
Der fünfte Tag
Santa Ynes-Berge, Kalifornien
Santa Monica, Kalifornien
Albuquerque, New Mexico
Sacramento, Kalifornien
Der sechste Tag
Sacramento, Kalifornien
Fresno, Kalifornien
Freers Institut, West Los Angeles
Der Vatikan, Rom
Goshen, Kalifornien
Santa Fe, New Mexico
Goshen, Kalifornien
Santa Fe, New Mexico
Sacramento, Kalifornien
Santa Fe, New Mexico
Der siebte Tag
Goshen, Kalifornien
West Los Angeles
Über dem Pazifik
Mojave-Wüste, Kalifornien
Der achte Tag
Las Vegas, Nevada
West Los Angeles, Kalifornien
Santa Fe, New Mexico
Las Vegas, Nevada
Der neunte Tag
Las Vegas, Nevada
Las Vegas, Nevada
Santa Fe, New Mexico
Der zehnte Tag
Las Vegas, Nevada
Malibu, Kalifornien
Washington, D.C.
Las Vegas, Nevada
Der elfte Tag
Santa Fe, New Mexico
Washington, D.C.
Der Vatikan, Rom
Washington, D.C.
Der zwölfte Tag
Washington, D.C.
Malibu, Kalifornien
Washington, D.C.
Der dreizehnte Tag
Santa Fe, New Mexico
Washington, D.C.
Santa Fe, New Mexico
Washington, D.C.
Santa Fe, New Mexico
Washington, D.C.
Der vierzehnte Tag
Greensville, Vermont
Der fünfzehnte Tag
Santa Fe, New Mexico
Kloster Greensville, Vermont
Der sechzehnte Tag
Detmold, Deutschland
Santa Fe, New Mexico
Der siebzehnte Tag
Aachen, Deutschland
Der letzte Tag
Aachen, Deutschland
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Santa Fe, New Mexico
Der Vatikan, Rom
Das neue Jahrtausend
Santa Monica, Kalifornien
Santa Fe, New Mexico
Kloster Greensville, Vermont
Scharm el-Scheich, Sinai
Vier Monate später
Los Angeles, Kalifornien
Santa Fe, New Mexico
Los Angeles, Kalifornien
Anmerkung der Übersetzer
Für Carlos
»Die Nacht neigt sich dem Ende zu, der Tag ist nahe.
Werft ab die Taten der Finsternis und legt an
die Rüstung des Lichts.«
Aus den Stundengebeten
»Ein Kind wird mit dem Glauben geboren.«
Kathryn Lindskoog
Information kennt keine Grenzen.
Universales Hacker-Credo
Prolog
In der Wüste Sinai
Der Magus riß der jungen Frau das purpurrote Gewand von den Schultern. Sie saß nackt und gefesselt im silbernen Mondlicht auf dem schweißbedeckten Pferd.
Seinem Gefolge verschlug es den Atem. Die Männer bestaunten schweigend die Schönheit der Frau. Sie glich den Statuen auf dem Markt, denn sie schien ebenso weiß, kühl und vollkommen zu sein. Aber keine Statue hatte wie sie so lange schwarze Haare, die ihr über den Rücken und die entblößten Brüste fielen. Auch das leichte Zittern ließ keinen Zweifel daran aufkommen, daß diese Frau aus Fleisch und Blut war.
Die Fesseln an Händen und Füßen nahmen ihr nichts von ihrer Würde. Einige der Männer wurden unruhig, senkten verlegen die Köpfe.
Der Magus, Herr und Gebieter über die Seelen im Reich, ließ sich von dem Stolz und der Würde seiner Gefangenen nicht beeindrucken. Er hatte mit allen Mitteln versucht, sie zum Sprechen zu bringen. In der Stadt hatte er ihr gedroht, sie bis an ihr Lebensende einzusperren und hungern zu lassen. Er hatte alles versucht, nur ihre Schönheit hatte er nicht angetastet, denn damit hätte er den Kaiser erzürnt.
Doch jetzt befanden sie sich nicht mehr in der Stadt. Er hatte die junge Frau hierher an diese einsame Stelle in der Wüste entführt, um ihr das Geheimnis doch noch zu entreißen. An diesem gespenstischen Ort waren nur Schlangen und Skorpione Zeugen seiner Tat, und der Wüstensand würde jeden Hinweis auf sein Verbrechen unter sich begraben.
Die sechs Reiter waren lange und schnell geritten. Sie hatten die Stadt unbemerkt bei Sonnenuntergang verlassen und waren durch die vom Mond beschienene Einöde galoppiert, als seien Dämonen hinter ihnen her. Die Legionen des Kaisers waren weit entfernt, und niemand folgte ihnen.
Erst als sie die Stelle an der verlassenen Küste erreichten, wo bizarre Felsen in den kalt funkelnden Sternenhimmel ragten, hielten sie an. Der Magus wußte: Hier hausten nur die Geister und Dämonen der Finsternis.
Er hatte in den alten Schriftrollen von dem tiefen Brunnen gelesen, aus dem nach der Überlieferung das Volk Israel während der vierzigjährigen Wanderschaft einst Trinkwasser geschöpft hatte. Der Brunnen war längst versiegt. Nur ein dunkles, tiefes Loch war geblieben.
Auf dem siebten Pferd saß die Gefangene. Die zierliche Stute hatte nach dem langen Ritt blutige Nüstern. Als die Männer den Weidenkorb losbanden und die gefesselte Frau aus dem Sattel hoben, wieherte das Pferd und brach tot zusammen.
Die Männer befestigten den Korb an einem langen Seil, und einer von ihnen murmelte ein Gebet, während sie ihn langsam in die Tiefe ließen. Als der Korb mit einem dumpfen Geräusch den Boden des Brunnens erreichte, führten sie die Frau an den Brunnenrand, wo der Magus stand und sie mit seinen Blicken durchbohrte.
»Ich frage dich noch einmal«, sagte er drohend und stieß mit dem Stab seiner Macht dreimal auf den Boden. »Wo ist die siebte Schriftrolle?«
Die Gefangene gab wieder keine Antwort. Wie in den vergangenen Wochen blieb sie stumm, als habe sie seine Worte nicht gehört. Und diesmal glaubte er, in ihren grünen Augen ein herausforderndes Funkeln zu sehen.
Der Magus zitterte wie die Gefangene, aber nicht vor Kälte, sondern vor kaum unterdrückter Wut.
Er war der letzte in der langen Reihe der Magi und wußte sehr wohl, daß die Tage seiner Macht gezählt waren. Die Klarheit des Wissens um das Unsichtbare, das alles Leben hier auf Erden lenkt, entzog sich ihm immer mehr. Wie sollte er der zuverlässige Ratgeber des Volkes und des Kaisers sein, wenn er die Zauberkräfte seiner Vorfahren nicht mehr besaß, denen die Götter die Macht des Wissens um das Unsichtbare geschenkt hatten? In der siebten Schriftrolle, das hatte der Magus nach dem Lesen der anderen sechs erfahren, stand die Offenbarung des neuen Glaubens. Die siebte Schriftrolle würde ihm den Weg zu den Unsterblichen weisen. Dann wäre seine Macht nicht zu erschüttern, denn dann wäre er es, der das Schicksal lenkte. Wenn er mit Hilfe dieser Frau die siebte Rolle fand, dann konnte er Wunder wirken, Tote zum Leben erwecken und Kranke heilen. Er würde das Ende der Welt aufhalten und als der wahre Herrscher neben dem Kaiser gelten.
Den Schlüssel zu allem, wonach er strebte, besaß diese junge Frau. Nur mit dem geheimen Wissen der siebten Schriftrolle würden sich die Worte der Verheißung an ihm erfüllen. Dann erhielte er das ewige Leben als Lohn für seine lange Suche.
Die Gefangene kannte das Versteck, aber sie schwieg. Wenn er die Rolle nicht fand, würde er in Ungnade fallen, in Vergessenheit versinken, und alle seine Bemühungen und die seiner Vorgänger wären gescheitert. Er würde den Mächten der Finsternis verfallen, denen er sich geweiht hatte, um das Geheimnis der unsichtbaren Welten zu enträtseln.
Der Magus hatte sich davon überzeugt, daß seine Gefangene schwach und hilflos war. Sie konnte die Macht, die die Worte des Lichts dem Eingeweihten verliehen, nicht nutzen. Im Grunde war ihr Martyrium sinnlos.
Aber ihr beharrliches Schweigen war für ihn so endgültig wie der Tod. Er glaubte sich fast am Ziel seiner Wünsche und konnte doch an ihrer Entschlossenheit nichts ändern.
Sie verachtete ihn, weil er mit den Menschen spielte, als seien sie nichts als Puppen. Sie mißtraute ihm, denn er war korrupt und intrigant. Er hatte keine Achtung vor dem Leben, tötete jeden, der ihm mißfiel. Der Magus war ein Sklave des Todes. Sie aber diente dem Licht.
»So sei es!«
Er hob die Hand und befahl den Männern mit einer knappen Geste, ihr frevelhaftes Werk zu tun.
Sie packten die junge Frau mit brutalen, gefühllosen Händen. Aus ihren Blicken sprachen Lüsternheit und Gier, als sie ihr ein Seil über den Oberkörper streiften und unter Armen und Brüsten festzogen, um sie langsam in den Brunnen hinablassen zu können.
»Du wirst nicht verletzt werden und schnell sterben!« rief der Magus mit kalter Stimme. »Du sollst lange in deinem dunklen Gefängnis am Leben bleiben. Du wirst bald jeden Stein, jede Spalte und alles Grauen der Dunkelheit kennen. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, wird die Luft zum Verdursten trocken sein, und in den kalten Nächten wird der Frost dich erstarren lassen. Deine Qualen werden mit jeder Stunde wachsen, bis sie über jedes erträgliche Maß hinausgehen. Deine Einsamkeit wird größer und erschreckender sein als der Tod. Du wirst schreien, aber niemand wird dich hören. Und am Ende wird dein Körper die Beute blutgieriger Wesen werden.«
Er machte einen Schritt auf sie zu und hob den Stab seines Amtes, vor dem in früheren Zeiten das ganze Volk in Ehrfurcht zu Boden gesunken war, dem sich jetzt aber nur noch die wenigen Männer und Frauen seiner Gefolgschaft hier und in der Stadt beugten.
»Ich frage dich zum letzten Mal«, flüsterte er, »wo ist die siebte Schriftrolle? Wenn du es mir sagst, schenke ich dir die Freiheit.« Sie gab keine Antwort.
»Sag mir wenigstens das eine: Hast du die Rolle mit eigenen Augen gesehen?«
Zum ersten Mal, seit er die Frau in seine Gewalt gebracht hatte, öffnete sie den Mund. Es klang fast wie ein Seufzen, als sie antwortete.
»Ja …«
Der Magus zuckte wie unter einem Peitschenhieb zusammen. Er glaubte an die Unsterblichkeit, an das ewige Leben, wie es Osiris geschenkt worden war. Der Leib des Gottes war in Stücke gerissen und über ganz Ägypten verteilt worden. Aber Isis hatte alle Teile gefunden, den zerstückelten Körper wieder zusammengefügt und ihm den Atem des Lebens eingehaucht. Auf diese Weise hatte sie den Geliebten wieder zum Leben erweckt.
In ohnmächtigem Zorn ballte der Magus die Faust und hob sie zum Himmel. »Wenn ich das Geheimnis nicht kennen darf, dann soll es den Sterblichen auf der Erde bis in alle Ewigkeit verborgen bleiben!«
Seine Männer hoben die Frau hoch und ließen sie Stück für Stück in den Brunnen hinab. Die rauhen Steine schürften die makellose zarte Haut, und Blut floß über ihren Rücken. Als ihre Schönheit in der Schwärze des Brunnenschachts verschwand, schlug der Magus mit dem goldenen Stab auf den kalten Stein und rief: »Bei der Macht, die dieser Stab mir verleiht, den mir mein Vater übergab, so wie ihm die Macht von seinem Vater anvertraut wurde und allen, die vor ihm kamen, bis zurück in die Zeit, als die Unsterblichen noch auf der Erde wandelten, verfluche ich diese Frau und die sechs Schriftrollen des neuen Glaubens, die ich hier mit ihr begraben lasse, damit das Geheimnis des Lebens auf immer den Menschen verborgen bleibe. Kein Sterblicher soll sie lesen und das Rätsel der Unsterblichen lösen. Wer diesen Brunnen findet, sei verflucht!«
Ein Reiter erschien unter den zerklüfteten Klippen. Er zügelte sein Pferd weit genug vom Lager der Männer entfernt, daß niemand ihn hörte. Dann saß er ab, schlich sich unbemerkt näher und schnitt mit dem Dolch den Schlafenden so schnell die Kehlen durch, daß keinem der fünf Männer Zeit blieb, einen letzten Schrei auszustoßen.
Als dies gelungen war, drang er in das Zelt des Magus ein, denn er hoffte, dort seine Geliebte zu finden. Aber sie war nicht da.
Er fesselte den Magus und hielt ihm den Dolch an die Kehle. Der Alte wehrte sich nicht. Er sah den jungen Mann nur wissend und in sein Schicksal ergeben an.
»Du wirst sie nicht finden, und du kannst sie nicht retten.«
Aus Zorn und in ohnmächtiger Verzweiflung stieß der junge Mann dem Magus den Dolch ins Herz. Das rote Blut tränkte das seidene Kissen.
Er verließ das Lager und machte sich auf die Suche nach seiner Geliebten. Er ritt am felsigen Ufer entlang und folgte den ausgetrockneten Wasserläufen. Er hob den Kopf und blickte hinauf zu den Sternen, als suche er sie auch dort.
Dann hörte er plötzlich einen erstickten Laut in der stillen Nacht. Er irrte durch die Dunkelheit. Schließlich fand er das tote Pferd und in der Nähe das purpurrote Gewand. Und er entdeckte den Brunnen. Er lauschte. Er rief ihren Namen. Er hörte ein Stöhnen. Der junge Mann wendete seinen Hengst, galoppierte zum Lager zurück und holte ein Seil. Als er den Brunnen wieder erreicht hatte, schlang er ein Ende des Seils um einen Felsen und kletterte in die Tiefe.
Sein Fuß stieß gegen etwas Weiches, und er wich seitlich aus, bis er den Boden spürte. Dann tastete er in der Dunkelheit nach seiner Geliebten. Er fand sie, und als er feststellte, daß sie nackt war, sank er neben ihr nieder und flüsterte: »Hab keine Angst, Liebste. Wir sind in Sicherheit. Deine Peiniger sind tot. Der Magus ist tot. Gib mir deine Hand, denn ich kann dich nicht sehen.« Er wartete, aber alles blieb still. »Warum gibst du mir keine Antwort?«
Er legte den Kopf auf ihre Brust. Ihr Herz schlug nicht mehr. Ihr Körper war noch warm. Noch vor kurzem hatte sie gestöhnt, aber jetzt war sie tot.
Sein Klageruf hallte dumpf in dem dunklen, tiefen Brunnen und stieg hoch zum Himmel auf. Er hatte seine Zeit damit vergeudet, die Männer und den Magus zu töten, während sie hier einsam und verlassen in dem Brunnen lag und starb.
Seine Hilfe kam zu spät.
Schluchzend kletterte er aus dem Brunnen und holte das reich bestickte purpurrote Gewand, das ihr gehört hatte.
Als er wieder in den Brunnen stieg, hielt er einen Augenblick an, bevor er den Boden erreichte. Kurz entschlossen durchtrennte er mit dem Dolch das Seil. Er fiel auf den Boden, das Seil baumelte außer Reichweite über ihm. Er breitete das Gewand über die inzwischen erkaltete Leiche, legte sich neben sie und nahm sie in die Arme. Seine Tränen wärmten ihr die Haare.
»Du sollst nicht vergebens gestorben sein, Geliebte«, flüsterte er.
»Die Götter sind Zeugen meines Schwurs. Mein Glaube, der sich von deinem unterscheidet, gibt mir die Kraft, dir zu versprechen, daß dein Tod nicht umsonst gewesen ist. Wir werden wieder zusammensein und uns ewig lieben. Das gelobe ich dir.«
Der erste Tag
Dienstag, 14. Dezember 1999
Scharm el Scheich, Golf von Akkaba
Die Explosion erschütterte das Land im weiten Umkreis und zerriß die morgendliche Stille. Staubwolken stiegen in die Luft, Geröll prallte an die zerklüfteten Felsen. Vögel, die in den Dattelpalmen saßen, flatterten erschrocken auf und flogen über das blaue Wasser des Golfs.
Dr.Catherine Alexander kam stolpernd aus ihrem Zelt. Zum Schutz vor den Strahlen der aufgehenden Sonne legte sie eine Hand über die Augen und blickte auf die etwa zweihundert Meter von ihrem Lager entfernte Baustelle. Beim Anblick der riesigen Baumaschinen lief ihr ein Schauer über den Rücken. Und als sie die Staubwolke sah, hätte sie vor Empörung beinahe laut aufgeschrien.
Warum das Dynamit?
Man hatte ihr versprochen, sie rechtzeitig vor einer Sprengung zu informieren. Die Baustelle befand sich ohnehin zu nahe an ihrer Grabungsstelle, und das Dynamit konnte die vorsichtig ausgehobenen Gräben mit einem Schlag vernichten.
Sie zog schnell die Stiefel an und rief den Männern ihrer Mannschaft, die verschlafen aus den Zelten krochen, zu: »Seht euch die Gräben an! Vergewissert euch, daß die Stützbalken halten. Ich werde mit unserem Nachbarn ein ernstes Wort reden.«
Während Catherine über den Sand eilte, sah sie, daß bereits Planierraupen heranfuhren, um das gesprengte Gestein abzuräumen. Sie fluchte leise.
Hier sollte ein Hotelkomplex entstehen, einer der vielen luxuriösen, klimatisierten Tummelplätze für reiche Touristen, die an der östlichen Küste der Sinaihalbinsel gebaut wurden. So weit man sehen konnte, ragten an der sanft geschwungenen Küste Hotels und Hochhäuser wie weiße Monolithe in den blauen Himmel und verwandelten die karge Landschaft in ein zweites Miami.
Catherine wußte, bald würde es hier keine Stelle mehr geben, an der Archäologen graben konnten. Das hatte sie versucht den Bürokraten in Kairo zu erklären, als sie sich vergeblich darum bemühte, einen Baustopp für das neue Hotel zu erwirken, bis ihre Ausgrabungen abgeschlossen sein würden. Aber in Kairo hörte niemand auf eine Frau und erst recht nicht auf eine, der man die Grabungserlaubnis nur mit Vorbehalten erteilt hatte.
»Hungerford!« rief Catherine schon von weitem, als sie sich den Wohncontainern der Bauleitung näherte. »Sie hatten mir versprochen, nicht zu sprengen!«
Die Gefährdung der Grabungen erschwerte ihr das Leben zusätzlich. Und im Augenblick hatte Catherine bereits mit genug Widrigkeiten zu kämpfen. Das Ministerium in Kairo saß ihr im Nacken und zeigte ein auffällig großes Interesse an der Ausgrabung. Früher oder später würden sie hinter die eigentliche Absicht kommen und wissen, daß Catherine gelogen hatte. Zu allem Überfluß hatte ihr die Stiftung in der letzten Woche mitgeteilt, man sehe sich gezwungen, das Projekt fallenzulassen und die Geldmittel zu streichen, wenn bei den Ausgrabungen nicht in Kürze positive Ergebnisse vorliegen würden.
Aber ich bin doch fast am Ziel, dachte Catherine, während sie von Container zu Container lief und an die Blechtüren klopfte.
Ich weiß, daß ich den Brunnen bald finden werde! Man muß mir nur die Möglichkeit geben, meine Arbeit ohne solche verdammten Störungen durchzuführen …
»Hungerford! Wo sind Sie?«
Catherine näherte sich dem Container, der als Planungsbüro diente. Plötzlich hörte sie in ihrem Rücken Stimmengewirr. Sie drehte sich um und sah im gleißenden Sonnenlicht, daß Hungerfords arabische Arbeiter zu der Stelle rannten, wo das Dynamit gezündet worden war.
Sie beobachtete verblüfft, wie die Männer aufgeregt gestikulierend in der sich langsam auflösenden Staubwolke auf einen Felsen zuströmten. Offenbar hatte einer der Arbeiter etwas gefunden.
Catherine hielt den Atem an. Sie kannte diese Art Aufregung. So war es auch bei den Grabungen in Israel und im Libanon gewesen, wenn etwas wirklich Wertvolles und Einmaliges gefunden worden war.
Plötzlich rannte auch sie los, sprang über Steine, wich Felsbrocken aus und stolperte über Geröll. Sie erreichte die Gruppe in dem Augenblick, als sich Hungerford einen Weg durch die Menge bahnte.
»Was soll das? Wer hat euch gesagt, daß ihr die Arbeit unterbrechen könnt?«
Der dicke Texaner nahm den leuchtend gelben Schutzhelm vom Kopf und fuhr sich mit der Hand durch die rötlichen Haare. Wie immer lief ihm der Schweiß über das rote Gesicht.
»Guten Morgen, Frau Doktor«, begrüßte sie Hungerford, als er Catherine sah. »Also, was ist los, Leute?«
Die Araber begannen alle auf einmal zu reden. Einer hielt etwas in der Hand, das wie das Stück einer alten vergilbten Zeitung aussah.
»Warum die Aufregung?« murmelte Hungerford kopfschüttelnd.
»Darf ich?« Catherine nahm dem Araber den Fund aus der Hand. Die Männer verstummten und sahen gespannt zu, als sie das Papier aufmerksam betrachtete.
Es war kein Papier, sondern Papyrus.
Sie zog eine Lupe aus der Tasche ihrer Khakibluse und betrachtete das Fragment. »›Jesus‹ …!« flüsterte sie plötzlich.
Hungerford verzog spöttisch die Lippen. »Sie werden doch nicht fluchen, Frau Doktor?«
»Nein, das steht hier. Sehen Sie? Hier steht auf griechisch ›Jesus‹.«
Hungerford kniff die Augen zusammen. Sie deutete auf das Wort ›Iesous‹, und er murmelte sichtlich beeindruckt: »Das heißt tatsächlich Jesus?«
»Ja, und das hier ist, wie Sie sehen, nur ein Fragment.« Catherine deutete auf den Riß. Die untere Hälfte des Papyrus fehlte.
Er lachte plötzlich laut, und es klang spöttisch, als er fragte: »Ist das vielleicht ein ›Jesus-Fragment‹?«
Catherine kannte seine unverschämte Art, sich über ihre Arbeit lustig zu machen, und gab ihm keine Antwort. Sie betrachtete den Fund nachdenklich. Der Papyrus hatte eine honiggelbe Farbe und war mit schwarzen Schriftzeichen bedeckt. Sie sah sofort, daß es sich nicht um neugriechische Buchstaben handelte. Das war in der Tat ein sehr altes Dokument. Ihr Herz schlug plötzlich schneller.
Bin ich vielleicht auf das gestoßen, wovon jeder Archäologe träumt? Nein, es wäre einfach zu schön, zu wunderbar, um wahr zu sein …
»Vermutlich stammt es von einem Einsiedler aus dem vierten Jahrhundert«, murmelte sie ausweichend und schob sich eine Strähne des kastanienbraunen Haars aus der Stirn. Dann fügte sie erklärend hinzu: »In den Felsenhöhlen hier lebte einst eine große Zahl Asketen und Propheten, und am Ende des römischen Reiches war Griechisch unter den Gelehrten weit verbreitet.«
Hungerfords Blick richtete sich auf die Wüstenlandschaft zu ihrer Linken. Die Sonne brannte bereits unbarmherzig auf die zerklüfteten hohen Felsen. Der ständige Wind am Golf schien plötzlich stärker zu werden. Die beiden Amerikaner und die wartenden Araber glaubten, ein merkwürdiges Pfeifen zu hören. Es klang wie zischender Dampf. Über ihren Köpfen kreiste ein Falke und stieß einen schrillen Schrei aus. Catherine lief ein Schauer über den Rücken.
Hungerford räusperte sich und blickte wieder auf das Fragment.
»Ist es etwas wert?«
Catherine hob die Schultern. »Das hängt von seinem Alter ab.«
Sie sah ihn nicht an. »Und davon, was auf dem Papyrus steht.«
»Können Sie es lesen?«
»Dazu muß ich in mein Zelt, um es mir genauer anzusehen. Die Buchstaben sind verblaßt, und der Papyrus ist an einigen Stellen bereits brüchig. Außerdem wäre es hilfreich, wenn wir den Rest finden würden.« Sie deutete noch einmal auf den gezackten unteren Rand.
»Also gut!« Hungerford setzte den Schutzhelm wieder auf. »Wir werden sehen, woher es kommt. Fünf ägyptische Pfund für den Mann, der mehr von dieser Art Papyrus findet. Yallah, Leute!«
Die Männer durchsuchten die nähere Umgebung. Das Geröll bestand in erster Linie aus Kalkstein und Schiefer. Plötzlich fand einer der Arbeiter etwas unter einem Stein. Alle stürzten sich darauf. Aber es war nur die Titelseite der International Times von vor zwei Tagen. Vermutlich hatte sie der Wind aus einem Touristenhotel hergetragen. Catherine sah die Schlagzeile:
›JAHRTAUSEND-FIEBER!‹
Darunter stand fett gedruckt: ›Das Ende? Weltuntergang in zwanzig Tagen!?‹
Ein Photo zeigte den Petersdom in Rom, wo sich bereits viele Menschen zu Tag- und Nachtwachen versammelten und darauf warteten, daß die Glocken das neue Jahrtausend einläuteten. In weniger als drei Wochen würde das Jahr 1999 enden und das Jahr 2000 beginnen.
Die Araber fanden zwischen den Steinen Stücke eines Hanfseils und Stoffreste. Als sich Catherine das brüchige Gewebe ansah, wußte sie, daß es ebenfalls sehr alt war.
Sie betrachtete noch einmal das Fragment, und wieder fiel ihr Blick auf das Wort: ›Jesus‹.
Was haben wir gefunden?
»Wir müssen den Platz freiräumen«, sagte sie mit belegter Stimme, und wieder lief ihr ein Schauer über den Rücken. Die Augen der Araber waren auf sie gerichtet.
Sie wissen es!
Catherines Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Hungerford und sie durften die Männer nicht mehr aus den Augen lassen. Wenn sich die Nachricht von einem ›Jesus-Fragment‹, wie Hungerford leichtsinnig laut gesagt hatte, verbreitete, würde bald jeder Beduine im Umkreis von fünfzig Meilen am Ort der Sprengung erscheinen und sein Zelt aufschlagen. Dann wären alle Artefakte verschwunden, bevor die ägyptischen Behörden einschreiten konnten. Catherine hatte auch das schon erlebt.
»Wir dürfen unter keinen Umständen etwas von dem Fund verlauten lassen.«
Hungerford sah sie erstaunt an und nickte dann langsam. »Verstehe …«, brummte er. »Und nun?«
Catherine wollte mit dem Fragment so schnell wie möglich zu ihrem Zelt. Sie mußte das brüchige Papyrus vor weiteren Schäden bewahren und es so schnell wie möglich übersetzen.
Was wird dort stehen außer dem Namen Jesus?
»Dr.Alexander!«
Sie drehte sich um und sah, daß Samir, ihr Aufseher, gerufen hatte. Als er sie erreichte, meldete er in dem klaren Englisch, das er während des Studiums in London gelernt hatte: »Einige Wände sind beschädigt und sechs Gräben eingestürzt.«
»Das bedeutet, wir haben einen Monat Arbeit verloren!«
Catherine warf einen wütenden Blick auf Hungerford, der verlegen lächelte. »Tut mir leid, aber der Fortschritt läßt sich nicht aufhalten. Die Vergangenheit darf der Zukunft nicht im Wege stehen, Frau Doktor.«
Catherine mochte Hungerford nicht. Sie hatte ihn von Anfang an abstoßend gefunden. Als er vor zwei Monaten mit seiner Mannschaft und dem gesamten Maschinenpark hier erschienen war, hatte er gefragt: ›Was macht eine so hübsche Frau wie Sie ganz allein in der Wüste?‹
Catherine hatte ihm höflich erklärt, daß sie mit ihrem Ausgrabungsstab und fünfzehn Arbeitern wohl kaum ›allein‹ sei.
Hungerford hatte anzüglich gelacht und ungerührt erwidert: ›Ach, Sie wissen ganz genau, was ich meine! Eine so hübsche Frau wie Sie braucht einen Mann.‹
Catherine erklärte, sie sei zum Arbeiten hier, aber er antwortete: ›Wir sind alle hier, um zu arbeiten. Das heißt doch nicht, daß man nicht hin und wieder Zeit hat, sich zu amüsieren …‹
Wie sich herausstellte, bestand das ›Amüsieren‹ in dem Versuch, sie zu einem Drink im nahe gelegenen Hotel Isis einzuladen. Der schäbige Betonklotz stammte noch aus den fünfziger Jahren und war ein Treffpunkt für Ausländer, die hier arbeiteten oder wohnten, und Touristen aus dem Nahen Osten, die nicht so viel Geld hatten wie die Gäste der Luxushotels. Auch Catherine erholte sich nach der Tagesarbeit hin und wieder mit einigen ihrer Leute in der verräucherten Bar des Hotels, aber sie ging Hungerford immer aus dem Weg. Sein aufdringliches Lachen gefiel ihr nicht, und der dicke Bauch über der riesigen Silberschnalle seines breiten Ledergürtels wurde auch nicht dadurch anziehender, daß er ihn ständig stolz mit beiden Händen umfaßte, als sei der Bauch etwas Besonderes, das nur er zu bieten habe. Der Texaner ließ sich jedoch keine Gelegenheit entgehen, sie in ein Gespräch über die Ausgrabung zu verwickeln. Er stellte ihr Fragen, wie: ›Sie suchen also nach den Tafeln mit den Zehn Geboten?‹ Catherine gab ihm jedesmal ausweichende Antworten und hütete sich davor, ihm den wahren Grund für ihre Grabung anzuvertrauen.
Aus Vorsicht hatte sie sogar den Behörden in Kairo nur gesagt, was alle wußten: ›Wir suchen nach Moses.‹
Sie konnte sich die Reaktionen gut vorstellen, wenn man die Wahrheit erfahren würde, daß sie nämlich nicht nach Moses, sondern nach seiner Schwester suchte, nach der Prophetin Mirjam.
»Also«, sagte Hungerford jetzt grinsend und deutete mit einem vom Nikotin verfärbten Finger auf das Fragment. »Glauben Sie, das hat etwas mit Ihrer Arbeit hier zu tun?«
Catherine hatte zweifellos das brüchige Stück einer Schriftrolle aus dem Altertum gefunden. Unwillkürlich betastete sie vorsichtig das bräunlichgelbe Blatt. Sie spürte die rauhe Oberfläche an der Fingerspitze und blickte ehrfurchtsvoll auf die mit großer Sorgfalt geschriebenen Buchstaben.
Hatte das überraschend aufgetauchte Dokument etwas mit ihrer Suche nach der Prophetin Mirjam zu tun?
Als sie nachdenklich den Kopf hob, traf der scharfe Wind ihr Gesicht. Sie atmete tief die zeitlose, salzige Luft des Golfs ein und rümpfte über die Gerüche des Fortschritts – Dieselabgase und der Rauch einer nicht allzuweit entfernten, brennenden Müllhalde – die Nase.
Wonach mochte die Luft gerochen haben, als die Israeliten vor mehr als dreitausend Jahren hier entlanggezogen waren? Wie war das Leben unter diesem Himmel gewesen, als sich Schleier und Umhänge der Israeliten im Wind blähten, und Mirjam die Kühnheit besaß, ihrem Bruder, dem Anführer der Juden, die Stirn zu bieten und ihn zu fragen: ›Hat der Herr nur durch Moses gesprochen?‹
Catherine zwang sich, in die Gegenwart zurückzukehren. Da sie Hungerfords Blick noch immer auf sich gerichtet sah, senkte sie schnell den Kopf und stellte fest, daß sie in der Eile nach der überraschenden Sprengung vergessen hatte, die oberen Knöpfe der Bluse zuzuknöpfen.
»Ich muß mir das Fragment genauer ansehen«, erklärte sie mit Nachdruck und drehte sich um. »Sagen Sie Ihren Leuten, sie sollen weitersuchen.«
»Na klar!« trompetete Hungerford, und sein vulgäres Lachen hallte von den Felsen wider.
Als Catherine das Lager erreichte, hatte ihr Grabungs-Team aus amerikanischen Studenten und Freiwilligen bereits damit begonnen, die Gräben zu sichern, die durch Hungerfords Sprengung in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Unter dem Sonnendach, ihrem ›Eßzimmer‹, füllte der Koch Körbchen mit einheimischem Fladenbrot, zerteilte den Ziegenkäse und stellte die unterschiedlichen Becher für den starken, schwarzen Kaffee bereit, den alle mit größter Begeisterung tranken.
In diesem Winter hatte Catherine eine gute Mannschaft. Das lag zum Teil an dem kühlen Wetter. Es war sehr viel schwieriger, in den drückend heißen Sommermonaten Leute zu finden, die bereit waren, bei einer Grabung mitzuarbeiten. Leider würden die meisten Weihnachten nach Hause fahren, und nur einige hatten ihre Rückkehr zugesagt. Auch das machte ihr Sorgen.
Das neue Jahr würde kein gewöhnliches Jahr sein. Es war der Beginn eines neuen Jahrzehnts, eines neuen Jahrhunderts und sogar eines neuen Jahrtausends.
Catherine fürchtete nicht zu Unrecht, daß sie gezwungen sein würde, die Ausgrabung vorübergehend abzubrechen. Genau das konnte sie sich aber nicht leisten, denn sie spürte mehr denn je, daß sie an einem Wendepunkt in ihrem Leben stand.
Sie trat in das Zelt und legte das Fragment vorsichtig auf die Arbeitsplatte, um es genauer zu untersuchen. Aber zuerst ging sie zum Waschbecken und kühlte sich das Gesicht ab. Ein Blick in den Spiegel zeigte ihr in der nüchternen Klarheit des hellen Morgens, daß sie müde und erschöpft aussah.
Wie konnte Julius behaupten, sie sei schön?
Catherine fand ihr Gesicht in keiner Weise außergewöhnlich, obwohl sie vermutlich sehr viel jünger als sechsunddreißig aussah. Trotz der anstrengenden Jahre unter der heißen Sonne bei Ausgrabungen in Israel und Ägypten war es ihr bis jetzt irgendwie gelungen, dem Schicksal aller Archäologen zu entgehen, ständig unter Sonnenbrand zu leiden und ein Gesicht voller Falten und Krähenfüße zu haben. Die großen grünen Augen, ein Erbe ihrer Mutter, fand auch Catherine schön. Immerhin waren die langen kastanienbraunen Haare, die sie im Nacken mit einer Spange zusammenhielt, noch nicht von grauen Fäden durchzogen. Aber jetzt stellte sie seufzend fest, daß ein neues Zeichen des Alters hinzugekommen war: eine senkrechte Falte zwischen den Augen. Die Falte war entstanden, weil sie bei ihrer konzentrierten Arbeit immer unbewußt die Augenbrauen zusammenzog. Bisher war sie stets wieder verschwunden. Doch obwohl Catherine das Gesicht jetzt bewußt entspannte, blieb die Falte deutlich sichtbar.
›Du wirst nicht jünger‹, hörte sie eine spöttische Stimme flüstern.
Catherine lächelte. ›Du auch nicht, mein lieber Julius …‹
›Sie brauchen einen Mann‹, hatte Hungerford gesagt.
Catherine hatte einen Mann. Leider befand er sich neuntausend Meilen entfernt am anderen Ende der Welt. Julius fehlte ihr … Catherine schaffte genügend Platz auf dem überfüllten Arbeitstisch. Dann öffnete sie eine Klappe am Zeltdach, um das Morgenlicht hereinzulassen.
Die Sonnenstrahlen fielen auf ein Photo, das sie mit Klebeband über dem Arbeitstisch befestigt hatte: Julius lächelte sie an, als unterhalte er sich gerade mit ihr.
Er sah wirklich gut aus, hatte schwarze Haare, einen gepflegten Bart und, wie sie fand, geheimnisvolle dunkle Augen.
Dr.Julius Voss war vor zwei Jahren auf einer Archäologen-Tagung in Oakland in ihr Leben getreten. Catherine hatte dort ein Thesenpapier vorgestellt mit dem Titel: ›Bestimmung der Herkunft von Ton bei Keramik der Bronzezeit mit Hilfe der optischen Emissionsspektroskopie.‹
Julius war Mediziner und hatte sich auf Krankheiten im Altertum spezialisiert. Er hielt einen Vortrag über das auffällig häufige Vorkommen von Unterarmbrüchen bei ägyptischen Skeletten, besonders bei Frauen. Er vertrat die Auffassung, daß diese Brüche entstanden waren, als der Arm zur Selbstverteidigung gehoben wurde, um einen Schlag abzuwehren.
In der Mittagspause lernten sie sich kennen, und die gegenseitige Anziehung war augenblicklich spürbar. Es war wirklich so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gewesen.
›Warum, Cathy?‹ hörte sie ihn wieder fragen, als befinde er sich plötzlich in ihrem Zelt. ›Warum willst du mich nicht heiraten? Es kann doch nicht daran liegen, daß du keine Jüdin bist. Das ist nicht der Grund. Du weißt, daß ich von dir nicht verlange, meine Religion anzunehmen.‹
Catherine würde sich niemals zu seinem Glauben bekehren, selbst wenn er das verlangen sollte. Sie hatte ihm bereits gesagt, daß sie keine Religion brauchte. Der Katholizismus ihrer Kindheit und Jugend reichte, um ein Leben lang genug von Religionen zu haben. Aber es gab andere Gründe dafür, daß sie Julius nicht heiraten konnte, auch wenn sie ihn noch so sehr liebte.
Das Problem ließ sich nicht so leicht in Worte fassen: Julius war Jude, genauer gesagt ein gläubiger Jude. Nicht die Tatsache, daß er Jude war, bereitete ihr Unbehagen, sondern seine Frömmigkeit. Catherine liebte Julius. Wenn sie sich über wissenschaftliche Themen oder über gemeinsame Interessen unterhielten, dann konnte sie frei und ungezwungen mit ihm reden, für ihn dasein und ihm zuhören. Aber jedesmal, wenn es um Religion ging – und das würde nicht ausbleiben, wenn sie in seine große orthodoxe Familie einheiratete –, dann erfaßte sie eine unbestimmte, namenlose Angst.
Catherine schob mit einem leisen Seufzen den Gedanken an Julius beiseite und konzentrierte sich auf das Fragment.
Sie überflog die griechischen Buchstaben, doch das Wort ›Jesus‹ fand sie nur an einer Stelle. Aber das war bedeutsam genug.
Bestand möglicherweise eine Verbindung zwischen diesem christlichen Dokument und der Prophetin des Alten Testaments, nach der sie hier auf der Sinaihalbinsel suchte? Gab das Jesus-Fragment vielleicht den entscheidenden Hinweis, auf den sie schon so lange gehofft hatte? Würde sie möglicherweise erfahren, wo sich die Oase befand, die Stelle in der Wüste, wo Mirjam und ihr Bruder den Kampf um die Macht geführt hatten?
Catherine überlegte einen Augenblick und nahm dann ein Buch aus dem Regal. Es stammte aus dem Jahr 1764, und es handelte sich um die englische Übersetzung der Erinnerungen von Ibn Hassan, einem Araber aus dem zehnten Jahrhundert, dessen Schiff im Jahr 976 n.Chr. in einem Sturm vom Kurs abgekommen war. Der Mann konnte sich an eine nur ungenau bezeichnete Küste retten. Beim ersten Lesen war Catherine die Stelle aufgefallen: ›… im Lande Sina gestrandet …‹
Damals dachte sie: Spricht er von der Sinaihalbinsel?
Sie verglich die unklaren Hinweise aus der Geschichte des Arabers mit Stellen im Alten Testament und kam unter Einbeziehung von Astronomie und der Navigation mit Hilfe von Sternen (Ibn Hassan berichtete: ›Ich sah, wie Aldebaran über meiner Heimat aufging‹) sowie unter Berücksichtigung der Legenden und Gebräuche der Beduinen dieser Gegend zu dem Schluß, daß der Araber an dieser Küste gestrandet war, wo jetzt die Ferienhotels Touristen aus aller Welt anlockten.
Mit dieser Erkenntnis hatte Catherines lebenslange, unbestimmte Suche schließlich ein Ziel gefunden. Sie sah ihre Vermutungen bestätigt, denn Ibn Hassan hatte geschrieben: ›Ich verbrachte meine einsamen Tage an einem Ort, wo die ansässigen Beduinen ihre Herden tränken, dem Bir Maryam …‹
Der Mirjam-Brunnen.
Catherines Suche hatte genaugenommen an einem ganz bestimmten Tag begonnen. Als Vierzehnjährige zeigte man in der von Nonnen geleiteten katholischen Schule während der Karwoche eine Reihe von Filmen für die achte und neunte Klasse zum Thema: ›Bibelfilme der vierziger und fünfziger Jahre.‹ Höhepunkt war DeMilles Klassiker Die Zehn Gebote aus dem Jahr 1954. Während die meisten ihrer Mitschüler, die mit den technischen Spezialeffekten von Star Trek und Krieg der Sterne aufgewachsen waren, kicherten und sich langweilten – allerdings gab es Beifall, als Moses das Rote Meer teilte –, wurde Catherine sehr nachdenklich. Alle Filme verherrlichten die Helden der Bibel: Samson, Moses, Salomon. Auf der Leinwand zeigte man gute, würdevolle und heldenhafte Männer. Unter den Frauen gab es dagegen nur zwei Typen: Die böse Verführerin und die geduldig leidende Jungfrau. Selbst ältere Frauen und Mütter wirkten in den Filmen irgendwie jungfräulich und blaß. In keinem Film gab es eine richtige Heldin. Catherine fand, daß die Frauen wenig mehr waren als Statistinnen zur Verherrlichung der Männer.
Aus dieser einfachen Beobachtung – Catherine war überzeugt davon, daß es auch in biblischen Zeiten Heldinnen gab – hatte sich bereits in ihrer Jugend eine wahre Besessenheit entwickelt, die schließlich zu ihrer Berufswahl führte: biblische Archäologie.
Sie glaubte felsenfest, daß der Wüstensand, in dem man Schätze wie das Grab des Tut-ench-Amun und die Schriftrollen vom Toten Meer gefunden hatte, weit mehr Geheimnisse barg, die nur darauf warteten, ausgegraben zu werden. Wenn man in der Bibel keine Heldinnen fand, dann wollte Catherine sie an Ort und Stelle, in der Wüste finden.
Sie mußte jedoch bald feststellen, daß die von Männern beherrschte Archäologie und Bibelwissenschaft mit ihren anerkannten und scheinbar unumstößlichen Theorien von der alten Garde wie eine uneinnehmbare Bastion verteidigt wurden. Sie tolerierten in ihren Reihen kaum Frauen und waren unter keinen Umständen bereit, von ihren grundsätzlichen Erkenntnissen abzurücken.
Als sich Catherine vor fünf Jahren zum ersten Mal um eine Grabungsgenehmigung in dieser Gegend bemüht hatte, erklärte sie den Beamten im Ministerium in Kairo, sie beabsichtige, nach dem Mirjam-Brunnen zu suchen, und hoffe damit, Beweise für ihre Theorie zu finden, daß Mirjam, die Schwester von Moses, eine Anführerin der Israeliten gewesen sei und daß sich die Geschwister die Führerschaft als gleichberechtigte Partner geteilt hätten.
Die zähen Verhandlungen zogen sich über Monate hin. Sie führte zahllose Gespräche, zahlte hohe Bestechungsgelder, mußte erleben, daß Dokumente spurlos verschwanden, wurde von einer Stelle zur anderen verwiesen, und schließlich lehnte man ihr Gesuch ab.
Deshalb hatte Catherine den Rückzug angetreten und eine andere Strategie entwickelt. Ein Jahr darauf erschien sie wieder in Kairo und stellte den Antrag auf eine Grabungserlaubnis, um den Moses-Brunnen zu suchen.
Als Catherine jetzt Ibn Hassans Buch aufschlug, las sie nicht die Stellen, die ihr Anhaltspunkte für die Suche nach dem Weg der Juden bei ihrem Auszug aus Ägypten geliefert hatten. Sie blätterte bis zu einer Passage, der sie bislang weniger Aufmerksamkeit geschenkt hatte, die sie jetzt jedoch nachdenklich noch einmal las.
›Eines Nachts erwachte ich‹, schrieb der Araber, ›und vor mir stand eine wundersame junge Frau, deren Schönheit und Glanz mich blendeten. Sie führte mich zu einem Brunnen und forderte mich auf, ihn zu füllen, zuerst mit weicher Erde und dann mit Steinen. Auf den Brunnen sollte ich einen Anker aus Schilf stellen.
‹Wenn du das für mich tust, Ibn Hassan›, sagte der Engel zu mir, ‹werde ich dir das Geheimnis des ewigen Lebens verraten.›‹
Catherine blickte nachdenklich auf die Worte: ›Anker aus Schilf‹.
Sie hatte ihnen bislang wenig Bedeutung beigemessen. Wozu einen Anker aus Schilf?
Sie zuckte zusammen. Plötzlich wußte sie die Antwort. Der Anker aus Schilf war ein Symbol, kein wirklicher Anker!
Sofort fiel ihr ein, daß der Anker in frühchristlicher Zeit eine symbolische Bedeutung besessen hatte und erst später vom Kreuz verdrängt worden war.
Catherine runzelte die Stirn. Der Anker war das Verbindungsglied zum Christentum, das sie suchte.
Sie blätterte zurück zur ersten Seite von Ibn Hassans Erinnerungen und las mit wachsender Erregung: ›Und so erhielt ich den Schlüssel zum ewigen Leben. Ich, Ibn Hassan Abu Mohammed Omar Abbas Ali, wurde gerettet. Ich konnte die einsame Küste verlassen und zu meiner Familie zurückkehren. Ich erzähle dies im hohen Alter von zweimal sechzig und neun Jahren bei bester Gesundheit und in dem festen Glauben, daß ich nicht sterben werde, denn der Engel hat mir das ewige Leben zum Geschenk gemacht.‹
Catherine hatte diese Worte bisher als Prahlerei eines alten Mannes abgetan, der es liebte, wundersame Geschichten zu erzählen, und deshalb behauptete, einhundertneunundzwanzig Jahre alt zu sein. Aber jetzt …
Sie blickte auf das Jesus-Fragment, das Hungerfords Araber gefunden hatten. Zwei Worte stachen ihr ins Auge: ›Zoe aionios.‹
Ewiges Leben.
Bestand ein Zusammenhang zwischen diesem Fragment, das sie nach vorsichtiger Schätzung um zweihundert nach Christus datierte, und der Erscheinung eines Engels, der einem Schiffbrüchigen sieben Jahrhunderte später das ›ewige Leben‹ verhieß? Wenn es diesen Zusammenhang gab, was hatte der Hinweis auf ›Jesus‹ mit dem Mirjam-Brunnen zu tun?
Catherine hatte, abgesehen von Ibn Hassans Erinnerungen, bisher keine Hinweise auf einen Mirjam-Brunnen gefunden. Aber sie war bei ihren Nachforschungen auf das Buch eines deutschen Ägyptologen von 1883 gestoßen. Er beschrieb darin eine Expedition in die Wüste Sinai. Eines Tages schlug die Gruppe ihr Lager an der Küste im Osten des Katharinenklosters auf. Die Zelte standen unter einem steilen Felsen in der Nähe eines Brunnens mit dem Namen Bir Umma – Brunnen der Mutter. In der Nacht wurden die Teilnehmer der Expedition von seltsamen Träumen heimgesucht. Die Frau des Deutschen berichtete fast in denselben Worten wie Ibn Hassan von der Erscheinung einer überirdisch schönen jungen Frau.
Die Frage lag nahe, ob die Ähnlichkeit der Erscheinung ein Hinweis darauf war, daß Professor Krügers Expedition das Lager an der Stelle aufgeschlagen hatte, an der Ibn Hassan Schiffbruch erlitten hatte.
Catherine entdeckte schließlich einen Anhaltspunkt im Alten Testament, der zu ihrem Entschluß führte, an dieser Stelle zu graben.
Exodus 13;21/22: ›Der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes, und die Feuersäule nicht bei Nacht.‹
Catherine erkannte nicht als erste, daß diese Bibelstelle sehr wohl einen aktiven Vulkan beschreiben mochte. Sie wußte, es gab auf der Sinaihalbinsel keine vulkanischen Gebirge, dafür aber in Saudi-Arabien im Osten des Golfs von Akkaba. Man nannte das Gebiet dort ›das Land Midian‹.
Deshalb kam sie zu folgendem Schluß: Das Gebirge befand sich an der Westküste Arabiens. Die Israeliten waren dem Feuer und Rauch des Vulkans gefolgt und an diesen Ort an der Ostküste, auf der anderen Seite des Golfs gelangt, denn dort hatten sie die ›Wolkensäule‹ bei Tag und ›das Feuer‹ in der Nacht gesehen.
Catherine war hierhergekommen, um einen Beweis für den Weg der Israeliten durch die Wüste zu finden und auch Hinweise auf die Prophetin Mirjam. Mit einem Papyrus-Fund, in dem das Wort ›Jesus‹ vorkam, hatte sie allerdings nicht gerechnet.
Sie überlegte: Was hat das Fragment und die Worte ›ewiges Leben‹ mit Ibn Hassans ›Engel‹, mit dem Traum der Frau des Ägyptologen und mit den Legenden der Beduinen zu tun, in denen immer wieder von Geistwesen oder Geistern berichtet wird, die an dieser Stelle den Menschen erscheinen?
Catherine lauschte auf die Geräusche vor dem Zelt. Der morgendliche Wind nahm an Heftigkeit zu. Er fuhr pfeifend über den dunkelblauen Golf und mischte sich mit dem Lachen und Rufen von Hungerfords Arbeitern, die das Geröll durchsuchten.
Plötzlich erinnerte sie sich, daß sie in der vergangenen Nacht ebenfalls einen seltsamen Traum gehabt hatte.
Nein, es war kein Traum gewesen. Eine Erinnerung, die sie mit großer Entschlossenheit verdrängt hatte, stellte sich erstaunlicherweise wieder ein, um sie zu quälen. ›Du abscheuliches Mädchen! Das wirst du büßen …‹
Catherine schob die Erinnerung seufzend beiseite und griff nach der Lupe. Sie wollte damit beginnen, die altgriechischen Worte zu übersetzen, als es draußen plötzlich laut wurde.
Die Araber hatten etwas gefunden.
In unmittelbarer Nähe der Sprengung waren die Arbeiter auf ein Loch gestoßen, das wie ein Tunneleingang wirkte. Catherine kniete im Sand und betrachtete die Öffnung. Ihr Herz schlug schneller, sie sprang auf und rannte ohne eine Erklärung zu ihrem Grabungsplatz zurück.
Vor Beginn der Ausgrabungen hatte sie das Gebiet mit den neuesten geologischen Meßinstrumenten untersucht und an dieser Stelle das Vorhandensein eines ungewöhnlichen unterirdischen Tunnels festgestellt. Sie hatte ein Planquadrat mit einem Raster angefertigt und dann mit den Grabungen begonnen. Ein Jahr später war sie auf der zweiten Ebene noch immer nicht auf Hinweise für eine menschliche Besiedlung gestoßen. Auf der dritten Ebene hatten sie eine Kalksteinschicht erreicht und den Einstieg zu einem Tunnel gefunden.
Als Catherine jetzt in einem der Gräben stand, wo sie diesen Tunnel entdeckt hatten, fiel ihr auf, daß er in Richtung der Sprengung verlief. Es war bestimmt nicht das Ende des unterirdischen Gangs, der offenbar zu dem steilen Uferfelsen führte.
Was mochte sich am Ende des Tunnels befinden?
Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.
Catherine band sich das Seil um die Hüfte, legte sich auf eine der Paletten auf Rädern, mit denen sie das Geröll aus den Gräben transportierten, und machte sich mit einer Taschenlampe in der Hand auf den Weg.
Im Innern wartete sie einen Augenblick. Der Gang war dunkel und eng. Staub und kleine Steine lösten sich von den Wänden. Niemand kannte die Festigkeit des Gesteins, das durch die Sprengung brüchig geworden sein mochte. Deshalb hatten sie ein Signal verabredet: Wenn Catherine einmal am Seil zog, würde man sie sofort herausholen.
Catherine hatte Hungerford vor dem abenteuerlichen Einstieg noch einmal ermahnt, ein Auge auf seine Leute zu haben und dafür zu sorgen, daß alle in der Nähe blieben und niemand zum nächsten Telefon rannte – die Preise, die die Einheimischen auf dem schwarzen Markt für die Schriftrollen vom Toten Meer und den ›Nag Hammadi‹-Schatz erzielt hatten, waren nicht vergessen. Catherine hatte ihre Gruppe angewiesen, kein Wort über den Fund verlauten zu lassen, bis eine wissenschaftliche Klärung vorlag.
Trotzdem machte sie sich Sorgen. Seit der Sprengung am frühen Morgen, die das Jesus-Fragment zutage gefördert hatte, waren drei Stunden vergangen. Das Gerücht von dem sensationellen Fund kursierte vielleicht schon auf der ganzen Halbinsel.
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als Catherine in der Dunkelheit verschwand. Sie bewegte sich langsam, schob sich mit den Ellbogen durch den Gang vorwärts und hielt den Strahl der Taschenlampe auf die endlose Schwärze gerichtet. Immer wieder rieselte Sand auf sie herab, und wenn sie die Palette zum Stehen brachte, hielt sie den Atem an und rechnete fast damit, daß die Decke des Tunnels im nächsten Augenblick einstürzen werde. Sie durfte vor allem nicht die Nerven verlieren. Der Gang war so niedrig, daß sie die meiste Zeit flach auf dem Bauch liegen und den Kopf einziehen mußte. Trotzdem stieß sie immer wieder gegen den Fels. Ihre nackten Knie waren auf dem rauhen Kalksteinboden bald aufgeschürft, und sie wünschte zu spät, die Khakishorts gegen Jeans ausgetauscht zu haben.
Trotz aller Hindernisse und möglicher Gefahren ließ sie sich nicht beirren. Vorsichtig rollte sie auf dem Wägelchen weiter, entschlossen herauszufinden, was sich am Ende des Tunnels befand.
Der Gang wand sich jetzt durch festes Gestein. Neugierig musterte Catherine im Schein der Taschenlampe die relativ glatte Decke und die ebenso glatten Wände. Nach einer Weile kam sie jedoch zu dem Schluß, der Tunnel sei nicht das Werk von Menschen, sondern ein natürlicher Gang. Möglicherweise war er durch ein Erdbeben entstanden oder von Wasser ausgehöhlt worden, das aus einer unterirdischen Quelle stammte.
Wasser für einen Brunnen?
Trotz der Kühle trat Catherine der Schweiß auf die Stirn. Ibn Hassan und Krügers Frau hatten berichtet, hier seien Menschen lebend begraben worden. Catherine liefen kalte Schauer über den Rücken. War ihr Traum eine Warnung gewesen? War dieser Ort verflucht?
Der Gang war plötzlich versperrt. Catherine holte tief Luft. Ihrer Schätzung nach war sie etwa fünfzig Meter von der Öffnung entfernt, wo Hungerford mit seinen Leuten stand und das Sicherungsseil abrollte. Vorsichtig untersuchte sie das Hindernis und stellte zu ihrem Erstaunen fest, daß es sich um die Reste eines Korbes handeln mußte, die zum Teil noch von Steinen umgeben waren. Sie griff danach und zog daran. Der Korb löste sich mühelos aus dem Geröll. Wieder rieselte Sand auf ihren Kopf. Catherine kniff die Augen zusammen und wartete mit angehaltenem Atem. Als sich die Staubwolke gelegt hatte, richtete sie die Taschenlampe nach vorne.
Der unterirdische Gang ging weiter.
Sie nahm die Korbreste zwischen die Arme und legte das Kinn darauf. Dann rollte sie langsam weiter.
Der Tunnel mündete plötzlich in einen kreisrunden Schacht, der senkrecht nach oben führte. Er hatte einen Durchmesser von etwa fünf bis sechs Metern und war über ihr verschlossen. Catherine sah, daß die Wände aus großen unbehauenen Feuersteinblöcken bestanden, wie sie für Bauten der Bronzezeit typisch waren.
Habe ich den Mirjam-Brunnen gefunden?
Catherine richtete die Taschenlampe nach unten und blickte zitternd über den Rand. Hoffentlich würde sie nicht in den Brunnen fallen. Der Boden war trocken. Sie sah Steine und loses Geröll, das sich offenbar durch die Sprengung gelöst und einen Teil des Schachts zum Einsturz gebracht hatte. Plötzlich entdeckte sie etwas Weißes. Sie verlagerte vorsichtig das Gewicht und streckte den Kopf vor, um besser in die Tiefe blicken zu können.
Der schwankende Lichtstrahl tanzte über die Steine, und dann sah sie es.
Dort lag ein Schädel! Der Schädel eines Menschen.
»Wie schätzen Sie diesen Fund ein?« fragte Hungerford und grinste. »Ich meine in Dollars und Cents. Was, meinen Sie, würde zum Beispiel ein Museum für das Jesus-Fragment zahlen?«
»Museen zahlen nicht«, erwiderte Catherine und klopfte sich den Staub von der Bluse. »Die privaten Sammler zahlen …« Sie sah Hungerford an. »Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Bis jetzt wissen wir nicht, ob das, was ich gefunden habe, überhaupt einen Wert hat.«
»Wie alt ist das Zeug?« fragte er und deutete auf das Bündel, das sie aus dem Tunnel mitgebracht hatte.
»Vielleicht siebtes oder achtes Jahrhundert«, antwortete Catherine, während sich alle um sie drängten und neugierig den Fund anstarrten. Catherine war über und über mit Staub und Sand bedeckt. Ihre kastanienbraunen Haare waren wie mit Puder bestäubt. Sie stand zwar wieder im hellen Sonnenlicht und atmete den frischen Meereswind, aber noch immer saß ihr die Angst im Nacken, die sie in dem engen unterirdischen Gang und am Rand des tiefen Brunnens erfaßt hatte.
»Die Webart des Leinens und die Verschnürung weisen auf eine nachbyzantinische Zeit hin.«
»Das heißt also«, sagte Hungerford mit gerunzelter Stirn, »es stammt nicht aus dem ersten Jahrhundert?«
»Leider nein«, antwortete Catherine und versuchte, soviel Enttäuschung wie möglich in ihre Stimme zu legen. Erleichtert stellte sie fest, daß die anderen ebenso enttäuscht waren wie Hungerford. In der vergangenen Stunde, während sie den unterirdischen Gang erkundet hatte, waren die Erwartungen der Leute gestiegen. Alle hatten auf einen spektakulären Fund gehofft.
»Und der Wert?« fragte Hungerford verdrießlich, als sei der schlichte, verrottete Korb dafür verantwortlich, daß seine Träume von Geld und Ruhm wie eine Seifenblase geplatzt waren.
»Je nachdem …«, sagte Catherine und wich seinem Blick aus.
»Ich glaube, der Korb gehörte einem der Einsiedler, von denen ich Ihnen erzählt habe. Ich werde Professor Gottlieb in Jerusalem anrufen. Er kann uns bestimmt schnell Gewißheit verschaffen.«
»Machen wir ihn auf.«
Catherine wich erschrocken zurück. »Nein! Wissenschaftliches Vorgehen verlangt, daß ein Fund dieser Art in Gegenwart glaubwürdiger Zeugen geöffnet wird. Ich werde sofort Kairo benachrichtigen und die zuständige Behörde informieren. Sie werden jemanden herschicken. Inzwischen sollten Sie an dieser Stelle keinerlei Arbeiten durchführen, bis das Gelände von den Regierungsbeamten untersucht worden ist.«
»Ja, ja. Ich werde meine Leute dort drüben einsetzen. Wir können inzwischen die Tennisplätze planieren.«
Der Texaner schob die Hände in die Hosentaschen und ging kopfschüttelnd davon.
Catherine ging eilig zu ihrem Zelt, zog den Reißverschluß der Zeltklappe zu und schaltete das Licht ein. Sie blieb einen Augenblick in der Mitte des Zelts stehen, um wieder ruhiger zu werden.
Hatte Hungerford ihr geglaubt? Sie hoffte es. Catherine log nur ungern, aber diesmal war ihr nichts anderes übriggeblieben. Sie durfte auf keinen Fall auch nur andeuten, daß der Fund vermutlich eine weit größere Bedeutung hatte, als sie es sich in ihren kühnsten Träumen vorstellte. Sonst wäre hier die Hölle los. Dieser Fund gehörte ihr, und je schneller sie die zuständigen Experten in Kairo informierte, desto besser.
Ihre Gedanken überschlugen sich. Wenn sich ihre Vermutungen bestätigten, dann hatte Hungerford sie mit der Sprengung nicht zu einem Fund aus dem achten Jahrhundert geführt, sondern möglicherweise enthielt der Korb Schriftrollen, die zweitausend Jahre alt waren. Dann konnte keine Rede mehr davon sein, die Ausgrabungen vorzeitig zu beenden! Die Stiftung würde ihr die Geldmittel so lange zur Verfügung stellen, wie sie brauchte, um die Arbeiten abzuschließen. Und sie würde auch alle gewünschten Arbeitskräfte bekommen.
Ihr Magen knurrte und erinnerte sie daran, daß sie nicht gefrühstückt hatte. Doch Catherine interessierte sich im Augenblick nicht für Essen. Sie mußte auf der Stelle zum Hotel Isis fahren und die Abteilung für Altertümer informieren. Sie würde keine Minute Ruhe haben, bis das Gelände von den Beamten gesichert worden war.
Als Catherine den Zündschlüssel für den Landrover suchte, hielt sie inne.
Die Bürokraten in Kairo konnten erfahrungsgemäß so schnell nichts in Bewegung setzen. Das wußte jeder. Aber Catherine brauchte sie hier auf der Stelle. Wie konnte sie das erreichen?
Sie blickte auf das Jesus-Fragment, das sie noch immer nicht übersetzt hatte. Wenn sie nach Kairo berichten konnte, daß das Fragment eindeutig aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert stammte, würde natürlich sofort jemand kommen.
Ein Blick auf die Uhr erinnerte sie daran, daß seit der Sprengung inzwischen mehr als vier Stunden vergangen waren. Sie überlegte kurz, ob sie sich die Zeit nehmen sollte, das Alter des Fragments zu bestimmen. Oder wäre es klüger, auf der Stelle zum Hotel zu fahren? Sie entschied, es könne nichts schaden, wenn sie die Behörde ein paar Minuten später informierte, legte das Fragment unter die helle Lampe, griff nach der Lupe und begann zu lesen.
Offenbar handelte es sich um den Anfang eines Briefes.
›Sabina, Eure Schwester, grüßt Euch und segnet die Gemeinschaft des Gerechten, unseres Herrn Jesus, im Haus der lieben Amelia, des verehrten …‹
Catherine zog die Augenbrauen zusammen. Was bedeutete das nächste Wort: ›διακονοσ – Diakonos‹?
Diakon …
Das konnte nicht sein. Catherine kannte die Anrede ›Diakonos – Diakon‹ aus anderen Schriften, aber nur in Verbindung mit einem Mann. Eine Frau war eine ›Diakonissa – Diakonin‹. Sie las den Satz noch einmal. Es gab keinen Zweifel. Sabina sprach von Amelia, einer Frau, als ›Diakonos – Diakon‹.
Kopfschüttelnd las sie weiter.
›Ich möchte Euch, liebe Schwestern, etwas so Erstaunliches berichten, daß meine Stimme beim Reden zittert. Aber zuerst sollt Ihr wissen, daß nur meine Stimme zu Euch spricht. Perpetua, eine gesegnete Frau, zu der ich auf höchst wundersame Weise gekommen bin, schreibt meine Worte an Euch nieder.
An dieser Stelle möchte ich Euch jedoch warnen: Lest diesen Brief im geheimen, in Sorge um Eure Sicherheit und in Furcht um Euer Leben.‹
Catherine stieß die Luft aus.
›Lest diesen Brief im geheimen und in Furcht um Euer Leben?‹
Was um alles in der Welt hatte sie gefunden?
Sie las noch einmal den Anfang:
›… der lieben Amelia, des verehrten Diakon …‹
Durch die dünne Nylonwand ihres Zelts hörte Catherine die üblichen Geräusche im Lager. Samir rief nach einer Kelle, einer der Studenten lachte laut, aus einem Kofferradio kamen die Nachrichten eines Senders in Jerusalem. All das registrierte ihr Bewußtsein kaum, während sie aufgeregt unter ihren Büchern suchte.
Als sie das entsprechende Werk gefunden hatte, suchte sie im Register und las: ›Diakonos (Strong’s Nummer: 1249-GSN) griechisch: ‹Diener›. Wird heute übersetzt als ‹Diakon›. In der Frühkirche waren Diakonai (die, die Befehle des Königs ausführen) Täufer, Prediger und Hüter des Sakraments, deshalb ist eine genauere Übersetzung im Kontext des Neuen Testaments ‹Priester›.‹
Catherine holte tief Luft. War Amelia eine Priesterin?
Eine Frau wurde in einem Brief, in dem das Wort ›Jesus‹ vorkam, als ›Priester‹ angeredet?
Das konnte nicht sein!
Catherine schlug ein Schriftbeispiel in dem Nachschlagewerk auf, griff nach der Lupe und verglich sorgfältig die Handschrift des Briefs mit den Buchstaben im Buch. Beide stimmten beinahe völlig miteinander überein. Kein Zweifel: Sabinas Brief an Amelia mußte im zweiten Jahrhundert geschrieben worden sein. Damals bekleideten jedoch nach der übereinstimmenden Ansicht von Theologen und Bibelwissenschaftlern keine Frauen das Priesteramt. Nur das hätte die Anrede ›Diakon‹ gerechtfertigt.
Sie klappte das Buch zu und versuchte, die erstaunlichen Schlußfolgerungen in ihrer Tragweite zu erfassen. Ihr Blick fiel auf das Photo der Autorin auf der Rückseite. Plötzlich erinnerte sie sich an das letzte Gespräch mit Julius. Sie hatte ihn vor einer Woche aus dem Hotel Isis angerufen.
›Ich hoffe, du kommst über die Feiertage‹, hatte er gesagt. ›Meine Eltern freuen sich darauf, dich wiederzusehen. Die ganze Familie ist zum Chanukkah-Fest hier. Danach werden sie abreisen.‹ Als sie geschwiegen hatte, fragte er: ›Cathy, besteht denn wenigstens die Möglichkeit, daß nur wir beide Weihnachten zusammensein können? Du fehlst mir so, Liebste.‹
Aber sie hatte ihm erklärt, sie könne die Ausgrabungen nicht unterbrechen. Außerdem sei Weihnachten für sie ein Tag wie jeder andere.
Seine Antwort und der Ton seiner Stimme gingen ihr nicht mehr aus dem Sinn.
›Es gab einmal eine Zeit, da hat dir Weihnachten sehr viel bedeutet, Cathy.‹ Dann sagte er: ›Du kannst der Kirche nicht ewig die Schuld an allem geben.‹
Sie hatte erwidert: ›O doch. Was beim Tod meiner Mutter geschehen ist, war ganz allein die Schuld der Kirche.‹
Ihr Blick richtete sich nachdenklich auf das Photo. Dr.Nina Alexander hatte das Handbuch des Griechischen im Neuen Testament geschrieben. Das Bild zeigte eine junge Frau mit lächelnden grünen Augen, aus denen eine wache Intelligenz sprach. Aber Catherine sah nicht die Augen, sondern sie hörte die tonlose Stimme ihrer Mutter am Ende ihres bewegten, streitbaren Lebens, als sie allein in einem Krankenhauszimmer lag und flüsterte: ›Sie hatten recht, Cathy, ich hätte nicht tun dürfen, was ich getan habe, denn mir fehlten die Beweise. Wenn ich doch nur einen Beweis gehabt hätte …‹
Catherine wollte nicht mehr an den schmerzlichen Tag denken, als ihre Mutter kurz vor dem Ende alle ihre Erkenntnisse widerrufen hatte und die Kirche schließlich doch triumphierte …
Verwirrt und innerlich aufgewühlt richtete Catherine ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Jesus-Fragment und das brisante Wort: ›Diakon‹.
Habe ich den Beweis gefunden, den meine Mutter gebraucht hätte?
Sie blickte auf den Korb und auf das Loch im Geflecht, das offenbar durch die Sprengung entstanden war. Dahinter entdeckte sie das abgerissene Ende eines Papyrus. Sie hielt das ebenfalls abgerissene untere Ende ihres Fragments daran. Die beiden Papyrus-Stücke paßten zusammen. Das bedeutete, das Ende des Briefes nach den Worten: ›in Sorge um Eure Sicherheit und in Furcht um Euer Leben‹ befand sich in dem Korb.
Catherine zögerte nicht mehr. Behutsam legte sie das Jesus-Fragment in eine verschließbare Kassette und schob sie zusammen mit dem Korb unter ihr Feldbett. Sie sah die Schlüssel für den Landrover neben dem Waschtisch, steckte sie ein und blickte auf die Uhr. In Kalifornien war es kurz nach Mitternacht. Hoffentlich war Julius zu Hause und nicht im Institut bei einem seiner Tests, die manchmal die ganze Nacht dauerten.
Catherines Plan stand fest. Zuerst würde sie Samir bitten, ihr Zelt zu bewachen, dann Julius aus dem Hotel Isis anrufen, danach Daniel in Mexiko und schließlich feststellen, mit welchem Flugzeug sie Ägypten so schnell wie möglich verlassen konnte.
Die Abteilung für Altertümer in Kairo würde sie nicht anrufen. Inzwischen sah die ganze Sache anders aus.
Als sie die Zeltklappe zurückschlug, um hinauszugehen, hörte sie einen Motor aufheulen. Sie vermutete, daß einer ihrer Leute zum Einkaufen nach Scharm el Scheich fahren wollte, und ging um das Zelt herum. Aber als sie sah, daß Hungerford in seinem Jeep in Richtung der Hotels davonbrauste, verriet ihr die Staubwolke, daß er es offenbar sehr eilig hatte.
Er wird reden!
In diesem Augenblick wußte Catherine, wenn das geschah, dann waren die Ausgrabung, der Fund und möglicherweise sogar ihre persönliche Sicherheit in großer Gefahr.
Santa Fe, New Mexico
»Erika! Erika, komm schnell!« Miles Havers nahm die Hand seiner Frau und zog Erika aus dem Sessel.
»Aber Miles! Ich bin doch gerade …«
»Das mußt du sehen, Liebling! Schnell, beeil dich!«
Er lief mit ihr nach draußen und durchquerte dabei eine verglaste Veranda mit alten spanischen Möbeln und sehr bequemen Rattansesseln. Er machte so große Schritte, daß sie beinahe rennen mußte.
»Du wirst staunen!« rief er so laut, daß sich seine Stimme an der getäfelten Decke brach und von den weißen Wänden ihres beinahe tausend Quadratmeter großen Hauses aus Adobeziegeln widerhallte.
Erika lachte. Sie hatte keine Ahnung, welche aufregende Überraschung Miles ihr zeigen wollte. Bei ihrem Mann mußte sie auf alles gefaßt sein. Es konnte eine ungewöhnliche Wolkenformation oder ein neuer superschneller Mikrochip sein. Aber wie immer ließ sie sich sofort von seiner Begeisterung anstecken. In den dreißig Jahren ihrer Ehe hatte es keinen einzigen Augenblick der Langeweile gegeben.