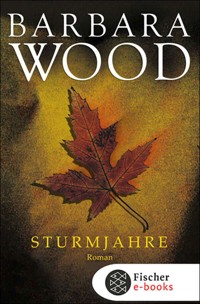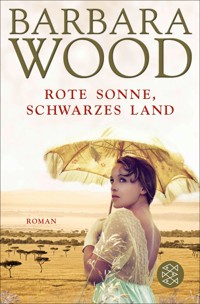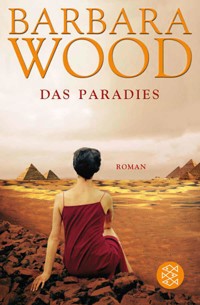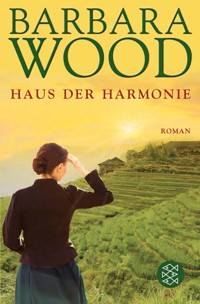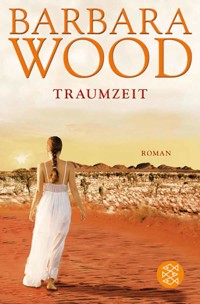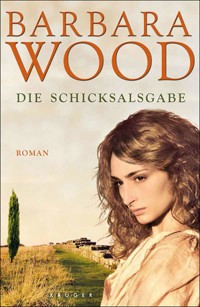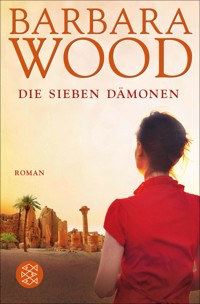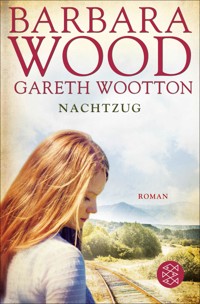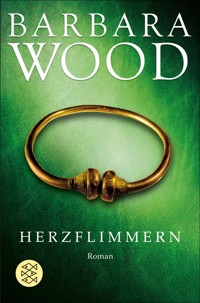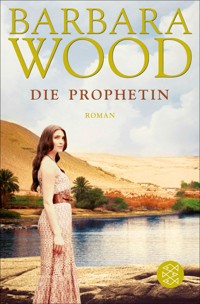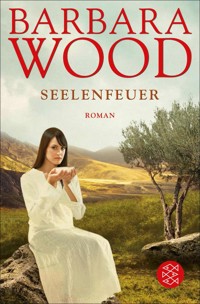
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon bei Selenes Geburt wurde deutlich, daß sie etwas Besonderes war: sie besaß die Gabe des »Seelenfeuers«, sie hatte die Kraft zu heilen – andere und, an einem Wendepunkt ihres Lebens, auch sich selbst. Im farbigen ersten Jahrhundert vor Christi Geburt wächst Selene bei einer Heilerin im Nahen Osten auf. Sie lernt die Anwendung der Heilkräuter, die Kunst des Schneidens und die Vervollkommnung ihrer Gabe. An ihrem 16. Geburtstag trifft sie Andreas, einen Arzt, und sie weiß, daß sie für immer füreinander bestimmt sind. Aber das Orakel spricht anders: Selene hat eine Prophezeiung zu erfüllen und ihre persönliche Bestimmung zu finden. Die Götter sind mit ihr, als sie durch die farbenprächtigen Länder des Mittelmeerraumes zieht und die wechselvollen Abenteuer einer Außenseiterin durchlebt. Sie ist besessen von dem Willen, ihre Heilkunst auszubilden, um allen Menschen helfen zu können: die Folge sind beschwerliche Reisen, Mißgunst und harte Arbeit. Bis schließlich ihr Lebenstraum, ein eigenes Krankenhaus, Wahrheit wird und Andreas wieder vor ihrer Tür steht ... Aber noch weichen ihre Widersacher nicht zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Barbara Wood
Seelenfeuer
Roman
Roman
Aus dem Amerikanischen von Mechthild Sandberg
Fischer e-books
Prolog
Viele Omen hatten den Tag gekennzeichnet, darum wußte die Heilerin, schon ehe sie das späte, dringliche Klopfen an ihrer Tür hörte, daß diese Nacht ihr Leben für immer verändern würde.
Seit Tagen hatte sie die Vorzeichen wahrgenommen: ihre eigenen bedeutungsschweren Träume – von Schlangen und einem blutroten Mond – und die Träume jener, die sie aufsuchten, schwangere Frauen, denen geträumt hatte, sie hätten Tauben geboren, und jungfräuliche Mädchen, die im Schlaf von beunruhigenden Bildern heimgesucht worden waren. Im Beduinenlager südlich der Stadt war ein Kalb mit zwei Köpfen zur Welt gekommen, und auf den Straßen hatte man um Mitternacht den Geist des Andrachus wandeln sehen, der, obwohl seinem Körper das Haupt fehlte, immer wieder die Namen seiner Mörder gerufen hatte. So viele Zeichen, daß sie nicht zu übersehen waren. Aber wem gelten diese Zeichen? fragten die Bürger der Wüstenstadt Palmyra mit ängstlichen Blicken.
Sie gelten mir, dachte die Heilerin, ohne zu wissen, woher sie das wußte.
Und als sie kurz nach Mondaufgang das verzweifelte Klopfen an ihrer Tür hörte, wußte sie: Dies ist die angekündigte Stunde.
Sie warf sich ein Tuch um die schmalen Schultern und öffnete, die Lampe in der Hand, die Tür, ohne zuvor zu fragen, wer da sei. Andere Bewohner Palmyras hätten den nächtlichen Besuch eines Fremden vielleicht gefürchtet; Mera nicht. Zu ihr kamen die Menschen, um sich Hilfe zu holen; sie wollten Medizin und Zaubersprüche, Linderung ihrer Schmerzen und Ängste. Keiner kam, um ihr Böses anzutun.
Ein Mann und eine Frau standen in der windgepeitschten Dunkelheit auf der Schwelle. Der Mann hatte weißes Haar und edle Gesichtszüge, an seinem blauen Umhang glänzte eine goldene Spange. Die Frau war kaum dem Kindesalter entwachsen, ihr weites Gewand verbarg kaum den gewölbten Leib. Die Augen des Mannes waren voller Furcht. Das Gesicht des Mädchens war schmerzverzerrt.
Mera trat zurück, so daß der Wind die beiden hereintreiben konnte. Sie hatte Mühe, die Tür zu schließen. Das Licht der Lampe flackerte unruhig, Meras lange, schwarze Zöpfe bewegten sich im Wind. Als die Tür zu war, drehte sie sich um und sah, daß die junge Frau auf die Knie gesunken war.
»Es ist ihre Stunde«, sagte der Mann, während er sie mit den Armen umfing und sich bemühte, sie aufrechtzuhalten.
Mera stellte die Lampe nieder und wies mit dem Kopf auf die Matte in der Ecke. Sie half ihm, die junge Frau niederlegen.
»In der Stadt sagte man uns, daß du helfen würdest«, begann er.
»Wie heißt sie?« fragte Mera. »Ich muß ihren Namen wissen.«
In seine Augen trat ein gehetzter Ausdruck. »Ist es notwendig?«
Mera spürte seine Furcht; sie berührte sie wie kalter Winterregen. Sie sah ihm in die angsterfüllten Augen und legte ihm die Hand auf den Arm. »Schon gut. Die Göttin weiß ihn.«
Flüchtlinge, dachte Mera, während sie sich eilig an die Arbeit machte. Vor irgend etwas oder irgend jemandem auf der Flucht. Wohlhabend nach ihren feinen Gewändern zu urteilen. Und sie kommen von weit her, sind fremd in Palmyra.
»Sie ist meine Frau«, sagte der Mann, der, unsicher was er tun sollte, in der Mitte des Raumes stehengeblieben war. Er musterte die Hebamme aufmerksam. Er hatte erwartet, in diesem Haus am Rande der Stadt, ein altes Weib vorzufinden. Doch diese Frau war schön und gewiß nicht alt, auch wenn er ihr Alter nicht schätzen konnte. Er breitete hilflos die Hände aus.
Glatte Hände, wie Mera im flackernden Lampenschein bemerkte. Langgliedrige, schöne Hände, die zu dem Mann paßten, der groß und gut gebaut war und zu den Gebildeten zu gehören schien. Ein Römer, vermutete sie. Ein Römer von hohem Rang.
Sie wünschte, sie hätte Zeit gehabt, um alles richtig vorzubereiten; um die Sterne und die astrologischen Karten zu befragen. Aber die Geburt stand unmittelbar bevor.
Der Mann beobachtete die weise Frau, während sie eilig Wasser heiß machte und Leinentücher zurechtlegte. Der Herbergswirt hatte mit Ehrfurcht von ihr gesprochen. Sie sei eine Zauberin, hatte er gesagt, und ihr Zauber sei sogar noch mächtiger als der Ishtars. Aber warum, fragte sich der Römer, während er sich in dem kleinen Raum umsah, lebte sie dann in solcher Armut? Ohne einen Sklaven, der nächtlichen Besuchern die Tür öffnete.
»Halte ihr die Hände«, sagte Mera, als sie zwischen den Beinen der jungen Frau niederkniete. »Welchen Gott habt ihr?«
Er zögerte einen Moment, ehe er antwortete: »Wir verehren Hermes.«
Sie kommen aus Ägypten! Mera nickte befriedigt. Sie war selbst Ägypterin und daher innig vertraut mit Hermes, dem Heilsgott. Rasch neigte sie sich über die Frau und machte das Zeichen des Kreuzes des Hermes, wobei sie Stirn, Brust und Schultern der Liegenden berührte. Dann richtete sie sich wieder auf und bekreuzigte sich selber. Hermes war ein mächtiger Gott.
Es war eine schwierige Geburt. Das Becken der jungen Frau war schmal; immer wieder schrie sie vor Schmerzen. Der Mann kniete fürsorglich an ihrer Seite, drückte ihr ein feuchtes Tuch auf die Stirn und hielt ihre Hände, während er in dem Dialekt des Niltals, den Mera selbst vor vielen Jahren gesprochen hatte, leise auf sie einredete. Wie süße Musik trafen die Worte Meras Ohren. Ich bin zu lange fort gewesen, dachte sie, während sie sich bemühte, dem Ungeborenen ins Leben zu helfen. Vielleicht gewährt mir die Göttin vor meinem Tod einen letzten Blick auf meinen grünen Strom …
»Es ist ein Junge«, sagte sie endlich und sog sachte an Näschen und Mund des Kindes.
Der Römer neigte sich zu ihr, und sein Schatten fiel über den Säugling wie eine schützende Decke. Die junge Frau, von den Wehen erlöst, seufzte tief auf. Nachdem Mera die Nabelschnur verknotet und abgeschnitten hatte, legte sie das Kind an die Brust der Mutter und sagte leise: »Du mußt ihm jetzt seine Namen geben. Schütze ihn, Mütterchen, damit der Wüstendschinn ihn nicht stehlen kann.«
Die junge Frau drückte die aufgesprungenen Lippen an das rosige kleine Ohr und flüsterte den Seelennamen ihres Sohnes, der nur ihm und den Göttern bekannt sein würde. Und danach sagte sie laut, wenn auch mit schwacher Stimme, seinen Lebensnamen: »Helios.«
Befriedigt wandte sich Mera wieder ihrer Arbeit zu. Doch während sich draußen das Pfeifen des Windes zu wildem Geheul steigerte und Türen und Läden klapperten, sah sie im ungewissen Licht etwas, das sie erschreckte. Ein blaugeädertes Händchen schob sich durch den Geburtskanal.
Ein Zwilling!
Wieder schlug sie das Kreuz des Hermes und schickte ihm das heilige Zeichen der Isis nach, um sich für die zweite Geburt bereitzumachen. Sie hoffte aus tiefstem Herzen, daß die junge Frau die Kraft besaß, sie durchzustehen.
Nun schien es wahrhaftig, als rüttelten die Dschinn an der Tür, um die zwei neuen Leben zu rauben, so schrill heulte der Sturm. Meras Häuschen, aus festen Lehmziegeln, zitterte und bebte, als wollte es jeden Augenblick einstürzen. Die junge Frau schrie mit dem Wind. Ihre Wangen brannten fiebrig; ihr Haar war feucht von Schweiß. Besorgt legte Mera ihr ein Amulett um den Hals, einen aus Jade geschnitzten Frosch, das heilige Tier der Hekate, Göttin der Hebammen.
Sonderbarerweise hatte das Neugeborene, das noch immer an der Brust seiner Mutter lag, bisher keinen Laut von sich gegeben.
Endlich gelang es Mera, das zweite Kind ins Licht zu holen. Mit tiefer Erleichterung sah sie, daß es lebte. Doch während sie dabei war, die Nabelschnur zu durchschneiden, hörte sie neben dem Heulen des Windes andere Geräusche. Mit einem Ruck hob sie den Kopf und sah, daß der Römer zur Tür starrte.
»Pferde«, sagte er. »Soldaten.«
Gleich darauf erschütterten donnernde Schläge die Tür. Das war nicht jemand, der um Einlaß bat, das waren Leute, die die Tür aufbrechen wollten.
»Sie haben uns gefunden«, sagte er.
Blitzschnell war Mera auf den Beinen. »Komm!« zischte sie und rannte zu der schmalen Tür am Ende des einzigen Raumes im Haus. Sie blickte nicht zurück, sah nicht die rotgekleideten Soldaten, die hereinstürmten. Ohne zu überlegen tauchte sie in die Finsternis des Vorratsschuppens, der sich an ihr Haus anlehnte, und kletterte, das neugeborene kleine Mädchen naß und nackt an ihr Herz gedrückt, in den Maistrog, wo sie sich unter Hülsen und Blättern so klein wie möglich zusammenrollte. Kaum atmend lag sie in der Finsternis und lauschte den schweren Tritten auf dem Fußboden aus festgetrampelter Erde: ein kurzer Wortwechsel in griechischer Sprache, eine scharfe Frage, der eine kurze Antwort folgte, ein pfeifendes Zischen zerschnitt die Luft, zwei Schreie, dann Stille.
Mera schauderte. Der Säugling in ihren Armen zitterte. Wieder hörte sie die schweren Schritte. Sie näherten sich dem Schuppen. Durch die Ritzen im Trog sah sie ein Licht. Dann hörte sie die Stimme des vornehmen Römers, schwach und atemlos. »Es ist niemand hier, sage ich euch. Die Hebamme war nicht im Haus. Wir sind allein. Ich – ich selbst habe das Kind geholt …«
Zu ihrem Entsetzen begann das Kind in ihren Armen zu wimmern. Hastig legte sie ihre Hand auf das kleine Gesichtchen und flüsterte: »Gesegnete Mutter, Königin des Himmels, laß nicht zu, daß dieses Kind getötet wird.«
Sie hielt den Atem an und lauschte wieder. Nun war nichts mehr um sie herum als Dunkelheit und Stille, und draußen das Pfeifen des Windes. Sie wartete. Das Kind an ihre Brust gedrückt, lag Mera eine Ewigkeit, wie ihr schien, im Maistrog. Ihr Körper begann zu schmerzen, das Kind wurde unruhig. Aber sie mußte in ihrem Versteck aushalten.
Endlich glaubte Mera eine Stimme zu hören. »Frau!« klang es schwach zu ihr herüber.
Vorsichtig richtete sie sich auf. In der Düsternis vor Tagesanbruch konnte Mera nur undeutlich die verkrümmte Gestalt auf dem Boden des Zimmers erkennen.
Wieder rief der Römer schwach: »Frau, sie sind fort …«
Glieder und Muskeln schmerzten, als sie aus dem Trog stieg und zu dem Mann hinüberging, der blutüberströmt auf dem Boden lag. »Sie haben sie mitgenommen«, stieß er hervor. »Meine Frau und meinen Sohn …«
Entsetzt blickte Mera zu der leeren Matte hinüber.
Der Römer hob zitternd einen Arm. »Meine Tochter … laß mich …«
Sie kamen, um den Vater zu töten, ging es Mera durch den Kopf, während sie dem sterbenden Mann den nackten Säugling in die Hände gab. Und doch haben sie Mutter und Sohn lebend mitgenommen. Warum?
»Ihre Namen«, stöhnte der Mann. »Ich muß ihr ihre Namen geben, ehe …«
Mera schob den Kopf des Säuglings dicht an seinen Mund und sah, wie seine Lippen den geheimen Namen formten, der das geistige Band eines Kindes zu den Göttern war, und den wegen seines mächtigen Zaubers kein Sterblicher hören durfte. Dann sprach er laut ihren Lebensnamen: »Selene. Sie heißt Selene …«
»Und jetzt laß mich deine Wunden versorgen«, sagte Mera sanft, aber er verneinte mit einem Kopfschütteln. Und sie sah, warum: Der Römer lag in unnatürlicher Haltung hingestreckt.
»Bring sie von hier fort«, flüsterte er. »Sofort. Noch heute nacht. Sie dürfen sie nicht finden. Versteck sie. Sorge für sie. Sie kommt von den Göttern.«
»Aber wer bist du? Was soll ich ihr sagen, wer ihre Eltern sind, welcher Familie sie angehört?«
Er schluckte krampfhaft. »Dieser Ring – gib ihn ihr, wenn sie älter ist. Er wird ihr – alles sagen. Er wird sie zu dem führen, was ihr bestimmt ist. Sie gehört den Göttern …«
Der Römer starb, als Mera ihm den schweren goldenen Ring vom Finger streifte, und im selben Moment begann das Kind – Selene – zu weinen.
Mera sah zu ihm hinunter und entdeckte mit Schrecken, daß der Mund nicht normal gestaltet war – ein kleiner Geburtsfehler. Aber plötzlich begriff sie: Es war das Zeichen dafür, daß dieses Kind in der besonderen Gunst der Götter stand. Der Römer hatte die Wahrheit gesprochen: Dieses kleine Mädchen stammte in der Tat von den Göttern ab.
Erstes Buch
Antiochien in Syrien
1
Selene überquerte gerade den Marktplatz, als das Unglück geschah. Sie kam nur selten in diesen Teil der Stadt, die nördliche Vorstadt mit ihren breiten Prachtstraßen und den Häusern der Reichen, und war an diesem heißen Julitag nur hierhergekommen, um ein Geschäft aufzusuchen, das seltene Heilkräuter verkaufte. Ihre Mutter brauchte Bilsenkraut für einen Schlaftrank. Was Mera nicht in ihrem Kräutergarten ziehen oder auf dem großen Markt der Unterstadt kaufen konnte, mußte ihr Selene bei Paxis, dem Griechen, besorgen. So kam es, daß sie gerade in dem Moment über den Marktplatz ging, als dem Teppichhändler der Unfall zustieß.
Selene sah, wie es geschah. Der Mann hatte mehrere Teppiche auf dem Rücken seines Esels festgezurrt und bückte sich, um das herabhängende Stück Strick aufzuheben, da schlug das Tier plötzlich aus und traf den Händler mit schwerem Schlag seitlich am Kopf.
Selene riß einen Moment erschrocken die Augen auf, dann lief sie zu dem Verunglückten. Achtlos ließ sie ihren Korb samt seinem kostbaren Inhalt fallen, kniete neben dem Bewußtlosen nieder und legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Er blutete stark, und sein Gesicht war aschgrau.
Einige Vorüberkommende blieben stehen und schauten neugierig, aber keiner machte Anstalten zu helfen. Selene sah zu den Umstehenden auf.
»H-hilfe!« rief sie. »Er ist v-v-v- …« Angestrengt verzog sie das Gesicht, während sie sich vergeblich bemühte, die Worte hervorzubringen.
Die Leute um sie herum starrten sie an. Sie konnte ihnen an den Gesichtern ablesen, was sie dachten. Eine Schwachsinnige! Sie kann ja nicht einmal sprechen.
»E-er ist v-verletzt!« stieß sie hervor, das Blut des Verunglückten an ihren Händen.
Die Umstehenden tauschten Blicke. »Dem ist nicht mehr zu helfen«, sagte ein Tuchhändler, der aus seinem Laden geeilt war und jetzt die teuren Teppiche musterte und überlegte, wie er sie in seinen Besitz bringen könnte. »Die Behörden werden dafür sorgen, daß er beerdigt wird.«
»Er ist nicht t-tot!« widersprach Selene, doch die Leute hatten schon das Interesse verloren und wandten sich ab. Vergeblich rief Selene ihnen nach, sie sollten doch helfen, irgend etwas tun.
»Was gibt es denn?« fragte plötzlich jemand neben ihr.
Selene hob den Kopf. Ein Mann von gebieterischem Auftreten, in der weißen Toga des römischen Bürgers, stand vor ihr.
»D-der Esel hat ausg-geschlagen«, artikulierte sie so deutlich sie vermochte. »Und ihn am K-kopf getr-troffen.«
Der Fremde musterte sie. Die Einkerbung zwischen seinen Brauen gab dem Gesicht einen finsteren Ausdruck; doch die Augen schienen freundlich. Er betrachtete sie einen Moment, die Augen, die um Hilfe flehten, den Mund, der sich ungeschickt mit den Worten abplagte, dann sagte er: »Nun gut«, kniete nieder und untersuchte rasch den Verletzten. »Komm mit mir. Vielleicht können wir ihn retten.«
Der Fremde winkte einem Begleiter, einem kräftigen Sklaven, der den Bewußtlosen auf seine breiten Schultern lud. Dann gingen die beiden Männer mit Selene an ihrer Seite, die groß war und gut Schritt halten konnte, in schnellem Tempo die Straße hinunter. Selene dachte nicht an ihren Korb, der auf dem Platz zurückgeblieben war und nun Beute eines Bettlers wurde; sie dachte auch nicht an ihre Mutter, die im Armenviertel Antiochiens auf die Bilsenkrautsamen wartete, die sie für eine Abtreibung brauchte.
Sie traten durch ein Tor in einer hohen Mauer in einen Garten voller Sommerblumen. Nie zuvor hatte Selene ein so prächtiges Haus mit so großen, luftigen Räumen gesehen, nie zuvor hatte sie Fuß auf so edlen, von Mosaiken gezierten Boden gesetzt. An schimmernden Marmorwänden vorbei folgte sie dem Herrn und seinem Sklaven durch das Atrium in einen Raum, der größer war als ihr ganzes Haus und sparsam ausgestattet mit einer Liegestatt, mehreren Stühlen und Tischen mit goldglänzenden Beinen.
Nachdem der Sklave den Verletzten auf dem Ruhebett niedergelegt und ihm Kissen unter den Nacken geschoben hatte, legte der Fremde seine weiße Toga ab und schickte sich an, die Kopfverletzung zu untersuchen.
»Ich bin Andreas«, sagte er zu Selene. »Ich bin Arzt.«
Der Sklave zog Schubladen auf, goß Wasser in eine Schale, legte Leinentücher und Instrumente bereit. Selene sah mit großen Augen zu, wie der Arzt den Kopf des Teppichhändlers rasierte, um dann die blutende Wunde mit Wein und Essig zu säubern.
Während er arbeitete, sah Selene sich aufmerksam um. Welch ein Unterschied zu dem Raum, in dem Mera ihre Heilkünste ausübte! In dem Haus, das nur aus einem Zimmer bestand, war jeder Winkel vollgestopft mit den Berufswerkzeugen ihrer Mutter. Krücken hingen an den Wänden, in Regalen stapelten sich Dosen und Töpfe, Kräuter und Wurzelwerk hingen von der niedrigen Decke herab, Schalen türmten sich in Schalen, Verbandzeug war in jeder Nische untergebracht. Das Häuschen war eine heimelige und vertraute Zuflucht für die Kranken und Verletzten des Armenviertels von Antiochien; und es war das einzige Heim, das Selene in ihrem beinahe sechzehnjährigen Leben kennengelernt hatte.
Aber dieser Raum hier! Groß und hell, mit glänzendem Fußboden und einem Fenster, durch das Sonnenlicht hereinströmte, mit kleinen Tischen, auf denen klar angeordnet Instrumente und Schwämme bereitlagen und kleine Behälter in ordentlichen Reihen nebeneinander standen. Und in der Ecke ein Standbild des Äskulap, des Gottes der Heilkunde. Dies, erkannte Selene, war der Behandlungsraum eines griechischen Arztes; sie hatte davon gehört, wie fortschrittlich diese Ärzte waren.
Als sie sah, wie sachkundig Andreas die Kopfhaut des Verletzten mit einem Messer aufschnitt, wußte sie, daß sie richtig vermutet hatte. Dieser Mann war vielleicht sogar in Alexandria ausgebildet worden.
Andreas hielt plötzlich in seiner Arbeit inne und sah sich nach Selene um. »Du kannst im Atrium warten. Mein Sklave ruft dich, wenn ich fertig bin.«
Aber sie schüttelte den Kopf und blieb.
Er maß sie mit einem flüchtigen Blick der Verwunderung, ehe er sich wieder seiner Aufgabe widmete. »Zuerst müssen wir feststellen, ob ein Bruch vorliegt.« Er sprach das Griechisch des gebildeten Mannes, das Selene in ihrem Viertel selten zu hören bekam. »Und um die Bruchstelle zu finden, tragen wir das hier auf …«
Während Andreas eine dicke schwarze Paste auf den geöffneten Schädel gab, trat Selene näher. Fasziniert beobachtete sie die Bewegungen der langen, schlanken Finger. Nachdem Andreas die Paste einen Moment hatte einwirken lassen, nahm er sie wieder ab.
»Da«, sagte er und wies auf eine schwarze Linie im Schädelbein. »Da ist der Bruch. Siehst du, wie der Knochen da eingedrückt ist? Er drückt auf das Gehirn. Wenn der Druck nicht beseitigt wird, stirbt der Mann.«
Selene war wie gebannt. Sie half ihrer Mutter seit Jahren bei der Versorgung der Kranken und Verletzten und hatte in dieser Zeit viel gesehen und gelernt, aber noch nie hatte sie eine solche Operation miterlebt.
Andreas ergriff ein Instrument, das ganz ähnlich aussah wie der Drillstab, den Selene und ihre Mutter benutzten, um Feuer anzufachen. »Malachus«, befahl er dem Sklaven, »halte ihn mir ruhig bitte.«
Staunend sah Selene zu, wie Andreas’ Hände in ruhigem, gleichmäßigem Rhythmus den Bohrer benutzten und Malachus die Wunde ab und zu mit Wasser auswusch. Schließlich legte Andreas das Instrument aus der Hand.
»Da ist es, das Ei, das ihn getötet oder für immer gelähmt hätte«, sagte er.
Selene sah es. Eingebettet wie in einem Nest, lag das Ei des bösen Geistes, der in den Huf des Esels gefahren war, zwischen Schädeldecke und Gehirn. Sie war tief beeindruckt. Wenn man Mera Menschen mit Kopfverletzungen brachte, pflegte sie den Patienten einen Breiumschlag aus Opium und Brot aufzulegen, sprach ein Gebet, gab ihm ein Amulett und ließ ihn wieder fortbringen. Die meisten Patienten mit derartigen Verletzungen starben. Selene wartete mit großer Spannung, ob sie jetzt ein Wunder erleben würde.
Andreas nahm ein Instrument, das aussah wie eine stumpfe Pflanzkelle, schob es vorsichtig unter die Schädeldecke und hob den auf das Gehirn drückenden Knochen an. Augenblicklich stieß der Mann einen tiefen Seufzer aus, sein Gesicht bekam Farbe, seine Atemzüge wurden tiefer.
Andreas arbeitete mit höchster Konzentration. Sein Gesicht wirkte streng durch die steile Falte, die sich zwischen den zusammengezogenen Brauen gebildet hatte. Die Lippen unter der großen, gebogenen Nase waren zu einer dünnen Linie zusammengepreßt, der Unterkiefer, durch einen kurzgestutzten braunen Bart konturiert, war angespannt. Selene meinte, er müsse etwa dreißig Jahre alt sein, obwohl sich im dunklen Haar an seinen Schläfen schon erste graue Fäden zeigten.
Er hob das Ei unversehrt heraus, doch zugleich strömte viel Blut aus der Wunde. Ohne sich davon beirren zu lassen, arbeitete Andreas ruhig und schweigend weiter. Sein Gesicht war ernst, doch es zeigte keine Furcht. Und doch glaubte Selene, er müsse jeden Augenblick die Instrumente hinwerfen und rufen: »Es ist nicht zu schaffen.«
Doch Andreas arbeitete unbeirrt, Augen, Hände, seine ganze Geisteskraft auf den Patienten konzentriert. Seine unerschrockene Entschlossenheit rief bei Selene tiefen Respekt hervor.
Endlich ließ die Blutung nach, und Andreas legte die Instrumente aus der Hand. Er säuberte die Wunde mit Wein, füllte die Öffnung mit angewärmtem Bienenwachs und zog dann die Ränder der Kopfhaut zusammen. Als er sich dann die Hände wusch, sagte er zu Selene: »Wenn er innerhalb von drei Tagen wieder zu Bewußtsein kommt, wird er am Leben bleiben. Wenn nicht, wird er sterben.«
Selene sah ihm einen Moment lang in die Augen und wünschte, sie könnte die vielen Fragen, die in ihrem Kopf herumschwirrten, in klare Worte fassen.
Plötzlich schrie der Mann auf dem Bett auf und begann, mit den Armen um sich zu schlagen. Der Sklave Malachus, der damit beschäftigt gewesen war, den Kopf zu verbinden, sprang zurück.
»Ein Anfall«, sagte Andreas und eilte zum Bett. Er versuchte, die Arme des Mannes zu fassen, doch es gelang ihm nicht. »Hol Stricke«, befahl er Malachus. »Und bring Polibus mit. Wir brauchen Hilfe.«
Der Bewußtlose wälzte und wand sich unter wilden Zuckungen auf dem Bett wie ein vom bösen Geist Besessener. Andreas mühte sich, ihn zu halten, um zu verhindern, daß er vom Bett stürzte, wurde aber immer wieder von den fuchtelnden Armen zurückgestoßen. Der Kopf des Mannes hämmerte in heftigem Auf und Nieder auf die Kopfstütze, so daß die Wunde aufbrach und unter dem Verband zu bluten begann. Ein befremdliches Knurren drang aus dem Mund des Mannes, die Sehnen an seinem Hals standen in dicken Strängen hervor.
Endlich kam Malachus mit einem Sklaven von riesenhaftem Wuchs zurück, und zu dritt schafften es die Männer, die Arme und Beine des Patienten an das Bett zu fesseln. Doch selbst dann ließ der Anfall nicht nach. Während der Tobende sich unter seinen Fesseln aufbäumte, krachten seine Glieder, als wollten sie jeden Moment brechen.
»Dagegen können wir nichts tun«, bemerkte Andreas bedrückt. »Er wird sich umbringen.«
Selene starrte ihn an, flüchtig trafen sich ihre Blicke, dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Tobenden. Eine Möglichkeit gab es noch …
Ohne ein Wort trat sie an das Krankenbett. Sie schloß die Augen und beschwor vor ihrem inneren Auge ein Bild herauf – das Bild einer ruhig und stetig brennenden goldgelben Flamme. Mit allen Sinnen gab sie sich der Vision der stetig brennenden Flamme hin, bis sie ihre Wärme zu fühlen begann und ihr sachtes Knistern hören konnte. Während sie sich auf die Flamme konzentrierte, die ihren Ursprung in der Tiefe ihrer Seele hatte, verlangsamte Selene ihren Atem und entspannte ihren Körper. Es war ein Vorgang, der ihr Stunden zu dauern schien, tatsächlich aber in Sekunden ablief – das Sammeln all ihrer Kräfte im Feuer dieser Flamme.
Für die Beobachter, Andreas und seine beiden Sklaven, sah es aus, als wäre sie in Schlaf gesunken. Ihr Gesicht verriet nichts von ihrer inneren Konzentration, nichts von dem, was in ihr vorging, die Bündelung der in ihr wachsenden Kräfte nämlich. Verwundert sahen sie zu, wie das Mädchen, ruhig und gleichmäßig atmend, langsam die Hände hob, um sie direkt über den zuckenden Körper des Verletzten zu halten. Die Innenflächen abwärts gekehrt, schwebten die Hände dicht über dem Mann, ohne ihn zu berühren, und begannen sich zu bewegen, in kleinen Kreisen zuerst, die allmählich immer größer wurden, bis sie den Körper des Kranken in seiner ganzen Länge überspielten.
Selene sah nur die Flamme, und nichts als die Flamme. Geradeso, wie Andreas all seine Verstandeskräfte auf die Operation gerichtet hatte, ließ Selene nun all ihre Lebensenergien in das Bild der Flamme einströmen. Und als sie mit ihr Verbindung bekam, floß die Wärme der Flamme aus ihrer Seele heraus in ihre Arme und durch ihre Hände und hüllte den rastlosen Körper des Verletzten ein.
Andreas beobachtete neugierig die leicht schwankende Gestalt des Mädchens. Er musterte das Gesicht – die hohen Wangenknochen, den volllippigen Mund –, das Augenblicke zuvor Scheu und Befangenheit gezeigt hatte, jetzt aber in einer ruhigen Heiterkeit leuchtete. Sie hielt die Hände über den Kranken, bis der gemarterte Körper sich langsam zu entspannen begann, ruhiger wurde und schließlich von Schlaf umfangen wurde.
Selene öffnete die Augen und blinzelte wie im Erwachen.
Andreas runzelte die Stirn. »Was hast du getan?«
Ihre Scheu war zurückgekehrt, und sie vermied es, ihn anzusehen. Sie war es nicht gewöhnt, mit Fremden zu sprechen. Sie reagierten mit Befremden, wenn sie so unbeholfene Rede aus ihrem wohlgeformten Mund vernahmen; und nach dem Befremden kam immer die Ungeduld, dann die Verachtung, die besagte, eine Schwachsinnige. Eigentlich, sagte sich Selene oft, hätte sie nach den langen Jahren grausamer Neckereien von ihren Altersgenossen und ständigen Nichtbeachtetwerdens an den Marktständen dagegen gefeit sein müssen. Ihre Mutter hatte ihr erklärt, der Defekt, die Zungenlahmheit, die ihr angeboren und die später korrigiert worden war, sei ein Zeichen dafür, daß die Götter sie liebten.
Zu Selenes Verwunderung zeigte das schöne Gesicht des griechischen Arztes keine der üblichen Reaktionen. Sie zwang sich, ihm in die Augen zu sehen, die streng und gütig zugleich waren, und glaubte eine tiefe Menschlichkeit in ihnen zu sehen.
»I-ich habe ihm d-den Weg in d-den Sch-schlaf gezeigt«, sagte sie.
»Wie?«
Selene sprach ganz langsam. Es bereitete ihr Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen; sie brauchte Zeit, und daher kam es, daß ihre Gesprächspartner im allgemeinen ihre Sätze für sie vollendeten.
»D-das hat m-meine Mutter m-mich gelehrt.«
Andreas zog eine Augenbraue hoch. »Deine Mutter?«
»Sie ist eine Heilk-kundige.«
Andreas blieb einen Moment nachdenklich. Dann erinnerte er sich der wieder aufgebrochenen Wunde des verletzten Teppichhändlers, trat zum Bett, nahm den blutgetränkten Verband ab und ging daran, die Wunde zu versorgen. Als er fertig war, nahm er eine rostige Speerspitze und schabte mit einem Messer den Rost ab, so daß er auf die Wunde fiel. »Der Rost beschleunigt die Heilung«, erklärte er, als er Selenes fragenden Blick bemerkte. »Es ist bekannt, daß in Kupfer- und Eisenbergwerken die Geschwüre von Sklaven rascher heilen als anderswo. Warum das so ist, weiß allerdings niemand.« Er umwickelte den Kopf des Teppichhändlers mit einem frischen Verband, ließ ihn sachte auf die Kopfstütze hinunter und wandte sich dann wieder Selene zu. »Sag mir, was du getan hast, um ihn zur Ruhe zu bringen. Wie hast du es gemacht?«
Von neuerlicher Schüchternheit überkommen, blickte Selene zu Boden. »I-ich habe g-gar nichts getan«, antwortete sie. »Ich habe n-nur s-seine En-en –« Sie ballte die Hände zu Fäusten, »seine Energien aus ihrer Ververwirrung geleitet.«
»Und das bringt Heilung?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es h-heilt n-nicht. Es h-hilft nur.«
»Wirkt es immer?«
»Nein.«
»Aber wie«, drängte er. »Wie hast du es gemacht?«
Selene hielt die Lider immer noch gesenkt. »Es ist ein a-altes Ver-verfahren. M-man s-sieht eine Flamme.«
Andreas betrachtete sie aufmerksam. Sie war schön. Ein Bild trat ihm vor die Augen, die Erinnerung an eine seltene Blume, die er einmal gesehen hatte und die den Namen Hibiskus trug. Selene hatte wohlgestaltete Gesichtszüge, und das Schönste war ihr Mund. Welch grausame Ironie, dachte er, daß dieser gefällige Mund seiner Aufgabe nur so unzulänglich gerecht werden kann. Sie war nicht zungenlahm, das konnte er sehen, wenn sie sprach.
Als von dem Teppichhändler plötzlich ein lautes Schnarchen kam, lächelte Andreas und sagte: »Deine Flamme besitzt Zauberkraft, scheint mir.«
Selene hob zaghaft den Blick und sah, wie das Lächeln sein Gesicht veränderte. Er sah plötzlich viel jünger aus.
Der Sprachfehler, dachte Andreas, war möglicherweise auf einen Geburtsdefekt zurückzuführen, der in der Kindheit korrigiert worden war, aber wohl erst spät und ohne nachfolgenden Sprechunterricht. Andreas konnte sich vorstellen, wie sehr das Mädchen unter dieser Unzulänglichkeit gelitten haben mußte. Sie war ein wahrhaft schönes Mädchen, doch sie war scheu bis zur Ängstlichkeit.
Ein Schatten flog über Andreas’ Gesicht, und die steile Falte zwischen den Brauen verdüsterte wieder seine Züge. Was geht es mich an? fragte er sich, da er schon vor Jahren den Punkt erreicht hatte, wo nichts ihm mehr naheging.
Ein Windhauch wehte durch das Fenster und blähte die feinen Vorhänge. Im heißen Atem des Sommers mischten sich die Düfte von Holzfeuern und blühenden Blumen mit dem Geruch des grünen Flusses, der sich dem Meer entgegenwälzte. Der Wind fuhr seufzend durch das Haus des Arztes Andreas und riß den Griechen aus seinen Gedanken.
»Du brauchst Hilfe, um deinen Freund fortzubringen«, sagte er und winkte Malachus. »Mein Sklave wird dir helfen.«
Selene warf ihm einen verständnislosen Blick zu.
»Ich nehme an, du möchtest ihn nach Hause bringen«, fügte Andreas hinzu.
»N-n-nach Hause?«
»Ja. Zu seiner Gesundung. Was hattest du dir denn vorgestellt?«
Selene war verwirrt. »I-ich weiß n-nicht. Ich w-weiß nicht, w-wer er ist.«
Andreas war verblüfft. »Du kennst den Mann gar nicht?«
»Ich g-ging g-gerade über d-den M-m –« Selene drückte erschrocken eine Hand auf den Mund. »Mein Korb!«
»Willst du mir sagen, daß du den Mann gar nicht kennst? Warum hast du dann um Hilfe gerufen?«
»Mein Korb!« rief sie wieder. »Unser l-letztes G-geld … die M-medizin …«
Jetzt kam doch Ungeduld in seine Stimme. »Wenn du diesen Mann nicht kennst – und ich kenne ihn ganz gewiß nicht –, warum sind wir dann hier? Und warum habe ich ihn behandelt?«
Selene warf einen Blick zu dem Schlafenden hinüber. »E-er war ververletzt.«
»Er war verletzt«, wiederholte Andreas ungläubig und sah die Belustigung seines Sklaven. Sein Gesicht wurde noch finsterer. »Einen ganzen Nachmittag an einen Fremden verschenkt«, murmelte er. »Was soll ich nun mit ihm anfangen?«
Selene antwortete nicht.
Andreas’ Ungeduld schlug in Gereiztheit um. »Du hast erwartet, daß ich ihn hier behalte, wie? Ich nehme keine Patienten in meinem Haus auf. Das ist nicht die Aufgabe des Arztes. Ich habe ihn behandelt. Jetzt ist es Aufgabe seiner Familie, für seine Genesung zu sorgen.«
Selenes Gesicht zeigte Verzweiflung. »A-aber ich k-kenne seine F-familie nicht.«
Andreas starrte sie ungläubig an. War es möglich, daß diesem Kind das Los eines wildfremden Menschen am Herzen lag? Wieso war sie nicht gleichgültig wie alle anderen? Wann war er das letztemal einem Menschen von solcher Naivität begegnet? Seit Jahren nicht; nicht mehr seit den Tagen in Korinth, als er in der Wasserfläche eines Weihers sein eigenes Spiegelbild betrachtet und das Gesicht eines unreifen Jungen gesehen hatte, eines noch kindlichen, bartlosen Knaben auf der Schwelle zur Ernüchterung.
Andreas zügelte den aufsteigenden Zorn. An dieser Schwelle stand jetzt dieses Mädchen, das noch arglos war und unverdorben. Sie hatte auf dem Marktplatz angehalten und ihre Schüchternheit überwunden, um einem Menschen zu helfen, den sie nicht kannte.
Selene sah den Ausdruck auf seinem Gesicht, und eine Frage, die sie schon lange beschäftigte, meldete sich wieder. Es war eine Frage, die allem Anschein nach nicht zu lösen war: Was tat man mit den Kranken und Verletzten, wenn sie behandelt waren, aber noch nicht wieder gesund?
Immer wieder erlebte es Selene im Haus ihrer Mutter: Fremde kamen zu ihr, um sich behandeln zu lassen, und hatten dann keinen Menschen, der sie pflegen konnte. Es waren Menschen, die allein lebten, Witwen ohne Verwandte, Invaliden, die sich zurückgezogen hatten. Alle diese behandelte Mera, aber danach war niemand da, der sich um sie kümmerte. Ach, und auf den Straßen! Besonders in dem schmutzigen Viertel am Hafen, wo die Kinder sich in Horden herumtrieben, wo Prostituierte in finsteren Gassen ihre Kinder gebaren, wo namenlose Matrosen von Krankheit befallen wurden und auf dem kalten Pflaster starben. Diese Menschen waren dem Tod ausgeliefert, weil sie niemanden hatten, dem ihr Wohl am Herzen lag, weil es für sie keinen Ort gab, wo sie Zuflucht finden konnten.
Selene sagte: »B-bitte, k-kannst du ihn nicht …«
Andreas sah sie stumm an, während er sich im stillen Vorwürfe machte, daß er sich auf diese Geschichte eingelassen hatte. Aber dann wurde er weich unter ihrem flehenden Blick.
»Also gut«, sagte er endlich. »Ich werde Malachus zum Marktplatz schicken, damit er sich dort erkundigt. Vielleicht kennt dort jemand den Mann. Inzwischen –« Andreas griff nach seiner weißen Toga und legte sie sich über die Schulter – »kann er hier in der Unterkunft meiner Sklaven bleiben.«
Selene lächelte dankbar.
Sie hatte etwas sehr Anziehendes, dachte Andreas, das nicht zu definieren war. Ganz sicher kam sie nicht aus wohlhabendem Hause – ihr Gewand ließ auf ärmliche Verhältnisse schließen. Und wie alt mochte sie sein? Noch nicht sechzehn; sie trug noch das kniekurze Kleid des Kindes. Aber der Tag, an dem sie die Stola und die Palla der Frau anlegen würde, war wahrscheinlich nicht mehr fern. Wieder wanderte Andreas’ Blick wie unwiderstehlich angezogen zu ihrem schönen Mund, der süße Sinnlichkeit verhieß. Und wieder dachte er an den blutroten Hibiskus, den er einmal gesehen hatte. Der volle, rote Mund verlieh dem Gesicht einen exotischen, stark verführerischen Zug, einen Reiz, dem man sich kaum entziehen konnte. Übel hatten die Götter ihr mitgespielt, daß sie diesen Mund, ihre schönste Gabe an das Mädchen, zugleich zum lähmenden Makel gemacht hatten. Es war, als wollten sie der Schönheit des Mädchens spotten. Er fühlte sich unerklärlich angerührt von diesem Schicksal.
Impulsiv fragte er: »Was hast du auf dem Markt verloren?«
»B-bilsenkraut«, antwortete sie und hob zwei Finger, um die Menge zu zeigen.
Andreas wandte sich an Malachus. »Gib ihr, was sie braucht. Und einen Korb dazu.«
»Ja, Herr«, antwortete der Sklave erstaunt und trat zu einem Bord mit einer Reihe von Behältern.
Andreas’ Gesicht wurde wieder streng, der dunkle, grüblerische Ausdruck kehrte zurück, der ihn älter wirken ließ, doch seine Stimme war gütig. »Sei in Zukunft vorsichtig, wem du hilfst. Im Hause des Nächsten bist du vielleicht nicht so sicher wie hier.«
Errötend nahm Selene den Korb entgegen, den Malachus ihr reichte, dankte Andreas und eilte hinaus.
Er stand da und lauschte dem Klang ihrer sich entfernenden Schritte. Dann schüttelte er den Kopf. Ein ungewöhnlicher Nachmittag! Zuerst hatte er einen Fremden operiert, der ihn wahrscheinlich nie dafür bezahlen würde, dann hatte er das Mädchen, dem er das zu verdanken hatte, mit einem Vorrat der teuersten Medizin fortgeschickt. Und als Gegenleistung hatte er nichts erhalten – hatte nicht einmal, wie ihm plötzlich bewußt wurde, ihren Namen erfahren.
2
»Da! Siehst du, Tochter?« flüsterte Mera, und Selene neigte sich näher, um mit dem Auge dem Weg des bronzenen Spekulums zu folgen, das den Weg zum Muttermund offenhielt. »Das ist der Muttermund«, murmelte Mera. »Das segensreiche Tor, durch das wir alle in die Welt eintreten. Siehst du den Faden, den ich vor Monaten um den Muttermund geschlungen habe, als er sich zu öffnen drohte, noch ehe das Kind ausgereift war? Paß gut auf, was ich jetzt tue.«
Selene staunte immer wieder über das Wissen und die Weisheit ihrer Mutter. Mera schien ihr alles zu wissen, was es über Geburt und Leben zu wissen gab. Sie kannte die Kräuter, die bei Frauen, die sich Kinder wünschten, die Fruchtbarkeit erhöhten, sie wußte um die Salben, mit denen die Empfängnis verhütet werden konnte; sie kannte die Mondzyklen und die günstigen Tage für Empfängnis und Geburt; sie wußte, welche Amuletts dem Ungeborenen den besten Schutz gaben; sie verstand sich sogar darauf, bei Frauen, die aus gewissen Gründen kein Kind bekommen durften, Abtreibungen vorzunehmen, ohne ihr Leben oder ihre Gesundheit zu gefährden. Erst an diesem Nachmittag hatte Selene zugesehen, wie Mera einen Bambusspan in den Schoß einer Schwangeren eingeführt hatte, deren Gesundheit so zart war, daß sie eine Geburt nicht überlebt hätte. Der Bambusspan, hatte Mera erklärt, würde, in den Muttermund eingeführt, die Körperflüssigkeit der Schwangeren aufsaugen, sich dabei ausdehnen, so daß der Muttermund sich öffnen mußte.
Die Frau, der Mera und Selene an diesem Abend im letzten Stadium der Wehen beistanden, war eine junge Frau, die im vergangenen Jahr drei Fehlgeburten erlitten hatte und nahe daran gewesen war, alle Hoffnung auf ein Kind aufzugeben. Ihr junger Ehemann, ein Zeltmacher, der unbedingt Söhne wollte, die später einmal das Geschäft weiterführen konnten, war von seinen Brüdern bedrängt worden, eine Scheidung ins Auge zu fassen, damit er sich eine neue Frau nehmen könne.
Darum war die junge Frau im zweiten Monat ihrer Schwangerschaft, voller Angst, auch dieses Kind zu verlieren, zu Mera gekommen. Es war ihre letzte Hoffnung gewesen. Und Mera hatte den Muttermund zugenäht. Dann hatte sie der jungen Frau den ganzen Winter und Frühling hindurch Bettruhe verordnet.
Nun waren die neun Monate um. Die junge Frau lag auf ihrem Bett, und an ihrer Seite kniete besorgt und ängstlich ihr Mann, der Zeltmacher.
»Jetzt müssen wir vorsichtig sein«, sagte Mera leise. »Halt die Lampe ruhig, Tochter. Ich will jetzt den Faden durchschneiden.«
Jedes Wort, das ihre Mutter sagte, jede Bewegung, die sie machte, prägte sich Selene ins Gedächtnis ein. Seit ihrem dritten Lebensjahr, seit sie zwischen dem heilsamen Blatt der Minze und dem tödlichen des Fingerhuts unterscheiden gelernt hatte, arbeitete und lernte Selene an der Seite ihrer Mutter. Auch an diesem Abend hatte sie ihr, sobald sie im Haus des Zeltmachers angekommen waren, bei den Vorbereitungen geholfen. Sie hatte das heilige Feuer der Isis entzündet, die kupfernen Instrumente in seinen Flammen erhitzt, um die bösen Geister der Infektion auszutreiben, hatte zu Hekate gebetet, der Göttin der Geburtshilfe, und sie gebeten, dieser jungen Mutter beizustehen, und hatte schließlich die Laken und Tücher, die das Neugeborene aufnehmen sollten, zurechtgelegt.
Danach hatte sich Mera an die Arbeit gemacht, nachdem sie sich vorher sorgfältig die Hände gewaschen hatte. Ihr scharf geschnittenes Gesicht wirkte wie aus schwarzen und braunen Flächen herausgemeißelt.
Während die junge Frau stöhnend die Hände ihres Mannes umklammerte, führte Mera mit ruhiger Hand eine lange Zange über die Furche des Spekulums und faßte das Ende des Fadens mit den feinen Kupferzähnchen. Dann ergriff sie das lange Messer und wartete ab.
Die Gebärmutter war in lebendiger Bewegung. Bei jeder Kontraktion wurde der Kopf des Ungeborenen an den verschlossenen Muttermund gedrückt. Die junge Frau schrie auf und versuchte, die Hüften zu heben. Mehrmals mußte Selene die Lampe in neue Position bringen; sie hielt das Spekulum ruhig für ihre Mutter. Nur eine dünne Wand aus weichem Fleisch trennte das scharfe Messer vom zarten Köpfchen des ungeborenen Kindes.
»Halt sie fest und ruhig«, befahl Mera dem bleichen Ehemann. »Ich muß jetzt schneiden. Ich kann nicht länger warten.«
Selene klopfte das Herz bis zum Hals. Ganz gleich, wie vielen Geburten sie beiwohnte, nie würde sie sie als etwas Alltägliches ansehen können. Jede Geburt war anders; jede war von ihren eigenen Elementen der Gefahr begleitet, jede war ein neues Wunder. Dieses Kind lief Gefahr, im Mutterschoß zu ersticken, an seinen vergeblichen Anstrengungen, ins Leben hinauszufinden, zu sterben.
Die Stadt außerhalb des Hauses des Zeltmachers lag still in der heißen Sommernacht. Die Bewohner der blühenden Handelsstadt Antiochien schliefen, viele auf den Dächern ihrer Häuser, während Mera, die ägyptische Heilerin, ihre wunderbare Arbeit verrichtete.
Die Augen des jungen Ehemannes waren starr vor Angst. Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Selene lächelte ihm zu, um ihn zu beruhigen, und berührte sachte seinen Arm. Manchmal litten die Männer bei einer Geburt so sehr wie ihre Frauen, erschüttert und hilflos angesichts dieses größten Mysteriums. Selene hatte erlebt, wie Männer am Bett ihrer gebärenden Frau ohnmächtig geworden waren; die meisten zogen es vor, draußen im Freien zu warten, am liebsten in der Gesellschaft von Freunden. Dieser junge Mann war ein guter Ehemann. Unverkennbar geängstigt und von dem Wunsch geplagt, schleunigst das Weite zu suchen, blieb er dennoch bei seiner Frau und bemühte sich, ihr in dieser schweren Stunde beizustehen.
Selene berührte nochmal leicht seinen Arm, um ihn zu trösten. Er sah sie an, schluckte einmal krampfhaft und nickte.
Meras Auge war ruhig. Ihr Rücken war starr, ihre Brust hob und senkte sich kaum unter ihren Atemzügen. Eine falsche Bewegung mit dem Messer jetzt, und alles war verloren.
Plötzlich erschlaffte die Gebärmutter einen Augenblick, und sie sah, wie der Kopf des Ungeborenen zurückwich. Mit einem raschen Schnitt durchtrennte sie den Faden.
Die junge Frau schrie auf. Mera entfernte eilig die Instrumente und machte sich für die Geburt bereit. Selene trat an die Seite des Bettes, kniete nieder und drückte der jungen Frau ein feuchtes Tuch auf die Stirn. Die Wehen kamen jetzt so rasch hintereinander, daß kaum Raum zum Verschnaufen blieb. Selene legte ihre Hände um den Kopf der Frau, schloß die Augen und beschwor die Seelenflamme herauf. Worte des Trostes und der Ermutigung konnte sie nicht bieten: sie war mit der Gabe der leichten, besänftigenden Rede, die anderen Heilerinnen geschenkt war, nicht gesegnet. Aber in ihrem Schweigen sprachen ihre Hände für sie. Ihre langen, kühlen Finger strahlten Ruhe und Kraft aus.
Die junge Frau stieß einen letzten wilden Schrei aus, dann glitt das Kind in Meras wartende Hände, ein gesunder Knabe, der sofort kräftig zu schreien anfing. Alle lachten, am lautesten der erleichterte Ehemann, der selig seine Frau in die Arme schloß.
Zur zweiten Nachtwache endlich kehrten Mera und Selene in ihr eigenes Haus zurück. Während Mera zu einem Schrank ging, um sich etwas zu trinken zu holen, machte sich Selene daran, die Instrumente zu waschen und die Vorräte in Meras Kräutertöpfen aufzufüllen.
Sie war müde, aber erregt, mit ihren Gedanken nicht bei der Arbeit, während sie Mutterkorn und weiße Nieswurz sortierte. Statt dessen weilte sie in Gedanken wieder in der prächtigen Villa in der Oberstadt, wo an diesem Nachmittag Andreas, der Arzt, ein Wunder vollbracht hatte.
Sie sah ihn so klar und deutlich vor sich, als stünde er im Schein der Lampe vor ihr: das lockige dunkelbraune Haar, das ihm weich in die Stirn fiel; die goldene Borte seiner weißen Tunika, unter der die muskulösen Beine hervorsahen; die langgliedrigen Hände. Wieder sah sie in die graublauen Augen, die in so scharfem Gegensatz zum strengen Ausdruck seines Gesichts standen. Und sie fragte sich, was Andreas zugestoßen war, das ihn so hart gemacht hatte.
Selene warf einen Blick auf ihre Mutter, die sich am Schrank zu schaffen machte, und überlegte, ob sie mit ihr über Andreas sprechen konnte. So vieles wollte sie wissen. Neue, unbekannte Gefühle regten sich in ihr, die sie verwirrten. Sie verstand nicht, warum sie sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren konnte. Ganz gleich, wie sehr Selene sich bemüht hatte, all ihr Denken auf ihre jeweilige Aufgabe zu richten, immer hatte das schöne Gesicht des griechischen Arztes sich dazwischengeschoben.
Selene hatte kaum Erfahrung mit Männern. Zwar pflegte sie Mera bei der Behandlung männlicher Patienten zu helfen, doch sonst kam sie nur selten mit Jungen oder Männern in Berührung. Die Jungen aus dem Viertel beachteten Selene nicht. Sie war hübsch, aber ihr Sprachfehler stellte ihre Geduld auf eine zu harte Probe.
Selene sah, wie ihre Mutter sich aus einem Krug etwas in einen Becher goß und trank. Mera weiß alles, dachte Selene. Es gab nichts, was ihre Mutter nicht verstand, nicht erklären konnte. Und doch …
Nie hatte Selene ihre Mutter von Liebe sprechen hören, von Männern oder Heirat. Sie hatte Selene in ihrer Kindheit von ihrem Vater erzählteinem Fischer, der bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen war, ehe sie geboren wurde –, aber darüber hinaus hatte Mera zu diesem Thema nichts zu sagen gehabt. Immer wieder hatten Männer Interesse an Mera gezeigt, waren mit Geschenken für sie ins Haus gekommen, aber Mera hatte sie alle freundlich, doch bestimmt zurückgewiesen.
Selene begann, die gewaschenen Instrumente zu polieren.
Heirat. Ehe. Darüber hatte sie eigentlich nie nachgedacht. Wenn sie sich ihre eigene Zukunft vorstellte, sah sie sich ein Leben führen wie ihre Mutter; ein bescheidenes Leben, allein in einem kleinen Haus, wo sie sich ihrem Kräutergarten und der Behandlung der Kranken und Verletzten widmete.
Während Selene die Instrumente in ein weiches Tuch einwickelte und an ihren Platz legte, fragte sie sich, ob Andreas verheiratet war; ob er allein in dem großen Haus lebte.
Wie geduldig er gewartet hatte, während sie gesprochen hatte. Nicht ein einziges Mal hatte er ihr die Worte aus dem Mund genommen, wie alle anderen das immer taten; nicht ein einziges Mal hatte sie sich von ihm ignoriert gefühlt. Ein schöner Name – Andreas. Am liebsten hätte sie ihn laut ausgesprochen, um ihn auf ihrer Zunge zu fühlen. Selene wußte, wenn sie sich an diesem Abend zu Bett legte, würde sie lange nicht einschlafen, sondern wach liegen und jeden Augenblick dieses Nachmittags noch einmal durchleben.
Im Schatten des Alkovens, wo sie ihre Mahlzeiten bereiteten, beobachtete Mera ihre Tochter, während sie heimlich aus einem Krug trank. Dann wischte sie sich mit dem Handrücken über den Mund, stellte den Krug nieder und schloß die Augen. Sie spürte, wie die starke Medizin in ihre Adern strömte, und konnte sich schon jetzt, ehe es soweit war, die Erleichterung vorstellen, die sie ihr bringen würde. Der Schmerz würde nachlassen; eine weitere Nacht, hoffte Mera, würde sie von ihm befreit sein.
Aber, dachte sie, während sie den Krug wieder an sein Versteck stellte, wie lange noch? Bald würde sie die Dosis erhöhen müssen. Und dann würde sie ihre Krankheit nicht länger vor Selene verheimlichen können.
Der Wind, der draußen durch die vereinsamten Straßen pfiff, erinnerte Mera an jene Nacht vor nahezu sechzehn Jahren, als der Wind ihr die Flüchtlinge unbekannter Herkunft ins Haus geweht hatte. Immer häufiger suchte die Erinnerung an jene Tage sie in letzter Zeit heim, und sie wußte auch, warum: Die Träume waren wiedergekehrt; die grauenvollen Träume, die in den ersten Tagen nach ihrer Flucht aus Palmyra ihren Schlaf gestört hatten – Träume von rotgekleideten Soldaten, die plötzlich in ihr Haus stürmten, Selene packten und sie in die Nacht hinaus schleppten. Manchmal sah Mera in ihren Träumen, wie sie das Kind ermordeten; manchmal wurde es in rabenschwarze Finsternis davongetragen, die es verschlang. Jedesmal war Mera mit rasendem Herzklopfen und schweißnassem Nachtgewand aus dem Schlaf hochgefahren.
Die Träume hatten vor Jahren aufgehört, und sie hatte sie vergessen; aber nun waren sie wieder da, Träume, die so wirklich schienen, daß Mera abends Angst vor dem Einschlafen hatte.
Was hatten sie zu bedeuten? Warum waren sie nach so langer Zeit wiedergekehrt? War der Grund Selenes bevorstehender Geburtstag, der Tag, an dem sie die Schwelle vom Kind zur Frau überschreiten würde? Waren die Träume eine Warnung der Götter? Und wenn ja, wovor sollten sie warnen?
In der Dunkelheit des Alkovens stehend, in Erwartung der lindernden Wirkung der Medizin, dachte Mera über sich und ihr Leben nach.
Sie war, groß und schlank, mit ihren einundfünfzig Jahren noch immer eine schöne Frau, obwohl das Leben sie nicht geschont hatte. Es war hart gewesen, dieses Leben, geprägt von langen Zeiten unsteter Wanderschaft, in denen sie sich immer wieder in neuen Städten hatte zurechtfinden müssen, und die Liebe ihr nur in unpersönlichen Umarmungen mit Männern begegnet war, deren Namen sie vergessen hatte. Nahezu dieses ganze harte Leben lang hatte sie darüber gerätselt, worin ihre Bestimmung lag, und hatte darauf gewartet, daß die Göttin ihr offenbaren würde, warum sie Mera zur Heilerin von Seele und Körper berufen hatte.
Warum war ihr dieses Kind anvertraut worden? War ihr ganzes Leben nur Vorbereitung auf die Betreuung dieses elternlosen kleinen Mädchens gewesen? Selene selbst war von einem Geheimnis umgeben, das die in vieler Hinsicht so weise und kundige Mera nicht zu ergründen vermocht hatte.
Bescheiden war das dem Kind zugedachte Vermächtnis, das Mera aus dem Häuschen in Palmyra mitgenommen hatte: ein Ring, eine Locke vom Haar des ermordeten Römers, ein kleines Stück von dem Leintuch, das den neugeborenen Zwillingsbruder aufgenommen hatte. Zeichen, in denen Selenes Identität eingeschlossen war.
Was diese Zeichen bedeuteten, hatte Mera nie zu entschlüsseln vermocht. Doch sie hatte sie sicher aufbewahrt für den Tag, an dem sie sie Selene übergeben würde; das Mädchen selbst mußte sich dann auf die Suche machen.
In sicherem Gewahrsam in einem kleinen Kästchen lag eine Elfenbeinrose. Mera hatte sie vor Jahren in der Stadt Byblos von einem dankbaren Patienten als Bezahlung erhalten. Sie hatte die Größe einer Pflaume, ein vollkommenes Kunstwerk aus edelstem Elfenbein geschnitzt. Innen war sie hohl, und darin hatte Mera den Ring, die Haarlocke und das Leinenfetzchen verwahrt. Im Lauf der Jahre hatte sie die Elfenbeinrose ab und zu aus dem Kästchen genommen, um sie Selene zu zeigen und sie mit Nachdruck auf ihren unermeßlichen Wert hinzuweisen. Aber als Selene wissen wollte, was denn im Herzen der Rose verborgen sei, hatte Mera ihr geantwortet, das würde sie erst erfahren, wenn sie älter sei, an ihrem sechzehnten Geburtstag, dem Tag, an dem sie sich, wie alle Mädchen, dem Wandlungsritual unterziehen würde, das sie vom Mädchen zur Frau machen würde.
Und was soll ich ihr an diesem Tag sagen? fragte sich Mera, während sie zusah, wie Selene den Medizinkasten an seinen Platz stellte. Ich werde ihr die Wahrheit sagen müssen, daß ich nicht ihre leibliche Mutter bin.
Wieder dachte Mera an jene Nacht vor nunmehr fast sechzehn Jahren. Wieder erinnerte sie sich der überstürzten Flucht aus dem Häuschen, das fünf Jahre lang ihr Heim gewesen war. Sie hatte in rasender Eile ihre Habseligkeiten – die Kräuter und Medizin, die Instrumente und die magischen Schriftrollen – in einen Kasten gepackt und war, mit dem Neugeborenen in einem Korb, den ihr alter Esel trug, nach Norden aufgebrochen. Es war eine lange und beschwerliche Reise gewesen, in Einsamkeit und Furcht. Sie hatte Haken geschlagen, um ihre Spur zu verwischen, für den Fall, daß rotgekleidete Soldaten ihnen folgten, und in Städten und Oasen nur lange genug Halt gemacht, um neue Kraft zu schöpfen, ehe sie weitergezogen war. Sie hatte sich westwärts reisenden Karawanen angeschlossen, das Wasser mit Wüstenbewohnern geteilt, in den Heiligtümern fremder Götter gebetet, bis sie endlich die blühende Stadt Antiochien erreicht hatte, die im grünen Schoß des Orontes-Tals eingebettet lag. Hier endlich hatten ihr die Sterne gesagt, daß ihre Wanderungen zu Ende waren; daß das Kind hier in Sicherheit sein würde.
Und so war es gewesen. Fast sechzehn Jahre lang hatte Selene in Antiochien Sicherheit und Geborgenheit genossen, während sie langsam herangewachsen war, bei Mera gelernt und ihr bis dahin einsames Leben mit warmer Liebe erfüllt hatte.
Nun würde es enden. Die Zeit war knapp, Mera spürte es beklemmend. In zwanzig Tagen sollte die erste Feier stattfinden – der bedeutungsvollste Tag im Leben eines Mädchens, wenn sie die Kinderkleider auszog und dafür die Stola anlegte, das lange Gewand der erwachsenen Frau, und den Hausgöttern eine Locke ihres Mädchenhaars zum Opfer brachte.
In den meisten Fällen endete die Einkleidung mit einem großen Fest, dem Freunde und Verwandte beiwohnten; Selene jedoch würde sich noch einem weiteren Ritual unterziehen müssen. In der ersten Vollmondnacht nach ihrem Geburtstag, in achtundzwanzig Tagen, wie Mera errechnet hatte, würde Selene von ihrer Mutter in die naheliegenden Berge hinaufgeführt werden, um dort in die höheren Mysterien eingeweiht zu werden.
Mera hatte Selene alles gelehrt, was sie von der Heilkunde wußte – uraltes Wissen, das über Generationen von der Mutter an die Tochter weitergegeben worden war. Nun jedoch sollten ihr in einem Ritual, dem Mera selbst sich vor Jahren in der ägyptischen Wüste unterzogen hatte, die höchsten Geheimnisse anvertraut werden. Es genügte nicht, die Kräuter und ihre Anwendung zu kennen; eine weise Frau mußte auch des Geistes der Göttin teilhaftig werden, die allein die Gabe des Heilens bescherte.
Nichts durfte diese Einweihung verhindern. Nicht einmal mein Tod, dachte Mera entschlossen.
Sie schloß die Augen und versuchte, das Bild ihrer Seelenflamme heraufzubeschwören, um die Wirkung des Opiums zu beschleunigen. Aber sie war zu angespannt; ihre Gedanken waren zu fest in der irdischen Ebene verwurzelt. Sie machte sich Sorgen um Selene und ihre Zukunft. Sie wußte, daß ihr der Tod beschieden war; daß sie sehr bald schon sterben würde. Dann würde Selene ganz allein auf der Welt sein. War sie vorbereitet? Wie würde dieses Kind, das noch immer Furcht hatte zu sprechen, überleben?
Selene war mit unbeweglicher Zunge zur Welt gekommen; sie war auf dem Grund ihres Mundes festgewachsen gewesen. Erst als das Kind sieben Jahre alt gewesen war, hatte Mera einen Arzt gefunden, der gut genug ausgebildet war, um die Operation zu wagen und die Zunge freizusetzen. Bis zu jenem Tag hatte Selene überhaupt nicht gesprochen, und selbst nach dem Eingriff hatte sie Mühe gehabt, richtig sprechen zu lernen. Und im Lauf der Jahre, durch den Spott der anderen Kinder und die Ungeduld der Erwachsenen, war der Sprachfehler schlimmer geworden statt besser. Das wenige, was Mera das Kind hatte lehren können, war durch die Außenwelt wieder zunichte gemacht worden. So kam es, daß Selene noch heute, zwanzig Tage vor ihrem sechzehnten Geburtstag und dem Eintritt in die Welt der Erwachsenen, von lähmender Schüchternheit geplagt war.
Heilige Isis, betete Mera, laß mich lange genug am Leben, um die Kraft meines Geistes an Selene weiterzugeben. Gib mir die Zeit, sie in die Welt der Frauen und der Selbständigkeit einzuführen. Und ich bitte dich, heilige Isis, gib, daß meine Tochter rein bleibt bis zum Tag ihrer Einweihung in die Mysterien …
Meras Gesicht verdunkelte sich, als sie sich erinnerte, in welcher Erregung Selene an diesem Nachmittag aus der Oberstadt heimgekehrt war. Der Korb an ihrem Arm war nicht der gewesen, mit dem sie am Morgen das Haus verlassen hatte, und er hatte weit mehr Bilsenkraut enthalten, als sie mit ihrem Geld hätte kaufen können. Selene hatte eine wirre Geschichte von einem Mann erzählt, der von einem Esel getreten worden war, von einem wohlhabenden griechischen Arzt und einer wunderbaren Heilung. Nie zuvor hatte Mera ihre Tochter so aufgeregt erlebt.
»E-er hat d-die In-instrumente zuerst im F-feuer erhitzt«, hatte Selene hervorgestoßen. »Und er h-hat sich zuerst d-die Hände ge-gewaschen.«
»Ja«, hatte Mera geantwortet. »Aber war das Feuer aus einem Tempel? Sonst hilft es nichts. Und hat er kein Räucherwerk verbrannt? Was für Amulette hat er in den Verband eingebunden? Was für Gebete hat er gesprochen? Welche Götter waren im Zimmer?«
Mera war überzeugt davon, daß einer der beste Arzt sein konnte und doch nichts ausrichten würde, wenn er sich nicht der Hilfe der Götter versicherte. Und ein Messer zu gebrauchen! Um ein Geschwür aufzustechen, ja, oder um die Naht um einen Muttermund zu durchtrennen. Aber das Messer in menschliches Fleisch zu senken, war Hochmut, Frevel. Mera vertraute auf Kräuter und Zauber; dem menschlichen Körper mit dem Messer zuleibe rücken, das taten nur Scharlatane und ruhmsüchtige Dummköpfe.
Als Mera aus dem Alkoven trat, um sich zur Ruhe zu legen, sah sie wieder Selenes Gesicht, wie es gewesen war, als sie von dem griechischen Arzt gesprochen hatte. Es hatte einen ganz neuen Ausdruck gezeigt, wie ihn Mera bis dahin nie an ihr gesehen hatte, und bei der Erinnerung daran fühlte Mera von neuem das Drängen der Zeit. Reinen Geistes, reinen Herzens und reinen Körpers mußte Selene zu ihrer Einweihung kommen. Es durfte keine Ablenkung geben, keinen Gedanken an fleischliche Lust. Fasten, Beten und Meditation würden dem Ritual vorausgehen, um das Mädchen in den Zustand kosmischen Bewußtseins zu bringen. Sie würde Selene in diesen letzten achtundzwanzig Tagen sicher behüten müssen.
Mit einem müden Seufzer streckte sich Mera auf ihrer Matte aus. Es war ein langer Tag gewesen. Am Morgen hatte sie den gebrochenen Arm der Frau eines Fischhändlers eingerichtet und geschient; ihr rechter Arm war es gewesen, wie fast immer bei Frauen. Die Frau hatte behauptet, sie hätte ihn sich beim Sturz von der Treppe gebrochen, aber Mera wußte die Wahrheit: Der Arm war gebrochen worden, als sie ihn abwehrend gegen ihren tobenden Ehemann erhoben hatte. Unzählige Male hatte Mera im Lauf der Jahre diese gleiche Verletzung behandelt.
Nachdem sie die Fischhändlersfrau versorgt hatte, hatte sie ein Geschwür aufstechen, ein entzündetes Ohr ausspülen und am Nachmittag eine Abtreibung vornehmen müssen. Das meiste hatte sie ohne die Hilfe ihrer Tochter schaffen müssen, deren weiches Herz sie wieder einmal verleitet hatte, sich um die Mißgeschicke eines Wildfremden zu kümmern.
Selene schien sich verpflichtet zu fühlen, jedem Unglücklichen zu helfen, der ihr über den Weg lief, ganz gleich, wie vergeblich oder sinnlos ihre Bemühungen waren. Als kleines Mädchen hatte sie verletzte Tiere nach Hause gebracht, ihnen kleine Kästen gebaut und sie gesund gepflegt, ehe sie sie wieder freigelassen hatte. Später hatte sie ihre Puppen in kleine Betten gelegt und ihre hölzernen Gliedmaßen mit Verbänden umwickelt. Woher Selene diese Idee hatte, diese Vorstellung von einem Haus, wo Kranke gemeinsam wohnten, wußte Mera nicht.
Mera starrte in die Dunkelheit, und in dieser Dunkelheit sah sie ihre Zukunft – den Tod. Und ich dachte, ich hätte noch Jahre vor mir. Aber das Schicksal befiehlt es anders.
Die Geschwulst an ihrer Seite, die eines Tages plötzlich da gewesen und von da an schnell gewachsen war, hatte Mera das Unabänderliche menschlicher Vergänglichkeit gezeigt. So ruhig wie der Orontes war das Leben dahingeflossen; jetzt aber drängte die Zeit, und die Tage schienen sich zu überschlagen wie das Wasser eines Sturzbachs.
Ich will zum Tempel gehen und das Orakel befragen, dachte sie. Ich muß wissen, was für eine Zukunft die Sterne für Selene bereithalten.
3
Sie saßen in einer Taverne in Antiochiens Vergnügungsviertel, in einer Straße beim Hafen, wo die Prostituierten rote Lampen über ihre Türen hängten, um die ankommenden Seeleute wissen zu lassen, daß ihre Häuser geöffnet waren.
Andreas und Naso, der Schiffskapitän, hatten sich in einer Ecke der Gaststube niedergelassen, abseits der trunkenen Menge, und sahen zwei nackten Tanzmädchen zu, die sich im Rhythmus von Cymbal und Flöte wiegten und drehten. Andreas beobachtete das Schauspiel mit Distanz. Obwohl für ihn als Arzt der nackte Frauenkörper nichts Geheimnisvolles hatte, ließen ihn solche verführerischen Darbietungen im allgemeinen nicht unberührt. Auf seinen Reisen hatte Andreas viele Tänzerinnen gekannt. An diesem Abend jedoch konnte er sich in die fröhliche Ausgelassenheit seiner Umgebung nicht hineinfinden, so sehr er es wünschte. Er konnte sich das Mädchen vom Marktplatz nicht aus dem Kopf schlagen.
Größtenteils drängten sich Seeleute in der Taverne, eine lärmende, trinkfreudige Horde von Matrosen, die entweder von langer Fahrt zurückgekehrt waren oder ein letztes Mal kräftig feierten, ehe sie in See stachen. Aus allen Teilen der Welt kamen sie in die reiche Hafenstadt Antiochien; Männer, die die unglaublichsten Geschichten zu spinnen wußten. Männer mit herzhaften Gelüsten, aber einfachen Bedürfnissen. Es waren Heimatlose, von der Gesellschaft Ausgestoßene, aber gerade unter ihnen fühlte sich der hochkultivierte Andreas sehr zu Hause. Das war der Grund, weshalb er von Zeit zu Zeit die Gesellschaft des knorrigen, von der Sonne geschwärzten Naso suchte, der sich rühmte, die größte Nase in Syrien zu haben. Dreimal in der Vergangenheit hatten Andreas und Naso ihren sonderbaren Vertrag geschlossen, und sie hatten sich an diesem Abend in der Taverne getroffen, um die Bedingungen eines vierten auszuhandeln.
Der Kapitän leerte seinen Krug und winkte der Kellnerin, ihm noch einen zu bringen. Andreas saß, wie Naso bemerkte und wie er es an ihm kannte, immer noch bei seinem ersten Bier, das er kaum angerührt hatte. Trotz ihrer langen Bekanntschaft und der gemeinsam bestandenen Abenteuer, blieb der schweigsame Arzt Naso ein Rätsel.
Er hatte keine Ahnung, was Andreas immer wieder, in beinahe regelmäßigen Abständen, aufs Meer zog. Es war fast, als stünde er unter einem Zwang. Dreimal in den letzten Jahren war Naso Zeuge dieses unerklärlichen Verhaltens gewesen. Der Arzt hatte sein Haus abgeschlossen, seine Patienten fortgeschickt, um auf Nasos Schiff zu fernen Häfen zu segeln. Wenn Andreas an Bord kam, war er stets unzugänglich und verschlossen, und in seinen Augen spiegelte sich ein tiefes, unergründliches Verlangen. Wochenlang pflegte er beinahe reglos an Deck zu stehen, den Blick in die Ferne gerichtet, immer abseits und alleine, nicht einmal die Mahlzeiten mit den Leuten gemeinsam einnehmend. Und immer dann, wenn Naso unruhig zu werden begann und dachte, er wird über Bord springen, trat die Veränderung ein. Andreas wurde plötzlich gesellig, sprach und aß mit den Leuten, und kehrte schließlich wie innerlich gereinigt nach Hause zurück.
Jetzt hatte ihn das Fieber wieder gepackt. Naso sah es ihm an. Er kannte diesen Ausdruck, hatte ihn in Alexandria, in Byblos und in Caeserea gesehen, den Hafenstädten, wo der wandernde Arzt gelebt hatte. Als Naso im vergangenen Jahr gehört hatte, daß Andreas in Antiochien ein Haus gekauft hatte, hatte er Hoffnung für den Freund gesehen. Jetzt wird er ruhiger werden, hatte der Kapitän gedacht. Er wird heiraten und eine Familie gründen. Aber nun, nach nur wenigen Monaten in seinem prächtigen Haus, war Andreas wieder hier, suchte im Hafen nach einem Schiff, das ihn weit fortbringen konnte.
Naso hätte sich nie einfallen lassen, ihn zu fragen, was ihn immer wieder auf die See hinaustrieb. Er kannnte das unter den Ärzten gebräuchliche Wort, ›Heile dich selbst, Arzt‹, aber er hatte den Verdacht, daß die Verwundung mit Salben und Wässerchen nicht zu heilen war.
»Wir segeln bei Tagesanbruch mit der Ebbe«, sagte Naso, nachdem die Bedienerin ihm ein frisches Bier gebracht hatte. Er nahm eine der Würste, die auf einem Teller auf dem Tisch standen, wickelte sie in einen flachen Brotfladen und stopfte sie sich in den Mund. »Diesmal geht’s bis zu den Heraklessäulen und weiter. Paßt dir das, Andreas?«